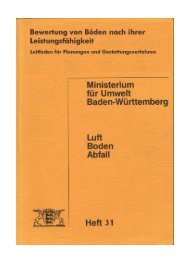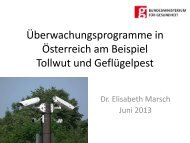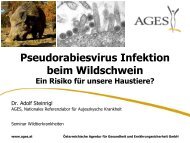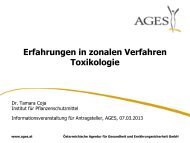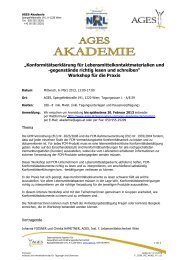Abschlussbericht (pdf) - AGES
Abschlussbericht (pdf) - AGES
Abschlussbericht (pdf) - AGES
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 4 von 45<br />
wiederum von Trüper und de’Clari (1998) aus taxonomischen Gründen zu<br />
Melissococcus plutonius abgeändert.<br />
1.2 Symptome und Krankheitsbild<br />
Ein markantes Indiz für EFB ist ein lückiges Brutnest (siehe Abb. 1). Es entsteht,<br />
wenn die Bienen erkrankte bzw. abgestorbene Larven aus den Zellen entfernen.<br />
Offene Brutzellen beherbergen gelb bis bräunlich verfärbte Maden, die schlaff an der<br />
Zellwand - meist mit dem Rücken zur Zellöffnung - liegen (siehe Abb. 2). Die<br />
Körpersegmentierung ist kaum zu erkennen. Durch die hohe Bakteriendichte im<br />
Darm scheint ein grau-gelber 2-3 mm großer Klumpen durch die Larvenhaut<br />
hindurch. Bereits abgestorbene Larven bilden eine dunkelbraune, meist nicht<br />
fadenziehende, breiartige Masse, die dann zu einem am Zellboden locker sitzenden<br />
Schorf eintrocknet (siehe Abb. 2) (Ritter, 1994).<br />
Die Zelldeckel sind eingefallen und teilweise löchrig. Die in den Zellen enthaltenen<br />
toten Maden und Puppen weisen eine schwarzbraune Verfärbung auf. Sie sind gar<br />
nicht oder leicht fadenziehend. Nach dem Eintrocknen des Schorfs, lässt sich dieser<br />
ebenfalls einfach entfernen (Lehnherr & Duvoisin, 2001). An der Innenseite der<br />
Zelldeckel kann ein schwarzer, lackartiger Überzug zu finden sein (Ritter, 1996).<br />
Projekt: Molekularbiologische Untersuchungen zum möglichen Vorkommen von Melissococcus plutonius (Erreger der<br />
Europäischen Faulbrut) an Bienen in Österreich