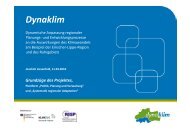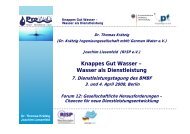BQN Arbeitspapier 12
BQN Arbeitspapier 12
BQN Arbeitspapier 12
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aspekte der ökonomischen und sozialen Entwicklung in der Emscher-Lippe-Region<br />
systeme, S- u. Stadtbahn). (ebd.)<br />
Um die Verbesserung der Umweltsituation herbeizuführen, wurde zunächst die „Politik der hohen<br />
Schornsteine“ (End-of-Pipe-Technologien wie Rauchgasentschwefelung und -entstickung) betrieben,<br />
um später doch auf Vermeidungs- und Einsparungskonzepte umzusteigen. Hier ist tatsächlich<br />
viel Geld durch den sprichwörtlichen Schornstein gegangen. (ebd.)<br />
Bezugnehmend auf die weiter oben genannten Diskussionsgegenstände für mögliche Lösungen für<br />
unsere Region stehen sich dabei zwei politisch-ökonisch Denkansätze (unversöhnlich) gegenüber,<br />
die hier stark vereinfacht als „Neoliberal“ und „Keynes-Massenkaufkraft-Ansatz“ dargestellt werden.<br />
Der Autor wird kurz beide Positionen gröblichst vereinfacht erläutern und aus seiner Sicht auf<br />
ihre jeweiligen theoretischen politisch-ökonomischen Denkfehler von Rechts und Links aufmerksam<br />
machen:<br />
Wenden wir uns zunächst dem etwas komplexeren neoklassisch bis neoliberalen Denkansatz à la<br />
Milton Friedman (Nobelpreis der Ökonomie 1976) zu. Von den Thesen von Friedman abgeleitet wird<br />
heute überwiegend von konservativ-liberaler Seite die Auffassung vertreten, dass der<br />
Staatsinterventionismus nebst der damit verbundenen Subventionsmentalität die Regionalkrise<br />
verursacht bzw. zumindest mit verursacht hat. Ohne Kohlesubventionen und gut ausgestatteter<br />
Sozialpläne wäre die Entwicklung in der Region günstiger verlaufen, da die Marktkräfte stärker ihre<br />
immanenten Ausgleichstendenzen hätten entfalten können. Des Weiteren wären die Löhne gesunken,<br />
daher wäre mehr Kapital von außen angelockt worden. Insgesamt hätte es so mehr<br />
Arbeitsplätze gegeben. Der theoretische Defekt dieser These besteht darin, dass ohne defensive<br />
Maßnahmen die Gefahr einer „kumulativen“ Krisenverschärfung bestanden hätte. (ebd.)<br />
Begründung: Wegen der noch stärkeren ökonomischen Schwächung der Region und der damit verbundenen<br />
höheren Arbeitslosigkeit wäre die Binnennachfrage noch geringer, als es heutzutage der<br />
Fall ist. Eine enorme zusätzliche Beeinträchtigung der Entwicklung eines starken Sektors haushaltsorientierter<br />
Dienstleistungen, des Handwerks und der Bauwirtschaft wäre die Folge gewesen.<br />
L'éclat, c'est moi: Regionalpolitiker und -ökonomen sind sich meist dieses kumulativen handlungsdefizitären<br />
Kriseneffekts nicht bewusst. Ergo: Eine Sanierung nur des metropolitanen Kerns unserer<br />
Innenstädte reicht nicht aus! (ebd.)<br />
Vielleicht sollten sie; wie es der Redakteur Wolfgang Uchatius in einem Artikel ausführt (DIE ZEIT<br />
vom 05.01.06), auf einen ihrer amerikanischen Kollegen hören: den Nobelpreisträger Robert<br />
Solow. Der forderte schon vor fünfzehn Jahren, die Wirtschaftswissenschaftler müssten endlich<br />
ihren Horizont erweitern. Er drückte es so aus: »Arbeiter sind keine Artischocken.« Also: Die deutschen<br />
Ökonomen haben sich verrannt. Der Lohn ist alles andere als ein normaler Preis.<br />
Weiter führt W. Uchatius etwas provokant aus: Arbeiter sind nicht anders als Artischocken. Oder<br />
Autos. Oder Brötchen. Sie sind eine Ware. Auch sie unterliegen den Marktkräften. Auch für sie gilt<br />
das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Jeder Politiker, jeder Gewerkschafter, der sich dieser unangenehmen<br />
Wahrheit verschließt, ist mit schuld am größten Problem der Bundesrepublik<br />
Deutschland: der Arbeitslosigkeit. So oder so ähnlich argumentiert die Mehrzahl der deutschen<br />
Wirtschaftswissenschaftler. Klingt ja auch logisch: Wenn es auf dem Gemüsemarkt zu viele<br />
Artischocken gibt, muss der Preis sinken, dann verschwindet das Überangebot. Wenn auf dem<br />
Arbeitsmarkt ein Überangebot besteht, muss der Lohn sinken. Dann verschwindet die<br />
Arbeitslosigkeit. (ebd.)<br />
9