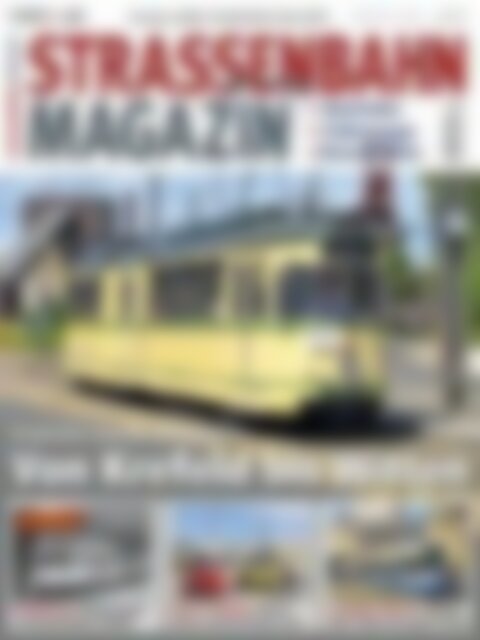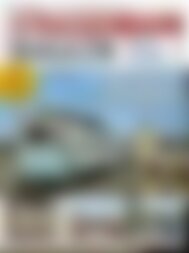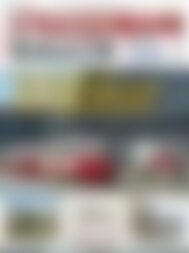STRASSENBAHN MAGAZIN Von Krefeld bis Witten (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Österreich: € 9,50<br />
7/2013 | Juli € 8,50<br />
Schweiz: sFr. 15,90<br />
NL: LUX: € € 9,90<br />
Europas größte Straßenbahn-Zeitschrift<br />
9,90<br />
Betriebe<br />
Fahrzeuge<br />
Geschichte<br />
Tramreise durchs Ruhrgebiet:<br />
<strong>Von</strong> <strong>Krefeld</strong> <strong>bis</strong> <strong>Witten</strong><br />
Bildraritäten aus<br />
drei Jahrzehnten!<br />
Neunkirchen: Erinnerungen<br />
an Deutschlands Steilste<br />
Wiener Klassiker: Wo sie<br />
heute noch im Einsatz sind<br />
»Leipziger Allerlei«: Mit der<br />
Linie 3 durch die ganze Stadt
Die schönsten<br />
Seiten der Bahn<br />
Das<br />
neue Heft<br />
ist da.<br />
Jetzt am<br />
Kiosk!<br />
Online blättern oder Testabo mit Prämie bestellen unter:<br />
www.bahn-extra.de/abo
Einsteigen, bitte …<br />
Stimmen Sie ab<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
mit dieser Ausgabe haben wir bereits die<br />
Mitte des Jahres 2013 erreicht. Jeder Abonnent<br />
verfügt damit schon über insgesamt<br />
sieben exklusive Ansichtskarten mit ganz<br />
besonderen Straßenbahnmotiven; weitere<br />
fünf folgen mit den nächsten Heften dieses<br />
Jahrgangs. Mit dieser Aktion wollen wir<br />
uns ganz besonders für Ihre Lesetreue bedanken.<br />
Übrigens: Wer sich jetzt noch entschließt,<br />
das <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
zu abonnieren, erhält die komplette zwölfteilige<br />
Foto-Edition ebenfalls gratis! Zudem<br />
sparen Sie mit dem Abo gegenüber dem Einzelkauf<br />
im Handel bares Geld und haben es<br />
mindestens zwei Tage vor dem Verkaufsstart<br />
am Kiosk versandkostenfrei im Briefasten.<br />
Lassen Sie sich das nicht entgehen!<br />
Viele von Ihnen werden nun bald in den<br />
Sommerurlaub starten – womöglich besuchen<br />
Sie dabei auch Ihnen <strong>bis</strong>her unbekannte<br />
Stadt- und Straßenbahnbetriebe?<br />
Verschiedene Beiträge dieses Heftes sollen<br />
Entspricht die <strong>bis</strong>herige Schwerpunktsetzung<br />
im <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> Ihren Interessen?<br />
• Ja, es ist mir sehr wichtig, in jeder Ausgabe viele Berichte aus dem<br />
deutschsprachigen Raum und aus meinem Umfeld zu finden<br />
• Nein, die Berichterstattung mit dem Schwerpunkt auf Deutschland,<br />
Österreich und die Schweiz sollte zugunsten von mehr Berichten aus<br />
anderen Ländern gekürzt werden<br />
• Die Schwerpunktsetzung ist gut – aber die Beiträge sind mir oft zu<br />
kurz. Lieber weniger Themen imHeft, diese aber ausführlicher<br />
Stimmen Sie online ab: www.strassenbahn-magazin.de<br />
Ihnen Lust auf genau solche Entdeckungstouren<br />
machen. Wir laden Sie herzlich ein,<br />
z. B. mit der Straßenbahn mehr als 100 Kilometer<br />
durch das Ruhrgebiet zurückzulegen.<br />
Oder lassen Sie sich von der „Goldenen<br />
Stadt“ am Moldauufer verzaubern.<br />
Auf den Seiten 42/43 erfahren Sie alle<br />
Neuigkeiten über den Betrieb in Prag.<br />
Die Stadt Kaschau in der benachbarten<br />
Slowakei trägt im Jahr 2013 den Titel<br />
„Kulturhauptstadt Europas“. Lernen Sie<br />
nach einem Bummel durch die Innenstadt<br />
doch einmal den dortigen Straßenbahnund<br />
Obus-Verkehr kennen!<br />
Doch auch in den östlichen Bundesländern<br />
einschließlich meiner sächsischen<br />
Heimat warten zahlreiche Städte auf Sie.<br />
Wir stellen Ihnen sieben Betriebe vor, in denen<br />
noch Tatrawagen zum Einsatz kommen.<br />
Wolfgang Kaiser berichtet über die<br />
von Wien ins Ausland gelangten Wagen.<br />
Und die Rubrik „Geschichte“ führt Sie<br />
dieses Mal ins Saarland sowie nach München<br />
und Basel.<br />
In Verbindung mit den Meldungen im<br />
Journal erhalten Sie damit einen breiten<br />
Themenmix aus allen Teilen Deutschlands,<br />
aber auch aus Österreich und der Schweiz.<br />
Doch wie wichtig ist es Ihnen,<br />
im <strong>STRASSENBAHN</strong><br />
<strong>MAGAZIN</strong> vorwiegend über<br />
Ihre Heimatregion zu lesen?<br />
Wie groß ist Ihr Interesse an<br />
Betrieben im nichtdeutschsprachigen<br />
Raum? Helfen Sie<br />
mir bitte mit Ihrer Meinung,<br />
unsere Zeitschrift für Sie noch<br />
attraktiver zu machen!<br />
Mit 12 attraktiven<br />
und exklusiven<br />
Straßenbahn-<br />
Ansichtskarten<br />
bedanken wir uns<br />
im Jahr 2013 für<br />
Ihre Lesetreue.<br />
Und wenn Sie jetzt<br />
Abonnent werden,<br />
erhalten Sie das<br />
komplette Set<br />
ebenfalls gratis!<br />
André<br />
Marks<br />
Verantwortlicher<br />
Redakteur<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
3
Inhalt<br />
Inhalt<br />
TITEL<br />
»Tour de Ruhr« von <strong>Krefeld</strong> nach <strong>Witten</strong>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
Betriebe<br />
Kulturhauptstadt mit Tram und Trolley . . . . 16<br />
Reisetipp 2013: Kosice – Das slowakische Kaschau präsentiert sich<br />
neben Marseille als Kulturhauptstadt Europas 2013. Die im Schnittpunkt<br />
zwischen Polen, Ungarn und der Ukraine gelegene zweitgrößte Stadt der<br />
Slowakischen Republik lädt aus diesem Grund zu einem Besuch ein<br />
TITEL<br />
»Tour de Ruhr« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
Per Stadt- und Straßenbahn durch das Ruhrgebiet – Auf der Fahrt<br />
von St. Tönis nach <strong>Witten</strong> erlebt man fünf Betriebe, zwei Spurweiten sowie<br />
eine große Fahrzeugtypenvielfalt, außerdem viel Revieratmosphäre – von<br />
Zechenanlagen und „Ruhrbarock“ <strong>bis</strong> hin zu hypermodernen Zweckbauten<br />
Vom Burgring ins Depot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
Historisches Straßenbahndepot St. Peter in Nürnberg wieder<br />
geöffnet – In der Frankenmetropole können seit Anfang Mai 2013 wieder<br />
die musealen Straßenbahnwagen besichtigt werden. Außerdem nimmt die<br />
Burgringlinie 15 ihren Weg nun wieder über die Pirckheimerstraße<br />
TITEL<br />
Im Leoliner nach Knautkleeberg . . . . . . . . . . . 32<br />
Leipzigs Linie 3 im Porträt – Mit der Netzreform 2001 entstand in der<br />
Messestadt eine neue Linie 3. <strong>Von</strong> der nordöstlich Leipzigs gelegenen<br />
Kleinstadt Taucha führt sie zum Leipziger Hauptbahnhof und von dort weiter<br />
nach Südenwesten – westlich der neu entstandenen Seenlandschaft<br />
Per Bergbahn nach Taläcker . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />
Die Künzelsauer Bergbahn – Seit Oktober 1999 verbindet eine neu<br />
gebaute Bergbahn als innerstäd tisches Verkehrsmittel den Ortskern von<br />
Künzelsau mit dem Neubaugebiet Taläcker. Seit mehreren Jahren ist aber<br />
auch ein Anschluss an das Karlsruher Stadtbahnnetz geplant<br />
Neue Linien an der Moldau. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42<br />
Liniennetzoptimierung in Prag – Im Jahr 2008 begann in der „Goldenen<br />
Stadt“ die Neuausrichtung des Tramliniennetzes an die aktuellen<br />
Verkehrsbedürfnisse. Seit Herbst 2012 ist in einer weiteren Stufe der Linienreform<br />
ein Kernnetz aus fünf Basis- und 16 Ergänzungslinien in Betrieb<br />
RUBRIKEN<br />
»Einsteigen, bitte ...« . . . . . . 3<br />
Bild des Monats . . . . . . . . . . 6<br />
Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
Nächster Halt . . . . . . . . . . . . 29<br />
Einst & Jetzt . . . . . . . . . . . . . 56<br />
Fundstück des Monats . . . . . 73<br />
»Forum«, Impressum . . . . . . 78<br />
<strong>Vorschau</strong> . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />
»Ende gut ...« . . . . . . . . . . . 82<br />
Das besondere Bild. . . . . . . . 83<br />
4 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
Neues Tramliniennetz in Prag 42<br />
Erinnerungen an die Straßenbahn Neunkirchen 58<br />
Die letzten Tatra-Wagen in Deutschland 44<br />
Münchens Tram in den 1980er-Jahren 68<br />
Fahrzeuge<br />
Abschied auf Raten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />
Die letzten Tatras in Deutschland (Teil 2) – In Rostock und Strausberg<br />
neigen sich die Tatra-Einsätze dem Ende entgegen – Zwickau setzt<br />
hingegen langfristig auch auf seine modernisierten KT4D. Seit dem Jahr<br />
2000 unterlag der Bestand an Tatras in den östlichen Bundesländern ganz<br />
unterschiedlichen Entwicklungen – ein Überblick<br />
TITEL<br />
<strong>Von</strong> Wien in die Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />
Wiener Exportwagen, Teil 1 – Seit 1997 eroberten zahlreiche rotweiße<br />
Straßenbahnen aus der Donaumetropole mehr als ein halbes<br />
Dutzend Städte Europas. Bis Ende 2012 gelangten 365 Trieb- und Bei -<br />
wagen der Wiener Linien nach Bosnien, Ungarn, Polen, Rumänien und in<br />
die Niederlande<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> im Modell<br />
Modellstadt Chemnitz . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />
Kleine Bahn ganz groß: Es ist die weltgrößte Ausstellung nur<br />
für Modellstraßenbahnen. Zum bereits zehnten Mal präsentierten<br />
sich Hobbyfreunde Ende Mai 2013 einem breiten Publikum<br />
Geschichte<br />
Deutschlands Steilste!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />
Die Neunkircher Straßenbahn – <strong>Von</strong> 1907 <strong>bis</strong> 1978 fuhr in Neunkirchen<br />
(Saar) eine regelspurige Straßenbahn. Ihr knapp 300 m langer Abschnitt<br />
mit 11,07 Prozent Steigung war nur eine von vielen Besonderheiten<br />
Den Rheinsprung neu entdeckt. . . . . . . . . . . . . 66<br />
Seitenblicke auf die Basler Tram im Jahr 1980 – Einen unvergleichbaren<br />
Blick aus dem Gestern auf die pulsie rende Gegenwart in Basel bietet<br />
die schmale Gasse Rheinsprung am Münsterberg seit mehr als 100 Jahren<br />
Als die Vernunft nicht zählte ... . . . . . . . . . . . . . 68<br />
Hintergründe zur Einstellungswelle in München vor 30 Jahren –<br />
1983 wurde ein Teil des Anfang der 1980er-Jahre aufgestellten „ÖPNV-<br />
Konzepts 2000“ des Münchner Verkehrsverbundes MVV umgesetzt. Damit<br />
ignorierten die Verkehrsbetriebe die Stimmung der Bevölkerung!<br />
Titelmotiv<br />
TITEL<br />
Essens historischer Gelenkwagen 705<br />
an der Haltestelle Kapitelwiese. Diese<br />
Etappe auf der mehr als 100 km langen<br />
Straßenbahnfahrt durchs Ruhrgebiet<br />
kann man an einigen Samstagen planmäßig<br />
in Museumsfahrzeugen zurücklegen<br />
MICHAEL BEITELSMANN<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
5
Bild des Monats<br />
Bild des Monats<br />
In der portugiesischen Stadt Porto überquert die Stadtbahnlinie D<br />
von Hospital Sao Joao nach Santo Ovidio die „Ponte Dom Luis I.“<br />
über den Fluss Douro. Die zwischen 1881 und 1886 nach Plänen<br />
des in Berlin geborenen Ingenieurs Théophile Seyrig gebaute Bogenbrücke<br />
hat eine Länge von 385,25 Metern und verbindet Porto mit<br />
der Nachbarstadt Vila Nova de Gaia. Christian Sacher hielt das imposante<br />
Bauwerk am 4. Mai dieses Jahres im Bild fest. Zum Gebiet<br />
der historischen Altstadt Portos gehörend, zählt es seit 1996 zum<br />
UNESCO-Weltkulturerbe.<br />
6<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Bild des Monats<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 6 | 2013<br />
7
Meldungen aus Deutschland,<br />
aus der Industrie und aus aller Welt<br />
Frankfurt am Main: Auf der Linie 18 zum Gravensteiner Platz fahren erstmals Pt-Wagen im Linienverkehr. Als diese<br />
Strecke Ende 2011 eröffnet wurde, hatte sich dieser Fahrzeugtyp längst aus dem Straßenbahnverkehr verabschiedet<br />
ONLINE-UMFRAGE<br />
100 Prozent Niederflur<br />
ohne Stufen kein Muss!<br />
Im letzen Heft fragten wir, auf welche<br />
Akzeptanz Straßenbahnwagen mit<br />
unterschiedlichen Fußbodenhöhen stoßen.<br />
Die absolute Mehrheit der an der<br />
Umfrage teilnehmenden Leser – 62 Prozent<br />
– gab zur Antwort, dass in Straßenbahnwagen<br />
vorhandene Stufen in<br />
ihrem Beisein <strong>bis</strong>her noch nie jemand<br />
zum Ärgernis geworden sind. Nur<br />
knapp zehn Prozent der Umfrageteilnehmer<br />
sind gegenteiliger Meinung.<br />
Sie haben schon mehrmals Fahrgäste<br />
schimpfen gehört bzw. deren Unmut<br />
wahrgenommen. Zu 100-prozentigen<br />
Niederflurwagen gebe es also keine Alternative.<br />
Für 28 Prozent der befragten<br />
Leser steht eine technisch einwandfreie<br />
Funktion der Straßenbahnwagen im<br />
Vordergrund. Für sie geht die Rücksichtnahme<br />
auf die Bedürfnisse einiger<br />
weniger Fahrgäste zu weit! SM<br />
Frankfurt am Main: Drei Ptb- zu Pt-Wagen rückgebaut, U5 steht vor Ausbau und Verlängerung<br />
Comeback für die P-Wagen, Durchbruch für die U5<br />
Auf dem kompletten oberirdischen Abschnitt der U5 (im Bild: Haltestelle<br />
Musterschule) fehlen noch Hochbahnsteige, weshalb hier die Ptb-Tw noch<br />
unverzichtbar sind<br />
P. KRAMMER, S. KYRIELEIS (BILD OBEN)<br />
Der Linienverkehr mit klassischen<br />
Düwag-Bahnen aus dem Museumsbestand<br />
hat seit Anfang Mai ein Ende.<br />
Seitdem übernehmen drei Pt-Wagen<br />
der Baujahre 1977-78 ihre Arbeit. Der<br />
Wechsel dient nicht nur der Schonung<br />
der Museumswagen, sondern erleichtert<br />
auch die Personalplanung. Im Gegensatz<br />
zu den Oldies mit mechanischem<br />
Schaltwerk können die Pt-Tw<br />
mit elektrischer Steuerung von allen<br />
Fahrern bedient werden. Nachdem im<br />
Juni 2012 die letzten 2,35 m breiten<br />
Pt-Wagen ins türkische Gaziantep verkauft<br />
wurden, entstanden die jetzt eingesetzten<br />
Pt-Wagen durch Rückbau<br />
von auf 2,65 m verbreiterten Ptb-Wagen.<br />
Neue Stadtbahnwagen des Typs<br />
U5 auf der Linie U6 hatten sie dort<br />
entbehrlich gemacht. In der Stadtbahnzentralwerkstatt<br />
demontierte<br />
man dazu im April bei den Wagen 728,<br />
738 und 748 die Vorbauten an den Türen<br />
und setzte die die Trittstufe zurück.<br />
Zudem erhielten die Wagen wieder ihre<br />
seitlich angebrachten Linientafeln.<br />
Einer der jetzt umgebauten Wagen soll<br />
später als Museumswagen in den Anlieferungszustand<br />
zurückversetzt werden,<br />
nachdem der ursprünglich dafür<br />
vorgesehene Wagen 190 (ex 690)<br />
ebenfalls nach Gaziantep ging. Die Pt-<br />
Wagen kommen auf den Linien 12 und<br />
18 zum Einsatz. Wegen ihres steileren<br />
Einstiegs wird das Comeback der mit<br />
Klapptrittstufen ausgestatteten Pt-Wagen<br />
nicht von allen Fahrgästen begrüßt.<br />
Kurse, auf denen ggf. Hochflurwagen<br />
verkehren, sind daher auf den<br />
Aushangfahrplänen gekennzeichnet.<br />
8 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Deutschland<br />
Ab 2019 soll die verlängerte U5 das neue Europaviertel der Bankenmetropole am Main erschließen, wobei die<br />
Strecke teils oberirdisch (rot) und teils unterirdisch (blau) verlaufen wird<br />
S. KYRIELEIS<br />
Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt<br />
(VGF) hofft auf eine Entspannung der<br />
Fahrzeugsituation, wenn in der zweiten<br />
Jahreshälfte zehn neue Straßenbahnen<br />
des Typs S ankommen. Aus<br />
wirtschaftlichen Gründen wird die<br />
Fahrzeugreserve aber auch künftig<br />
knapp bleiben. Der jetzige Engpass<br />
war wegen eines Auffahrunfalls im<br />
März aufgetreten (siehe SM 5/2013).<br />
Ausbau der U5 beginnt<br />
Während sich die Straßenbahnfahrgäste<br />
vorübergehend an den hohen<br />
Einstieg gewöhnen müssen, ist er bei<br />
der Stadtbahnlinie U5 (Hauptbahnhof<br />
– Preungesheim) immer noch Alltag.<br />
Dort wird zwischen den Stationen<br />
Musterschule und Preungesheim<br />
(zwölf Stationen) oberirdisch von<br />
niedrigen Bahnsteigen oder direkt von<br />
der Straße eingestiegen. Im Sommer<br />
beginnen die Bauarbeiten für die Ausrüstung<br />
der Strecke mit Hochbahnsteigen.<br />
Alle umzubauenden Stationen erhalten<br />
80 cm hohe Bahnsteige mit<br />
einer für Drei-Wagenzüge ausreichenden<br />
Länge, ampelgesicherte Überwege,<br />
Rampen und taktile Leitelemente<br />
für Sehbehinderte. Eine besondere Gestaltung<br />
bekommen die Stationen<br />
Musterschule und Glauburgstraße, deren<br />
Umbau erst 2014 beginnen soll.<br />
Um die Bahnsteige im Straßenraum<br />
nicht so wuchtig wirken zu lassen, ist<br />
nur das mittlere Drittel 80 cm hoch.<br />
Der restliche Bahnsteig ist 20 cm niedriger.<br />
Bodenmarkierungen und Hinweistafeln<br />
an allen Stationen der Linie<br />
U5 sollen mobilitätsbehinderten Fahrgästen<br />
den Weg in den richtigen Zugteil,<br />
der am erhöhten Abschnitt hält,<br />
weisen. Die Kosten für den Umbau der<br />
Woltersdorf: Der<br />
jüngst restaurierte<br />
Triebwagen<br />
218, hier in<br />
der Ausweiche<br />
am Thälmannplatz,<br />
wurde<br />
zum 100. Jubiläum<br />
der Woltersdorfer<br />
Straßenbahn<br />
präsentiert<br />
B. KUSSMAGK<br />
Stationen belaufen sich auf rund 24,6<br />
Mio. Euro. Unklar ist noch, ob die derzeitige<br />
Endstation Preungesheim nur<br />
provisorisch umgebaut wird. <strong>Von</strong> hier<br />
ist der Weiterbau der Strecke zum<br />
Frankfurter Berg geplant, der aber aus<br />
Gründen der Haushaltskonsolidierung<br />
abermals verschoben wurde. Erst<br />
wenn alle Stationen der U5 mit Hochbahnsteigen<br />
ausgestatten sind, können<br />
auf dieser Linie die Ptb-Wagen<br />
von neuen U5-Tw, die keine Klapptrittstufen<br />
haben, abgelöst werden.<br />
Weiterbau ins Europaviertel<br />
Am anderen Ende der U5 wird die Verlängerung<br />
der Linie vom Hauptbahnhof<br />
ins Europaviertel, einem Wohnund<br />
Gewerbegebiet auf dem Gelände<br />
des ehemaligen Güterbahnhofs, vorangetrieben.<br />
Im Mai beschloss der<br />
Frankfurter Magistrat dazu eine Bauund<br />
Finanzierungsvorlage. Aus Kostengründen<br />
wird die 2,7 km langen Strecke,<br />
die <strong>bis</strong> 2019 realisiert werden soll,<br />
entgegen ursprünglicher Planungen<br />
zur Hälfte oberirdisch verlaufen. Die<br />
geplante Strecke zweigt in Höhe des<br />
Platzes der Republik von der bestehenden<br />
U-Bahnstrecke zur Messe ab<br />
und bleibt einschließlich der neuen<br />
Station Güterplatz im Tunnel. Östlich<br />
der Emser Brücke kommt sie dann<br />
über eine Rampe an die Oberfläche<br />
und verläuft im Zuge der Europa-Allee<br />
mit den Stationen Emser Brücke und<br />
Europagarten. Dann unterquert die<br />
Stadtbahn zusammen mit dem Autoverkehr<br />
den Europagarten, eine Parkanlage,<br />
und endet an der Haltestelle<br />
Wohnpark. Da das Europaviertel sich<br />
noch im Bau befindet, lassen sich die<br />
oberirdischen Abschnitte mit Rasengleis<br />
und flankiert von Bäumen gut in<br />
den breiten Boulevard der Europa-Allee<br />
integrieren. Für den Bau der Strecke<br />
wird mit Kosten von 217,3 Mio.<br />
Euro gerechnet, wobei die Stadt mit<br />
einer Finanzierung von 143,6 Mio.<br />
durch Fördermittel und die Stellplatzablöse<br />
rechnet.<br />
SKY<br />
Woltersdorf<br />
100 Jahre Straßenbahn<br />
Der kleine Straßenbahnbetrieb östlich<br />
von Berlin feierte sein Jubiläum<br />
vom 17. <strong>bis</strong> zum 19. Mai mit einem<br />
großen Fest. Einer der Höhepunkte war<br />
der Einsatz historischer Fahrzeuge im<br />
Zehn-Minutentakt am 18. und am 19.<br />
Mai. An diesen Tagen kamen neben<br />
zwei Gothawagen auch Tw 2 (Zweiachser<br />
mit geschlossenen Plattformen,<br />
Baujahr 1913), Tw 7 (KSW-Zweiachser<br />
mit geschlossenen Plattformen, Baujahr<br />
1943), Tw 218 (Maximum-Vierachser<br />
mit offenen Plattformen aus<br />
Berlin, Baujahr 1913) und Tw 2990<br />
(Maximum-Vierachser mit offenen<br />
Plattformen aus Berlin, Baujahr 1910)<br />
zum Einsatz. Den besonderen Blickfang<br />
bildete Tw 218, der nach viereinhalb<br />
Jahren Restaurierungszeit erstmalig<br />
im öffentlichen Einsatz war. BEKUS<br />
Dortmund<br />
Neuerungen im<br />
Hochflur-Wagenpark<br />
Die DSW21 will in den nächsten<br />
Jahren für insgesamt 270 Mio. Euro<br />
ihre Hochflur-Stadtbahnflotte erneuern.<br />
Dabei sollen die zehn 2003 <strong>bis</strong><br />
2004 aus Bonn übernommenen Wagen<br />
aus den 1970er-Jahren komplett durch<br />
Augsburg<br />
Die Stadtwerke Augsburg<br />
(SWA) haben die drei M8C-Wagen<br />
mit den Nummern 8003,<br />
8010 und 8012 nach Polen verkauft.<br />
Nach einer Aufarbeitung<br />
durch die Firma Modetrans aus<br />
Posen sollen sie bei der Straßenbahn<br />
im nordpolnischen Elblag<br />
eine neue Heimat finden. Die<br />
ersten beiden Wagen wurden in<br />
der Kalenderwoche 20, der dritte<br />
in der Kalenderwoche 21 per<br />
LKW abtransportiert. Damit verbleiben<br />
sieben M8C in Augsburg,<br />
die mit dem Ende des<br />
Umleitungsnetzes ab Dezember<br />
2013 auch wieder regulär eingesetzt<br />
werden sollen. PKR<br />
Braunschweig<br />
Am 21. Mai hat die Braunschweiger<br />
Verkehrs-AG beim<br />
polnischen Bus- und Straßenbahnhersteller<br />
Solaris die Option<br />
für die Bestellung von drei<br />
weiteren Straßenbahnen vom<br />
Typ Tramino eingelöst. Der ursprüngliche<br />
Auftrag vom Mai<br />
2012 beinhaltete 15 Straßenbahnen,<br />
sodass Braunschweig<br />
nun insgesamt 18 dieser vierteiligen<br />
und 36 m langen Straßenbahnen<br />
erwartet. Während die<br />
ursprünglich bestellten Traminos<br />
von Mai <strong>bis</strong> Dezember 2014 geliefert<br />
werden sollen, wird für<br />
die drei Nachzügler der Mai<br />
2015 als spätester Anliefertermin<br />
genannt.<br />
SM<br />
München<br />
Einen Tag bevor diese am<br />
31. Mai ausgelaufen wäre, hat<br />
die Technische Aufsichtsbehörde<br />
die vorläufige Einsatzzulassung<br />
für die Variobahnen noch einmal<br />
<strong>bis</strong> zum 30. September 2013 verlängert.<br />
Für eine endgültige Zulassung<br />
der in der Kritik stehenden<br />
Niederflurfahrzeuge muss<br />
erst noch der Abschlussbericht<br />
über neue Gummielemente der<br />
Radreifen ausgewertet werden,<br />
der seit Mitte Mai vorliegt. Nach<br />
wie vor dürfen die Variobahnen<br />
in München nur auf den Linien<br />
19 und 20/21/22 fahren, wobei<br />
der Einsatz derzeit ausschließlich<br />
auf der Linie 19 erfolgt. SM<br />
rz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
9
Aktuell<br />
Herne: Die Haltestelle Am Buschmannshof erhielt im Rahmen des barrierefreien Ausbaus sowie der Umgestaltung<br />
des namensgebenden Platzes ein markantes Dach<br />
C. LÜCKER<br />
Herne<br />
Neues Dach in Wanne-Eickel<br />
20 Neubauten ersetzt werden. Die<br />
höhere Zahl ist wegen des höheren<br />
Bedarfs durch neue Angebote und höhere<br />
Fahrgastzahlen notwendig. Für<br />
die neuen Wagen wird ein Stückpreis<br />
zwischen 2,5 und 3,5 Mio. Euro kalkuliert.<br />
Geplant ist die Ausschreibung der<br />
neuen Wagen für 2014 mit einer Lieferung<br />
drei Jahre später. Anschließend<br />
sollen die jüngeren Wagen des Typs<br />
B80 kernsaniert und so für weitere 15<br />
Jahre Einsatz ertüchtigt werden. MKO<br />
Karlsruhe<br />
Streckensperrung für<br />
die „Kombilösung“<br />
Der Bau der unterirdischen Straßenbahnstrecke<br />
in der Kaiserstraße als Teil<br />
der Kombilösung hat abschnittsweise<br />
eine Verspätung von rund eineinhalb<br />
Jahren. Um die Bauarbeiten zu straffen,<br />
wurden auf der Westseite des Kronenplatzes<br />
zwei Baufelder vereinigt<br />
und gleichzeitig auf der Ostseite des<br />
Marktplatzes mit dem größten Teil des<br />
unterirdischen Gleisdreieckbauwerks<br />
begonnen, was zu einer siebenmonatigen<br />
Sperrung des Kaiserstraßenabschnitts<br />
Marktplatz – Kronenplatz<br />
führte. Ursprünglich sollte die Kaiserstraße,<br />
ausgenommen einzelner (verlängerter)<br />
Wochenenden, während des<br />
Tunnelbaus durchgängig befahrbar<br />
bleiben. Für den Zeitraum vom 29.<br />
April <strong>bis</strong> November müssen die Bahnen<br />
zwischen Marktplatz und Kronenplatz<br />
über die Baumeisterstraße fahren.<br />
Um die Knotenpunkte nicht zu<br />
überlasten, wurden die Linien 2, 5 und<br />
6 im Osten eingestellt. Nach Wolfartsweier<br />
(Linie 2) wurde als Ausgleich die<br />
Linie 8 als Zubringer zur Linie 1 verstärkt,<br />
nach Rintheim (Linie 5) fahren<br />
Ersatzbusse und die östliche Linie 6<br />
wird durch die Führung der Linien S2<br />
und S5 über die Südostbahn ersetzt.<br />
Karlsruhe: Wegen<br />
der Bauarbeiten<br />
für die<br />
Kombilösung<br />
müssen am<br />
Marktplatz alle<br />
von Westen<br />
kommenden<br />
Bahnen Richtung<br />
Ettlinger<br />
Tor abbiegen<br />
W. VÖGELE<br />
Die modernisierte Haltestelle Am Buschmannshof, direkt<br />
im Zentrum des Stadtteils Wanne bzw. der <strong>bis</strong> 1975<br />
eigenständigen Stadt Wanne-Eickel gelegen, ging Anfang<br />
April in Betrieb. Neben der Straßenbahnlinie 306 der<br />
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Bogestra)<br />
halten hier 13 Buslinien. Besonders auffällig ist das rund<br />
80 m lange Glasdach, das die komplette Haltestellenanlage<br />
überspannt. Insgesamt hat der Umbau rund 2,5 Mio.<br />
Euro gekostet. Am Buschmannshof war die letzte Haltestelle<br />
entlang der Linie 306 (Bochum Hbf – Wanne-Eickel<br />
Hbf), die noch nicht niederflurgerecht ausgebaut war.<br />
Da auf der 306 nur noch im äußersten Notfall hochflurige<br />
M-Wagen verkehren, ist diese Linie damit in der Regel<br />
komplett barrierefrei.<br />
CLÜ<br />
Erstmals wurde auch eine Prognose für<br />
die Endabrechnung mit 789 Mio. Euro<br />
statt der derzeit gül tigen Veranschlagung<br />
von 648 Mio. Euro aus dem Jahre<br />
2012 vorgestellt. WV<br />
Berliner S-Bahn<br />
Betriebskonzept<br />
für die »S21«<br />
Für die „S21“ genannte Verbindung<br />
des Hauptbahnhofs mit den Nord-Südsowie<br />
den Ring-S-Bahn-Strecken zeichnet<br />
sich ein Linienkonzept ab. Wenn<br />
2017 der erste Teilabschnitt vom Nordring<br />
(mit Verbindungen von den Stationen<br />
Wedding und Westhafen) zum<br />
Hauptbahnhof eröffnet wird, soll die<br />
Strecke von drei Linien befahren werden:<br />
Die Anbindung des Hauptbahnhofs<br />
von Norden soll durch eine neue<br />
S-Bahn-Linie S15 (Waidmannslust-<br />
Hauptbahnhof) erfolgen, vom Ostring<br />
soll die S85 von Grünau kommend<br />
künftig ab Schönhauser Allee zum<br />
Hauptbahnhof statt nach Waidmannslust<br />
fahren und vom Westring soll die<br />
Anbindung durch eine Verlängerung<br />
der von Königs Wusterhausen kommenden<br />
Linie S46 über Westend hinaus<br />
zum Hauptbahnhof erfolgen. Für<br />
die unterirdische Fort führung der S21-<br />
Strecke vom Hauptbahnhof zum Potsdamer<br />
Platz, wo wiederum Anschluss<br />
an die Nord-Süd-S-Bahnen besteht,<br />
soll nun das Planfeststellungsverfahren<br />
eingeleitet werden. Ein Baubeginn<br />
wird für 2019 angepeilt. Nach der Inbetriebnahme<br />
des zweiten Teilabschnitts<br />
zum Potsdamer Platz soll die<br />
S1 (Oranienburg-Wannsee) zur Hauptlinie<br />
auf der neuen Strecke werden,<br />
wofür sie zwischen Gesundbrunnen<br />
und Potsdamer Platz vom Nord-Süd-<br />
Tunnel in den künftigen S21-Tunnel<br />
verlegt werden soll.<br />
PKR<br />
Düsseldorf<br />
Geänderte Umleitungen<br />
am Jan-Wellem-Platz<br />
Seit Juni ist ein Teil der Umleitungen,<br />
die aufgrund der städtebaulichen<br />
Umgestaltung am Jan-Wellem-Platz<br />
ab März wirksam wurden, wieder aufgehoben.<br />
Die Linien 701, 706 und 715<br />
können wieder von Norden (Venloer<br />
Straße) kommend den Jan-Wellem-<br />
Platz erreichen, müssen aber gen Süden<br />
weiterhin den Umweg über die<br />
10<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Deutschland<br />
Altstadt nehmen. In Fahrtrichtung<br />
Norden wird der Abschnitt Berliner Allee<br />
– Venloer Straße bzw. Marienhospital<br />
dagegen weiter <strong>bis</strong> zum Jahr<br />
2015 gesperrt bleiben, womit die Bahnen<br />
in dieser Relation weiterhin eine<br />
Umleitung über die Schadowstraße<br />
fahren müssen. Der Grund sind Bauarbeiten<br />
für neue Straßentunnel in Höhe<br />
des Hofgartens.<br />
MBE<br />
Hamburger U-Bahn<br />
Entwurf für künftige<br />
U4-Endstelle<br />
Nachdem der Weiterbau der Linie<br />
U4 an die Elbe beschlossen wurde,<br />
stellte die Hochbahn den Siegerentwurf<br />
der neuen Haltestelle Elbbrücken vor.<br />
Die in Hochlage geplante Haltestelle<br />
soll direkt am Ufer der Norderelbe entstehen<br />
und so den Sprung der Hochbahn<br />
über die Elbe vorbereiten. Der<br />
Entwurf des Architekturbüros gmp<br />
sieht den Bau einer tragenden Stahlkonstruktion<br />
mit innenliegender Glasfassade<br />
vor. Die transparente Hallenkonstruktion<br />
mit ihrem filigranen<br />
Trägerwerk schmiegt sich der Linienführung<br />
der alten Elbbrücke an und<br />
bildet zu dieser einen interessanten<br />
Kontrast. Neben der künftigen U-Bahn-<br />
Endstelle soll auch ein neuer S-Bahnhof<br />
entstehen. Auch die bereits im Dezember<br />
2012 fertiggestellte U-Bahnstation<br />
HafenCity Universität zeichnet sich<br />
durch eine gelungene Gestaltung aus,<br />
weshalb sie jetzt den „International<br />
Lighting Design Award“ gewann.<br />
Neben dem Neubau investiert die<br />
Hamburger Hochbahn aber auch in<br />
den Bestand: Dieses Jahr sollen vier<br />
Brücken, ein Durchgang, ein Durchlass<br />
und die Haltestellen Langenhorn Nord<br />
und Kiwittsmoor zeitgleich erneuert<br />
bzw. modernisiert werden. Die Arbeiten<br />
sind mit einer zwölfwöchigen<br />
Sperrung der U-Bahnlinie U1 zwischen<br />
den Haltestellen Ochsenzoll und Langenhorn<br />
Markt verbunden. Bis zum<br />
27. August müssen die werktäglich<br />
rund 21.000 Fahrgäste (pro Richtung)<br />
auf Ersatzbusse umsteigen. Ende Oktober<br />
sollen die Arbeiten dann komplett<br />
abgeschlossen sein.<br />
JEP<br />
Stuttgart<br />
Zwei Jahre<br />
»Oldtimer-SEV«<br />
Dresden: Im Rahmen der Sonderausstellung „Zugpferde – als Pferdestärken noch starke Pferde waren“ widmete<br />
sich das Verkehrsmuseum am 27. April mit mehreren Vorträgen dem Thema Pferdebahnen. Vor dem ehemaligen<br />
Marstall des sächsischen Residenzschlosses war als Werbung für die Veranstaltung der Pferdebahnwagen<br />
aus Döbeln ausgestellt. Die Sonderausstellung hat noch <strong>bis</strong> zum 1. September geöffnet – der Döbelner<br />
Wagen ist in seine Heimatstadt zurückgekehrt, vor dem Hochwasser wurde er sichergestellt<br />
A. MARKS<br />
<strong>Von</strong> Ende Juli an wird die Strecke<br />
der Oldtimerlinie 23 (Straßenbahnwelt<br />
– Ruhbank/Fernsehturm) für voraussichtlich<br />
zwei Jahre vom Meterspur-<br />
Restnetz abgehängt und interimsweise<br />
mit historischen Omnibussen bedient.<br />
Gründe sind zunächst die Sperrung<br />
der Nordbahnhofstraße zur Verlängerung<br />
der Hochbahnsteige für den<br />
Einsatz von 80-m-Zügen der U12 und<br />
anschließende Bauarbeiten für das<br />
Straßenbauprojekt Rosensteintunnel<br />
im Bereich der Wilhelma. Zuvor veranstalten<br />
Stuttgarter Straßenbahnen AG<br />
und Stuttgarter Historische Straßenbahnen<br />
e. V. am 21. Juli einen Aktionstag,<br />
an dem sowohl die Straßenbahnlinien<br />
21 und 23 als auch die neue<br />
Buslinie 23E von 10.30 <strong>bis</strong> 17 Uhr im<br />
Stundentakt verkehren.<br />
Derweil schreitet die Sanierung der<br />
oberen Wagenhalle des Depots Bad<br />
Cannstatt, in der 2015 die Straßenbahnwelt<br />
neue Räume erhält, weiter<br />
voran. Seit zwei Jahren schon laufen<br />
Arbeiten zur Erhöhung der Standfestigkeit<br />
des 75 Jahre alten Gebäudes,<br />
dazu gehören die Sanierung des hölzernen<br />
Dachtragwerks und zusätzliche<br />
Bewehrungsmaßnahmen für die Stütz -<br />
pfeiler. Zur Entlastung des Gebälks erfolgt<br />
die Abspannung der Fahrleitungsanlage<br />
neuerdings über eigens<br />
aufgestellte Stahlrohrmasten. Innerhalb<br />
der Halle und in der westlichen<br />
Hofzufahrt wurden außerdem sechs<br />
Weichen ersetzt. An der Ostseite der<br />
Depotanlagen entsteht zurzeit eine<br />
Hamburg: So soll die künftige Endstation<br />
der U4 aussehen. In direkter<br />
Nachbarschaft wird auch ein S-<br />
Bahnhof entlang der Linien S3/S31<br />
entstehen GMP, SLG. J. PERBANDT<br />
Düsseldorf: Durch das Bauprojekt Kö-Bogen und den Abriss einer Hochstraße<br />
hat sich der Jan-Wellem-Platz stark verändert M. BEITELSMANN<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
11
Aktuell<br />
ANZEIGE<br />
Ihre Prämie<br />
Noch mehr Auswahl unter<br />
www.strassenbahnmagazin.de/abo<br />
Auf dem Kölner Abschnitt der Rheinuferbahn soll die Linie 16 ab 2017 durch eine neue Linie 17, die den Südabschnitt<br />
des Nord-Süd-Tunnels befährt, verstärkt werden<br />
P. KRAMMER<br />
Köln<br />
Linie 17 kommt nun doch<br />
Anders als es sich zuletzt abzeichnete,<br />
soll der südliche Teil der<br />
Nord-Süd-Stadtbahn nun doch vorgezogen<br />
in Betrieb genommen werden.<br />
Voraussichtlich ab Mitte 2016<br />
soll damit eine neue Linie 17 im<br />
Zehn-Minuten-Takt zwischen Severinstraße<br />
und Rodenkirchen fahren,<br />
in den Spitzenzeiten sogar weiter <strong>bis</strong><br />
Sürth. Diese benutzt zwischen Severinstraße<br />
und Schönhauser Straße<br />
den südlichen Teil des Nord-Süd-<br />
Tunnels und verdichtet anschließend<br />
die Linie 16. Die lange Vorlaufzeit ergibt<br />
sich daraus, dass noch ein Ausbau<br />
der Sicherungstechnik sowie ein<br />
neues Weichenkreuz in Höhe der<br />
Tunnelrampe erforderlich sind. Damit<br />
kann die Linie 17 dann die beiden<br />
eingleisigen Tunnelröhren immer<br />
abwechselnd bedienen, was nötig<br />
ist, da am provisorischen Endpunkt<br />
Severinstraße keine Gleisverbindung<br />
existiert. Ebenfalls muss noch eine<br />
neue Wendeanlage in Rodenkirchen<br />
gebaut werden.<br />
Stuttgart: Ab 28. Juli verkehren auf der Oldtimerlinie 23 anstelle von Straßenbahnen<br />
histo rische Omnibusse. Die Oldtimerlinie 21 wird dagegen<br />
planmäßig fahren<br />
J. DAUR<br />
Posse um Vorlaufbetrieb<br />
Dem Ratsbeschluss vom 30. April 2013<br />
ging eine politische Posse voraus. Als<br />
das Vorhaben im vergangenen Herbst<br />
auf der politischen Tagesordnung<br />
stand, positionierten sich SPD und CDU<br />
aufgrund der Kosten noch dagegen.<br />
Dafür stimmten seinerzeit Grüne und<br />
FDP, was insofern bemerkenswert ist,<br />
als dass im Kölner Stadtrat eigentlich<br />
eine rot-grüne Koalition existiert. Vor<br />
diesem Hintergrund versuchte man in<br />
der Folgezeit einen Kompromiss zu finden.<br />
Dem Vernehmen nach hätte im<br />
Gegenzug für die Ablehnung der vorgezogenen<br />
Inbetriebnahme ein Verkehrsinvestitionsprogramm,<br />
welches<br />
auch die Verlängerung der Linie 7 in<br />
Zündorf beinhaltete, beschlossen<br />
werden sollen. Soweit kam es aber<br />
nicht, denn die CDU änderte im letzten<br />
Moment ihre Meinung und<br />
stimmte zusammen mit den Grünen<br />
und der FDP für die Inbe trieb nahme.Im<br />
Zuge des nördlichen Tunnelabschnittes<br />
geht bereits im Dezember<br />
dieses Jahres der kurze Abschnitt<br />
vom Rathaus zum Heumarkt in Betrieb.<br />
Der Lückenschluss zwischen<br />
Heumarkt und Severinstraße und damit<br />
die Gesamtinbetriebnahme der<br />
Strecke wird jedoch frühestens 2019<br />
möglich sein.<br />
C. GRONECK<br />
neue Ausfahrrampe. Die alte Rampe<br />
und mehrere Erweiterungsbauten aus<br />
den 1960er Jahren waren 2010 zur<br />
Beseitigung einer Bodenaltlast abgebrochen<br />
worden.<br />
JDA<br />
Gera<br />
Streckensperrung und<br />
Finanzierungsprobleme<br />
Am 12. April begannen am künftigen<br />
Gleisdreieck Berufsakademie mit<br />
einem offiziellen Spatenstich die Bauarbeiten<br />
für den lang erwarteten weiteren<br />
Ausbau des Geraer Straßenbahnnetzes.<br />
Begonnen wurde dort mit<br />
dem Bau einer provisorischen Gleis-<br />
schleife, um das Wenden der Straßenbahnzüge<br />
während der Streckensperrung<br />
nach Bieblach Ost zu ermöglichen.<br />
Seit 29. April ist jene Strecke nun<br />
komplett gesperrt. Zuvor wurden dort<br />
bereits seit Ostern erste vorbereitende<br />
Baumaßnahmen durchgeführt wurden.<br />
Bis Ende September wird die<br />
Strecke in Stadtbahnqualität mit barrierefreien<br />
Haltestellen, modernen<br />
Fahrgastinformationssystemen und für<br />
eine Höchstgeschwindigkeit von 70<br />
km/h ausgebaut. Für das Geraer Stadtbahnprogramm,<br />
zu dem auch der Ausbau<br />
der Wiesestraße sowie eine Neubaustrecke<br />
von der Berufsakademie<br />
nach Langenberg gehören, werden<br />
von Bund und Freistaat Thüringen 29<br />
Mio. Euro Fördermittel bereitgestellt.<br />
Anfang Mai wurde allerdings auch bekannt,<br />
dass durch erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten<br />
des städtischen<br />
Eigenanteils die Bauarbeiten in der<br />
Wiesestraße Ende April nicht beginnen<br />
konnten und auch der Bau nach Gera-<br />
Langenberg noch einmal auf dem<br />
Prüfstand steht. Der weitere Ausbau<br />
des Geraer Straßenbahnnetzes scheint<br />
so noch einmal an einem unerwarteten<br />
und unsicheren Zeitpunkt angelangt<br />
zu sein.<br />
ROG<br />
Industrie<br />
Hilton Kommunal<br />
Neuer Oberleitungsmontagewagen<br />
für IVB<br />
Die Innsbrucker Verkehrsbetriebe<br />
(IVB) beschafften von Hilton Kommunal<br />
ein neues Oberleitungsmontagefahrzeug<br />
als Ersatz für den Zweiwege-Unimog<br />
866, der fast drei Jahrzehnte in<br />
Innsbruck im Einsatz war. Das neue<br />
Fahrzeug mit der Betriebs-Nummer 749<br />
wurde aufgebaut auf einem MAN-<br />
Fahrgestell und verfügt über ein Schie-<br />
12 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Deutschland · Industrie · Weltweit<br />
Gera: Während der weitere Ausbau der Straßenbahn unsicher ist, wird die<br />
Strecke Berufsakademie – Bieblach Ost <strong>bis</strong> September 2013 auf Stadtbahnniveau<br />
gebracht<br />
R. GLEMBOTZKY<br />
Hilton Kommunal: Das neue Oberleitungsmontagefahrzeug, hier im Einsatz<br />
auf der Innsbrucker Mittelgebirgsbahn bei Tantegert, ersetzte den<br />
Zweiwege-Unimog 866<br />
H. SCHIESTL<br />
nenfahrsystem (hydrostatisch angetriebene<br />
Lore), eine Funkfernsteuerung, eine<br />
schwenkbare Teleskopbühne und<br />
beidseitige Gerätekästen. Das nach<br />
hinten offene Fahrerhaus ist mit einem<br />
Werkstattaufbau verbunden, auf dem<br />
ein Pantograph mit Messlineal montiert<br />
ist. Für das Fahrdrahtziehen ist an der<br />
Bühne ein hydraulisch verfahrbares<br />
Stativ vorhanden. Das Zweiwegefahrzeug<br />
des Typs Hilton OMF 3T-110 ist<br />
zusätzlich ausgerüstet mit Dreilicht-<br />
Spitzensignal für jede Fahrtrichtung,<br />
mit Blaulicht sowie mit gelben Warnblinkleuchten.<br />
Für den städtischen Einsatz<br />
auf Schienen steht eine Warnglocke<br />
und für die Überlandstrecken ein<br />
Signalhorn zur Verfügung. Für den Einsatz<br />
auf der Stubaitalbahn ist es zudem<br />
mit dem Zugleitsystem ausgerüstet. Ein<br />
ähnliches Fahrzeug konnte 2012 an<br />
Stern & Hafferl, unter deren Regie unter<br />
anderem die Gmundener Straßenbahn<br />
fährt, verkauft werden. ROS<br />
Stadler<br />
19 weitere Tangos<br />
für die BLT<br />
Am 27. Mai 2013 hat der Verwaltungsrat<br />
der Baselland Transport (BLT)<br />
das zweite Bestelllos von 19 Tango-<br />
Trams ausgelöst. Die Auslieferung der<br />
94 Mio. Franken teuren Fahrzeuge erfolgt<br />
2015 <strong>bis</strong> Mitte 2016. Ab dann<br />
werden die Tramlinien 10 und 11 nur<br />
noch mit Tango-Trams betrieben. Die<br />
Schindler-Sänftenfahrzeuge, welche in<br />
den letzten zehn Jahren einem umfangreichen<br />
Sanierungsprogramm unterzogen<br />
wurden, sollen ab dann nur<br />
noch auf den Einsatzlinien E11 und 17<br />
unterwegs sein. Bis 2012 erhielt die<br />
BLT bereits 19 Tango-Trams. Ursprünglich<br />
sollte dieser Fahrzeugtyp nicht nur<br />
für den kleineren Baseler Trambetrieb<br />
BLT, sondern auch für das größere Unternehmen<br />
Baseler Verkehrsbetriebe<br />
(BVB) beschafft werden. So kam es<br />
Stadler/Basel: Ab 2016 sollen die beiden BLT-Hauptlinien 10 und 11 ausschließlich mit Tangos betrieben werden,<br />
wofür Stadler 19 weitere Exemplare an die Stadt am Rhein liefert<br />
P. KRAMMER<br />
aber nicht, denn die BVB bestellten<br />
Ende 2011 insgesamt 60 Tw des Bombardier-Typs<br />
Flexity 2, von denen die<br />
ersten Vorserienfahrzeuge ab Ende<br />
2013 zur Verfügung stehen sollen. PKR<br />
Stadler/Alstom<br />
Neues auf dem<br />
UITP-Kongress<br />
Ende Mai 2013 trafen sich Fachleute<br />
aus aller Welt zum 60. Weltkongress<br />
des Internationalen Verbandes<br />
für öffentliches Verkehrswesen (UITP),<br />
zur Mobility und City Transport Ausstellung<br />
und zur Fachmesse suissetraffic<br />
in Genf. 300 Aussteller priesen<br />
ihre Produkte an. Unter den vielen<br />
Neuheiten zeigte Stadler neben dem<br />
Mock-up der U-Bahnwagen für das<br />
Berliner Kleinprofilnetz den ersten<br />
Obus, den Stadler Minsk gemeinsam<br />
mit einem lokalen Partner für den<br />
Markt in den GUS-Staaten herstellt.<br />
Somit erweitert Stadler sein Produktportfolio<br />
nach dem Geschäftsfeld U-<br />
Bahn abermals. Für großes Aufsehen<br />
sorgte auch die von Alstom ausgestellte<br />
Citadis-Tram für die Stadt Tours<br />
(Frankreich). Über die Neuheiten aus<br />
Genf berichten wir ausführlich in der<br />
nächsten Ausgabe.<br />
ROS<br />
Siemens<br />
Verspätete Zulassung<br />
für Münchener Bahnen?<br />
Um das Angebot im Tram- und U-<br />
Bahn-Bereich zu verbessern, benötigt<br />
die Münchener Verkehrsgesellschaft<br />
(MVG) bereits zum Fahrplanwechsel<br />
im Dezember die neuen U-Bahn-Züge<br />
vom Typ C2 sowie die neuen Trams<br />
vom Typ Avenio. Nach Aussage des<br />
Regierungspräsidiums Oberbayern<br />
droht aber bei den beiden Siemens-Typen<br />
eine verspätete Zulassung, da<br />
noch wichtige Dokumente fehlen. Sollte<br />
es so kommen, müsste die MVG<br />
von den im März angekündigten Angebotsverbesserungen<br />
Abstriche machen.<br />
Geplant ist u.a. ein Zwei-Minuten-Takt<br />
während des morgendlichen<br />
Berufsverkehrs auf dem U-Bahn-Abschnitt<br />
Hauptbahnhof – Kolumbusplatz,<br />
die Einführung des Samstagsbetriebs<br />
auf der neuen Tramlinie 28<br />
(Sendlinger Tor – Scheidplatz), die Verlängerung<br />
der Linie 18 vom Effnerplatz<br />
nach St. Emmeram nicht nur in<br />
der Morgenspitze sondern auch nachmittags<br />
sowie zahlreiche weitere<br />
punktuelle Fahrplanausweitungen. PKR<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
13
Aktuell<br />
Siemens: Ob die Münchener C2-Züge, von denen der erste im April die<br />
Wiener Werkshallen verließ, rechtzeitig zugelassen werden, ist laut dem<br />
Regierungspräsidium Oberbayern eher fraglich<br />
R. WYHNAL<br />
Bern: Das heute noch zweiteilige „Mandarinli“ 43, hier nahe der Station<br />
Felsenau, bleibt aufgrund seiner automatischen Fahrgastzählgeräte weiter<br />
im Einsatz bei der RBS<br />
J. SCHRAMM<br />
Ausland<br />
Rumänien: Galati<br />
Betrieb setzt auf<br />
ex-Rotterdamer GT6<br />
Der ostrumänische Straßenbahnbetrieb<br />
hat in den vergangenen Monaten<br />
die letzten aus Rotterdam gebraucht<br />
übernommen GT6 in Betrieb<br />
genommen. Seit 2007 hat Galati insgesamt<br />
27 dieser 1984 bei Düwag<br />
gebauten Fahrzeuge übernommen.<br />
Abzüglich zweier Ersatzteilspender<br />
können jetzt in der Regel alle Kurse<br />
mit den Rotterdamer Wagen bestückt<br />
werden. Der Einsatz von Gebrauchtwagen<br />
aus Deutschland steht damit<br />
laut Betrieb kurz vor dem Ende. <strong>Von</strong><br />
den fünf 1997 aus Frankfurt übernommenen<br />
L-Zügen waren im Mai nur<br />
noch vier Tw vorhanden, zwei standen<br />
vor der Verschrottung. Alle sieben T4<br />
ex Magdeburg waren bereits verschrottet.<br />
Die zwölf T4 aus Dresden<br />
warten, ebenso wie die meisten der<br />
31 Berliner KT4D, auf ihre Zukunft. Die<br />
letzten rund zehn einsatzfähigen ex-<br />
Berliner KT4D werden kaum noch benötigt<br />
und sollen bald abgestellt werden.<br />
CLÜ<br />
Schweiz: Bern RBS<br />
NExT ersetzen<br />
»Mandarinlis«<br />
Die Reihen der ursprünglich 21 Be<br />
4/8 (Bj. 1974 <strong>bis</strong> 1978) von der Regionalverkehr<br />
Bern-Solothurn (RBS) werden<br />
sich bald lichten. 16 der wegen<br />
ihrer orangefarbenen Lackierung<br />
„Man darinlis“ genannten Tw erhielten<br />
zwischen 1999 und 2002 einen niederflurigen<br />
Zwischenwagen. 2004<br />
wurden dann alle Züge grundlegend<br />
modernisiert. Dennoch wurde Ende<br />
2011 mit dem Wagen 44 der erste wegen<br />
Schäden an Rahmen und Fahrzeugkasten<br />
ausgemustert und verschrottet.<br />
Seit 2009 erhielt die RBS<br />
von Stadler sechs neue Triebwagen<br />
„NExT“, welche vorwiegend den RE-<br />
Verkehr zwischen Bern und Solothurn<br />
übernommen haben. 2013 werden<br />
acht weitere NExT folgen, sodass die<br />
Linie S8 weitgehend mit den neuen<br />
Fahrzeugen bedient werden kann.<br />
Dies bedeutet gleichzeitig das Aus für<br />
die letzten zweiteiligen „Mandarinli“,<br />
die heute in den Spitzenzeiten als Verstärkungsmodule<br />
auf der S8 eingesetzt<br />
werden. Betroffen sind die Wagen<br />
41, 42, 45, 46. 48 und 49, die <strong>bis</strong><br />
Ende 2013 ausscheiden werden. Hiervon<br />
sind die Wagen 41, 46 und 49<br />
dreiteilig, dagegen wird der heute<br />
zweiteilige Wagen 43 erhalten bleiben<br />
und mit einem der frei werdenden<br />
Mittelteile ergänzt werden; der Grund<br />
hierfür ist seine Ausstattung für die<br />
Fahrgastzählung. Die beiden anderen<br />
Mittelteile sollen verkauft werden. JÖS<br />
Algerien: Oran/Constantine<br />
Zwei neue<br />
Straßenbahnbetriebe<br />
Nachdem 2011 neben der ersten<br />
Metrolinie auch die erste Straßenbahn<br />
des Landes in der Hauptstadt Algier in<br />
Betrieb genommen worden war, folgte<br />
Galati: Ex-Rotterdamer GT6er<br />
aus den 1980er-Jahren haben<br />
deutsche Gebrauchtfahrzeuge<br />
aus Berlin, Magdeburg, Dresden<br />
und Frankfurt/Main verdrängt<br />
C. LÜCKER<br />
am 1. Mai 2013 die Eröffnung einer<br />
18,7 km langen Straßenbahnlinie in<br />
Algeriens zweitgrößter Stadt Oran (ca.<br />
1 Mio Einw.). Diese Linie führt von den<br />
östlichen Vororten (Bir El Djir) ins<br />
Stadtzentrum und schwenkt dann<br />
nach Süden, um im Bereich der Universität<br />
in Senia zu enden. An der Strecke<br />
liegen 32 Haltestellen.<br />
Im Juli 2013 startet auch der Fahrgastbetrieb<br />
bei der neuen Tramway<br />
von Constantine (ca. 500.000 Einw.)<br />
im Osten des Landes auf einer neun<br />
km langen Linie mit elf Haltestellen.<br />
Die Strecke beginnt am südlichen<br />
Rand der Innenstadt, die auf einem<br />
Plateau 650 m über dem Meeresspiegel<br />
liegt. Die Tramway überquert nach<br />
2,7 km Fahrt das tiefe Tal des Flusses<br />
Rhumel auf einem ca. 500 m langen<br />
Viadukt, um dann mehrere Vororte im<br />
Süden der Stadt zu erschließen. Am<br />
südlichen Endpunkt Zouaghi wird eine<br />
multimodale Umsteigeanlage eingerichtet.<br />
Wie bereits die Tramway in Algier<br />
werden die beiden neuen Netze von<br />
SETRAM (Société d’exploitation des<br />
tramways d’Algérie) betrieben, an der<br />
die Pariser RATP-Dev maßgeblich beteiligt<br />
ist. Der französische Einfluss ist<br />
nicht nur am Ausbaustandard der<br />
Strecken und Haltestellen zu erkennen,<br />
es werden bei allen drei Betrieben<br />
auch nur Citadis 302-Fahrzeuge<br />
von Alstom eingesetzt. Nach demselben<br />
Muster sollen in den nächsten<br />
Jahren weitere Betriebe in Sétif, Annaba,<br />
Mostaganem, Sidi-Bel-Abbès, Tiaret<br />
und Ouargla entstehen. RSC<br />
Frankreich: Nizza<br />
Straßenbahnnetz<br />
wird erweitert<br />
Im Juli 2013 soll die seit 2007 betriebene<br />
8,7 km lange Straßenbahn im<br />
südfranzösischen Nizza (Nice) um eine<br />
Haltestelle verlängert werden. Die<br />
14 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Weltweit<br />
Neubaustrecke beginnt an der nordöstlichen<br />
Endhaltestelle Pont Michel<br />
der <strong>bis</strong>lang einzigen Straßenbahnlinie<br />
1 und endet nach 450 m am Krankenhaus<br />
Hôpital Pasteur. Die Gleise 1 und<br />
2 der alten Endstelle Pont Michel werden<br />
nach Westen weitergeführt, während<br />
das südliche Bahnsteiggleis 3 als<br />
Kehrgleis verbleibt. Die Strecke verläuft<br />
auf besonderem Bahnkörper in<br />
südlicher Seitenlage und überquert<br />
dabei auf einem 93 m langen Brückenbauwerk<br />
neben der Straßenbrücke<br />
Pont René Coty den Fluss Paillon.<br />
Anstatt des sonst üblichen Oberbaus<br />
mit Zweiblockschwellen wurden dieses<br />
Mal Längsbetonbalken verwendet.<br />
Eingedeckt sind die Gleise mit Asphalt,<br />
Natursteinpflaster oder Rasen. Der<br />
neue Endpunkt erhält zwei 40 m lange<br />
Seitenbahnsteige, deren vorgeschaltete<br />
doppelte Gleisverbindung mit einer<br />
abhängig geschalteten Fahrsignalanlage<br />
gesichert ist. Eine spätere Verlängerung<br />
von hier aus nach La Trinité ist<br />
möglich.<br />
Für den Herbst 2013 plant die Stadt<br />
zudem den Baubeginn der zweiten<br />
Straßenbahnlinie, die von St-Augustin<br />
am Flughafen westlich der Stadt entlang<br />
der Küste <strong>bis</strong> zum Hafen von<br />
Nizza führen soll. Die Innenstadt wird<br />
in einem 3,6 km langen Tunnel unterfahren,<br />
der die Linie 1 an den Haltestellen<br />
Jean Médecin und Garibaldi<br />
kreuzt.<br />
MKE<br />
Schweiz: Basel BVB<br />
»Badwännli« stillgelegt<br />
Wie jetzt bekannt wurde, verfügten<br />
die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) bereits<br />
im Herbst 2012 die Außerbetriebsetzung<br />
des offenen Aussichtswagens<br />
B2 1045, was mit Bedenken<br />
bezüglich der Sicherheit begründet<br />
wurde. Schließlich sei während der<br />
Der neue Niederflurwagen 1002 (Piccola) fährt als Linie 9 in der Hakushima-dori-Straße. Bis 2027 sollen in Hiroshima<br />
42 dieser Tw in Dienst gestellt sein<br />
E. PLEFKA<br />
Japan: Hiroshima<br />
»Piccolo« und »Piccola« sind da!<br />
Nachdem in den letzten Jahren für die am stärksten<br />
frequentierten Linien 1 und 2 Niederflurgelenkwagen beschafft<br />
wurden, stehen nun die alten Vierachser zur Erneuerung<br />
an. Anfang 2013 wurden von Kinki Sharyo und<br />
Mitsu<strong>bis</strong>hi zwei 18,6 m lange vierachsige Niederflurwagen<br />
mit schwebendem Mittelteil geliefert. Sie sind weitgehend<br />
bauartgleich mit dem 2004 <strong>bis</strong> 2008 gelieferten<br />
fünfteiligen Sechsachsern 5101 <strong>bis</strong> 5110 „Greenmover-<br />
Max“. Eingesetzt werden die neuen Wagen 1001 („Piccolo“)<br />
und 1002 („Piccola“) seit Februar auf den Linien 7<br />
und 8 und auf den Einlagekursen der Linie 9 zwischen Eba<br />
und Hakushima. Bis 2027 sollen weitere 40 Wagen dieser<br />
Fahrt eine Beschädigung der Fahrleitung,<br />
bei welcher es zum Herabfallen<br />
von Teilen und so zu einer Gefährdung<br />
der Fahrgäste kommen könnte, nicht<br />
ausgeschlossen.<br />
Die beiden Sommerwagen C 260<br />
und C 262 wurden in den Jahren 1938<br />
bzw. 1939 in offene Aussichtswagen<br />
für Stadtrundfahrten verwandelt und<br />
entstammen den 1901 von SIG Neuhausen<br />
gebauten Wagen C 93 und C<br />
95. Beim Umbau wurden das Dach<br />
entfernt, niedrige Seitenwände angebracht<br />
und der Radsatzabstand vergrößert.<br />
Die offenen Wagen erhielten<br />
im Volksmund schnell den Namen<br />
Wagentype beschafft werden, um damit die derzeit mehr<br />
als 50 Jahre alten Vierachser zu ersetzen.<br />
Akuter Erneuerungsbedarf<br />
Der Erneuerungsbedarf bei der Straßenbahn von Hiroshima<br />
ist besonders akut, denn von den 125 für den Linienbetrieb<br />
zur Verfügung stehenden Wagen sind nur 36 (29 %) jünger<br />
als 20 Jahre. 46 Wagen (37 %) sind zwischen 20 und 31<br />
Jahre alt, die restlichen 43 Wagen (34 %) weisen mittlerweile<br />
ein Alter von 49 <strong>bis</strong> 73 Jahren auf, wobei die ältesten<br />
eingesetzten Fahrzeuge die 1940 von Kinami Sharyo für<br />
Osaka gebauten Vierachser 761 – 763 sind.<br />
EPL<br />
„Badwännli“. 1954 erhielten sie die<br />
neuen Nummern 1045 und 1046. Der<br />
Wagen 1046 verabschiedete sich bereits<br />
neun Jahre früher als sein<br />
Schwesterfahrzeug aus dem Fahrgastverkehr,<br />
da er seinerzeit dem Brand<br />
des Depots Wiesenplatz zum Opfer<br />
fiel.<br />
DOM<br />
Nizza: Citadis 018 kehrt in der heutigen Endhaltestelle Pont Michel – im<br />
Hintergrund ist die Gleisbaustelle für die Verlängerung zum Hôpital Pasteur<br />
zu erkennen<br />
M. KEUCHEL<br />
Basel: Der letzte große Auftritt des B2 1045, im Volksmund Badwännli genannt,<br />
war am 20. Januar 2012, als er das traditionelle Vogel-Gryff-Spiel<br />
zur Haltestelle Eglisee beförderte<br />
D. MADÖRIN<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
15
Betriebe<br />
In die vom Elisabeth-Dom dominierte Innenstadt von Kosice kommt die Straßenbahn nicht mehr, sondern umfährt sie auf dem Altstadtring.<br />
Der VarioLFR.S 701 – das erste Neufahrzeug Kaschaus seit über 15 Jahren – passiert hier den Namestie Osloboditelov<br />
M. JUNGE<br />
Kulturhauptstadt<br />
mit Tram und Trolley<br />
Reisetipp 2013: Kosice Das slowakische Kaschau präsentiert sich neben Marseille als diesjäh rige<br />
Kulturhauptstadt Europas. Die im Schnittpunkt zwischen Polen, Ungarn und der Ukraine gelegene<br />
zweitgrößte Stadt der Slowakischen Republik lädt aber nicht nur deshalb zu einem Besuch ein<br />
16<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Slowakei: Kaschau<br />
Das Straßenbahnnetz<br />
in Kosice<br />
Altstadtring<br />
Die Stammstrecke beginnt am Hauptbahnhof<br />
Kosice, umschließt in einem Halbkreis die Altstadt<br />
und endet am nördlichen Innenstadtrand<br />
(Havlickova); am Rand der Altstadt befindet sich<br />
ein zweiter Linienendpunkt (Namestie Maratonu<br />
Mieru)<br />
Westliche Schleife<br />
Der Altstadtring wird um eine westliche Schleife<br />
erweitert, die in einem weiten Bogen die<br />
Westbezirke anschließt; von der westlichen<br />
Schleife zweigt eine Stichstrecke zur Technischen<br />
Universität ab und endet am nordwestlichen<br />
Innenstadtrand (Botanicka Zahrada)<br />
Die Straßenbahn von Kosice dient vor allem zur Erschließung der Neubausiedlungen und Industrieanlagen.<br />
Eine T3-Doppeltraktion nähert sich hier der Station VVS krizovatka<br />
Außenast 1<br />
Die Strecke zweigt vom Altstadtring (Osloboditelov-Platz)<br />
ab und verbindet das Zentrum mit<br />
der Trabantenstadt Vazecka im Osten Kaschaus;<br />
von diesem Außenast zweigt eine Stichstrecke<br />
ab und endet am östlichen Innenstadtrand<br />
(Socha Jana Pavla II.)<br />
Außenast 2<br />
Die Strecke zweigt von der westlichen Schleife<br />
ab und verbindet das Zentrum mit dem Stahlwerk<br />
(Vstupny Areal U.S.Steel) im Südosten der<br />
Stadt Kosice<br />
Tangente<br />
Die Strecke verknüpft beide Außenäste und die<br />
westliche Schleife und stellt die kürzeste Verbindung<br />
zwischen Vazecka und den Westbezirken<br />
sowie dem Stahlwerk her<br />
Das 240.000 Einwohner zählende<br />
Kosice – der deutsche Stadtname<br />
lautet Kaschau – ist zwar industriell<br />
von einem Stahlwerkskomplex<br />
geprägt, verfügt aber auch über ein<br />
sehr stilvolles und großflächiges Altstadtensemble<br />
mit dem gotischen Elisabeth-Dom<br />
als markantem Wahrzeichen. Um die Innenstadt<br />
<strong>bis</strong> hinauf auf die benachbarten<br />
Höhenrücken gruppieren sich eine Reihe<br />
von Trabantenstädten mit der typischen<br />
Plattenbauarchitektur, die im Zuge der forcierten<br />
Industrialisierung in den 1960er-Jahren<br />
zur Beschaffung von Wohnungen entstanden<br />
sind. Diese Standortfaktoren sind<br />
auch maßgebend für die Struktur des öffentlichen<br />
Nahverkehrs in Kosice.<br />
LINKS Neben herkömmlichen Bussen und der<br />
Straßenbahn werden in Kosice im Öffentlichen<br />
Personennahverkehr auch Obusse eingesetzt<br />
– hergestellt wurden sie in den tschechischen<br />
Skodawerken<br />
Der Triebwagen 376, ein Tatra-T3SUCS, wirbt derzeit für Kosice in dieser auffälligen Lackierung<br />
als europäische Kulturhauptstadt J. BOHNDORF (3)<br />
Kernstück sind ein Straßenbahnnetz und<br />
eine Obus-Strecke. 40 weitere Autobuslinien<br />
komplettieren das städtische Bedienungssystem.<br />
Die Straßenbahn erschließt mit 34 km<br />
Streckenlänge vornehmlich die Innenstadt<br />
sowie den Osten und Westen der Stadt. Die<br />
im Infokasten genannten Netzteile sind an<br />
allen Abzweigstellen über Gleisdreiecke miteinander<br />
verknüpft, so dass sich für die Linienführung<br />
keine Restriktionen ergeben.<br />
Auf dieser Infrastruktur verkehren sieben<br />
Regel-Verkehrslinien. Die Linienführung ist<br />
so gestaltet, dass von den maßgebenden<br />
Endpunkten Havlickova im Norden, Hauptbahnhof<br />
im Zentrum und Vazecka im Osten<br />
alle Ziele auf dem Altstadtring, der westlichen<br />
Schleife und dem Außenast 1 ohne<br />
Umsteigen erreicht werden. Die Stichstrecken<br />
werden jeweils mit einer Linie bedient,<br />
die beide über den Altstadtring führen.<br />
Auf den einzelnen Linien verkehren die<br />
aus Tatra-Fahrzeugen gebildeten Züge in<br />
der Regel in 20-Minuten-Intervallen, die in<br />
den Hauptverkehrszeiten zu 15-Minuten-<br />
Zugfolgen verdichtet werden.<br />
Ein Spezifikum des Kaschauer Straßenbahnsystems<br />
sind acht zusätzliche Berufsverkehrslinien,<br />
die alle Netzteile direkt mit<br />
dem Stahlwerk verbinden und nur bedarfsorientiert<br />
bedient werden.<br />
Zum elektrisch betriebenen Streckennetz<br />
zählt auch eine Obus-Strecke, die von der<br />
nordöstlich gelegenen Trabantenstadt Lingov<br />
durch das Zentrum <strong>bis</strong> zum westlichen<br />
Stadtrand (Sidlisko KVP/Klastor) führt, auf<br />
der zwei Obus-Linien verkehren.<br />
JOACHIM BOHNDORF<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
17
Betriebe<br />
Grüner als man denkt<br />
präsentiert sich das<br />
Ruhrgebiet an vielen<br />
Stellen auf der Reise<br />
quer durch das Ballungsgebiet<br />
– wie<br />
hier in <strong>Witten</strong> auf der<br />
Bogestra-Linie 310<br />
kurz hinter der Haltestelle<br />
Hardel<br />
MARCO CHRISTIAN<br />
»Tour de Ruhr«<br />
Die längste Straßenbahnfahrt auf einem zusammenhängenden Netz Auf der über<br />
100 Kilometer langen Fahrt von St. Tönis nach Heven Dorf erlebt der Fahrgast fünf Betriebe, zwei<br />
Spurweiten sowie eine große Fahrzeugtypenvielfalt. Außerdem sieht er viel Revieratmosphäre –<br />
von Zechenanlagen und „Ruhrbarock“ aus Kaisers Zeiten <strong>bis</strong> hin zu hypermodernen Zweckbauten<br />
18 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Ruhrgebiet<br />
Kombi-Tickets für Schnäppchen-Jäger!<br />
Fahrkarten-Tipps für die Straßenbahnexkursion an Rhein und Ruhr<br />
Für die „Tour de Ruhr“ benötigt man ein Ticket<br />
der Preisstufe D im Verkehrsverbund Rhein/Ruhr<br />
(VRR). Die Einzelfahrt kostet damit 12,50 Euro –<br />
theoretisch, denn die Geltungsdauer eines solchen<br />
Einzeltickets ist auf vier Stunden beschränkt.<br />
Wer aber ausschließlich per Straßen- und Stadtbahn<br />
von Tönisvorst <strong>bis</strong> nach <strong>Witten</strong>-Heven fahren<br />
möchte, benötigt selbst bei optimalen Anschlüssen<br />
und ohne jede Pause mindestens fünf<br />
Stunden.<br />
Es bleibt also nur eine Tageskarte, die in dieser<br />
Preisstufe inzwischen mit stolzen 27,40 Euro zu<br />
Buche schlägt. Günstiger wird es in der Gruppe:<br />
Eine Tageskarte für <strong>bis</strong> zu fünf Personen kostet<br />
38, – Euro. Eventuell lohnt sich auch das „SchönerTagTicket“,<br />
das zwar erst ab 9 Uhr gilt, mit<br />
dem man aber dann den kompletten Nahverkehr<br />
in ganz Nordrhein-Westfalen nutzen kann. Es kostet<br />
28,50 Euro (Einzelperson) bzw. 39,50 Euro<br />
(Gruppenticket <strong>bis</strong> zu fünf Personen). Sonnabends<br />
und sonntags ist die bundesweite Nahverkehrs-<br />
Netzkarte „Schönes-Wochenende-Ticket“ eine Alternative<br />
Clevere Sparfüchse können ihre Straßenbahnerkundungsreise<br />
im Ruhrgebiet mit dem Besuch<br />
einer Veranstaltung verbinden, deren Eintrittskarte<br />
als Kombi-Ticket am jeweiligen Tag auch als<br />
Fahrkarte im gesamten VRR-Tarifgebiet gilt. Dies<br />
ist bei diversen Messen (Düsseldorf, Essen, Dortmund),<br />
bei zahlreichen kulturellen Events und vielen<br />
Sportveranstaltungen der Fall. So bekommt<br />
man z.B. die „Tour de Ruhr“ inklusive eines Fußballspiels<br />
des VfL Bochum in der 2. Bundesliga<br />
schon für 11,– Euro (Stehplatz Vollzahler)!<br />
Einige, zum Teil sogar recht preiswerte und sehr<br />
zentral gelegene Hotels an Rhein und Ruhr – vor<br />
allem in Düsseldorf, aber auch in Essen, Wuppertal<br />
und Gelsenkirchen –, stellen ihren Übernachtungsgästen<br />
eine kostenlose Fahrkarte für das gesamte<br />
VRR-Gebiet (Nahverkehr, 2. Klasse) aus! Sie<br />
gilt ab Ankunft im Hotel und auch noch den gesamten<br />
Abreisetag. Schnäppchenjäger können so<br />
bereits ab 35,– Euro (im Einzelzimmer) und ab<br />
45,– Euro (zu zweit im Doppelzimmer) übernachten<br />
und nach Belieben Straßenbahn fahren. Mehr<br />
Infos unter www.hotel-kombiticket.de. MIK<br />
Auch wenn das dichte Straßenbahnnetz<br />
im Großraum Rhein-Ruhr der<br />
Vergangenheit angehört, verbindet<br />
die Tram doch weiterhin die Städte<br />
im Revier. Fünf Betriebe, zwei Spurweiten,<br />
unterirdische, ebenerdige und aufgeständerte<br />
Strecken, „Oldies“ aus den 1970er-Jahren<br />
und brandneue Niederflurwagen sowie<br />
viel Revieratmosphäre – von Zechenanlagen<br />
und „Ruhrbarock“ aus Kaisers Zeiten<br />
<strong>bis</strong> hin zu hypermodernen Zweckbauten:<br />
Die „Tour de Ruhr“ mit der Straßenbahn ist<br />
ein Erlebnis!<br />
Unser Abenteuer beginnt in Tönisvorst,<br />
einer 30.000-Einwohner-Stadt im Kreis<br />
Viersen, und zwar am Wilhelmplatz in<br />
St. Tönis in typisch niederrheinischer Kleinstadt-Atmosphäre.<br />
Hier wartet die Linie<br />
041 der <strong>Krefeld</strong>er SWK Mobil GmbH. Die<br />
Abfahrtshaltestelle ist zweigleisig, doch<br />
wird das zweite Gleis nur selten genutzt. Befördern<br />
wird uns der noch recht neue „Flexity“<br />
612, ein eleganter Niederflurwagen<br />
der Firma Bombardier mit einer dynamischen<br />
rot/weißen Lackierung. Oder warten<br />
wir einen Kurs ab? Werktags ist die Chance<br />
gut, dass wir dann einen 1980/81 gebauten<br />
M8C erwischen. Aber Fahrzeuge dieser<br />
Bauart erwarten uns in Essen und Bochum<br />
auf alle Fälle noch – und Zeit wollen wir<br />
nicht verlieren. Denn bereits ohne Pause<br />
und mit optimalen Anschlüssen dauert unsere<br />
rund 106 km lange Tour etwa fünf<br />
Stunden!<br />
Da die komplette Reise im Verkehrsverbund<br />
Rhein-Ruhr verläuft, brauchen wir<br />
nur ein einziges Ticket (Infos siehe Kasten).<br />
Aber Achtung: Eine Einzelfahrt auf dieser<br />
langsamen Umwegroute erlaubt das Tarifsystem<br />
nicht!<br />
Seit drei Jahren ohne »Klassiker«<br />
Gleich nach der Endstelle erleben wir eine<br />
sehenswerte Gleisverschlingung, als der Wagen<br />
aus der Häuserblockschleife in die enge<br />
<strong>Krefeld</strong>er Straße einbiegt. Bald verlassen wir<br />
den Ort St. Tönis, und die <strong>Krefeld</strong>er Straße<br />
ist plötzlich eine breite Fahrbahn, in deren<br />
Mitte wir ungestört auf eigenem Bahnkörper<br />
vorwärtskommen. Die Linie 041 passiert<br />
einige Felder, doch inzwischen dominieren<br />
hier große Neubaugebiete. Die fröhliche<br />
Horde von Schulkindern ist wieder<br />
verschwunden, und im Wagen ist Ruhe eingekehrt.<br />
In <strong>Krefeld</strong> heißt es aufpassen: Auf der<br />
rechten Seite fahren wir am Depot- und<br />
Werkstattgelände der SWK am Weeserweg<br />
vorbei. Nur mit viel Glück steht manchmal<br />
der historische blaue Oldtimer mit seinen<br />
drei Bogenfenstern im Freien. Die klassischen<br />
achtachsigen Düwag-Gelenkwagen<br />
sind seit drei Jahren Geschichte. Ein Stück<br />
weiter steht die Verwaltung der Stadtwerke<br />
<strong>Krefeld</strong>. Auf der anderen Straßenseite finden<br />
sich noch Reste der früheren Wendeschleife<br />
Obergplatz.<br />
Erneut fahren wir ein Stück weiter Richtung<br />
Innenstadt, und die Bebauung wird zunehmend<br />
großstädtischer und enger, auch<br />
einige alte Industriebauten können wir bewundern.<br />
Die meterspurigen Straßenbahngleise<br />
kreuzen die regelspurigen Gleise der<br />
SWK-Eisenbahnstrecke, die zum <strong>Krefeld</strong>er<br />
Nordbahnhof und weiter nach Hüls führt.<br />
Über viele Kilometer sind wir mehr oder<br />
weniger geradeaus gefahren, doch am alten<br />
Horten-Gebäude biegt die 041 nach rechts<br />
in den Ostwall ein, eine der geschäftigsten<br />
<strong>Krefeld</strong>er Innenstadtstraßen. Hier erreichen<br />
wir die wichtigste <strong>Krefeld</strong>er Straßenbahnhaltestelle<br />
mit Namen „Rheinstraße“. Alle<br />
vier SWK-Linien verkehren hier, außerdem<br />
wendet die normalspurige Stadtbahnlinie<br />
U76 der Düsseldorfer Rheinbahn in einer<br />
mittigen Stumpfendstelle mit Umsetzgleis.<br />
Hinter dem modernen Kürzel „U76“ ver-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
19
Betriebe<br />
In St. Tönis bei <strong>Krefeld</strong> gibt es am Ende der Häuserblockschleife eine Gleisverschlingung.<br />
Für die Flexity der <strong>Krefeld</strong>er SWK Mobil kein Problem! M. PABST<br />
birgt sich die frühere Linie „K“, die seit<br />
1898 als elektrifizierte Kleinbahn Düsseldorf<br />
und <strong>Krefeld</strong> verbindet. Wir steigen das<br />
erste Mal um.<br />
U76: Stadtbahnwagen mit Bistro<br />
Die Rheinbahn setzt auf der U76 in der Regel<br />
Doppeltraktionen aus B80-Stadtbahnwagen<br />
ein. Wir haben Glück: Unser Zug<br />
Fototipps für eine »Tour de Ruhr«<br />
Wer nicht nur die Fahrt genießen, sondern auch<br />
einige Erinnerungsfotos entlang der Strecke schießen<br />
möchte, dem seien folgende Fotostellen empfohlen:<br />
Die Gleisverschlingung hinter der Starthaltestelle<br />
Wilhelmplatz in St. Tönis bietet sich<br />
schattenbedingt vor allem bei bewölktem Himmel<br />
als Motiv an.<br />
In <strong>Krefeld</strong> sollte die zentrale Haltestelle Rheinstraße<br />
festgehalten werden, sie wird ihr klassisches<br />
Flair im nächsten Jahr durch einen Komplettumbau<br />
verlieren. Entlang der U76 ist die<br />
Oberkasseler Brücke in Düsseldorf mit Blick auf<br />
den Rhein zu fast jeder Tageszeit ein guter Tipp –<br />
am besten an den Haltestellen Luegplatz oder<br />
Tonhalle aussteigen.<br />
Ähnlich wie die U76, bietet auch die U79 auf<br />
dem Weg nach Düsseldorf reizvolle Überlandabschnitte,<br />
wie etwa zwischen den Haltestellen Froschenteich<br />
und Kesselsberg. Neben der Ortsdurchfahrt<br />
in Mülheim-Speldorf ist entlang der 901 die<br />
schmale Brückendurchfahrt hinter der Haltestelle<br />
Speldorf Bahnhof zu empfehlen.<br />
Wer auf urbanes Flair steht, der fotografiert am<br />
besten die Linie U18 hinter der Haltestelle Savignystraße<br />
– hier verkehren die Bahnen inmitten<br />
der A40. Beim Umsteigen am Essener Hauptbahnhof<br />
unbedingt die blau beleuchtete Tunnelstation<br />
aufnehmen.<br />
Ein Motivklassiker findet sich an der Haltestelle<br />
Kapitelwiese in Essen. Im Sommer lassen sich die<br />
M8C der Linie 107 hier am besten am Nachmittag<br />
vor der Kulisse des Förderturms der Zeche Zollverein<br />
festhalten.<br />
In Bochum bietet die Tunnelhaltestelle Lohring<br />
an der 302/310 mit ihrer Beleuchtung ein spannendes<br />
Umfeld. <strong>Von</strong> hier aus verkehrt auch die<br />
310 nach <strong>Witten</strong>. Typischen Ruhrpott-Überlandcharakter<br />
hat die Strecke noch zwischen Am Honnengraben<br />
und Crengeldanz. Als Motiv eignet sich<br />
außerdem je nach Blickrichtung ganztägig der Bereich<br />
hinter der Bahnhofsstraße in <strong>Witten</strong>. Hier<br />
rollt die 310 eingleisig inmitten einer Kopfsteinpflasterstraße<br />
einen leichten Hügel hinauf.<br />
CHRISTIAN LÜCKER<br />
führt einen der vier vorhandenen „Bistro“-<br />
Wagen mit sich. Während der Fahrt genießen<br />
wir einen Kaffee und kleine Happen.<br />
Leider ist es nur ein Rest früherer Speisewagenherrlichkeit.<br />
Doch ist die U76 damit immer<br />
noch etwas Besonderes.<br />
Unser massiver Normalspur-Stadtbahnzug<br />
fährt zusammen mit den zierlicheren<br />
SWK-Meterspurfahrzeugen auf einem Vierschienengleis<br />
den Ostwall hinunter. Vor<br />
dem wuchtigen Sandsteingebäude des <strong>Krefeld</strong>er<br />
Hauptbahnhofs biegt er nach links<br />
ab. Ab Dießem liegen die Gleise schnellbahnartig<br />
auf eigenem Bahnkörper.<br />
Noch einmal begegnet unsere in Spitzenzeiten<br />
durch die Linie U70 verstärkte U76<br />
der <strong>Krefeld</strong>er Straßenbahn: In der Umsteigehaltestelle<br />
Grundend am östlichen Ortsrand<br />
des Stadtteils Fischeln sehen wir wieder<br />
unsere Linie 041, die dort ihre andere<br />
Endstation hat. In der Regel gewinnt die<br />
U76 das Wettrennen.<br />
Wir fahren nun recht flott auf Meerbusch<br />
zu. Vor der Zwischenendstelle Görgesheide<br />
mit ihrem mittigen Wendegleis wird zunächst<br />
die Autobahn A44 unterfahren sowie<br />
nach der Haltestelle die Eisenbahnstrecke<br />
<strong>Krefeld</strong> – Neuss auf einer Brücke<br />
überquert. Eine weitere Zwischenendstelle<br />
ist die Station „Haus Meer“, wo <strong>bis</strong> Ende<br />
der 1950er-Jahre die Fernlinie „M“ der<br />
Rheinbahn in Richtung Moers abzweigte –<br />
die Stadt ist heute, wie manch andere im<br />
Rhein-Ruhr-Gebiet, völlig straßenbahnfrei.<br />
Das dichte Netzgeflecht im Revier der<br />
1950er-Jahre ist passé – doch freuen wir<br />
uns, dass wir immer noch eine vergleichsweise<br />
vielfältige und ausgedehnte Straßenbahnlandschaft<br />
genießen dürfen.<br />
Nachdem wir mit Büderich den nächsten<br />
Meerbuscher Stadtteil passiert haben, befinden<br />
wir uns auf Düsseldorfer Stadtgebiet.<br />
Vor der Endstelle Lörick der U74 geht die<br />
Fahrt vorbei an den früheren Stahlwerken.<br />
Danach fährt die Bahn in der Mitte der<br />
20 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Ruhrgebiet<br />
Meterspur trifft Normalspur: <strong>Krefeld</strong>er Flexity neben normalspurigem B80 der Rheinbahn an der viergleisigen Haltestelle <strong>Krefeld</strong> Ostwall, die in<br />
Kürze umfangreich modernisiert werden wird. Hier geht es von der 041 in die U76<br />
M. PABST<br />
Ein B80-Doppel auf der U76 in <strong>Krefeld</strong>-Grundend – hier befindet sich<br />
auch die südliche Endschleife der Meterspurlinie 041 M. KOCHEMS<br />
Fast wie bei der „großen“ Eisenbahn: Auf der U76 ist der Reisende<br />
zwischen <strong>Krefeld</strong> und Düsseldorf im „Bistro-Wagen“ König RHEINBAHN<br />
Hansaallee auf eigenem Bahnkörper in<br />
Richtung Oberkassel. Links biegt an der<br />
Prinzenallee die vor einigen Jahren neugebaute<br />
Strecke zum Bürogebiet Am Seestern<br />
ab, einige hundert Meter weiter befindet<br />
sich rechts die Hauptverwaltung der Düsseldorfer<br />
Rheinbahn.<br />
Noch mit formschönen GT8SU<br />
In Düsseldorf-Oberkassel ist der Belsenplatz<br />
der zentrale Verknüpfungspunkt aller linksrheinischen<br />
Stadtbahnlinien sowie mehrerer<br />
Buslinien. Der Platz wird dominiert durch<br />
das alte Bahnhofsgebäude von 1900.<br />
Nun gilt es eine fahrzeugtechnische Attraktion<br />
zu würdigen: Aus Neuss kommend,<br />
biegen am Belsenplatz die ältesten im<br />
Planbetrieb eingesetzten Schienenfahrzeuge<br />
der Rheinbahn ein. Denn die U75 wird<br />
noch weitgehend mit den formschönen<br />
GT8SU aus den 1970er-Jahren betreiben.<br />
Nun werden sie noch einmal aufgearbeitet<br />
und verlieren dabei ihre rot/weiße Farbgebung<br />
mit dem charakteristischen roten<br />
„Schnauzbart“ an der Front.<br />
Bei der Fahrt entlang der Luegallee genießen<br />
wir die zahlreichen schönen Häuser aus<br />
der Gründerzeit. Auf der mächtigen Oberkasseler<br />
Brücke überqueren wir den Rhein<br />
und vergessen nicht, auf der rechten Seite<br />
einen Blick auf die markante Ansicht der<br />
Düsseldorfer Altstadt mit Schlossturm und<br />
St. Lambertus zu werfen. Auf der jenseitigen<br />
Brückenrampe halten wir am Inselbahnsteig<br />
der Station Tonhalle – ein eindrucksvolles<br />
Bauwerk im Hintergrund –, dann fahren<br />
wir über eine langgezogene Rampe in den<br />
Tunnel. Kurz darauf rollt der Stadtbahnzug<br />
in die viergleisige Anlage des Bahnhofs<br />
Heinrich-Heine-Allee ein, wo wir umsteigen<br />
werden.<br />
Mit der U79 nach Duisburg<br />
Hier hat die U76 Anschluss an die U79, die<br />
frühere Fernlinie „D“ nach Duisburg. Auch<br />
diese Verbindung wird mit Doppeltraktionen<br />
aus B-Wagen bedient, doch kommen<br />
hier sowohl Düsseldorfer Fahrzeuge der<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
21
Betriebe<br />
Dynamische Haltestellenanzeigen in Echtzeit<br />
sorgen für eine gute Information RHEINBAHN<br />
Nachschlag gefällig?<br />
Die „Tour de Ruhr” lässt sich durch diverse Umwege<br />
noch erweitern, ohne dass man von der<br />
eigentlichen Route abkommt. Wer mit der U79<br />
von Düsseldorf kommend <strong>bis</strong> zur Endstelle Meiderich<br />
Bahnhof statt nur <strong>bis</strong> zum Hauptbahnhof<br />
fährt, der rauscht auf einer fast fünfminütigen<br />
Fahrt ohne Halt durch den Ruhr-Tunnel unter<br />
dem Duisburger Hafen. <strong>Von</strong> Meiderich aus geht<br />
es weiter mit der 903 Richtung Dinslaken. An<br />
der Haltestelle Marxloh, Pollmann ist umsteigen<br />
in die 901 nach Mülheim angesagt. Auf der<br />
Fahrt dorthin streift die Linie u. a. die gigantischen<br />
Industrieanlagen von Duisburg-Bruckhausen<br />
und den Hafen in Höhe Ruhrort. Wer das<br />
Revier von seiner schmuddeligen Seite kennen<br />
lernen will, sollte sich diesen Umweg „gönnen“.<br />
Alternativ zur Fahrt mit der U18 geht es von<br />
der Mülheimer Stadtmitte aus mit der 104 in<br />
Richtung Essen und am Abzweig Aktienstraße<br />
mit der 105 weiter zum Essener Hauptbahnhof.<br />
Auch hier ist ein weiterer Schlenker möglich:<br />
Statt der 107 bringt uns die U11 nach Gelsenkirchen<br />
und zwar in den Stadtteil Horst. <strong>Von</strong> dort<br />
geht es weiter mit der Linie 301 nach Gelsenkirchen-Buer<br />
Rathaus und ab da mit der Linie 302<br />
an der Arena „auf Schalke” vorbei über Gelsenkirchen<br />
Hbf Richtung Bochum.<br />
CHLÜ<br />
Rheinbahn wie auch Fahrzeuge der dortigen<br />
Duisburger Verkehrsgesellschaft zum<br />
Einsatz. Man muss schon genau hinschauen:<br />
Ob Rheinbahn oder DVG – im rot/weißen<br />
Stadtbahn-Look sind sie alle gehalten.<br />
Der Bahnsteig ist gedrängelt voll. Viele Reisende<br />
verkürzen sich ihre Wartezeit mit einem<br />
Blick auf die großen Multimediatafeln<br />
an den Wänden, wo sich Werbungen und<br />
Cartoons abwechseln.<br />
Tunnel, Hochbahn, Geisterbahnhof<br />
Nach zwei U-Bahnhöfen kommt unser<br />
DVG-Wagen der U79 wieder ans Tageslicht<br />
und führt zunächst in Straßenmitte durch<br />
die Stadtteile Golzheim und Stockum. Am<br />
Reeser Platz lag früher nicht nur eine Wendeschleife,<br />
sondern hier begann seit 1937<br />
auch ein viergleisiger Abschnitt, in dem die<br />
Strecken nach Kaiserswerth und Duisburg<br />
bzw. zum Stadion und Messe jeweils zwei<br />
Gleise besaßen. Heute ist mit zwei Gleisen<br />
Bescheidenheit eingekehrt. Am Freiligrathplatz<br />
verzweigen sie sich in zwei Richtungen,<br />
nachdem vorher der Nordpark und der<br />
„Aquazoo“ passiert wurden. Links sind bereits<br />
die Hallen der Düsseldorfer Messe und<br />
der große Klotz der „Esprit-Arena“ zu erkennen,<br />
wo die Fortuna 2012/13 nach langer<br />
Zeit wieder eine Saison in der ersten<br />
Fußball-Bundesliga spielen durfte. Rechts<br />
liegt das große Areal des Düsseldorfer Flughafens,<br />
das <strong>bis</strong> zum Bau der B8N von der<br />
Bahn aus eingesehen werden konnte.<br />
Die U79 fährt nun schnellbahnmäßig auf<br />
eigenem Bahnkörper durch Kaiserswerth,<br />
Wittlaer und vorbei an einer Haltestelle mit<br />
dem schönen Namen Froschenteich.<br />
Nun haben wir Duisburger Gebiet erreicht.<br />
Die Linie wird zur gesichtlosen<br />
Hochbahn, wir durchfahren Stationen in<br />
dunklen Betonhallen mit vielen uneinsehbaren<br />
Ecken – und nahe der erst vor einigen<br />
Jahren neu gebauten Station St.-Anna-<br />
Krankenhaus in Duisburg-Huckingen sogar<br />
einen nie genutzten und halb verfallenenen<br />
Geisterbahnhof! Hier hat sich der Stadtbahnwahn<br />
der frühen 1970er-Jahre ausgetobt.<br />
Diese Bauweise hat die Unterhaltungskosten<br />
in die Höhe getrieben und führt<br />
inzwischen zu Diskussionen, ob mittelfristig<br />
verschiedene Stadtbahnlinien im Ruhrgebiet<br />
eingestellt werden müssen – darunter auch<br />
diese –, weil das Geld für bald unausweichliche<br />
Sanierungsmaßnahmen fehlt.<br />
Wenige Minuten später befinden wir uns<br />
wieder im Straßenplanum: Mittig fährt die<br />
Bahn auf eigenem Bahnkörper in der Düsseldorfer<br />
Straße. Mehrere Eisenbahnstrecken<br />
werden mit Unterführungen gekreuzt.<br />
Auf der rechten Seite sehen wir den Betriebshof<br />
Grunewald der DVG an der<br />
gleichnamigen Haltestelle. Viel Abwechslung<br />
gibt es hier nicht: für die Stadtbahn<br />
sechsachsige B80-Wagen, für die Straßenbahn<br />
zehnachsige GT10NC-DU.<br />
An der Haltestelle Platanenhof fahren wir<br />
in den Duisburger Stadtbahntunnel ein.<br />
Charakteristisch für die Duisburger Tunnelstationen<br />
ist die Unterteilung in einen hohen<br />
Bahnsteig für die U79 und einen niedrigen<br />
Bahnsteig für die Straßenbahnlinien 901<br />
und 903. Für die Fahrgäste bedeutet dies,<br />
fleißig Treppen zu steigen.<br />
B80 und »Baby-B80«<br />
Am Duisburger Hauptbahnhof verlassen<br />
wir die U79 und wechseln zur 901 in Richtung<br />
Mülheim an der Ruhr. Wir besteigen<br />
einen der vierteiligen, zehnachsigen<br />
GT10NC-DU der DVG, die in den 1990er-<br />
Jahren ein zusätzliches niederfluriges Wagenteil<br />
erhielten. Wegen ihrer schmäleren<br />
Bauweise und der durchaus vorhandenen<br />
22 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Ruhrgebiet<br />
An der Haltestelle Düsseldorf Tonhalle<br />
begegnen wir noch einem nicht<br />
modernisierten GT8SU-Gespann in<br />
ursprünglicher Lackierung auf Linie<br />
U75 Richtung Neuss Hbf M. PABST<br />
Ähnlichkeit in der Formgebung tragen die<br />
Fahrzeuge den Spitznamen „Baby-B80“.<br />
Auch wenn sie kein Ausbund an Schönheit<br />
sind, so sind sie immerhin eine Rarität: Zehnachser<br />
gibt es bei Straßenbahnen selten.<br />
Nach dem Halt am Hauptbahnhof fahren<br />
wir wieder an die Oberfläche. An der Station<br />
Zoo/Uni sehen wir rechts das charakteristische<br />
Universitätsgebäude, links den Eingang<br />
zum bekannten Duisburger Zoo. Hier<br />
befindet sich auch noch eine Wendeanlage,<br />
da jede zweite Fahrt der 901 hier endet. Unser<br />
Kurs fährt glücklicherweise weiter. Auf<br />
der Fahrt im Zuge der Mülheimer Straße<br />
überqueren wir die Autobahn A3 und fahren<br />
durch viel Wald. Bald ist Mülheim erreicht<br />
und die Straßenbahn windet sich<br />
durch den Stadtteil Speldorf.<br />
Vierschienig unter der Ruhr<br />
Rechts steht vor dem alten Straßenbahndepot,<br />
in dem sich heute ein Einkaufszentrum<br />
befindet, der rot/weiße Mülheimer Zweiachser<br />
Nr. 811 als Denkmal. Eigentlich ist<br />
es ein Stuttgarter Wagen, der hier nur kurze<br />
Zeit aushalf. Ein Stück weiter sehen wir auf<br />
der anderen Seite das heutige Depot der<br />
Mülheimer Verkehrsgesellschaft MVG. Es<br />
befindet sich auf dem Gelände eines früheren<br />
Eisenbahn-Ausbesserungswerkes.<br />
Wir lassen die vom Depot kommende Betriebsstrecke<br />
einfädeln und fahren zur Abwechslung<br />
wieder in einen Tunnel, wo sich<br />
die 901 einen vierschienigen Abschnitt mit<br />
der meterspurigen MVG-Linie 102 teilt. <strong>Von</strong><br />
der Ruhr sehen wir ebenso wenig wie von der<br />
Mülheimer Innenstadt: Der Fluss und die Station<br />
Stadtmitte werden unterirdisch passiert.<br />
Am Mülheimer Hauptbahnhof steigen wir<br />
am unterirdischen Endpunkt der 901 in die<br />
Stadtbahnlinie U18 um. Hier weht europäisches<br />
Flair, denn die Essener Verkehrs AG<br />
Stadtbahn zwischen Wiesen und Feldern bei Düsseldorf-Wittlaer – diese B80-Doppeltraktion<br />
auf der U79 wird vom DVG-Triebwagen 4707 geführt M. KOCHEMS (2)<br />
Ein bulliger B-Wagen würde sich im eher beschaulichen Mülheim-Speldorf weniger gut machen.<br />
Dann lieber ein GT10NCDU, der wegen seiner Form auch „Baby-B“ genannt wird C. LÜCKER<br />
Briten im Ruhrpott: Ehemalige Docklands-Triebwagen 5239+5229 der EVAG in Essen, Wickenburgstraße<br />
entlang des Ruhrschnellwegs auf der U18 von Mülheim nach Essen. Diese Verbindung<br />
wurde einst als „Modellstrecke der Stadtbahn Rhein/Ruhr“ entworfen und gebaut<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
23
Betriebe<br />
Nur während der Sperrung der Autobahn A40 sind solche Aufnahmen der Linie U18 von der Fahrbahn aus erlaubt und möglich! Christian Lücker<br />
nutzte am 5. August 2012 so eine Gelegenheit im Bereich der Haltestelle Savignystraße<br />
An der U-Station Essen-Rathaus steigen wir in den meterspurigen<br />
Stadtbahnwagen 1162 Typ M8C der EVAG um M. KOCHEMS (2)<br />
Die Rampen an der Station Essen-Rathaus zeigen, dass die Bahnhöfe<br />
ursprünglich für Hochflurbetrieb konzipiert waren<br />
setzt nicht nur die allseits bekannten B-Wagen,<br />
sondern auch ehemalige Triebwagen der<br />
Londoner „Docklands Light Railway“ ein.<br />
Ihren Weg haben die kantigen Fahrzeuge der<br />
Typen P86/P89 freilich im niedersächsischen<br />
Salzgitter im Linke-Hofmann-Busch-Werk<br />
begonnen. Nun wird es auch bunt: Das<br />
Duisburger Einheits-Rot/Weiß wird in Essen<br />
und Mülheim von einem Sammelsurium verschiedener<br />
Farbschemata abgelöst. Beide Betriebe<br />
setzen Wagen im ursprünglichen<br />
Rot/Weiß und im „Stadtlinie“-Farbschema<br />
(Weiß/Lichtgrau mit orangen und roten Zierstreifen)<br />
ein. Die jüngsten Essener Wagen<br />
sind leuchtend gelb mit blauen Absetzungen,<br />
die Mülheimer ebenfalls gelb, aber mit<br />
schwarzen und weißen Zierstreifen lackiert.<br />
Die frischen Farbtupfer machen sich gut im<br />
Revier, insbesondere wenn die Häuser schon<br />
länger auf den Maler gewartet haben.<br />
Über die A40 in die »Blaue Grotte«<br />
Die U18 fährt im Tunnel Richtung Osten,<br />
<strong>bis</strong> es an der Station „Heißen, Kirche“ wieder<br />
an die Oberfläche geht. Über eine Rampe<br />
und einen Einschnitt wird die Trasse in<br />
die Mitte der Autobahn A40 eingefädelt.<br />
Links und rechts rauschen Autos und Lastwagen<br />
vorbei, so dass es auch innerhalb der<br />
Triebwagen unangenehm laut ist.<br />
Auf der rechten Seite sehen wir das Einkaufscenter<br />
„Rhein-Ruhr Zentrum“, direkt<br />
daneben die Hauptwerkstatt der EVAG an<br />
der Schweriner Straße. Die Stationen in der<br />
Mitte der Autobahn sind durchweg moderne,<br />
überdachte Stadtbahnhaltestellen mit<br />
Hochbahnsteigen. Teilweise stehen die<br />
Wohnhäuser rechts und links dicht entlang<br />
der Autobahn.<br />
Stadtbahn und Autos haben sich so gut<br />
aneinander gewöhnt, dass sie nach der Haltestelle<br />
„Savignystraße/ETEC“ gemeinsam<br />
in einen Tunnel eintauchen, der das Essener<br />
Stadtzentrum unterquert. Doch auch im<br />
Untergrund gibt es Sehenswürdigkeiten –<br />
24 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Ruhrgebiet<br />
„UNESCO-Weltkulturerbe Zollverein“ und M8DNF-Niederflurwagen der EVAG 1532 in Essen, Kapitelwiese, auf der „Kulturlinie“ 107. Die Niederflurwagen<br />
verkehren nur als Verstärkerzüge zwischen Essen Hbf und Abzweig Katernberg<br />
M. KOCHEMS<br />
die berühmte „Blaue Grotte“, sprich der<br />
wegen seiner gewöhnungsbedürftigen bläulich<br />
Beleuchtung so genannte „Essen<br />
Hauptbahnhof“. Hier wechseln wir abermals<br />
die Spurweite: Mit einem meterspurigen<br />
EVAG-Triebwagen der Linie 107 geht<br />
es weiter nach Gelsenkirchen, und der Reviergeruch<br />
wird merklich stärker.<br />
»Kulturlinie« auf Meterspur<br />
Die Linie 107 firmiert als „Kulturlinie“, passiert<br />
sie doch auf ihrem langen Linienweg<br />
von Bredeney im Essener Süden <strong>bis</strong> Gelsenkirchen<br />
zahlreiche Denkmäler. Neben einer<br />
eigenen Homepage tragen auch diverse<br />
Triebwagen entsprechende Werbungen. Der<br />
M8C der EVAG hält zwar am niedrigen<br />
Bahnsteig, besitzt jedoch Klappstufen.<br />
Grund dafür sind die Tunnelstationen zwischen<br />
Hauptbahnhof und Florastraße, wo<br />
sich die Linien 101 und 107 nach Bredeney<br />
die Strecke und die Hochbahnsteige mit der<br />
U11 zur Gruga/Messe teilen müssen.<br />
Die folgende U-Bahn-Station „Rathaus<br />
Essen“ beeindruckt durch vier Bahnsteiggleise<br />
an niedrigen Bahnsteigen, so dass<br />
nicht nur in die M-Wagen, sondern auch in<br />
die jüngeren Niederflurwagen bequem eingestiegen<br />
werden kann. Offensichtlich war<br />
beim Bau eine spätere Umgestaltung auf<br />
Hochbahnsteige vorgesehen, denn die Treppen<br />
zur Oberfläche enden auf den Bahnsteigen<br />
auf etwa 50 Zentimeter hohen Podesten,<br />
zu denen dann wieder Rampen hinauf<br />
führen. Diese Station passieren alle Essener<br />
Straßenbahnlinien.<br />
Nach der nächsten Station kommt die Strecke<br />
wieder ans Tageslicht. „Am Freistein“<br />
trennt sich die 107 von der Linie 106 und<br />
führt in Straßenmitte Richtung Nordosten<br />
in Richtung Katernberg. Schnell wird die<br />
Bebauung lockerer, die Häuser kleiner. An<br />
Auf »Tour de Ruhr« im Klassiker?<br />
Wer einen Teil der „Tour de Ruhr“ authentisch in<br />
längst nicht mehr planmäßig eingesetzten „Klassikern“<br />
erfahren möchte, der hat regelmäßig auf<br />
dem Linienweg der 107 zwischen Essen Hauptbahnhof<br />
bzw. Klinikum und Gelsenkirchen Hauptbahnhof<br />
die Möglichkeit dazu.<br />
Die Verkehrshistorischen Arbeitsgemeinschaften<br />
der EVAG und der BOGESTRA bieten von Mai <strong>bis</strong><br />
Oktober an jedem ersten Samstag im Monat Fahrten<br />
„auf Linie“ mit ihren Museumswagen auf dieser<br />
Strecke an.<br />
der Station Kapitelwiese erkennen wir das<br />
imposante „UNESCO Weltkulturerbe Zollverein“.<br />
Die alte Zechenanlage dominiert<br />
<strong>bis</strong> zur nächsten, gleichnamigen Haltestelle<br />
den Blick aus dem linken Fenster. Der Straßenbahnfan<br />
freut sich am Abzweig Katern-<br />
Im 30- bzw. 60-Minuten-Takt kommen die Wagen<br />
u. a. an der Zeche Zollverein vorbei. Zum Einsatz<br />
gelangen nach Verfügbarkeit zum Beispiel der<br />
Essener GT8-ZR 1753 oder der Essener Aufbau-<br />
Zweiachser 888 sowie teilweise auch Museumswagen<br />
der Nachbarbetriebe, wie der Mülheimer<br />
GT6 259 oder der Bochumer KSW 96. Die Mitfahrt<br />
ist mit allen im VRR gültigen Tickets ohne Aufpreis<br />
möglich.<br />
Alle Termine und Infos gibt es auf www.vhagevag.de<br />
bzw. www.vhag-bogestra.de. CHLÜ<br />
Der Düwag-Aufbauwagen<br />
Nr. 888, der<br />
zwischen 1949<br />
und 1974 regulär<br />
in Essen fuhr,<br />
im Rahmen der<br />
planmäßigen<br />
Museumsfahrten<br />
„Auf Linie” vor dem<br />
Förderturm der<br />
Zeche Zollverein<br />
M. BEITELSMANN<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
25
Betriebe<br />
Die drei Bogestra-Triebwagen M6C 349, MGT6D 414 und M6S 310 in Bochum-Laer. Im Hintergrund sieht man bereits die nächste Haltestelle:<br />
Opel Werk 1. Deren Bezeichnung wird nach der Werksschließung im Jahr 2014 überdacht werden müssen M. KOCHEMS, F. FREDENBAUM (RECHTS UNTEN)<br />
berg über eine kleine Wendeschleife, in der<br />
die Verstärkerkurse der 107 enden.<br />
Nach der S-Bahn-Station „Zollverein<br />
Nord“ hält der Triebwagen am Katernberger<br />
Markt. Hier gilt die evangelische Kirche<br />
als Sehenswürdigkeit der „Kulturlinie“. Ein<br />
Stück danach entdecken wir an der Hanielstraße<br />
eine weitere Wendeschleife, in der<br />
jede zweite Bahn der Linie 107 im Normaltakt<br />
werktags endet. Die Häuserblockumfahrung<br />
lässt hier typisches Ruhrpott-Flair<br />
aus vergangenen Tagen aufkommen.<br />
Die 107 passiert in der Folge die Stadtgrenze<br />
von Essen nach Gelsenkirchen. Auf der linken<br />
Seite entdecken wir an der gleichnamigen<br />
Haltestelle die umfangreichen Anlagen der<br />
Gelsenkirchener Trabrennbahn. Nun wird<br />
die Bebauung langsam wieder dichter und<br />
wir nähern uns dem Stadtzentrum.<br />
Mit der 302 durch den Pott<br />
Kurz vor der gleichnamigen Haltestelle sehen<br />
wir links das wuchtige Musiktheater.<br />
Hier ist auch unsere Umsteigestelle zum<br />
nächsten Reiseabschnitt, den wir mit der Linie<br />
302 der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen<br />
(Bogestra) zurücklegen werden.<br />
Wir steigen in einen Düwag-Niederflurwagen<br />
der ersten Generation aus den 1990er-<br />
Jahren ein. Der Wagen mit seiner blauen<br />
Vollwerbung für die „Knappen“ (für Nicht-<br />
Fußballfans: „FC Schalke 04“) ist bereits<br />
sehr voll.<br />
Die Gleise führen nun wieder abwärts,<br />
und die Gelsenkirchener Innenstadt wird<br />
inklusive der Station Hauptbahnhof im<br />
Tunnel unterquert. Nur kurze Zeit später<br />
kommt die Trasse an der Station<br />
Rhein elbestraße wieder an die Oberfläche<br />
und führt nun in Richtung des Stadtteils<br />
Wattenscheid.<br />
Fahrzeugvielfalt<br />
wie sonst nirgends!<br />
Während das Straßenbahnnetz an Rhein und<br />
Ruhr in den vergangenen Jahrzehnten deutlich<br />
geschrumpft ist, ist die Fahrzeugvielfalt groß geblieben.<br />
Vor 30 Jahren wären wir auf der Tour de<br />
Ruhr überwiegend mit klassischen Düwag-Wagen<br />
verschiedenster Ausführungen gefahren – etwa<br />
mit den GT6 in <strong>Krefeld</strong>, den GT8 in Düsseldorf<br />
oder den Zweirichtungs-GT6 in Bochum.<br />
Heute reicht die Spanne vom Flexity Outlook-<br />
Niederflurwagen in <strong>Krefeld</strong>, über die verschiedenen<br />
B-und M-Wagen-Versionen, <strong>bis</strong> hin zu den<br />
MGT6D und Variobahnen in Gelsenkirchen bzw.<br />
Bochum. Außerdem begegnen uns zwei in dieser<br />
Form einmalige Wagentypen: Die GT10NC-DU in<br />
Duisburg und die Dockland-Wagen in Essen.<br />
CHLÜ<br />
Über Wattenscheid nach Bochum<br />
Nun sind wir wieder mitten im „Pott“ –<br />
links und rechts der Strecke ist viel alter<br />
„Ruhrbarock“ zu bewundern. Auch finden<br />
sich bemerkenswerte Gegensätze zwischen<br />
Alt und Neu. So fährt die Bahn stadtbahnmäßig<br />
auf eigenem Bahnkörper inmitten einer<br />
modernen, vierspurigen Straße, doch an<br />
den Seiten stehen typische, alte Zechenhäuser<br />
und auf der linken Seite die noch erhaltenen<br />
Gebäude der früheren Zeche „Holland“.<br />
Dem noch recht modern wirkenden<br />
Niederflurwagen merkt man sein Alter von<br />
immerhin schon beinahe 20 Jahren auch an<br />
– und seine Konstruktion: Sobald die Gleislage<br />
etwas schlechter ist, rumpelt das Einzelrad-Einzelachsfahrwerk<br />
(EEF) unter uns<br />
sehr vernehmlich.<br />
Nachdem wir das enge Ortszentrum von<br />
Wattenscheid mit seinen vielen leerstehenden<br />
Läden passiert haben, ist die Umgebung<br />
der Strecke wieder deutlich grüner und lockerer<br />
bebaut. Es ist ein Irrglaube, dass das<br />
Ruhrgebiet eine einzige Stein- und Betonwüste<br />
mit endlosen Straßen und Gebäudekomplexen<br />
ist.<br />
Wenig später ist die Kreuzung mit der im<br />
Ausbau auf sechsspurigen Betrieb befindlichen<br />
Autobahn A40 erreicht, während unweit<br />
Getreidefelder zu sehen sind. Ein Stück<br />
weiter sehen wir links für einen kurzen Moment<br />
die Bochumer Jahrhunderthalle.<br />
Futuristische U-Bahnhöfe<br />
An der nächsten Ecke vereinigt sich die 302<br />
mit der aus Höntrop kommenden Linie<br />
310, der letzten Stammstrecke der M6-<br />
Triebwagen der Bogestra. Gemeinsam führen<br />
beide Linien nun schnell ins Bochumer<br />
Stadtzentrum. Wieder werden wir um einen<br />
Blick betrogen: Seit 2006 fährt die Bahn<br />
26 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Ruhrgebiet<br />
Die Heilig-Kreuz-Kirche in Gelsenkirchen-Ückendorf aus dem Jahr 1929 beeindruckt durch ihre Backstein-Architektur in „neuer Sachlichkeit“ und<br />
prägt hier das historische Stadtbild. Nur der moderne Niederflur-Tw 419 und die geparkten Pkw deuten auf das Jahr 2013 hin ... M. BEITELSMANN<br />
Der Tunnelbahnhof Bochum Rathaus (Süd) fasziniert mit farblich wechselnden Lichtelementen<br />
und einer verglasten unterirdischen Straßenbahnbrücke (rechts oben), auf der die Linie 306 kreuzt<br />
auch im Herz dieser Stadt unterirdisch –<br />
verkehrspolitisch umstritten. Die architektonisch<br />
Gestaltung der futuristisch anmutenden<br />
U-Bahnhöfe Rathaus (mit bunten<br />
Lichtspielen und unterirdischer Brücke der<br />
Linie 306) und Lohring (mit beleuchtetem<br />
Glasboden und Klangspielen) ist freilich herausragend.<br />
Südöstlich des Hauptbahnhofs kommt<br />
die Trasse in der <strong>Witten</strong>er Straße wieder ans<br />
Tageslicht und führt nun auf den Stadtteil<br />
Laer zu. Auf eigenem Bahnkörper inmitten<br />
einer vierspurigen Schnellstraße passieren<br />
wir den Komplex eines Möbelhauses, wäh-<br />
rend auf der rechten Seite bereits die ersten<br />
Anlagen des Bochumer Opel-Werkes sichtbar<br />
sind.<br />
Wir erreichen nun „Laer Mitte“, zugleich<br />
der Endpunkt der 302. Die Station ist nicht<br />
gerade romantisch: Der Wagen wendet in<br />
einem mittigen Stumpfgleis hinter dem Inselbahnsteig,<br />
der nur über eine Fußgängerbrücke<br />
über die Straße zugänglich ist.<br />
Da die 302 hier endet, steigen wir in die<br />
bereits erwähnte Linie 310 in Richtung <strong>Witten</strong><br />
um. Irgendwie wirken die recht kleinen<br />
M-Wagen auf der weit geschwungenen Strecke,<br />
vorbei am Ansatz zur Autobahn A44<br />
und unter der A43 hindurch, fast ein wenig<br />
fehl am Platz. Immerhin kann auf diesem<br />
Stück die konstruktive Höchstgeschwindigkeit<br />
von 70 km/h annähernd ausgefahren<br />
werden, was die Fahrzeuge jedoch meist mit<br />
einigen Wacklern und Hopsern quittieren.<br />
Die Bebauung wird nun immer spärlicher:<br />
Viele Bäume, Büsche und Wiesen beherrschen<br />
den Blick zu beiden Seiten.<br />
Eingleisige Überlandatmosphäre<br />
Nun nähern wir uns einem Höhepunkt unserer<br />
Reise: Auf dem Endstück der 310 nach<br />
<strong>Witten</strong> und Heven kann man noch klassische<br />
Überlandatmosphäre pur erleben – eingleisige<br />
Streckenstücke entlang von Straßen, Feldern<br />
und kleinen Ortschaften, mit Haken und Kurven.<br />
Was anderswo längst verschwunden ist,<br />
ist hier noch stellenweise erlebbar.<br />
An der Kreuzung <strong>Witten</strong>er Straße/Universitätsstraße<br />
wird die 310 künftig geradeaus<br />
auf einer Neubaustrecke via Langendreer<br />
<strong>Witten</strong> erreichen. Noch biegt die Strecke<br />
nach rechts in die Universitätsstraße ab.<br />
Hier beginnt ein größtenteils eingleisiges<br />
Teilstück, das beim Bau der Autobahn A44<br />
vor vielen Jahren als Provisorium entstanden<br />
war, jedoch <strong>bis</strong> heute erhalten geblieben<br />
ist. Die Zeit scheint tatsächlich stehen geblieben<br />
zu sein. Das Gleis liegt neben der<br />
Straße, die Masten sind schon recht alt und<br />
die Umgebung ist grün.<br />
Nachdem die Autobahn auf einer modernen<br />
Brücke überquert wurde, ist die in einem<br />
kurzen zweigleisigen Stück liegende Halte-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
27
Betriebe<br />
Halt mal!<br />
Neben kulturellen Lecker<strong>bis</strong>sen wie der Tonhalle in Düsseldorf,<br />
der Zeche Zollverein in Essen oder der Jahrhunderthalle<br />
in Bochum, gibt es entlang der Strecke auch einige kulinarische<br />
Lecker <strong>bis</strong>sen: Die Pizzeria San Michele, Rheinstraße<br />
88 in <strong>Krefeld</strong>, Haltestelle Rheinstraße.<br />
Oder: Essen in einem der ältesten Häuser Duisburgs bei<br />
„Duisburgs Lindenwirtin“, Mül heimer Straße 203 nahe der<br />
Haltestelle Zoo/Uni der Linie 901. Und Kult-Currywurst, angeblich<br />
die Beste im ganzen Revier, gibt es beim „Profi-Grill“<br />
in Bochum-Wattenscheid, Bochumer Straße 96, Haltestelle<br />
Centrumplatz der Linie 302. Guten Appetit!<br />
CLÜ<br />
In <strong>Witten</strong> wechselt sich städtisches Ruhrgebietsflair mit dörflichem Ambiente ab. Tw 312 hat soeben die Haltestelle Sprockhöveler Straße verlassen<br />
und steuert die nächste Ausweiche nahe der Haltestelle Hans-Böckler-Straße an, wo der Gegenzug schon wartet<br />
An der Stumpfendstelle <strong>Witten</strong>-Heven Dorf findet die Linie 310 ein abruptes Ende – und damit<br />
auch unsere „Tour de Ruhr“per Straßen- und Stadtbahn M. KOCHEMS (2)<br />
stelle „Am Honnengraben“ die planmäßige<br />
und auch einzig mögliche Kreuzungsstelle.<br />
Durch waldiges Umfeld fahren wir um einen<br />
Hügel herum und durch eine im Gefälle liegende<br />
S-Kurve zur ebenfalls häufig fotografierten<br />
Station Papenholz. Entlang von Feldern<br />
erreichen wir nun das Stadtgebiet von<br />
<strong>Witten</strong>.<br />
Das Straßenbahngleis führt nun in die Bochumer<br />
Straße und läuft weiter in Seitenlage<br />
<strong>bis</strong> nach Crengeldanz, wo es kurz vor der<br />
Unterführung unter der Eisenbahnstrecke<br />
wieder in die Straßenmitte wechselt und<br />
zweigleisig wird.<br />
Zum Endpunkt <strong>Witten</strong>-Heven<br />
Hatte das letzte Stück durch seine landschaftliche<br />
Umgebung beeindruckt, fährt<br />
die 310 nun eher nüchtern in die Stadt hinein.<br />
Etwas Abwechslung bietet der zweigleisige<br />
Abschnitt durch die Fußgängerzone<br />
<strong>bis</strong> zur Eisenbahnunterführung unweit des<br />
<strong>Witten</strong>er Bahnhofs. Danach wird die Strecke<br />
wieder eingleisig und führt über eine<br />
Kopfsteinpflasterstraße, vorbei an einem<br />
großen Stahlwerk und typischen Ruhrgebiets-Häusern,<br />
zur nächsten Ausweiche in<br />
der Hans-Böckler-Straße, wo der Gegenzug<br />
bereits wartet. Eingleisig geht es wieder weiter<br />
durch den Stadtteil Heven, bald seitlich<br />
neben der Straße und ansteigend. Eine weitere<br />
Ausweiche befindet sich an der Haltestelle<br />
Hellweg.<br />
Nun haben wir noch ein kurzes Stück <strong>bis</strong><br />
zur Endstation, das die Bahn abseits der<br />
Straßen auf einer Trasse quasi durch die<br />
Gärten zurücklegt. Die Strecke fällt wieder<br />
deutlich ab. Viele der Häuser zeigen das typisch<br />
niederbergische Aussehen mit Fachwerk<br />
oder Schieferverkleidungen.<br />
Unvermutet endet unsere Reise an der<br />
Stumpfendstelle „Heven Dorf“ – ohne Umsetzmöglichkeit<br />
an einem kurzen Bahnsteig.<br />
Unsere Vermutung bestätigt sich bei späterer<br />
Lektüre: Die Strecke wurde hier mutwillig<br />
gekappt. Die Nachbargemeinde Herbede<br />
wollte keine Straßenbahn mehr, daher endet<br />
die Bahn nun einfach an der Ortsgrenze.<br />
Leider können wir nicht mehr – wie früher<br />
– mit der Straßenbahn von Bochum<br />
nach Dortmund weiterfahren. Daher endet<br />
unsere Fahrt von West nach Ost nach einem<br />
halben Tag am grünen südlichen Rand des<br />
Ruhrgebietes. In acht Straßen- und Stadtbahnwagen<br />
von fünf Betrieben haben wir<br />
106 Kilometer zurückgelegt. Schöner kann<br />
Reisen kaum sein – zumindest für Tramfreunde.<br />
MICHAEL KOCHEMS<br />
28 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Nächster Halt: …<br />
Am 5. Mai 2013 hat der Tw 654 die Haltestelle Wiesenhügel erreicht. Die Linie 6 ist derzeit jedoch nur baustellenbedingt auf den Wiesenhügel<br />
zurückgekehrt. Dessen Name leitet sich nicht vom Wort „Wiese“, sondern vom Nachnamen eines früheren Flurstückbesitzers ab R. GLEMBOTZKY<br />
Nächster Halt:<br />
Wiesenhügel<br />
Zwischen 1985 und 1988 entstand im Südosten<br />
von Erfurt das Wohngebiet Wiesen -<br />
hügel als typisches DDR-Plattenbaugebiet.<br />
Mit seiner Lage am östlichen Ende der Nordkante<br />
des Steigers – einer Hochfläche mit<br />
ausgedehntem Waldgebietes – bietet es dem<br />
Betrachter entlang seiner Nordkante einen<br />
grandiosen Blick über die Landeshauptstadt<br />
und bei klarer Sicht <strong>bis</strong> weit ins Thüringer<br />
Becken hinein.<br />
Seit dem 7. Juni 1985 wird der kleine<br />
Stadtteil von der Straßenbahn in Form eines<br />
Abzweigs von der erst wenige Jahre zuvor<br />
nach Melchendorf verlängerten Strecke<br />
(Linie 3) erschlossen. Neben der Endstelle<br />
Wiesenhügel (mit doppelgleisiger Wendeschleife)<br />
wird noch die im unteren Wohngebietsteil<br />
gelegene Haltestelle Färberwaidweg<br />
bedient (<strong>bis</strong> 1990 „Straße der Sportler“).<br />
Vor der Netzumstellung am 5. Oktober<br />
2007 verkehrte die Linie 6 zum Wiesenhügel,<br />
die erste Straßenbahnlinie, die in Erfurt von<br />
Anfang an ausschließlich mit KT4D betrieben<br />
wurde. Seit 2007 wird der Ast durch die<br />
Linie 4 bedient, womit an Schultagen wieder<br />
einzelne Kurse als Großzüge verkehren (inzwischen<br />
ausschließlich in Form von Niederflurwagen).<br />
Allerdings ist dieses Kapazitätsangebot<br />
eher der Nachfrage auf dem<br />
Nordwestabschnitt der Linie 4 mit seinen<br />
Bildungseinrichtungen geschuldet.<br />
Vorübergehend kehrte die Linie 6 Mitte<br />
März dieses Jahres in Folge der baustellenbedingten<br />
Netzumstellung für gut acht Monate<br />
auf ihren alten südlichen Linienweg<br />
zurück (siehe SM 6/13, Seite 16).<br />
Das Gebiet auf der Anhöhe über Melchendorf<br />
(1938 nach Erfurt eingemeindet) war<br />
früher eher unter der Bezeichnung „Melm“<br />
bekannt. Lediglich ein kleines Flurstück trug<br />
auf einer Karte von 1845 die Bezeichnung<br />
„Wiesers Hügel“; die Herkunft dieses Namens<br />
leitet sich von einem früheren Besitzer<br />
dieses Flurstücks ab.<br />
Der einst für 12.000 Bewohner geplante<br />
Stadtteil hatte 1990 noch knapp 10.000 Einwohner.<br />
Diese Zahl reduzierte sich jedoch<br />
<strong>bis</strong> 2012 nochmals um fast die Hälfte, was<br />
mit dem üblichen „Stadtumbau“ einherging.<br />
SEBASTIAN PASCHINSKY<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
29
Betriebe<br />
Triebwagen 867 (Bj. 1929, MAN/SSW, 1952 neu aufgebaut) und Beiwagen 1116 verlassen am 5. Mai 2013 auf der Burgringlinie 15 ihren Halteplatz<br />
am Plärrer. Dort befand sich einst der alte Ludwigsbahnhof<br />
U. ROCKELMANN<br />
Vom Burgring ins Depot<br />
Nürnberg: Historisches Straßenbahndepot St. Peterwieder geöffnet Seit Anfang Mai 2013<br />
können wieder museale Straßenbahnwagen besichtigt werden. Zudem nimmt die Burgringlinie 15<br />
ihren Weg nun wieder über die im Linienbetrieb nicht mehr befahrene Pirckheimerstraße<br />
Nach Abschluss von Sanierungsarbeiten<br />
hat das historische Straßenbahndepot<br />
St. Peter in Nürnberg<br />
seit dem ersten Maiwochenende<br />
wieder für Besucher geöffnet. Vor allem am<br />
Hallenboden waren umfangreiche Maßnahmen<br />
ausgeführt worden – so wurden die<br />
Gruben verfüllt und z.B. sämtliche Hallengleise<br />
erneuert. Das etwa einem Kilometer<br />
südöstlich vom Nürnberger Hauptbahnhof<br />
gelegene Werk wurde <strong>bis</strong> 1974 von der<br />
VAG betrieblich genutzt und beherbergt<br />
heute mit allein 23 historischen Straßenbahnwagen<br />
eine der größten Fahrzeug-<br />
Blick in das wiedereröffnete Depot St. Peter<br />
der Nürnberger VAG – in den Monaten zuvor<br />
waren u. a. die maroden Untersuchungsgruben<br />
verfüllt worden, anschließend entstand<br />
in der Halle ein neuer Fußboden A. NEUER<br />
30 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Nürnberg<br />
Vor dem Historischen Straßenbahndepot St. Peter in Nürnberg drängten sich am ersten Maiwochenende viele Besucher, um die historischen<br />
Wagen zu bestaunen. Seit dem 4. Mai können sie hier wieder regelmäßig jedes erste Wochenende im Monat besichtigt werden TH. NAUMANN<br />
Öffnungszeiten & Kontakt<br />
Das Historische Straßenbahndepot St. Peter<br />
öffnet jeweils am ersten Wochenende im<br />
Monat von 10 <strong>bis</strong> 17.30 Uhr (letzter Einlass<br />
17 Uhr) seine Pforten. Während der Öffnungszeiten<br />
fährt die historische Burgringlinie 15<br />
entlang der Nürnberger Altstadt.<br />
Infos im Internet:: www.vag.de/Museum oder<br />
www. strassenbahnfreunde-nuernberg.de.<br />
Erreichbar ist das Museum mit den Straßenbahnlinien<br />
6 sowie mit der Buslinie 36,<br />
Haltestelle Peterskirche.<br />
Historisches Straßenbahndepot St. Peter<br />
Schlossstraße 1<br />
90478 Nürnberg<br />
Telefon: (09 11) 2 83 46 54<br />
sammlungen in Deutschland. Die historischen<br />
Fahrzeuge der Nürnberger Straßenbahn<br />
sind nicht zuletzt deswegen so bekannt<br />
und beliebt, weil viele nicht nur als<br />
stumme Zeugen der Vergangenheit im Museum<br />
stehen, sondern regelmäßig im Stadtbild<br />
lebendig präsent sind.<br />
Die Burgringlinie 15 und<br />
die »Stadtführungs-Linie« 13<br />
Am jeweils ersten Wochenende im Monat<br />
werden sie auf der Linie 15, dem historischen<br />
„Burgring“, planmäßig eingesetzt.<br />
Aktuell werden an der Kreuzung Bucher-/<br />
Pirckheimerstraße zwei Weichen und eine<br />
Kreuzung erneuert, der „Burgring“ wird somit<br />
auch weiter auf seiner angestammten<br />
Route durch die Pirkheimerstraße verkehren<br />
können. Planmäßig fahren seit Einstellung<br />
der Linie 9 seit Ende 2011 hier keine<br />
Der 1935 von MAN/SSW gebaute Tw 876 fährt am 5. Mai auf der Burgring-Linie 15 die Haltestelle<br />
Aufseßplatz an. Das Fahrzeug präsentiert sich in seiner ursprünglichen Lackierung TH. NAUMANN<br />
Straßenbahnen mehr. Die erkennbar große<br />
Wertschätzung, die der Straßenbahn aber<br />
nun seitens des amtierenden VAG-Vorstandes<br />
entgegen gebracht wird, lässt keine<br />
Zweifel mehr an einer gedeihlichen Zukunft<br />
des „Burgrings“.<br />
<strong>Von</strong> Mai <strong>bis</strong> September wird jeden Montag<br />
unter dem Liniensignal 13 ab Hauptbahnhof<br />
eine Stadtführung auf Schienen<br />
angeboten, in deren Rahmen man auch<br />
über den einzigartigen Friedhof St. Johannis<br />
spazieren und eine Altstadtführung zu Fuß<br />
erleben kann. Für diese Touren kommt in<br />
der Regel der sechsachsige MAN-Gelenkzug<br />
305 zum Einsatz – manchmal verstärkt<br />
durch den vierachsigen Beiwagen 1556. Beide<br />
Fahrzeuge zählen zum Depotbestand in<br />
St. Peter. Wem das alles noch nicht genügt,<br />
der darf sich auch 2013 wieder auf die vorweihnachtlichen<br />
„Glühweinfahrten“ rund<br />
um die Altstadt freuen oder kann die betriebsfähigen<br />
Fahrzeuge auch nach Belieben<br />
für eigene Sonderfahrten mieten. Alle Fahrten<br />
mit historischen Wagen im Netz sind<br />
Angebote der VAG, werden aber vom Verein<br />
betreut.<br />
THOMAS NAUMANN<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
31
Betriebe<br />
Im Leoliner nach<br />
Knautkleeberg<br />
32 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Leipzig<br />
LINKS Über die Haltestelle<br />
Goerdelerring<br />
gab es einst eine<br />
Fußgängerbrücke.<br />
Als der von Tw 2109<br />
geführte Großzug<br />
am 15. Februar 2013<br />
in Richtung Knautkleeberg<br />
aufbrach,<br />
war diese längst<br />
Geschichte<br />
RECHTS Der Tw 1101<br />
wartete am 5. März<br />
2013 an der Endstelle<br />
in Taucha auf<br />
die Abfahrt in<br />
Richtung Leipzig.<br />
Er ist der einzige<br />
NGT8, der für den<br />
Beiwagenbetrieb<br />
hergerichtet wurde<br />
ALLE FOTOS: T. LAAKE<br />
Leipzigs Linie 3 im Porträt Mit der Netzreform 2001 entstand in der Messestadt eine neue<br />
Linie 3. <strong>Von</strong> der nordöstlich Leipzigs gelegenen Kleinstadt Taucha führt sie zum Leipziger Hauptbahnhof<br />
und von dort weiter nach Südenwesten – westlich der neu entstandenen Seenlandschaft<br />
Die etwas vom Ortskern entfernte<br />
Endstellenschleife in Taucha befindet<br />
sich „An der Bürgerruhe“, womit<br />
ein kleiner Park gemeint ist.<br />
An der Einstiegshaltestelle steht heute meist<br />
eines der zahlreich eingesetzten Leolinerpärchen<br />
bereit, Tatrawagen sind deutlich in<br />
der Unterzahl. Die heutige Linie 3 entstand<br />
mit der Liniennetzreform im Jahr 2001 und<br />
löste die hier verkehrende Linie 13 ab.<br />
Abfahrtszeit: Das Signal der eingleisigen<br />
Strecke springt auf frei. Neben der Leipziger<br />
Straße eilen wir auf eigenem Gleiskörper<br />
nun in Richtung Leipzig. Wir fahren vorbei<br />
an den Ausläufern der Kleinstadt und<br />
durchfahren die idyllische Ausweichstelle<br />
Freiligrathstraße. Nach der Haltestelle passieren<br />
wir eine Lagerhalle, vor der ein abgeklemmtes<br />
Anschlussgleis liegt; eines der<br />
letzten Zeugnisse des Straßenbahngüterverkehrs<br />
in Leipzig.<br />
Teils eingleisig <strong>bis</strong> zur A14<br />
Nun weicht die Wohnbebauung dem Gewerbe.<br />
An der Otto-Schmidt-Straße wartet<br />
bereits der Gegenzug, danach befahren wir<br />
den vorerst letzten eingleisigen Abschnitt.<br />
Das Ortsausgangsschild von Taucha liegt<br />
hinter uns, die Strecke wird zweigleisig.<br />
Jetzt unterqueren wir die A 14 und erreichen<br />
Leipziger Stadtgebiet. An der Portitzer<br />
Allee mündet die Strecke der Linie 3E aus<br />
Sommerfeld in die Tauchaer Strecke. Rings<br />
um die Torgauer Straße ist auf dem Gelände<br />
der ehemaligen Sowjetkasernen nunmehr<br />
An der Stadtgrenze von Leipzig an der Torgauer Straße grüßt ganz in der Nähe der Autobahnabfahrt<br />
Taucha die Besucher Leipzigs das Wappentier der Stadt: ein steinerner Löwe<br />
Kleingewerbe zu finden. Hinter der Bahnstrecke<br />
nach Eilenburg rechts liegt die<br />
Hauptwerkstatt Heiterblick der LVB. Die<br />
Einfahrt an der Teslastraße zeigt das rege<br />
Baugeschehen im Zusammenhang mit dem<br />
Neubau des Technischen Zentrums Heiterblick.<br />
Gegenüber hat ein großer Internetversandhändler<br />
seinen Sitz.<br />
Schnurgerade Strecke und freie Ampeln<br />
ermöglichen die Fahrt mit Höchstgeschwin -<br />
digkeit. Nach dem Arcus-Park erklimmt die<br />
Straßenbahn die Brücke über die Eisenbahn<br />
anlagen von Schönefeld, um auf der<br />
Rampe die Hohentichelnstraße zu kreuzen<br />
und die gleichnamige Haltestelle zu bedienen.<br />
Für ganz besonderen „Nahverkehr“<br />
sorgt hier das „Haus am Wasserturm“.<br />
Rasant geht es von der Brücke wieder<br />
hin ab, mit etwas Glück steht auf der rechten<br />
Seite vor einer der Hallen ein Münchner<br />
Niederflurwagen auf dem Tieflader. Hier<br />
hat die IFTEC eine Außenstelle zur Modernisierung<br />
der Münchner Fahrzeuge.<br />
Am Rande des Neubaugebiets Schönefeld<br />
Ost vorbei wird die Gegend wieder zunehmend<br />
städtischer; wir erreichen die Permoserstraße.<br />
Hinter der Kreuzung wechselt die<br />
Strecke wieder in Straßenmitte. Nun geht es<br />
am Volksgarten Leipzig vorbei und unter<br />
den seit Ende 2012 stillgelegten Eisenbahn-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
33
Betriebe<br />
Plan der Linie 3 Taucha – Knautkleeberg.<br />
An der Haltestelle Portitzer Allee zweigt der<br />
Streckenast nach Sommerfeldt ab, den<br />
die Kurse mit dem Liniensignal 3E nehmen<br />
GRAFIK: M. JUNGE<br />
Die Linie 3 wird von Leolinern geprägt, die<br />
von der HeiterBlick GmbH geliefert wurden<br />
Daten & Fakten: Linie 3<br />
In Leipzig-Neuschönefeld befindet sich die Haltestelle Einertstraße. Aus<br />
der Innenstadt kommend setzt Tw 1341 seine Fahrt nach Taucha fort<br />
Linienlänge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 km<br />
Spurweite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.458 mm<br />
Anzahl Haltestellen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />
Fahrzeit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Minuten<br />
Takt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Minuten<br />
zwischen Portitzer Allee und Knautkleeberg<br />
alle 10 Minuten<br />
Tarif:. . . . . . Einzelfahrkarte 2,80 € (zwei Zonen)<br />
Tageskarte: . . . . . . . . . . . . . 7,00 € (zwei Zonen)<br />
Fahrzeugeinsatz: . . . . . . . . . . . . . 2 x NGTW6-L,<br />
T4DM-Großzüge mit NB4,<br />
NGT8 mit NB4<br />
am Wochenende auch T4DM-NB4 und NGT8<br />
gleisen vom Hauptbahnhof nach Stötteritz<br />
hindurch.<br />
Wieder geht es bergan, damit auf einer<br />
Brücke die Eisenbahnstrecken nach Dresden<br />
und Chemnitz überquert werden können.<br />
Am Ende des Gefälles liegt der Straßenbahnknoten<br />
Torgauer Platz. Wir biegen nun<br />
nach rechts in die Eisenbahnstraße ein. Jetzt<br />
sind wir mitten in der Stadt – es dominieren<br />
hohe Häuser und eine enge Bebauung. An<br />
der Kreuzung mit der Hermann-Liebmann-<br />
Straße kommt von rechts das Straßenbahngleis<br />
aus Schönefeld hinzu, <strong>bis</strong> 2001 Bestandteil<br />
der letzten Tangentiallinie Leipzigs.<br />
Durch die Eisenbahnstraße<br />
zum Hauptbahnhof<br />
Die Gegend hier ist nicht gerade ein Aushängeschild<br />
der Stadt. Im Verlauf der Straße<br />
finden sich jede Menge leerstehende und<br />
verwahrloste Häuser. Doch Abseits der von<br />
internationalem Flair durchdrungenen Eisenbahnstraße<br />
sieht es besser aus. Links zeigt<br />
sich der Stadtteilpark Rabet. Wir erreichen<br />
den Friedrich-List-Platz. Vor uns erhebt sich<br />
schon das 107 Meter hohe Wintergartenhochhaus.<br />
Nach der Hofmeisterstraße<br />
kommt noch ein letzter Häuserblock und<br />
schon öffnet sich vor uns das Leipziger Zentrum:<br />
Links der Augustusplatz mit Gewandhaus,<br />
Uni-Riesen, Oper und Schwanenteich<br />
– vor uns der Hauptbahnhof, in dessen stets<br />
belebte, viergleisige Haltestellenanlage wir<br />
einfahren. Hier treffen fast alle Straßenbahnlinien<br />
aufeinander. Nach einem kurzen<br />
Aufenthalt geht es weiter zum Goerdelerring,<br />
Eine Doppeltraktion Tatra-T4DM am 2. Februar<br />
2013 in der Eisenbahnstraße<br />
Die Haltestellenanlage vor dem Leipziger Hauptbahnhof ist auch für die Linie 3 der wichtigste<br />
Zwischenstopp. Am 15. Februar 2013 verlässt sie ein Leoliner-Pärchen in Richtung Taucha<br />
34 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Leipzig<br />
Kurz vor dem Einsatzende der Leipziger Tatra T6A2 entstand im Mai<br />
2007 diese Aufnahme in der Höhe des Leipziger Sportforums<br />
In Plagwitz erreicht ein von Tw 2187 geführter Großzug die Haltestelle<br />
Felsenkeller; seit Taucha liegen zwei Drittel der Strecke hinter ihm<br />
der Blick schweift rechts zum ehemaligen<br />
Hotel Astoria. Das Leipziger Zentrum, seit<br />
1965 straßenbahnfrei, streifen wir nur am<br />
Nordrand. Linkerhand erstreckt sich das<br />
neueste Einkaufszentrum der Stadt, gegen<br />
das die reformierte Kirche rechts mit ihrem<br />
73 Meter hohen Turm dagegen geradezu<br />
winzig wirkt. In das neue Center integriert<br />
wurden auch die Reste der „Blechbüchse“,<br />
dem 1968 größten Kaufhaus der DDR mit<br />
einer markanten Aluminiumfassade.<br />
Vom Innenstadtring<br />
zum Sportzentrum<br />
Mit der Querung der Kreuzung am Goerdelerring<br />
verlassen wir den Innenstadtring<br />
schon wieder in Richtung Westen. Die neu<br />
errichtete Angermühlbrücke überspannt den<br />
2006 wieder ans Tageslicht geholten Elstermühlgraben,<br />
der uns im Ranstädter Steinweg<br />
begleitet und an der Haltestelle Leibnizstraße<br />
wieder unter Tage verschwindet.<br />
Nun beginnt die enge Jahnallee, eines der<br />
Nadelöhre Leipzigs, die Tram muss wieder<br />
in Straßenmittellage fahren. Wir erreichen<br />
den Waldplatz, an dem nach rechts die Strecke<br />
in das Rosental abzweigt. Die Linie 3<br />
hält jedoch an der komplett neugestalteten<br />
Haltestelle Waldplatz/Arena, wo es insbesondere<br />
bei Veranstaltungen regelmäßig zu<br />
einem großen Fahrgastansturm kommt. Seit<br />
2006 geht es nach dem Verlassen der Haltestelle<br />
rasant bergab, ganz kurz wird es<br />
dunkel und schon geht es wieder bergauf<br />
und wir erreichen die Haltestelle am Sportforum<br />
– dem sportlichen Zentrum Leipzigs.<br />
<strong>Von</strong> Nahem grüßt das Hauptgebäude mit<br />
Glockenturm des alten Zentralstadions,<br />
welches bei Errichtung 1956 nahezu<br />
100.000 Besuchern Platz bot.<br />
Ab ins Grüne!<br />
Nun schweift der Blick beim Befahren der<br />
Zeppelinbrücke nach links und rechts über<br />
das Elsterbecken und zum Palmengarten,<br />
der zum „grünen Band“ der Stadt Leipzig<br />
Nicht nur am Wasserwerk Windorf<br />
führt die Linie 3 durch viel Natur.<br />
So ist am 7. Mai 2011 ein vom<br />
Tw 1349 geführtes Leoliner-Pärchen<br />
hier „im Grünen“ unterwegs<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
35
Betriebe<br />
Der Bahnhof Leipzig-Knauthain ist zum Knotenpunkt zwischen Straßenbahn, Eisenbahn und Bus<br />
geworden und bietet Pendlern mit dem P & R-Parkplatz eine Alternative zum Auto<br />
Reisetipp für Leipzig 2013<br />
Der Oktober 2013 steht in Leipzig und der Region<br />
ganz im Zeichen des Gedenkens, Feierns und<br />
Erlebens. Im Herbst 1813 markierte die Völkerschlacht<br />
vor den Toren der Stadt den entscheidenden<br />
Wendepunkt der Befreiungskriege gegen<br />
die napoleonischen Truppen. 100 Jahre später<br />
wurde das Völkerschlachtdenkmal eingeweiht.<br />
Die nahe gelegene russisch-orthodoxe St.-Alexij-<br />
Gedächtniskirche (erbaut 1913) erinnert an die<br />
rund 22.000 russischen Gefallenen in dieser<br />
Schlacht. Anlässlich des Doppeljubiläums 2013<br />
kommen Bürger, Wissenschaftler, geistliche und<br />
politische Würdenträger aus ganz Europa in Leipzig<br />
zusammen, um gemeinsam zurück und nach<br />
gehört. In zügiger Fahrt wird nun der Straßenbahnhof<br />
Angerbrücke erreicht, der 1925<br />
eröffnet und von 2001 <strong>bis</strong> 2005 umfangreich<br />
modernisiert wurde. Auch einige Kurse<br />
der Linie 3 haben hier ihre Heimat.<br />
Unser Leoliner biegt nun nach links in die<br />
Zschochersche Straße ein und passiert an der<br />
Ecke zur Dreilindenstraße das Operettentheater<br />
„Drei Linden“. Auch durch die Dreilindenstraße<br />
fuhr dereinst die Straßenbahn.<br />
Nach wenigen Augenblicken erreichen<br />
wir den Stadtteil Plagwitz und an einer belebten<br />
Kreuzung die Haltestelle Felsenkeller,<br />
deren Name von einem Ballhaus stammt.<br />
Das markante Gebäude mit Kuppel dient<br />
heute nur noch Ausstellungszwecken. Nach<br />
der Abfahrt kreuzen wir die Strecke der Linie<br />
14 und fahren nun geradeaus, Industrieruinen<br />
und Neubauten wechseln sich mit<br />
Gründerzeithäusern ab. Auch ein Blick in<br />
die Seitenstraßen lohnt sich! Plagwitz ist auf<br />
dem besten Wege, ein Szenestadtteil zu werden,<br />
bietet es doch viele unterschiedliche Facetten<br />
auf kleinstem Raum.<br />
Unsere Bahn überquert derweil den Karl-<br />
Heine-Kanal, an dessen Ufer entlang es sich<br />
vortrefflich Rad fahren und spazieren lässt.<br />
Erwähnenswert ist auch das Stelzenhaus,<br />
ein architektonisches Denkmal, welches<br />
heute Ateliers und ein Restaurant beherbergt.<br />
Früher gab es unmittelbar nach der<br />
Brücke die Plagwitzer Anschlussbahn; heute<br />
künden Radwege vom einst umfangreichen<br />
Gleisnetz.<br />
Der Blick nach links fällt zwischen Baumkronen<br />
auf die typischen roten Backstein-<br />
Vor der Haltestelle<br />
Seumestraße passiert<br />
am 2. März 2013 ein<br />
T4DM mit einem NB4<br />
ein altes Gehöft, hinter<br />
dem eine ehemalige<br />
Sandgrube liegt<br />
36
Leipzig<br />
vorn zu blicken. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist<br />
eine Gedenkwoche im Oktober 2013, deren<br />
Strahlkraft im Geiste der Völkerverständigung<br />
weit über die Grenzen Leipzigs wirken soll, so die<br />
Veranstalter.<br />
Aber auch in den Monaten zuvor gibt es zahlreiche<br />
Ausstellungen, Vorlesungen und andere attraktive<br />
Termine – siehe www.voelkerschlacht-jubilaeum.de.<br />
Wie wäre es, den Besuch einer – oder mehrerer<br />
– solcher Veranstaltungen mit der ganzen<br />
Familie mit eine ausgiebigen Straßenbahnrundfahrt<br />
zu verknüpfen? Das Netz der LVB ist immer<br />
eine Reise wert! PM/AM Das alte Gleisdreieck in Knautkleeberg am 14. Juli 2009. Der Fahrer rüstet in der Gleitsmannstraße<br />
den Heckfahrstand des NB4 auf, um in die Haltestelle in der Dieskaustraße zu gelangen<br />
fassaden der ehemaligen Buntgarnwerke<br />
Leipzig, die heute Deutschlands größtes Industriedenkmal<br />
sind.<br />
Auf Großverbundplatten schaukelt unser<br />
Wagen jetzt weiter nach Süden, hin zur<br />
Kreuzung mit der Limburgerstraße. Hier<br />
ereignete sich am 24. Februar 1995 das<br />
größte „Schlammassel“ der Stadt: Bei der<br />
Sprengung eines Schornsteins an der Limburger<br />
straße kippte dieser nach vorn und<br />
fiel genau in die davor liegende Schlammgrube<br />
…<br />
Die Haltestelle Adler ist erreicht, wo die<br />
Linien 1 und 2 und die Buslinie 60 auf die<br />
Linie 3 treffen. Entsprechend groß ist auch<br />
der Fahrgastandrang an der Haltestelle. Bis<br />
1972 kreuzte hier auch noch der Obus die<br />
Straßenbahngleise.<br />
Durch Kleinzschocher<br />
Wir verlassen Plagwitz und fahren geradeaus<br />
in die Dieskaustraße. Auf einer Freifläche<br />
an der Straßenecke Windorfer Straße<br />
befand sich <strong>bis</strong> 1994 der Namensgeber der<br />
Haltestelle und der Kreuzung, der Gasthof<br />
„Zum goldenen Adler“. Weiter geht die<br />
Fahrt durch Kleinzschocher. Zwischen den<br />
hohen Gebäuden befinden sich etliche zweigeschossige<br />
kleine Wohnhäuser, die zum<br />
Teil noch aus dem 18. Jahrhundert stammen.<br />
Wir halten kurz an der Haltestelle<br />
Kötzschauer Straße, hinter der sich die<br />
Blockumfahrung der Wendeschleife Kleinzschocher<br />
anschließt. Auf der rechten Seite<br />
sehen wir die Hallen des <strong>bis</strong> 1959 in Betrieb<br />
befindlichen Straßenbahnhofs Kleinzscho-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
37
Betriebe<br />
LINKS Eine Störung<br />
am 8. Juni 2007<br />
machte die Kurzfahrt<br />
des Großzuges<br />
<strong>bis</strong> Kleinzschocher<br />
nötig. Die schon verriegelte<br />
Weiche<br />
muss der Fahrer unter<br />
großer Kraftanstrengung<br />
von Hand<br />
stellen<br />
UNTEN Am Endpunkt<br />
in Knautkleeberg<br />
haben die Fahrer<br />
Zeit, ggf. Streusand<br />
nachzufüllen. Dazu<br />
ist am Bahnsteig ein<br />
stets gut gefüllter<br />
Vorratsbehälter aufgestellt<br />
cher (siehe SM 7/12). Gegenüber befindet<br />
sich die Leipziger Radrennbahn, die im<br />
Volksmund oft einfach nur kurz als Alfred-<br />
Rosch-Kampfbahn bezeichnet wird und mit<br />
einer Länge von 400 Metern die längste ihrer<br />
Art in Deutschland ist.<br />
Nun unterqueren wir die Eisenbahngleise<br />
der so genannten „Waldbahn“ von Plagwitz<br />
nach Gaschwitz und biegen nach zwei weiteren<br />
Halten an der kleinen Apostelkirche<br />
langsam in die Huttenstraße ein, wo die<br />
gleichnamige Haltestelle bedient wird. Hier<br />
besteht Anschluss an die Linie 65 nach<br />
Markkleeberg und zum Cospudener See, einem<br />
beliebten Ausflugsziel im Süden der<br />
Stadt.<br />
Weblinks<br />
Leipziger Auenwald und Palmengarten:<br />
www.leipzig.de/stadtwald<br />
Leipziger Kleinmesse am Cottaweg:<br />
www.leipziger-kleinmesse.net<br />
Forsthaus Knautkleeberg und Restaurant<br />
Dimitris:<br />
www.forsthaus-knautkleeberg.de<br />
Vergnügungspark Belantis: www.belantis.de<br />
Dem Endpunkt entgegen<br />
Wir setzen die Fahrt fort und biegen am<br />
Ende der Straße nach einem kleinen Gegenbogen<br />
scharf nach links ab und erreichen<br />
die Haltestelle Gerhardt-Ellrodt-Straße, an<br />
der sich auch eine Zwischenwendeschleife<br />
befindet, die <strong>bis</strong> 2010 von der Linie 3E bedient<br />
wurde. Auf eigenem Trassee geht es<br />
nun durch viel Grün, die Strecke ist von<br />
Bäumen gesäumt. Am Wasserwerk Windorf<br />
ist eine kleine Pause notwendig, denn wir<br />
müssen an der Haltestelle erst den kreuzenden<br />
Gegenzug aus der eingleisigen Strecke<br />
abwarten. Unvermittelt empfängt uns schon<br />
dörflicher Charakter. Ein kurzer Gruß des<br />
Fahrers vom Gegenzug, und das Signal zeigt<br />
Fahrt.<br />
Auf der linken Seite taucht hinter einer<br />
Streuobstwiese die Dieskaustraße wieder<br />
auf, die uns <strong>bis</strong> zur Endstelle begleitet. Bis<br />
vor wenigen Jahren standen hier am Straßenrand<br />
noch viele alte Pappelbäume und<br />
auch wenn diese einem Radweg weichen<br />
mussten, spricht man hier von der Pappelallee.<br />
Ausgangspunkt für Entdeckungen<br />
Knautkleeberg und Knauthain – das kleine<br />
Ortseingangsschild zeigt es an – die „Dörfer<br />
hinter den Pappeln“ sind erreicht. Den<br />
Ortseingang markiert ein großes saniertes<br />
Eckhaus zur Seumestraße, in dessen Erdgeschoss<br />
ein Restaurant zum Essen und Verweilen<br />
einlädt – mit Freisitz und Blick zur<br />
Straßenbahn.<br />
Die Haltestelle Seumestraße ist als Ausweiche<br />
angelegt. Durch eine Ampelanlage<br />
gesichert fahren wir wieder auf die Dieskaustraße.<br />
Die Stadtrandlage ist deutlich erkennbar,<br />
vornehmlich Einfamilienhäuser<br />
stehen an der Hauptstraße. Unser Wagen<br />
legt die letzten Meter <strong>bis</strong> zur Endstelle<br />
durch den Ortskern des Stadtteils zurück,<br />
unterbrochen nur von zwei weiteren Halten.<br />
Kurz nachdem rechts das Empfangsgebäude<br />
des Bahnhofs Knauthain zu sehen ist,<br />
endet unsere Fahrt in der 2010 neu angelegten<br />
Schleifenanlage Knautkleeberg, die<br />
das letzte planmäßig genutzte Wendedreieck<br />
der Leipziger Straßenbahn ersetzte. Der<br />
Bahnhof liegt auf Knautkleeberger Flur, der<br />
Name Knauthain wurde einst von den Rittergutsbesitzern<br />
erkauft.<br />
Wer Lust hat, kann von hier aus den<br />
Süden Leipzigs weiter erkunden. Der Cospudener<br />
See ist fußläufig erreichbar, die<br />
Buslinie 118 stellt die Verbindung zum Vergnügungspark<br />
Belantis her. Auch Knauthain<br />
selbst bietet einige kleine Sehenswürdigkeiten,<br />
wie den Schlosspark und das Knauthainer<br />
Schloss.<br />
MARTIN JUNGE/TONY LAAKE<br />
38 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Filme für Ihr Hobby.<br />
Riesenauswahl für echte Fans.<br />
NEU!<br />
www.geramond.de<br />
Historischer Nahverkehr in Berlin: Diese DVD zeigt klassische S-Bahnen und U-Bahn-<br />
Züge ebenso wie nostalgische Straßenbahnen und Omnibusse im Einsatz.<br />
2013 DVD: Best.-Nr. 45932<br />
ca. 55 Min. € 19,99<br />
Eine sehenswerte DVD von Ton<br />
Pruissen: Erleben Sie die Vielfalt des<br />
Tram-Betriebs in der DDR der 60erund<br />
70er- Jahre: Oldtimer zwischen<br />
Ostsee und Erzgebirge.<br />
1966 – 1978 · ca. 50 Min.<br />
DVD: Best.-Nr. 31544<br />
€ 9,99<br />
Einmal mitten durch die Hansestadt<br />
Hamburg: Eine Führerstandsmitfahrt<br />
von Wedel über Blankenese, den<br />
Hauptbahnhof und Ohlsdorf nach<br />
Poppenbüttel.<br />
2007 · ca. 75 Min.<br />
DVD: Best.-Nr. 31650<br />
€ 9,95<br />
Die ganze Vielfalt des Schienenverkehrs<br />
in Berlin: Straßen-, U- und S-Bahnen<br />
prägen das Bild der Großstadt ebenso<br />
wie der Regional- und Fernverkehr.<br />
2012 · ca. 50 Min.<br />
DVD: Best.-Nr. 45917<br />
€ 19,95<br />
Eine besondere Doppel-DVD: Zwei<br />
Mitfahrten von Potsdam nach Erkner,<br />
aufgenommen in den Jahren 1993<br />
und 2011, verdeutlichen alle Veränderungen.<br />
2011 · ca. 180 Min.<br />
DVD: Best.-Nr. 45928<br />
€ 24,95<br />
Diese DVD zeigt Gegenwart und Vergangenheit<br />
der Münchner Tram. Aktuelle<br />
Fahrzeugtypen sind ebenso zu sehen wie<br />
Veteranen aus der »guten, alten Zeit«.<br />
2010 · ca. 60 Min.<br />
DVD: Best.-Nr. 31670<br />
€ 19,95<br />
Das Beste von der Berliner S-Bahn:<br />
Auf dem Führerstand unterwegs<br />
zwischen Wartenberg und Berlin-<br />
Spandau – mit Fahrt über die<br />
berühmte Stadtbahn!<br />
2005 · ca. 70 Min.<br />
DVD: Best.-Nr. 31619<br />
€ 19,95<br />
DVD-Preise: € 9,95 = [A] 9,95 · sFr. 15,90; € 19,95 = [A] 19,95 · sFr. 29,90; € 19,99 = [A] 19,99 · sFr. 29,90;€ 24,95 = [A] 24,95 · sFr. 36,90<br />
** 14 Ct/Min. a.d. deutschen Festnetz * innerhalb Deutschlands versandkostenfrei ab Bestellwert von € 15,–<br />
✃<br />
✗<br />
JA, ich bestelle versandkostenfrei * folgende Filme:<br />
Vorname/Nachname<br />
Straße/Hausnummer<br />
PLZ/Ort<br />
Anzahl Titel Best.-Nr. Preis<br />
Wa.-Nr: 6200080096<br />
Telefon / E-Mail (für Rückfragen und weitere Infos)<br />
✗<br />
Datum/Unterschrift<br />
Bitte informieren Sie mich künftig gern per E-Mail, Telefon<br />
❑ oder Post über Neuigkeiten und Angebote (bitte ankreuzen).<br />
www.geramond.de GeraMond Leserservice, Postfach 1280<br />
82197 Gilching<br />
Telefon 0180-532 16 17** Fax 0180-532 16 20**
Betriebe<br />
Kurz vor der Talstation<br />
kommt die Bergbahn<br />
aus dem dichten<br />
Wald heraus und<br />
durchquert auf einer<br />
aufgeständerten<br />
Trasse eine Wiese<br />
Per Bergbahn nach Taläcker<br />
Die Künzelsauer Bergbahn Seit Oktober 1999 verbindet eine neu gebaute Bergbahn als<br />
innerstäd tisches Verkehrsmittel den Ortskern von Künzelsau mit dem Neubaugebiet Taläcker. Seit<br />
mehreren Jahren ist aber auch ein Anschluss an das Karlsruher Stadtbahnnetz geplant<br />
Künzelsau – die idyllische Kreisstadt<br />
des Ho henlohekreises – zählt rund<br />
15.000 Einwohner und liegt im Tal<br />
des Kochers etwa 38 Kilometer<br />
nordwestlich von Heilbronn. Trotz der geringen<br />
Einwohnerzahl gibt es für Freunde<br />
innerstädtischer Schienenbahnen seit dem<br />
3. Oktober 1999 einen guten Grund, Künzelsau<br />
zu besuchen. An diesem Tag nahm<br />
nämlich die Bergbahn Künzelsau, eine moderne<br />
Standseilbahn, ihren Betrieb auf. Ungleich<br />
der meisten anderen Standseilbahnen<br />
hierzulande verbindet die Künzelsauer Bergbahn<br />
aber nicht die Stadt mit einem höher<br />
gelegenen Naherholungsgebiet, sondern<br />
dient in erster Linie dem städtischen Verkehr.<br />
Deshalb wurde die Bahn ihren Bewohnern<br />
beim Bau gar als Stadtbahn angekündigt.<br />
Schnell zum Neubaugebiet Taläcker<br />
Die Künzelsauer Bergbahn pendelt auf ihrer<br />
einen Kilometer langen Strecke zwischen der<br />
Kernstadt und dem Neubaugebiet Taläcker.<br />
Letzteres entstand in den 1990er-Jahren auf<br />
der Hohenlohe-Hochebene. Mit 404 Metern<br />
liegt das neue Siedlungsgebiet 175 Meter höher<br />
als die Künzelsauer Altstadt. Diesem<br />
starken Höhenunterschied ist es geschuldet,<br />
dass Taläcker und Altstadt zwar nur etwa<br />
1,4 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt<br />
sind, man mit dem Pkw aber über 5,2 Kilometer<br />
Straße nach oben kurven muss. Im<br />
Stadtteil Taläcker sind mittlerweile 3.000<br />
Menschen zu Hause, womit etwa jeder fünfte<br />
Künzelsauer dort wohnt. Und wenn es darum<br />
geht einen beachtlichen Höhenunterschied<br />
auf kurzer Strecke zu überwinden;<br />
welches Verkehrsmittel bietet sich da besser<br />
an als die gute alte Standseilbahn? Nichtsdestotrotz<br />
bedurfte es natürlich einer ge -<br />
hörigen Portion visionären Denkens und<br />
politischer Überzeugungsarbeit, um das<br />
neue Verkehrsmittel in der Hohenlohestadt<br />
durchzusetzen. Letzteres geschah übrigens<br />
nicht gegen den Willen der Bürger, denn die<br />
Bergbahn musste vor ihrer Realisierung den<br />
ersten und <strong>bis</strong>lang einzigen Bürgerentscheid<br />
Künzelsaus als Prüfstein nehmen, was mit<br />
einer Zustimmung von 51,2 Prozent geradeso<br />
gelang.<br />
Vollautomatisch im<br />
Viertelstunden-Takt<br />
Die Künzelsauer Bergbahn hält nur an zwei<br />
Stationen, der Bergstation Taläcker und der<br />
Talstation. Während die Bergstation optimal<br />
inmitten des Neubaugebiets liegt, wurde<br />
die Talstation etwa 300 Meter außerhalb<br />
der Altstadt, dafür aber in direkter Nachbarschaft<br />
zu einem Einkaufszentrum angelegt.<br />
Beide Stationen bestechen durch ihre<br />
gelungene Architektur, die mit gewölbten<br />
Metalldächern und blau gestrichenen Sichtbetonwänden<br />
Akzente setzt. Wie üblich für<br />
Standseilbahnen fährt auch die Künzelsauer<br />
Bergbahn mit zwei Wagen auf einer eingleisigen<br />
Strecke mit einer Ausweiche in<br />
Streckenmitte. Im Gegensatz zu vielen älteren<br />
Standseilbahnen ist die Künzelsauer<br />
Bergbahn aber vollautomatisch unterwegs.<br />
<strong>Von</strong> der Bergstation aus verläuft die Trasse<br />
zunächst im Einschnitt durchs Wohngebiet,<br />
wo auch zwei Straßen mit kurzen Tunneln<br />
unterquert werden. Die Trasse mündet<br />
am Rande des Wohngebiets in einen Wald,<br />
wo sich auch die Ausweiche befindet. Etwa<br />
200 Meter vor der Talstation weitet sich die<br />
Landschaft hin zum Kochertal auf und man<br />
kann den Blick über Künzelsau genießen.<br />
Auf diesem letzten Abschnitt fährt die Bergbahn<br />
auf einer aufgeständerten Trasse<br />
durch eine Streuobstwiese bevor, kurz vor<br />
der Talstation, die Bundesstraße 19 auf einer<br />
Stahlfachwerkbrücke gequert wird.<br />
Die Bahn ist unter der Woche zwischen<br />
6.15 und 22.30 Uhr im Viertelstundentakt<br />
40 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Künzelsau<br />
Im Zentrum des<br />
Wohngebiets<br />
Taläcker wurde eine<br />
platzartige Situation<br />
geschaffen, die<br />
eindeutig von der<br />
modernen Berg -<br />
station dominiert<br />
wird<br />
Daten der Bergbahn Künzelsau<br />
Baukosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 Mio. Euro<br />
Höhe Talstation . . . . . . . . . . . . . . . 234 m ü.N.N.<br />
Höhe Bergstation . . . . . . . . . . . . . 404 m ü.N.N.<br />
Höhendifferenz . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Meter<br />
Fahrstrecke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.034 Meter<br />
mittlere Steigung . . . . . . . . . . . . . . 19,4 Prozent<br />
größte Steigung . . . . . . . . . . . . . . . 30,0 Prozent<br />
kleinste Steigung . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 Prozent<br />
Maximale Geschwindigkeit . 8 m/s (ca. 29 km/h)<br />
Fahrzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Minuten<br />
Waggonneigung . . . . . . . . . . . . . . 18,5 Prozent<br />
Sitzplätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
unterwegs, wobei an Schultagen in der<br />
Frühspitze, um die Mittagszeit sowie nachmittags<br />
ein 7,5-Minuten-Takt angeboten<br />
wird. Sams tags beginnt der Betrieb eine<br />
Viertelstunde später.<br />
An Sonn- und Feiertagen fährt die Bergbahn<br />
dagegen von 9 Uhr (sonntags) bzw.<br />
10.30 Uhr (feiertags) <strong>bis</strong> 20 Uhr. Wenn bei<br />
Großveranstaltungen viele Fahrgäste in kurzer<br />
Zeit befördert werden müssen, wird sogar<br />
im Fünfminutentakt gefahren. Bei dieser<br />
Taktfrequenz wird die Bahn aber nicht vollautomatisch<br />
betriebenen, sondern von einem<br />
Mitarbeiter im Kommandoraum der<br />
Bergstation gesteuert. Die Bahn ist übrigens<br />
voll in den Heilbronner Verkehrsverbund<br />
HNV integriert.<br />
Schlechte Karten für<br />
Stadtbahnanschluss<br />
Nach der Einweihung der Bergbahn gab<br />
und gibt es eine weitere ÖPNV-Vision, die<br />
die Kommunalpolitiker in Künzelsau umtreibt:<br />
Die Anbindung an das Karlsruher<br />
Stadtbahnnetz und damit die Reaktivierung<br />
der Kochertalbahn zwischen Waldenburg<br />
und Künzelsau. Bereits 2005 wurde die<br />
Stadtbahnlinie S4 entlang der Hohenlohebahn<br />
von Heilbronn nach Öhringen-Cappel<br />
verlängert, wofür dieser Streckenabschnitt<br />
elektrifiziert wurde. Seit langem gibt es<br />
Überlegungen, die Stadtbahnen über Öhringen<br />
hinaus zu verlängern. Dafür bestehen<br />
zwei Optionen, deren Realisierung sich gegenseitig<br />
nicht ausschließen würde. Zum einen<br />
könnten die Stadtbahnen weiter <strong>bis</strong><br />
Schwä<strong>bis</strong>ch Hall-Hessental fahren, wo die<br />
Verlauf der Bergbahn und der<br />
ehemaligen Kochertalbahn,<br />
auf der die Kommunalpolitik<br />
in Zukunft gerne die gelben<br />
AVG-Stadtbahnwagen fahren<br />
sehen würde<br />
P. KRAMMER<br />
In einem talwärts immer tiefer werdenden Einschnitt durchquert die meterspurige Bergbahn<br />
das Neubaugebiet Künzelsau-Taläcker<br />
ALLE AUFNAHMEN: P. KRAMMER<br />
Hohenlohebahn auf die bereits elektrifizierte<br />
Bahnstrecke Stuttgart – Crailsheim trifft.<br />
Auch denkbar wäre es, die Stadtbahnen von<br />
Öhringen weiter nach Künzelsau zu führen.<br />
Dafür müssten die gelben Wagen ab Öhringen-Cappel<br />
noch etwa 10 Kilometer der<br />
Hohenlohebahn <strong>bis</strong> zum Bahnhof Waldenburg<br />
folgen, ab wo dann die Kochertalbahn<br />
<strong>bis</strong> Künzelsau (weitere 12 Kilometer) reaktiviert<br />
werden müsste. Um dafür die Realisierungschancen<br />
zu prüfen, wurden in den<br />
Jahren 2002, 2008 und zuletzt 2012 Machbarkeitsstudien<br />
erstellt. Dabei wurden verschiedenste<br />
Varianten für eine Stadtbahnanbindung<br />
Künzelsaus durchgerechnet. In<br />
einem Fall wurde sogar untersucht, die<br />
Stadtbahn von Waldenburg kommend nicht<br />
hinunter ins Kochertal in die Künzelsauer<br />
Kernstadt zu führen, sondern auf der Hohenlohe-Hochebene<br />
an der Bergstation Taläcker<br />
enden zu lassen. Doch die Gutachter<br />
sind in allen Fällen zu dem Ergebnis gekommen,<br />
dass die Wiederbelebung des<br />
Bahnverkehrs nach Künzelsau volkswirtschaftlich<br />
nicht sinnvoll ist und damit auch<br />
keine Chance auf Fördermittel besteht.<br />
Trotz all dieser ernüchternden Ergebnisse<br />
will man in Künzelsau aber weiter für eine<br />
Reaktivierung der Bahnanbindung kämpfen.<br />
PHILIPP KRAMMER<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
41
Betriebe<br />
Der Masaryk-Bahnhof ist ein bedeutender Umsteigepunkt zum Regionalverkehr in und um Prag. Seine Anbindung an<br />
das Straßenbahnnetz wurde mit der aktuellen Netzreform verbessert. Die Linie 24 wurde hingegen gekürzt und geht<br />
jetzt am Ortenovo námestí auf die Linie 14 über M. JUNGE (2)<br />
Neue Linien<br />
an der Moldau<br />
Prager Tramlinien aktuell<br />
1 Petriny – Spojovací<br />
2 Petriny – Podbaba<br />
3* Brezineveská – Levského<br />
4 Kotlárka – Kubánské námestí<br />
5 Divoká Sárka – Cernokostelecká<br />
6 Sporilov – Smichovské nádrazí<br />
(– Sidlisté Barrandov)<br />
7 Radlická – Ustredni dilny DP<br />
8 Podbaba – Stary Hloubetín<br />
9* Sidliste Repy – Spojovací<br />
10 Sidliste Repy – Sidliste Dáblice<br />
11* Sporilov – Olsanské hrbitovy<br />
12 Palmovka – Sidlisté Barrandov<br />
14 Sidlisté Barrandov – Ortenovo námesti<br />
16 Lehovec – Sídliste Repy<br />
17* Vozovna Kobylisy – Levského<br />
18 Petriny – Vozovna Pankrác<br />
20 Divoká Sárka – Sídlisté Barrandov<br />
22* Nádrazí Hostivar – Bilá Hora<br />
24 Ortenovo námesti – Kubánské námesti<br />
25 Vypich – Lehovec<br />
26 Nádrazi Hostivar – Divoká Sárka<br />
* Basislinien<br />
Liniennetzoptimierung in Prag Im Jahr 2008 begann in<br />
der Goldenen Stadt die Neuausrichtung des Tramliniennetzes an<br />
die aktuellen Verkehrsbedürfnisse, seit Herbst 2012 ist in einer<br />
weiteren Stufe der Linienreform ein Kernnetz aus fünf Basisund<br />
16 Ergänzungslinien in Betrieb<br />
Die Straßenbahn ist in der tschechischen<br />
Hauptstadt ein nicht<br />
wegzudenkendes Verkehrsmittel,<br />
das trotz umfangreichen Ausbaus<br />
der Metro und damit einhergehender Streckennetzreduzierungen<br />
in den 1970er- und<br />
1980er Jahren seinen Platz im Nahverkehr<br />
behaupten konnte: Jeder dritte Fahrgast in<br />
Prag benutzt heute für seine Wege die Straßenbahn.<br />
Für die zahlreichen Touristen wird die<br />
Straßenbahn immer interessanter: Neben<br />
Sonderfahrten und der Nostalgielinie 91<br />
findet mittlerweile auch die Linie 22 in fast<br />
jedem Reiseführer Erwähnung, da sie wichtige<br />
Sehenswürdigkeiten Prags auf interessanter<br />
Strecke miteinander verbindet.<br />
Trotzdem wurden Änderungen am Liniennetz<br />
unumgänglich, entsprach es doch in<br />
weiten Teilen nicht mehr den Verkehrsströmen.<br />
Vielfach gab es zudem Parallelverkehr<br />
mit Buslinien. Deshalb begannen der Prager<br />
Verkehrsbetrieb DPP und der regionale Verkehrsverbund<br />
ROPID eine grundlegende<br />
Umgestaltung der Liniennetze von Bussen<br />
und Straßenbahnen zu planen, an deren<br />
Ende ein übersichtliches, gut merkbares Liniennetz<br />
stehen sollte, das die heutigen<br />
Fahrgastströme besser abdeckt.<br />
Die neue Liniensystematik<br />
Rückgrat der Straßenbahn sind fünf Linien,<br />
die auf den Hauptachsen mit kurzen Intervallen<br />
verkehren. Bereits in den Jahren 2008<br />
und 2009 sind die ersten beiden dieser Basislinien<br />
eingeführt worden, so dass parallel<br />
führende Verstärkungslinien nicht mehr bedient<br />
werden mussten – was einerseits zu<br />
42 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Tschechien: Prag<br />
Die Manesuv-Brücke vor dem Panorama des Prager Burgareals wird oftmals für Umleitungen genutzt. Im Regelverkehr befährt sie auch im<br />
neuen Netz nur die Linie 18 – meist mit Niederflurtriebwagen, hier jedoch mit einer Tatra-Doppeltraktion als Linie 12<br />
Einsparungen führte, andererseits das Angebot<br />
verlässlicher und attraktiver machte. Seit<br />
dem 17. September 2012 gibt es fünf Basislinien<br />
(3, 9, 11, 17 und 22). Darüber hinaus<br />
gibt es vier Bündel von jeweils zwei Linien,<br />
die in ihren Kernabschnitten so aufeinander<br />
abgestimmt sind, dass auch dort das Taktgefüge<br />
der Basislinien entsteht. Die verbleibenden<br />
acht Linien übernehmen überwiegend<br />
Ergänzungsfunktionen zu den Hauptlinien<br />
oder zur Metro und sind teilweise auch nur<br />
von Montag <strong>bis</strong> Freitag im Einsatz.<br />
Bewährtes bewahrt<br />
Vielfach blieben die Linienführungen im<br />
Grundsatz erhalten und änderten sich nur<br />
im Bereich des Stadtzentrums. Bestehende<br />
Linien wurden teilweise verlängert und ersetzen<br />
so andere Linien. Insgesamt entfielen<br />
durch die Reorganisation vier Straßenbahnlinien<br />
– die 15, 19, 21 und 36. Insbesondere<br />
im Nordosten der Stadt kam es zu<br />
Einschränkungen im Fahrtenangebot, was<br />
vor allem an der schnellen Metroverbindung<br />
zur Innenstadt liegt. Hingegen weist<br />
das Prager Zentrum nun auf vielen Linien<br />
einen verdichteten Fahrplan auf, auch die<br />
Linienäste nach Zizkov und Letná werden<br />
häufiger bedient.<br />
Auf neuen Linienführungen mit verdichteten<br />
Takten sollen die Straßenbahnen die<br />
teils an der Kapazitätsgrenze verkehrende<br />
Metro entlasten und für attraktive Verbindungen<br />
in die Innenstadt sorgen. Neu organisiert<br />
wurde auch der Fahrzeugeinsatz: Am<br />
Wochenende sind auf vielen Linien – teilweise<br />
auch auf den Basislinien – nur noch<br />
Abschied von den KT8D5<br />
Solowagen im Einsatz, während an Arbeitstagen<br />
auf einigen Linien als Doppeltraktionen<br />
fahren, die <strong>bis</strong>her nur mit Einzelwagen<br />
bedient wurden. Der nächtliche<br />
Straßenbahnverkehr mit den Linien 51 <strong>bis</strong><br />
59 blieb unverändert. MARTIN JUNGE<br />
Mit einer ausschließlich von den verbliebenen KT8D5 besetzten Sonderlinie 15 verabschiedeten sich am<br />
21. Mai 2013 der Prager Verkehrsbetrieb und Straßenbahnfreunde von diesem Fahrzeugtyp. Gegen 17<br />
Uhr rückte der Triebwagen 9048 in den Betriebshof Stresovice ein, wo er im Museum des öffentlichen<br />
Verkehrs erhalten bleiben wird. Die übrigen KT8D5 werden zu teilniederflurigen Fahrzeugen umgebaut<br />
und werden noch einige Zeit den Straßenbahnbetrieb in Prag mitprägen, sind sie doch bei Baustellen<br />
unverzichtbar für eine flexible Betriebsführung (Foto: Ondrej Matej Hrubes in der Invalidovna) YUG<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
43
Fahrzeuge<br />
Abschied<br />
auf Raten<br />
Potsdam: Der Triebwagen 155 vom<br />
Typ KT4DMC der ViP durchfährt am<br />
24. April 2012 auf Linie 96 nach<br />
Kirchsteigfeld das Nauener Tor.<br />
Nach einem Unfall wurde er in<br />
diesem Jahr zerlegt<br />
S. SCHRADER<br />
44 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Die letzten Tatras in<br />
Deutschland (Teil 2)<br />
In Rostock und Strausberg<br />
neigen sich die Tatra-Einsätze<br />
dem Ende entgegen – Zwickau<br />
setzt hingegen langfristig auch<br />
auf seine modernisierten<br />
KT4D. Seit dem Jahr 2000 unterlag<br />
der Bestand an Tatras in<br />
den östlichen Bundesländern<br />
ganz unterschiedlichen Entwicklungen<br />
– ein Überblick<br />
Tatras<br />
Vor dem Mauerfall waren sie bei fast<br />
jedem Straßenbahnbetrieb in der<br />
DDR zu finden – Tatrawagen. Gab<br />
es damals lediglich die Großraumwagen<br />
der Typen T3D mit B3D, T4D mit<br />
B4D, KT4D und T6A2 mit B6A2, so hat sich<br />
diese Vielfalt durch Umbauten und nachträgliche<br />
Zugänge später sogar erhöht! Heute<br />
gibt es in den östlichen Bundesländern<br />
auch mit Niederflurmittelteilen versehene<br />
KTNF6 und KTNF8 sowie drei KT8.<br />
Doch der Bestand an Tatrawagen ist bei<br />
den 20 Betrieben rückläufig. Darüber kann<br />
auch nicht hinwegtäuschen, dass mit Jena<br />
seit Jahresanfang nun sogar ein 21. Unternehmen<br />
über ein solches Fahrzeuge verfügt.<br />
Trotzdem schreitet der Wechsel zu neuen<br />
Fahrzeugtypen bei den einzelnen Verkehrsbetrieben<br />
ganz unterschiedlich voran. Stellte<br />
Teil 1 dieses Überblicks im STRASSEN-<br />
BAHN <strong>MAGAZIN</strong> 6/2013 bereits vor, wie<br />
sich der Bestand in den Städten Berlin, Brandenburg<br />
(Havel), Chemnitz, Cottbus, Dresden,<br />
Erfurt, Frankfurt (Oder), Gera, Görlitz,<br />
Gotha, Halle (Saale), Jena, Leipzig und<br />
Magdeburg seit dem Jahr 2000 verändert<br />
hat, so folgt nun die Entwicklung bei den<br />
übrigen sieben Betrieben von Plauen <strong>bis</strong><br />
Zwickau.<br />
Plauen<br />
Bei der Plauener Straßenbahn GmbH waren<br />
im Jahr 2000 noch 40 in den 1990er-Jahren<br />
modernisierte und mit Choppersteuerung<br />
ausgerüstete KT4DMC vorhanden. Dieser<br />
Bestand hat sich in den vergangenen 13 Jahren<br />
fast halbiert. Zunächst wurde der 2004<br />
noch vorhandene Tw 209 ohne Choppersteuerung<br />
im selben Jahr zerlegt, der Tw 215<br />
gelangte hingegen 2005 nach Zwickau.<br />
<strong>Von</strong> den Wagen mit Choppersteuerung<br />
schieden acht aus dem Bestand aus – siehe<br />
Tabelle. Aktuell befinden sich noch 24 zwischen<br />
1981 und 1988 gebaute KT4DMC im<br />
Bestand: Die Tw 203, 205, 207, 208, 214,<br />
216, 220, 224, 225, 227 <strong>bis</strong> 229, 231 <strong>bis</strong> 234<br />
sowie 236 <strong>bis</strong> 243.<br />
Im vogtländischen Plauen legt der Tw 232 am 10. April 2011 an der Haltestelle Capitol einen<br />
Halt ein. Den KT4D stellte CKD im Jahr 1988 her. Die Tatras sollen <strong>bis</strong> ins nächste Jahrzehnt in<br />
Plauen im Einsatz bleiben<br />
R. GLEMBOTZKY<br />
Als Arbeits-Tw auf Tatrabasis sind die Tw<br />
0202 und 0235 vorhanden. Ersterer wurde<br />
1995 aus dem 1976 gebauten Tw 202 vom<br />
Typ KT4D zum Schleif- und Schmierwagen<br />
umgebaut; letzterer wurde 2012 aus dem<br />
1988 gebauten Tw 235 vom Typ KT4DC<br />
zum Winterdienstwagen umgewidmet.<br />
Für die Bedienung der fünf Plauener Linien<br />
(Nr. 1 sowie 3 <strong>bis</strong> 6) werden aktuell werktags<br />
16 Tatrawagen eingesetzt, an Samstagen<br />
reduziert sich diese Zahl auf zwölf und an<br />
Sonn- sowie Feiertagen auf sieben.<br />
Nach dem Eintreffen der ersten Niederflurwagen<br />
sollen noch in diesem Jahr zunächst<br />
zwei Tatras abgestellt werden. Man<br />
geht in der Stadt an der Weißen Elster jedoch<br />
davon aus, dass der reguläre Tatraeinsatz<br />
nicht vor 2020 enden wird.<br />
Potsdam<br />
Durch die 16 zwischen 1998 und 2001 gelieferten<br />
Combino und die zehn 2011/12 eingetroffenen<br />
Variobahnen hat sich der Bestand<br />
an Tatras bei der Verkehrsbetrieb Potsdam<br />
GmbH (ViP) nach dem Jahr 2000 drastisch<br />
reduziert.<br />
KT4DMC-Abgänge aus dem<br />
Plauener Bestand nach 2000<br />
2004: Tw 219 und 221 – verschrottet<br />
2005: Tw 205, 210, 212 und 217 – verschrottet<br />
2005: Tw 215 verkauft nach Zwickau; Tw 223:<br />
Übungsobjekt an Landesschule für Brandu.<br />
Katastrophenschutz Eisenhüttenstadt<br />
2006: Tw 206 und 211 – verschrottet<br />
2006: Tw 230 nach Zwickau abgegeben<br />
2009: Tw 226 und 245 – verschrottet<br />
2010: Tw 218 und 244 – verschrottet<br />
2010: Tw 213 nach Flieden bei Fulda verkauft –<br />
Nutzung als Im<strong>bis</strong>s<br />
Waren Anfang des Jahrtausends noch<br />
etwa 85 Wagen vorhanden, so hat sich diese<br />
Zahl im April 2013 in Summe auf 32 verringert.<br />
Dieser Bestand setzt sich wie folgt<br />
zusammen:<br />
• aus acht als führende Tw („100er-Nummern“)<br />
nutzbaren KT4DM; von ihnen sind<br />
jedoch die Tw 123, 124, 142, 147, 162 abgestellt<br />
und sollen noch in diesem Jahr verkauft<br />
werden; genutzt werden lediglich die<br />
Tw 144 und 146; der Tw 141 wurde als Reservefahrzeug<br />
aufgearbeitet<br />
• nur als geführter Tw („200er-Nummern“)<br />
ohne Choppersteuerung einsetzbar wäre der<br />
KT4DM-Tw 246 – er ist jedoch abgestellt<br />
und steht ebenfalls zum Verkauf<br />
• mit Choppersteuerung als führende Tw<br />
nutzbar sind elf einst 1987 gebaute<br />
KT4DMC. Es handelt sich um die Tw 148<br />
<strong>bis</strong> 154, 156, 157, 159 und 161<br />
• als geführte Triebwagen mit Choppersteuerung<br />
sind zehn 1987 gebaute Tatras im<br />
Bestand – die Tw 248 <strong>bis</strong> 256 sowie der abgestellte<br />
259<br />
Für Sonderverkehre befindet sich mit dem Tw<br />
001 der 1972 gebaute Prototyp der KT4D im<br />
Unterhaltungsbestand.<br />
Als Fahrschul- bzw. Fahrleitungsbeobachtungswagen<br />
steht außerdem der Tw 301 vom<br />
Typ KT4DM zur Verfügung.<br />
Hat die ViP zwischen 2002 und 2009 ganze<br />
45 KT4DM und KT4DMC nach Temirtau,<br />
Cluj/Klausenburg, Szeged und Ploiesti<br />
verkauft, so gab es auch mehrere Verschrottungen<br />
solcher Wagen:<br />
2003: Tw 129 und 158, 229 und 258<br />
2011: Tw 143 und 160<br />
2012: Tw 130, 131 und 145<br />
2013: Tw 155 und 257<br />
<strong>Von</strong> den in Potsdam verbliebenen 32 Tatras<br />
stehen also in Summe sieben kurz vor ihrem<br />
Verkauf, für den Liniendienst befanden sich<br />
hingegen im April 23 Triebwagen im Unter-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
45
Fahrzeuge<br />
Dietmar Linser nahm in Rostock am<br />
24. Mai 2012 den Tw 812 samt<br />
Beiwagen 862 auf. Den T6A2 steht<br />
in der Hansestadt jedoch keine<br />
lange Einsatzdauer mehr bevor<br />
In Schwerin wurde <strong>bis</strong> Ende 2010 der Tw 211 mit dem Bw 311 noch als „Kinderfahrschule“ genutzt.<br />
Er durfte aber das Betriebshofgelände nicht verlassen. Jetzt dient dazu Tw 111 J. PERBANDT<br />
In Leipzig sind die Tatras langfristig nicht entbehrlich<br />
– hier der Fahrerplatz im T4DM T. LAAKE<br />
haltungsbestand. Davon werden werktags<br />
zehn Wagen benötigt (sowie 22 Niederflurfahrzeuge).<br />
An Sams- und Sonntagen sind<br />
maximal drei Tatrawagen sowie 18 Niederflurfahrzeuge<br />
unterwegs. Die Tatras kommen<br />
meist früh und nachmittags z. B. als Verstärker<br />
zum Einsatz, sie bedienen dabei in Doppeltraktion<br />
alle sieben Linien. Die Zahl der<br />
eingesetzten Wagen kann natürlich immer variieren<br />
und hängt von der Wartung, möglichen<br />
Unfällen und anderen Vorkommnissen<br />
ab, die die Verfügbarkeit eines Fahrzeugtyps<br />
einschränken können.<br />
Die ViP strebt mittelfristig an, 100 Prozent<br />
der Kurse niederflurig abzusichern. Nach<br />
dem Eintreffen von weiteren Variobahnen im<br />
nächsten Jahr werden deshalb voraussichtlich<br />
erneut mehrere Tatras aus dem Unterhaltungsbestand<br />
ausscheiden. In welchem Jahr<br />
ihr regulärer Einsatz in Potsdam enden wird,<br />
ist derzeit noch nicht absehbar.<br />
Rostock<br />
Anfang des neuen Jahrtausends standen der<br />
Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) noch<br />
alle 24 zwischen 1989 und 1990 für die Hansestadt<br />
gebauten Tatratriebwagen vom Typ<br />
T6A2M zur Verfügung.<br />
In den Jahren 2001/02 lieferte Bombardier<br />
insgesamt 22 niederflurige Beiwagen für die<br />
Tatras nach Rostock, woraufhin die sechs<br />
originalen Tatrabeiwagen vom Typ B6A2, die<br />
bereits 1996 abgestellt waren, 2005 ins ungarische<br />
Szeged abgegeben wurden. Jedem<br />
T6A2M ist seitdem ein ganz konkreter Niederflur-Beiwagen<br />
zugewiesen.<br />
Nachdem der Tw 811 im Jahr 2009 verschrottet<br />
wurde, ereilte die Tw 709, 712, 807<br />
und 809 das gleiche Schicksal, wodurch fünf<br />
Niederflurbeiwagen „frei“ geworden sind.<br />
Anfang 2013 kam der Bw 752 nach Leipzig,<br />
die übrigen vier – Bw 754, 855, 861 und 860<br />
– folgten von Ende April <strong>bis</strong> Mai.<br />
In diesem Jahr sind am Warnowufer aktuell<br />
noch 19 Tatrawagen im Unterhaltungsbestand.<br />
Wie die bereits zerlegten waren sie<br />
zwischen 1996 und 2001 von der RSAG modernisiert<br />
worden. Zwei der 19 Wagen werden<br />
seit 2010 bzw. 2012 als Arbeitswagen<br />
(Nr. 551, ex Tw 808, und 552, ex Tw 707)<br />
genutzt. Der Tw 704 wurde im Mai 2010 als<br />
historischer Wagen designiert, er kommt aber<br />
noch regulär als Linienwagen zum Einsatz.<br />
Damit stehen heute in Rostock insgesamt<br />
noch 17 Tatrawagen für den Liniendienst zur<br />
Verfügung. Sie kommen zusammen mit den<br />
40 in den 1990-Jahren gebauten NGT6WDE<br />
zum Einsatz. Die Tatrawagen befahren dabei<br />
planmäßig nur noch die Linie 1. Für den regulären<br />
Betrieb werden dort werktags zehn<br />
T6A2M benötigt, am Wochenende sind keine<br />
unterwegs.<br />
Wenn voraussichtlich Anfang 2014 die ersten<br />
neuen 6N2 vom Typ Tramlink in Rostock<br />
eintreffen, wird sich die RSAG schrittweise<br />
von den Tatras verabschieden. Sie befinden<br />
sich derzeit also womöglich bereits in ihrem<br />
letzten vollständigen Einsatzjahr an der Warnow<br />
...<br />
Schöneiche<br />
Der Bestand der Schöneicher-Rüdersdorfer<br />
Straßenbahn GmbH (SRS) umfasste im Jahr<br />
2000 u. a. acht in den Jahren 1992 <strong>bis</strong> 1994<br />
aus Cottbus übernommene KT4DM – die Tw<br />
46 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Tatras<br />
Übersicht: Tatra-Tw in Deutschland<br />
Betrieb Typ Baujahre geliefert Einsatzende Ende 4/2013 im Wagen vsl. Bemerkungen zur<br />
Betriebsbestand im Einsatz <strong>bis</strong> Situation Ende April 2013<br />
Berlin KT4D 1976–1988 477 – 160 2017 10 weitere Wagen abgestellt<br />
KT4Dt 1983–1987 99 2013 0 – 35 Wagen abgestellt vorhanden<br />
T6A2 1988–1990 118 2007 0 –<br />
B6A2 1988–1990 69 2007 0 –<br />
Brandenburg (H.) KT4D 1979–1983 16 – 4 mind. 2020 im Einsatzbestand Tw 173, 174, 179, 180,<br />
als ATw Nr. 154<br />
KTNF6 [1997–1998] – – 10 mind. 2020 durch Umbau aus KT4D entstanden<br />
Chemnitz T3D 1968–1986 132 – 22 mind. 2016 im Betriebsbestand noch 505, 507, 509, 512–517,<br />
519, 521–532<br />
B3D 1973–1986 62 2008 0 – noch im Betriebshof vorhanden<br />
Cottbus KT4D 1978–1990 65 – 0 –<br />
KTNF6 [1996–1998] – – 21 mind. 2028 5 weitere KTNF6 wurden verkauft bzw. zerlegt<br />
Dresden T4D 1967–1984 574 – 18 mind. 2015 Wagen für Sonderdienste im Bestand<br />
B4D 1970–1984 250 2005 0 –<br />
T6A2 1985–1988 4 2000 0 –<br />
B6A2 1985–1988 2 2000 0 –<br />
Erfurt KT4D 1976–1990 156 – 6 2014 im Einsatzbestand noch Tw 405, 450, 495, 518, 519<br />
und 520<br />
Frankfurt (O.) KT4D 1987–1990 34 – 17 mind. 2015<br />
T6A2M [1988] – – 1 – in Berlin Tw 5118 bzw. 8118 bzw. 218 118<br />
Gera KT4D 1978–1990 61 – 22 mind. 2018 zusätzlich noch Tw 354 und 358 als Ersatzteilspender<br />
vorhanden<br />
KTNF8 [1998–2003] – – 6 mind. 2018 Tw 348 <strong>bis</strong> 253<br />
Görlitz KT4D 1983–1990 11 – 15 mind. 2020 5 Tw aus Erfurt, 3 aus Cottbus<br />
Gotha KT4D 1981–1982 6 – 18 mind. 2020 12 Tw gebraucht aus Erfurt<br />
Halle T4D 1968–1986 323 – 20 mind. 2013 Tw 1147, -53, 54, 56, 60, 61, 69, 76, 77, 83, 91, 94,<br />
97, 98, 1201, -08, 09, 11, 14 und 1221<br />
B4D 1969–1986 124 – 10 mind. 2013 Bw 180, -85, 95, 97, 204, -05, 06, 07, 12 und 222<br />
Jena KT4D [1979] – – 1 – 2013 aus Erfurt, Einsatz als ATw<br />
Leipzig T4D 1968–1986 597 – 131 mind. 2020<br />
B4D 1968–1986 273 – 4 mind. 2014<br />
KT4D [1976] 8 1984 0 –<br />
T6A2 1988–1990 28 2007 0 –<br />
B6A2 1988–1990 14 2007 0 –<br />
Magdeburg T4D 1968–1986 274 2013 0 –<br />
B4D 1969–1986 142 2013 0 –<br />
T6A2 1989–1990 12 2013 11 mind. 2016 Einsatzverlängerung als Reserve<br />
B6A2 1990 6 2013 2 mind. 2018 Einsatzverlängerung als Reserve<br />
Plauen KT4D 1976–1988 45 – 24 mind. 2020 Tw 203, 205, 207, 208, 214, 216, 220, 224, 225, 227<br />
<strong>bis</strong> 229, 231 <strong>bis</strong> 234 sowie 236 <strong>bis</strong> 243, zzgl. 2 Atw<br />
Potsdam KT4D 1974–1987 45 – 23 mind. 2016 80 Triebwagen aus Berlin übernommen, weitere Tw<br />
KT4D 80 abgestellt vorhanden<br />
Rostock T6A2 1989–1990 24 2014/15 17 mind. 2013 Tw 701 <strong>bis</strong> 706, 708, 710, 711, 801 <strong>bis</strong> 806, 810, 812,<br />
zzgl. 2 ATw (551, 552)<br />
B6A2 1989–1990 6 1997 0 –<br />
Schöneiche KT4D [1981] – – 1 mind. 2013 Tw 22, abgestellt noch Tw 18 und 21 vorhanden<br />
(alle drei ex Cottbus)<br />
KTNF6 [1996–1998] – – 3 mind. 2024 Tw 26, 27 und 28 (alle drei ex Cottbus)<br />
Schwerin T3D 1973–1988 115 2003 0 –<br />
B3D 1973–1988 56 2003 0 –<br />
Strausberg KT8 [1989–1990] – – 1 mind. 2013 Tw 22, abgestellt noch Tw 21 und 23 vorhanden<br />
(alle drei ex Kosice/Kaschau)<br />
T6C5 [1998] – – 1 mind. 2013 Tw 30, Prototyp von CKD<br />
Zwickau KT4D 1987–1988 21 – 22 mind. 2024 Tw 928 <strong>bis</strong> 949 – Tw 948 aus Plauen übernommen<br />
17 <strong>bis</strong> 22 sowie Tw 24 und 25. War davon<br />
der Tw 24 im Jahr 1979 gebaut worden, so<br />
stellte CKD die übrigen sieben 1981 fertig.<br />
<strong>Von</strong> den acht KT4DM sind derzeit noch die<br />
drei in den Jahren 1995/96 bei der Mittenwalder<br />
Gerätebau GmbH modernisierten<br />
Tw 18, 21 und 22 vorhanden. Davon sind<br />
allerdings die Tw 18 und 21 abgestellt. Der<br />
Triebwagen 22 dient zwar offiziell als Reserve,<br />
kommt aber so gut wie nie zum Einsatz,<br />
da er kurz vor seiner Laufkilometergrenze<br />
steht. Erreicht er diese, müsste er aufgearbeitet<br />
werden. Dies ist derzeit nicht vorgesehen<br />
– im Gegenteil: Alle drei KT4DM stehen aktuell<br />
zum Verkauf.<br />
Die fünf Anfang 2000 noch zusätzlich vorhandenen<br />
KT4D wurden zur Ersatzteilgewinnung<br />
allesamt verschrottet: Tw 19 noch<br />
im Jahr 2000, die Tw 17 und 20 im Jahr<br />
2001, Tw 25 im folgenden Jahr sowie Tw 24<br />
schließlich 2008.<br />
Die zweite Gruppe Tatrawagen der SRS<br />
bilden inzwischen drei 1996 bzw. 1998 für<br />
den Einsatz in Cottbus mit einem Niederflurmittelteil<br />
versehene KT4D – seit ihrem<br />
Umbau werden sie als KTNF6 geführt. Bei<br />
der SRS befinden sich:<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
47
Fahrzeuge<br />
Der Zwickauer<br />
Tatra-Schleifwagen<br />
Um einen KT4DMC handelt es sich beim Zwickauer<br />
Triebwagen 200. Das 1988 gebaute Fahrzeug<br />
kam aus Plauen (dort Tw 230) nach Westsachsen.<br />
<strong>Von</strong> 2006 <strong>bis</strong> 2008 erfolgte sein<br />
Umbau zum Schleifwagen. Als solcher steht er<br />
auf dem Zwickauer Meterspurnetz zuverlässig<br />
im Dienst.<br />
Der im Dezember 2011 aus Leipzig in Zwickau<br />
eingetroffene Schneepflug entstand übrigens<br />
auf Basis eines KT4D-Drehgestells aus Zwickau.<br />
In Schöneiche kommen die in Cottbus mit einem Niederflurmittelteil versehenen KT4D als KTNF6<br />
auch in Zukunft zum Einsatz. Hier passiert Tw 26 am 7. März 2012 das Postamt in Rüdersdorf<br />
In Zwickau werden die modernisierten KT4D noch <strong>bis</strong> ins nächste Jahrzehnt benötigt. Im August<br />
2010 waren die Tw 949 und 932 auf der Werdauer Straße unterwegs M. KOCHEMS, J. BECKER (OBEN)<br />
• Tw 26 seit 2009, in Cottbus Tw 171 (<strong>bis</strong><br />
1991 Erfurt)<br />
• Tw 27 seit 2010, in Cottbus Tw 142<br />
• Tw 28 seit 2011, in Cottbus Tw 139<br />
Im regulären Verkehr befinden sich aktuell<br />
im Wechsel mit den 1966 und 1973 gebauten<br />
Düwag-GT6 aus Heidelberg täglich ein <strong>bis</strong><br />
zwei KTNF6, der dritte Tatrawagen mit Niederflurteil<br />
kommt bedarfsweise als Schülerbahn<br />
ebenfalls zum Einsatz. Es ist vorgesehen,<br />
die KTNF6 <strong>bis</strong> ca. 2024 zu unterhalten.<br />
Schwerin<br />
Die Nahverkehr Schwerin GmbH hat als erster<br />
deutscher Verkehrsbetrieb auf Tatrawagen<br />
im Liniendienst verzichtet. Bereits im August<br />
2003 verabschiedete die NVS ihre nach<br />
2000 noch vorhandenen modernisierten Tatra-Großraumtriebwagen<br />
vom Typ T3DC1<br />
(führende Triebwagen) sowie die nur geführt<br />
einsetzbaren T3DC2 aus dem regulären Planeinsatz.<br />
Insgesamt 30 seit dem Jahr 2001 eingetroffene<br />
achtachsige Niederflurwagen vom<br />
Typ SN2001 machten dies möglich.<br />
Daraufhin gab die NVS <strong>bis</strong> 2005 fast alle<br />
T3D nach Osteuropa ab – siehe Tabelle. In<br />
Schwerin wurden hingegen die beiden 1983<br />
gebauten T3DC2 Nr. 249 und 254 jeweils<br />
2003 und der von 2004 <strong>bis</strong> 2010 als Kinderstraßenbahn<br />
genutzte Tw 211 (T3DC2, Baujahr<br />
1977) schließlich 2010 verschrottet.<br />
Dadurch befinden sich heute lediglich noch<br />
Tatra-Arbeits- und Traditionsfahrzeuge in<br />
Schwerin:<br />
• Tw 111, ein T3DC1 als Kinderfahrschule<br />
(darf nur auf dem Betriebshof fahren)<br />
• Tw 417, ein originaler T3D als Traditionsfahrzeug<br />
• Tw 418, ein originaler T3D als Traditionsfahrzeug,<br />
seit 2005 abgestellt<br />
• Bw 359, ein originaler B3D als Traditionsfahrzeug,<br />
seit 2005 abgestellt<br />
• Tw 905, ex 146, ein T3DC1h als Arbeitswagen,<br />
seit 2010 abgestellt<br />
• Tw 907, ex 154, ein T3DC1h als Arbeitswagen,<br />
seit April 2013 abgestellt<br />
Doch der Einsatz der Tatras als Arbeitsfahrzeuge<br />
ist seit Mitte April nun ebenfalls Geschichte.<br />
Der Tw 907 absolvierte am 13.<br />
April beim alljährlichen „Schweriner Frühjahrsputz“<br />
seinen vermutlich letzten Einsatz.<br />
Zuvor war er <strong>bis</strong> Februar 2013 als Oberleitungs-Enteisungsfahrzeug<br />
genutzt worden.<br />
Nachdem die Nahverkehrsgesellschaft den<br />
Bombardier-Tw 817 mit speziellen Enteisungs-Stromabnehmern<br />
ausgerüstet hat, wurde<br />
der Tatrawagen nun überflüssig. Er bleibt<br />
jedoch (wie Tw 905) <strong>bis</strong> auf weiteres im Betriebshof<br />
Haselholz hinterstellt. Dort sind<br />
auch die Traditionswagen sowie der Tw 111<br />
stationiert. Dieser wird auf dem Betriebshof<br />
als Kinderfahrschule eingesetzt. Als derzeit<br />
letzter einsatzfähiger Tatra-Triebwagen für<br />
Sonderfahrten im Schweriner Straßenbahnnetz<br />
steht der Museums-Tw 417 zur Verfügung.<br />
Abgänge aus Schwerin <strong>bis</strong> 2005 nach Osteuropa:<br />
• die zwischen 1973 und 1979 gebauten<br />
T3DC1 Tw 101 <strong>bis</strong> 110 sowie 112 <strong>bis</strong> 127<br />
• die von 1981 und 1983 gebauten T3DC1<br />
Tw 142 <strong>bis</strong> 145, 147 <strong>bis</strong> 153 und 155<br />
• die zwischen 1973 und 1979 gebauten<br />
T3DC2 Tw 201 <strong>bis</strong> 210 und 212 <strong>bis</strong> 227<br />
• die zwischen 1981 und 1983 gebauten<br />
T3DC2 Tw 242 <strong>bis</strong> 245 und 247 <strong>bis</strong> 253<br />
sowie 255<br />
• die dazugehörigen Großraum-Beiwagen<br />
vom Typ B3DC wurden in Deutschland<br />
verschrottet<br />
Strausberg<br />
Bei der Strausberger Eisenbahn GmbH (STE)<br />
trafen 1995 die ersten drei Tatrawagen ein.<br />
Es handelt sich um die zwischen 1989 und<br />
1990 gebauten Tw 21, 22 sowie 23 vom Typ<br />
KT8D5. Die aus Kosice/Kaschau übernommenen<br />
Wagen sind gleichzeitig die ersten und<br />
<strong>bis</strong>her einzigen KT8 in Deutschland. Trugen<br />
sie im Jahr 2000 die Hauptlast auf der STE,<br />
so erhielten sie ab 2003 Unterstützung durch<br />
den 1998 gebauten Prototyp vom Typ T6C5.<br />
48 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Schlachten,<br />
Technik,<br />
Feldherren<br />
In Strausberg wird neben den beiden Flexity noch mindestens ein Tatra für den Linienbetrieb<br />
benötigt. Am 29. Oktober 2010 war Tw 21 in Richtung Strausberg Bahnhof unterwegs S. SCHRADER<br />
Diese Aufnahme aus Berlin zeigt, warum viele Betriebe auf die hochflurigen Tatras verzichten: Sie<br />
sind gerade für Rentner oder Fahrgäste mit Kinderwagen beschwerlich zu erklimmen ... B. SCHULZ<br />
Nachdem im März bzw. Mai dieses Jahres auf<br />
der STE zwei Flexity Berlin in den Liniendienst<br />
gekommen sind, wird geprüft, die Tw<br />
21 und 23 nach Prag zu verkaufen. Tw 30<br />
bleibt ebenso wie der dritte KT8 als Reservewagen<br />
<strong>bis</strong> auf weiteres in Strausberg.<br />
Zwickau<br />
Der Wagenbestand der Städtischen Verkehrsbetriebe<br />
Zwickau GmbH weist im Berichtszeitraum<br />
eine für die östlichen Bundesländer<br />
ungewohnte Konstanz auf. <strong>Von</strong> den<br />
23 im Jahr 2000 im Unterhaltungsbestand<br />
befindlichen modernisierten KT4DC sind <strong>bis</strong><br />
heute noch alle Wagen vorhanden, lediglich<br />
der Tw 927 ist inzwischen abgestellt. Wie der<br />
noch eingesetzte Tw 948 ist er 1983 gebaut<br />
worden und stammt ebenfalls aus Plauen.<br />
Die übrigen 21 im Liniendienst genutzten<br />
Wagen waren zwischen 1987 <strong>bis</strong> 1990<br />
werks neu nach Zwickau gekommen. Im<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
Rahmen ihrer ersten Modernisierung erhielten<br />
sie Anfang der 1990er-Jahre in Mittenwalde<br />
anstelle der Falttüren neue Außenschwenktüren<br />
sowie eine neue Bestuhlung<br />
und Fahrtzielanzeigen.<br />
<strong>Von</strong> September 2000 <strong>bis</strong> Mai 2004 erhielten<br />
alle Fahrzeuge in Zusammenarbeit mit<br />
CKD Alstom in Zwickau eine zweite Modernisierung,<br />
in deren Rahmen die Wagen<br />
Choppersteuerungen bekamen. Nach Befragung<br />
des Fahrpersonals blieb die Pedalsteuerung<br />
jedoch erhalten. Die mit den Nummern<br />
928 <strong>bis</strong> 949 versehenen 22 Tatras teilen sich<br />
heute mit den zwölf 1993 von MAN gebauten<br />
GT6M den Liniendienst in Zwickau.<br />
Werktags werden regulär 17 Tatras benötigt,<br />
sie verkehren mit den GT6M im Wechsel. An<br />
Wochenenden sind weniger Kurse unterwegs.<br />
Nach jetzigem Planungsstand werden die<br />
KT4DC in Zwickau noch mindestens <strong>bis</strong><br />
2024 betrieben. ANDRÉ MARKS<br />
Das neue Heft ist da.<br />
Jetzt am Kiosk!<br />
Testabo mit Prämie bestellen unter:<br />
www.clausewitz-magazin.de/abo
Fahrzeuge<br />
<strong>Von</strong> Wien in die Welt<br />
Wiener Exportwagen, Teil 1<br />
Seit 1997 eroberten zahlreiche<br />
rot-weiße Straßenbahnen aus der<br />
Donaumetropole mehr als ein<br />
halbes Dutzend Städte Europas.<br />
Bis Ende 2012 gelangten 365<br />
Trieb- und Beiwagen der Wiener<br />
Linien nach Bosnien, Ungarn, Polen,<br />
Rumänien und in die Niederlande<br />
Die E 1 102–123 gingen in<br />
Krakau mit blau/beiger Farbgebung<br />
in Betrieb. In Anlehnung an die früher in<br />
Wien verwendeten Liniensignalscheiben am<br />
Dach wurde am Platz des Liniensignalwürfels<br />
ein digitaler Anzeiger montiert<br />
(E 1 108 + 568; 6. September 2005)<br />
50 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Wiener Exportwagen<br />
Sarajevo: Die zuerst in Betrieb genommene C 1 /c 1 -Garnitur 400 + 4000 machte mit einer Aufschrift auf den Initiator der Aktion aufmerksam,<br />
hier am 24. September 1997 in der Endstelle am noch zerstörten Bahnhof<br />
ALLE AUFNAHMEN: W. KAISER<br />
Seit 2004 fahren in Miskolc ausschließlich Gebrauchtwagen: Die E 1 verkehren<br />
auf Linie 2 und die aus Kosice und Most übernommenen KT8D5<br />
sind auf Linie 1 unterwegs, hier am 22. April 2010<br />
Miskolc: Im Inneren des Wagens 196 ist am 30. April 2010 immer noch<br />
die ehemalige Wiener Nummer ersichtlich, es gibt aber auch Hinweise<br />
zum neuen Eigentümer. Die Typenbezeichnung lautet offiziell „SGP E1“<br />
Als Mitte der 1990er-Jahre die große<br />
„Gebrauchtwagen-Wanderung“ in<br />
die ehemaligen Ostblockländer einsetzte,<br />
konnte Wien vorerst keine geeigneten<br />
Fahrzeuge beisteuern. Erst 1990<br />
wurden die letzten Stahlkasten-Zweiachser<br />
der Baujahre 1960/61 durch fabrikneue Gelenktriebwagen<br />
des Typs E 2 ersetzt und die<br />
Prototypen der ULF-Niederflurwagen (Typen<br />
A und B) hatten noch nicht ihre Serienreife erlangt.<br />
Die zahlreich vorhandenen sechsachsigen<br />
Gelenktriebwagen mit „all-electric“-Ausrüstung<br />
und Nockenschaltwerk – wegen ihrer<br />
unkomplizierten Technik bei den potenziellen<br />
Empfängern gerne gesehen – wurden daher<br />
noch allesamt für den Linienbetrieb benötigt.<br />
Ausgangslage 1995<br />
Im Jahre 1995 gab es 547 derartige Triebwagen<br />
– davon 89 Typ E, 336 E 1 , 122 E 2 –<br />
und 429 dazu passende Beiwagen – 51 c 2 ,<br />
188 c 3 , 73 c 4 , 117 c 5 , allesamt von den ortsansässigen<br />
Unternehmen Lohner (ab 1970<br />
Bombardier-Rotax) und Simmering-Graz-<br />
Pauker (SGP) in Düwag-Lizenz gebaut.<br />
Dazu kamen noch einige vierachsige Gelenktriebwagen<br />
des Typs F (Baujahr 1963/<br />
64; Weiterbau von Zweiachsern mit Nachläufer-Drehgestell)<br />
sowie die 1955 <strong>bis</strong> 1959<br />
in Düwag-Lizenz gebauten Großraumzüge<br />
C 1 /c 1 . Diese Bauarten blieben im Einsatz,<br />
um den letzten hauptberuflichen Schaffnern<br />
weiterhin einen Arbeitsplatz bieten zu können.<br />
Denn die Triebwagen C 1 und F wurden<br />
nie auf schaffnerlosen Betrieb umgebaut<br />
und besaßen einen Schaffnerplatz nächst<br />
dem hinteren Einstieg. Der Schaffner war<br />
nicht nur für den Verkauf und die Entwertung<br />
der Fahrkarten zuständig, er bediente<br />
auch mittels Knopfdruck die Türen (ausgenommen<br />
Tür 1) und erteilte dem Fahrer die<br />
Abfahrtserlaubnis. Schließlich musste er<br />
mangels einer „Totmann-Ausrüstung“ am<br />
Fahrerplatz den Zug bei Bedarf mittels eines<br />
Notbremspedals zum Stehen bringen.<br />
Abschied von Typ F und C 1<br />
Mitte 1996 kam aber dann doch das Aus<br />
für den Typ F und die Abstellung der letzten<br />
C 1 /c 1 war ursprünglich für das Jahr 1997<br />
vorgesehen. Bereits Mitte 1996 initiierte die<br />
Firma Siemens aber eine Hilfsaktion für den<br />
im Bosnienkrieg schwer in Mitleidenschaft<br />
gezogenen Straßenbahnbetrieb in Sarajevo.<br />
Obwohl die Züge wegen ihres hohen Alters<br />
(<strong>bis</strong> zu 41 Jahre) und ihrer vergleichsweise<br />
komplizierten Technik – namentlich Druckluftausrüstung<br />
für Zusatz-, Festhalte- und<br />
Schleuderschutzbremse, Scheibenwischer,<br />
Sandstreueinrichtung – gar nicht für eine<br />
Weitergabe geeignet erschienen, kam es zur<br />
vorzeitigen Ausmusterung der letzten Garnituren<br />
<strong>bis</strong> Ende 1996.<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
51
Fahrzeuge<br />
Der Abtransport von je 13 Trieb- und<br />
Beiwagen erfolgte im Zeitraum Dezember<br />
1996 <strong>bis</strong> April 1997, wobei jeweils mehrere<br />
Garnituren gleichzeitig auf die Reise geschickt<br />
wurden. Die Verladung auf spezi elle<br />
Tiefladewagen der Eisenbahn erfolgte in der<br />
Hauptwerkstätte der Wiener Linien mittels<br />
zweier Feuerwehrkräne. Die Wiener Berufsfeuerwehr<br />
führte diese Aktionen im<br />
Rahmen von ohnehin notwendigen Übungen<br />
durch. Eingereiht in planmäßige Güterzüge<br />
ging es zunächst nach Split, von wo die<br />
Fahrzeuge auf dem Straßenweg nach Sarajevo<br />
gelangten.<br />
Exportschlager E 1<br />
Für die ab 1999 sukzessive ausgemusterten<br />
Gelenkwagen Typ E fanden sich wegen des<br />
hohen Alters und der schwachen Motorisierung<br />
zunächst keine Abnehmer. In diesem<br />
Zusammenhang muss aber auch erwähnt<br />
werden, dass die Wiener Linien aus eigenem<br />
Antrieb nicht nach potenziellen Kunden<br />
Ausschau hielten und auch seitens der Stadt<br />
Rotterdam: Der E 1 660 fährt im Stadtteil<br />
Charlois durch ein ruhiges Wohnviertel und<br />
wird in Kürze die gleichnamige Endstelle erreichen.<br />
Nur die Wagennummer und der<br />
Schriftzug „RET“ weisen am 16. April 2003<br />
auf den neuen Eigentümer hin<br />
In Utrecht kommen die E 6 gemeinsam mit<br />
1983 gebauten Stadtbahnwagen zum Einsatz.<br />
Die sehr unterschiedlichen Bauarten begegnen<br />
einander hier am 7. April 2010<br />
Wien oder Österreichs keine Hilfsaktionen<br />
für bedürftige Betriebe (z.B. in Rumänien)<br />
initiiert wurden.<br />
2001 erreichte die Wiener Linien aber<br />
eine Anfrage aus Rotterdam. Man wollte<br />
kurzfristig zwölf E 1 erwerben, die zu diesem<br />
Zeitpunkt aber noch gar nicht auf der „Abschussliste“<br />
standen. Da der Beginn der<br />
planmäßigen Ausmusterungen aber für das<br />
Folgejahr anstand, zog man die ersten Ausmusterungen<br />
vor und konnte die Lieferung<br />
von zehn Triebwagen für Sommer 2001 zusagen.<br />
Es handelte sich dabei aber nicht um<br />
die ältesten Fahrzeuge, sondern um die letzten<br />
E 1 , deren „Geamatic“-Steuerungen noch<br />
nicht mit Bauteilen der Firma Intermas modernisiert<br />
worden waren. Rotterdam erhielt<br />
daher zehn E 1 des Baujahres 1971 und darüber<br />
hinaus die ohnehin auszumusternden<br />
E 4626 und 4629.<br />
Weitere Anfragen ließen nicht lange auf<br />
sich warten: Im Sommer 2002 meldete die<br />
ungarische Stadt Miskolc Bedarf an zunächst<br />
neun E 1 an, die in Wien im Novem-<br />
52 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Wiener Exportwagen<br />
Braila: Der E 1 4689 wartet am 2. September<br />
2009 in der Endstelle Radu Negru auf seine<br />
Abfahrtszeit. Das passende Liniensignal „21“<br />
stammt aus Wien und wurde von Straßenbahnfreunden<br />
beigesteuert<br />
Craiova: Der E 1 659 (ex Rotterdam 659, ex<br />
Wien 4766) am 3. Juni 2008 im Einsatz auf Linie<br />
100. Die gelbe Tafel über dem Scheinwerfer<br />
nennt die amtliche Zulassungsnummer, die<br />
seit 2008 in Rumänien vorgeschrieben ist<br />
ber 2002 ausgemustert und umgehend auf<br />
dem Straßenweg umgesetzt wurden. 2003<br />
konnten die Wiener Linien erstmals acht<br />
Exemplare der bereits rund 40 Jahre alten<br />
Beiwagenserie c 3 verkaufen, und zwar<br />
ebenfalls nach Miskolc. Im Laufe des Jahres<br />
2003 unterzeichnete dann der Verkehrsbetrieb<br />
MPK der polnischen Stadt<br />
Krakau einen Vertrag zur Übernahme von<br />
je 30 E 1 und c 3 . Die vereinbarten Stückzahlen<br />
wurden in den Folgejahren mehrmals<br />
nach oben hin korrigiert. Mit Kattowitz erhielt<br />
ab 2010 ein weiterer polnischer Betrieb<br />
E 1 .<br />
Über einen Zwischenhändler gelangten<br />
ab 2005 auch insgesamt 16 E nach Sarajevo,<br />
2007 erhielt Graz drei E 1 und 2008/09<br />
organisierte das Unternehmen MT Eisenbahnbedarf<br />
(Betreiber der Museumstramway<br />
Mariazell) die Umsetzung von elf E 1 ins<br />
rumänische Braila.<br />
»Sorgenkinder« E 6 /c 6<br />
Anders gestaltete sich die Abgabe der Zweirichtungs-Sechsachser<br />
E 6 und c 6 , deren erste<br />
Exemplare 1979 für die damals noch bestehende<br />
Gürtellinie der Stadtbahn gebaut<br />
wurden und hier die bereits völlig veralteten<br />
Zweiachser N 1 /n 2 ablösten. Da man diese<br />
Stadtbahnlinie mittelfristig zur vollwertigen<br />
Erfolgstyp E/E 1<br />
<strong>Von</strong> 1959 <strong>bis</strong> 1976 beschafften die Wiener Linien<br />
(damals noch „Wiener Verkehrsbetriebe“) insgesamt<br />
427 sechsachsige Gelenktriebwagen der Ty -<br />
pen E und E 1 , mit denen die Wiener Straßenbahn<br />
grundlegend modernisiert werden konnte. Es handelt<br />
sich dabei um Düwag-Lizenzbauten, die sich<br />
aber in mehreren Punkten von ihren deutschen<br />
„Geschwistern“ unterscheiden. Die Produktion<br />
teilten sich die ortsansässigen Unternehmen Lohner<br />
und Simmering-Graz-Pauker (SGP) auf.<br />
Schwächere E, stärkere E 1<br />
Zunächst produzierten die beiden Firmen von<br />
1959 <strong>bis</strong> 1966 insgesamt 89 Wagen des Typs E,<br />
die sich jedoch wegen der schwachen Motorisierung<br />
(2 x 95 bzw. 110 kW) für einen Betrieb mit<br />
Beiwagen als wenig geeignet erwiesen. <strong>Von</strong> 1967<br />
<strong>bis</strong> 1976 wurde daher die deutlich stärkere, beiwagentaugliche<br />
Variante E 1 (2 x 150 kW) beschafft.<br />
Ab Mitte der 1990er-Jahre veränderte sich<br />
das Erscheinungsbild durch die Verstärkung des<br />
Prallschutzes an der Front und die Anbringung<br />
von Schallschutzverkleidungen an den Drehgestellen.<br />
Die 427 Triebwagen mit nahezu identischem<br />
Aussehen machten lange Zeit mehr als zwei Drittel<br />
des Fuhrparks aus, waren in allen Teilen des<br />
Netzes präsent und prägten das Bild der Wiener<br />
Straßenbahn nachhaltig. Die E kamen dabei in der<br />
Regel solo und die E 1 vorwiegend mit vierachsigen<br />
Beiwagen zum Einsatz. Bis Ende der 1990er-<br />
Jahre waren die Wagen fast vollzählig vorhanden,<br />
nur die E 1 4557 (Unfall) und 4860 (Brand) wurden<br />
1980 bzw. 1987 vorzeitig ausgemustert. Erst<br />
1998/99 kam es wieder zu Ausmusterungen, als E<br />
4403 (Unfall) und E 1 4498 (seit 1990 Drehstrom-<br />
Versuchswagen) außer Standes genommen wurden.<br />
Nach der Inbetriebnahme der ersten ULF-Serienwagen<br />
begannen 1999 die planmäßigen<br />
Ausmusterungen von E und seit 2001 werden<br />
auch die E 1 sukzessive abgestellt. Die letzten E<br />
verkehrten am 25. Oktober 2007 auf der Linie 62<br />
und mit Ende 2012 waren noch 150 E 1 der Baujahre<br />
1971 <strong>bis</strong> 1976 im Einsatzbestand. Per Januar<br />
2013 waren an Schultagen noch <strong>bis</strong> zu 85 E 1<br />
mit Beiwagen und 25 Solowagen im Einsatz. Mit<br />
der Abstellung der letzten E 1 ist nach heutigem<br />
Stand der Dinge um 2018 zu rechnen.<br />
U-Bahn-Linie U6 umbauen wollte, waren<br />
die Züge für einen späteren Einsatz im Straßenbahnnetz<br />
vorgesehen und auch entsprechend<br />
konzipiert. Aus kosten- und denkmalpflegerischen<br />
Gründen entschied sich<br />
die Stadt Wien aber schließlich, die U6 weiterhin<br />
als „Stadtbahn“ mit niedrigen Bahnsteigen<br />
und Oberleitung zu betreiben und<br />
zusätzlich zum vorhandenen Wagenpark bei<br />
Bombardier Wien Mittelflurwagen des Typs<br />
T anzuschaffen. Enorme Fahrgastzuwächse<br />
und technische Probleme mit dem Mischbetrieb<br />
veranlassten die Wiener Linien aber<br />
schließlich, auch die <strong>bis</strong> 1991 beschafften E 6<br />
(Nr. 4901–4948) und c 6 (Nr. 1901–1946)<br />
durch die breiteren und barrierefrei zugänglichen<br />
T zu ersetzen.<br />
Zweirichtungswagen für<br />
Utrecht und Krakau<br />
Da sie wegen ihres geringen Alters in den<br />
Büchern noch nicht abgeschrieben waren,<br />
musste man aktiv nach potenziellen Käufern<br />
suchen. Zunächst bekundete die phi-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
53
Fahrzeuge<br />
Krakau: Ab dem E 1 124 wurde bei der Standardlackierung das Beige durch Weiß ersetzt. Am 15. April 2009 begegnen sich die Züge 153 + 553<br />
und 123 + 583 sowie der Triebwagen 2033. Am Beiwagen sind die umgebauten Rückleuchten zu erkennen<br />
Krakau: Dem EU8N 3023 sieht man seine Herkunft nicht an. Er entstand 2011 aus je einem E 6<br />
und c 6 . Das eingefügte Niederflur-Mittelteil baute die Firma Autosan SA in Sanok (18. Mai 2012)<br />
Übersicht der E 1 -Umsetzungen<br />
Stadt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ges.<br />
Rotterdam*) 10 10<br />
Miskolc 9 3 13 1 26<br />
Krakau 2 11 10 13 10 14 14 8 1 83<br />
Graz 3 3<br />
Braila 6 5 11<br />
Kattowitz 1 18 11 30<br />
gesamt 10 9 5 24 10 13 14 20 19 9 18 12 163<br />
*) 9 Wagen 2005 nach Craiova weitergegeben<br />
lippinische Hauptstadt Manila Interesse, die<br />
eine Stadtbahnlinie mit entsprechend adaptierten<br />
CKD-Fahrzeugen des Typs KT8D5<br />
(Typ RT8M) betreibt. Als Vertreter des Verkehrsbetriebs<br />
in der Wiener Hauptwerkstätte<br />
die für einen Massenverkehr völlig<br />
ungeeigneten Fahrzeuge begutachteten, ließ<br />
das Interesse allerdings schlagartig nach,<br />
das Geschäft kam nicht zustande. Käufer<br />
fanden sich schließlich in den Niederlanden<br />
und Polen: Utrecht übernahm zwischen<br />
2008 und 2010 insgesamt 16 E 6 sowie elf c 6<br />
und der „Stammkunde“ Krakau kaufte im<br />
selben Zeitraum 27 E 6 und 26 c 6 , denen jedoch<br />
in der neuen Heimat ein großzügiger<br />
Umbau bevorstand.<br />
In drei Teilen werden in der Reihenfolge<br />
ihrer ersten Umsetzungen die Wiener Gebrauchtwagen<br />
in den Übernahmebetrieben<br />
näher vorgestellt.<br />
Sarajevo<br />
Die ersten C 1 /c 1 -Garnituren trafen am 7. Januar<br />
1997 gemeinsam mit einem Team der<br />
Firma Siemens und der Wiener Linien in<br />
der neuen Heimat ein, im Mai 1997 waren<br />
schließlich alle 13 Garnituren am Be -<br />
stimmungsort. Der Verkehrsbetrieb GRAS<br />
(Gradski Saobracaj Sarajevo – Städtischer<br />
Verkehr Sarajevo) führte vor der Inbetriebnahme<br />
einige Umbauten durch. So erhielten<br />
die Wagen – damals in Wien noch nicht übliche<br />
– Rückblickspiegel, die Türsteuerung<br />
wurde auf zentrales Schließen vom Fahrer-<br />
54 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Wiener Exportwagen<br />
Sarajevo: Wegen Gleisarbeiten war das Netz im August 1998 vom Depot abgeschnitten und die Reservezüge wurden am nicht benutzten<br />
Streckenabschnitt abgestellt. Darunter befanden sich am 23. August 1998 auch drei C 1 /c 1 -Vollwerbezüge – vorn Zug 402 + 4002<br />
platz aus umgebaut und es kamen pro<br />
Fahrzeug mehrere Lochentwerter zum Einbau.<br />
Teilweise bereits in Wien wurden die<br />
Schaffnerplätze im Heck ausgebaut und die<br />
Sitzanordnung geändert, im Frontbereich<br />
fanden sich nunmehr Einzel- statt Doppelsitze.<br />
Außerdem erfolgte der Umbau der Innenbeleuchtung<br />
von Leuchtstoffröhren auf<br />
Glühlampen. Die GRAS nahm die Züge ab<br />
Februar 1997 mit den Nummern 400–412<br />
(Triebwagen) und 4000–4012 (Beiwagen)<br />
in Betrieb, wobei die Beiwagen stets mit<br />
dem nummernmäßig passenden Triebwagen<br />
gekuppelt wurden. Erstmals verfügte<br />
der normalspurige Straßenbahnbetrieb über<br />
Beiwagen, die von zahlreichen Fahrgästen<br />
als „Freibrief“ für eine Fahrt ohne gültigen<br />
Fahrausweis angesehen wurden.<br />
Problem Pneumatik<br />
Für das Fahr- und Werkstattpersonal, das<br />
„All-electric“-Fahrzeuge gewohnt war, stellte<br />
die Bedienung und Wartung der C 1 / c 1<br />
eine Herausforderung dar, gab es doch hier<br />
pneumatische Einrichtungen. Darunter befand<br />
sich auch eine mittels Pedal zu betätigende<br />
Druckluftbremse, die in Wien nur bei<br />
Notbremsungen, in Sarajevo allerdings<br />
auch bei normalen Betriebsbremsungen benutzt<br />
wurde. Zur Herstellung der erforderlichen<br />
Druckluft war der Kompressor daher<br />
fast ständig in Betrieb, und Störungen an<br />
diesem Verschleißteil führten öfters zum<br />
Sarajevo: Vor dem Holiday Inn fährt am 17. August 2009 der E 702 (ex 4433) Richtung Zentrum.<br />
An Schultagen fahren gewöhnlich vier Wagen, die auf den Linien 1 und 4 zum Einsatz kommen<br />
Ausfall von Garnituren. So kam es bereits<br />
im Jahr 2000 zur Abstellung der ersten C 1 /<br />
c 1 und <strong>bis</strong> Ende 2004 wurden alle Züge aus<br />
dem Linienbetrieb abgezogen.<br />
Die von den Initiatoren angestrebte Einsatzdauer<br />
von fünf Jahren konnte allerdings<br />
dennoch teilweise übertroffen werden.<br />
Die Garni turen erhielten nie Neulack<br />
im aktuellen, gelb/blauen Farbschema der<br />
GRAS, die Wiener Farben (rot/weiß) verschwanden<br />
aber durch das Aufbringen von<br />
Totalwerbungen dennoch bald aus dem<br />
Stadtbild von Sarajevo.<br />
<strong>Von</strong> 2007 <strong>bis</strong> 2009 verschrottete die<br />
GRAS in Eigenregie alle Fahrzeuge mit Ausnahme<br />
der Garnitur 407/4007, die zur betriebsfähigen<br />
Aufarbeitung und musealen<br />
Erhaltung vorgesehen ist. Sie ist allerdings<br />
seit der Ausmusterung im Freien abgestellt<br />
und die Witterungseinflüsse setzten ihr bereits<br />
stark zu.<br />
wird fortgesetzt · WOLFGANG KAISER<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
55
Geschichte<br />
56 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Einst & Jetzt<br />
Einst&Jetzt<br />
Im Südostens Lettlands liegt<br />
Daugavpils (Dünaburg), die<br />
zweitgrößte Stadt des Landes.<br />
Erst zu sowjetischer Zeit bekam<br />
die Stadt eine Straßenbahn,<br />
sie wurde am 5. November<br />
1946 in russischer<br />
Breitspur (1.524 mm) eröffnet.<br />
Der Betrieb wurde langsam<br />
ausgebaut und umfasst<br />
heute drei Linien, die von<br />
mehreren Wagentypen befahren<br />
werden. Das Bild vom<br />
30. Mai 1999 zeigt eine vom<br />
Hauptbahnhof kommende<br />
RWS-6-Doppeltraktion an<br />
der Haltestelle Tirgus<br />
(Markt). Sie hat noch die alte<br />
Farbgebung aus sowjetischer<br />
Zeit.<br />
Ungewöhnlich waren die<br />
beiden, während der Fahrt<br />
stets an die Fahrleitung angelegten<br />
Stangenstromabnehmer;<br />
in der Hauptstadt Riga<br />
war dies ebenfalls so üblich.<br />
Die Zeiten ändern sich<br />
auch im Baltikum und so<br />
steht jetzt am Markt ein großes<br />
Einkaufszentrum, von<br />
dem auf dem Bild vom 2. Mai<br />
2012 ein kleines Stück zu<br />
sehen ist. Lediglich das Stationsschild<br />
der Straßenbahn<br />
scheint auf beiden Bildern<br />
gleichgeblieben zu sein. Noch<br />
immer sind einige der RWS-6-<br />
Wagen in Doppeltraktion<br />
unterwegs, ebenso wie die<br />
russischen KTM-5-Triebwagen,<br />
von denen das frisch gestrichene<br />
Exemplar Nr. 105<br />
gerade an der Haltestelle<br />
steht. T3DC-Tatrawagen, die<br />
aus Schwerin angekauft wurden,<br />
unterstützen die Fahrzeugflotte,<br />
auch sie erhielten<br />
Stangenstromabnehmer.<br />
TEXT UND FOTOS:<br />
BERNHARD KUSSMAGK<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
57
Geschichte<br />
Deutschlands Steilste!<br />
Die Neunkircher Straßenbahn <strong>Von</strong> 1907 <strong>bis</strong> 1978 verkehrte in Neunkirchen (Saar) eine regelspurige<br />
Straßenbahn. Ihr knapp 300 Meter langer Abschnitt mit 11,07 Prozent Steigung ist in<br />
Deutschland allgemein bekannt, aber dieser Betrieb bot noch andere Besonderheiten<br />
Nach Saarbrücken (1899) erhielt das<br />
Dorf (!) Neunkirchen (erst seit<br />
1922 Stadtrecht) als zweiter Ort<br />
auf dem Gebiet des heutigen Saarlandes<br />
eine elektrische Straßenbahn. Nachdem<br />
der Gemeinderat dazu im April 1906<br />
den Beschluss gefasst hatte, erfolgte im September<br />
des gleichen Jahres der erste Spatenstich.<br />
Knapp ein Jahr danach war es soweit:<br />
Am 10. September 1907 fand die<br />
feierliche Eröffnung der 5,3 Kilometer langen<br />
ersten Linie statt, der Regelbetrieb startete<br />
drei Tage später. Als Baukosten waren<br />
890.257 Reichsmark zu verbuchen.<br />
Auf ihrer Fahrt hatten die Straßenbahnwagen<br />
enorme Steigungen zu überwinden,<br />
denn sie starteten am höchsten Punkt Neunkirchens,<br />
„auf der Scheib“, und durchquerte<br />
dann Neunkirchen von Süd nach Nord<br />
<strong>bis</strong> ins benachbarte Wiebelskirchen. Endpunkt<br />
war dort zunächst am Hangarder<br />
Weg (heute Wibilostraße/Ostertalstraße).<br />
Zwischen der Zweibrücker Straße auf der<br />
Scheib und dem Stummplatz bewältigten<br />
die Wagen auf der Hüttenbergstraße auf einer<br />
Länge von knapp 300 Metern ein Gefälle<br />
von 11,07 Prozent, was der regelspurigen<br />
Straßenbahn eine lange Betriebszeit<br />
sichern sollte. Dieser Abschnitt war zugleich<br />
Deutschlands und sogar Europas steilster<br />
Schienenabschnitt, der ohne Zahnstange im<br />
reinen Adhäsionsbetrieb betrieben wurde.<br />
Da sich entlang der Linie kein für das<br />
Depot geeignetes Grundstück im Eigentum<br />
der Gemeinde befand, entstand der Betriebshof<br />
einschließlich Verwaltungsgebäude<br />
zwischen der Wellesweiler Straße und der<br />
Norduferstraße, zu dessen Anschluss von<br />
der Bahnhofstraße aus ein über einen Kilometer<br />
langes Betriebsgleis durch die Wellesweiler<br />
Straße verlegt worden war.<br />
Der Betrieb lief positiv an – im ersten Betriebsjahr<br />
zählte die Gemeinde 1,6 Millionen<br />
Fahrgäste, wodurch sie Einnahmen in<br />
Höhe von 152.382 Reichsmark aus dem<br />
Verkauf von Fahrkarten erzielte. In den folgenden<br />
Jahren stieg die Zahl der beförderten<br />
Personen stetig.<br />
Erweiterungen in den 1920er-Jahren<br />
Im Jahr 1908 begannen die Planungen für<br />
eine zweite Linie nach Spiesen, die aber erst<br />
nach dem Ersten Weltkrieg in Angriff genommen<br />
wurden. Der Südteil des Regierungsbezirks<br />
Trier der preußischen Rheinprovinz<br />
sowie der Westteil der bayerischen<br />
Pfalz waren ab 1920 als „Saargebiet“ für 15<br />
58 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Neunkirchen<br />
Die legendäre Hüttenbergstraße mit 11,07 Prozent Steigung bzw. Gefälle, hier in den 1970er-Jahren. Damals war sie für<br />
den Straßenverkehr nur als Einbahnstraße zugelassen, links geht die Vogelstraße ab<br />
K. OEHLERT-SCHELLBERG<br />
LINKS Am 6. April<br />
1957 kam es vor<br />
dem Hüttenwerk zu<br />
dieser Begegnung<br />
des Tw 17<br />
(SGCM/Alstohm<br />
1927) samt des aus<br />
der Anfangszeit<br />
stammenden Bw 32<br />
mit einem Obus<br />
D. WALTKING,<br />
SLG. A. REUTHER (2)<br />
Daten & Fakten: Neunkirchen<br />
Eröffnungstag: . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.09.1907<br />
Spurweite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.435 mm<br />
erste Betreibergesellschaft:<br />
Gemeindeverwaltung Neunkirchen (Saar)<br />
Betreibergesellschaft ab 1925:. . . . . . . . . . . . . .<br />
Straßen- und Kleinbahn AG Neunkirchen<br />
Betreibergesellschaft ab 1938:. . . . . . . . . . . . . .<br />
Neunkircher Straßenbahn AG<br />
maximale Anzahl Linien: . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
maximale Netzausdehnung in km: . . . . . . . 19,2<br />
größte Steigung:. . . . . . . . . . . . . . 11,07 Prozent<br />
Einstellungstag: . . . . . . . . . . . . . . . . 10.06.1978<br />
Der 1907 von van den Zypen und der AEG gebaute Tw 3 hat am 8. Mai 1953 auf Linie 1 den<br />
Stummplatz erreicht. Er zeigt sich mit der für Neunkirchen typischen nachträglichen Verglasung<br />
Jahre offiziell dem Völkerbund unterstellt.<br />
In dieser Zeit zählte die Region zum französischen<br />
Wirtschafts- und Währungsgebiet,<br />
was die Beschaffung von Ersatzteilen oder<br />
neuen Wagen aus Deutschland erschwerte.<br />
In diese Zeit fällt jedoch auch die längst<br />
überfällige Verleihung des Stadtrechtes an<br />
Neunkirchen 1922. Danach gründete die<br />
Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Kreis<br />
Ottweiler am 12. August 1925 die Straßenund<br />
Kleinbahn AG in Neunkirchen (Saar).<br />
Die vorhandene Straßenbahnlinie Scheib –<br />
Wiebelskirchen brachte die Stadtverwaltung<br />
in die neue Gesellschaft ein. <strong>Von</strong> dieser wurde<br />
zunächst die vom Stumm-Denkmal südwestlich<br />
über Dechen und Heinitz nach<br />
Spiesen führende 4,74 Kilometer lange Strecke<br />
gebaut und am 9. April 1927 in Betrieb<br />
genommen. Am 9. Dezember 1927 erweiterte<br />
die AG diese Linie vom Stumm-Denkmal<br />
in östliche Richtung. Dazu wurde die<br />
<strong>bis</strong>her lediglich als Betriebsgleis genutzte<br />
Zufahrt zum Depot in der Wellesweilerstraße<br />
um etwa 500 Meter <strong>bis</strong> zum Schlachthof<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
59
Geschichte<br />
In Spiesen endete zwar die normalspurige Neunkircher Straßenbahn, aber es bestand Anschluss zur meterspurigen Straßenbahn nach Saarbrücken<br />
(hinten rechts). Tw 14 steht am 23. November 1953 zur Rückfahrt nach Neunkirchen bereit<br />
P. BOEHM, SLG. A. REUTHER<br />
Schematische Darstellung des Neunkirchener<br />
Straßenbahnnetzes<br />
K. OEHLERT-SCHELLBERG/AL<br />
verlängert und anschließend für den öffentlichen<br />
Verkehr freigegeben.<br />
Zwei Tage vor Einweihung des Astes zum<br />
Schlachthof wurde am 7. Dezember 1927<br />
der 1.010 Meter lange Abschnitt von der<br />
Scheib in ebenfalls östlicher Richtung zur<br />
Roten-Kreuz-Siedlung am Steinwald eröffnet.<br />
Im Jahre 1928 stellte die AG hingegen<br />
eine neue, größere Wagenhalle fertig.<br />
Ergänzt wurde das Netz im Jahre 1931<br />
durch die Strecke zur Ortschaft Heiligenwald,<br />
die am 24. Oktober dem Verkehr<br />
übergeben wurde. Damit erreichte das Straßenbahnnetz<br />
eine Länge von 19 Kilometern;<br />
der Oberbau war <strong>bis</strong> auf einen 2,6 Kilometer<br />
langen Abschnitt eingleisig mit<br />
Ausweichen angelegt.<br />
Wichtigstes Verkehrsmittel<br />
Im Jahr 1934, als die Industrie- und Hüttenstadt<br />
Neunkirchen auf 60.000 Einwohner<br />
angewachsen war, leistete die Straßenbahn<br />
800.000 Wagenkilometer und beförderte in<br />
diesem Jahr drei Millionen Fahrgäste. Im folgenden<br />
Jahr stimmten 90,8 Prozent der<br />
Menschen im Saargebiet für die Angliederung<br />
ihrer Heimat an das Deutsche Reich.<br />
Bereits ab 1925 waren von der Straßenund<br />
Kleinbahn AG zusätzlich mehrere Buslinien<br />
eingerichtet worden, welche die Orte<br />
Elversberg, Limbach, Heiligenwald und<br />
Hangard-Fürth bedienten. Doch bereits im<br />
Jahre 1936 wurde dieser Betriebszweig auf-<br />
60 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Neunkirchen<br />
Der zur Erstausstattung gehörende Triebwagen 10 (AEG, Baujahr 1907) ist im Jahr 1942 auf der Linie 1 ohne Beiwagen in Richtung Wiebels kirchen<br />
unterwegs – hier am Stummplatz im Stadt zentrum von Neunkirchen<br />
F. GRÜNWALD, SLG. VDVA<br />
grund mangelnder Rentabilität eingestellt<br />
und im Oktober an die Deutsche Reichspost<br />
verkauft.<br />
Im folgenden Jahr erreichte der Wagenpark<br />
der AG seinen höchsten Stand. Er umfasste<br />
22 Trieb- sowie fünf Beiwagen. Am<br />
16. August 1938 änderte die Aktiengesellschaft<br />
ihren Unternehmensnamen in Neunkircher<br />
Straßenbahn AG.<br />
Der 1927 gebaute Tw 16 und der Bw 31 von 1908 sind am 23. November 1952 auf der Linie 4<br />
unterwegs, hier auf der Saarbrücker Straße, Nähe Stummplatz<br />
P. BOEHM, SLG. A. REUTHER<br />
Die Straßenbahn im<br />
Zweiten Weltkrieg<br />
Die nahe Grenze zu Frankreich hatte für die<br />
Menschen an der Saar bereits wenige Tage<br />
nach Kriegsbeginn im September 1939<br />
Konsequenzen: Saarbrücken wurde evakuiert<br />
und viele Einwohner mussten sich im<br />
Hinterland für mehrere Monate eine neue<br />
Bleibe suchen, wofür auch die Stadt Neunkirchen<br />
genutzt werden durfte. Das schlug<br />
sich auch in den Beförderungszahlen der<br />
Straßenbahn nieder.<br />
Der Krieg hatte aber auch auf die Spurweite<br />
der Neunkircher Linie 3 Auswirkungen!<br />
An ihrem Endpunkt in Spiesen bestand<br />
seit ihrer Eröffnung die Möglichkeit, in die<br />
Wagen der auf meterspurigen Gleisen verkehrenden<br />
Gesellschaft für Straßenbahnen<br />
im Saartal AG nach Saarbrücken umzusteigen.<br />
Im Februar 1940 wurde der Abschnitt<br />
von Dechen nach Spiesen der Neunkircher<br />
Straßenbahn AG an die Saarbrücker-Gesellschaft<br />
abgetreten. Diese ließ den Abschnitt<br />
von 1.435 auf 1.000 Millimeter umspuren<br />
und in Spiesen an die Linie 9 der<br />
Saarbrücker Straßenbahn anschließen. Auf<br />
diese Weise war auf den meterspurigen Gleisen<br />
ein durchgehender Güterverkehr von<br />
Saarbrücken ohne Umladen zur Zeche Heinitz<br />
möglich.<br />
Bereits zum 1. November 1941 wurde<br />
dieser Streckenabschnitt der Linie 3 jedoch<br />
wieder auf Normalspur zurückgebaut, damit<br />
die Neunkirchener Kumpel ihrerseits<br />
ohne Umsteigen in die Zeche kamen. Im<br />
weiteren Kriegsverlauf wurden Umformeranlagen<br />
für die 600-Volt-Oberleitung sowie<br />
Büroräume und Werkstattbereiche der Straßenbahn<br />
durch Luftangriffe schwer beschädigt.<br />
Insgesamt drei Triebwagen brannten<br />
aus und galten als Totalschaden. Der Stra-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
61
Geschichte<br />
Auf der Scheib treffen sich die Straßenbahnen auf der Zweibrücker Straße. Der Blick aus der Steinwaldstraße in die Hermannstraße zeigt eine<br />
Begegnung zweier Esslinger Gelenktriebwagen im letzten Betriebsjahr der Neunkircher Straßenbahn K. OEHLERT-SCHELLBERG (4)<br />
Der Blick aus einem Esslinger auf den Schwesterwagen Nr. 6, der 1978<br />
den Hüttenberg zum Oberen Markt hinauffährt<br />
Die Anfang der 1960er-Jahre von der Maschinenfabrik Esslingen (ME)<br />
gelieferten GT4-N waren mit geschwungenen Holzsitzen versehen<br />
ßenbahnbetrieb kam letztendlich vor der<br />
Besetzung bzw. dem Kriegsende Mitte März<br />
1945 völlig zum Erliegen.<br />
Die Entwicklung nach 1945<br />
Nach Eroberung des Saargebietes durch die<br />
Amerikaner wurden die Schäden an den<br />
Straßenbahnanlagen zwischen der Innenstadt<br />
und Spiesen rasch behoben. Am 19.<br />
April 1945 – wenige Wochen vor Kriegsende<br />
– ging dieser Abschnitt vom Stumm-<br />
Denkmal auf Anweisung der Amerikaner<br />
wieder in Betrieb. Im Juli 1945 übernahmen<br />
die Franzosen die Besetzung des Saargebietes.<br />
Am 8. November 1947 wurde dann der<br />
teilautonome Staat Saarland gegründet, der<br />
wirtschaftlich komplett an Frankreich angeschlossen<br />
war. Zuvor hatte die Straßenbahn<br />
AG im Jahr 1946 mit 13 Millionen Fahrgästen<br />
ihren Nachkriegsrekord erreicht. Bis<br />
1949 nahm sie auch die übrigen Linien nach<br />
deren Reparatur wieder in Nutzung.<br />
Im Jahre 1950 wurde durch die AG der<br />
Omnibusbetrieb wieder aufgenommen und<br />
<strong>bis</strong> zum Jahre 1955 auf vier Buslinien erweitert.<br />
Der Ausbau des Busbetriebes wurde<br />
von den Franzosen gefördert, da Frankreich<br />
damals gegen Straßenbahnen eingestellt war<br />
und die französische Waggonindustrie nach<br />
1942 keine Trams mehr baute – in Paris war<br />
die letzte Straßenbahnlinie bereits 1938 auf<br />
Busbetrieb umgestellt worden.<br />
Der Obus kommt!<br />
Als moderne Form der Busse kam nun in<br />
Neunkirchen der Obus ins Spiel, zumal auf<br />
Fahrleitung und Umformer der vorhandenen<br />
Straßenbahn zurückgegriffen werden<br />
konnte. Zum 1. August 1953 löste die neue<br />
62 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Neunkirchen<br />
Erinnerungen ...<br />
Ein ehemaliger Neunkircher<br />
Straßenbahner berichtet<br />
Die Straßenbahnführer hatten für Tage mit heftigem<br />
Glatteis oder Schnee die Anweisung, bei der<br />
ersten Fahrt frühmorgens am Stummdenkmal mit<br />
der Bahn über eine Weiche die Straßenseite zu<br />
wechseln und den Hüttenberg auf dem in Fahrtrichtung<br />
linken Gleis hinaufzufahren. Dabei sollten<br />
sie ständig den Sandstreuer betätigen. Die Gefahr,<br />
dabei mit einer bergabfahrenden Bahn zusammenzustoßen,<br />
bestand ja nicht, weil es an diesem<br />
Tag die erste Bahn auf der Strecke war. Aber mit<br />
dem prophylaktisch ausgestreuten Sand sollte der<br />
Glätte auf den Schienen entgegengewirkt werden,<br />
damit der Wagen – wenn er später vom Steinwald<br />
zurückkam – den Hüttenberg sicher und ohne<br />
Bremsprobleme wieder hinunterfahren konnte. (notiert<br />
von Rainer Freyer)<br />
Kinderbelustigung<br />
Neunkircher Bürger erinnern sich: Manchmal hatten<br />
wir Kinder einen Heidenspaß, wenn wir ein 1-, 2- oder<br />
5-Franken-Stück – sie waren aus Aluminium – auf die<br />
Schienen legten, kurz bevor eine Straßenbahn die<br />
Stelle passierte. Und wie stolz waren wir dann auf unsere<br />
total platt gewalzte Münze, die nun eine ovale<br />
Form hatte, hauchdünn und fast doppelt so groß<br />
wie vorher! Allerdings haben wir das nur ganz selten<br />
getan, denn wir konnten es uns eigentlich nicht<br />
leisten, Geldstücke nur zum Spaß zu „entwerten“.<br />
Ein <strong>bis</strong> fünf Franken, das war damals viel Geld für<br />
uns. Ich erinnere mich daran, dass unsere ganze<br />
Familie einmal überglücklich war, als mein Bruder<br />
Klaus die unglaubliche Summe von 500 Franken auf<br />
der Straße gefunden und nach Hause gebracht hatte.<br />
Umgerechnet wären das heute nur etwas mehr<br />
als zwei Euro, aber man konnte damals viel mehr<br />
damit kaufen als heute ... RAINER FREYER<br />
Obuslinie 4 die parallel geführte Straßenbahnlinie<br />
auf dem 7,4 km langen Abschnitt<br />
vom Neunkircher Zentrum nach Heiligenwald<br />
ab. Außerdem errichtete die Straßenbahn-AG<br />
eine 2,1 Kilometer lange Obus-<br />
Betriebsstrecke zum Depot am Schlachthof.<br />
Bereits ein knappes Jahr später wurde<br />
auch der Streckenabschnitt vom Stumm-<br />
Denkmal über Hauptbahnhof <strong>bis</strong> nach Wiebelskirchen<br />
von der Obuslinie 4 übernommen.<br />
Grund waren Bergschäden und der<br />
bevorstehende Ausbau der Bundesstraße 41.<br />
Die Straßenbahn ist unverzichtbar<br />
Doch auf die Straßenbahnlinie 2 vom<br />
Schlachthof zum Steinwald sowie die Linie<br />
3 vom Schlachthof nach Spiesen konnte das<br />
Verkehrsunternehmen wegen der hohen<br />
Fahrgastzahlen sowie wegen der steilen<br />
Hüttenbergstraße nicht verzichten. Daher<br />
wurde am 9. August 1959 die Umstellung<br />
vom Stangenstromabnehmer mit Schleifschuh<br />
auf Scherenstromabnehmer vollzogen.<br />
Die Bewohner an den Strecken dankten<br />
es, war doch danach der Radioempfang<br />
ohne Störgeräusche möglich. Seit Januar<br />
1957 gehörte das Saarland übrigens politisch<br />
wieder zu Deutschland, seit dem 6. Juli<br />
1959 auch wirtschaftlich – ab diesem Tag<br />
galt auch im Saarland die Deutsche Mark<br />
als alleiniges Zahlungsmittel.<br />
Neue Wagen für Neunkirchen<br />
Ebenfalls zum Ende des Jahres 1959 bestellte<br />
der Verkehrsbetrieb bei der Maschinenfabrik<br />
Esslingen (ME) acht GT4 für den Zweirichtungsbetrieb,<br />
wie sie in ähnlicher Art<br />
auch Freiburg (1960) und Reutlingen (1963)<br />
erhielten. Die offizielle Bezeichnung lautete<br />
„GT 4N“ – das „N“ stand dabei für Normalspur,<br />
denn alle weiteren GT4-Wagen der<br />
ME wurden für Meterspurbetriebe gebaut.<br />
Im Januar 1961 wurde das erste Fahrzeug<br />
angeliefert. Fortan wurde die Linie 2 mit<br />
vier und die Linie 3 mit drei Fahrzeugen betrieben.<br />
Da Linie 3 nach Spiesen zwar eingleisig,<br />
aber meist auf eigenem Bahnkörper<br />
Ein „Nachschuss“ von der Marktstraße zum Oberen Markt auf den Tw 8. <strong>Von</strong> der Scheib kommend<br />
fährt er hinter der Station Oberer Markt dann später in das Gefälle der Hüttenbergstraße<br />
verlief, erreichte man mit den neuen Wagen<br />
eine erheblich höhere Reisegeschwindigkeit.<br />
Doch bereits im Jahre 1964 deutete sich<br />
die Schließung der Zechen im Raum Heinitz<br />
an. Nachdem sich diese Befürchtungen bewahrheitet<br />
hatten, rechtfertigten die Fahrgastzahlen<br />
auf der Linie 3 keinen Straßenbahnbetrieb<br />
mehr. Außerdem waren die<br />
Gleise und Bahnkörper reparaturbedürftig,<br />
so dass die Strecke am 29. November 1965<br />
auf Einmann-Omnibusbetrieb umgestellt<br />
wurde. Der Obusbetrieb war in Neunkirchen<br />
bereits am 31. März 1964 eingestellt worden.<br />
Letzter Betrieb auf Linie 2<br />
Fortan verkehrte nur noch die Straßenbahnlinie<br />
2 auf dem 5,4 km langen Streckenabschnitt<br />
zwischen Steinwald, Scheib<br />
und Stumm-Denkmal mit Abzweig zum<br />
Schlachthof und kurzem Streckenabschnitt<br />
zum Hauptbahnhof. Damit galt Neunkirchen<br />
damals als kleinster Straßenbahnbetrieb<br />
der Bundesrepublik Deutschland. Der<br />
Betrieb erfolgte überwiegend im 10-Minuten-Betrieb<br />
mit vier Triebwagen. Daher<br />
brauchte der durch einen Unfall auf der Linie<br />
3 schwer beschädigte Triebwagen 7<br />
nicht mehr in Stand gesetzt werden.<br />
An einen Ersatz der Straßenbahnlinie 2,<br />
die den etwa einen Kilometer langen Abschnitt<br />
der Linie 3 von der Wellesweiler<br />
Straße <strong>bis</strong> zum Schlachthof ebenfalls übernommen<br />
hatte, durch Busse war zu diesem<br />
Zeitpunkt nicht zu denken. Ein Omnibuseinsatz<br />
erschien auf der Hüttenbergstraße<br />
mit ihrer Steigung von 1:9,03 = 11,07 Prozent<br />
besonders im Winter nicht möglich, da<br />
das Kondenswasser der Kühltürme der benachbarten<br />
Eisenwerke die Straßenfahrbahn<br />
regelmäßig gefrieren ließ.<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
63
Geschichte<br />
Seit 1965 war das<br />
nördliche Streckenende<br />
der Straßenbahn<br />
am Hauptbahnhof<br />
Neunkirchen. Die<br />
Endhaltestelle befand<br />
sich dabei unmittelbar<br />
auf der<br />
Bahnhofsbrücke, dahinter<br />
beginnt die<br />
Bahnhofstraße<br />
K. OEHLERT-SCHELLBERG (3)<br />
Mit einer tüchtig nach oben gerundeten Steigungsangabe<br />
warben die Fahrscheine für die<br />
letzte Fahrt<br />
Windstärke 8 seitlich schwankte. Technische<br />
Bedenken gegen das Befahren der 11,07-<br />
Prozent-Steigung mit Straßenfahrzeugen waren<br />
nicht mehr aufrecht zu halten, da die<br />
neueren Busse im Netz Steigungen <strong>bis</strong> 16<br />
Prozent problemlos bewältigten.<br />
Der nordöstliche Endpunkt der Neunkircher Straßenbahn befand sich seit 1927 in der Wellesweilerstraße.<br />
1978 hat ein GT4-N die Endhaltestelle Schlachthof erreicht<br />
Im Jahre 1973 wurden die sieben noch<br />
vorhandenen Triebwagen auf Einmann-Betrieb<br />
umgebaut, um einen effizienteren Betrieb<br />
zu ermöglichen. Zunächst bestand die<br />
Absicht, den Schienenbetrieb <strong>bis</strong> zur Abschreibung<br />
der GT 4N im Jahre 1981 aufrecht<br />
zu erhalten, doch wirtschaftliche und<br />
verkehrstechnische Gründe zwangen zu einer<br />
früheren Umstellung. Die Schienen waren<br />
weitgehend abgefahren, die eingleisige<br />
Seitenlage zwischen Scheib und Steinwald<br />
und zwischen Innenstadt und Betriebshof<br />
brachte besonders zu den Hauptverkehrszeiten<br />
bedenkliche Verkehrssituationen mit<br />
sich, wenn die Straßenbahn im Gegenverkehr<br />
dem Individualverkehr begegnete. Heimische<br />
Verkehrsteilnehmer konnten mit<br />
dieser Situation gut umgehen, auswärtige<br />
Fahrzeuge – besonders Lkw – waren davon<br />
zunehmend überfordert.<br />
Ausbau- und Regulierungsarbeiten seitens<br />
der Stadt Neunkirchen standen unmittelbar<br />
bevor, was den Betrieb der Straßenbahn<br />
weitgehend verteuerte, zumal die Straßenbahn<br />
zwischen Scheib und Steinwald bei höherer<br />
Geschwindigkeit wie ein Schiff bei<br />
Gründe für die Umstellung<br />
Ferner bedeutete es für den Betrieb, der täglich<br />
maximal nur noch vier Triebwagen für<br />
den 10-Minuten-Takt einzusetzen brauchte,<br />
eine erhebliche wirtschaftliche Erschwernis,<br />
hierfür Stromversorgung, Werkstattanlagen<br />
und Ersatzteillager vorzuhalten sowie Fahrer<br />
auszubilden, zumal die Straßenbahnen<br />
im Saartal, wie sich der Saarbrücker Schienenbetrieb<br />
nannte, den öffentlichen Nahverkehr<br />
ab dem 22. Mai 1965 ohne Straßenbahnen<br />
abwickelte.<br />
Gleichzeitig machte man der Bevölkerung<br />
die Umstellung auf Busse schmackhaft, da<br />
man eine durchgehende Buslinie 1 von Wiebelskirchen<br />
über den Hbf, Innenstadt und<br />
Scheib <strong>bis</strong> Steinwald und Storchenplatz einrichten<br />
wollte. Dies entsprach der ehemali-<br />
64 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Neunkirchen<br />
Begegnung zweier GT4-N am unteren Hüttenberg 1978. <strong>Von</strong> der Hüttenbergstraße biegt links die Königstraße ab, der hellblaue Pkw kommt<br />
hingegen aus der Stummstraße; im Hintergrund ist das Neunkircher Eisenwerk zu sehen<br />
Literatur-Hinweise<br />
Johannes Sebastian: Die Neunkircher Straßenbahn<br />
– einmalig in Europa. In: Neunkircher<br />
Stadtbuch, herausgegeben im Auftrag der<br />
Kreisstadt Neunkirchen von Rainer Knauf und<br />
Christof Trepesch, Neunkirchen 2005,<br />
S. 197–208, ISBN 3-00-015932-0<br />
Kochems, M., Höltge, D.: Straßen- und Stadtbahnen<br />
in Deutschland, Band 12, Rheinland-<br />
Pfalz/Saarland, Freiburg 2011, S. 284–309,<br />
ISBN 978-3-88255-393-2<br />
im Internet z.B. die Seiten von Rainer Freyer:<br />
www.saar-nostalgie.de/verkehr.htm<br />
Beim Verein „Hannoversches Straßenbahn-<br />
Museum e.V.“ in Sehnde-Wehmingen bei Hannover<br />
ist u. a. der Kurzgelenkwagen 2 aus<br />
Neunkirchen betriebsfähig erhalten. Unrestauriert<br />
ist der Tw 15, ein zweiachsiger Schleifwagen<br />
(CEF 1927), vorhanden B. OEHLERT<br />
gen Straßenbahnlinie 1, wie sie <strong>bis</strong> in die<br />
1950er-Jahre existiert hatte.<br />
Der Abschied von der Straßenbahn<br />
Da aufgrund eines Streiks neun MAN-Busse<br />
nicht rechtzeitig ausgeliefert werden<br />
konnten, fand der endgültige Abschied von<br />
der Straßenbahn in Neunkirchen letztendlich<br />
mit zweiwöchiger Verspätung am 10.<br />
Juni 1978 statt. Ein großes Volksfest an der<br />
zentralen Haltestelle Stumm-Denkmal bildete<br />
einen würdigen Rahmen, zumal die<br />
Straßenbahn an diesem Samstagmorgen mit<br />
einem 2-Groschen-Sonderfahrschein benutzt<br />
werden durfte.<br />
Kaum mehr ein Stehplatz stand bei dem<br />
fahrplanmäßigen 10-Minuten-Betrieb zur<br />
Verfügung. Die letzte Fahrt unternahm ab<br />
Betriebshof der Triebwagen 6. Geschmückt<br />
ging es um 15.45 Uhr noch einmal <strong>bis</strong> zur<br />
Steinwaldstraße. Um 16.17 Uhr übernahm<br />
vom Stumm-Denkmal aus erstmals ein Bus<br />
die Aufgaben der Straßenbahnlinie 2. Damit<br />
war die Zeit der Tram in Neunkirchen abgelaufen.<br />
71 Jahre hatte die Straßenbahn<br />
nahezu störungsfrei mehrere 100 Millionen<br />
Fahrgäste befördert und das Leben in dieser<br />
„buckeligen“ Industriestadt im Saarland<br />
wesentlich erleichtert.<br />
KLAUS OEHLERT-SCHELLBERG/AM<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
65
Geschichte<br />
Den Rheinsprung noch<br />
einmal ganz neu entdeckt<br />
Seitenblicke auf die Basler<br />
Tram im Jahr 1980 Einen<br />
unvergleichbaren Blick aus<br />
dem Gestern auf die pulsie -<br />
rende Gegenwart in Basel<br />
bietet die schmale Gasse<br />
Rheinsprung am Münsterberg.<br />
Diesen Bereich prägt seit<br />
mehr als 100 Jahren auch die<br />
Straßenbahn …<br />
Mit Basel verbindet der ÖPNV-Interessierte<br />
zuallererst einen vorbildlichen<br />
Nahverkehr in Stadt<br />
und Umland. Doch Basel ist natürlich<br />
sehr viel mehr: Die Stadt im Dreiländereck<br />
ist ein weithin beachteter Ort der<br />
Wissenschaft und der Kultur, der Messen<br />
und Kongresse und – last but not least – der<br />
Industrien. Es ist eine Stadt mit vielen Gesichtern<br />
aus vielen Zeitepochen. Kaum ein<br />
anderer Ort gestattet den Blick aus dem Gestern<br />
auf die pulsierende Gegenwart wie die<br />
schmale Gasse Rheinsprung im historischen<br />
Basel am Münsterberg.<br />
Schiefe Fachwerkhäuser säumen beide<br />
Gassenseiten, wobei die oberen Geschosse in<br />
den Weg hineinragen. Der Grund hierfür ist<br />
leicht nachvollziehbar. Auf diese Weise ließen<br />
sich seinerzeit Steuern sparen, da diese nur<br />
nach der bebauten Grundfläche erhoben<br />
wurden. Räumliche, aber keineswegs geistige<br />
Enge kennzeichnet das Quartier: Basels Universität<br />
entstand 1460 als erste der Schweiz<br />
hier am Rheinsprung, das alte Kolleggebäude<br />
erinnert daran. Vom Münsterberg herunterkommend<br />
öffnet sich der schmale Spalt,<br />
auf den man schaut, immer weiter. Noch<br />
schlendert der Passant langsam an den mittelalterlichen<br />
Mauern von Handwerker- und<br />
Kaufmannshäusern vorbei, doch er nähert<br />
Blick 1980 aus der Gasse „Rheinsprung“ hinunter<br />
in den engen Schlitz der Moderne mit<br />
Düwag-Gelenkwagen 656 auf der Linie 14 im<br />
wilden Verkehrsgetümmel: Welch ein Gegensatz!<br />
ALLE AUFNAHMEN A. MAUSOLF<br />
66 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Schweiz: Basel<br />
Der Großraumzug<br />
416/1583 aus dem<br />
Rheinsprung gesehen.<br />
Der Trieb -<br />
wagen ging 1998<br />
auf den Schrott<br />
sich unaufhörlich der Moderne, die – wie<br />
sollte es in Basel anders sein – sich in Form einer<br />
Trambahn kurz in diesen Spalt drängt,<br />
um von hier aus nicht mehr sichtbar über die<br />
Rheinbrücke zu verschwinden. Hier unten ist<br />
die Illusion endgültig vorbei, man befände<br />
sich in einem idyllischen kleinen Rheinstädchen<br />
– die Großstadt ist zum Greifen nah geworden.<br />
Tramdominierte Straßen bringen<br />
den gerade noch entrückten Passanten ins<br />
Jetzt – ins Basel, das so gar nicht zu dieser<br />
Gasse zu passen scheint, die man gerade herabgestiegen<br />
ist und die doch so prägend war<br />
für diese im Jahre 374 erstmals urkundlich<br />
erwähnte Stadt.<br />
Eigentliches Ziel: ein »Krokodil«<br />
Doch warum der Name Rheinsprung? Sollte<br />
man hier ansetzen zum Sprung über den<br />
Fluss? Wohl besser nicht, die Treidelfähre gestattet<br />
eine angenehmere Passage. Oder<br />
sprangen hier die Gedanken zur Liebsten auf<br />
der anderen Seite? Eines ist sicher: Der Rhein<br />
entspringt hier nicht! Da muss man sich<br />
schon etwas weiter flussaufwärts in den<br />
Schweizer Kanton Graubünden bemühen.<br />
Am Ende steht ein Geständnis: Der Verfasser<br />
dieser Zeilen hat den Rheinsprung rein<br />
zufällig entdeckt. Organisiert oder gar vorgeplant<br />
war seinerzeit nichts. Es kommt<br />
noch „schlimmer“: Weder die herrliche Altstadt<br />
von Basel noch die Tram waren der<br />
Grund für die weite Reise im Jahre 1980.<br />
Zwar auch auf Schienen angewiesen, jedoch<br />
schon lange nicht mehr mit Reisezügen unterwegs,<br />
zog ihn seinerzeit ein zur Rangierlok<br />
degradiertes „Krokodil“ nach Basel, genauer<br />
gesagt nach Muttenz ganz in der<br />
Nähe. Aber das ist eine ganz andere Geschichte<br />
…<br />
ANDREAS MAUSOLF<br />
RECHTS Unterhalb der<br />
Rheinsprung-Gasse<br />
tobt Großstadtverkehr:<br />
Tw 615 mit Bw<br />
1328 aus der von<br />
1933 <strong>bis</strong> 1943 gebauten<br />
Serie 1303<br />
<strong>bis</strong> 1332 setzt zum<br />
Rheinsprung an! Der<br />
Beiwagen wechselte<br />
1985 zur Baselland<br />
Transport (BLT),<br />
1999 kam sein Ende<br />
UNTEN Auf Linie 15<br />
ist an diesem Sommertag<br />
1980 der<br />
1967 gebaute Tw<br />
460 auf dem Weg<br />
zur französischen<br />
Grenze nach St.<br />
Louis unterwegs<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
67
Geschichte<br />
<strong>Von</strong> 1979 <strong>bis</strong> 1983 wurden die Linien 4 und 21 wegen des U-Bahn-Baus durch die Landshuter Allee umgeleitet. Zwischen<br />
1858 und 1892 verlief hier die Trasse der Bayerischen Ostbahn nach Landshut P. SCHRICKER (3)<br />
Als die Vernunft<br />
nicht zählte ...<br />
Hintergründe zur Einstellungswelle in München vor 30 Jahren 1983 wurde ein Teil des Anfang<br />
der 1980er-Jahre aufgestellten „ÖPNV-Konzepts 2000“ des Münchner Verkehrsverbundes (MVV)<br />
umgesetzt. Damit ignorierten die Verkehrsbetriebe vor 30 Jahren die Stimmung der Bevölkerung!<br />
Das ganze Jahr 1982 hatte sich der<br />
Werkausschuss damit beschäftigt,<br />
welche Streichungen im Münchner<br />
Straßenbahnnetz umgesetzt werden<br />
sollten – siehe <strong>STRASSENBAHN</strong> MA-<br />
GAZIN 6/2013. Am Tag der Eröffnung der<br />
nur 3,3 Kilometer langen U1 zwischen<br />
Hauptbahnhof und Rotkreuzplatz war es<br />
am 28. Mai 1983 dann soweit: Die Verkehrsbetriebe<br />
stellten gleichzeitig drei Straßenbahnlinien<br />
mit rund zehn Kilometer<br />
Strecke ein – die Linien 4, 17 und 21.<br />
In engen Bögen durchs Westend: Am 10. März<br />
1984, dem letzten Betriebstag der Linie 14,<br />
begegnen sich zwei M4-Züge an der Kreuzung<br />
Gollier-/Astallerstraße. Seit 1993 fahren hier<br />
keine Straßenbahnen mehr<br />
68 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
München<br />
OBEN Vor der Kulisse des Maximilianeums<br />
quert Anfang der 1980er-Jahre ein M3-Zug als<br />
Linie 14 auf seinem Weg von der St.-Veit-Straße<br />
zum Gondrellplatz die Isar C.-J. SCHULZE<br />
RECHTS Die Linie 27 verband die Schwanseestraße<br />
mit Harras. Ein von Tw 2428 geführter<br />
Zug legt 1984 oberhalb der Theresienwiese am<br />
alten Messeplatz einen Halt ein. Die Stationsgebäude<br />
entstanden in den 1950er-Jahren<br />
Diesem Kahlschlag waren viele verkehrspolitische<br />
Diskussionen vorangegangen,<br />
über die heute noch die Archive in München<br />
Auskunft geben. Demnach berief man<br />
sich damals vor allem auf das „ÖPNV-Konzept<br />
2000“ des Münchner Verkehrsverbundes<br />
MVV (siehe Kasten), das verschiedene<br />
Szenarien für den zukünftigen Oberflächenverkehr<br />
entwickelt hatte.<br />
Auf dieser Basis fasste der Werkausschuss<br />
des Stadtrats am 7. Dezember 1982 den<br />
formalen Beschluss, sich spätestens Mitte<br />
der 1990er-Jahre von der Trambahn ganz<br />
zu verabschieden. „Die Gesichtspunkte der<br />
erforderlichen Platzkapazität, der Attrak tivität<br />
für den Fahrgast, des Umweltschutzes<br />
und der Energiesicherheit wurden unter den<br />
im <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 6/2013<br />
genannten Prämissen (Präferenz für die<br />
Straßenbahn) eingehend untersucht; soweit<br />
erforderlich wurden von unabhängigen<br />
Instituten im Auftrage des Planungsreferats,<br />
des U-Bahn-Referats und des MVV entsprechende<br />
Mengenberechnungen durchgeführt.<br />
Trotz dieser Vorgaben ergab sich kein Planungsfall,<br />
der den Weiterbestand der Straßenbahn<br />
in München als dritten Verkehrsträger<br />
dann erforderlich macht, wenn der<br />
U-Bahn-Ausbau einen bestimmten Stand erreicht<br />
hat“, heißt es in der Beschlussvorlage.<br />
Damit setzten sich die Stadtväter nun auch<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
69
Geschichte<br />
An der Hanauer Straße befand sich eine großzügige Wendeanlage. Im Mai 1983 erreicht eine<br />
„15” gerade ihr Ziel, während die „4er” gleich ihre Fahrt beginnen wird P. SCHRICKER (3)<br />
»ÖPNV-Konzept 2000«<br />
von 1982<br />
Das ÖPNV-Konzept hatte der Stadtrat am 26.<br />
April 1978 in Auftrag gegeben. Die Experten<br />
sollten „ein Netz der öffentlichen Verkehrsmittel<br />
mit Alternativen [...] entwickeln, bei dem unter<br />
Beachtung der Ziele des Stadtentwicklungsplans<br />
ein möglichst günstiges Verhältnis von<br />
Kosten, Einnahmen und Bedienungsqualität erreicht<br />
wird.“ Dabei sollte mit einem „Straßenbahnbonus“<br />
gerechnet werden, das heißt mit<br />
einem „Attraktivitätszuschlag“ bei der Benutzung<br />
der Trambahn im Oberflächenverkehr. Das<br />
1982 veröffentlichte Konzept stellt zwei Systemtypen<br />
vor: Typ 1 besteht nur noch aus S- sowie<br />
U-Bahn und Busbetrieb. Typ 2 bezieht in<br />
mehreren Szenarien die Tram mit ein. Doch<br />
mehr als ein aus wenigen Linien bestehendes<br />
Straßenbahn-Restnetz, das der Tram keine wirkliche<br />
Existenzberechtigung eingeräumt hätte,<br />
konnten sich die Planer nicht vorstellen. Sie plädierten<br />
deshalb für die Einstellung der Weiß-<br />
Blauen und empfahlen den Stadträten: „Die<br />
Entscheidung muss jetzt fallen.“<br />
über den Willen der eigenen Bürgerinnen<br />
und Bürger hinweg, die seit 1980 auf vielen<br />
Bürgerversammlungen in ihren Stadtteilen<br />
und über die Bezirksausschüsse, wie die<br />
Stadtteilvertretungen in München heißen,<br />
sich vehement für den Fortbestand vor allem<br />
der Linien 16 und 17 eingesetzt hatten.<br />
Meist wurde die größere Umweltfreundlichkeit<br />
der Tram in Sachen Emissionen,<br />
Energieverbrauch und Lärmbelastung sowie<br />
deren größerer Komfort angeführt.<br />
Der U-Bahn-Bau erforderte zahlreiche Umleitungen. Am letzten Betriebstag biegt eine „4er“<br />
am Maßmannbergl in die Umleitungsstrecke durch die Joseph-Ruederer- und Sandstraße ein<br />
Seit Stilllegung der Linie 14 am 10. März 1984 fährt die „19“ nach Berg am Laim. Mitte der<br />
1980er-Jahre wenden die Tw 2033 und 2619 als Verstärkungslinie 29 an der Sankt-Veit-Straße<br />
Argumente gegen die Tram<br />
Die Stimme einer Münchner Bürgerin, wie<br />
sie in einem Antrag zu einer Bürgerversammlung<br />
im April 1982 zum Ausdruck<br />
kommt, mag die teilweise kämpferische<br />
trambahnfreundliche Stimmung illustrieren:<br />
„Man hat vielmehr den Eindruck, daß eine<br />
bestimmte, gewissenlose Bus-Lobby um jeden<br />
Preis – auch auf Kosten der Gesundheit<br />
der Bevölkerung – gute Geschäfte mit ihren<br />
umweltvergiftenden Bussen machen möchte.<br />
Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß<br />
Trambahnen im Endeffekt doch billiger<br />
kommen und noch viele andere Vorteile haben.<br />
Da ich laufend Unterschriften für die<br />
Erhaltung der Tram sammle, kann ich mitteilen,<br />
daß die weitaus größere Zahl der<br />
Bürger der Straßenbahn den Vorzug gibt.<br />
Eine trotzdem durchgeführte Abschaffung<br />
der Trambahn würde eine brutale Unterdrückung<br />
des Wunsches der Bevölkerung<br />
darstellen und hätte mit Demokratie nichts<br />
mehr zu tun!“<br />
Weder Stadtwerke noch Mehrheit im<br />
Stadtrat ließen sich von solchen Schimpfka-<br />
70 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
München<br />
Das ÖNVP-Konzept<br />
2000 gab der Trambahn<br />
keine Zukunft.<br />
Das als eine Variante<br />
vorgeschlagene<br />
Rumpfnetz aus drei<br />
Linien (blaue Farbe)<br />
wäre gänzlich unrentabel<br />
und unattraktiv<br />
gewesen. Es<br />
kam anders – nicht<br />
nur bei der Straßenbahn,<br />
sondern auch<br />
beim U-Bahn-Bau:<br />
das heutige Netz<br />
entspricht nicht<br />
gänzlich den Plänen<br />
von 1982<br />
STADTARCHIV MÜNCHEN<br />
RECHTS Die „Oanser“ gehörte <strong>bis</strong> zu ihrer Einstellung<br />
1980 zu den Traditionslinien Münchens.<br />
M4-Wagen 2453 legt auf seinem Weg<br />
von Moosach nach Steinhausen am Max-II.-<br />
Denkmal einen Halt ein<br />
C.-J. SCHULZE<br />
nonaden beeindrucken. Sie wiesen sie alle<br />
diese Anträge zurück, dabei bedienten sie<br />
sich schier gebetsmühlenhaft immer wieder<br />
folgender Argumente:<br />
• die Stadtwerke Verkehrsbetriebe seien zu<br />
größtmöglicher Wirtschaftlichkeit verpflichtet,<br />
ansonsten drohe eine Revision<br />
der MVV-Verträge durch die Deutsche<br />
Bundesbahn und eine Rückzahlung der<br />
Zuschüsse, die die Stadt München vom<br />
Freistaat Bayern zum U-Bahn-Bau gemäß<br />
Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten<br />
habe. Die Gesellschafterversammlung des<br />
Münch ner Verkehrsverbundes hatte am<br />
2. Dezember 1981 klargestellt, dass „im<br />
unmittelbaren Einzugsbereich von<br />
Schnell bahnen aus verkehrlichen und<br />
ökonomischen Gründen keine Parallelführung<br />
von Oberflächenverkehrsmitteln<br />
möglich“ sei<br />
• der Neubau von Straßenbahnstrecken sei<br />
nicht finanzierbar und die Mittel fehlten<br />
für den U-Bahn-Bau<br />
• die Regierung von Oberbayern habe zum<br />
Ausdruck gebracht, dass die Tram bei<br />
zwölf Millionen Nutzungskilometer weitaus<br />
mehr an tödlichen Unfällen beteiligt<br />
gewesen sei, als der Bus bei 22 Millionen<br />
Nutzungskilometer<br />
• der Schadstoffausstoß der Busse liegt bei<br />
einem Prozent der vom Kfz-Verkehr erzeugten<br />
Schadstoffmenge<br />
• der Energieverbrauch der Tram (Primärenergie)<br />
liege im Durchschnitt wegen geringerer<br />
Platzausnutzung sogar höher als<br />
der des Busses. Bei einem Netz aus U-<br />
Bahn und Bus betrage der Anteil der angesichts<br />
der zweiten „Ölpreis-Krise“ von<br />
1979 bevorzugten elektrischen Energie<br />
bei 50 Prozent, bei einem Netz aus U-<br />
Bahn, Tram und Bus bei 55 Prozent. Allerdings<br />
ändere sich dies zugunsten der<br />
Tram, wenn die Rückspeisung der Bremsenergie<br />
in das Netz realisierbar sei<br />
• die Lärmemission des Busses ist in stark<br />
befahrenen Straßen nicht deutlicher<br />
wahrnehmbar als die der Tram. Die Tram<br />
schneide als Lärmquelle eher ungünstiger<br />
ab, da sie aufgrund ihres „andersartig zusammengesetzten<br />
Geräuschspektrums“<br />
eher deutlicher hörbar sei<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
71
Geschichte<br />
Die Linie 2 verband <strong>bis</strong> 1980 die Innenstadt via Schwanthalerhöhe mit dem einstigen Trambahnknoten Harras in Sendling; deshalb konnte man<br />
mit ihr auch zum Oktoberfest fahren – dann war nicht nur der hier aufgenommene Tw 2488 „gerammelt“ voll<br />
C.-J. SCHULZE<br />
• der Bus sei bei geringerem Bedarf besser<br />
an das Verkehrsangebot anzupassen, er<br />
biete sogar attraktivere Fahrplantakte<br />
• der Bus biete günstigere Haltestellenverhältnisse<br />
im Bereich der Bürgersteige<br />
Das Hauptargument freilich waren die höheren<br />
Kosten der Tram für Betrieb, Wartung<br />
und anstehende Investitionen in das<br />
Gleisnetz und den Wagenpark. In dem Gutachten,<br />
das zum Beschluss vom 7. Dezember<br />
1982 geführt hatte, setzten die Planer<br />
bei Fortführung des Trambetriebs Mehrkosten<br />
von 20,5 Millionen DM pro Jahr an,<br />
„ohne daß Fahrgäste gewonnen würden“.<br />
Teure Tram?<br />
Man errechnete dank der Einstellungen<br />
1983 eine Einsparung von 110 Fahrerinnen<br />
und Fahrern, von denen man nur 50 zur U-<br />
Bahn umsetzte und die restlichen 60 „abbaute“.<br />
Zu den Fahrzeugen heißt es: „Die<br />
zur Zeit im Einsatz befindlichen Straßenbahnwagen<br />
sind aufgrund ihres Alters in einem<br />
Zustand, der eine weitere Überholung<br />
aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr zulässt.“<br />
Der Betrieb eines Trambahnzugs kostete<br />
pro Jahr 679.045 DM, der eines Busses<br />
hingegen nur 244.094 DM. Für die Hauptuntersuchung<br />
fielen 280.000 DM pro Triebwagen<br />
und 200.000 DM pro Beiwagen an.<br />
Bei einem den Verkehrsbetrieben im Geschäftsjahr<br />
1982 drohenden Defizit von<br />
mehr als 150 Millionen DM mögen diese<br />
Argumente nachvollziehbar erscheinen, betrachtet<br />
man die Zahlen jedoch näher, so<br />
hielten sich die Einsparungen zumindest für<br />
den Betrieb in Grenzen. Für den Südast der<br />
Linie 17 betrugen sie ganze 872.000 DM<br />
pro Jahr gegenüber dem Busbetrieb.<br />
Investitionsstau<br />
Außerdem basierten die Kalkulationen auf<br />
dem Betriebszustand der Trambahn um<br />
1980, der bereits deutliche Züge eines Auslaufmodells<br />
trug, in dessen Infrastruktur<br />
und Wagenbestand nur noch das Nötigste<br />
investiert wurde. Der Wagenpark war technisch<br />
überholt, die Infrastruktur wurde auf<br />
niedrigem Niveau aufrecht erhalten. Ausdruck<br />
dafür ist die Bemerkung in dem besagten<br />
Gutachten: „Erneuerungsmaßnahmen<br />
sind nur zu rechtfertigen, wenn der<br />
Weiterbestand der entsprechenden Straßenbahnlinie<br />
über einen längeren Zeitraum gewährleistet<br />
ist. Andernfalls müsste der Unterhalt<br />
auf das aus Sicherheitsgründen<br />
Quellen<br />
Stadtarchiv München: Protokolle der Werkausschuss-Sitzungen<br />
des Stadtrats (1979 <strong>bis</strong> 1983)<br />
Statistisches Handbuch der Stadt München<br />
1985<br />
erforderliche Mindestmaß beschränkt oder,<br />
wo dies ohne größere Investitionen nicht<br />
mehr möglich ist, der Straßenbahnbetrieb<br />
auf Bus umgestellt werden.“ Damit standen<br />
selbstverständlich im Falle einer Beibehaltung<br />
der Tram deutlich höhere Investitionen<br />
an, als wenn es sich um einen gut gepflegten<br />
und zeitgemäßen Betrieb gehandelt hätte.<br />
Kehrtwende<br />
Die absolute CSU-Mehrheit im Stadtrat<br />
führte nach 1978 die verkehrspolitischen<br />
Ideen aus den späten 1960er-Jahren konsequent<br />
weiter – und das in einer Zeit, als sich<br />
andernorts die ersten Anzeichen einer verkehrspolitischen<br />
Neubewertung der Straßenbahn<br />
bereits andeutete. Im Kommunalwahlkampf<br />
1984 warb die SPD folgerichtig<br />
für den Fortbestand der traditionsreichen<br />
Tram – und gewann. Es sollte freilich noch<br />
zwölf Jahre dauern, <strong>bis</strong> man in München<br />
Strecken wiedererrichtete und 25 Jahre, <strong>bis</strong><br />
die heutige Münchner Verkehrsgesellschaft<br />
(MVG) die erste Neubaustrecke eröffnete.<br />
Nicht zu vergessen ist jedoch, München<br />
leistete beispielsweise mit der Einführung<br />
von Niederflurwagen wichtige Pionierarbeit<br />
für die weltweite Renaissance der Tram.<br />
1983 wagte niemand zu ahnen, dass sich<br />
Münchens Trambahn 30 Jahre später als<br />
moderner und lebendiger Betrieb präsentieren<br />
würde.<br />
PETER SCHRICKER<br />
72 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
Fundstück des Monats<br />
FOLGE 4<br />
Weimar<br />
Innenstadt<br />
<strong>Von</strong> Weimars Straßenbahn gibt es im Stadtgebiet Relikte! So befindet sich z.B. am Gebäude der Bauhaus-Universität<br />
Weimar an der Geschwister-Scholl-Straße Ecke Marienstraße noch die Wandrosette<br />
K. SPATH<br />
Wandrosetten als Erinnerung<br />
Am 30. Juni 1937 fuhr die Straßenbahn das letzte Mal durch Weimar – doch wer heute aufmerksam<br />
durch die Stadt läuft, der entdeckt noch immer verschiedene Reste der Weimarer Straßenbahn …<br />
Wer erinnert sich noch an die „Elektrische“, welche in der Großherzoglichen<br />
Residenzstadt Weimar am 4. Juni 1899 ihre erste Fahrt<br />
unternahm? Vom Hauptbahnhof lagen die Gleise der Straßenbahn<br />
<strong>bis</strong> zum Karlsplatz (Goetheplatz). Hier bestand ein Abzweig durch<br />
den Graben, über Herderplatz, Markt und Frauenplan zum Wielandplatz.<br />
Dort trafen die Gleise wieder auf diejenigen vom Karlsplatz<br />
über Sophienstiftsplatz und durch die Steubenstraße. Vom<br />
Wielandplatz konnte man <strong>bis</strong> zur Gaststätte „Falkenburg“ fahren.<br />
Ab 1908 ging es auch vom Wielandplatz zur Erfurter Straße und<br />
zurück zum Sophienstiftsplatz.<br />
Acht Triebwagen genügten anfänglich für den Verkehr, später<br />
kamen noch fünf weitere hinzu. Beiwagen gab es in Weimar nie.<br />
Nach einer Betriebsunterbrechung 1923/24 wurden ab 1926 die<br />
Gleisanlagen überholt und neue Triebwagen beschafft. Nach 1933<br />
entstanden Pläne, welche die vollständige Umgestaltung des Gebietes<br />
zwischen dem Landesmuseum und der Kernstadt zum Inhalt<br />
hatten. Das führte zu einer Verkehrslösung, bei der für die Straßenbahn<br />
kein Platz mehr war – der Betrieb endete am 30. Juni 1937.<br />
Die Jenaer Elektrizitätswerke AG erwarb die relativ neuen Triebwagen,<br />
zwischen 1972 und 1975 gingen sie dort „den Weg des alten<br />
Eisens“.<br />
Was erinnert im Weimar heute noch an die Tram? Straßenbauarbeiten<br />
haben mit einer Ausnahme durchweg alle Gleisanlagen verschwinden<br />
lassen. Die Rekonstruktion vieler Gebäude führte dazu,<br />
dass nur noch wenige Wandhaken für die Befestigung der Ober -<br />
leitung an den Häusern erinnern. Allenthalben gibt es aber noch<br />
Reste der von 1948 <strong>bis</strong> 1993 verkehrenden Oberleitungsbusse.<br />
Es bedarf schon einiger Kenntnis, um fündig zu werden. Sophiengymnasium,<br />
Johannes-Falk Grundschule und das Haus Brennerstraße<br />
2 besitzen je einen Mehrfachhalter der Oberleitung. An<br />
den Häusern Markt 2, Steubenstraße 8, Trierer Straße 59 und dem<br />
Gebäude der Bauhaus-Universität Geschwister Scholl Ecke Marienstraße<br />
haben sich die Wandabspannungen ebenfalls erhalten. Das<br />
Haus Humboldtstraße 15 wurde vor einigen Jahren ebenfalls vorbildlich<br />
rekonstruiert einschließlich des Hakens an der westlichen<br />
Seite.<br />
KONRAD SPATH<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 6 | 2013<br />
73
■ Miniatur-Nahverkehr: Anlagen, Fahrzeuge, Tipps und Neuheiten<br />
Modellstadt<br />
Chemnitz<br />
Kleine Bahn<br />
Ganz Groß<br />
10. Internationale Modell Straßenbahn Ausstellung<br />
Druck: cdt-werbedruck.de<br />
Kleine Bahn ganz groß ■ Es ist<br />
die weltgrößte Ausstellung nur<br />
für Modellstraßenbahnen. Ende<br />
Mai präsentierten sich Hobbyfreunde schon<br />
zum zehnten Mal einem breiten Publikum<br />
25. - 26.05.2013<br />
Samstag 13:00 - 01:00 Uhr<br />
ab 18:00 Uhr als besonderes Angebot zur 14. Chemnitzer Museumsnacht<br />
Sonntag 12:00 - 16:00 Uhr<br />
im CVAG Omnibusbetriebshof<br />
Chemnitz, Werner-Seelenbinder-Straße<br />
Bus-Shuttleverkehr im 30-min-Takt ab Hauptbahnhof über Zentralhalteste le<br />
Es hatte schon ein <strong>bis</strong>schen<br />
was von den früher bei Hausfrauen<br />
so beliebten Schlussverkäufen,<br />
bei denen bei<br />
Öffnung stets eine Menschenmenge<br />
ins Kaufhaus stürmte und über die<br />
Sonderangebote herfiel. Statt eines<br />
Kaufhauses öffnete am letzten Mai-<br />
Sonnabend um 13 Uhr aber eine Bushalle<br />
der Chemnitzer Verkehrs-AG<br />
die Tore und statt Billigware gab‘s<br />
Modellstraßenbahnen zu besichtigen<br />
– der Andrang vor der Bushalle war<br />
aber ähnlich. Schon zehn Minuten<br />
nach Öffnung waren der rund 2.400<br />
Quadratmeter große Flachbau gut<br />
gefüllt und alle Modelltramanlagen<br />
und Stände umringt. Da störte es<br />
dann auch nicht, dass einige Anlagenbetreiber<br />
den Aufbau noch gar<br />
Hobbyfreund Don Sibley aus Belgien zeigte wieder eine seiner kleinen<br />
Anlagen, die alle unterschiedliche Themen haben. Diesmal war es die<br />
Straßenbahn von Reichenberg (tschechisch Liberec), die auf der aus<br />
zwei Modulen bestehenden Anlage (komplett 23 x 180 cm) auf H0- und<br />
H0m-Gleisen fuhr. Fahrzeuge, Schienen und Gebäude sind durchweg Eigenbauten,<br />
z. T. auf Basis von Halling-Fahrwerken und Kibri-Bausätzen<br />
74 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7|2013
Anlagenbau<br />
Die Magdeburger Straßenbahnfreunde setzen auf ihrer H0-Anlage<br />
vorwiegend Straßenszenen ihrer Stadt ins Modell um. Auf dem Anlagenteil<br />
»Heumarkt« passiert gerade eine Autokolonne mit wichtigen<br />
DDR-Politgrößen einen T6A2/B6A2-Großzug. Diese und einige<br />
andere Aufnahmen dieses Berichtes wurden digital etwas nachbehandelt,<br />
um störende Hintergründe zu entfernen OLGA BANDELOWA (9)<br />
nicht abgeschlossen hatten und nur<br />
eingeschränkten Fahrbetrieb vorführen<br />
konnten. Schuld war eine etwas<br />
unglückliche Programmgestaltung<br />
am Vorabend, welche die Aussteller<br />
vom Aufbau abhielt und stattdessen<br />
auf Stadtrundfahrt schickte.<br />
Unter dem Motto „Kleine Bahn ganz<br />
groß“ informierten in Chemnitz Modellstraßenbahner<br />
und Hersteller<br />
zum zehnten Mal über unser Hobby,<br />
wobei das „Groß“ im Titel inzwischen<br />
auch für Qualität und Quantität<br />
der Veranstaltung steht. „Mit<br />
beeindruckenden 48 Ausstellern ist<br />
es jetzt die weltgrößte Modell tram-<br />
Veranstaltung“, stellte Rolf Hafke<br />
aus Köln erfreut fest, der so wie einige<br />
andere gewerbliche Anbieter mit<br />
seinen Hobbyprodukten nicht nur<br />
bei den eingefleischten Modelltrambahnern<br />
auf reges Interesse stieß.<br />
Die Hauptattraktionen waren für die<br />
Besucher aber zweifellos die Anlagen<br />
und Fahrvorführungen, wozu<br />
auch die mächtig Krach machenden<br />
Großmodelle von Straßen- und Militärfahrzeugen<br />
nach DDR-Vorbild ge-<br />
Beim Vorbild gibt es das Magdeburger Depot an der Lübecker Straße heute nicht mehr. Die Straßenbahnfreunde haben es in H0 erhalten<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7|2013 75
Straßenbahn im Modell<br />
Jan Rupperts Tatra in Prager Lackierung, die hier gerade einen großen Plattenbau passiert, ist ein Einzelstück mit besonderer Bedeutung für ihn<br />
hörten, die nicht so recht zum Thema<br />
der Ausstellung passend im hinteren<br />
Hallenbereich recht platzgreifend<br />
vorgeführt wurden. Modellstraßenbahner<br />
waren davon nicht immer<br />
wirklich begeistert. „Sowas gehört<br />
hier einfach nicht her“, äußerte<br />
Tram-Urgestein Alfred Spühr aus Osnabrück<br />
deutlich sein Unverständnis,<br />
während er aufpassen musste, dass<br />
er nicht von einem der fast meterlangen<br />
Panzer angefahren wird.<br />
Doppelter Fahrspaß<br />
Zweifelsfrei richtig im Thema war<br />
dagegen Jan Ruppert aus Berlin. Der<br />
modellbegeisterte Straßenbahnfahrer<br />
zeigte drei H0m-Module seiner<br />
Straßenbahnanlage. Für doppelte<br />
Streckenlänge mit mehr Abwechslung<br />
beim Betrieb sorgte ein Zwischenstück.<br />
„So konnte ich meine<br />
Module an die Anlage ,Bunzlau‘ von<br />
Christian Petzold aus Zwickau anschließen“,<br />
freute sich Ruppert über<br />
das Mehr an Fahrspaß. Auf seinen<br />
Anlagenteilen, die jeweils ein eigenes<br />
Thema haben, drehte auch ein ganz<br />
Jan Ruppert (Mitte) war mit drei H0m-Modulen nach Chemnitz gereist.<br />
Beim Aufbau und Fahrbetrieb unterstützte ihn Dario Deschan tatkräftig<br />
besonderes Modell seine Runden:<br />
Den Tatra-Gelenkwagen KT4D-ZR<br />
ohne echtes Vorbild in den Farben<br />
Rot, Schwarz und Grau hat ihm in den<br />
1980er-Jahren sein Vater Günter aus<br />
Messing gebaut. „Dabei wurde jedes<br />
Fenster noch einzeln ausgesägt und<br />
gefeilt“, erinnert sich Ruppert. „Das<br />
Modell entstand als Zweirichtungswagen,<br />
weil es auf meiner damaligen<br />
Eisenbahnanlage nur eine Stumpfendstelle<br />
gab.“ Mit neuem Antrieb<br />
und Lack versehen gehört es heute<br />
zu Jan Rupperts Lieblingsmodellen.<br />
Die markanten Wohnblocks, die das<br />
Modul „Plattenbaugebiet“ prägen,<br />
sind Eigenbauten aus Plexiglas und<br />
Karton. Ruppert fährt auf seiner Anlage<br />
digital im Oberleitungsbetrieb.<br />
Seine Module haben einheitliche<br />
ANZEIGEN<br />
www.bus-und-bahn-und-mehr.de<br />
DÜWAG GT6<br />
Bielefeld<br />
Bielefeld<br />
Jetzt schnell zugreifen!<br />
Nur noch wenige Exemplare!<br />
– <br />
✕<br />
Mehr Infos<br />
im Internet<br />
oder<br />
Infoblatt<br />
anfordern<br />
Demnächst auch Variante<br />
Rheinbahn Düsseldorf<br />
Sie finden uns im Internet oder fordern Sie einfach unsere kostenlose<br />
Versandliste an vom: Versandhandel BUS UND BAHN UND MEHR<br />
Geschwister-Scholl-Straße 20 · 33613 Bielefeld · Telefon 0521-8989250<br />
Fax 03221-1235464 · E-Mail: info@bus-und-bahn-und-mehr.de<br />
Straßenbahn-Bücher und Nahverkehrs-Literatur<br />
Im Versand, direkt nach Haus<br />
ganz NEU Hamburg im Minutentakt Jubiläums-Buch der HOCHBAHN 2012, 200 S., 24 x 23 cm, mit Straßenbahn 19,95 €<br />
NEU Die LOWA-Straßenbahnwagen ET 50/54 + EB 50/54 (Kalbe, Möller, <strong>Von</strong>dran), 256 S., 17 x 24 cm, ~220 Abb. 28,50 €<br />
NEU 130 Jahre Straßenbahn in Berlin-Köpenick (J. Kubig, Neddermeyer-V.), 96 Seiten, A4, 120 Aufn. 12,50 €<br />
ganz NEU Die Freiburger Straßenbahn heute (EK-Bildarchiv, Band 2), 96 S., 24 x 17, ~ 100 SW- + Farbf. 19,80 €<br />
Ende Mai Der Nahverkehr in Görlitz Straßenb. + Busverkehr ... Neißestadt (Endisch-V), ~ 190 S., 17 x 21 cm, ~ 200 SW- + C-Fo. 27,00 €<br />
ganz NEU Die Hallesche Straßenbahn zwischen 1960 und 1990, (Sutton-V., HSF), 96 S., 17 x 24 cm, 160 SW-Fotos 18,95 €<br />
NEU Die Straßenbahn in Kleve (Kenning-Verlag), 96 Seiten, A 4, 36 Farb- + 141 SW-Fotos, 14 Zeichnungen 24,95 €<br />
ganz NEU Die Kleinbahnen Rees–Empel + Wesel–Rees–Emmerich (Kenning-V.), 144 S., A4, 35 F- + 243 SW-F. 29,95 €<br />
MAI Die Woltersdorfer Straßenbahn (Ivo Köhler, VBN), ~112 S., 17 x 24 cm, ~150 Fotos, teils in Farbe 19,80 €<br />
ganz NEU Die Wormser Straßenbahn (Häussler, Sutton) 128 S., 17 x 24 cm, 200 SW-Abb. (Halle Frühj. 2013) 18,95 €<br />
Sommer Straßen- + Stadtbahn in D, Bd. 13, Berlin – Hoch-, U- + S-Bahn (EK), ~320 S., 17 x 24 cm, ~ 350 Abb. 45,00 €<br />
NEU Wiener Straßenbahnlinien 71 ~ 82 160 S., 15 x 22 cm, >100 SW- + ~50 Farbf. (noch lieferbar: ... 51 ~ 60 + 61 ~ 70) 24,90 €<br />
NEU Tussen stad en land (Moerland, Hoogerhuis), 208 S., A4, 300 Farbabb.+Karten, von Überlandbahnen <strong>bis</strong> Stadtbahn 35,00 €<br />
ganz NEU Charleroi's trams since 1940 Coal, steel and cornfield (LRTA), 112 S., A4, hist. Aufn., großer Plan 33,00 €<br />
ganz NEU Trolleybus miniatures, model and the real things (Trolleybooks, engl.), 416 S., A4, voll in Farbe, 1532 Abb. 49,50 €<br />
ANGEBOT Metropolitan Railways Rapid Transit in America, von 2003, 275 S., A4, Netzpläne, Fuhrpark, Technik 24,00 €<br />
Alle Straßenbahn-Neuheiten (auch von Betrieben)/zzgl. Porto/Verpackung (1,50 <strong>bis</strong> 4,00 €)<br />
TS: T t<br />
TramShop, Rolf Hafke, Sieben-Schwaben-Weg 22, 50997 Köln<br />
t 0 22 33-92 23 66 F 0 22 33-92 23 65 m Hafke.Koeln@t-online.de<br />
76 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7|2013
Anlagenbau<br />
An die erste Dresdner Tram von 1872, die eine Pferdebahn war, erinnert dieses kleine Detail der H0-Anlage des Clubs der Dresdner Verkehrsbetriebe<br />
Übergänge und können auch anders<br />
aneinandergereiht werden, so dass<br />
sich immer wieder neue Betriebssituationen<br />
ergeben.<br />
Einige Meter neben Ruppert und<br />
Petzold hatte Steffen Grünes seinen<br />
Stand aufgebaut. Grünes Chemnitzer<br />
Firma CDT ist seit Jahren für Trammodelle<br />
aus Karton bekannt. Auf einer<br />
kleinen H0-Anlage zeigte er, dass<br />
seine „Pappbahnen“ motorisiert<br />
durchaus eine Bereicherung für eine<br />
Tramanlage sein können. 20 Modelle<br />
aus verschiedenen Epochen waren<br />
betriebssicher im Dauereinsatz.<br />
Was den rund 4.000 zahlenden Besuchern<br />
der Chemnitzer Modell tram-<br />
Ausstellung sonst noch so alles geboten<br />
wurde, lesen und sehen Sie in<br />
Ihrer nächsten SM-Ausgabe. JOG<br />
Auch vor Kartonmodellen macht die moderne Technik nicht halt; die neueste CDT-Tram entstand in Lasertechnologie.<br />
Das Vorbild des Triebwagens 309 mit Beiwagen gehört heute zum Dresdner Straßenbahnmuseum<br />
ANZEIGE<br />
SPIEL + TECHNIK<br />
MODELLBAHNEN<br />
MODELLISMO FERROVIARIO<br />
• täglicher Versand • vendita per corrispondenza<br />
Museumstrasse 6 • 6020 Innsbruck • T: +43-512-585056<br />
info@heiss.co.at • www.heiss.co.at<br />
Unser neuestes Tram-<br />
Modell in H0 und H0m<br />
Gelenkwagen<br />
Düwag GT6<br />
Innsbruck<br />
Zwei Motoren<br />
LED-Beleuchtung<br />
8-Pin-Schnittstelle<br />
€ 209,95<br />
MODELLBAHNEN<br />
MODELLISMO FERROVIARIO<br />
• täglicher Versand • vendita per corrispondenza<br />
Museumstraße 6 • 6020 Innsbruck • T: +43-512-585056<br />
info@heiss.co.at • www.heiss.co.at<br />
Für Steffen und Ute Grünes von CDT war die Modelltram-Ausstellung<br />
ein Heimspiel. Die Chemnitzer präsentierten Straßenbahnen aus Karton<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7|2013 77
Ihre Seiten: Ergänzungen, Anmerkungen, Kritik und Anregung<br />
0 89 – 13 06 99-720<br />
ö 0 89 – 13 06 99-700<br />
: redaktion@geramond.de<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Postfach 40 02 09 · 80702 München<br />
Zu „Per Pferdebahn ins<br />
Sanatorium“ (SM 6/13)<br />
Fahrzeiten stehen fest<br />
Nach Druckbeginn vom Juni-Heft habe<br />
ich die aktuellen Fahrzeiten der Pferdebahn<br />
in Mrozy erhalten. Demnach verkehrt<br />
die Pferdebahn jeden Sonnabend von 15<br />
<strong>bis</strong> 19 Uhr und jeden Sonntag von 12 <strong>bis</strong><br />
19 Uhr (jeweils erste und letzte Abfahrt).<br />
Die Abfahrten erfolgen zu jeder vollen<br />
Stunde von der Haltestelle in der Nähe des<br />
Bahnhofs. Die Saison geht voraussichtlich<br />
<strong>bis</strong> Ende September.<br />
Norbert Kuschinski, Dresden<br />
Zu „Aachen – Bürger gegen<br />
Campusbahn“ (SM 5/13)<br />
Starker Gegenwind<br />
Die Tatsache, dass dieses Projekt im<br />
Bürgerentscheid abgelehnt wurde, nahm<br />
ich mit großer Enttäuschung zur Kenntnis.<br />
Gerade das Vorhaben, die Oberleitung der<br />
Aachener Stadtbahn ebenfalls mit zum<br />
Betrieb von Elektrobussen zu nutzen, wäre<br />
in meinen Augen vermutlich wegweisend<br />
gewesen. Ich kann allerdings nicht recht<br />
glauben, dass es von 66 Prozent der<br />
stimmberechtigten Aachener Bürger abgelehnt<br />
worden ist, das hätte eine hohe<br />
Wahlbeteiligung vorausgesetzt, die bei<br />
solchen Bürgerbefragungen höchst selten<br />
erreicht wird.<br />
Bedauerlich: Während in Frankreich<br />
und einigen anderen europäischen Nachbarländern<br />
neue Stadtbahnsysteme förmlich<br />
wie Pilze aus der Erde schießen, tritt<br />
Deutschland in dieser Hinsicht offenbar<br />
auf der Stelle.<br />
Erinnert sei daran, dass die Pläne für<br />
den Neubau eines Stadtbahnsystems in<br />
Hamburg wieder in den Schubladen verschwanden.<br />
Auch aus Bochum ist mir bekannt,<br />
dass der neuen Linie 310 harter Gegenwind<br />
ins Gesicht weht. In meiner<br />
Heimatstadt Frankfurt (Oder) gab es ein<br />
Straßenbahnprojekt in die polnische Nachbarstadt<br />
Slubice, welches zweimal scheiterte.<br />
Hier war es ebenfalls ein kleines Häuflein<br />
Straßenbahngegner, die recht schnell<br />
und lautstark die „Stammtischhoheit“ in<br />
der Stadt eroberten. Mit abenteuerlichsten<br />
Gegenargumenten gelang es diesen Menschen,<br />
einen Teil der Bürger auf ihre Seite<br />
zu ziehen. Befördert wurden diese Tendenzen<br />
noch von der örtlichen Lokalpresse, die<br />
zwar nicht offen gegen das Projekt auftrat,<br />
doch mit dem Ziel, eine bestimmte Leserklientel<br />
zu bedienen und evtl. neue Abonnenten<br />
zu gewinnen, wurden regelmäßig<br />
tramskeptische Artikel gedruckt und den<br />
Leserbriefen der Tramgegner sehr viel Platz<br />
eingeräumt. Eine in diesem Klima 2006<br />
durchgeführte Bürgerbefragung führte zu<br />
einem deutlichen Nein zu dem Projekt,<br />
wobei auch nur ca. ein Viertel der Stimmberechtigten<br />
sich daran beteiligten.<br />
Ulf Lieberwirth, Frankfurt (Oder)<br />
Zu „Windhoff-Schleifwagen“<br />
(SM 5/13)<br />
Anfangs große Probleme<br />
Der Berliner<br />
Tw 3337 ist<br />
derzeit nicht<br />
betriebsfähig,<br />
sondern in<br />
Aufarbeitung<br />
I. KÖHLER<br />
schen den Fahrzeugen, die bei der Windhoff<br />
AG, und denen, die bei der Windhoff<br />
GmbH gebaut wurden, unterschieden<br />
werden muss. Erstere sind die, die öfter in<br />
der Werkstatt als im Dienst stehen, letztere<br />
sind wohl zuverlässiger im Einsatz.<br />
Silvio Kopte, Dresden<br />
Zu „Berliner Mitteleinstiegs -<br />
wagen“ (SM 5 und 6/13)<br />
Chaos wie Combino-<br />
Krise<br />
Die Beiträge geben einen guten Überblick<br />
über die hochkomplexe und <strong>bis</strong>lang<br />
insbesondere für die Anfangsphase nur<br />
unvollständig erforschte Geschichte dieses<br />
Wagentyps. Es sei darauf hingewiesen,<br />
dass die schlagartige Außerdienststellung<br />
aller 300 Wagen nach nur kurzer Einsatzzeit<br />
seinerzeit ein Presseecho auslöste, das<br />
jenes zum Beispiel zur „Combino-Krise“<br />
noch in den Schatten stellen dürfte – einschließlich<br />
spürbarer Häme von Firmen,<br />
die bei diesem Auftrag nicht zum Zuge gekommen<br />
waren, sowie der Verbreitung offenkundiger<br />
Unwahrheiten zu technischen<br />
Details (Wirksamkeit elektrodynamische<br />
Bremse etc).<br />
Auf einige kleine Ungenauigkeiten im<br />
2. Teil (Heft 6) sei hingewiesen: S. 44: Die<br />
bei der BVG Ost verbliebenen Wagen wurden<br />
erst (zum Teil) in den 1960er-Jahren<br />
auf Fahrschalter des Typs StNFB 1 umgebaut.<br />
Bei den durch die Waggonbau-Industrie<br />
Anfang der 1950er-Jahre vorgenommenen<br />
Instandsetzungen verblieben<br />
Den Artikel habe ich mit Interesse gelesen.<br />
Ein wenig schmunzeln musste ich,<br />
als ich etwas von „einer erfolgreichen Serie<br />
von mittlerweile zwölf Fahrzeugen“ las.<br />
Der Autor mag natürlich Recht haben,<br />
wenn er schreibt, dass die Windhoff-Arbeitswagen,<br />
die heute gebaut werden, inzwischen<br />
technisch ausgereift wären. Jedoch<br />
die ganze Serie <strong>bis</strong>her gebauter<br />
Fahrzeuge als erfolgreich zu bezeichnen,<br />
dürfte ein wenig unglücklich formuliert<br />
sein, da es nahelegt, dass auch die ersten<br />
Wagen dieser Serie heute erfolgreich und<br />
zuverlässig im Einsatz stünden. Dem ist<br />
aber keineswegs so.<br />
Beispielsweise hat die ständige Reparaturbedürftigkeit<br />
des Dresdner Schleifwagens<br />
einen DVB-Vorstand im Jahr 2004<br />
zur öffentlichen Aussage verleitet, dass<br />
man bei diesem Fahrzeug „eben leicht daneben<br />
gegriffen“ habe, nachdem man<br />
neuerlich 250.000 Euro investiert hatte.<br />
Die oszillierende Technik sei zwar „ausgezeichnet,<br />
wenn sie denn funktionierte“,<br />
dass sie aber auch für den Hersteller neu<br />
war, wurde den DVB verschwiegen. Nach<br />
einem längeren Werkstattaufenthalt ist<br />
der Wagen aktuell seit Mitte Mai wieder<br />
im Einsatz.<br />
Auch in Basel und Berlin scheint man<br />
mit dem Wagen nicht so recht zufrieden zu<br />
sein. Allerdings scheint mir, als wenn zwizum<br />
einen die in den TM 34 verbauten<br />
Nockenfahrschalter im Fahrzeug, zum Teil<br />
wurde der „Standardfahrschalter“ FB 3<br />
eingebaut. Größtenteils wurden aber die<br />
Verbundfahrschalter aller nun überflüssigen<br />
Teile beraubt und weiterverwendet.<br />
Dies nahm die BVG Ost vor den Generalreparaturen<br />
bereits in Eigenregie vor.<br />
S. 46: 721 009 (ex Tw 3337) wurde 1981<br />
als historischer Wagen hinterstellt, war<br />
aber <strong>bis</strong>lang nicht im Einsatz. 1987 wurden<br />
Arbeiten am Wagenkasten begonnen,<br />
die 1993 soweit gediehen waren, dass er<br />
seitdem äußerlich im Zustand von 1934<br />
vorzeigbar ist (Lackierung gelb/weiß).<br />
721 008 (ex Tw 3802) wurde 1980 zunächst<br />
für Filmaufnahmen provisorisch im<br />
Zustand der 1950er-Jahre (mit Kompromissen)<br />
hergerichtet. 1982 <strong>bis</strong> 1990 wurde<br />
er im Zustand von 1934 restauriert,<br />
aber erst 1996 zugelassen und war somit<br />
ab diesem Zeitpunkt wieder einsatzfähig.<br />
Bildunterschrift S. 47 unten: Tw 3493 ist<br />
seit 1985 historischer Wagen (Zustand<br />
von 1952 mit einigen Kompromissen), die<br />
gezeigte Lackierung trägt er seit 1989. Die<br />
Restaurierung erfolgte durch die AG Berliner<br />
Nahverkehr (heute DVN). Eine „BVG<br />
Ost“ gab es in den 1970er Jahren nicht<br />
mehr, diese wurde bereits 1969 durch das<br />
Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe (BVB)<br />
abgelöst.<br />
Zur Tabelle im Heft 6, Seite 47: Der Tw<br />
3337 ist Ausstellungsstück, <strong>bis</strong>her nicht<br />
einsatzfähig; Tw 3813 wurde 1996 und<br />
Tw 3824 im Jahr 2005 zerlegt.<br />
Ivo Köhler, Potsdam<br />
78 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013
LOWA-Wagen im Überblick<br />
Schiffe<br />
Jahrzehntelang prägten die sogenannten LOWA-Straßenbahnwagen<br />
das Erscheinungsbild zahlreicher Betriebe<br />
in der DDR. Im Buch „Die LOWA-Straßenbahnwagen<br />
der Typen ET 50/54 und EB 50/54“, das im Herbst 2012<br />
beim Verlag Dirk Endisch erschienen ist, wird nun erstmals<br />
die Fahrzeuggeschichte dieser Typen umfassend<br />
beschrieben. Das Autorentrio <strong>Von</strong>dran, Kalbe und Möller<br />
schließt damit eine Lücke in der Nahverkehrsliteratur<br />
und den Fahrzeugmonografien.<br />
Das Buch spannt den Bogen von der Vereinheitlichung<br />
von Straßenbahnwagen über die Entwicklungen<br />
nach 1945 und den Wegbereitern des LOWA-Wagens<br />
über eine kurze Abhandlung über die beiden Fertigungsstandorte<br />
<strong>bis</strong> hin zur technischen Beschreibung der beiden<br />
Fahrzeugtypen. Detailliert stellen die Autoren in verständlich<br />
formulierten und knappen Texten die<br />
Unterschiede zwischen den verschiedenen Untertypen<br />
heraus und ergänzen diese durch zumeist aussagekräftige,<br />
allerdings durchgängig schwarz-weiß gedruckte<br />
Bilder. Glanzstück des Buches sind die vielen verschiedenen<br />
Tabellen, die – konsequent und logisch aufgebaut<br />
– den Leser auf den ersten Blick den Lebenslauf eines<br />
jeden gebauten LOWA-Wagens nachvollziehen<br />
lassen. Weitere Tabellen geben Aufschluss über Umbauten<br />
und die Verwendung als Sonderfahrzeuge.<br />
Jedoch offenbart das Buch auch einige Schwächen:<br />
So gibt es keine Einsatzchronik für die einzelnen Betriebe<br />
in der DDR, auch der Einsatz in der Sowjetunion und<br />
in Polen wird nur am Rande betrachtet, die Beschreibungen<br />
bleiben oberflächlich. Viele Informationen – wie<br />
zum Beispiel den letzten Einsatz in den verschiedenen<br />
Betrieben – erhält der Leser<br />
nur durch das Studium der<br />
Tabellen.<br />
Anzuerkennen ist, dass<br />
die Autoren versuchten,<br />
möglichst viel von der Vielfalt<br />
der LOWA-Wagen einschließlich<br />
ihrer Umbauten<br />
in Bildern zu zeigen. Bildauswahl<br />
wie auch Bildqualität können in Teilen<br />
nicht überzeugen, hier wäre weniger mehr gewesen<br />
und vor allem interessanter! Es ist bedauerlich, dass<br />
scheinbar nur Bilder einiger weniger Fotografen verwendet<br />
werden sollten, obwohl Alternativen in besserer<br />
Qualität zur Verfügung gestanden hätten.<br />
Die Abschlussanmerkungen sollten wohl die Brücke<br />
zu den Nachfolgetypen schlagen, verlieren sich dann jedoch<br />
in einem Sammelsurium: Fabrikschilder – hier<br />
wäre eine Einordnung in den Hauptteil wünschenswert<br />
gewesen – und Modellstraßenbahnen.<br />
Das Buch kann trotz der genannten Schwächen Straßenbahnfreunden<br />
zum Kauf empfohlen werden, die sich<br />
für die Geschichte der LOWA-Wagen interessieren und<br />
ihre Freude an umfangreichen Wagenstatistiken finden.<br />
BERND KULBE<br />
Peter Kalbe, Frank Möller, Volker <strong>Von</strong>dran: Die<br />
LOWA-Straßenbahnwagen der Typen ET 50/54<br />
und EB 50/54. Verlag Dirk Endisch 2012, 176 Seiten,<br />
244 Abbildungen, 13 Zeichnungen, 23 Tabellen,<br />
Format 17 x 24 cm, gebunden. Preis 28,50 €<br />
und Meer ...<br />
Das neue Schifffahrt-Magazin<br />
ist da!<br />
Stadtbahn-Geschichte, die unter die Haut<br />
wie Erde geht<br />
Die Stuttgarter Straßenbahn AG fungierte im vorigen<br />
Jahr wieder einmal als Herausgeber einer Broschüre, die<br />
auch für uns Freunde des schienengebundenen Nahverkehrs<br />
interessant sein dürfte. Innerhalb der Folge „Themen<br />
der Zeit“ erschienen im Sommer 2012 die Erinnerungen<br />
des Tiefbauingenieurs Manfred Müller, der<br />
maßgeblich am Stadtbahnbau in Stuttgart beteiligt war.<br />
Der Beginn des Tunnelbaus für dieses System jährte sich<br />
im Juli des vorigen Jahres zum 50. Male.<br />
Manfred Müller war von 1964 <strong>bis</strong> 2003 beruflich an<br />
vorderster Stelle mit dem Bau der Stadtbahn Stuttgart<br />
und ihrer Tunnel betraut. Entsprechend kompetent schildert<br />
er Entstehung, Bau und Nutzung der „Röhren“, die<br />
heute die Landeshauptstadt Baden-Württembergs<br />
durchziehen. Themen wie der Geologie des Baugrundes<br />
oder die Finanzierung der Arbeiten sucht der interessierte<br />
Leser keinesfalls vergeblich.<br />
Als Ingenieur schreibt er sachlich korrekt, aber keinesfalls<br />
langweilig oder im „Fachchinesisch“ über sein<br />
ehemaliges Arbeitgebiet. Der Leser erfährt dabei auch<br />
zahlreiche Hintergründe, die sich z.B. später im Fahrzeugeinsatz<br />
widerspiegelten.<br />
Die inhaltsstarke Broschüre wird mit knapp 140<br />
prägnanten Illustrationen zusätzlich aufgewertet. Neben<br />
farbigen und schwarzweißen Fotografien sind dabei<br />
auch zahlreiche Grafiken und Zeichnungen mit hohem<br />
Aussagewert zum Abdruck gekommen. Der begeisterte<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013<br />
Leser wird in diesen womöglich das einzige Manko der<br />
Broschüre finden – viele der Aufnahmen hätten noch<br />
größer abgebildet werden müssen! Geschickte Einführungen<br />
und Streckenkarten machen die Veröffentlichung<br />
auch für Nicht-Stuttgarter lesbar und lesenswert. Wem<br />
die Thematik Stadtbahn und/oder Tunnel interessiert,<br />
sollte sich den Titel nicht entgehen lassen. Das Werbebudget<br />
der SSB macht es möglich, dass sich die<br />
Anschaffungskosten auf das Porto beschränken. Der<br />
schwä<strong>bis</strong>chen Bauernweisheit, was nichts kostet tauge<br />
nichts, kann in diesem Fall mit Vehemenz widersprochen<br />
werden!<br />
A. MARKS<br />
Manfred Müller: Zwischen Sankt Barbara und<br />
Barbar – 50 Jahre Stadtbahnbau in Stuttgart, 76<br />
Seiten, A 4 quer, broschiert, mehr als 130 Aufnahmen,<br />
erhältlich gegen 1,45 EUR in Briefmarken<br />
bei: SSB AG, Pressestelle, VPR, Postfach 80 10 06,<br />
70510 Stuttgart<br />
Jetzt am Kiosk!<br />
Online blättern oder Abo<br />
mit Prämie unter:<br />
www.schiff-classic.de/abo
Literatur · Händlerverzeichnis · Impressum<br />
Nummer 285 • 7/2013 • Juli • 44. Jahrgang<br />
80<br />
Termine<br />
23./30. Juni, Stuttgart: Jeden Sonntag verkehren die Straßenbahn-Oldtimerlinien<br />
21 und 23 zwischen Straßenbahnwelt Stuttgart<br />
und Hauptbahnhof bzw. Ruhbank (Fernsehturm). Info:<br />
www.strassenbahnwelt.com oder www.shb-ev.info. Infolge größerer<br />
Baumaßnahmen heißt es im Juli 2013 für voraussichtlich<br />
zwei Jahre Abschied nehmen von der Oldtimerlinie 23. Ein Ersatzkonzept<br />
mit historischen Omnibussen befindet sich in Arbeit, zur<br />
Umstellung ist eine größere Publikumsveranstaltung geplant<br />
23. Juni, Wuppertal: Fahrtag bei den BMB. Die Bergischen Museumsbahnen<br />
e.V. fahren auf ihrer Strecke zwischen der Kohlfurther<br />
Brücke und Greuel im Halbstundentakt. Das Museum selbst<br />
ist samstags und sonntags von 11 <strong>bis</strong> 17 Uhr geöffnet. Fahrplan<br />
und Infos unter www.tram-info.de/bmb<br />
23. Juni, München: MVG-Museum von 11 <strong>bis</strong> 17 Uhr geöffnet,<br />
Ständlerstraße 20, 81549 München<br />
30. Juni, Sehnde-Wehmingen: Straßenbahn selbst fahren im<br />
Hannoverschen Straßenbahn-Museum, Hohenfelser Straße 16,<br />
31319 Sehnde, geöffnet von 11–17 Uhr, Gelegenheit, unter Anleitung<br />
eines HSM-Fahrlehrers selbst eine Straßenbahn zu fahren,<br />
Kosten: 15 EUR, siehe www.tram-museum.de<br />
5./6. Juli: Liberec/Reichenberg: Sonderfahrten mit historischen<br />
Straßenbahnwagen, Veranstalter: Bovaraclub Liberec<br />
6. Juli, Essen/Gelsenkirchen: Die historischen Straßenbahnen<br />
der VhAG EVAG, BOGESTRA und MVG fahren im Stundentakt<br />
zwischen Essen-Holsterhausen und Gelsenkirchen Hbf, zwischen<br />
Essen Hbf und Zeche Zollverein sogar alle 30 Minuten. Zustieg<br />
mit einem gültigen VRR-Ticket. Infos: www.vhag-bogestra.de<br />
6. Juli, Berlin: Führungen durch das Baudenkmal Betriebshof<br />
Niederschönhausen und die Sammlung historischer Straßenbahnen<br />
und Busse, Dietzgenstraße 100 (Straßenbahnlinie M1 <strong>bis</strong> Haltestelle<br />
Nordend, Buslinien 107 und 124 <strong>bis</strong> Haltestelle Dietzgenstr./Mittelstr.),<br />
stündlich von 10 <strong>bis</strong> 15 Uhr; Eintritt: Erw. 2<br />
EUR, Kinder (6–14 Jahre) 1 EUR, siehe auch www.dvn-berlin.de<br />
6. Juli, Freiburg: Pendelfahrten der Oldtimerlinie 7 im 30-Minuten-Takt<br />
zwischen Musikhochschule und Paduaallee von 9.55 <strong>bis</strong><br />
ca. 17.30 Uhr; parallel verkehrt das Tramcafé von 12.25 <strong>bis</strong> ca.<br />
In diesen Fachgeschäften erhalten Sie das <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Postleitzahlgebiet 0<br />
Thalia-Buchhandlung, 02625 Bautzen,<br />
Kornmarkt 7 · Fachbuchhandlung<br />
Hermann Sack, 04107 Leipzig,<br />
Harkortstr. 7<br />
Postleitzahlgebiet 1<br />
Schweitzer Sortiment, 10117 Berlin,<br />
Französische Str. 13/14 · Loko Motive<br />
Fachbuchhandlung, 10777 Berlin,<br />
Regensburger Str. 25 · Modellbahnen<br />
& Spielwaren Michael Turberg, 10789<br />
Berlin, Lietzenburger Str. 51 · Buchhandlung<br />
Flügelrad, 10963 Berlin,<br />
Stresemannstr. 107 · Modellbahn-<br />
Pietsch, 12105 Berlin, Prühßstr. 34<br />
Postleitzahlgebiet 2<br />
Roland Modellbahnstudio,<br />
28217 Bremen, Wartburgstr. 59<br />
Postleitzahlgebiet 3<br />
Buchhandlung Decius, 30159 Hannover,<br />
Marktstr. 52 · Train & Play, 30159<br />
Hannover, Breite Str. 7 · Pfankuch<br />
Buch, 38023 Braunschweig, Postfach<br />
3360 · Pfankuch Buch, Kleine Burg<br />
10, 38100 Braunschweig<br />
Postleitzahlgebiet 4<br />
Menzels Lokschuppen, 40217 Düsseldorf,<br />
Friedrichstr. 6 · Goethe-Buchhandlung,<br />
40549 Düsseldorf, Will -<br />
stätterstr. 15 · Modellbahnladen Hilden,<br />
Hofstr. 12, 40723 Hilden · Fach -<br />
buchhandlung Jürgen Donat, 47058<br />
Duis burg, Ottilienplatz 6<br />
Postleitzahlgebiet 5<br />
Technische Spielwaren Karin Lindenberg,<br />
50676 Köln, Blaubach 6-8 ·<br />
Modellbahn-Center Hünerbein, 52062<br />
Aachen, Augustinergasse 14 · Mayersche<br />
Buchhandlung, 52064 Aachen,<br />
Matthiashofstr. 28-30 · Buchhandlung<br />
Karl Kersting, 58095 Hagen, Berg -<br />
str. 78<br />
Postleitzahlgebiet 6<br />
Kerst & Schweitzer, 60486 Frankfurt,<br />
Solmsstr. 75<br />
Postleitzahlgebiet 7<br />
Stuttgarter Eisenbahn-u.Verkehrsparadies,<br />
70176 Stuttgart, Leuschnerstr. 35<br />
· Buchhandlung Wilhelm Messerschmidt,<br />
70193 Stuttgart, Schwabstr.<br />
96 · Buchhandlung Albert Müller,<br />
70597 Stutt gart, Epplestr. 19C · Eisen -<br />
bahn-Treffpunkt Schweickhardt,<br />
71334 Waiblingen, Biegelwiesenstr.<br />
31 · Osiandersche Buch handlung,<br />
72072 Tübingen, Unter dem Holz 25 ·<br />
Buch verkauf Alfred Junginger, 73312<br />
Ob Tag der offenen Tür, Sonderfahrt oder Sym posium:<br />
Veröffentlichen Sie Ihren Termin hier kostenlos.<br />
Fax (0 89) 13 06 99-700 · E-Mail: redaktion@geramond.de<br />
17.45 Uhr zwischen Rieselfeld und Vauban; Mitfahrten sind kostenlos;<br />
Spenden an die Freunde der Freiburger Straßenbahn e.V.<br />
sind willkommen; Informationen siehe www.fdfs.de<br />
14. Juli, Bochum/Gelsenkirchen: „Glückauf-Tour“ der VhAG<br />
BOGESTRA e.V. – Ruhrgebietsgeschichte und -gegenwart: Besichtigung<br />
des Betriebshofs Engelsburg (ehemaliges Zechengelände),<br />
Mittagsim<strong>bis</strong>s, Sonderfahrt mit historischer Straßenbahn und Besichtigung<br />
des Zechengeländes „Consolidation“ in Gelsenkirchen.<br />
Start: 11 Uhr. Infos/Buchung: www.vhag-bogestra.de<br />
14. Juli, Berlin: Themenfahrten mit historischen Straßenbahnen,<br />
ab Alexanderplatz/Dircksenstraße um 11 und 14 Uhr: Rundfahrten<br />
durch die Stadtteile Lichtenberg, Marzahn und Hohenschönhausen;<br />
Dauer: ca. 2,5 Stunden; Fahrpreise: Erwachsene 6,– EUR,<br />
Kinder (6–14 Jahre) 3,– EUR; Fahrscheine in den Wagen erhältlich,<br />
keine Platzreservierung, siehe auch www.dvn-berlin.de<br />
21. Juli, Stuttgart: „Umsteigen bitte“ heißt es für die Fahrgäste<br />
der Oldtimerlinie 23. Aufgrund von Bauarbeiten verkehren zwischen<br />
Straßenbahnwelt und Ruhbank (Fernsehturm) für ca. zwei<br />
Jahren ersatzweise historische Omnibusse. Zur Umstellung veranstalten<br />
SSB und SHB einen Aktionstag mit jeder Menge Fahrbetrieb.<br />
Die Straßenbahnlinien 21 und 23 sowie die neue Buslinie<br />
23E verkehren zwischen 10.30 und 17 Uhr im Stundentakt. Die<br />
Straßenbahnwelt bietet ein buntes Rahmenprogramm. Info:<br />
www.strassenbahnwelt.com oder www.shb-ev.info<br />
14./28. Juli, München: MVG-Museum von 11 <strong>bis</strong> 17 Uhr geöffnet,<br />
Ständlerstraße 20, 81549 München<br />
14./28. Juli, Wuppertal: Fahrtag bei den BMB. Die Bergischen<br />
Museumsbahnen e.V. fahren auf ihrer Strecke zwischen der Kohlfurther<br />
Brücke und Greuel im Halbstundentakt. Das Museum<br />
selbst ist samstags und sonntags von 11 <strong>bis</strong> 17 Uhr geöffnet.<br />
Fahrplan und Infos unter www.tram-info.de/bmb<br />
28. Juli, Sehnde-Wehmingen: Straßenbahn selbst fahren im<br />
Hannoverschen Straßenbahn-Museum, Hohenfelser Straße 16,<br />
31319 Sehnde, geöffnet von 11–17 Uhr, Gelegenheit, unter Anleitung<br />
eines HSM-Fahrlehrers selbst eine Straßenbahn zu fahren,<br />
Kosten: 15 EUR, siehe www.tram-museum.de<br />
Geis lingen, Karlstr. 14 · Service rund<br />
ums Buch Uwe Mumm, 75180 Pforzheim,<br />
Hirsauer Str. 122 · Modellbahnen<br />
Mössner, 79261 Gutach, Landstr.<br />
16 A<br />
Postleitzahlgebiet 8<br />
Fachbuchzentrum & Antiquariat Stiletto,<br />
80634 München, Schulstr. 19 ·<br />
Augsburger Lok schuppen, 86199<br />
Augsburg, Gögginger Str. 110 · Verlag<br />
Benedikt Bickel, 86529 Schroben -<br />
hausen, Ingolstädter Str. 54<br />
Postleitzahlgebiet 9<br />
Buchhandlung Jakob, 90402 Nürnberg,<br />
Hefners platz 8 · Modellbahnvertrieb<br />
Gisela Scholz, 90451 Nürnberg,<br />
Nördlinger Str. 13 · Modell spielwaren<br />
Helmut Sigmund, 90478 Nürnberg,<br />
Schweiggerstr. 5 · Buchhandlung<br />
Rupprecht, 92648 Vohenstrauß, Zum<br />
Beckenkeller 2 · Fried rich Pustet & .,<br />
94032 Passau, Nibe lun gen platz 1 ·<br />
Schöningh Buchhandlung & ., 97070<br />
Würz burg, Franziskanerplatz 4<br />
Österreich<br />
Buchhandlung Herder, 1010 Wien,<br />
Wollzeile 33 · Modellbau Pospischil,<br />
1020 Wien, Novaragasse 47 · Technische<br />
Fachbuch handlung, 1040 Wien,<br />
Wiedner Hauptstr. 13 · Leporello – die<br />
Buchhandlung, 1090 Wien, Liechtensteinstr.<br />
17 · Buchhandlung Morawa,<br />
1140 Wien, Hackinger Str. 52 · Buchhandlung<br />
J. Heyn, 9020 Klagenfurt,<br />
Kramergasse 2-4<br />
Belgien<br />
Musée du Transport Urbain Bruxellois,<br />
1090 Brüssel, Boulevard de Smet de<br />
Naeyer 423/1<br />
Tschechien<br />
Rezek Pragomodel, 110 00 Praha 1<br />
Klimentska 32<br />
Dänemark<br />
Peter Andersens Forlag, 2640 Hede -<br />
husene, Brandvaenget 60<br />
Spanien<br />
Librimport, 8027 Barcelona, Ciudad<br />
de Elche 5<br />
Großbritannien<br />
ABOUT, GU46 6LJ, Yateley,<br />
4 Borderside<br />
Niederlande<br />
van Stockum Boekverkopers, 2512 GV,<br />
Den Haag, Westeinde 57 · Norsk<br />
Modell jernbane AS, 6815 ES, Arnheim,<br />
Kluizeweg 474<br />
www.strassenbahn-magazin.de<br />
Redaktionsanschrift:<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Postfach 40 02 09 · D-80702 München<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.720<br />
Fax + 49 (0) 89.13 06 99.700<br />
redaktion@strassenbahn-magazin.de<br />
Verantw. Redakteur:<br />
André Marks, andre.marks@geramond.de<br />
Redaktion:<br />
Michael Krische (Redaktionsleitung),<br />
Thomas Hanna-Daoud, Martin Weltner<br />
Redaktion Journal/aktuelle Meldungen:<br />
Philipp Krammer,<br />
philipp.krammer@geramond.de<br />
Redaktion Straßenbahn im Modell:<br />
Jens-Olaf Griese-Bande low,<br />
jobandelow@geramond.de<br />
Redaktionsteam:<br />
Berthold Dietrich-Vandoninck, Wolfgang Kaiser,<br />
Michael Kochems, Bernhard Kuß magk,<br />
Ronald Glembotzky, Dr. Martin Pabst,<br />
Axel Reuther, Robert Schrempf, Michael Sperl<br />
Redaktionsassistenz: Brigitte Stuiber<br />
ABO –HOTLINE<br />
Leserservice, GeraMond-Programm<br />
Tel. 0180 – 532 16 17 (14 ct/min.)<br />
Fax 0180 – 532 16 20 (14 ct/min.)<br />
leserservice@strassenbahn-magazin.de<br />
Gesamtanzeigenleitung:<br />
Helmut Kramer<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.270<br />
helmut.kramer@verlagshaus.de<br />
Anz.-leitung <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>:<br />
Helmut Gassner<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.520<br />
helmut.gassner@verlagshaus.de<br />
Anzeigendispo <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>:<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.130<br />
anzeigen@verlagshaus.de<br />
www.verlagshaus-media.de<br />
Es gilt Anzeigenpreisliste Nr. 23 vom 1.1.2013<br />
Layout: Axel Ladleif<br />
Litho: Cromika, Verona<br />
Druck: Stürtz GmbH, Würzburg<br />
Verlag:<br />
GeraMond Verlag GmbH,<br />
Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
Geschäftsführung:<br />
Clemens Hahn, Carsten Leininger<br />
Herstellungsleitung:<br />
Sandra Kho<br />
Vertrieb Zeitschriften:<br />
Dr. Regine Hahn<br />
Vertrieb/Auslieferung Handel:<br />
MZV, Unterschleißheim<br />
Im selben Verlag erscheinen außerdem:<br />
Preise: Einzelheft Euro 8,50 (D), Euro 9,50 (A),<br />
sFr. 15,90 (CH), bei Einzelversand zzgl. Porto;<br />
Jahresabopreis (12 Hefte) Euro 91,80 (incl. MwSt.,<br />
im Ausland zzgl. Versandkosten)<br />
Erscheinen und Bezug: <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
erscheint monatlich. Sie erhalten die Reihe in Deutsch -<br />
land, in Österreich und in der Schweiz im Bahnhofs buch -<br />
handel, an gut sortierten Zeitschriftenki os ken, im Fachbuchhandel<br />
sowie direkt beim Verlag.<br />
© 2013 by GeraMond Verlag. Die Zeitschrift und alle ihre<br />
enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Durch Annahme eines Manu skripts erwirbt<br />
der Verlag das aus schließ liche Recht zur Ver öffentlichung.<br />
Für unverlangt ein gesandte Fotos wird keine Haftung<br />
übernommen. Gerichtsstand ist München.<br />
Ver antwortlich für den redaktionellen Inhalt: André Marks;<br />
verantwortlich für Anzeigen: Helmut Kramer, beide Infanteriestr.<br />
11a, 80797 München.<br />
ISSN 0340-7071 • 10815<br />
Betriebe<br />
Fahrzeuge<br />
Geschichte<br />
SCHIFFClassic<br />
80
12x <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
+ Geschenk<br />
Tramino Jena<br />
GT8SU<br />
Grazer TW 206<br />
Ihr<br />
Willkommensgeschenk<br />
GRATIS!<br />
Buch »Straßenbahnen in der DDR«<br />
Voll waren die Züge, vielfältig der Fahrzeugpark und<br />
zahlreich die Neubaustrecken: Ein bild- und faktenreicher<br />
Überblick über das Straßenbahnland DDR.<br />
✁<br />
Mein Vorteilspaket<br />
✓ Ich spare 10%<br />
(bei Bankeinzug sogar 12%)!<br />
✓ Ich erhalte mein Heft 2 Tage vor<br />
dem Erstverkaufstag (nur im Inland)<br />
bequem nach Hause und verpasse<br />
keine Ausgabe mehr!<br />
✓ Ich kann nach dem ersten Jahr<br />
jederzeit abbestellen und erhalte<br />
zuviel bezahltes Geld zurück!<br />
✗<br />
Das <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>- Vorteilspaket<br />
❑ JA, ich möchte mein <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>-Vorteilspaket<br />
Bitte schicken Sie mir das <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> ab sofort druckfrisch und mit 10% Preisvorteil für<br />
nur €7,65* pro Heft (Jahrespreis: €91,80*) monatlich frei Haus. Ich erhalte als Will kommens geschenk<br />
das Buch »Straßenbahnen in der DDR«**. Versand erfolgt nach Bezahlung der ersten Rechnung. Ich<br />
kann das Abo nach dem ersten Bezugsjahr jederzeit kündigen.<br />
Bitte informieren Sie mich künftig gern per E-Mail, Telefon oder Post über interessante<br />
❑ Neuigkeiten und Angebote (bitte ankreuzen).<br />
Sie möchten noch mehr sparen?<br />
Dann zahlen Sie per Bankab bu chung (nur im Inland möglich)<br />
und Sie sparen zusätzlich 2 % des Abopreises!<br />
Ja, ich will sparen und zahle künftig per Bankabbuchung<br />
❑ pro Quartal nur €22,50 ❑ pro Jahr nur €89,90<br />
WA-Nr. 620SM60284 – 62145128<br />
Ihr Geschenk<br />
Vorname/Nachname<br />
Straße/Hausnummer<br />
PLZ/Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail (für Rückfragen und weitere Infos)<br />
✗<br />
Datum/Unterschrift<br />
Kreditinstitut<br />
Kontonummer<br />
✗<br />
Datum/Unterschrift<br />
Bankleitzahl<br />
Bitte ausfüllen, ausschneiden oder kopieren und gleich senden an:<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> Leserservice, Postfach 1280, 82197 Gilching<br />
oder per Fax an 0180-532 16 20 (14 ct/min.),<br />
per E-Mail: leserservice@strassenbahnmagazin.de<br />
www.strassenbahn-magazin.de/abo<br />
* Preise inkl. Mwst., im Ausland zzgl. Versandkosten<br />
** Solange Vorrat reicht, sonst gleichwertige Prämie
<strong>Vorschau</strong><br />
Liebe Leser,<br />
Sie haben<br />
Freunde, die<br />
sich ebenso<br />
für die<br />
Straßenbahn<br />
mit all Ihren<br />
Facetten begeistern<br />
wie Sie? Dann empfehlen<br />
Sie uns doch weiter! Ich freue mich<br />
über jeden neuen Leser<br />
TOPTHEMA<br />
Versenkt 1985 –<br />
die Straßenbahn<br />
in Kiel<br />
Am 21. Juli 1977 fiel in der Kieler Ratsversammlung die Entscheidung, die Straßenbahn 1985 in Kiel durch Busse zu ersetzen.<br />
Die Fakten dazu schaffte man jedoch bereits ab Mitte der 1960er-Jahre. Der Beitrag zeigt die einzelnen Schritte auf,<br />
die zur Einstellung des Straßenbahnbetriebes in der Ostseestadt führten. Vom Autor wurden dazu viele <strong>bis</strong>her unberücksichtigte<br />
Quellen eingesehen und anschließend akri<strong>bis</strong>ch ausgewertet.<br />
100 Jahre Woltersdorfer<br />
Straßenbahn<br />
Weitere Themen der kommenden Ausgabe<br />
Der kleine Straßenbahnbetrieb östlich von Berlin feierte im<br />
Mai sein 100. Jubiläum mit einem großen Fest. Einer der<br />
Höhepunkte war der Einsatz historischer Fahrzeuge im 10-<br />
Minuten-Takt. Der Beitrag wirft einen Blick in die Geschichte<br />
des Betriebes – vor allem aber auf das Jubiläumsfest am<br />
Pfingstwochenende dieses Jahres.<br />
TW3000 – neue Generation für<br />
Hannover nimmt Formen an<br />
Für die üstra entstehen derzeit in Leipzig bei der HeiterBlick<br />
GmbH im Auftag von Vossloh Kiepe/Alstom die Wagen des<br />
Typs TW3000. Die ersten dieser Hochflurwagen werden<br />
voraussichtlich Ende 2013 testweise durch Hannover rollen.<br />
Der Beitrag berichtet über den Stand der Dinge und zeigt<br />
die ersten Aufnahmen der im Bau befindlichen Wagen.<br />
J. KARKUSCHKE<br />
Frankfurts Stadtbahnwagen<br />
Typ U2 – ein Porträt<br />
Der 4. Oktober 1968 war für die Bevölkerung in Frankfurt<br />
(Main) ein besonderer Freitag: Die Stadtbahnstrecke A1<br />
ging in Betrieb. Damit begann aber auch die Ära der<br />
U2-Wagen. Ihr Erscheinungsbild prägt den Nahverkehr in<br />
der Mainmetropole seit über vier Jahrzehnten. Nun heißt<br />
es jedoch von den Wagen Abschied zu nehmen.<br />
Erinnerung: Die Straßenbahn<br />
im schweizerischen Fribourg<br />
Ab Ende Juli 1897 verkehrte im schweizerischen Fribourg<br />
eine Straßenbahn. Die komplexe Topografie der Stadt hatte<br />
zuvor für einiges Kopfzerbrechen gesorgt. Nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg sank der Stern des liebenswürdigen Betriebes<br />
mit seinen Steigungen und urigen Altbaufahrzeugen. Am<br />
31. März 1965 verkehrte auf der verbliebenen Strecke<br />
Charmettes – Gare – Tilleul – St. Leonard – Cimetière das<br />
Tram zum letzten Mal.<br />
A. HELLMUTH<br />
N. MÜLLER<br />
André Marks,<br />
verantwortlicher Redakteur<br />
Ende gut …?<br />
Putzen für Elisabeth<br />
In Halle (Saale) säuberten Schüler<br />
einer neunten Klasse des Elisabethgymnasiums<br />
im Rahmen eines sozialen<br />
Aktionstages vor einiger Zeit<br />
eine Straßenbahn und einen Bus der<br />
Halleschen Verkehrs-AG. Die Aktion<br />
fand zum Namenstag der Schulpatronin<br />
Heilige Elisabeth auf dem Betriebshof<br />
Freiimfelder Straße statt.<br />
Nach einer Führung durch die Werkstatt<br />
der HAVAG wurden die Gymnasiasten<br />
von Mitarbeitern der Servicegesellschaft<br />
Saale mbH (SGS) in<br />
das Säubern der Fahrzeuge eingewiesen.<br />
Ausgestattet mit Eimer,<br />
Lappen und Fensterputzutensilien<br />
durften sie – unter den fachkundigen<br />
Augen der SGS – Fenster und<br />
andere Oberflächen selbst reinigen.<br />
Die Schüler erhielten damit Einblick<br />
in die Werkstätten der HAVAG sowie<br />
in die umfangreichen Arbeiten,<br />
die zur Reinhaltung der Fahrzeuge<br />
notwendig sind.<br />
Hintergrund derartiger Aktionen, die<br />
es auch in anderen deutschen Städten<br />
gibt, ist nicht zuletzt die Absicht,<br />
Jugendliche mit dem Aufwand zu<br />
konfrontieren, der zur Reinigung<br />
von Nahverkehrsmitteln notwendig<br />
ist. Die Verkehrsbetriebe erhoffen<br />
sich dadurch bei den Jugendlichen<br />
die Einsicht, in Bussen und Bahnen<br />
weniger Verunreinigungen zu hinterlassen<br />
– deren Spektrum reicht<br />
bekanntlich von Kaugummis <strong>bis</strong> zu<br />
besprühten oder zerkratzten Fensterscheiben.<br />
Damit erfüllen derartige<br />
Aktionstage nicht nur rein soziale<br />
und pädagogische Zwecke,<br />
sondern dienen am Ende sogar der<br />
Vandalismus-Vorbeugung. AM<br />
DAS <strong>STRASSENBAHN</strong>-<strong>MAGAZIN</strong> 8/2013 erscheint am 19. Juli 2013<br />
82<br />
… oder schon 2 Tage früher mit <strong>bis</strong> zu 36 % Preisvorteil und Geschenk-Prämie! Jetzt sichern unter www.strassenbahn-magazin.de<br />
Plus Geschenk<br />
Ihrer Wahl:<br />
z.B. DVD »Trams<br />
im Wirtschafts -<br />
wunderland«
Das besondere Bild<br />
Das besondere Bild<br />
Das besondere Bild<br />
Mit der Wiederinbetriebnahme des Gotha-Großraumzuges HTw<br />
1734 + HBw 2015 im April dieses Jahres erinnerten sich viele<br />
Straßenbahnfreunde in Dresden an die Geschichte dieses Wagentyps<br />
in ihrer Heimatstadt.<br />
Am Straßenbahnhof Tolkewitz nahm Peter Miersch den<br />
Dresdner Wagen 1749 schon unter seiner neuen Berliner Bezeichnung<br />
8053 Ende des Jahres 1969 unmittelbar vor dem Abtransport<br />
an die Spree auf. Neben dem MAN-Beiwagen 1164 wirkte<br />
das Gothafahrzeug hochmodern.<br />
Den Zeitgeist der 1960er-Jahre spiegelt der Sowjetstern auf dem<br />
Depot wider. Weitere Aufnahmen von diesem Tag zeigen über den<br />
anderen Einfahrten Parolen wie „Freiheit für Vietnam“ oder<br />
Hetze gegen den Imperialismus.<br />
Die eleganten Vierachser aus Gotha kamen 1962–1964 an die<br />
Elbe. Nachdem hier die Zuführung der ersten Tatra-Großraumwagen<br />
erfolgte, gelangten die T4-62/B4-61 1968 <strong>bis</strong> 1970 in die<br />
„Hauptstadt der DDR“, wo sie als Tw 8035 <strong>bis</strong> 8053 und Bw<br />
3091 <strong>bis</strong> 3109 in den Bestand eingereiht wurden. Nach dem Einsatzende<br />
der Gotha-Großraumwagen in Berlin kehrte 1995/96 die<br />
Garnitur Tw 1734 II (Baujahr 1962) mit Bw 2015 (Baujahr 1963)<br />
zur musealen Erhaltung nach Dresden zurück.<br />
TEXT: M. SPERL/AM; FOTO: SLG. M. SPERL<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7 | 2013 83
Exklusiv und gratis<br />
nur für Abonnenten –<br />
die Fotoedition »Die schönsten Straßenbahnen«<br />
2013 erhalten Sie als Abonnent von <strong>STRASSENBAHN</strong><br />
<strong>MAGAZIN</strong> mit jeder Ausgabe ein Exemplar der Fotoedition<br />
»Die schönsten Straßenbahnen«. Die Karten –<br />
zum Sammeln, zum Aufhängen oder Weiterverschicken<br />
– sind aus hochwertigem Chromokarton,<br />
12 x 17 cm groß und erscheinen in limitierter Auflage.<br />
In<br />
8/2013<br />
Sie sind noch nicht Abonnent?<br />
Dann bestellen Sie am besten heute noch Ihr Vorteilspaket unter:<br />
www.strassenbahn-magazin.de/abo Telefon 0180-532 16 17 *<br />
Fax 0180-532 16 20 *<br />
* (14 ct/min.)