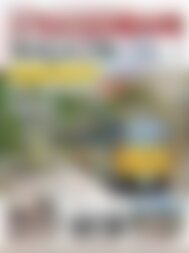STRASSENBAHN MAGAZIN Juwelenjagd in Esslingen - Die unvergessene END (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Österreich: € 9,50<br />
8/2014 | August € 8,50<br />
Schweiz: sFr. 15,90<br />
NL: LUX: € € 9,90<br />
Europas größte Straßenbahn-Zeitschrift<br />
9,90<br />
Seit 1978<br />
Geschichte:<br />
Essl<strong>in</strong>gen –<br />
Nell<strong>in</strong>gen –<br />
Denkendorf<br />
Bildraritäten und<br />
Zeitzeugen-<br />
Berichte<br />
Betriebe<br />
Fahrzeuge<br />
Geschichte<br />
<strong>Juwelenjagd</strong><br />
<strong>in</strong> Essl<strong>in</strong>gen<br />
<strong>Die</strong> <strong>unvergessene</strong> <strong>END</strong><br />
Samba im Revier: Mülheims<br />
Großraumwagen im Porträt<br />
Perle im Vogtland: 120 Jahre<br />
Straßenbahn <strong>in</strong> Plauen<br />
Totaler Tiefpunkt 1994: <strong>Die</strong><br />
Münchner Tram vor 20 Jahren
E<strong>in</strong>steigen, bitte …<br />
E<strong>in</strong>e Frage der Klasse<br />
Stimmen Sie ab<br />
Kurz nach Redaktionsschluss für<br />
den Journal-Teil dieses Heftes meldeten<br />
die Stadtwerke Gera am<br />
27. Juni Insolvenz an. <strong>Die</strong> genauen<br />
Folgen dieses Schrittes für den Geraer Verkehrsbetrieb<br />
GmbH als Tochter der Stadtwerke<br />
werden vermutlich erst nach Druckbeg<strong>in</strong>n<br />
unseres Magaz<strong>in</strong>s feststehen. Hier<br />
sollen jetzt ke<strong>in</strong>e Befürchtungen aufgezählt,<br />
sondern die Stärken des GVB betont werden:<br />
Der kle<strong>in</strong>e Straßenbahnbetrieb <strong>in</strong><br />
Ostthür<strong>in</strong>gen hat sich <strong>in</strong> den vergangenen<br />
Jahren zum Vorzeigeobjekt dafür entwickelt,<br />
wie <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Städten e<strong>in</strong> effizienter<br />
und trotzdem moderner Trambetrieb<br />
laufen kann. Ob diese im städtischen Nahverkehr<br />
<strong>in</strong> Gera erreichte Klasse im vollen<br />
Umfang erhalten bleibt, wird die Zukunft<br />
zeigen – und im <strong>STRASSENBAHN</strong> MA-<br />
GAZIN nachzulesen se<strong>in</strong>.<br />
Stichwort „Klasse“ – dieses Wort br<strong>in</strong>gt<br />
ja nicht nur Qualität ganz allgeme<strong>in</strong> zum<br />
Ausdruck, sondern ist auch e<strong>in</strong>e Maße<strong>in</strong>-<br />
Was halten Sie von der Idee, <strong>in</strong> Straßen- oder Stadtbahnen<br />
1.-Klasse-Abteile e<strong>in</strong>zuführen?<br />
• Das wäre e<strong>in</strong>e gute Sache – damit gibt man der Straßenbahn noch<br />
zusätzliche Qualität als Verkehrsmittel.<br />
• Davon halte ich nichts; das schafft nur Probleme im Betrieb und verkompliziert<br />
den Fahrkartenverkauf.<br />
• Das geht am Bedarf völlig vorbei – das Interesse der Fahrgäste dürfte<br />
nur ger<strong>in</strong>g se<strong>in</strong> …<br />
Stimmen Sie onl<strong>in</strong>e ab: www.strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de<br />
heit für Reisekomfort. Bei e<strong>in</strong>em Treffen<br />
von Eisen- und Straßenbahnfreunden kam<br />
kürzlich zur Sprache, dass viele Eisenbahngesellschaften<br />
<strong>in</strong> Deutschland auch<br />
im S-Bahnverkehr Sitzplätze der 1. und<br />
2. Klasse anbieten. Im Bereich des um<br />
Dresden zuständigen Verkehrsverbundes<br />
Oberelbe nutzen etwa e<strong>in</strong> Zehntel aller<br />
S-Bahn-Fahrgäste den 1.-Klasse-Bereich.<br />
Im S-Bahn-Betrieb von Ballungsräumen<br />
wie Berl<strong>in</strong>, München und Hamburg gehören<br />
die Klassenunterschiede bewusst seit<br />
mehreren Jahren der Vergangenheit an.<br />
Vor allem <strong>in</strong> der Vorkriegszeit experimentierten<br />
aber auch verschiedene europäische<br />
Straßenbahnbetriebe mit Sitzbereichen<br />
1. Klasse – etwa Merseburg und<br />
Neuchâtel. Da stellt sich die Frage: Spricht<br />
eigentlich etwas gegen e<strong>in</strong>en qualitativ<br />
höherwertigen Bereich <strong>in</strong> heutigen Straßen-<br />
oder Stadtbahnwagen? Unter den erwähnten<br />
Freunden entspann sich e<strong>in</strong> munterer<br />
Gedankenaustausch – von der<br />
Überzeugung, auf diese Weise endlich<br />
mehr Autofahrer <strong>in</strong> die Tram zu bekommen,<br />
bis h<strong>in</strong> zu praktischen Überlegungen,<br />
wie die Sitzbereiche abgetrennt werden<br />
könnten. Andere w<strong>in</strong>kten ab:<br />
zu platzraubend, am Bedarf<br />
vorbeigehend, nicht umsetzbar<br />
etc. Ich persönlich me<strong>in</strong>e, es<br />
gäbe für e<strong>in</strong> solches Angebot<br />
ke<strong>in</strong>en Platz – die Wagen vieler<br />
Straßenbahnbetriebe s<strong>in</strong>d ja<br />
heute schon voll. Doch wie<br />
sehen Sie, liebe Leser, das?<br />
Mit Stoff überzogene<br />
Schaumstoffplatten<br />
als „Polsterung“<br />
und meist nur für<br />
normalgewichtige<br />
Menschen berechnete<br />
Sitzabstände –<br />
das prägt aktuelle<br />
Stadt- und Straßenbahnwagen.<br />
Welchen<br />
Zuspruch fänden<br />
1.-Klasse-Bereiche?<br />
CHRISTIAN LÜCKER<br />
André<br />
Marks<br />
Verantwortlicher<br />
Redakteur<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
3
Inhalt<br />
TITEL<br />
<strong>Die</strong> <strong>unvergessene</strong> Straßenbahn Essl<strong>in</strong>gen – Nell<strong>in</strong>gen – Denkendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />
Betriebe<br />
TITEL<br />
Vogtlandperle auf Meterspur . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />
120 Jahre Straßenbahn <strong>in</strong> Plauen – Sie gehört zu den liebevoll geführten<br />
Kle<strong>in</strong>betrieben <strong>in</strong> Deutschland – und die Plauener dürfen auf ihre im November<br />
1894 eröffnete Straßenbahn zu Recht stolz se<strong>in</strong>. Da stellt sich die<br />
Frage, wie würdigen sie deren 120. Jubiläum <strong>in</strong> diesem Jahr?<br />
Im Schatten des Herkules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
Kassels L<strong>in</strong>ie 1 im Porträt – Nur wenige Straßenbahnl<strong>in</strong>ien haben<br />
e<strong>in</strong>e längere Geschichte als sie. E<strong>in</strong>e ihrer Endstellen führt sogar zu<br />
e<strong>in</strong>em UNESCO-Weltkulturerbe. Doch Kassels 1 hat noch mehr zu<br />
bieten als e<strong>in</strong>e mittlerweile 137-jährige Tradition und e<strong>in</strong>e drei<br />
Kilometer lange Berg- und Talbahn<br />
Tram-Kultur mit Stange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
Aktuelles von der Straßenbahn<br />
<strong>in</strong> Riga – Sie ist Europas<br />
Kulturhauptstadt 2014 – und<br />
auch die Straßenbahnhauptstadt<br />
Lettlands – Riga! Noch immer<br />
fahren auf neun L<strong>in</strong>ien massenhaft<br />
Tatra- Wagen mit Trolleystange<br />
durch die Straßen. Doch<br />
die Ablösung der Fahrzeuge<br />
rückt näher<br />
Titelmotiv<br />
<strong>Die</strong> Straßenbahn Essl<strong>in</strong>gen –<br />
Nell<strong>in</strong>gen – Denkendorf<br />
kurz nach ihrem Ausgangspunkt<br />
auf der Neckarbrücke<br />
<strong>in</strong> Essl<strong>in</strong>gen DIETER SCHLIPF<br />
RUBRIKEN<br />
„E<strong>in</strong>steigen, bitte ...“ . . . . . . 3<br />
Bild des Monats . . . . . . . . . . 6<br />
Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
Nächster Halt . . . . . . . . . . . . 33<br />
E<strong>in</strong>st & Jetzt . . . . . . . . . . . . . 50<br />
Fundstück des Monats . . . . . 75<br />
Forum, Impressum . . . . . . . . 80<br />
<strong>Vorschau</strong> . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />
„Ende gut ...“ . . . . . . . . . . . 82<br />
Das besondere Bild. . . . . . . . 83<br />
4 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
Besondere B-Wagen <strong>in</strong> Bochum und Dortmund 44 137 Jahre alt und jüngst erweitert: Kassels L<strong>in</strong>ie 1 24<br />
In der Talsohle 1994: Münchens Tram vor 20 Jahren 66 Dresden: Als die L<strong>in</strong>ie 3 noch bis Freital fuhr ... 64<br />
Fahrzeuge<br />
Geschichte<br />
TITEL<br />
Samba <strong>in</strong> Mülheim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />
60 Jahre Großraumwagen l<strong>in</strong>ks und rechts der Ruhr – Am<br />
19. Februar 1954 g<strong>in</strong>g der erste vierachsige Großraumwagen mit ungewohnt<br />
großer Aufnahmefläche <strong>in</strong> Mülheim an der Ruhr <strong>in</strong> <strong>Die</strong>nst.<br />
Elf solche Trieb- und 13 Beiwagen prägten vier Jahrzehnte die dortigen<br />
Meterspurgleise<br />
TITEL<br />
<strong>Juwelenjagd</strong> <strong>in</strong> Essl<strong>in</strong>gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />
Er<strong>in</strong>nerungen an die <strong>END</strong> – Auch mehr als 35 Jahre nach E<strong>in</strong>stel lung<br />
und Abriss der Straßenbahn Essl<strong>in</strong>gen–Nell<strong>in</strong>gen–Denkendorf besteht<br />
sie <strong>in</strong> der Er<strong>in</strong>nerung vieler Menschen fort. Doch was macht den Nimbus<br />
dieser Überlandstrecken aus? <strong>Die</strong> Re daktion sprach darauf verschiedene<br />
Zeitzeugen an …<br />
<strong>Die</strong> Längsten und Jüngsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />
Stadtbahnwagen B <strong>in</strong> Dortmund und Bochum – Seit 1986 fahren <strong>in</strong><br />
Dortmund spezielle B-Wagen. Und nur hier ist – seit 1996 – dieser klassische<br />
Stadtbahnwagentyp auch als dreiteiliger Achtachser anzutreffen. Auch<br />
die Bogestra orderte für ihre e<strong>in</strong>zige Normalspurl<strong>in</strong>ie B-Wagen. 25 Exemplare<br />
s<strong>in</strong>d auf der U35 zwischen Bochum-Hustadt und Herne unterwegs<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> im Modell<br />
Idyll mit Manta und Mülleimer. . . . . . . . . . . 76<br />
E<strong>in</strong> Stück Ruhrgebiet <strong>in</strong> H0: Guido Mandorf hat se<strong>in</strong>e Modelltram-<br />
Anlage aus dem Kohlenpott und dem Bergischen Land erweitert<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
Ablösung durch den Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />
Details zum Ende von L<strong>in</strong>ie 3 nach Freital – Am zeitigen Morgen<br />
des 26. Mai 1974 fuhr die letzte Straßenbahn von Freital-He<strong>in</strong>sberg nach-<br />
Dresden-Löbtau. Dann übernahmen Busse diese Leistung …<br />
TITEL<br />
Vor dem Neubeg<strong>in</strong>n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />
<strong>Die</strong> Münchner Straßenbahn vor 20 Jahren – 1994 befand sich die<br />
Tram <strong>in</strong> der bayerischen Landeshauptstadt auf ihrem historischen Tiefpunkt:<br />
Noch wenige Monate zuvor hatte es Streckenstilllegungen gegeben – aber<br />
wie fand Stefan H<strong>in</strong>der aus Oldenburg den Betrieb vor?<br />
Ganze 28 Tage <strong>in</strong> <strong>Die</strong>nst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />
<strong>Die</strong> Straßenbahn <strong>in</strong> Cuxhaven – 2014 ist das Jahr des Gedenkens<br />
an den Beg<strong>in</strong>n des Ersten Weltkriegs. Unmittelbar damit verknüpft ist<br />
aber auch die Er<strong>in</strong>nerung an die kurze Betriebszeit der Straßenbahn <strong>in</strong><br />
Cuxhaven – aber warum war sie nur wenige Tage <strong>in</strong> Betrieb?<br />
5
Bild des Monats<br />
Bild des Monats<br />
Sommerzeit – Urlaubszeit! Den <strong>in</strong> diesen Monaten s<strong>in</strong>nvollen Badespaß mit dem<br />
Hobby Straßenbahn zu verb<strong>in</strong>den, das ist zum Beispiel auf der spanischen Insel<br />
Mallorca möglich. Seit nunmehr 101 Jahren verb<strong>in</strong>det hier die Tranvia de Sóller<br />
den Bahnhof mit dem Hafen der Geme<strong>in</strong>de. <strong>Die</strong> knapp fünf Kilometer lange<br />
Strecke hat e<strong>in</strong>e Spurweite von drei englischen Fuß (914 Millimeter) und wird<br />
von der Bevölkerung liebevoll als „Orangen-Express“ bezeichnet. Bis heute<br />
kommen hier auch mehrere Fahrzeuge aus der Anfangszeit der Tram zum E<strong>in</strong>satz.<br />
So fotografierte Paul G. Liebhart an e<strong>in</strong>em heißen Julitag 2012 den 1913<br />
<strong>in</strong> Saragossa von der Firma Carde & Escoriaza gebauten Triebwagen 2 mit zwei<br />
offenen Beiwagen an der Uferpromenade im Alltagsdienst.<br />
6<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Bild des Monats<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014 7
Meldungen aus Deutschland,<br />
aus der Industrie und aus aller Welt<br />
<strong>Die</strong> Variobahn 607 passiert am 18. Juni 2014 nach dem Verlassen der Bahnhofshalle<br />
das Empfangsgebäude des Chemnitzer Hauptbahnhofs MARKUS BERGELT<br />
ONLINE-UMFRAGE<br />
Reservewagen für<br />
Notfälle erforderlich<br />
Im Heft 7/2014 fragten wir die Leser,<br />
ob Betriebe grundsätzlich e<strong>in</strong>e Reserve<br />
an Straßenbahnwagen für unvorhergesehene<br />
Fälle unterhalten sollten?<br />
Zu Redaktionsschluss erklärten 87,3<br />
Prozent der sich an der Umfrage beteiligenden<br />
Leser: Ja, die Betriebe<br />
sollten zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>e gewisse Anzahl<br />
älterer Straßenbahnfahrzeuge als<br />
Reserve vorhalten.<br />
8,5 Prozent der Teilnehmer s<strong>in</strong>d der<br />
Me<strong>in</strong>ung, dass diese Reserve unbed<strong>in</strong>gt<br />
aus modernen und zeitgemäßen<br />
Fahrzeugen bestehen müsse. Immerh<strong>in</strong><br />
4,2 Prozent der Leser erklärten,<br />
dass e<strong>in</strong> Reservepark betriebswirtschaftlich<br />
nicht vertretbar sei. Bei<br />
Engpässen wäre e<strong>in</strong> Ersatzverkehr mit<br />
angemieteten Bussen s<strong>in</strong>nvoller. SM<br />
Chemnitz: Straßenbahnumbau am Hauptbahnhof vollendet<br />
Nächster Schritt für das „Chemnitzer Modell“<br />
Seit dem 16. Juni fahren die Wagen<br />
der Chemnitzer Straßenbahnl<strong>in</strong>ien 4<br />
und 6 sowie der City-Bahn-L<strong>in</strong>ie 522<br />
durch den Chemnitzer Hauptbahnhof.<br />
Damit ist e<strong>in</strong>e weitere Voraussetzung<br />
zur Umsetzung des Chemnitzer Modells<br />
geschaffen. <strong>Die</strong> 2002 elektrisch <strong>in</strong><br />
Betrieb genommene City-Bahn-Verb<strong>in</strong>dung<br />
Chemnitz – Stollberg verkörpert<br />
als Pilotprojekt die „Stufe 0“ des<br />
Chemnitzer Modells: Erstmals realisierten<br />
die beteiligten Partner dabei e<strong>in</strong>e<br />
schnelle und bequeme Schienenanb<strong>in</strong>dung<br />
des Umlands – von Stollberg über<br />
Pfaffenha<strong>in</strong> und Neukirchen-Klaffenbach<br />
– an die Chemnitzer Innenstadt.<br />
Ziel ist seither, e<strong>in</strong> nachhaltiges Verkehrskonzept<br />
für den Großraum Chemnitz<br />
zu verwirklichen. Insgesamt sollten<br />
dafür nach ursprünglichen Planungen<br />
etwa 264 Millionen Euro Investitionen<br />
fließen. Das „Zielnetz 2020“ würde bei<br />
kompletter E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung aller Teilabschnitte<br />
des Chemnitzer Modells bis zu<br />
226 Kilometer Eisenbahn- und Straßenbahngleise<br />
umfassen. Das Vorhaben ist<br />
dabei <strong>in</strong> fünf Stufen gegliedert – Stufe 1:<br />
E<strong>in</strong>fahrt <strong>in</strong> den Chemnitzer Hauptbahnhof;<br />
Stufe 2: Ausbau nach Thalheim;<br />
Stufe 3: Ausbau nach Niederwiesa; Stufe<br />
4: Ausbau nach Limbach-Oberfrohna<br />
sowie die Verlängerung Stollberg –<br />
Oelsnitz (Stufe 5).<br />
Infrastruktur für<br />
Stufe 1 vorbereitet<br />
<strong>Die</strong> am 16. Juni eröffneten Anlagen bilden<br />
die Voraussetzung für die „Stufe<br />
1“ des Chemnitzer Modells. Sie umfassen<br />
die Neugestaltung des Hauptbahnhofes<br />
mit Verknüpfung von Straßenbahn-<br />
und Eisenbahnnetz. Für diese<br />
erste Stufe veranschlagte der projektierende<br />
Verkehrsverbund Mittelsachsen<br />
(VMS) Planungs- und Baukosten<br />
von 32,5 Millionen Euro, die sich wesentlich<br />
aus Mitteln des Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)<br />
speisen. Mit dem 2011 begonnenen<br />
Umbau und der Öffnung der Bahnsteighalle<br />
und des Querbahnsteiggebäudes<br />
s<strong>in</strong>d die wichtigsten Voraussetzungen<br />
geschaffen, um Züge aus<br />
Mittweida, Burgstädt oder Ha<strong>in</strong>ichen<br />
auf Straßenbahngleisen weiter zur<br />
Zentralhaltestelle und darüber h<strong>in</strong>aus<br />
zu führen. Von der Hallenwand entlang<br />
der Georgstraße blieb im Zuge der Arbeiten<br />
nur die tragende Konstruktion<br />
stehen, die zwischenzeitlich e<strong>in</strong>e neue<br />
Verkleidung erhielt. Im Laufe der Umgestaltung<br />
entfernten die Arbeiter die<br />
westlichen Hallenbahnsteige 1 bis 4<br />
komplett und verfüllten den Gepäckund<br />
Posttunnel. Das Terra<strong>in</strong> für die<br />
neuen „Straßenbahnsteige“ ist gegenüber<br />
den Bahnsteigen der Eisenbahn<br />
um etwa 2,5 Meter abgesenkt. Neu<br />
entstand e<strong>in</strong>e Stützmauer neben dem<br />
Gleis am Bahnsteig 5. <strong>Die</strong>se Stützmauer<br />
markiert <strong>in</strong>nerhalb der Bahnhofshalle<br />
zugleich die Grenze zwischen dem<br />
Gleisbereich der DB AG im östlichen<br />
Hallenteil und den auf westlicher Seite<br />
tiefer liegenden Bahnsteigen, die für<br />
das Chemnitzer Modell benötigt werden.<br />
Der Bahnsteig 5 blieb an se<strong>in</strong>er<br />
alten Stelle, von hier fahren die Züge <strong>in</strong><br />
Richtung Leipzig ab.<br />
Hybridfahrzeuge vor<br />
der Auslieferung<br />
<strong>Die</strong> für die betriebliche Umsetzung der<br />
„Stufe 1“ nötigen acht Zweisystem-<br />
8<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Deutschland<br />
<strong>Die</strong> Berl<strong>in</strong>er Verkehrsbetriebe (BVG)<br />
und der Hersteller Stadler Pankow<br />
GmbH präsentierten im Juni die Rohbauten<br />
der neuen Berl<strong>in</strong>er U-Bahn-<br />
Wagen des Typs IK. Stadler fertigt<br />
zunächst zwei neue U-Bahn-Prototypzüge<br />
für das Kle<strong>in</strong>profilnetz (L<strong>in</strong>ien U1<br />
bis U4) der BVG. Sie sollen 2015 <strong>in</strong><br />
den L<strong>in</strong>iene<strong>in</strong>satz gehen. Nach erfolgreichem<br />
Testbetrieb besteht e<strong>in</strong>e Option<br />
auf Serienherstellung für bis zu 34<br />
weitere Fahrzeuge. <strong>Die</strong> Unternehmen<br />
versprechen e<strong>in</strong> modernes Fahrgast<strong>in</strong>formationssystem<br />
und helles, freundlifahrzeuge<br />
– mit Option auf zwei weitere<br />
Wagen – des Typs „CityL<strong>in</strong>k“ von<br />
Vossloh werden nach e<strong>in</strong>er entsprechenden<br />
Ausschreibung vom Sommer<br />
2012 für Ende 2014 bis Anfang 2015<br />
erwartet. Bis zum ersten L<strong>in</strong>iene<strong>in</strong>satz,<br />
der momentan ab Fahrplanwechsel<br />
im Dezember 2015 zunächst<br />
auf den Strecken nach Mittweida,<br />
Burgstädt und Ha<strong>in</strong>ichen geplant ist,<br />
s<strong>in</strong>d noch umfangreiche Probe- und<br />
Zulassungsfahrten zu absolvieren. <strong>Die</strong><br />
dreiteiligen Fahrzeuge zum Stückpreis<br />
von über drei Millionen Euro werden<br />
etwa 37 Meter lang und 2,65 Meter<br />
breit se<strong>in</strong>. Sie sollen über 94 Sitzplätze<br />
und Luftfederung für hohen Fahrkomfort<br />
verfügen und m<strong>in</strong>destens<br />
100 Kilometer pro Stunde erreichen.<br />
<strong>Die</strong> Traktionsleistung auf den Eisenbahnabschnitten<br />
wird e<strong>in</strong> <strong>Die</strong>selaggregat<br />
übernehmen.<br />
L<strong>in</strong>ienänderung<br />
im CVAG-Netz<br />
<strong>Die</strong> seit 16. Juni mögliche Durchfahrt<br />
durch den Hauptbahnhof zog Veränderungen<br />
im L<strong>in</strong>iennetz der Stadt nach<br />
sich: <strong>Die</strong> L<strong>in</strong>ien 4 und 6 sowie die City-<br />
Bahn-L<strong>in</strong>ie 522 steuern den Bahnhof<br />
nun direkt an. Während die L<strong>in</strong>ie 4 die<br />
Wendefahrt über Straße der Nationen<br />
– Hauptbahnhof – Carolastraße im<br />
Uhrzeigers<strong>in</strong>n absolviert, befahren die<br />
sich im Takt ergänzenden L<strong>in</strong>ien 6 und<br />
522 die Hauptbahnhofschleife <strong>in</strong> entgegengesetzter<br />
Richtung. <strong>Die</strong> L<strong>in</strong>ien 1<br />
und 2 s<strong>in</strong>d seit 16. Juni wieder mit -<br />
e<strong>in</strong>ander verknüpft: Bahnen der L<strong>in</strong>ie 1,<br />
die aus Schönau kommen, fahren über<br />
Zentralhaltestelle zur Brückenstraße<br />
und weiter als L<strong>in</strong>ie 2 – erneut über<br />
Zentralhaltestelle – nach Bernsdorf,<br />
ebenso <strong>in</strong> der Gegenrichtung. Zuvor<br />
endeten ab 8. Mai die Straßenbahnl<strong>in</strong>ien<br />
2, 6 und die City-Bahn-L<strong>in</strong>ie 522<br />
übergangsweise am Bahnhofsvorplatz,<br />
nachdem bereits ab Februar 2013 von<br />
der Nordseite kommend Bahnen <strong>in</strong> die<br />
Bahnhofshalle rollten und dort stumpf<br />
wendeten.<br />
Zur feierlichen Freigabe der Bahnhofs-Durchfahrt<br />
am 16. Juni fuhren<br />
nach den obligatorischen Ansprachen<br />
je e<strong>in</strong>e Variobahn der CVAG und der<br />
City-Bahn parallel aus der Bahnhofshalle<br />
vorbei an Ehrengästen und<br />
Schaulustigen h<strong>in</strong>aus auf die Bahnhofstraße.<br />
Berl<strong>in</strong><br />
U-Bahn-Wagen IK<br />
<strong>in</strong> Endmontage<br />
MSP<br />
Im Chemnitzer Hauptbahnhof steht am 17. Juni Variobahn 411 der City-<br />
Bahn zur Abfahrt nach Stollberg bereit<br />
PETER KALBE<br />
Auch die historischen Straßenbahnfahrzeuge können jetzt den Hauptbahnhof<br />
von Chemnitz erobern, so im Rahmen des Kappler Straßenbahnfestes<br />
hier Triebwagen 801 bei e<strong>in</strong>er Rundfahrt am 21. Juni STEFFEN KUSS<br />
ches Design. <strong>Die</strong> Luftfederung wirkt<br />
sich positiv auf die Laufruhe der Fahrzeuge<br />
aus. Durch die sogenannte<br />
Bombierung verbreitert sich der Innenraum<br />
um etwa zehn Zentimeter. Das<br />
ermöglicht e<strong>in</strong>e komfortablere Anordnung<br />
der Sitze und Mehrzweckabteile.<br />
Auch der Fahrerarbeitsplatz zeichnet<br />
sich durch besonderen Komfort aus: Er<br />
ist so gestaltet, dass der Fahrer sowohl<br />
im Sitzen als auch im Stehen arbeiten<br />
kann. <strong>Die</strong> Fahrerkab<strong>in</strong>e ist darüber<br />
h<strong>in</strong>aus dunkel gestaltet, um e<strong>in</strong><br />
mögliches Blenden der Fahrer entgegenkommender<br />
Züge zu verr<strong>in</strong>gern.<br />
<strong>Die</strong> jeweils vierteiligen Züge s<strong>in</strong>d<br />
für bis zu 330 Fahrgäste dimensioniert,<br />
sie sollen über etwa 80 Sitzplätze<br />
<strong>in</strong> Längsbestuhlung sowie über 250<br />
Stehplätze verfügen. In den kommenden<br />
Wochen werden <strong>in</strong> Re<strong>in</strong>ickendorf<br />
die Rohbauten für den zweiten Zug<br />
hergestellt. <strong>Die</strong> e<strong>in</strong>zelnen Zugbestandteile<br />
kommen nach Fertigstellung zur<br />
Endmontage <strong>in</strong>s Stadler-Werk Hohenschönhausen.<br />
PM<br />
Hamburg<br />
S-Bahn zeigt<br />
neues Fahrzeug<br />
Am 16. Juni präsentierte die S-<br />
Bahn Hamburg GmbH geme<strong>in</strong>sam mit<br />
dem Hersteller Bombardier Transportation<br />
der Presse e<strong>in</strong> Modell der zukünftigen<br />
Elektrotriebwagen der Baureihe<br />
490 <strong>in</strong> Orig<strong>in</strong>algröße. Es zeigt die<br />
Stirnfront, welche die neueste Sicherheitsnorm<br />
erfüllt, sowie die geplante<br />
Ausstattung des Innenraums. Im durchgehend<br />
begehbaren Zug s<strong>in</strong>d Klimatisierung<br />
und e<strong>in</strong> modernes Fahrgast<strong>in</strong>formationssystem<br />
vorgesehen. Ab 2016<br />
testet die S-Bahn zunächst acht Prototypen,<br />
von denen vier E<strong>in</strong>heiten als<br />
Bielefeld<br />
Der Nahverkehrsbetreiber mo-<br />
Biel bedauert die Entscheidung<br />
der Bürger gegen die Stadtbahnverlängerung<br />
nach Heepen. Mit<br />
53,4 Prozent Ne<strong>in</strong>-Stimmen<br />
zeigte der Bürgerentscheid am<br />
25. Mai e<strong>in</strong> knappes Votum gegen<br />
e<strong>in</strong>e Neubaustrecke Sennestadt<br />
– Heepen. Ungeachtet dessen<br />
plant moBiel drei andere<br />
Netzerweiterungen, konkret die<br />
der L<strong>in</strong>ie 4 vom Lohmannshof zur<br />
Schloßhofstraße und die der L<strong>in</strong>ie<br />
3 von Stieghorst nach Hillegossen.<br />
Weiterh<strong>in</strong> beg<strong>in</strong>nen voraussichtlich<br />
im Herbst die Bauarbeiten<br />
zur Verlängerung der L<strong>in</strong>ie 2<br />
nach Altenhagen.<br />
MSP<br />
Heidelberg<br />
Am 23. Juni erteilte das<br />
Regierungspräsidium Karlsruhe<br />
den Planfeststellungsbeschluss<br />
für die 2,5 Kilometer lange Straßenbahn<br />
<strong>in</strong>s Neuenheimer Feld.<br />
Sie ist Herzstück des „Heidelberger<br />
Mobilitätsnetzes“, mit dem<br />
die Heidelberger Straßen- und<br />
Bergbahn AG (HSB) ihr Straßenbahnnetz<br />
umfassend ausbaut.<br />
<strong>Die</strong> HSB <strong>in</strong>vestiert mit Förderung<br />
durch Bund und Land etwa 37,5<br />
Millionen Euro <strong>in</strong> das Projekt<br />
Neuenheimer Feld. Voraussichtlich<br />
im Frühjahr 2015 kann der<br />
Bau beg<strong>in</strong>nen. Entlang der neuen<br />
Strecke s<strong>in</strong>d fünf Haltestellen<br />
geplant.<br />
MSP<br />
Bremen<br />
<strong>Die</strong> Bremer Straßenbahn Aktiengesellschaft<br />
(BSAG) hat ihre<br />
Strecke über die Stadtgrenze<br />
h<strong>in</strong>aus nach Lilienthal und Falkenberg<br />
fertiggestellt. <strong>Die</strong> Kosten<br />
des Projekts summieren sich<br />
auf voraussichtlich 64,1 Millionen<br />
Euro und s<strong>in</strong>d damit um<br />
7,75 Millionen Euro teuer als ursprünglich<br />
veranschlagt. Schleifwagen<br />
3985 befuhr am 24. Juni<br />
nach dreijähriger Bauzeit als<br />
erstes Schienenfahrzeug die<br />
neue Gleisanlage. Ab Anfang Juli<br />
f<strong>in</strong>den Personalschulungen mit<br />
Leerfahrten statt. Am 1. August<br />
wird die neue Strecke von Borgfeld<br />
nach Falkenberg offiziell eröffnet.<br />
MSP<br />
rz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
9
Aktuell<br />
Berl<strong>in</strong>: Vom 12. Mai bis 14. Juni erneuerte die BVG die Gleise zwischen Pankow Kirche und Französisch Buchholz/<br />
Guyotstraße. <strong>Die</strong> L<strong>in</strong>ie 50 fuhr deshalb nur zwischen Virchow-Kl<strong>in</strong>ikum und Pankow Kirche, zwischen Pankow S/U und<br />
Guyotstraße verkehrte Schienenersatzverkehr. Kurz nach Pankow Kirche entstand mittels Kletterweiche e<strong>in</strong>e provisorische<br />
Endstelle, auf L<strong>in</strong>ie 50 setzte die BVG Zweirichtungswagen e<strong>in</strong>, hier F6Z 4034 am 13. Mai<br />
ERNST PLEFKA<br />
Zweisystemzüge für e<strong>in</strong>en Betrieb<br />
auch unter 15-Kilovolt-Vollbahn-Fahrleitung<br />
ausgeführt s<strong>in</strong>d. <strong>Die</strong> Zweisystemversion<br />
ist für e<strong>in</strong>e Höchstgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
von 140 Kilometer pro<br />
Stunde ausgelegt, die re<strong>in</strong>en Gleichstromzüge<br />
sollen h<strong>in</strong>gegen maximal<br />
100 Kilometer pro Stunde erreichen.<br />
Bis Ende 2018 verstärken zunächst 60<br />
Züge den vorhandenen Fahrzeugpark<br />
und lösen die Wagen der Baureihen<br />
472/473 ab. JEP<br />
Magdeburg<br />
Straßenbahn wieder<br />
bis Barleber See<br />
Am 8. Juni 2013 stellten die Magdeburger<br />
Verkehrsbetriebe (MVB)<br />
hochwasserbed<strong>in</strong>gt den Straßenbahnverkehr<br />
zum Barleber See e<strong>in</strong>. Seitdem<br />
fuhr die Straßenbahn nur bis zur Zwischenschleife<br />
Neue Neustadt. Ab<br />
28. Oktober 2013 durften Fahrgäste<br />
bei E<strong>in</strong>- und Ausrückfahrten zum und<br />
vom Betriebshof Nord bis und ab Haltestelle<br />
Schule Rothensee mitfahren.<br />
Am 23. Dezember 2013 nahmen die<br />
MVB e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>geschränkten Betrieb<br />
bis zum Depot Nord auf, im 10-M<strong>in</strong>uten-Takt<br />
fuhr jede zweite Bahn weiterh<strong>in</strong><br />
nur bis Neue Neustadt. Am Betriebshof<br />
wendeten die Wagen über<br />
das Gleisdreieck, e<strong>in</strong>e Weiterfahrt zur<br />
etwa 200 Meter entfernten Zwischenschleife<br />
Rothen see war nicht möglich,<br />
da das Gleis dort auf mehreren Metern<br />
unterspült worden ist.<br />
In den zurückliegenden Wochen<br />
erledigten die MVB die nötigen Stopfund<br />
Richtarbeiten an den Gleisan lagen.<br />
Seit 2. Juni Betriebsbeg<strong>in</strong>n können die<br />
Wagen wieder auf der Gesamtstrecke<br />
fahren, allerd<strong>in</strong>gs wegen noch immer<br />
e<strong>in</strong>geschränkter Energieversorgung ab<br />
Neue Neustadt nur alle 20 M<strong>in</strong>uten.<br />
Für die 2015 angedachte Behebung<br />
dieser Schäden s<strong>in</strong>d schätzungsweise<br />
über fünf Millionen Euro sowie e<strong>in</strong>e<br />
europaweite Ausschreibung nötig.<br />
Positive Signale gibt es <strong>in</strong>des von<br />
e<strong>in</strong>er anderen Baustelle: Voraussichtlich<br />
im Oktober beg<strong>in</strong>nen die Arbeiten<br />
für die Neubaustrecke, die entlang der<br />
Wiener Straße e<strong>in</strong>e neue Verb<strong>in</strong>dung<br />
zwischen den Bestandsstrecken entlang<br />
der Halberstädter und Leipziger<br />
Straße herstellt.<br />
DP<br />
Dresden<br />
Hauptuntersuchung<br />
für Tatra-Wagen<br />
<strong>Die</strong> Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB)<br />
feierten 2010 den Abschied von ihren<br />
Tatras, doch sieht e<strong>in</strong>e jüngst am 16. Juni<br />
veröffentlichte Ausschreibung die erneute<br />
Hauptuntersuchung (HU) für neun<br />
modernisierte Wagen vor. Insgesamt sollen<br />
vier T4D-MT und fünf TB4D (mit<br />
Hilfsführerstand) mangels eigener Kapazitäten<br />
bei e<strong>in</strong>em externen Anbieter e<strong>in</strong>e<br />
8-Jahres-Inspektion gemäß BOStrab erhalten.<br />
Bei diesen Fahrzeugen handelt<br />
es sich laut Ausschreibung um Wagen,<br />
deren letzte HU im Zeitraum 2001 bis<br />
2007 erfolgte. Infrage kommen dementsprechend<br />
die teils seit vielen Jahren abgestellten<br />
T4D-MT 224 201, 249, 263,<br />
267 und 277 sowie die teilweise aktuell<br />
noch im E<strong>in</strong>satz stehenden TB4D 244<br />
033, 034, 046-048. Neben der eigentlichen<br />
Inspektion gehören e<strong>in</strong>e Grund<strong>in</strong>standsetzung<br />
aller Bauteile, Fahrzeug<strong>in</strong>betriebnahme<br />
und Transport der Wagen<br />
zum Auftragsumfang. <strong>Die</strong> Ausschreibung<br />
erfolgte europaweit, im Juli erwartet<br />
die DVB Angebote <strong>in</strong>teressierter<br />
Unternehmen. Im Oktober ist die Zuschlagserteilung<br />
geplant. Bereits zwischen<br />
2010 und 2012 erhielten neun Tatras,<br />
allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> eigener Werkstatt,<br />
e<strong>in</strong>e Hauptuntersuchung.<br />
DTF<br />
Köln<br />
Serie K2400<br />
im L<strong>in</strong>iendienst<br />
<strong>Die</strong> Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB)<br />
haben die ersten beiden Fahrzeuge<br />
der neuen Stadtbahn-Serie K2400 am<br />
13. Juni <strong>in</strong> den L<strong>in</strong>iendienst gestellt.<br />
<strong>Die</strong> Wagen entstanden durch e<strong>in</strong>en<br />
umfassenden Umbau alter Fahrzeuge<br />
der Serie K2100 von 1984/85. <strong>Die</strong> KVB<br />
leistet die pro Doppelwagen etwa 1,7<br />
Millionen Euro teure Sanierung weitgehend<br />
<strong>in</strong> Eigenarbeit, was zugleich<br />
den Erhalt von Arbeitsplätzen und<br />
Know-how <strong>in</strong> der KVB-Hauptwerkstatt<br />
fördert. Vossloh Kiepe unterstützt als<br />
Partner die Revitalisierung der elektronischen<br />
Ausrüstung. <strong>Die</strong> Stadt fördert<br />
Hamburg: <strong>Die</strong> Kopfform der ab dem Jahr 2016 zu liefernden S-Bahn-Wagen<br />
verdeutlicht dieses Modell <strong>in</strong> Orig<strong>in</strong>algröße<br />
JENS PERBANDT<br />
Magdeburg: Niederflurwagen 1355 konnte als e<strong>in</strong>er der ersten Züge am<br />
2. Juni wieder bis Barleber See durchfahren DITMAR PAUKE<br />
10<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Deutschland<br />
Dresden: Für neun Tatras, darunter 224 201, planen die Verkehrsbetriebe<br />
e<strong>in</strong>en weiteren Instandhaltungszyklus<br />
MICHAEL SPERL<br />
Stuttgart: ZTw 104 hat se<strong>in</strong>en Standplatz <strong>in</strong> der Straßenbahnwelt verlassen<br />
und wird auf den Tieflader gezogen<br />
JÜRGEN DAUR<br />
die Investition der KVB mit bis zu 1,3<br />
Millionen Euro je E<strong>in</strong>heit. Bis 2017 erhalten<br />
im Rahmen des Umbauprogramms<br />
alle 28 Fahrzeuge der Serie<br />
2100 e<strong>in</strong>e Verjüngungskur und s<strong>in</strong>d<br />
damit weitere 25 bis 30 Jahre fit für<br />
den L<strong>in</strong>iendienst.<br />
Verändert wird der Fahrgastraum<br />
mit mehr Platz für Rollstühle und K<strong>in</strong>derwagen,<br />
neuen barrierearmen<br />
Klapptrittstufen sowie Klimatisierung.<br />
Von den ursprünglich zwei Fahrerkab<strong>in</strong>en<br />
pro E<strong>in</strong>heit entfällt e<strong>in</strong>e, was dank<br />
E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> Doppeltraktion betrieblich<br />
aber unproblematisch ist. Der Fahrerarbeitsplatz<br />
wird ergonomischer gestaltet<br />
und den anderen Stadtbahn-Serien<br />
angepasst. Nach umfangreichem Vergleich<br />
zwischen den Optionen Sanierung<br />
oder Neubeschaffung entschied<br />
sich die KVB 2008 für den Weg der Sanierung.<br />
Hierbei war von entscheidender<br />
Bedeutung, dass sich die Qualität<br />
der alten Fahrzeuge, vor allem des<br />
Stahls der Wagenkästen, als ausgesprochen<br />
gut erwiesen hatte. Auch die<br />
Drehgestelle erwiesen sich <strong>in</strong> <strong>in</strong>tensiven<br />
Tests als so stabil, dass sie nach<br />
Grundüberholung langfristig weiter<br />
verwendbar s<strong>in</strong>d.<br />
PM/MSP<br />
Stuttgart<br />
Kurze Reise –<br />
großer Aufwand<br />
Als e<strong>in</strong>e der vorerst letzten baulichen<br />
Maßnahmen erhält das historische<br />
SSB-Depot Bad Cannstatt seit Juni<br />
sukzessive neue Toranlagen. <strong>Die</strong>s gilt<br />
auch für die Ausstellungshalle der Straßenbahnwelt,<br />
bei der als Konzession an<br />
die Statik allerd<strong>in</strong>gs nur die mittig gelegenen<br />
Gleise Tore erhalten. Der bisher<br />
ganz am Rand platzierte Zahnradbahnzug<br />
aus Triebwagen 104 (Essl<strong>in</strong>gen,<br />
1950) und den Vorstellwagen 118 und<br />
120 (Essl<strong>in</strong>gen, 1898 bzw. 1900) lief somit<br />
Gefahr, „auf ewig“ e<strong>in</strong>gemauert zu<br />
werden. <strong>Die</strong>s gab den Anstoß, die ohneh<strong>in</strong><br />
nicht optimal dargebotenen Fahrzeuge<br />
aus der Schausammlung zu entfernen<br />
und bis auf weiteres <strong>in</strong> der<br />
benachbarten oberen Wagenhalle zu<br />
h<strong>in</strong>terstellen. Aufgrund der tief sitzenden<br />
Antriebs- bzw. Bremszahnräder sowie<br />
weiterer Besonderheiten konnte die<br />
ANZEIGE<br />
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt<br />
e<strong>in</strong>en ambitionierten und <strong>in</strong>novativen<br />
Produktmanager /<br />
Redakteur (m/w)<br />
Eisenbahn-Bücher<br />
Sie sollten e<strong>in</strong> gutes Gespür für die Bedürfnisse des Marktes und der angesprochenen<br />
Zielgruppe mitbr<strong>in</strong>gen sowie über e<strong>in</strong>e hohe Fachkompetenz und<br />
Organisationstalent verfügen.<br />
Ihre Kernaufgaben:<br />
• Entwicklung um Umsetzung neuer Buchthemen<br />
• Gew<strong>in</strong>nung und Betreuung von Autoren und Fotografen<br />
• Eigenverantwortliche Zusammenarbeit mit Autoren, Industriekunden,<br />
Layoutern und Herstellung<br />
Ihr Profil:<br />
• Mehrjährige Erfahrung als Buch-Lektor/<strong>in</strong> oder -Redakteur/<strong>in</strong><br />
• sehr gute Kenntnisse im Bereich Eisenbahn/Modellbau/Luftfahrt<br />
• Begeisterungsfähigkeit und Kreativität<br />
• Stilsicherheit und Detailgenauigkeit<br />
• Erfahrung <strong>in</strong> der Konzeption von erfolgreichen Reihen<br />
und E<strong>in</strong>zeltiteln<br />
Zur Unterstützung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt e<strong>in</strong>en<br />
Volontär (m/w) Onl<strong>in</strong>e-Redaktion<br />
Das s<strong>in</strong>d Ihre Aufgaben bei uns:<br />
• Erstellung und Optimierung von zielgruppenspezifischen Texten (auch<br />
unter SEO-Gesichtspunkten)<br />
• Mitwirkung an der Entwicklung neuer digitaler Angebote<br />
• Betreuung von Webseiten und Newslettern<br />
• Arbeiten mit den Content-Management-Systemen Typo3, Drupal, Word-<br />
Press, Tomato<br />
• Report<strong>in</strong>gs sowie Auswertung von SEO-, Traffic- und Nutzungsanalysen<br />
• Enge Zusammenarbeit mit den Zeitschriftenredaktionen zur bestmöglichen<br />
crossmedialen Ansprache der Zielgruppe<br />
Das s<strong>in</strong>d Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten:<br />
• Grundkenntnisse <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Content-Management-System<br />
• Erste Erfahrung <strong>in</strong> der Erstellung von SEO-Texten, Programmier- und<br />
SEM-Grundkenntnisse<br />
• Grundkenntnisse <strong>in</strong> HTML und Bildbearbeitung (Photoshop)<br />
• Kenntnisse <strong>in</strong> Video-Market<strong>in</strong>g und -E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung e<strong>in</strong>es Youtube-Channels<br />
• Sicherer Umgang mit MS-Office, Outlook, Acrobat Reader<br />
• Themen-, Onl<strong>in</strong>e- und Crossmedia-Aff<strong>in</strong>ität<br />
• Überzeugungskraft und Beharrlichkeit<br />
• Hohe Eigenmotivation und selbstständiges Arbeiten<br />
• Lösungsorientierter Arbeitsstil<br />
Ihre ausführlichen Unterlagen mit Ihrem frühestem E<strong>in</strong>trittsterm<strong>in</strong> senden Sie bitte an:<br />
GeraNova Bruckmann Verlagshaus GmbH, Frau Ir<strong>in</strong>a Dörrscheidt, Infanteriestraße 11a, 80797 München oder per E-Mail an ir<strong>in</strong>a.doerrscheidt@verlagshaus.de<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
11
Aktuell<br />
Essen: Der nach Unwettern auf der L<strong>in</strong>ie 106 auf der Mart<strong>in</strong>-Luther-Straße<br />
<strong>in</strong> Essen West „gestrandete“ N8C Nr. 1108<br />
WERNER WÖLKE<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
„Ela“-Unwetterschäden<br />
Wegen Sturmschäden stellten mehrere Straßenbahn- und Stadtbahn-<br />
Betriebe am Pf<strong>in</strong>gstmontagabend (9. Juni) bzw. am Folgetag ihren Verkehr für<br />
teils mehrere Tage vorübergehend e<strong>in</strong>. Aufgrund umgestürzter Bäume auf den<br />
Straßen, Oberleitungsschäden und vere<strong>in</strong>zelten Stromausfällen konnten viele<br />
oberirdische L<strong>in</strong>ien nicht mehr fahren. Auch gab es zahlreiche Schäden an Haltestellen-<br />
und Signalanlagen. Alle<strong>in</strong> im Bereich der Stadt Essen richtete das<br />
Tiefdruckgebiet „Ela“ Schäden <strong>in</strong> Höhe von mehr als 63 Millionen Euro an.<br />
<strong>Die</strong> EVAG bot ab 15. Juni wieder den kompletten Verkehr auf Essener Stadtgebiet<br />
an. In Mülheim betrafen Oberleitungsschäden alle Straßenbahnl<strong>in</strong>ien sowie<br />
die Stadtbahnl<strong>in</strong>ie U18. Auf der Strecke bef<strong>in</strong>dliche Züge erlitten bei mehreren<br />
Betrieben Schäden durch herabstürzende Äste. In Duisburg betrafen die<br />
Unwetterfolgen die L<strong>in</strong>ie 901 sowie die U79, die nicht bis Düsseldorf fahren<br />
konnte. <strong>Die</strong> Rhe<strong>in</strong>bahn rechnet damit, dass die komplette Schadensbehebung<br />
noch länger andauern wird. Am 11. Juni fuhr zunächst e<strong>in</strong>e provisorische<br />
„R<strong>in</strong>gl<strong>in</strong>ie“ <strong>in</strong> der Düsseldorfer Innenstadt, ab 18. Juni lief der Verkehr bei der<br />
Rhe<strong>in</strong>bahn wieder planmäßig. <strong>Die</strong> EVAG und MVG starteten spontan e<strong>in</strong>e Aktion<br />
„Freie Fahrt für freiwillige Helfer“ am Wochenende 14./15. Juni. PM/MSP<br />
Vossloh: Am 12. Juni wurde der Cityl<strong>in</strong>k 327 der VBK im Klima-W<strong>in</strong>d- Kanal<br />
<strong>in</strong> Wien unter w<strong>in</strong>terlichen Bed<strong>in</strong>gungen gestestet ROBERT SCHREMPF<br />
„Zacke“ oder „Zacketse“ – wie die<br />
Stuttgarter ihre Zahnradbahn nennen –<br />
nicht auf eigener Achse, sondern nur<br />
mit Hilfe e<strong>in</strong>es Spezialtiefladers umziehen.<br />
In e<strong>in</strong>er ganztägigen Aktion am<br />
15. Mai rollten die Fahrzeuge Stück für<br />
Stück aus der Ausstellungshalle auf die<br />
Ladebrücke e<strong>in</strong>es Lkw, um dann nach<br />
750 Meter Fahrt <strong>in</strong> der oberen Halle<br />
wieder auf Schienen zu stehen. Weil<br />
dies kurzzeitige Straßensperren erforderte,<br />
musste neben e<strong>in</strong>em Sicherungsfahrzeug<br />
bei jeder Fahrt auch die Polizei<br />
h<strong>in</strong>zugezogen werden.<br />
JDA<br />
Darmstadt<br />
Hitzeprobleme<br />
bei der Tram<br />
Am 12. Juni stellte HEAG mobilo<br />
den Betrieb auf der L<strong>in</strong>ie 1 (Eberstadt<br />
– Hauptbahnhof) e<strong>in</strong>. <strong>Die</strong> extreme Hitze<br />
bee<strong>in</strong>trächtigte die Elektronik der<br />
Straßenbahnen und führt zu erhöhtem<br />
Wartungsaufwand <strong>in</strong> den Werkstätten.<br />
Parallel dazu traten an den älteren<br />
Hochflurfahrzeugen technische Probleme<br />
bei der Antriebssteuerung auf,<br />
die HEAG mobilo <strong>in</strong> Zusammenarbeit<br />
mit dem Hersteller behebt, was voraussichtlich<br />
e<strong>in</strong>ige Wochen <strong>in</strong> Anspruch<br />
nimmt. Bis diese Arbeiten vollendet<br />
s<strong>in</strong>d, entfällt der Betrieb auf der L<strong>in</strong>ie<br />
1. Ausgenommen s<strong>in</strong>d davon nur wenige<br />
Frühfahrten ab der Haltestelle<br />
Frankenste<strong>in</strong> und vier E<strong>in</strong>rückfahrten<br />
am Abend retour. „Mit dieser Maßnahme<br />
können wir trotz der ger<strong>in</strong>geren<br />
Fahrzeugverfügbarkeit alle übrigen<br />
L<strong>in</strong>ien verlässlich bedienen“, erklärte<br />
die Pressesprecher<strong>in</strong> der HEAG mobilo.<br />
<strong>Die</strong> HEAG mobilo bittet die Fahrgäste<br />
für die damit verbundenen Bee<strong>in</strong>trächtigungen<br />
um Verständnis. PM<br />
Wuppertal<br />
Schwebebahnausbau<br />
mit Nacharbeiten<br />
Obwohl e<strong>in</strong> Festakt am 4. April<br />
2014 den vor 19 Jahren begonnenen<br />
Ausbau der Schwebebahn offiziell abgeschlossen<br />
hatte, ruhte der Betrieb<br />
am Wochenende 14./15. Juni erneut:<br />
In der Betriebspause während der<br />
nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Osterferien<br />
waren die Arbeiten <strong>in</strong> der Wagenhalle<br />
Oberbarmen nicht fertiggestellt worden.<br />
<strong>Die</strong> notwendigen Nacharbeiten<br />
waren ursprünglich während des regulären<br />
Schwebebahnbetriebs sowie<br />
vor allem nachts vorgesehen. Verursacht<br />
durch Stromausfälle im Bereich<br />
der neuen Kehre <strong>in</strong> Oberbarmen stand<br />
der Betrieb am 8. Mai für rund 20 und<br />
ANZEIGE<br />
Ihre Prämie<br />
Noch mehr Auswahl unter<br />
www.strassenbahnmagaz<strong>in</strong>.de/abo<br />
am 9. Mai für 90 M<strong>in</strong>uten still. Um<br />
ähnliche Vorkommnisse auszuschließen,<br />
legte die Betriebsleitung fest, alle<br />
Restarbeiten gebündelt am genannten<br />
Wochenende auszuführen.<br />
Ab 1995 ließen die Stadtwerke Wuppertal<br />
GmbH (WSW) das Gerüst der<br />
Schwebebahn, beide Wagenhallen sowie<br />
die Haltestellen der Wuppertaler<br />
Schwebebahn (ausgenommen die drei<br />
Stationen Hauptbahnhof, Ohligsmühle<br />
und Alter Markt) erneuern. Dazu <strong>in</strong>vestierten<br />
sie 512 Millionen Euro. Als Letztes<br />
haben die WSW <strong>in</strong> Oberbarmen e<strong>in</strong>e<br />
neue Wagenhalle bauen lassen. Im kommenden<br />
Jahr soll der Fahrplan im Berufsverkehr<br />
auf e<strong>in</strong>en Zwei-M<strong>in</strong>uten-<br />
Takt verdichtet und der Wagenpark<br />
durch Neubaufahrzeuge ersetzt werden,<br />
womit die Runderneuerung der Schwebebahn<br />
abgeschlossen se<strong>in</strong> wird. PKR<br />
Industrie<br />
Vossloh<br />
Erster Cityl<strong>in</strong>k<br />
<strong>in</strong> Karlsruhe<br />
Der erste von <strong>in</strong>sgesamt 25 bestellten<br />
Niederflur-Stadtbahnen NET 2012<br />
aus der Cityl<strong>in</strong>k-Familie von Vossloh traf<br />
Ende Mai <strong>in</strong> zwei Teilen bei den Verkehrsbetrieben<br />
Karlsruhe (VBK) e<strong>in</strong>. Der<br />
NET 2012 ist 37,20 Meter lang und 2,65<br />
Meter breit, niederflurig, klimatisiert und<br />
erreicht e<strong>in</strong>e Fahrgastkapazität von 224<br />
Personen. Im September sollen die ersten<br />
sieben NET 2012 <strong>in</strong> den L<strong>in</strong>iene<strong>in</strong>satz<br />
kommen. Für Ende des Jahres ist<br />
auch e<strong>in</strong>e Eisenbahnzulassung für e<strong>in</strong>en<br />
möglichen E<strong>in</strong>satz auf den AVG-Strecken<br />
der S1 und S11 vorgesehen.<br />
Nach e<strong>in</strong>er europaweiten Ausschreibung<br />
haben die VBK zusammen mit der<br />
Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) im<br />
Oktober 2011 die Wagen für rund 75<br />
Millionen Euro bestellt. Vossloh baut die<br />
12<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Industrie · Weltweit<br />
Fahrzeuge im ostspanischen Valencia.<br />
Durch e<strong>in</strong>en Zwei-Schicht- Betrieb will<br />
Vossloh zusammen mit VBK/AVG bis August<br />
die Zulassung nach der Bau- und<br />
Betriebsordnung für Straßenbahnen<br />
(BOStrab) erreichen. Mitte Juni 2014<br />
weilte der zweite von Vossloh gefertigte<br />
Karlsruher Cityl<strong>in</strong>k im Klima-W<strong>in</strong>d-Kanal<br />
<strong>in</strong> Wien. In der Anlage simulierten die<br />
Techniker Wettere<strong>in</strong>flüsse am Triebwagen<br />
327, die Verfügbarkeit und Sicherheit<br />
von Komponenten unter realistischen<br />
Betriebsbed<strong>in</strong>gungen zwischen<br />
-20 und +40 Grad Celsius im Zusammenspiel<br />
mit Fahrtw<strong>in</strong>d- und Fahrzyklussimulationen.<br />
Mit der fortlaufenden<br />
Auslieferung stehen dann genügend<br />
Niederflurfahrzeuge zur Verfügung, um<br />
die modernisierte Strecke im Stadtteil<br />
R<strong>in</strong>theim bis zum Jahresende barrierefrei<br />
<strong>in</strong> Betrieb nehmen zu können. <strong>Die</strong><br />
dort <strong>in</strong> Form der hochflurigen GT8 noch<br />
teilweise e<strong>in</strong>gesetzte „Holzklasse“ schicken<br />
die VBK mit Wiedereröffnung des<br />
Streckenabschnitts voraussichtlich <strong>in</strong><br />
den Ruhestand/Reservedienst. MSP/ROS<br />
Bombardier/Vossloh<br />
Zweite Flexity-Serie<br />
für Krefeld<br />
Bombardier Transportation und Vossloh-Kiepe<br />
begannen mit der Auslieferung<br />
von zwölf weiteren niederflurigen<br />
Flexity Outlook (FOC) – Serie 660 bis<br />
671 – an die Stadtwerke Krefeld (SWK).<br />
Das erste Fahrzeug erreichte Krefeld am<br />
23. Mai. Im Gegensatz zur Erstserie erfolgt<br />
die Endmontage nicht mehr im<br />
Werk Aachen, sondern <strong>in</strong> Wien. <strong>Die</strong><br />
Überführung nach Krefeld geschieht auf<br />
dem Schienenweg mittels Spezialtrans-<br />
Wuppertal: Der Abschluss der vor 19 Jahren begonnenen Erneuerung<br />
der Schwebebahn (im Bild die Haltestelle Pestalozzistraße)<br />
verzögerte sich bis Mitte Juni<br />
PHILLIP KRAMMER<br />
portwagen. Ab Ende 2014 verfügen die<br />
SWK nach Abschluss der Lieferung über<br />
31 Flexity Outlook. Für Verstärkerfahrten<br />
zu Stoßzeiten beabsichtigen die SWK,<br />
fünf bis sechs hochflurige M8C-Triebwagen<br />
zu erhalten. <strong>Die</strong> übrigen M8C werden<br />
durch die aktuelle FOC-Auslieferung<br />
sukzessive abgelöst. In Umbau bef<strong>in</strong>den<br />
sich zurzeit die Flexity Outlook der Erstserie<br />
601 bis 619, <strong>in</strong> deren äußeren Wagenmodulen<br />
ersetzt SWK die sieben nebene<strong>in</strong>ander<br />
angeordneten Längssitze<br />
durch drei Quersitze. <strong>Die</strong> Sitzplatzanzahl<br />
s<strong>in</strong>kt damit von 52 auf 46, die Zahl der<br />
Stehplätze steigt von 106 auf 111. ROS<br />
Siemens/Astra<br />
Sechs Imperio-Trieb -<br />
wagen für Arad bestellt<br />
Ende August 2011 stellten der Verkehrsbetrieb<br />
und die Stadtverwaltung<br />
<strong>in</strong> Arad geme<strong>in</strong>sam den ersten niederflurigen<br />
Triebwagen vom Typ „Impe-<br />
Bombardier: <strong>Die</strong> Überführungsfahrt des ersten Krefelder Flexity Outlook der<br />
zweiten Lieferserie legte am 21. Mai <strong>in</strong> L<strong>in</strong>z e<strong>in</strong>en Stopp e<strong>in</strong> ROBERT SCHREMPF<br />
rio“ vor. Nun hat die Stadt Arad beschlossen,<br />
Triebwagen dieses Typs zu<br />
beschaffen, die vom Konsortium aus<br />
„Astra Vagoane Calatori“ und Siemens<br />
<strong>in</strong> Arad gebaut werden. In Auftrag s<strong>in</strong>d<br />
sechs Fahrzeuge im Wert von 9,4 Millionen<br />
Euro angegeben – f<strong>in</strong>anziert<br />
durch e<strong>in</strong>en Kredit der Bank für Wiederaufbau<br />
und Entwicklung. Astra sei, so<br />
verlautete aus der Geschäftsleitung,<br />
derzeit <strong>in</strong> der Lage, jährlich bis zu 36<br />
solcher Triebwagen herzustellen. Auch<br />
Wien: Als Ersatzverkehr für die<br />
am 14./15. Juni baubed<strong>in</strong>gt unterbrochene<br />
U-Bahn-L<strong>in</strong>ie U6 fungierte<br />
die eigens e<strong>in</strong>gerichtete Straßenbahnl<strong>in</strong>ie<br />
„E6“, die zwischen<br />
der Jägerstraße und Floridsdorf<br />
pendelte und <strong>in</strong> den Betriebsbahnhöfen<br />
Brigittenau (Wexstraße) und<br />
Floridsdorf (Peitlgasse) wendete.<br />
Zum E<strong>in</strong>satz kamen fünf lange Niederflurwagen<br />
Typ B und als Besonderheit<br />
auch e<strong>in</strong>e der seit April <strong>in</strong><br />
Floridsdorf beheimateten E 2 + c 5 -<br />
Garnituren. Mit den sechs Zügen<br />
boten die Wiener L<strong>in</strong>ien e<strong>in</strong> 7,5-M<strong>in</strong>uten-Intervall<br />
an, das die ebenfalls<br />
<strong>in</strong> dieser Relation verkehrende<br />
L<strong>in</strong>ie 31 (Schottenr<strong>in</strong>g – Stammersdorf)<br />
noch halbierte. Mit Straßenbahnen<br />
im 3- bis 4-M<strong>in</strong>uten-Takt<br />
war das Fahrgastaufkommen gut<br />
zu bewältigen. WOLFGANG KAISER<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
13
Aktuell<br />
Ed<strong>in</strong>burgh: Triebwagen 273 der neu eröffneten Straßenbahn vor dem<br />
Ed<strong>in</strong>burgh Castle. Insgesamt 27 dieser vom Unternehmen CAF <strong>in</strong> Spanien<br />
gebauten Fahrzeuge stehen zur Verfügung<br />
ANDREW THOMPSON<br />
Prag: Am 3. Juni traf der 100. Wagen vom Skoda-Typ 15T e<strong>in</strong>. Am 8. Juni absolvierte<br />
er Probefahrten, hier an der Modranska skola. Nach e<strong>in</strong>em Sicherheitstest<br />
wechselte er am 12. Juni <strong>in</strong> den Betriebsbestand ONDREJ MATEJ HRUBES<br />
andere rumänische Betriebe wie Oradea<br />
und Cluj haben bereits Interesse an<br />
diesem Fahrzeugtyp bekundet. AMA<br />
Ausland<br />
Großbritannien: Ed<strong>in</strong>burgh<br />
Straßenbahn nimmt<br />
Fahrgastbetrieb auf<br />
Mit dreie<strong>in</strong>halb Jahren Verspätung<br />
und erheblichen Kostenüberschreitungen<br />
nahm die schlüsselfertig von e<strong>in</strong>em<br />
Konsortium unter der Führung des Baukonzerns<br />
Bilf<strong>in</strong>ger erstellte Straßenbahn<br />
<strong>in</strong> der schottischen Hauptstadt<br />
Ed<strong>in</strong>burgh am 31. Mai den Fahrgastbetrieb<br />
auf. <strong>Die</strong> Stadtverwaltung und der<br />
Betreiber Ed<strong>in</strong>burgh Trams Limited<br />
(ETL) verzichteten auf e<strong>in</strong> spektakuläres<br />
Eröffnungsfest. <strong>Die</strong> rund 13,5 Kilometer<br />
lange Strecke mit 15 Haltestellen<br />
führt vom Stadtzentrum zum westlich<br />
der Stadt gelegenen Flughafen. Speziell<br />
für ihre Funktion als Flughafenzubr<strong>in</strong>ger<br />
bieten die Wagen e<strong>in</strong>e hohe Anzahl<br />
an Gepäckfächern. <strong>Die</strong> erste Phase des<br />
Projekts schloss ursprünglich e<strong>in</strong>e Verlängerung<br />
vom Stadtzentrum Richtung<br />
Norden <strong>in</strong> den Stadtteil Leith am Hafen<br />
e<strong>in</strong>. Doch aufgrund der ständig steigenden<br />
Kosten, die für die schließlich verkürzte<br />
Strecke 1,2 Milliarden Euro erreichten,<br />
stellten die Planer diesen<br />
Abschnitt 2011 zurück. Da hatte die<br />
Auslieferung der 27 bei CAF bestellten,<br />
42,5 Meter langen Niederflurbahnen<br />
vom Typ Urbos 3 jedoch bereits begonnen.<br />
Für die nun eröffnete Strecke s<strong>in</strong>d<br />
nur 17 Fahrzeuge nötig, womit e<strong>in</strong> erheblicher<br />
Fahrzeugüberhang besteht.<br />
Infolge der Kostensteigerungen ist die<br />
schottische Regierung derzeit nicht gewillt,<br />
weiter <strong>in</strong> den Ausbau der Tram zu<br />
<strong>in</strong>vestieren. Während die Innenstadtstrecke<br />
zwischen York Place und dem<br />
Bahnhof Haymarket größtenteils straßenbündig<br />
verläuft, ist der Westabschnitt<br />
überwiegend stadtbahnmäßig<br />
mit nur wenigen Bahnübergängen ausgebaut.<br />
Auf e<strong>in</strong>zelnen Abschnitten ist<br />
e<strong>in</strong>e Höchstgeschw<strong>in</strong>digkeit von 70 Kilometer<br />
pro Stunde möglich. RSC<br />
Slowakei: Bratislava<br />
Neue Obusse <strong>in</strong> Betrieb<br />
Obusse vom Škoda/SOR-Typ 30Tr <strong>in</strong><br />
Betrieb. <strong>Die</strong> 12,1 Meter langen Normalbusse<br />
mit den Betriebsnummern<br />
6001 bis 6015 verfügen über vier E<strong>in</strong>stiege<br />
und bieten Platz für 28 sitzende<br />
und 67 stehende Fahrgäste. <strong>Die</strong><br />
Wagen kommen vorerst ausschließlich<br />
auf der L<strong>in</strong>ie 204 zwischen Rádiová<br />
und Valašská zum E<strong>in</strong>satz.<br />
In den kommenden Monaten geht<br />
die Modernisierung des Fuhrparks zügig<br />
weiter, denn der Verkehrsbetrieb<br />
bestellte 2013/14 <strong>in</strong>sgesamt 50 Normal<br />
obusse vom Typ 30Tr und 70 Gelenkobusse<br />
vom Typ 31Tr. <strong>Die</strong> neuen,<br />
zu 85 Prozent von der EU f<strong>in</strong>anzierten<br />
Fahrzeuge können die 68 Altwagen<br />
vom Typ 14Tr und die 40 Exemplare<br />
Bauart 15Tr vollständig ablösen, zudem<br />
erhöht der Verkehrsbetrieb den<br />
Anteil an Gelenkwagen deutlich.<br />
Auf dem rund 40 Kilometer langen<br />
Obus-Netz verkehren derzeit 14 L<strong>in</strong>ien<br />
(33, 64, 201 bis 212), die sich im<br />
Stadtzentrum oft mehrfach überlagern.<br />
Gelenkwagen vom Typ 15Tr<br />
s<strong>in</strong>d nur auf den L<strong>in</strong>ien 201, 202 und<br />
208 anzutreffen, die ausgedehnte<br />
Wohngebiete im Südosten der Stadt<br />
bedienen. Bisher besaß der Verkehrs-<br />
In der slowakischen Hauptstadt<br />
Bratislava (Preßburg) s<strong>in</strong>d seit 4. Juni<br />
<strong>in</strong>sgesamt 15 fabrikneue Niederflurbetrieb<br />
sieben Niederflur-Obusse: Auf<br />
der isolierten L<strong>in</strong>ie 33 im Westen der<br />
Stadt s<strong>in</strong>d seit 2006 sechs Gelenkwagen<br />
Škoda/Irisbus 25Tr im E<strong>in</strong>satz und<br />
im Stadtnetz ist seit 2003 e<strong>in</strong> Normalbus<br />
vom Škoda-Typ 21TrAC vorhanden.<br />
WK<br />
Schweiz: Genf<br />
Mehr Straßenbahnen<br />
nach Carouge<br />
Neun zusätzliche Haltestellen hat<br />
die Straßenbahnl<strong>in</strong>ie 18 seit Ende<br />
Juni. Mit der Verlängerung verstärken<br />
die Transports Publics Genevois<br />
(TPG) die Bedienung der südwestlich<br />
des Flusses Arve gelegenen Stadt<br />
Carouge mit ihren 21.000 E<strong>in</strong>wohnern.<br />
Weitere Verlängerungen s<strong>in</strong>d<br />
für die vier Straßenbahnl<strong>in</strong>ien 12,<br />
14, 15, 18 <strong>in</strong> Planung, um die Innenstadt<br />
und die Vorstädte besser zu<br />
bedienen. Besonderes Augenmerk<br />
richten die Verkehrsplaner <strong>in</strong> Genf<br />
auch auf die grenzüberschreitenden<br />
Nahverkehrsl<strong>in</strong>ien, denn täglich gibt<br />
es mehr als 80.000 E<strong>in</strong>pendler aus<br />
Frankreich und dem Kanton Vaud.<br />
Größtes Neubauvorhaben ist „Ceva“,<br />
L<strong>in</strong>z: 3,6 Millionen Personen nutzten 2013 die neue Tramverb<strong>in</strong>dung von<br />
Leond<strong>in</strong>g nach L<strong>in</strong>z, abgebildet am Harter Plateau. In zwei Etappen wird<br />
die L<strong>in</strong>ie 3 nun von Leond<strong>in</strong>g nach Traun verlängert ROBERT SCHREMPF<br />
Bratislava: 15 viertürige Obusse vom Škoda/SOR-Typ 30Tr verjüngen seit<br />
Juni 2014 den Fahrzeugpark <strong>in</strong> der slowakischen Landeshauptstadt, weitere<br />
85 Neue 30Tr/31Tr folgen <strong>in</strong> den nächsten Monaten WOLFGANG KAISER<br />
14<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Weltweit<br />
e<strong>in</strong> 16 Kilometer langes S-Bahn-ähnliches<br />
Projekt, das Genf-Cornav<strong>in</strong> mit<br />
Eaux-Vives und Annemasse verb<strong>in</strong>den<br />
soll und künftig 225.000 Grenzgebietsbewohnern<br />
den Weg nach<br />
Genf erleichtert. 1,25 Milliarden Euro<br />
stellen die Schweiz und der Kanton<br />
Genf dafür zur Verfügung. VLC<br />
Österreich: L<strong>in</strong>z<br />
StadtRegioTram<br />
nach Traun im Bau<br />
<strong>Die</strong> Straßenbahnl<strong>in</strong>ie 3 fährt seit<br />
August 2011 vom L<strong>in</strong>zer Hauptbahnhof<br />
weiter <strong>in</strong> das südwestlich gelegene<br />
Wohn- und Gewerbegebiet der<br />
Nachbarstadt Leond<strong>in</strong>g. Seit Anfang<br />
Mai 2014 ist e<strong>in</strong>e zweite Ausbaustufe,<br />
die 4,5 Kilometer lange Neubaustrecke<br />
über die Geme<strong>in</strong>de Pasch<strong>in</strong>g<br />
<strong>in</strong> das Stadtzentrum von Traun, im<br />
Bau. <strong>Die</strong> Inbetriebnahme erfolgt <strong>in</strong><br />
zwei Etappen: Ab November 2015<br />
soll die L<strong>in</strong>ie 3 zunächst von der bisherigen<br />
Endstation „Doblerholz“<br />
rund 2,7 Kilometer weiter zur „Traunerkreuzung“<br />
führen, wo e<strong>in</strong> neuer<br />
Nahverkehrsknoten entsteht. Mitte<br />
2016 folgt der zweite Bauabschnitt,<br />
die Weiterführung über den Hauptplatz<br />
der Stadt Traun bis zum vorläufigen<br />
Endpunkt „Schloss Traun“. Bauherr<br />
ist das vom Land Oberösterreich<br />
gegründete Eisenbahn<strong>in</strong>frastruktur-<br />
Unternehmen „Schiene OÖ GmbH“.<br />
Für den Betrieb besteht mit den L<strong>in</strong>z<br />
AG L<strong>in</strong>ien e<strong>in</strong> bis 2033 laufender Verkehrsdienstevertrag.<br />
In Planung ist<br />
die abermalige Verlängerung der<br />
StadtRegioTram um rund 3,5 Kilometer<br />
nach Haid-Ansfelden und Kremsdorf.<br />
ROS<br />
Portugal: Lissabon<br />
Stadtrundfahrten<br />
unter neuem Label<br />
<strong>Die</strong> rot-weiß lackierten historischen<br />
Wagen der Stadtrundfahrt-L<strong>in</strong>ie<br />
Col<strong>in</strong>as de Lisboa – Circuito Turistico<br />
fahren seit Kurzem unter der Sightsee<strong>in</strong>g-Ägide<br />
„yellowbus“ mit dem<br />
Label „carristur“. Von Juni bis September<br />
geht es von 9.20 bis 19 Uhr<br />
im 20-M<strong>in</strong>uten-Takt von der Praça de<br />
Comércio auf dem Rundkurs über<br />
den L<strong>in</strong>ienweg der 25E nach Estrella<br />
Basilica, weiter auf der 28E durch die<br />
engen und steilen Gassen des Altstadtviertels<br />
Alfama zum Endpunkt<br />
Martim Moniz und von hier aus zurück<br />
zum Ausgangspunkt auf e<strong>in</strong>er<br />
Teilstrecke der L<strong>in</strong>ie 12E. Bei hohem<br />
Andrang beispielsweise durch Kreuz-<br />
fahrtschiffe kommen weitere Wagen<br />
aus dem Depot h<strong>in</strong>zu und verdichten<br />
den Takt. <strong>Die</strong> Companhia Carris de<br />
Ferro de Lisboa reagiert damit auf die<br />
steigende Bekanntheit und Beliebtheit<br />
der Tram <strong>in</strong> Lissabon bei Touristen<br />
und die Überfüllung der Stamml<strong>in</strong>ie<br />
28E. <strong>Die</strong> Abschnitte Praça de<br />
Comércio – Estrella Basilica und Martim<br />
Moniz – Praça de Comércio werden<br />
hierbei mit dem E<strong>in</strong>holmstromabnehmer<br />
befahren, während auf<br />
dem Streckenabschnitt entlang der<br />
28E zwischen Estrella Basilica und<br />
Martim Moniz wegen <strong>in</strong>s Lichtraumprofil<br />
ragenden Hausecken stets der<br />
Stangenstromabnehmer mit Kontaktrolle<br />
Verwendung f<strong>in</strong>det.<br />
CT<br />
USA: M<strong>in</strong>neapolis/St. Paul<br />
Green L<strong>in</strong>e eröffnet<br />
Am 14. Juni g<strong>in</strong>g im Großraum<br />
M<strong>in</strong>neapolis/St. Paul im US-Bundesstaat<br />
M<strong>in</strong>nesota die 17,6 Kilometer<br />
lange Green L<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Betrieb. Hauptbestandteil<br />
ist e<strong>in</strong> 15 Kilometer langer<br />
Neubauabschnitt mit 18 Haltestellen;<br />
die L<strong>in</strong>ie verb<strong>in</strong>det die<br />
Zentren der Tw<strong>in</strong> Cities und ergänzt<br />
die bereits 2004 eröffnete Hiawatha<br />
L<strong>in</strong>e (Länge 19,7 Kilometer), die der<br />
Verkehrsbetrieb MetroTransit nun als<br />
Blue L<strong>in</strong>e bezeichnet. <strong>Die</strong> ersten 2,6<br />
Kilometer durch das Zentrum von<br />
M<strong>in</strong>neapolis legen die beiden Stadtbahnl<strong>in</strong>ien<br />
auf e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen<br />
Trasse zurück.<br />
Während die Blue L<strong>in</strong>e danach <strong>in</strong><br />
Richtung Flughafen nach Süden weiterfährt,<br />
zweigt die Green L<strong>in</strong>e nach<br />
Osten ab und bedient die University<br />
of M<strong>in</strong>nesota mit mehreren Haltestellen.<br />
<strong>Die</strong> Strecke überquert dabei<br />
den Mississippi auf dem Unterdeck<br />
der Wash<strong>in</strong>gton Avenue Bridge, wo<br />
zwei der bisher vier Autofahrspuren<br />
der Stadtbahn gewichen s<strong>in</strong>d. <strong>Die</strong><br />
Fahrt endet am östlichen Rand der<br />
Innenstadt von St. Paul am kürzlich<br />
wiedereröffneten Fernbahnhof Union<br />
Depot. <strong>Die</strong> Stadtbahnen verkehren<br />
ganztags alle zehn M<strong>in</strong>uten und<br />
brauchen für die Gesamtstrecke 48<br />
M<strong>in</strong>uten. Für den Betrieb auf der<br />
Green L<strong>in</strong>e hatte MetroTransit bei<br />
Siemens <strong>in</strong> Sacramento (Kalifornien)<br />
47 Fahrzeuge des Typs S70, der bereits<br />
<strong>in</strong> zahlreichen nordamerikanischen<br />
Städten im E<strong>in</strong>satz ist, bestellt.<br />
Weitere zwölf Wagen lieferte Siemens<br />
als Ergänzung für die Blue L<strong>in</strong>e,<br />
die bisher ausschließlich mit 27 Flexity<br />
Swift-Stadtbahnwagen von Bombardier<br />
verkehrte.<br />
RSC<br />
Lissabon: Der Tw 9 ist am 30. Mai auf der Stadtrundfahrtl<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> der Altstadt<br />
unterwegs. Hier bleiben Stangenstromabnehmer Pflicht CLAUDIA TUGEMANN<br />
ANZEIGE<br />
Kultur Akademie<br />
Naumburg<br />
…für Menschen, die mehr wissen wollen<br />
www.kulturakademie-naumburg.de<br />
Herbstsem<strong>in</strong>ar Straßenbahn – 20. bis 22. 10. 2014<br />
HINTER DIE KULISSEN DER<br />
KLEINSTEN <strong>STRASSENBAHN</strong> GMBH<br />
<strong>Die</strong> Naumburger Straßenbahn bietet kle<strong>in</strong> und kompakt, was andere Verkehrsunternehmen<br />
meist groß aufbauen und organisieren müssen. Erleben Sie e<strong>in</strong><br />
außergewöhnliches Sem<strong>in</strong>ar mit hochrangigen Referenten über die vielfältigen<br />
Aufgaben, die Geschichte und die Zukunft der Straßenbahn.<br />
Der spektakuläre Höhepunkt: Fahren Sie selbst auf e<strong>in</strong>er Teststrecke <strong>in</strong> Halle.<br />
Weitere Sem<strong>in</strong>arangebote, Information und Buchung<br />
KulturAkademie Naumburg<br />
Domplatz 19, 06618 Naumburg (Saale)<br />
Ihre Ansprechpartner<strong>in</strong>: Frau Re<strong>in</strong>sperger<br />
Telefon: (0 34 45) 23 01-123, 23 01-103<br />
<strong>in</strong>fo@kulturakademie-naumburg.de<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
15
Betriebe<br />
Zu den Historischen Fahrzeugen<br />
der Plauener Straßenbahn<br />
gehört Triebwagen 51<br />
(MAN 1928), hier am 16. Juni<br />
2013 vor dem Oberen Bahnhof.<br />
Ihm folgt der <strong>in</strong>zwischen<br />
verkaufte Tw 234. Gegenwärtig<br />
unterhält die PSB noch<br />
21 modernisierte KT4D<br />
RONNY DAUER<br />
Vogtlandperle<br />
120 Jahre Straßenbahn <strong>in</strong> Plauen Sie gehört zu den liebevoll geführten Kle<strong>in</strong>betrieben <strong>in</strong><br />
Deutschland – und die Plauener dürfen auf ihre im November 1894 eröffnete Straßenbahn zu<br />
Recht stolz se<strong>in</strong>. Da stellt sich die Frage, wie würdigen sie deren 120. Jubiläum <strong>in</strong> diesem Jahr?<br />
Zu den Städten im Deutschen Kaiserreich,<br />
<strong>in</strong> denen vor 120 Jahren die<br />
erste elektrische Straßenbahn gefahren<br />
ist, zählt neben Bochum/Herne,<br />
Dortmund, Erfurt, Gotha, Hamburg, Lübeck,<br />
Mülhausen im Elsass, Straßburg,<br />
Wuppertal und Zwickau auch die im Südwesten<br />
von Sachsen gelegene Stadt Plauen<br />
im Vogtland.<br />
Ende des 19. Jahrhunderts setzte <strong>in</strong> dieser<br />
an traditionellen Handelsstraßen gelegenen<br />
Stadt e<strong>in</strong>en ungeahntes <strong>in</strong>dustrielles Wachstum<br />
e<strong>in</strong>. Doch sowohl der Bahnhof der 1851<br />
eröffneten Sächsisch-Bayerischen Staatseisenbahn<br />
von Leipzig nach Hof als auch der<br />
Bahnhof der 1875 eröffneten Elstertalbahn<br />
lagen <strong>in</strong> dieser Zeit noch außerhalb der Stadt.<br />
Um vom Stadtzentrum zur ab 1875 „Plauen<br />
oberer Bahnhof“ genannten Station der<br />
Eisenbahnstrecke nach Bayern bzw. Leipzig/Chemnitz<br />
zu kommen, war e<strong>in</strong> Anstieg zu<br />
16 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Plauen<br />
An der Syrabrücke, später nur „Tunnel“ genannt, herrscht seit Inbetriebnahme der L<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> Richtung<br />
Neundorf (1899) immer Hochbetrieb, hier die zentralen Umsteigestelle vor dem Ersten Weltkrieg<br />
Der im Jahr 1928 von MAN gebaute werkneue Triebwagen 56: Er trägt den vom 23. April 1921<br />
bis Ende 1950 gültigen Eigentumsnamen „Sächsische Elektrizitäts-Straßenbahn-Aktiengesellschaft“<br />
(SESAG). <strong>Die</strong>ser Tw schied 1969 aus dem L<strong>in</strong>iendienst aus SLG. AXEL REUTHER (2)<br />
meistern – zum „Unteren Bahnhof“ an der<br />
Eisenbahnstrecke Gera – Weischlitz galt es<br />
h<strong>in</strong>gegen, <strong>in</strong>s Elstertal h<strong>in</strong>abzulaufen. Da sich<br />
sowohl <strong>in</strong> diesem Bereich als auch oberhalb<br />
des Stadtzentrums nach der Reichse<strong>in</strong>igung<br />
zahlreiche Unternehmen ansiedelten, erschien<br />
der Bau und Betrieb e<strong>in</strong>er Straßenbahn e<strong>in</strong>e<br />
gew<strong>in</strong>nversprechende Investition zu se<strong>in</strong>. <strong>Die</strong><br />
Lohnkutscher und seit 1862 zu Fuß arbeitenden<br />
Packträger reichten für das Beförderungs-<br />
und Transportbedürfnis nicht aus. Daraufh<strong>in</strong><br />
vere<strong>in</strong>barte die Stadtverwaltung im<br />
Oktober 1885 mit e<strong>in</strong>em Leipziger Unternehmer<br />
den Bau e<strong>in</strong>er Straßenbahn zwischen<br />
dem Unteren und Oberen Bahnhof. Der Vertrag<br />
hätte anschließend e<strong>in</strong>en Betrieb mit<br />
Pferden, mit e<strong>in</strong>er „vollständig rauch- und<br />
rußfreien Locomotive bzw. Locomotivwagens“<br />
oder aber mit e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Röhre unterirdisch<br />
geführten Drahtseil erlaubt. Doch<br />
das Projekt verlief im Sande – womöglich<br />
überforderten alle drei Varianten die f<strong>in</strong>anziellen<br />
Möglichkeiten des Leipzigers?<br />
<strong>Die</strong> AEG hält Wort<br />
Da der Bedarf an e<strong>in</strong>er Straßenbahn <strong>in</strong> Plauen<br />
von Jahr zu Jahr wuchs, schloss die Stadtverwaltung<br />
am 29. Mai 1893 mit der Allgeme<strong>in</strong>en<br />
Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG)<br />
e<strong>in</strong>en Vertrag zum Bau e<strong>in</strong>er elektrischen<br />
Straßenbahn. Vom Betrieb e<strong>in</strong>er Pferdebahn<br />
hatte man zu diesem Zeitpunkt vermutlich<br />
e<strong>in</strong>erseits aufgrund der beschriebenen Steigungen,<br />
andererseits aber wohl aufgrund der<br />
positiven Erfahrungen mit elektrischen Straßenbahnen<br />
im In- und Ausland längst Abstand<br />
genommen. Der Bau der gemäß Vertrag<br />
meterspurigen Gleisanlagen begann am<br />
27. März 1894, parallel entstanden e<strong>in</strong>e Wagenhalle<br />
an der Erholungsstraße (heute e<strong>in</strong><br />
Teil der Theaterstraße) sowie die „Kraftstation“.<br />
Im Juli 1894 trafen neun von der Firma<br />
P. Herbrand & Co. <strong>in</strong> Köln-Ehrenfeld<br />
gebaute zweiachsige Triebwagen auf dem<br />
Daten & Fakten:<br />
Straßenbahn Plauen<br />
Anschrift:<br />
Straßenbahn Plauen GmbH<br />
Wiesenstraße 24, 08527 Plauen<br />
www.strassenbahn-plauen.de<br />
Telefon: 03 74 1/29 94-0<br />
Spurweite: . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Millimeter<br />
Eröffnung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.11.1894<br />
Aktuelle Streckenlänge: . . . . . . . 16,2 Kilometer<br />
Anzahl L<strong>in</strong>ien:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
Fahrzeuge: . . . . . . . . . . 21 KT4D (modernisiert),<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Flexity Classic Plauen<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
17
Betriebe<br />
Umsteigestelle Tunnel 1947: <strong>Die</strong> Folgen der nur wenige Jahre zurückliegenden Bombenangriffe s<strong>in</strong>d<br />
noch unübersehbar. Polygone Glasreste und Pappen bilden die Fenster der Triebwagen<br />
„Wir üben Solidarität ...“ prangt am Haltestellengebäude des Tunnels, der<br />
<strong>in</strong> der DDR-Zeit den Namen Otto-Grotewohl-Platz trägt. H<strong>in</strong>ter dem hier<br />
am 5. Mai 1973 fotografierten Tw 52 steht der Nonnenturm PETER DÖNGES<br />
Auf diesem um 1939 gedruckten Schülerfahrsche<strong>in</strong> der Straßenbahn ist<br />
auch e<strong>in</strong>e vom Tunnel nach Chrieschwitz geplante Busl<strong>in</strong>ie e<strong>in</strong>gezeichnet.<br />
Kriegsbed<strong>in</strong>gt nahm sie ihren Betrieb nicht auf SLG. SIGURD HILKENBACH<br />
Unteren Bahnhof e<strong>in</strong>. Mit Pferden <strong>in</strong>s Depot<br />
an der Erholungsstraße gezogen, begann der<br />
E<strong>in</strong>bau der AEG-Motoren.<br />
Mit der Betriebsführung beauftragte die<br />
AEG e<strong>in</strong>es ihrer Tochterunternehmen – die<br />
Allgeme<strong>in</strong>en Local- und Straßenbahngesellschaft<br />
mit Sitz <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>. Am 17. November<br />
1894 eröffnete diese die erste Teilstrecke<br />
der Plauener Straßenbahn – sie<br />
führte vom Oberen Bahnhof zum Neustadtplatz.<br />
Knapp drei Wochen danach<br />
g<strong>in</strong>g der e<strong>in</strong>gleisig ausgeführte Abschnitt<br />
zum Unteren Bahnhof <strong>in</strong> Betrieb.<br />
<strong>Die</strong> ersten Betriebsjahre<br />
Nach wenigen Betriebsmonaten verkaufte<br />
die Allgeme<strong>in</strong>en Local- und Straßenbahngesellschaft<br />
den 3,3 Kilometer langen<br />
Straßenbahnbetrieb<br />
zum 28. Mai<br />
1895 an die Sächsische<br />
Straßenbahn-Gesellschaft (SSG), auf<br />
deren Rechnung rückwirkend auch der Betrieb<br />
ab 1. Januar 1895 stattfand.<br />
Bis 1898 bee<strong>in</strong>trächtigen wiederholt Pflasterarbeiten<br />
die Straßenbahn, da die AEG deren<br />
Gleise <strong>in</strong> 1894 unbefestigte Straßen hatte<br />
legen lassen. Parallel ließ die SSG bis August<br />
1899 den Abschnitt vom Tunnel bis zum Neustadtplatz<br />
zweigleisig ausbauen. Zwischen den<br />
Jahren 1898 und 1903 stockte die SSG den<br />
Wagenpark erstmals auf. Entsprachen die<br />
1898 <strong>in</strong> Werdau gebauten Tw 10 und 11 noch<br />
weitestgehend den 1884 gelieferten Zweiachsern,<br />
so waren die 1899 von der Firma O. L.<br />
Kummer & Co. <strong>in</strong> Niedersedlitz gelieferten<br />
Tw 12 bis 15, die 1902 von der AG Elektrizitätswerke<br />
(vorm. O. L. Kummer & Co.) gelieferten<br />
Tw 16 bis 18 sowie die 1903 von der<br />
Waggon- und Masch<strong>in</strong>enfabrik AG vorm.<br />
Busch <strong>in</strong> Bautzen gelieferten Tw 19 und 20 auf<br />
andersartigen Untergestellen aufgebaut. Ab<br />
1905 stammten alle bis 1928 von der Plauener<br />
Straßenbahn beschafften Triebwagen von<br />
MAN aus Nürnberg. Beiwagen gab es die ersten<br />
sechse<strong>in</strong>halb Betriebsjahrzehnte <strong>in</strong> Plauen<br />
nicht. Um die Jahrhundertwende entstand<br />
e<strong>in</strong>e zweite Strecke, sie zweigte von der Syrabrücke<br />
(später <strong>in</strong> Tunnel umbenannt) <strong>in</strong><br />
Richtung Westen zur Gaststätte Grüner<br />
Kranz ab. <strong>Die</strong>sen am 21. Oktober 1899 eröffneten<br />
Abschnitt erweiterte die SSG am<br />
1. Januar 1905 bis zur Kaserne <strong>in</strong> Neundorf.<br />
<strong>Die</strong> 1894 e<strong>in</strong>geweihte Verb<strong>in</strong>dungsstrecke<br />
zwischen den beiden wichtigsten<br />
Bahnhöfen Plauens ließ das Unternehmen<br />
h<strong>in</strong>gegen im Mai 1902 nach Norden bis zur<br />
Parkstraße <strong>in</strong> Haselbrunn verlängern – sieben<br />
Jahre danach weitere 500 Meter bis<br />
Waldschlösschen.<br />
Anfang Januar 1902 nahm die Straßenbahngesellschaft<br />
an der Talbahnstraße e<strong>in</strong>e<br />
Wagenhalle <strong>in</strong> Betrieb, um den angewachsenen<br />
Fahrzeugpark warten und nachts<br />
geschützt abstellen zu können. Doch drei<br />
Jahre später löste diesen „Motorwagen-<br />
Schuppen“ e<strong>in</strong> am Unteren Bahnhof errichtetes<br />
Depot ab. Fasste dieses anfangs auf<br />
sechs überdachten Gleisen 24 Triebwagen,<br />
so ließ es die SSG 1911 und 1928 erweitern.<br />
Das Netz und der<br />
Fahrzeugpark wachsen<br />
Im Jahr 1904 überschritt die Stadt Plauen<br />
die 100.000-E<strong>in</strong>wohner-Marke, zum<br />
Jahresende stellte die SSG den Betrieb<br />
der eigenen Kraftstation<br />
e<strong>in</strong> und bezog ab 1. Januar<br />
1905 ihren Strom vom<br />
städtischen Elektrizitätswerk.<br />
Im August 1905 weihte<br />
die SSG e<strong>in</strong>e neue, zwei<br />
Kilometer lange, zweigleisige<br />
Strecke e<strong>in</strong>: Sie führte als<br />
„rote L<strong>in</strong>ie“ als Diagonale<br />
vom Dittrichplatz zum Friedhof<br />
an der Less<strong>in</strong>gstraße, ab dem 1. Juni<br />
1906 weitere 900 Meter nach Nordosten bis<br />
Preißelpöhl. <strong>Die</strong> beiden anderen L<strong>in</strong>ien erhielten<br />
1905 e<strong>in</strong>e gelbe und blaue Markierung.<br />
Während im September 1909 im Norden<br />
die bereits erwähnte Verlängerung <strong>in</strong> Haselbrunn<br />
fertiggestellt war, g<strong>in</strong>g Anfang Dezember<br />
1909 im Süden e<strong>in</strong>e vom Tivoli abzweigende<br />
Neubaustrecke (weiße L<strong>in</strong>ie) bis<br />
<strong>in</strong>s e<strong>in</strong>en Kilometer entfernte Re<strong>in</strong>sdorf <strong>in</strong><br />
Betrieb (nach der E<strong>in</strong>geme<strong>in</strong>dung 1926 <strong>in</strong><br />
Südvorstadt umbenannt).<br />
Da die SSG gew<strong>in</strong>nbr<strong>in</strong>gend wirtschaftete,<br />
übernahm sie 1910 das gesamte Aktien-<br />
18 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Plauen<br />
Nach dem Wiederaufbau war die Haltestelle<br />
Tunnel auch <strong>in</strong> der DDR-Zeit e<strong>in</strong> beliebtes<br />
Motiv für Ansichtskarten<br />
SLG. SIGURD HILKENBACH (2)<br />
kapital der Geraer Straßenbahn und<br />
1910/11 Anteile an zwei Elektrizitätsgesellschaften.<br />
Ebenso war e<strong>in</strong>e Beteiligung an<br />
den 1912 geplanten Überlandstraßenbahnen<br />
nach Rodewisch und Reichenbach vorgesehen,<br />
deren Bau aufgrund des Ersten<br />
Weltkrieges unterblieb.<br />
Waren bis 1905 <strong>in</strong>sgesamt 34 Triebwagen<br />
<strong>in</strong> <strong>Die</strong>nst gestellt worden, so beschaffte die<br />
SSG <strong>in</strong> den Jahren 1911/12 elf weitere zweiachsige<br />
Motorwagen. Zwei Jahre vor Ausbruch<br />
des Ersten Weltkrieges erreichte zugleich<br />
die Stadt Plauen mit über 128.000<br />
E<strong>in</strong>wohnern ihren Bevölkerungshöchststand.<br />
Während des Ersten Weltkrieges<br />
Anfang August 1914 waren auch nahezu 80<br />
Prozent des Fahrpersonals zum Frontdienst<br />
e<strong>in</strong>gezogen worden. Daraufh<strong>in</strong> stellte die<br />
SSG den Betrieb der weißen L<strong>in</strong>ie komplett<br />
und den der roten L<strong>in</strong>ie im Bereich der Innenstadt<br />
für zwei Wochen e<strong>in</strong>. Im Oktober<br />
1914 begann die Straßenbahngesellschaft<br />
mit dem verspätet e<strong>in</strong>getroffenen Material<br />
den Bau e<strong>in</strong>er neuen Straßenbahnstrecke<br />
vom Dittrichplatz auf kürzerem Wege zum<br />
Unteren Bahnhof. Nachdem <strong>in</strong> der Blücher-,<br />
Pestalozzi- und e<strong>in</strong>em Teil der Konradstraße<br />
bereits die Gleise lagen, stoppte das Unternehmen<br />
die Arbeiten am 5. November<br />
1914 kriegsbed<strong>in</strong>gt. Im weiteren Kriegsverlauf<br />
stellte die SSG mehrfach aufgrund Personalknappheit<br />
den Betrieb auf der weißen<br />
und roten L<strong>in</strong>ie e<strong>in</strong> und legte 1917 mehrer<br />
L<strong>in</strong>ien zusammen. In den letzten Kriegsjahren<br />
arbeiteten deshalb auch<br />
Frauen als Schaffner<strong>in</strong>nen.<br />
Nach Ausrufung der Republik<br />
blieb die wirtschaftliche<br />
und politische Lage <strong>in</strong> Plauen<br />
angespannt: Im Jahr 1919 stellte<br />
die SSG den Gesamtverkehr<br />
aufgrund von Kohlenmangel im<br />
Elektrizitätswerk an 35 Tagen<br />
und im Jahr 1920 den Verkehr<br />
auf der roten L<strong>in</strong>ie zwischen Dittrichplatz<br />
und Albertplatz<br />
aufgrund<br />
ger<strong>in</strong>ger<br />
Nachfrage<br />
e<strong>in</strong>. Den<br />
übrigen<br />
Betrieb legten zwischen<br />
1920 und 1922 mehrfach<br />
Streiks lahm.<br />
Durch die 1920er- und 1930er-Jahre<br />
Da sich der unternehmerische Schwerpunkt<br />
der Gesellschaft seit 1912 mehr auf Elektrizitätswerke<br />
richtete, beschloss die Generalversammlung<br />
der SSG am 23. April 1921<br />
e<strong>in</strong>e Umbenennung <strong>in</strong> Sächsische Elektrizitäts-Straßenbahn-Aktiengesellschaft<br />
(SE-<br />
SAG).<br />
Bereits vom Dittrichplatz <strong>in</strong> Richtung Unterer<br />
Bahnhof verlegte Schienen ließ noch<br />
die SSG 1920 ausbauen und verwendete sie<br />
für den Bau der neuen Strecke zum Hauptfriedhof<br />
im Stadtteil Reusa. Von dieser<br />
nahm die SESAG zunächst am 11. Juni den<br />
L<strong>in</strong>iennetzplatz vom 4. April 1939. An diesem<br />
Tag erhielten die bisher lediglich mit Farben<br />
gekennzeichneten L<strong>in</strong>ien erstmals Nummern<br />
zugewiesen<br />
GRAFIK: JOACHIM MENSDORF<br />
Abschnitt von der Albertbrücke bis zum<br />
Schloss Reusa (Ortse<strong>in</strong>gang Reusa) <strong>in</strong> Betrieb.<br />
Nach E<strong>in</strong>weihung e<strong>in</strong>er Zwischenetappe<br />
im November 1921 eröffnete die AG<br />
am 13. Juli 1922 die als grüne L<strong>in</strong>ie betrie-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
19
Betriebe<br />
Am nach 1945 neu errichteten Oberen Bahnhof enden heute die L<strong>in</strong>ien 1 und 6. In der Wendeschleife<br />
verbr<strong>in</strong>gen am 11. Juni 2006 die Wagen 230 und 236 ihre Wendezeit MICHAEL SPERL<br />
bene Gesamtstrecke bis zum E<strong>in</strong>gang des<br />
Hauptfriedhofes.<br />
Aufgrund hoher Betriebsverluste stellte<br />
die SESAG den Straßenbahnbetrieb <strong>in</strong> der<br />
Silvesternacht 1922 e<strong>in</strong> – nach über e<strong>in</strong>em<br />
Jahr Betriebsruhe nahm sie ihn am 16. April<br />
1924 auf den Hauptl<strong>in</strong>ien wieder auf. Zwischen<br />
1925 und 1931 änderte sich der L<strong>in</strong>ienverlauf<br />
der befahrenen Strecken mehrfach,<br />
an den Schnittstellen Tunnel und<br />
Albertbrücke ergänzte Weichen und Gleise<br />
vere<strong>in</strong>fachten den Betrieb.<br />
Im Jahr 1926 lieferte MAN vier und<br />
1928 sieben neue Triebwagen nach Plauen,<br />
so dass auf die noch vorhandenen, aber zwischenzeitlich<br />
modernisierten Wagen aus der<br />
Anfangszeit der Straßenbahn langsam ausschieden.<br />
Der als siebtes und zunächst letztes<br />
neues Fahrzeug im Juni 1928 gelieferte<br />
Triebwagen trug die Nr. 56.<br />
Anfang der 1930er-Jahre bee<strong>in</strong>trächtigte<br />
die Weltwirtschaftskrise den Betrieb – auf e<strong>in</strong>e<br />
Betriebse<strong>in</strong>stellung verzichtete die SESAG jedoch.<br />
Per 4. April 1939 lösten die L<strong>in</strong>iennummern<br />
1 bis 4 das bisherige Farbsystem ab<br />
(1944 um L<strong>in</strong>ie 5 im Verlauf der gleichzeitig<br />
verkürzten L<strong>in</strong>ie 2 ergänzt). Pläne von 1939,<br />
auch <strong>in</strong> Plauen e<strong>in</strong>en Obusbetrieb e<strong>in</strong>zurichten,<br />
legte man 1941 zu den Akten.<br />
<strong>Die</strong> 1940er-Jahre<br />
Beförderte die Plauener Straßenbahn 1939<br />
über 9,154 Millionen Fahrgäste, so stieg die<br />
Beförderungsleitung im Jahr 1943 auf 20,382<br />
Millionen. In jenem Kriegsjahr verfügte die<br />
SESAG über 41 Personentriebwagen, unter<br />
den 180 Betriebsangehörigen befanden sich<br />
55 Frauen. Aufgrund der Treibstoffknappzeit<br />
entstand im Herbst 1944 e<strong>in</strong> Anschlussgleis<br />
von der Pausaer Straße zum Güterbahnhof,<br />
dessen Nutzung im Krieg aber h<strong>in</strong>ter den Erwartungen<br />
zurückblieb.<br />
Nach dem siebten Bombenangriff auf<br />
Plauen stellte die Straßenbahn am 19. März<br />
1945 den Betrieb e<strong>in</strong>, nach dem 14. Angriff<br />
war die Stadt am 10. April zu 75 Prozent<br />
zerstört, was auf fast alle Gleisanlagen und<br />
Oberleitungen <strong>in</strong> der Innenstadt zutraf. <strong>Die</strong><br />
Wagenhalle am Unteren Bahnhof gab es<br />
nicht mehr, die Werkstatt an der Wiesen-<br />
Seit 1976 gibt es die Kurzgelenkwagen des Tatratyps KT4D <strong>in</strong> Plauen. Hier zwei Wagen mit der typischeren Farbgebung am 23. Mai 1990 an<br />
der Endstelle Waldfrieden. <strong>Die</strong>se Strecke g<strong>in</strong>g im Oktober 1983 <strong>in</strong> Betrieb<br />
PETER DÖNGES<br />
20 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Plauen<br />
straße sowie die Wagenhalle an der Theaterstraße<br />
wiesen schwere Beschädigung auf.<br />
Von den 42 Triebwagen waren fünf irreparabel<br />
zerstört, acht schwer und 29 leicht beschädigt.<br />
Glasscheiben gab es <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em<br />
Wagen mehr, berichtete der im April 2014<br />
verstorbene Plauener Straßenbahnhistoriker<br />
Joachim Mensdorf.<br />
Während der amerikanischen Besatzungszeit<br />
zogen Pferde noch rollfähige Wagen<br />
vor die zerstörten Wagenhallen, ab<br />
Ende Mai 1945 pendelten ersatzweise von<br />
den US-Behörden dafür freigegebene Busse<br />
<strong>in</strong> der zerstörten Stadt, nach dem Besatzerwechsel<br />
im Sommer stellten die Russen den<br />
Busbetrieb Ende Oktober 1945 e<strong>in</strong>. Dank<br />
des Fleißes der Straßenbahner und Beschäftigten<br />
verschiedener Baubetriebe war e<strong>in</strong><br />
erster Gleisabschnitt ab 12. November<br />
1945 elektrisch befahrbar – die Wagen fuhren<br />
vom Tunnel nach Norden bis Haselbrunn.<br />
Bis Oktober 1948 erfolgte der Wiederaufbau<br />
fast aller Gleisanlagen – bis auf den<br />
Abschnitt vom Dittrichplatz (Len<strong>in</strong>platz)<br />
zur Bahnhofstraße <strong>in</strong> der Friedensstraße. Ab<br />
Mai 1946 standen 15 Triebwagen zur Verfügung,<br />
die nachts <strong>in</strong> der reparierten Fahrzeughalle<br />
an der Theaterstraße standen, diese<br />
Halle blieb bis 1962 <strong>in</strong> Nutzung.<br />
<strong>Die</strong> DDR-Zeit<br />
Der 1948 begonnene Wiederaufbau der<br />
Werkstatt an der Wiesenstraße war am<br />
22. Mai 1950 abgeschlossen. Nachdem der<br />
Rat der Stadt den Bau e<strong>in</strong>er neuen Wagenhalle<br />
an der Melanchthonstraße abgelehnt<br />
hatte, ließ die Straßenbahngesellschaft die<br />
Halle am Unteren Bahnhof ebenfalls wiederaufbauen.<br />
Ab Februar 1951 stand sie<br />
wieder zur Verfügung.<br />
Per 1. Januar 1951 führte der VEB (K)<br />
Verkehrsbetrieb der Stadt Plauen den Straßenbahnbetrieb,<br />
die SESAG wurde Ende<br />
Juni 1951 aus dem Handelsregister gelöscht.<br />
Seit 1951 verkehrt die Plauener Straßenbahn<br />
wieder täglich <strong>in</strong> vollem Umfang – und <strong>in</strong><br />
diesem Jahr trafen nach 23 Jahren die ersten<br />
Neubaufahrzeuge e<strong>in</strong>: drei LOWA-Wagen<br />
vom Typ ET51 (Tw 57 bis 59).<br />
Mitte der 1950er-Jahre begann der im<br />
August 1965 abgeschlossene zweigleisige<br />
Ausbau des Netzes sowie die Umgestaltung<br />
L<strong>in</strong>iennetz 1. Januar 1969<br />
L<strong>in</strong>ie 1<br />
L<strong>in</strong>ie 2<br />
L<strong>in</strong>ie 3<br />
L<strong>in</strong>ie 4<br />
L<strong>in</strong>ie 5<br />
L<strong>in</strong>ie 5<br />
Plamag – Neundorf<br />
Oberer Bahnhof – Unterer Bahnhof<br />
Oberer Bahnhof – Preißelpöhl<br />
Oberer Bahnhof – Reusa<br />
Oberer Bahnhof – Südvorstadt<br />
Plamag – Südvorstadt<br />
(nur <strong>in</strong> Hauptverkehrszeit)<br />
„Kle<strong>in</strong>e Bahn ganz groß“ – mit dieser Veranstaltung begannen im Mai 2014 die Festlichkeiten<br />
zum 120. Jubiläum. Dazu verkehrte am 17. Mai der historische Gotha-Wagen-Zug RONNY DAUER (2)<br />
Der als Partywagen genutzte Tw 78 gehört zu den Markenzeichen der PSB. Anlässlich „20 Jahre Bier-<br />
Elektrische“ fand am 10. September 2011 e<strong>in</strong>e Sonderfahrt statt, hier am Oberen Bahnhof<br />
der Endstellen – sofern der Verkehrsbetrieb<br />
die Strecken nicht verlängern ließ. Letzteres<br />
traf auf die L<strong>in</strong>ie 1 zu, deren neuer Endpunkt<br />
sich seit 30. Dezember 1957 an der<br />
Plamag bef<strong>in</strong>det.<br />
Traf Anfang 1957 e<strong>in</strong> Gotha-Triebwagen<br />
vom Typ ET54 e<strong>in</strong> (Tw 60), so folgten zwischen<br />
Ende 1957 und Juli 1960 sieben Gotha-T57<br />
und 1961/62 fünf erste T2. Sie<br />
ersetzten geme<strong>in</strong>sam mit den etwa zwei<br />
Dutzend bis 1968 vom Verkehrsbetrieb neu<br />
beschafften bzw. von der Reichsbahn aus<br />
Kl<strong>in</strong>genthal oder Halle gebraucht übernommen<br />
Wagen der Typen ET54, T57, T2<br />
und T2D die nach der Jahrhundertwende<br />
gebaute MAN-Fahrzeuge. Mit den parallel<br />
e<strong>in</strong>getroffenen Beiwagen der Gotha-Typen<br />
B57 und B2-61 begann im März 1961 der<br />
offizielle Beiwagenbetrieb auf L<strong>in</strong>ie 1.<br />
In punkto Gleisbau gab es <strong>in</strong> den 1960er-<br />
Jahren vor allem Änderungen an den Knotenpunkten<br />
sowie im Bereich des Abzweiges<br />
zum Unteren Bahnhof. Außerdem entstanden<br />
weitere Endschleifen, nach deren Fertigstellung<br />
sich der Beiwagenbetrieb auf<br />
weitere L<strong>in</strong>ien ausdehnte. Als zweite Neubaustrecke<br />
nach Kriegsende g<strong>in</strong>g im Dezember<br />
1966 die Verlängerung um 800<br />
Meter vom Hauptfriedhof bis zur neuen<br />
Endstelle Reusa <strong>in</strong> Betrieb.<br />
L<strong>in</strong>iennetz ab 5. Oktober 1983<br />
L<strong>in</strong>ie 1<br />
L<strong>in</strong>ie 2<br />
L<strong>in</strong>ie 3<br />
L<strong>in</strong>ie 4<br />
L<strong>in</strong>ie 5<br />
L<strong>in</strong>ie 6<br />
L<strong>in</strong>ie 7<br />
Plamag – Neundorf<br />
Oberer Bahnhof – Unterer Bahnhof<br />
Waldfrieden – Neundorf<br />
Plamag – Reusa<br />
Südvorstadt – Preißelpöhl<br />
Oberer Bahnhof – Waldfrieden<br />
Reusa – Unterer Bahnhof<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
21
Betriebe<br />
Jubiläumsfeierlichkeiten 2014<br />
Nach e<strong>in</strong>er Modellausstellung am 17./18. Mai bereitet<br />
sich die PSB derzeit auf dem September vor.<br />
Vom 4. bis zum 13. f<strong>in</strong>det dann <strong>in</strong> der Stadtgalerie<br />
e<strong>in</strong>e Ausstellung mit Exponaten, Dokumenten<br />
und Aufnahmen der Straßenbahn statt. Höhepunkt<br />
ist jedoch e<strong>in</strong> für den 13. September geplanter<br />
Fahrzeugkorso von der Bahnhofstraße<br />
über den Tunnel nach Neundorf. An diesem werden<br />
neben allen historischen Wagen auch je e<strong>in</strong><br />
KT4D und e<strong>in</strong> neuer Niederflurwagen teilnehmen.<br />
An der Zentralhaltestelle am Tunnel veranstaltet<br />
die PSB parallel e<strong>in</strong> Volksfest. Details werden ab<br />
August auf der Homepage der Straßenbahngesellschaft<br />
bekanntgegeben.<br />
Historischer Wagenpark<br />
Für den Sonderverkehr hält die PSB die historischen<br />
Tw 21 (MAN 1905) sowie Tw 51 (MAN 1928) betriebsfähig<br />
vor. Der 1966 gebaute Gotha-T2-64<br />
Nr. 78 verkehrt h<strong>in</strong>gegen seit 1991 als Partywagen<br />
„Bier-Elektrische“. Der baugleiche Tw 79 und der<br />
Bw 28 (B2-64) stehen im historischen Zustand<br />
der 1970er-Jahre für Sonderfahrten zur Verfügung.<br />
<strong>Die</strong>se vier Triebwagen können für 150 Euro<br />
pro Stunde gechartert werden.<br />
Als Hilfsgerätefahrzeug (Salzwagen) ist mit dem<br />
Tw 64 e<strong>in</strong> zweiachsiger Gothawagen vom Typ T57<br />
noch im Bestand. Der KT4D Nr. 0202 dient h<strong>in</strong>gegen<br />
als Schleif- und Schmierwagen sowie der<br />
Tw 0235 (KT4DMC) als W<strong>in</strong>terdienstwagen.<br />
Am 16. Juni 1976 kam der erste Kurzgelenkwagen<br />
<strong>in</strong> Plauen zum E<strong>in</strong>satz – der KT4D<br />
Nr. 202. Bis 1988 gelangten <strong>in</strong>sgesamt 45 solche<br />
Wagen <strong>in</strong> die Vogtlandmetropole. Ihren<br />
E<strong>in</strong>satz koord<strong>in</strong>ierte ab 1. Januar 1982 der <strong>in</strong><br />
das Volkseigene (VE) Verkehrskomb<strong>in</strong>at Karl-<br />
Marx-Stadt <strong>in</strong>tegrierte VEB Städtischer Nahverkehr<br />
der Stadt Plauen.<br />
Seit 5. Oktober 1983 erschließt die Straßenbahn<br />
auch das Neubaugebiet Chrieschwitzer<br />
Hang. <strong>Die</strong>se 2,11 Kilometer lange<br />
Neubaustrecke zweigt im Bereich der<br />
Haltestelle Vogtlandkl<strong>in</strong>ikum von der L<strong>in</strong>ie<br />
nach Reusa <strong>in</strong> Richtung Nordosten ab – die<br />
Endschleife trägt den Namen Waldfrieden.<br />
<strong>Die</strong> Entwicklung seit 1990<br />
Bereits vor der Vere<strong>in</strong>igung am 3. Oktober<br />
1990 erhielten viele Haltestellen ihre alten<br />
Namen zurück – so bezeichnete der Verkehrsbetrieb<br />
den Otto-Grotewohl-Platz<br />
nach dem Mauerfall rasch wieder als Tunnel.<br />
Per 1. Juli 1990 erfolgte die Umwandlung<br />
des Betriebes <strong>in</strong> die Plauener Straßenbahn<br />
GmbH (PSB). Mit den ab Oktober zur<br />
Verfügung stehenden Fördergeldern ließ der<br />
Betrieb mehrere Gleisbereiche, aber auch<br />
die Werkstatt an der Wiesenstraße erneuern<br />
bzw. modernisieren.<br />
Nachdem zwischen 1987 und 1989 <strong>in</strong>sgesamt<br />
24 weitere KDT4 e<strong>in</strong>getroffen waren,<br />
reduzierte sich der Zweiachserbestand<br />
ab 1989 <strong>in</strong> großen Schritten. Am 9. November<br />
1991 endete ihr regulärer L<strong>in</strong>iendienst,<br />
die danach auf L<strong>in</strong>ie 2 noch genutzten<br />
Zweirichtungswagen stellte der Betrieb<br />
am 14. August 1992 ab. An diesem Tag<br />
g<strong>in</strong>g am Unteren Bahnhof e<strong>in</strong>e Wendeschleife<br />
<strong>in</strong> Betrieb.<br />
Waren die Fahrpreise der Straßenbahn ab<br />
1944 mehr als vier Jahrzehnte gleich geblieben<br />
(e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfahrsche<strong>in</strong> kostete 20<br />
Pfennige), erhöhten sie sich ab 1991 <strong>in</strong> mehreren<br />
Schritten bis auf aktuell 1,30 Euro für<br />
e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zelfahrt und 3,40 Euro für e<strong>in</strong>e Tageskarte.<br />
Am 29. Mai 1994 trat e<strong>in</strong> neuer L<strong>in</strong>ienplan<br />
<strong>in</strong> Kraft. Danach gab es sieben Jahre<br />
lang ke<strong>in</strong>e direkte Verb<strong>in</strong>dung zwischen<br />
Oberen und Unteren Bahnhof, wie es 100<br />
Jahre lang üblich gewesen war.<br />
Um bei angenehmem Wetter an die Eröffnung<br />
des Straßenbahnbetriebes zu gedenken,<br />
fand am 17./18. September 1994<br />
e<strong>in</strong>e große Jubiläumsfeier statt. Aus diesem<br />
Anlass verkehrten unter anderem e<strong>in</strong> großer<br />
Fahrzeugcorso sowie die Sonderl<strong>in</strong>ie 100<br />
zum Betriebshof. Am eigentlichen Jubiläumstag<br />
im November würdigten Stadtverwaltung<br />
und PSB das 100-jährige Verkehrsmittel<br />
nochmals.<br />
In den Sommerferien und Weihnachtsferien<br />
1996/97 fuhr die PSB erstmals nach e<strong>in</strong>em<br />
Ferienfahrplan. Da er sich bewährte,<br />
reduziert sich das Angebot während der<br />
schulfreien Wochen danach mehrere Jahre.<br />
E<strong>in</strong>er der gegenwärtig sechs vorhandenen Niederflurwagen<br />
von Bombardier ist am 7. Juni 2014 auf der<br />
Syrastraße unterwegs <strong>in</strong> die Südvorstadt (L<strong>in</strong>ie 5),<br />
im H<strong>in</strong>tergrund steht der e<strong>in</strong>st zur Stadtbefestigung<br />
dienende „Rote Turm“<br />
RONNY DAUER<br />
22<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Bahnhofstr.<br />
5<br />
Plamag<br />
Hof<br />
Am Vogtlandstadion<br />
Am Stadtwald<br />
Wartburgplatz<br />
Morgenbergstraße<br />
Zwickau<br />
Leipzig<br />
Seumestr.<br />
Chamissostraße<br />
PLAUEN Oberer Bf.<br />
Oberer Bf,<br />
Oberer Bahnhof, Stadtpark<br />
Pausaer Str. Mart<strong>in</strong>-Luther-Straße<br />
1 6<br />
Oberer Bahnhof<br />
Busbahnhof Am Albertplatz<br />
Capitol<br />
Neues Tunnel<br />
Westbahnhof<br />
Dittrichplatz Rathaus<br />
1 3<br />
Seehaus<br />
Hans-Löwel-Platz<br />
Neundorf<br />
Plauen-West<br />
Neue Elsterbrücke<br />
Westend<br />
Weischlitz<br />
Cheb<br />
Pausaer Str.<br />
Liebknechtstr.<br />
Plauen-Zellwolle<br />
Parkeisenbahn<br />
Festwiese<br />
Pausaer Str.<br />
Ha<strong>in</strong>str.<br />
Neundorfer Str.<br />
Preißelpöhl<br />
4<br />
Beethovenstraße<br />
Schlachthofstraße<br />
Plauen<br />
Unterer Bahnhof<br />
A.-Bebel-Str.<br />
Hofer Straße<br />
Bickelstraße<br />
Südvorstadt<br />
Weischlitz<br />
aus: Schwandl‘s Tram Atlas Deutschland<br />
Aktueller L<strong>in</strong>iennetzplan der Plauener Straßenbahn GmbH<br />
1·4·5·6<br />
3·4·5·6<br />
Böhlerstr.<br />
Syrastr.<br />
Breitscheidstr.<br />
Hofer Str.<br />
Oelsnitzer Str.<br />
5<br />
(Plauen Mitte)<br />
(proj.)<br />
Reichenbacher<br />
Str.<br />
Äußere<br />
Weiße Elster<br />
3 6<br />
Greiz<br />
Gera<br />
Waldfrieden<br />
Vogtlandkl<strong>in</strong>ikum<br />
Schloss Reusa Hauptfriedhof<br />
Knielohstr. Röntgenstraße<br />
Suttenwiese<br />
Anton-Kraus-<br />
Straße<br />
Dr.-Karl-Gelbke-Straße<br />
Carl-von-Ossietzky-Weg<br />
Reichenbacher Str.<br />
Dammstr.<br />
Röntgenstr.<br />
1<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Reusaer Str.<br />
Oberer Bahnhof – Neundorf<br />
Neundorf – Waldfrieden<br />
Preißelpöhl – Reusa<br />
Plamag – Südvorstadt<br />
Oberer Bahnhof – Waldfrieden<br />
Straßenbahn<br />
Eisenbahnstrecken<br />
1 km<br />
Dresdner Str.<br />
Plauen<br />
Kle<strong>in</strong>friesener Str.<br />
4<br />
Reusa<br />
GRAFIK: ROBERT SCHWANDL<br />
Lesen<br />
<br />
Sie noch oder<br />
sammeln<br />
Sie schon?<br />
Der Bau der Stadtgalerie <strong>in</strong> der Plauener<br />
Innenstadt führte auch bei der PSB von<br />
1999 bis 2001 zu Beh<strong>in</strong>derungen. Während<br />
der Sanierung der Elsterbrücke pendeln e<strong>in</strong>e<br />
Woche lang je zwei KT4D Heck an Heck<br />
zwischen der provisorischen Endhaltestelle<br />
vor der Brücke und der Baustelle am Tunnel.<br />
Dort gestaltete die PSB die Zentralhaltestelle<br />
bis zum Herbst 2001 völlig neu.<br />
Mangels Nachfrage der Fahrgäste bis zum<br />
Unteren Bahnhof stellte die PSB die am<br />
20. Juli 2001 wieder als Verb<strong>in</strong>dung zum<br />
Oberen Bahnhof e<strong>in</strong>gerichtete L<strong>in</strong>ie 2 am<br />
30. März 2007 e<strong>in</strong>. Als Ersatz fährt e<strong>in</strong>e neue<br />
Stadtbusl<strong>in</strong>ie den Unteren Bahnhof an. Seitdem<br />
betreibt das Unternehmen nur noch fünf<br />
L<strong>in</strong>ien. Deren Gleise hat die PSB <strong>in</strong> den vergangenen<br />
zwei Jahrzehnten teils grundlegend<br />
sanieren lassen. Während der Bauarbeiten<br />
übernahmen oft Busse den Verkehr, so auch<br />
während der Rekonstruktion der Neundorfer<br />
Straße als die L<strong>in</strong>ien 1 und 3 vom April<br />
2008 bis zum Oktober 2009 nicht vom Zentrum<br />
nach Neundorf fahren konnten.<br />
Der aktuelle Betrieb<br />
Für den Betrieb stehen der PSB aktuell noch<br />
21 zwischen 1992 und 1999 modernisierte<br />
KT4D sowie derzeit sechs Flexity Classic<br />
zur Verfügung. Der erste dieser Niederflurwagen<br />
traf am 20. August 2013 aus Bautzen<br />
<strong>in</strong> Plauen e<strong>in</strong>. Insgesamt sollen zehn<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
Wagen dieses Typs beschafft werden. Seit<br />
dem Ende des regulären Doppeltraktionsbetriebes<br />
im November 2007 verkehren die<br />
KT4D lediglich bei Fußballheimspielen des<br />
VFC Plauen sowie zu Silvester „im Zweierpack“.<br />
Zu den Besonderheiten Plauens gehört,<br />
dass die Tatrawagen im W<strong>in</strong>ter mit<br />
zwei angelegten Stromabnehmern fahrend,<br />
während im Sommer nur der vordere Triebwagen<br />
die Energie über den Stromabnehmer<br />
aus dem Netz bezieht.<br />
In der Hauptverkehrszeit bedient die PSB<br />
wochentags alle Straßenbahnl<strong>in</strong>ien im 12-<br />
M<strong>in</strong>uten-Takt, samstags alle 15 M<strong>in</strong>uten,<br />
sonntags gilt e<strong>in</strong> 30-M<strong>in</strong>uten-Takt. Nach<br />
20.30 Uhr wickelt die Gesellschaft den Betrieb<br />
seit 2007 mit Bussen und Kle<strong>in</strong>bussen<br />
(L<strong>in</strong>ientaxis) ab. <strong>Die</strong> Beschaffung der Niederflurwagen<br />
gilt als Beweis dafür, dass die<br />
Stadt Plauen auf die Straßenbahn auch weit<br />
über deren 120. Jubiläum h<strong>in</strong>aus nicht verzichten<br />
will.<br />
ANDRÉ MARKS<br />
Quellen<br />
Joachim Mensdorf, Klaus Reichenbach: 75<br />
Jahre Straßenbahn Plauen, hrsg. im Auftrag des<br />
Verkehrsmuseums Dresden 1969<br />
Joachim Mensdorf, Klaus Reichenbach: „110<br />
Jahre Straßenbahn Plauen 1894–2004“, hrsg.<br />
von der Plauener Straßenbahn GmbH 2004<br />
GeraMond Verlag GmbH, Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
<strong>Die</strong>se hochwertigen Acryl-Sammelkassetten<br />
helfen Ihnen, Ihre <strong>STRASSENBAHN</strong>-<br />
<strong>MAGAZIN</strong>-Ausgaben zu ordnen. In jede<br />
Kassette passt e<strong>in</strong> kompletter Jahrgang.<br />
1 Acryl-Kassette<br />
€ 18,95<br />
Best.-Nr. 75000<br />
15% gespart bei 5 Acryl-Kassetten<br />
€ 79,95<br />
Best.-Nr. 75001<br />
Jetzt bestellen unter:<br />
www.strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de oder<br />
Telefon 0180-532 2316 17<br />
(14 Cent/M<strong>in</strong>ute von 8-18 Uhr)
Betriebe<br />
Im Schatten des Herkules<br />
Kassels L<strong>in</strong>ie 1 im Porträt Nur wenige Straßenbahnl<strong>in</strong>ien<br />
haben e<strong>in</strong>e längere Geschichte als sie. E<strong>in</strong>e ihrer Endstellen<br />
führt sogar zu e<strong>in</strong>em UNESCO-Weltkulturerbe. Doch Kassels 1<br />
hat noch mehr zu bieten als e<strong>in</strong>e mittlerweile 137-jährige Tradition<br />
und e<strong>in</strong>e drei Kilometer lange Berg- und Talbahn<br />
Auf dem Kamm des Habichtswalds überragt der Herkules<br />
die Stadt Kassel, zu dessen Wahrzeichen er zählt.<br />
Aus Richtung der im Jahr 1717 fertiggestellten Statue führt<br />
die Wilhelmshöher Allee <strong>in</strong> die Innenstadt. Seit 9. Juli 1877 fährt<br />
hier auch die heutige Straßenbahnl<strong>in</strong>ie 1<br />
STEFAN VOCKRODT<br />
24<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Kassel<br />
Gibt es <strong>in</strong> Deutschland neben Kassels<br />
1 noch e<strong>in</strong>e weitere Traml<strong>in</strong>ie,<br />
die seit 137 Jahren durchgehend<br />
ihre Stammstrecke befährt? Gewiss<br />
– als am 9. Juli 1877 Kassels Straßenbahn<br />
auf dem Abschnitt Königsplatz – Wilhelmshöhe<br />
(der Stammstrecke der heutigen<br />
L<strong>in</strong>ie 1) den Betrieb aufnahm, hieß sie noch<br />
nicht „1“. Und sie fuhr auch nicht elektrisch.<br />
Zunächst zogen kle<strong>in</strong>e Trambahnlokomotiven<br />
dreiachsige Beiwagen auf der<br />
Wilhelmshöher Allee aus der Stadt h<strong>in</strong>aus<br />
und zur Endstation e<strong>in</strong>ige 100 Meter unterhalb<br />
des ehemals kurfürstlichen Schlosses<br />
Wilhelmshöhe h<strong>in</strong>auf. 1898 löste die „Elektrische“<br />
den Dampfbetrieb ab, während auf<br />
dem übrigen Netz noch Pferdebahnen verkehrten.<br />
Im Jahre 1928 verlängerte der Straßenbahnbetrieb<br />
die Traml<strong>in</strong>ie 1 vom Königsplatz<br />
aus nach Norden. Mehr als 80<br />
Jahre lag ihre dortige Endstelle an der Holländischen<br />
Straße zu Füßen des Werkes<br />
Mittelfeld von Henschel (heute Bombardier<br />
Kassel). Seit Oktober 2011 führt sie von<br />
dort parallel zur B7 <strong>in</strong> die kle<strong>in</strong>e, aber stark<br />
gewachsene Nachbarstadt Vellmar. Mit<br />
etwa 13 Kilometer Länge, handelt es sich<br />
zwar seitdem nicht um Kassels längste, aber<br />
nach wie vor um e<strong>in</strong>e der nachfragestärksten<br />
L<strong>in</strong>ien Kassels.<br />
Begeben wir uns auf e<strong>in</strong>e Fahrt mit Kassels<br />
L<strong>in</strong>ie 1. Man sollte etwas Zeit mitbr<strong>in</strong>gen,<br />
denn es lohnt sich durchaus, unterwegs e<strong>in</strong>mal<br />
auszusteigen. Wer mit dem Fernzug nach<br />
Kassel kommt, steigt am 1991 neugestalteten<br />
Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe aus. Hier erwartet<br />
uns e<strong>in</strong> großzügig überdachter, mit vier<br />
Tramgleisen ausgerüsteter Tram- und Busbahnhof.<br />
Auf Gleis 5 erwartet uns die L<strong>in</strong>ie 1<br />
Richtung Wilhelmshöhe.<br />
Futuristisch wirkt die Bus- und Straßenbahnhaltestelle vor dem 1991 e<strong>in</strong>geweihten ICE-Bahnhof<br />
Kassel-Wilhelmshöhe. <strong>Die</strong> Wagen der L<strong>in</strong>ie 1 bedienten bis Ende 2013 die Station auf dem l<strong>in</strong>ken<br />
Gleis <strong>in</strong> Richtung Wilhelmshöhe und auf dem zweiten von rechts nach Vellmar LARS BRÜGGEMANN<br />
<strong>Die</strong> Schleife der L<strong>in</strong>ie 1 am Bergpark<br />
Wilhelmshöhe liegt völlig im<br />
Grünen. Der Tw 462 bef<strong>in</strong>det sich<br />
nach des Betriebshofs auf der<br />
Fahrt <strong>in</strong> die Stadt<br />
STEFAN VOCKRODT<br />
Besonderheit im Fahrzeugpark<br />
Es kommt Tw 475. Der Wagen ist e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e<br />
Besonderheit, nicht nur weil er der letztgebaute<br />
der 25 NGT6C ist, mit denen <strong>in</strong><br />
Deutschland die moderne Niederflurära begann.<br />
Ihn beschaffte 1994 nicht die KVG,<br />
sondern die Kassel-Naumburger Eisenbahn<br />
(KNE), heute e<strong>in</strong>e Tochter der Hessischen<br />
Landesbahn (HLB). Warum? 1995 verlängerte<br />
man <strong>in</strong> Kassel die L<strong>in</strong>ie 5 auf den Gleisen<br />
der KNE <strong>in</strong> die südwestliche Nachbarstadt<br />
Baunatal. Seither wird die alte Schleife<br />
zu Füßen des VW-Werks Baunatal nur noch<br />
von Schichtwechslerzügen bedient. Und als<br />
Beitrag der KNE bzw. HLB für die Überlandtram<br />
tragen die Tw 474 und 475 zwar<br />
den KVG-Lack, aber das Eigentümersignet<br />
der Eisenbahn.<br />
Der Tw 475 präsentiert sich bereits im aktuellen,<br />
etwas dunkleren Blau der KVG mit<br />
weißer Schrift „<strong>Die</strong> Straßenbahn“, dunkelrotem<br />
Wappenlöwen an den Frontenseiten<br />
und breitem roten Streifen an der unteren<br />
Wagenkastenkante als Eigentumskennzeichen.<br />
Nimmt man ganz vorne rechts über<br />
dem Triebdrehgestell Platz, so kann man<br />
durch die Frontscheibe auf die Strecke<br />
schauen. Der Zug fährt los, biegt rechts ab<br />
auf die Wilhelmshöher Allee, passiert den<br />
Abzweig der L<strong>in</strong>ien 3 und 4 Richtung Druseltal<br />
und Helleböhn und die Schleife der L<strong>in</strong>ie<br />
7 durch die Rolandstraße und rollt nun<br />
geradeaus die sanft steigende Wilhelmshöher<br />
Alle h<strong>in</strong>auf. <strong>Die</strong> Tram fährt <strong>in</strong> Straßenmitte,<br />
der Gleiskörper liegt fahrbahnbündig,<br />
ist aber durch das Pflaster herausgehoben.<br />
L<strong>in</strong>ks und rechts gibt es e<strong>in</strong>e Pkw-Spur, daneben<br />
Parkstreifen und streckenweise angenehm<br />
breite Fußwege.<br />
Blick h<strong>in</strong>auf zum Herkules<br />
Vor uns ragt der Habichtswald auf, dessen<br />
Gipfel die 1701 bis 1717 auf e<strong>in</strong>em Oktogon<br />
Schloss mit Pyramide errichtete Herkules-Statue<br />
krönt, die e<strong>in</strong>en fantastischen<br />
Blick über Kassel und das Fuldatal bis h<strong>in</strong> -<br />
über zum Meißner und Hohen Hagen bietet.<br />
Unterhalb des Herkules liegen die Kaskaden<br />
– die berühmten Wasserspiele – und<br />
darunter liegt wie e<strong>in</strong> Riegel Schloss Wilhelmshöhe,<br />
e<strong>in</strong>st Sitz der hessischen Kurfürsten,<br />
später logierten hier Napoleons<br />
Bruder Jerome (Kassel war Hauptstadt des<br />
kurzlebigen „Königreichs Westfalen“) und<br />
Kaiser Wilhelm II. Heute dient das Schloss<br />
als Kunstmuseum – vor allem Gemälde alter<br />
niederländischer Meister, darunter zwölf<br />
von Rembrandt, gehören zur Sammlung.<br />
Wir passieren die vor e<strong>in</strong>igen Jahren zur<br />
Kaphaltestelle umgebaute Station Kunoldstraße<br />
und biegen, kurz bevor die Straße<br />
steiler zu steigen beg<strong>in</strong>nt, nach rechts ab <strong>in</strong><br />
die Haltestelle – ne<strong>in</strong>, nicht „Betriebshof<br />
Wilhelmshöhe“, sondern – „Hessischer<br />
Rundfunk“. Auch wenn direkt h<strong>in</strong>ter der<br />
Haltestelle die E<strong>in</strong>fahrt <strong>in</strong> den Betriebshof<br />
Wilhelmshöhe liegt, ältestes und größtes<br />
Depot sowie Hauptwerkstatt der Kasseler<br />
Straßenbahn, heißt die Haltestelle nach dem<br />
auf der anderen Seite der Straße gelegenen<br />
Funkhaus Kassel des HR. Während der<br />
Fahrerwechsel stattf<strong>in</strong>det, hat man e<strong>in</strong>en<br />
guten Blick auf die Hallen des Betriebshofs,<br />
<strong>in</strong> dem sich mit etwas Glück noch ältere<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
25
Betriebe<br />
Im wahrsten S<strong>in</strong>ne des Wortes e<strong>in</strong> Bahnhof: <strong>Die</strong> Endstelle Wilhelmshöhe von Kassels L<strong>in</strong>ie 1 mit<br />
dem 1877 errichteten Empfangs- und Verwaltungsgebäude. Als die Aufnahme vor 2011<br />
entstand, endete die L<strong>in</strong>ie 1 noch an der Holländischen Straße<br />
BRIAN TURNER<br />
N8C oder der als Gleispflegezug dienende<br />
frühere Tw 317 (GT6-ZR) erkennen lassen.<br />
<strong>Die</strong> große Wendeschleife<br />
Wilhelmshöhe<br />
Der folgende Abschnitt ist für Fotografen e<strong>in</strong><br />
„Muss“, wir fahren nun <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Art „grünen<br />
Tunnel“ e<strong>in</strong>, die beiden Gleise säumen l<strong>in</strong>ks<br />
und rechts recht hohe Bäume, nach etwa 100<br />
Meter Weg trennen sich die Gleise und wir beg<strong>in</strong>nen<br />
die Fahrt durch die ausgedehnte Wendeschleife.<br />
Am E<strong>in</strong>gang liegt die Haltestelle<br />
„Kurhessentherme“, beide Bahnsteige s<strong>in</strong>d bereits<br />
räumlich weiter getrennt. Hier steigen<br />
Spaziergänger aus, die entweder <strong>in</strong> den Park<br />
h<strong>in</strong>auf oder auch durch den Wald h<strong>in</strong>über zur<br />
ebenfalls im Grünen gelegenen Endstelle Hessenschanze<br />
gehen wollen. Unsere Bahn rollt<br />
weiter und passiert die ehemalige Haltestelle<br />
Weißenste<strong>in</strong>straße, e<strong>in</strong>e der wohl am wenigstens<br />
genutzten Haltestellen Deutschlands.<br />
Danach biegt unser Zug <strong>in</strong> die Endstelle Wilhelmshöhe<br />
e<strong>in</strong>. Hier kann man staunen: H<strong>in</strong>ter<br />
den beiden 60 Meter langen Haltestellengleisen<br />
ragt e<strong>in</strong> pompöses Empfangsgebäude<br />
auf, das erkennbar älteren Baujahrs ist. Tatsächlich<br />
errichtete die „Cassels Tramway<br />
Company“ hier 1877 e<strong>in</strong>en „großen Bahnhof“.<br />
Das Gebäude ist denkmalgeschützt und<br />
beherbergt e<strong>in</strong> Besucherzentrum für den Bergpark.<br />
Zwischen Bahnsteigen und Bau bef<strong>in</strong>den<br />
sich großzügige Fahrradstellplätze, hier lassen<br />
sich auch Räder des Fahrradverleihs „Konrad“<br />
mieten, für ÖPNV-Nutzer zu sehr günstigen<br />
Konditionen.<br />
Wer <strong>in</strong> den Park und zum Herkules will,<br />
klettert nun die Stufen h<strong>in</strong>auf und geht<br />
durch den Park. Es lohnt sich, man sollte<br />
aber m<strong>in</strong>destens zwei Stunden dafür e<strong>in</strong>planen.<br />
Wir wollen aber weiterfahren, lassen<br />
den Fahrer se<strong>in</strong>e Pause machen und rollen<br />
nach sieben M<strong>in</strong>uten Wendezeit wieder h<strong>in</strong>unter.<br />
<strong>Die</strong> Bahn fährt die lange Schleife zu<br />
Ende, hält am stadte<strong>in</strong>wärtigen Bahnsteig<br />
der Kurhessentherme und erreicht h<strong>in</strong>ter<br />
dem Betriebshof wieder die Wilhelmshöher<br />
Allee. Es lohnt sich erneut, vorne zu sitzen,<br />
denn jetzt fällt der Blick h<strong>in</strong>ab auf Kassel.<br />
<strong>Die</strong> lange Gerade:<br />
Wilhelmshöher Allee<br />
Von nun rollt die „1“ rund 3 Kilometer geradeaus,<br />
zwischen dem Bahnhof Wilhelmshöhe<br />
und der City teilt sie sich den Weg mit<br />
der L<strong>in</strong>ie 3 (Druseltal – Ihr<strong>in</strong>gshäuser Straße).<br />
Der kreisrunde Königsplatz ist das Zentrum von Kassels City. <strong>Die</strong> Haltestelle liegt<br />
mitten im Platz, bis zu drei Wagen können hier h<strong>in</strong>tere<strong>in</strong>ander halten. Sechs<br />
der sieben Traml<strong>in</strong>ien fahren hier durch STEFAN VOCKRODT<br />
26<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Kassel<br />
Daten & Fakten: Kassels L<strong>in</strong>ie 1<br />
Führung: . . . . . . . . . . Wilhelmshöhe – Bahnhof<br />
Wilhelmshöhe – Kirchweg – Rathaus –<br />
Königsplatz – Stern – Holländische Straße –<br />
Vellmar Nord<br />
Haltestellen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />
Länge:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 km<br />
Fahrzeit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 M<strong>in</strong>uten<br />
Takt: . . . . . . . . . . . . . . . . 15 M<strong>in</strong>uten (tagsüber)<br />
Fahrzeuge:. . . . . . . . . . NGT6C, NGT8 (auch 2x),<br />
bald auch NGT8 + NB4<br />
Fahrpreis:<br />
• E<strong>in</strong>zelfahrsche<strong>in</strong> (Stadtgebiet): . . . . 2,70 Euro<br />
• Tageskarte: „KasselPlus“ . . . . . . . . . 6,20 Euro<br />
Gruppenkarte . . . . . . . . 12,– Euro<br />
(bis 5 Personen)<br />
Nachdem wir den Nahverkehrsterm<strong>in</strong>al am<br />
ICE-Bahnhof verlassen und die Gleise der DB<br />
überquert haben, fahren wir nun auf eigenem<br />
Gleiskörper (heute überwiegend Rasengleis)<br />
die breite Allee h<strong>in</strong>unter.<br />
H<strong>in</strong>ter der Haltestelle „Rotes Kreuz“<br />
zweigt nach l<strong>in</strong>ks die L<strong>in</strong>ie 4 ab, die den E<strong>in</strong>schnitt<br />
der verrohrten Drusel durchfährt, bevor<br />
sie dann auf der Friedrich-Ebert-Straße<br />
weitgehend parallel zur „1“ Richtung City<br />
läuft. Wir durchqueren jetzt den Stadtteil<br />
Wehlheiden und erreichen die Haltestelle<br />
„Kirchweg“. Hier biegt nach l<strong>in</strong>ks die L<strong>in</strong>ie<br />
7 <strong>in</strong> die Germania- und die Goethestraße ab,<br />
bis 1965 fuhren rechts von hier die Züge der<br />
meterspurigen Herkulesbahn los Richtung<br />
Brasselisberg und Herkules. Nun geht es wieder<br />
e<strong>in</strong> Stück bergan – die Wilhelmshöher Allee<br />
ist zwar schnurgerade, aber e<strong>in</strong> wenig<br />
„Berg- und Talbahn“ – bis wir die Haltestelle<br />
Murhardstraße erreichen, <strong>in</strong> deren Nähe<br />
sich e<strong>in</strong> Teil der stark gewachsenen Universität<br />
bef<strong>in</strong>det. <strong>Die</strong> Bahn ist bereits gut besetzt,<br />
jetzt wird sie voll. An der Haltestelle Weigelstraße<br />
vorbei erreichen wir das Wilhelmshöher<br />
Tor mit se<strong>in</strong>en recht klobigen Torbauten<br />
am Brüder-Grimm-Platz. In der Nähe liegt<br />
das Museum für Sepulkralkultur, das sich –<br />
wohl e<strong>in</strong>malig auf der Welt – den Totenriten<br />
der unterschiedlichen Kulturen widmet. Nun<br />
biegt die Bahn scharf nach l<strong>in</strong>ks und rollt h<strong>in</strong>ab<br />
<strong>in</strong> die Innenstadt. An der großen Kreuzung<br />
mit der Fünffensterstraße mündet unsere<br />
L<strong>in</strong>ie 1 <strong>in</strong> den Innenstadtr<strong>in</strong>g. Wir rollen<br />
weiter geradeaus <strong>in</strong> die Haltestelle Rathaus.<br />
Jetzt erreichen wir Kassels Innenstadt und<br />
fahren durch e<strong>in</strong>e der ältesten Fußgängerzonen<br />
Deutschlands: die Obere und Untere<br />
Königsstraße. Bis auf die L<strong>in</strong>ien RT5 und 7<br />
führen alle Kasseler Traml<strong>in</strong>ien hier durch.<br />
Neben unserer „1“ s<strong>in</strong>d das die L<strong>in</strong>ie 3, die<br />
L<strong>in</strong>ien 4 und 8 von der Friedrich-Ebert-Straße,<br />
die L<strong>in</strong>ien 5 und 6 aus der Frankfurter<br />
Straße sowie die Regiotraml<strong>in</strong>ien RT3 von<br />
Hofgeismar und RT4 von Wolfhagen. <strong>Die</strong><br />
Bahn rollt langsam an den zahlreichen Fußgängern<br />
vorbei zum Friedrichsplatz mit dem<br />
Museum Fridericianum, Kunstkennern wegen<br />
der alle fünf Jahre <strong>in</strong> Kassel stattf<strong>in</strong>denden<br />
Documenta bestens vertraut, und<br />
erreicht den zentralen, kreisrunden Königsplatz.<br />
Nun geht es auf der engeren Unteren<br />
Königsstraße h<strong>in</strong>ab zum Stern, e<strong>in</strong>er echten<br />
„Grand Union“. Hier können die Bahnen<br />
aus jeder <strong>in</strong> jede Richtung abbiegen. Doch<br />
unsere „1“ (und die sie auf diesem Abschnitt<br />
verstärkenden L<strong>in</strong>ien RT3, RT4 und 5) fahren<br />
geradeaus weiter nach Norden <strong>in</strong> die<br />
Holländische Straße.<br />
Am alten Henschelwerk<br />
<strong>Die</strong> Trasse ist nun optisch wenig ansprechend,<br />
durchfahren wir doch e<strong>in</strong>en ehemals<br />
stark <strong>in</strong>dustriell geprägten Stadtteil. Am<br />
Holländischen Platz passieren wir den Ort<br />
des Stammwerk von Henschel. Doch der<br />
Lokomotivbau gehört hier schon lange der<br />
Vergangenheit an, heute nutzt die Universität<br />
das Gelände, viele Studierende steigen<br />
hier aus und e<strong>in</strong>.<br />
Weiter geht es auf der Holländischen<br />
Straße nach Nord-Nord-West, l<strong>in</strong>kerhand<br />
liegt der große Hauptfriedhof, h<strong>in</strong>ter der<br />
RT3 Hofgeismar<br />
1<br />
Vellmar Nord<br />
RT4 Wolfhagen<br />
Ahnatal-<br />
Heckershausen<br />
Ahnatal-<br />
Casselbreite<br />
Vellmar-Obervellmar<br />
VELLMAR<br />
Musikerviertel<br />
Nordstraße<br />
a)<br />
Vellmar Stadtmitte<br />
Vellmar Festplatz<br />
1<br />
Wilhelmshöhe (Park) – Vellmar Nord<br />
a) Gleisverschl<strong>in</strong>gung<br />
b) L<strong>in</strong>ksverkehr<br />
1 km<br />
2014 © R. Schwandl<br />
8<br />
Hessenschanze<br />
1<br />
Wilhelmshöhe<br />
(Park)<br />
Bebelplatz<br />
Weißenste<strong>in</strong>str.<br />
Bf. Wilhelmshöhe<br />
Hessischer<br />
Rundfunk Kunoldstr.<br />
Kurhessen-<br />
Therme<br />
3 Druseltal<br />
Der L<strong>in</strong>ienverlauf von Kassels 1<br />
3<br />
7<br />
4·(7)<br />
a)<br />
Vellmar-<br />
Osterberg/EKZ<br />
KS-Jungfernkopf<br />
Rotes<br />
Kreuz<br />
KS-Harleshausen<br />
KS-Kirchditmold<br />
4<br />
8<br />
Kirchweg<br />
6<br />
Wolfsanger<br />
7<br />
Dörnbergstr.<br />
Holländische Straße<br />
Hegelsbergstraße<br />
KASSEL Hbf<br />
Annastr.<br />
Berlepschstr.<br />
Murhardstr./<br />
KS-Wilhelmshöhe<br />
Weigelstr.<br />
Universität<br />
5 Baunatal<br />
4 Mattenberg<br />
6 Brückenhof<br />
5<br />
Vellmar-Niedervellmar<br />
Vellmar, Triftstraße<br />
b) Stadtgrenze<br />
Kassel, Berl<strong>in</strong>er Straße<br />
Wilhelmshöher Allee<br />
Wiener Straße<br />
Hauptfriedhof<br />
Mombachstraße<br />
Holländischer Platz/<br />
Universität<br />
1·3<br />
(<br />
(<br />
Holländische Str.<br />
7<br />
5·6<br />
Am<br />
Stern<br />
Königspl.<br />
Friedrichsplatz<br />
Rathaus<br />
1·5<br />
Ihr<strong>in</strong>gshäuser<br />
Straße<br />
7<br />
3·6·7<br />
Altmarkt<br />
4·8<br />
Gött<strong>in</strong>gen<br />
3<br />
3 7<br />
Weserspitze<br />
4 Hessisch Lichtenau<br />
8 Kaufungen, Papierfab.<br />
GRAFIK ROBERT SCHWANDL<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
27
Betriebe<br />
Am nördlichen Stadtrand Vellmars liegt die andere Endstelle der<br />
L<strong>in</strong>ie 1. Bei der Eröffnung am 22. Oktober 2011 entstand diese<br />
Aufnahme mit dem Triebwagen 618<br />
MICHAEL KOCHEMS<br />
Haltestelle Hegelsbergstraße befand sich<br />
früher der Betriebshof Holländische Straße,<br />
wieder e<strong>in</strong>e Spezialität: E<strong>in</strong>st barg die Wagenhalle<br />
die Wagen teilweise auf zwei Etagen<br />
– heute bef<strong>in</strong>det sich hier e<strong>in</strong>e Tankstelle.<br />
Zuletzt wendeten 2008/09 die Züge der<br />
L<strong>in</strong>ien 1, 2 und 5 <strong>in</strong> diesem Bereich während<br />
des Umbaus der Schleife Holländische<br />
Straße, unter anderem für den L<strong>in</strong>ksverkehr<br />
nach Vellmar.<br />
Auf dem l<strong>in</strong>ken Gleis nach Vellmar<br />
L<strong>in</strong>ksverkehr? Richtig gelesen. Kurz vor der<br />
Schleife Holländische Straße wechseln wir<br />
auf das l<strong>in</strong>ke Gleis. <strong>Die</strong> Wendeschleife wird<br />
deshalb auch im Uhrzeigers<strong>in</strong>n (normal ist<br />
gegen den Uhrzeigers<strong>in</strong>n) befahren. Wir laufen<br />
auf dem l<strong>in</strong>ken Gleis <strong>in</strong> den Durchgangsteil<br />
der Haltestelle e<strong>in</strong>. Gegenüber steht abfahrbereit<br />
e<strong>in</strong> Zug der L<strong>in</strong>ie 5 nach Baunatal.<br />
Nun beg<strong>in</strong>nt die Neubaustrecke nach Vellmar.<br />
Wir passieren – l<strong>in</strong>ksfahrend – e<strong>in</strong>ige<br />
Bau- und Heimwerker- sowie Autozubehörmärkte,<br />
rechts von uns liegt die stark befahrene,<br />
autobahnmäßig ausgebaute Holländische<br />
Straße (B7). Direkt vor der Haltestelle<br />
Berl<strong>in</strong>er Straße wechselt die „1“ <strong>in</strong> den Mittelstreifen<br />
der B7.<br />
Das ist auch der Grund für den L<strong>in</strong>ksverkehr:<br />
Damit die L<strong>in</strong>ie 1 mit E<strong>in</strong>richtungswagen<br />
bedient werden kann, der Mittelstreifen<br />
der B7 aber nur Mittelbahnsteighaltestellen<br />
zuließ, hat man halt ganz pragmatisch die<br />
Seiten gewechselt. So geht es an den Haltestellen<br />
Berl<strong>in</strong>er Straße (noch Kassel) und<br />
Triftstraße (bereits Vellmar) vorbei und unter<br />
der ICE-Strecke Kassel – Hannover sowie<br />
der alten Hannoverschen Südbahn h<strong>in</strong>durch.<br />
Kurz darauf wechselt unsere Bahn wieder<br />
auf die rechte Seite – der Gleiswechsel ist hier<br />
e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache, signalgesicherte Kreuzung. Der<br />
im L<strong>in</strong>ksverkehr befahrene Abschnitt ist<br />
etwa 1,5 Kilometer lang.<br />
Auf Straße und Rasengleis<br />
durch Vellmar<br />
Kurz danach biegen wir rechts ab <strong>in</strong> den Ort<br />
Vellmar h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> zur Haltestelle Dörnbergstraße,<br />
der erste Verknüpfungspunkt mit den Vellmar<br />
erschließenden Busl<strong>in</strong>ien und mit P&R-<br />
Parkplätzen. Von dort geht es e<strong>in</strong> kurzes<br />
Stück abseits jeglicher Straße weiter, bevor die<br />
„1“ auf der Brüder-Grimm-Straße wieder zur<br />
echten Straßenbahn wird. So passieren wir die<br />
Haltestelle Vellmar Festplatz, dann geht es auf<br />
die eigene Trasse. Auf Rasengleis wird die<br />
Haltestelle Vellmar Stadtmitte erreicht. Mit ei-<br />
<strong>Die</strong> Kassler<br />
Verkehrsgesellschaft AG<br />
Anschrift:<br />
Kassler Verkehrsgesellschaft AG (KVG)<br />
Königstor 3–13, 34117 Kassel<br />
www.kvg.de<br />
Spurweite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.435 mm<br />
Streckenlänge (Tram): . . . . . . . . . . . . . . 89,2 km<br />
(ohne Regiotram)<br />
L<strong>in</strong>ien: . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tram, 4 Regiotram<br />
Fahrzeuge: . . . . . . . 85 Straßenbahntriebwagen,<br />
davon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 N8C<br />
(Tw 417 bis 422, Hochflur, Reserve)<br />
. . . . . . . 25 6NGTW (Tw 451 bis 475)<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 NGT8 ER<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 NGT8 ZR<br />
(alle Bombardier Classic, zwei Bauserien)<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Regiotram<br />
Betriebshöfe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />
ner Fahrbahnbreite von 6 Meter und 82 Meter<br />
Bahnsteiglänge ist sie der zentrale Umsteigepunkt<br />
zwischen Tram und Bus <strong>in</strong> Vellmar.<br />
Und wieder folgt e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>ere Besonderheit:<br />
Zwischen Vellmar Stadtmitte und der Nordstraße<br />
verläuft die Trasse der „1“ am l<strong>in</strong>ken<br />
Straßenrand und e<strong>in</strong> Stück <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gleisverschl<strong>in</strong>gung.<br />
Hier fahren wir durch e<strong>in</strong>e typische moderne<br />
Vorstadt mit E<strong>in</strong>- und Mehrfamilienhaussiedlungen,<br />
die h<strong>in</strong>ter e<strong>in</strong>er Schallschutzwand<br />
liegen. Auf eigener, begrünter<br />
Trasse geht es an der Haltestelle Musikerviertel<br />
vorbei zur Endstelle Vellmar Nord an<br />
der Stadtgrenze. <strong>Die</strong> Schleife umrundet e<strong>in</strong>en<br />
gut gefüllten P&R-Platz, daneben s<strong>in</strong>d<br />
dutzende, teilweise gesicherte Abstellmöglichkeiten<br />
für Fahrräder vorhanden.<br />
<strong>Die</strong> Bahnsteige liegen am Beg<strong>in</strong>n der Wendeschleife,<br />
die auf dem üblichen, also gegen<br />
die Uhr zeigenden Weg durchfahren wird.<br />
Nach rund 42 M<strong>in</strong>uten (ab Endstelle Wilhelmshöhe<br />
gerechnet) s<strong>in</strong>d wir am Ziel. <strong>Die</strong><br />
„1“, <strong>in</strong>sbesondere die Verlängerung nach<br />
Vellmar, ist e<strong>in</strong>e stark ausgelastete L<strong>in</strong>ie. Doch<br />
wie alle Kasseler Stadtl<strong>in</strong>ien wird sie im 15-<br />
M<strong>in</strong>uten Takt befahren. Um die Fahrgastkapazität<br />
zu erhöhen, hat Kassel e<strong>in</strong>ige NB4-<br />
Beiwagen aus Rostock erworben, die h<strong>in</strong>ter<br />
den Classic NGT8 zum E<strong>in</strong>satz kommen sollen.<br />
Derzeit verkehren bis zu sechs Kurse als<br />
Doppeltraktionen aus NGT8 aller Serien.<br />
Kassels L<strong>in</strong>ie 1 bietet nicht nur viel Kultur,<br />
sondern dem Straßenbahnfreund auch<br />
e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>teressante L<strong>in</strong>ienführung mit vielseitigem,<br />
abwechslungsreichem Betrieb. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
sollten Fotografen etwas aufpassen:<br />
Es gibt <strong>in</strong> Kassel Straßenbahnfahrer, die sich<br />
und ihre Wagen nicht gerne fotografieren<br />
lassen ...<br />
STEFAN VOCKRODT<br />
28 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Nächster Halt: …<br />
Der Wagen 22 der Wuppertaler Schwebebahn am 24. Juli 2009 an der zehn Jahre zuvor wieder e<strong>in</strong>gerichteten Haltestelle Kluse auf der Fahrt von<br />
Oberbarmen nach Vohw<strong>in</strong>kel. Oben ist die Glaskonstruktion der <strong>in</strong> Höhe Bembergstraße gelegenen Haltestelle zu erkennen<br />
LARS BRÜGGEMANN<br />
Nächster Halt:<br />
Kluse<br />
Bei Eröffnung der Wuppertaler Schwebebahn<br />
g<strong>in</strong>g am 1. März 1901 <strong>in</strong> Elberfeld auch die<br />
Haltestelle Kluse <strong>in</strong> Betrieb. Bis zum 23. Mai<br />
1901 war sie Endpunkt des Abschnittes vom<br />
Zoo. Am folgenden 24. Mai nahm die Cont<strong>in</strong>entale<br />
Gesellschaft für elektrische Unternehmungen<br />
(e<strong>in</strong>e Tochter der Elektrizitäts-AG vormals<br />
Schuckert & Co. mit Sitz <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>) den<br />
Abschnitt Zoo – Vohw<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> <strong>Die</strong>nst. In den<br />
ersten drei Betriebsjahren gab es an der Kluse<br />
e<strong>in</strong>e Kehrschleife, die nach der Verlängerung<br />
bis Oberbarmen 1903 überflüssig wurde – die<br />
Haltestelle Kluse lag seitdem fast <strong>in</strong> der Mitte<br />
der Strecke. <strong>Die</strong> bis zur Gründung der Stadt<br />
Wuppertal (1929) als Schwebebahn Barmen–<br />
Elberfeld–Vohw<strong>in</strong>kel bezeichnete E<strong>in</strong>schienenhängebahn<br />
entwickelte sich rasch zu e<strong>in</strong>em<br />
Wahrzeichen der Region, für die Wuppertaler<br />
war und ist sie aber bis heute e<strong>in</strong> ganz normales<br />
<strong>in</strong>nerstädtisches Verkehrsmittel.<br />
Im Zweiten Weltkrieg führten die Bombardements<br />
auch zu Beschädigungen der Schwebebahn.<br />
<strong>Die</strong> bei e<strong>in</strong>em Angriff im Juni 1942 ausgebrannte<br />
Haltestelle Kluse bediente die<br />
Betreibergesellschaft nach dem Krieg nicht<br />
mehr und ließ die letzten Trümmer 1954 beseitigen.<br />
Nach E<strong>in</strong>stellung der Straßenbahn <strong>in</strong><br />
den 1980er-Jahren bestand zwischen den<br />
Schwebebahnhaltestellen Hauptbahnhof und<br />
Landgericht im Stadtteil Elberfeld jedoch e<strong>in</strong><br />
Defizit an öffentlichen Nahverkehrsangeboten<br />
– vor allem um Besucher <strong>in</strong>s Schauspielhaus<br />
und Großk<strong>in</strong>o sowie zur Kultur<strong>in</strong>sel zu br<strong>in</strong>gen.<br />
Daraufh<strong>in</strong> begannen Planungen zum Neubau<br />
der Haltestelle Kluse. Am 26. März 1999<br />
war es soweit: Nach 54 Jahren hielt wieder die<br />
Schwebebahn zwischen den Pfeilern 266/267.<br />
<strong>Die</strong> neue Haltestelle mit dem Hauptnamen<br />
Kluse und dem Be<strong>in</strong>amen Schauspielhaus wirkt<br />
etwas futuristisch – selbst von unten ist die Hallenkonstruktion<br />
mit gläsernem Dach sichtbar.<br />
<strong>Die</strong> Haltestelle Kluse/Schauspielhaus liegt über<br />
der Wupper im Kluse-Bogen. Mit dem Begriff<br />
Klus – teils auch Klause genannt – wird meist<br />
e<strong>in</strong> enges, steiles Durchbruchstal bezeichnet,<br />
also e<strong>in</strong>e Art Schlucht mit felsigen Seitenwänden,<br />
aber mit verhältnismäßig ger<strong>in</strong>gem Gefälle<br />
des Talgrundes. <strong>Die</strong> Wupper fließt hier <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
engen Bogen. Wikipedia erklärt es aber etwas<br />
e<strong>in</strong>facher: Kluse stehe e<strong>in</strong>fach für e<strong>in</strong>e Haltestelle<br />
der Wuppertaler Schwebebahn im Stadtteil<br />
Elberfeld. LARS BRÜGGEMANN/AM<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
33
Betriebe<br />
Tram-Kultur mit Stange<br />
Aktuelles von der Straßenbahn <strong>in</strong> Riga Sie ist Europas Kulturhauptstadt 2014 – und auch<br />
die Straßenbahnhauptstadt Lettlands – Riga! Noch immer fahren auf neun L<strong>in</strong>ien massenhaft Tatra-<br />
Wagen mit Trolleystange durch die Straßen. Doch die Ablösung der Fahrzeuge rückt näher<br />
Irgendwie sehen sie e<strong>in</strong> bisschen unvollständig<br />
aus. Ja, sogar e<strong>in</strong> bisschen<br />
nackt: die über 200 Tatra-Wagen, die jeden<br />
Tag zehntausende Fahrgäste <strong>in</strong><br />
Lettlands Hauptstadt Riga befördern. Auf<br />
dem Dach der Wagen: Ke<strong>in</strong> für die meisten<br />
europäischen Länder so typischer E<strong>in</strong>holmoder<br />
Scherenstromabnehmer, sondern die<br />
klassische Trolleystange, die <strong>in</strong> den meisten<br />
europäischen Straßenbahnstädten schon<br />
seit gut 100 Jahren ausgedient hat!<br />
<strong>Die</strong> Letten schwören aber offenbar darauf.<br />
Außer <strong>in</strong> Riga sorgen nämlich auch <strong>in</strong> Daugavpils<br />
(Dünaburg) noch Trolleystangen für<br />
die Stromaufnahme, nur der Straßenbahnbetrieb<br />
<strong>in</strong> Liepaja (Libau) setzt <strong>in</strong> Lettland auf<br />
„Schere“. Was soll‘s? Es funktioniert ja!<br />
Auf gut 100 Kilometern Streckenlänge und<br />
neun L<strong>in</strong>ien „stängeln“ sich die Tatras jeden<br />
Tag durch die Kulturhauptstadt 2014. Dabei<br />
setzt der Betrieb als e<strong>in</strong>ziges der drei lettischen<br />
Straßenbahnunternehmen ke<strong>in</strong>e gebrauchten<br />
Bahnen aus dem Westen e<strong>in</strong>: Zum<br />
Fahrzeugbestand gehören über 200 modernisierte<br />
T3A und T3MR. Außerdem rücken<br />
nach und nach neue Škoda-Niederflurwagen<br />
an. Mittlerweile s<strong>in</strong>d davon schon 26 dreiund<br />
vierteilige Wagen <strong>in</strong> Riga im E<strong>in</strong>satz, so<br />
dass die stark frequentierten L<strong>in</strong>ien 6 und 11<br />
<strong>in</strong> der Regel komplett oder zum Großteil mit<br />
diesen Wagen bedient werden. Weitere Fahrzeuge<br />
werden die noch sehr gepflegten Tatras<br />
langsam ersetzen.<br />
So oder so: <strong>Die</strong> Reise nach Riga lohnt sich!<br />
Das Straßenbahnnetz erstreckt sich über weite<br />
Teile der Stadt und überrascht an vielen<br />
Stellen mit <strong>in</strong>teressanten Streckenführungen.<br />
Zentraler Knotenpunkt ist die Haltestelle<br />
Centraltirgus <strong>in</strong> der Nähe des Hauptbahnhofs.<br />
Hier herrscht großstädtisches Getümmel,<br />
hier überquert die Bahn im dichten Takt<br />
e<strong>in</strong>en Kanal, um vor den Markthallen des<br />
Hafens jeden Tag tausende Fahrgäste e<strong>in</strong>und<br />
auszuspucken. <strong>Die</strong> Fahrgäste kaufen frisches<br />
Obst, Blumen für den Wohnzimmertisch<br />
und lassen sich manchmal von den Möwen<br />
ihr halbes Fischbrötchen klauen: Riga ist<br />
eben e<strong>in</strong>e alte Hansestadt und damit richtig<br />
maritim! Das liegt wohl vor allem am Fluss<br />
Daugava (Düna), auf den die Straßenbahnwagen<br />
nach dem Verlassen der Haltestelle<br />
mit Blick auf die riesigen Eisenbahn- und Autobrücken<br />
zusteuern.<br />
Anstatt Fahrsche<strong>in</strong>e<br />
elektronische Tickets<br />
Für die Fahrer e<strong>in</strong> alltäglicher Anblick – sie<br />
verkaufen noch während der Fahrt Tickets<br />
für die, die sich vorher ke<strong>in</strong>es mehr beschaffen<br />
konnten. Das ist allerd<strong>in</strong>gs ke<strong>in</strong>e gute<br />
34 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Lettland: Riga<br />
RECHTS Willkommen<br />
<strong>in</strong> der Kulturhauptstadt<br />
2014! Von der<br />
Daugava-Brücke aus<br />
haben die Besucher<br />
e<strong>in</strong>en fantastischen<br />
Blick auf die<br />
Altstadt von Riga.<br />
E<strong>in</strong> T3A-Paar macht<br />
sich vor dieser<br />
Kulisse auf den Weg<br />
<strong>in</strong> Richtung<br />
Bišumuiža<br />
LINKS Vor den zen -<br />
tralen Markthallen<br />
<strong>in</strong> der Nähe des<br />
Hauptbahnhofs<br />
laden die Fahrgäste<br />
fast jeden Tag unzählige<br />
Tüten mit<br />
frischem Obst, Gemüse<br />
und Fisch <strong>in</strong><br />
die Straßenbahn e<strong>in</strong><br />
ALLE FOTOS:<br />
CHRISTIAN LÜCKER<br />
RECHTS E<strong>in</strong> drei tei li ger<br />
Škoda-Niederflur -<br />
wagen flüchtet vor<br />
e<strong>in</strong>em Gewitter und<br />
streift dabei die<br />
Oper und die<br />
Altstadt von Riga<br />
Entscheidung. In den Bahnen s<strong>in</strong>d die Fahrkarten<br />
vergleichsweise teuer. Dafür gibt es sie<br />
an fast jedem Kiosk <strong>in</strong> der Stadt. Statt e<strong>in</strong>er<br />
Karte aus Pappe oder Papier kauft man <strong>in</strong><br />
Riga e<strong>in</strong> elektronisches Ticket, das nach Belieben<br />
mit Geld aufgeladen werden kann.<br />
Großer Vorteil für Touristen: In Lettland<br />
gibt es seit diesem Jahr den Euro. E<strong>in</strong> Tagesticket<br />
für alle Straßenbahnl<strong>in</strong>ien kostet rund<br />
drei Euro. Es gilt, sobald das Ticket mit dem<br />
Lesegerät <strong>in</strong> der Bahn <strong>in</strong> Berührung kommt.<br />
Also los! Besonders empfehlenswert ist e<strong>in</strong>e<br />
Fahrt mit der L<strong>in</strong>ie 10. Sie fährt von der Haltestelle<br />
Centraltirgus aus über die lange Dünabrücke<br />
und wird ziemlich schnell zur idyllischen<br />
Vorortl<strong>in</strong>ie. Direkt h<strong>in</strong>ter der City geht<br />
es auf zum Teil schmalen Straßen durch ausgedehnte<br />
Parkanlagen mit Hügeln und Seen.<br />
Später führt die 10 e<strong>in</strong>gleisig durch e<strong>in</strong>e mit<br />
Kopfste<strong>in</strong>en gepflasterte Straße, e<strong>in</strong>gerahmt<br />
von den typischen lettischen Wohnhäusern<br />
mit Holzvertäfelung. Das alles lässt sich bequem<br />
aus e<strong>in</strong>em Tatrawagen entdecken – diese<br />
Fahrt macht richtig Spaß!<br />
Riga zu Fuß erkunden, lohnt sich allerd<strong>in</strong>gs<br />
ebenfalls: Von der Oper aus erreichen<br />
die Besucher direkt die gut erhaltene Altstadt,<br />
den Stadtkern mit se<strong>in</strong>en prächtigen Jugendstilhäusern<br />
und die vielen, wunderschön angelegten<br />
Parkanlagen. Ohneh<strong>in</strong> ist Riga e<strong>in</strong>e<br />
sehr grüne Stadt. Abgesehen von den Straßenbahnen<br />
– fast alle s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den Hausfarben<br />
Dunkelblau, Hellblau und Weiß lackiert. Das<br />
steht den Wagen zwar sehr gut. Was aber völlig<br />
fehlt: Ansprechende Werbungen, die darauf<br />
h<strong>in</strong>weisen, dass Riga Kulturhauptstadt<br />
ist. Als solche muss sich die Stadt mit ihrer<br />
Straßenbahn und ihrem kulturellen Angebot<br />
nämlich auf ke<strong>in</strong>en Fall verstecken.<br />
CHRISTIAN LÜCKER<br />
Anreise und Tramreise<br />
Von Deutschland aus steuern verschiedene Flugl<strong>in</strong>ien<br />
Riga an, zum Beispiel das Unternehmen<br />
„Air Baltic“, das sich auf Flüge <strong>in</strong> den baltischen<br />
Raum spezialisiert hat. Riga ist auch e<strong>in</strong> guter<br />
Ausgangspunkt, um die anderen beiden lettischen<br />
Straßenbahnbetriebe zu besuchen.<br />
Daugavpils (Dünaburg) im Osten des Landes ist<br />
mit e<strong>in</strong>er täglichen Eisenbahnverb<strong>in</strong>dung zu erreichen.<br />
In der zweitgrößten Stadt Lettlands fahren<br />
überwiegend die sehr rustikalen lettischen<br />
RWS-6 sowie russische KTM-5, aber auch ehemalige<br />
Schwer<strong>in</strong>er T3D.<br />
Liepaja (Libau) an der Küste im Westen ist am<br />
besten mit dem Bus angebunden. Dort s<strong>in</strong>d ausschließlich<br />
KT4SU und KT4D im E<strong>in</strong>satz, letztere<br />
aus Erfurt, Cottbus und Gera.<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
35
Fahrzeuge<br />
Samba <strong>in</strong> Mülheim<br />
60 Jahre Großraumwagen l<strong>in</strong>ks und rechts der Ruhr Am 19. Februar 1954 g<strong>in</strong>g der erste<br />
vierachsige Großraumwagen mit ungewohnt großer Aufnahmefläche <strong>in</strong> Mülheim an der Ruhr <strong>in</strong><br />
<strong>Die</strong>nst. Elf solche Trieb- und 13 Beiwagen prägten vier Jahrzehnte die dortigen Meterspurgleise<br />
Anfang der 1950er-Jahre war man<br />
auch <strong>in</strong> Mülheim an der Ruhr wieder<br />
wer: Das Wirtschaftswunder<br />
verlieh e<strong>in</strong> neues Selbstbewusstse<strong>in</strong>,<br />
der Sambatanz aus Brasilien erreichte<br />
große Popularität und die deutschen Fußballer<br />
errangen zum ersten Mal den Weltmeistertitel.<br />
In diese Zeit fiel die Aufstockung<br />
und Verjüngung des Wagenparks.<br />
<strong>Die</strong> Betriebe der Stadt Mülheim an der<br />
Ruhr beobachteten die Entwicklung neuer<br />
Straßenbahnwagen sehr genau. <strong>Die</strong> Landesausstellung<br />
„Schiene und Straße“ <strong>in</strong> der<br />
Nachbarstadt Essen vom 8. bis zum 23.<br />
September 1951 zeigte die neuesten Entwicklungen<br />
im Verkehrsbereich und aus der<br />
Industrie. Während die Deutsche Bundesbahn<br />
ihre größte Dampflok <strong>in</strong> Form der<br />
umgebauten 05 003 präsentierte, stellten<br />
die Hersteller von Straßenbahnfahrzeugen<br />
die ersten Großraumzüge für Hannover,<br />
Düsseldorf und Essen vor. Als E<strong>in</strong>richtungswagen<br />
waren die 17,1 Tonnen schweren,<br />
14,10 Meter langen und 2,20 Meter<br />
breiten Fahrzeuge (<strong>in</strong> Düsseldorf 2,35 Meter<br />
breit) mit den elektrisch angetriebenen<br />
neuen Düwag-Falttüren nur auf der rechten<br />
Seite ausgestattet. Mit „nur“ e<strong>in</strong>em Fahrerstand<br />
benötigten sie an den Endstationen<br />
zum Wenden entsprechend Gleisschleifen<br />
oder Umsetzdreiecke. Das Abfertigen der<br />
Fahrgäste erfolgte nach dem <strong>in</strong> den USA<br />
praktizierten Fahrgastfluss-System: Nach<br />
dem E<strong>in</strong>stieg an der großen Heckplattform<br />
verkaufte der Schaffner von se<strong>in</strong>em fest <strong>in</strong>stallierten<br />
Schaffnersitzplatz die Fahrschei-<br />
36 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Mülheims Großraumwagen<br />
RECHTS E<strong>in</strong> vom<br />
Tw 229 geführter<br />
Mülheimer Großraumzug<br />
nimmt auf<br />
der Fahrt nach Mülheim<br />
am 26. März<br />
1973 an der Haltestelle<br />
Hamburger<br />
Straße <strong>in</strong> Essen mehrere<br />
Fahrgäste auf.<br />
Seit dem 28. Mai<br />
1977 verkehrt hier<br />
auf dem Mittelstreifen<br />
der A40 die L<strong>in</strong>ie<br />
U18 auf Normalspur<br />
LINKS Fabrikneue Großraumwagen<br />
warten im<br />
alten Mülheimer Betriebs<br />
hof an der Friedrich-Ebert-Straße<br />
auf<br />
ihren E<strong>in</strong>satz auf den<br />
mit der EVAG betriebenen<br />
Geme<strong>in</strong>schaftsl<strong>in</strong>ien<br />
8 und 18<br />
SLG. AXEL REUTHER (2)<br />
FRITZ ORWAT,<br />
SLG. BERND OEHLERT<br />
UNTEN Der Fahrgastraum<br />
dieser Vierachser<br />
präsentiert sich<br />
mit der Bestuhlung<br />
für den Berufs -<br />
verkehr. <strong>Die</strong> Geräumigkeit<br />
lässt den<br />
Vergleich mit e<strong>in</strong>er<br />
Samba-Tanzfläche zu<br />
ne und fertigte den Wagen ab. Zum Aussteigen<br />
waren die doppelte Mitteltür sowie<br />
die E<strong>in</strong>zeltür beim Fahrer vorgesehen.<br />
<strong>Die</strong> Vorbilder der Mülheimer Wagen<br />
Der ausgestellte Essener Wagen 513 war mit<br />
der gleichen schräg gestellten Frontscheibe<br />
ausgerüstet wie das Fahrzeug 301 für den<br />
Straßenbahnbetrieb <strong>in</strong> Hannover. Bis 1953<br />
nahm die Süddeutsche Eisenbahngesellschaft,<br />
Abteilung Essener Straßenbahn, sechs<br />
weitere Triebwagen dieser Bauform <strong>in</strong> Betrieb.<br />
Dabei hatte sich die SEG schon maßgeblich<br />
an der Entwicklung der Großraumwagen<br />
<strong>in</strong> den frühen 1930er-Jahren beteiligt:<br />
Sie stellte <strong>in</strong> Essen 1933 zwei Prototypen<br />
vierachsiger Zweirichtungs-Triebwagen mit<br />
dem neuartigen Tandemantrieb der Waggonfabrik<br />
Uerd<strong>in</strong>gen als Tw 503 und 504 <strong>in</strong><br />
<strong>Die</strong>nst (siehe SM 4/2014, Seiten 48ff.) Hierbei<br />
trieb e<strong>in</strong> längsliegender Motor über Kardangelenke<br />
und spiralverzahnte Räder beide<br />
Achsen der Drehgestelle an. In den Jahren<br />
1939 und 1940 erhielt Mülheims Nachbarstadt<br />
20 ähnliche, aber nicht identische vier-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
37
Fahrzeuge<br />
Der erstgelieferte Mülheimer Großraumwagen – Tw 220 – hat im April 1957 mit e<strong>in</strong>em Beiwagen<br />
die Haltestelle Mülheim-Stadtmitte <strong>in</strong> Richtung Essen verlassen<br />
PETER BOEHM, SLG. AXEL REUTHER<br />
<strong>Die</strong> ersten Nachkriegsjahre <strong>in</strong> Mülheim<br />
Unmittelbar nach dem Ende der Kampfhandlungen<br />
im Ruhrgebiet begann <strong>in</strong> Mülheim der Wiederaufbau.<br />
<strong>Die</strong> Besatzungsmacht und Stadtverwaltung<br />
teilten die Bediensteten der Betriebe der Stadt Mülheim<br />
an der Ruhr am 14. April 1945 zu Reparaturarbeiten<br />
an den Gleisen und Fahrzeugen e<strong>in</strong>. Nur<br />
wenige Strecken waren befahrbar, von den 120<br />
Trieb- und Beiwagen waren 33 Fahrzeuge mehr<br />
oder weniger betriebsbereit. Zum Instandsetzen der<br />
Fahrzeuge mangelte es allerd<strong>in</strong>gs an Materialien.<br />
Hier war Improvisation gefragt. Mit Loren- und Güterwagen<br />
der Straßenbahn fuhren die Männer den<br />
Trümmerschutt ab. <strong>Die</strong> Mitarbeiter leisteten Unvorstellbares,<br />
da bis zum Ende des Jahres 1945 fast alle<br />
Straßenbahnstrecken wieder <strong>in</strong> Betrieb genommen<br />
werden konnten – bis auf e<strong>in</strong>ige Abschnitte im<br />
achsige Wagen. <strong>Die</strong> Entwicklung solcher<br />
Fahrzeuge setzte die ab 1935 zur Waggonfabrik<br />
Uerd<strong>in</strong>gen gehörende Düsseldorfer<br />
Waggonfabrik AG (Düwag) 1949 fort.<br />
Stadtteil Styrum, die nach Brückensprengungen<br />
nicht erreichbar waren. Im Jahr 1946 beförderte die<br />
Straßenbahn <strong>in</strong> Mülheim bereits wieder 27 Millionen<br />
Fahrgäste. Nach der Währungsreform am 20.<br />
Juni 1948 besserten sich die Verhältnisse. <strong>Die</strong> Wiederherstellung<br />
der Strecken gipfelten im Netzanschluss<br />
e<strong>in</strong>er neuen Siedlung <strong>in</strong> Oberdümpten im<br />
Jahre 1952, die heute noch von der L<strong>in</strong>ie 102 bedient<br />
wird. Der Kauf von zehn KSW-Trieb- und fünf<br />
passenden Beiwagen sowie fünf Aufbaumotorwagen<br />
l<strong>in</strong>derte bis 1949 die Kriegsverluste. Inzwischen<br />
zählte der Verkehrsbetrieb jährlich knapp 32 Millionen<br />
Fahrgäste pro Jahr, die er mit veralteten, oft<br />
notdürftig reparierten Zweiachserzügen beförderte.<br />
Ersatz sowie e<strong>in</strong> höheres Platzangebot durch Neubaufahrzeuge<br />
waren dr<strong>in</strong>gend notwendig.<br />
<strong>Die</strong> ersten Bestellungen aus Mülheim<br />
Nachdem der überarbeitete Tandemantrieb<br />
mit Achshohlwellen statt der zuvor verwendeten<br />
Pendelrollenlager die Serienreife erlangt<br />
hatte, bestellten die Betriebe der Stadt Mülheim<br />
an der Ruhr bei der Düwag zunächst<br />
sechs Großraumwagen für E<strong>in</strong>richtungsbetrieb<br />
zum Stückpreis von gut 160.000 DM,<br />
den elektrischen Teil fertigte Siemens. Zu dieser<br />
Zeit hielt man E<strong>in</strong>richtungswagen für<br />
komfortabler als Zweirichter, da sie durch die<br />
geschlossene Bauweise auf der l<strong>in</strong>ken Seite<br />
zugluftfrei waren und mehr Sitzplätze anboten.<br />
Ohne e<strong>in</strong>en zweiten Fahrerplatz samt<br />
Fahrschalter kamen sie auch etwas preiswerter<br />
daher. Der erste Wagen – <strong>in</strong> selbsttragender<br />
Stahlleichtbauweise hergestellt – nahm am<br />
19. Februar 1954 <strong>in</strong> Mülheim den <strong>Die</strong>nst auf.<br />
Zum E<strong>in</strong>satz kamen die neuen Fahrzeuge mit<br />
den Betriebsnummern 220 bis 225 auf den<br />
mit Essen betriebenen Geme<strong>in</strong>schaftsl<strong>in</strong>ien 8<br />
und 18 zunächst solo. An den Endstellen dieser<br />
L<strong>in</strong>ien – <strong>in</strong> Mülheim-Uhlenhorst und <strong>in</strong><br />
Essen-Steele bzw. bei der Verstärkerl<strong>in</strong>ie 8 <strong>in</strong><br />
Essen am Porscheplatz – gab es Gleisschleifen.<br />
Im Mülheimer Gebiet fuhren die neuen Wagen<br />
ab der zweiten Hälfte des Jahres 1954 auf<br />
der L<strong>in</strong>ie 13, nachdem an der Duisburger<br />
Straße/Akazienallee e<strong>in</strong> Gleisdreieck e<strong>in</strong>gerichtet<br />
war und die Endstelle Hauptfriedhof<br />
e<strong>in</strong>e Gleisschleife erhalten hatte. Zum Wenden<br />
<strong>in</strong> Dreiecken verfügten die Fahrzeuge<br />
über entsprechende Heckfahrschalter.<br />
Technische Details der Wagen<br />
Stolz erwähnten die Mülheimer die <strong>in</strong> ihrer<br />
Heimatstadt produzierten Bauteile der neuen<br />
Wagen: die von den Mülheimer Eisenwerken<br />
hergestellten Getriebe und die von der Firma<br />
Neumann gelieferten Lautsprecheranlagen.<br />
<strong>Die</strong> Großraumwagen boten 29 gepolsterte<br />
Sitz- und etwa 80 Stehplätze. Fahrer und<br />
Schaffner führten ihre Tätigkeiten jetzt im Sitzen<br />
aus, während sie zuvor ihre Arbeit täglich<br />
bis zu zehn Stunden stehend verrichtet hatten.<br />
Erstmals steuerten die Fahrer diese Fahrzeuge<br />
nicht mit e<strong>in</strong>er Fahrkurbel, sondern<br />
bedienten den Doppelnockenfahrschalter<br />
mit Schalthilfe über e<strong>in</strong>en Fahrknüppel, wobei<br />
die Bewegung nach vorne „Fahren“ und<br />
nach h<strong>in</strong>ten „Bremsen“ bedeutete (mit dem<br />
Nullkontakt <strong>in</strong> der Mitte der Knüppelführung).<br />
<strong>Die</strong>se Fahrschalter, ausgestattet mit<br />
20 Fahr- (davon elf <strong>in</strong> Serie, acht parallel<br />
und e<strong>in</strong>e mit 30 Prozent Feldschwächung)<br />
sowie 14 Bremsstufen, waren zu dieser Zeit<br />
die modernsten ihrer Art: Sie benötigten im<br />
Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit viel<br />
weniger Raum und Gewicht als die älteren<br />
Fahrschalter, weil durch die Doppelnockenschalterbauart<br />
auf die sogenannte Fahr-<br />
Brems-Walze verzichtet werden konnte, was<br />
wiederum Unterhaltskosten e<strong>in</strong>sparte.<br />
Als Antrieb kamen je zwei Motoren des<br />
Typs GB 191 der Siemens-Schuckert-Werke<br />
AG mit e<strong>in</strong>er Leistung von je 95 Kilowatt<br />
zum E<strong>in</strong>bau. <strong>Die</strong> Bremse<strong>in</strong>richtung bestand<br />
aus e<strong>in</strong>er elektrischen Kurzschlussbremse,<br />
elektromagnetischen Schienenbremsen und<br />
e<strong>in</strong>er Handhebelbremse, die durch hydraulische<br />
Druckübertragung auf die Bremstrom-<br />
Der Tw 224 kommt am 31. August 1974 von der<br />
unterirdischen Haltestelle Mülheim Hbf und erklimmt<br />
die provisorische Rampe zur Fahrt nach<br />
Mülheim-Heißen Kirche<br />
WOLFGANG MEIER<br />
38 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Mülheims Großraumwagen<br />
meln wirkten. Zum Auslösen der Schienenbremse<br />
und des Sandstreuers stand dem<br />
Fahrer am Armaturenbrett e<strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ationshebel<br />
zur Verfügung, der mit der rechten<br />
Hand zu bedienen war. <strong>Die</strong> Fronten der neuen<br />
Fahrzeuge verfügten nach Düsseldorfer<br />
Vorbild über e<strong>in</strong>e geradestehende Panorama-W<strong>in</strong>dschutzscheibe.<br />
Ab Werk besaßen<br />
die Wagen von der Bergischen Stahl<strong>in</strong>dustrie<br />
<strong>in</strong> Remscheid ab den 1940er-Jahren hergestellte<br />
automatische Kompaktkupplungen.<br />
Mülheim-Rathausmarkt: Bw 300 – der 1958 erstgelieferte Bw <strong>in</strong> Zweirichtungsvariante – ver stärkt<br />
am 12. April 1962 auf L<strong>in</strong>ie 15 nach Oberhausen den GT6 Nr. 253 WILHELM ECKERT, SLG. WOLFGANG MEIER<br />
E<strong>in</strong>satz der Mülheimer Großraumwagen 1958<br />
L<strong>in</strong>ie 8: Mülheim-Uhlenhorst – Essen, Porscheplatz (bei zwei Mülheimer und zwei Essener Kursen)<br />
L<strong>in</strong>ie 11: Mülheim-Hauptfriedhof – Essen-Stadtwaldplatz (über Essen-Borbeck; bei dieser L<strong>in</strong>ie vermischte<br />
sich der Betrieb mit Zweiachserzügen)<br />
L<strong>in</strong>ie 13: Flughafen – Raffelberg, Duisburger Straße (mit zwei Solowagen bei drei Kursen)<br />
L<strong>in</strong>ie 18: Mülheim-Uhlenhorst – Essen-Steele (vier Mülheimer sowie zwei Essener Züge)<br />
<strong>Die</strong> Anschlusslieferungen<br />
Da sich die neuen Fahrzeuge gut bewährten,<br />
erteilten die Betriebe der Stadt e<strong>in</strong>en Anschlussauftrag<br />
von fünf weiteren Triebwagen<br />
und vier Großraumbeiwagen, die zwischen Januar<br />
und März 1955 als Tw 226 bis 230 und<br />
Bw 186 bis 189 e<strong>in</strong>trafen. <strong>Die</strong> zweite Großraumwagenserie<br />
war ebenfalls mit e<strong>in</strong>er vornehm<br />
wirkenden Innenraum-Holzverkleidung<br />
versehen, aber mit 33 Sitzplätzen ausgerüstet.<br />
Davon waren zehn Doppelsitze als Stapelsitze<br />
ausgeführt, die <strong>in</strong> der Hauptverkehrszeit<br />
auf die nebenstehenden Stühle gestülpt werden<br />
konnten. Durch den Entfall der zehn Sitzplätze<br />
gewann man 23 Stehplätze h<strong>in</strong>zu.<br />
<strong>Die</strong> gut 40.000 DM teuren Beiwagen mit<br />
e<strong>in</strong>em Gewicht von knapp zehn Tonnen<br />
verfügten über die gleiche Sitzplatzanordnung.<br />
Neu war jedoch, dass deren Innenraum<br />
nicht mit Holz, sondern ähnlich wie<br />
bei Omnibussen mit Kunststoff verkleidet<br />
war. Lackiert waren sowohl die Trieb- als<br />
auch Beiwagen <strong>in</strong> Hellelfenbe<strong>in</strong>, unterbrochen<br />
mit e<strong>in</strong>em breiten tannengrünen Farbband<br />
unterhalb der Fenster, das wiederum<br />
mit Chromleisten e<strong>in</strong>gefasst war.<br />
Im Jahre 1958 lieferte die Düwag vier weitere<br />
Großraum-E<strong>in</strong>richtungsbeiwagen, welche<br />
die Betriebe als Bw 190 bis 193 <strong>in</strong> <strong>Die</strong>nst<br />
stellten, so dass jetzt acht Mülheimer Großraumzüge<br />
vornehmlich auf den mit der Essener<br />
Verkehrs-AG (EVAG) betriebenen Geme<strong>in</strong>schaftsl<strong>in</strong>ien<br />
zum E<strong>in</strong>satz kamen – siehe<br />
Kasten. Auf drei Mülheimer Kursen der L<strong>in</strong>ie<br />
11 konnten demnach höchstens zwei Mülheimer<br />
Großraumzüge fahren, die Essener<br />
hatten hier fünf Kurse zu besetzten.<br />
Der Tw 228 biegt im Juni 1973 mit e<strong>in</strong>em ehemaligen<br />
Bogestra-Beiwagen im Zuge der<br />
Oberen Saarland straße auf der L<strong>in</strong>ie 13 (seit<br />
1980 VRR-L<strong>in</strong>ie 110) <strong>in</strong> die Haltestelle Witthausstraße<br />
e<strong>in</strong> GÜNTER HAPPEL, SLG. BERND OEHLERT<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
39
Fahrzeuge<br />
Der Tw 227 bedient im Dezember 1985 <strong>in</strong> Richtung Mülheim die Haltestelle Siegfriedbrücke. Der<br />
Gelenkwagen vom Typ M8C fährt als Gegenzeug <strong>in</strong> Richtung Friesenstraße REINHARD SCHULZ<br />
Zu erwähnen ist, dass die Essener bis 1956<br />
<strong>in</strong>sgesamt 50 Triebwagen mit schwächerer<br />
Motorleistung erhielten, weil sie zunächst auf<br />
die Doppeltraktion setzten, aber auch entsprechende<br />
Leichtbaubeiwagen <strong>in</strong> Betrieb<br />
nahmen. Bis 1977 rüstete die EVAG dann 20<br />
Großraumwagen mit je zwei 100-Kilowatt-<br />
Motoren für den E<strong>in</strong>satz mit Großraumbeiwagen<br />
um. Ebenfalls im Jahre 1958 erhielt<br />
Mülheim die fünf Zweirichtungsanhänger 300<br />
bis 304 zur Verstärkung von gleichzeitig <strong>in</strong><br />
<strong>Die</strong>nst gestellten Gelenkwagen.<br />
Auch aus der westlichen Nachbarstadt<br />
kamen weitere Großraumwagen nach Mülheim:<br />
Auf der Normalspurl<strong>in</strong>ie 2 setzte die<br />
Duisburger Verkehrsgesellschaft von DU-<br />
Hochfeld Bahnhof-Süd bis zum Mülheimer<br />
Rathaus auf acht Kursen regelmäßig e<strong>in</strong>en<br />
ihrer aus Wagen der Baujahre 1952 und<br />
1954 gebildeten vier Großraumzüge e<strong>in</strong>.<br />
Das war aber nicht von langer Dauer, da<br />
sich die Duisburger auf die Anschaffung von<br />
Gelenkwagen konzentrierten und 1962 ihre<br />
Vierachser entsprechend erweitern ließen.<br />
Für die von den Essenern vom 18. Mai<br />
1952 bis zum 8. April 1958 werktäglich betriebene<br />
Schnellbahnl<strong>in</strong>ie D (Durchgangsl<strong>in</strong>ie<br />
von Essen Hbf bis Mülheim Stadtmitte<br />
und zurück) genügte e<strong>in</strong> Kurs, der im Stundentakt<br />
mit e<strong>in</strong>em Großraumwagen <strong>in</strong> 25<br />
M<strong>in</strong>uten beide Zentren mite<strong>in</strong>ander verband<br />
und an der Stadtgrenze Kurswagen der L<strong>in</strong>ien<br />
8 und 18 überholen konnte – bei e<strong>in</strong>em<br />
Zeitgew<strong>in</strong>n von zehn M<strong>in</strong>uten. Mit dem Beg<strong>in</strong>n<br />
der Ausbauarbeiten auf der Kruppstraße<br />
stellte die EVAG diese L<strong>in</strong>ie e<strong>in</strong>. Ab 1963<br />
bewährten sich die Großraumzüge der L<strong>in</strong>ien<br />
8 und 18 auf dem eigenen Bahnkörper der<br />
nun autobahnähnlich ausgebauten Kruppstraße<br />
im Zuge der heutigen Autobahn A 40<br />
mit Geschw<strong>in</strong>digkeiten von bis zu 70 km/h.<br />
Nachbestellung 1956 abgelehnt<br />
und Modernisierungen<br />
Während der Internationale Rat für Gesellschaftstanz<br />
den Samba im Jahre 1959 <strong>in</strong> das<br />
Turnierprogramm der late<strong>in</strong>amerikanischen<br />
Tänze aufnahm, sank das Interesse der Straßenbahnbetriebe<br />
an Vierachsern, da zu dieser<br />
Zeit bereits fassungsstärkere und leistungsfähigere<br />
Gelenkwagen zur Verfügung standen.<br />
So lehnten die Betriebe der Stadt Mülheim an<br />
der Ruhr im Jahr 1956 e<strong>in</strong> Angebot der Düwag<br />
zur Lieferung von fünf weiteren Großraum-Triebwagen<br />
ab. <strong>Die</strong>se Fahrzeuge wären<br />
mit den moderneren, größeren Seitenscheiben<br />
ausgestattet gewesen und hätten die Betriebsnummern<br />
231 bis 235 getragen.<br />
<strong>Die</strong> elf vorhandenen Großraumtriebwagen<br />
waren <strong>in</strong> Mülheim jedoch unverzichtbar.<br />
Analog zur Modernisierung der ab 1958 angeschafften<br />
Mülheimer Gelenkwagen unterzog<br />
sie der Verkehrsbetrieb mehreren Umbauten.<br />
So erhielten alle Wagen ab 1968<br />
Der aus Tw 221 und Bw 183 (ex Bogestra) gebildete Großraumzug verkehrt am 19. Mai 1979 auf L<strong>in</strong>ie 8 als Verstärkerzug bis zum Betriebshof<br />
Mülheim-Broich, hier aufgenommen <strong>in</strong> der Le<strong>in</strong>weberstraße im Mülheimer Zentrum<br />
BERND OEHLERT<br />
40 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Mülheims Großraumwagen<br />
elektromechanische Federspeicherbremsen<br />
der Bauart Raco. In den Werkstätten von<br />
Mülheim und der EVAG erfolgte bis 1969<br />
auch den Umbau aller Wagen auf schaffnerlosen<br />
Betrieb. Der heutige Museumstriebwagen<br />
227 diente im Jahre 1964 als Prototyp<br />
für den Umbau zum E<strong>in</strong>mannwagen. Dabei<br />
entfiel der Schaffnerplatz, stattdessen erhielt<br />
der Vierachser Fahrsche<strong>in</strong>entwerter und automatisierte<br />
Türschließvorrichtungen. <strong>Die</strong><br />
Befestigung der ab Werk am rechten Türholm<br />
angebrachten vorderen l<strong>in</strong>ken E<strong>in</strong>gangstür<br />
wechselte nach l<strong>in</strong>ks, um dem Fahrpersonal<br />
bei an Haltestellen geöffneter Tür<br />
mehr Bewegungsfreiheit für den Fahrsche<strong>in</strong>verkauf<br />
zu ermöglichen. <strong>Die</strong> Armaturenbretter<br />
erhielten Piktogrammtaster, den E<strong>in</strong>bau<br />
e<strong>in</strong>er Funkanlage kennzeichnete fortan<br />
e<strong>in</strong> schwarzes „F“ auf der Fahrzeugfront.<br />
Äußerlich waren die Wagen nach der Modernisierung<br />
an dreiteiligen Streifen unterhalb<br />
der Fenster zu erkennen, die pflege<strong>in</strong>tensiven<br />
Chromleisten entfielen. Außerdem rüstete das<br />
Werkstattpersonal alle Großraumwagen mit<br />
automatischen Kupplungen der Bauart Scharfenberg<br />
aus. <strong>Die</strong>se verbanden nicht nur die<br />
Wagen, sondern gleichzeitig auch die Lichtund<br />
Bremsleitungen mite<strong>in</strong>ander. Alle Großraumbeiwagen<br />
bekamen zudem Signalan -<br />
lagen, Notbremse<strong>in</strong>richtungen und e<strong>in</strong>e elektrische<br />
Abreißbremse; der Großteil der<br />
Triebwagen erhielt e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>holmstromabnehmer<br />
der Bauart Stemmann BS 80.<br />
Am Tw 230 erprobten die Verkehrsbetriebe<br />
e<strong>in</strong>e von der Firma Hann<strong>in</strong>g & Kahl entwickelte<br />
hydraulische Federspeicherbremse;<br />
am Tw 229 testeten sie von Juli 1966 bis zum<br />
August 1972 die elektronische Fahrschaltersteuerung<br />
der Bauart Simatic. <strong>Die</strong> fünf Zweirichtungsbeiwagen<br />
bauten die Betriebe ab<br />
1963 ebenfalls auf schaffnerlosen Betrieb um.<br />
Nach E<strong>in</strong>stellung der L<strong>in</strong>ie 15 auf Oberhausener<br />
Gebiet im Jahr 1971 rüstete man sie zu<br />
E<strong>in</strong>richtungswagen um und teilte ihnen danach<br />
die Betriebsnummern 194 bis 198 zu.<br />
Weitere Beiwagen von der<br />
Bogestra und neuer Lack<br />
Wegen des Bedarfes an zusätzlichen Beiwagen<br />
kauften die Betriebe der Stadt Mülheim<br />
an der Ruhr von der Bochum-Gelsenkirchener<br />
Straßenbahn AG im Jahre 1971 fünf<br />
Großraumanhänger der Baujahre 1955/56<br />
an, die dort als Zweirichtungsfahrzeuge mit<br />
den Betriebsnummern 507 bis 509, 513 und<br />
514 e<strong>in</strong>gesetzt worden waren. Nach der Anpassung<br />
an die Mülheimer Betriebsverhältnisse<br />
und dem Umbau auf schaffnerlosen<br />
E<strong>in</strong>richtungsverkehr g<strong>in</strong>gen sie <strong>in</strong> Mülheim<br />
zwischen Juni 1972 und Januar 1973 als Wagen<br />
181 bis 185 <strong>in</strong> Betrieb. Sie unterschieden<br />
sich von den e<strong>in</strong>heimischen Wagen durch ihre<br />
Türanordnung 2-1-1 (von h<strong>in</strong>ten aus gezählt),<br />
boten 37 Sitzplätze aus Durofol-Werkstoff<br />
<strong>in</strong> Abteilform und 78 Stehplätze. An-<br />
Am 3. November 1979<br />
verlässt Tw 224 mit<br />
e<strong>in</strong>em ehema ligen<br />
Bogestra-Beiwagen<br />
die Stadtmitte am<br />
Berl<strong>in</strong>er Platz zum<br />
Uhlenhorst<br />
BERND OEHLERT<br />
Das Pr<strong>in</strong>zip des<br />
Fahrgastflusses<br />
entnahmen die<br />
Fahrgäste ab 1955<br />
den Fahrplänen<br />
SLG. BERND OEHLERT<br />
fangs waren sie noch beige lackiert, ab 1976<br />
bekamen sie die neue gelbe Farbgebung und<br />
verstärkten auf allen Mülheimer L<strong>in</strong>ien das<br />
Angebot sowohl h<strong>in</strong>ter vierachsigen Großraumwagen<br />
als auch h<strong>in</strong>ter Sechsachsern.<br />
Nach erfolgter Hauptuntersuchung kam<br />
mit Tw 222 am 1. Mai 1975 der erste Großraumtriebwagen<br />
<strong>in</strong> gelber Farbgebung auf<br />
der L<strong>in</strong>ie 13 <strong>in</strong> Betrieb. Allerd<strong>in</strong>gs wies er<br />
im Gegensatz zum im Jahre 1974 umlackierten<br />
Gelenkwagen 254 und dem <strong>in</strong>zwischen<br />
gelb lackierten Bw 198 e<strong>in</strong> gelbes<br />
Dach auf, um auch diese Farbvariante zu<br />
testen. Nach e<strong>in</strong>er Woche ließ die Betriebsleitung<br />
das Dach des Tw 222 allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong>s<br />
pflegeleichtere Grau ändern. Nach diesem<br />
Schema lackierten die Verkehrsbetriebe<br />
fortan alle Straßenbahnwagen im Rahmen<br />
von Hauptuntersuchungen entsprechend<br />
neu. Lediglich die Tw 223 und 225 sowie<br />
mehrere Großraumbeiwagen verkehrten bis<br />
zu ihrem Ausscheiden mit dem alten hellelfenbe<strong>in</strong>-farbenen<br />
Anstrich.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus erhielten alle Großraumwagen<br />
ab Ende der 1970er-Jahre neue Vordertüren<br />
mit fast bis <strong>in</strong> Fußbodenhöhe herunterreichender<br />
Verglasung.<br />
<strong>Die</strong> letzten E<strong>in</strong>satzjahre<br />
<strong>Die</strong> Tw 222 und 225 setzten die Betriebe der<br />
Stadt Mülheim bei Bedarf als Fahrschulwagen<br />
e<strong>in</strong>. Nach dem Beg<strong>in</strong>n des Umbaus der Kruppstraße<br />
auf Stadtbahnbetrieb beschränkte sich<br />
das E<strong>in</strong>satzgebiet der Vierachser ab dem<br />
7. April 1974 fast ausschließlich auf das<br />
Mülheimer Straßenbahnnetz. Nur auf der L<strong>in</strong>ie<br />
104 kamen die Wagen noch bis auf Essener<br />
Gebiet. Der Tw 225 und der Bw 187 fuhren<br />
allerd<strong>in</strong>gs im Rahmen e<strong>in</strong>er Sonderfahrt<br />
am 13. Juli 1987 durch das westliche Ruhrgebiet,<br />
hauptsächlich durch Mülheim und Essen.<br />
Im Frühjahr 1982 führte die Ruhrgebietstour<br />
sogar bis zum Hauptbahnhof von<br />
Reckl<strong>in</strong>ghausen. Der aus den frisch lackierten<br />
Tw 230 und Bw 189 gebildete Zug verkehrte<br />
an diesem Tag als e<strong>in</strong>e der vielen Abschiedsfahrten<br />
zur Vestischen Straßenbahn.<br />
Während die letzten Essener Vierachser<br />
im November 1982 den Weg des alten Eisens<br />
g<strong>in</strong>gen, schieden die Mülheimer Großraumbeiwagen<br />
ab 1981 und die Großraumtriebwagen<br />
ab 1984 aus. Nach e<strong>in</strong>em<br />
Unfall musterten die Betriebe im Mai 1984<br />
als erstes den Tw 223 aus. Im September<br />
1984 traf es dann die gelb lackierten Tw<br />
221 und 224. <strong>Die</strong> letzten beiden Großraumtriebwagen<br />
blieben bis zur Anlieferung<br />
der Niederflur-Wagenserie 201 bis 204 im<br />
Jahre 1995 <strong>in</strong> Betrieb.<br />
Den Tw 230 und die Bw 185 sowie 186<br />
gaben die Betriebe 1995 an e<strong>in</strong> im Aufbau<br />
bef<strong>in</strong>dliches Museum nach Schwerte ab. Sie<br />
kehrten später auf unerwartete Weise <strong>in</strong><br />
den Regeldienst zurück: Nach der Schließung<br />
des Museums übernahm die drei<br />
Fahrzeuge im Dezember 1998 der Straßen-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
41
Fahrzeuge<br />
Am 31. August 1997<br />
f<strong>in</strong>den anlässlich<br />
des 100. Jubiläums<br />
der Mülheimer<br />
Straßenbahn auch<br />
Stadtrundfahrten<br />
mit dem Museums -<br />
triebwagen 227<br />
statt. Er startet am<br />
Betriebshof, der im<br />
Rahmen e<strong>in</strong>es Tages<br />
der offenen Tür für<br />
alle Interessierte<br />
geöffnet ist<br />
BERND OEHLERT (2)<br />
bahnbetrieb im rumänischen Arad, um damit<br />
se<strong>in</strong>en Wagenpark weiter zu modernisieren.<br />
Auch der zunächst <strong>in</strong> Mülheim als<br />
Museumsbeiwagen vorgesehene Bw 183<br />
kam im Jahr 2000 nach Rumänien. <strong>Die</strong>se<br />
vier Fahrzeuge standen dort bis zum Jahr<br />
2009 <strong>in</strong> Betrieb.<br />
Das Museumsstück Tw 227<br />
Der Tw 227 wird <strong>in</strong> Mülheim als betriebsfähiges<br />
Museumsfahrzeug vorgehalten, seit<br />
1993 trägt er wieder das Farbschema von<br />
1964. E<strong>in</strong>en se<strong>in</strong>er ersten E<strong>in</strong>sätze als historischer<br />
Wagen absolvierte er – noch behängt<br />
mit dem ehemals Bochumer Bw 183 – anlässlich<br />
der 100-Jahr-Feier der Essener Straßenbahn<br />
am 22. August 1993 auf der Ausstellung<br />
<strong>in</strong> der Schwer<strong>in</strong>er Straße und beim<br />
anschließenden Wagenkorso. Weitere E<strong>in</strong>sätze<br />
fanden am 31. August 1997 zur 100-<br />
Jahr-Feier der Mülheimer Straßenbahn auf<br />
e<strong>in</strong>er Sonderl<strong>in</strong>ie zwischen Betriebshof und<br />
Am 17. Mai 1999 –<br />
dem „Vatertag“ –<br />
genießen die Fahrgäste<br />
im Tw 227 e<strong>in</strong>e Ruhr -<br />
gebietsrundfahrt<br />
Länge<br />
Breite<br />
Drehzapfenabstand<br />
Leistung<br />
Masse<br />
Daten & Fakten: Mülheims Großraumwagen<br />
Baujahr Betriebsnummern Stückzahl<br />
1954 Tw 220 bis 225 6<br />
1955 Tw 226 bis 230 5<br />
14,10 Meter<br />
2,20 Meter<br />
6,00 Meter<br />
2 x 95 Kilowatt<br />
17,1 Tonnen<br />
Baujahr Betriebsnummern Stückzahl<br />
1955 Bw 186 bis 189 4<br />
1958 Bw 190 bis 193 4<br />
1958 Bw 300 bis 304 5<br />
(ab 1965 > Bw 194 bis 198)<br />
von Bogestra 1955/56 ab 1972/73 <strong>in</strong> Mülheim 5<br />
übernommen als Bw 181 bis 185<br />
Hauptfriedhof sowie am 12. September<br />
1998 anlässlich des RÜ-Festes im Essener<br />
Stadtteil Rüttenscheid statt, als er zwischen<br />
Holsterhauser Platz und Essen-Borbeck<br />
pendelte.<br />
Inzwischen mit dem Mülheimer Stadtwappen<br />
„nachgerüstet“, kam der Museums -<br />
wagen zu Sonderfahrten im Ruhrgebiet sogar<br />
bis Wanne-Eickel. Zum 125. Jubiläum<br />
der Essener Straßenbahn verkehrte er am<br />
21. September 2013 mit Fahrpersonal der<br />
Verkehrshistorischen Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
(VHAG) der Mülheimer Verkehrsgesellschaft<br />
zwischen den Gleisschleifen Knappschaftskrankenhaus<br />
<strong>in</strong> Steele und Katernberg im<br />
Osten Essens, nachdem Technik-Spezialisten<br />
der VHAG-EVAG e.V. bei der Instandsetzung<br />
des zuvor aufgrund von Fahrschalterschäden<br />
abgestellten Wagens geholfen<br />
hatten.<br />
Aktuell steht der Mülheimer Großraumwagen<br />
ohne E<strong>in</strong>schränkung für Sonderfahrten<br />
zur Verfügung. Den Fahrdienst und<br />
die Vermietung übernehmen die Mitglieder<br />
der VHAG-MVG e.V. – dieser Vere<strong>in</strong> ist per<br />
Post auf der Duisburger Straße 78 <strong>in</strong> 45479<br />
Mülheim, im Netz unter www.mhvg.de/<br />
Service/Nostalgiefahrten.html oder unter<br />
der Telefonnummer (02 01) 82 61 455 erreichbar.<br />
Im nächsten Jahr blickt Tw 227<br />
dann auf e<strong>in</strong> „erlebnisreiches“ Sechzigjähriges<br />
zurück.<br />
BERND OEHLERT<br />
42 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Fahrzeuge<br />
<strong>Die</strong> Dortmunder Stadtwerke (DSW) setzen als e<strong>in</strong>ziger Betrieb auch dreiteilige<br />
Stadtbahnwagen B e<strong>in</strong>. Der Tw 349, hier am 1. Februar 1997 bei Westerfilde,<br />
gehört zu den elf nachträglich mit e<strong>in</strong>em Mittelteil ausgerüsteten B-Wagen<br />
CHRISTIAN WENGER<br />
<strong>Die</strong> Längsten und Jüngsten<br />
Stadtbahnwagen B <strong>in</strong> Dortmund und Bochum Seit 1986 fahren <strong>in</strong> Dortmund spezielle<br />
B-Wagen, und nur hier trifft man – seit 1996 – diesen Fahrzeugtypen auch als dreiteiligen Achtachser<br />
an. Auch die BOGESTRA orderte für ihre e<strong>in</strong>zige Normalspurl<strong>in</strong>ie <strong>in</strong>sgesamt 25 B-Wagen<br />
<strong>Die</strong> ab 1986 an die Dortmunder Stadtwerke<br />
(DSW) gelieferten B-Wagen<br />
s<strong>in</strong>d der zweiten Generation zuzurechnen.<br />
Im Vergleich zu den Lieferungen<br />
an andere Betriebe gibt es aber e<strong>in</strong>ige<br />
betriebsspezifische Besonderheiten. Zwar<br />
stammt der wagenbauliche Teil ebenfalls von<br />
der Düsseldorfer Waggon fabrik AG (Düwag),<br />
die elektrische Ausrüstung jedoch von der<br />
AEG (Motoren) und BBC/Kiepe (übrige Elektrik).<br />
<strong>Die</strong> Sitz- und Raum aufteilung ist weitgehend<br />
identisch mit den fünf 1985 nach<br />
Essen gelieferten Wagen. Am Gelenkportal<br />
bef<strong>in</strong>det sich allerd<strong>in</strong>gs auf Anordnung der<br />
Landesregierung anstelle der <strong>in</strong> Köln üblichen<br />
Längssitzbank jeweils auf e<strong>in</strong>er Seite e<strong>in</strong> Beh<strong>in</strong>dertensitz<br />
mit Aufstützhandlauf – wie<br />
auch bei den Düsseldorfer Wagen. <strong>Die</strong> erste<br />
Liefererserie für Dortmund umfasste 1986 die<br />
zehn Wagen Nr. 301 bis 310.<br />
<strong>Die</strong> Wagenkästen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Stahlleichtbauweise<br />
erstellt und entsprechen den für die<br />
meisten Betriebe gelieferten Wagen. Auch<br />
die Drehgestellbauweise ist unverändert.<br />
Das Leergewicht sank gegenüber den mit<br />
38,4 Tonnen bereits gewichtsoptimierten<br />
Essener Wagen noch e<strong>in</strong>mal im 900 Kilogramm<br />
auf 37,5 Tonnen. <strong>Die</strong> <strong>in</strong> herkömmlicher<br />
Stahlbauweise gefertigten Düsseldorfer<br />
B-Wagen der Serie 4000 wogen h<strong>in</strong>gegen<br />
43,4 Tonnen. Da die Dortmunder Fahrer<br />
ke<strong>in</strong>e Fahrausweise verkaufen, verzichteten<br />
die DSW auf die E<strong>in</strong>zeltüren an den Wagenenden.<br />
Pro Seite des Gelenkwagens stehen<br />
somit vier Doppeltüren zur Verfügung.<br />
E<strong>in</strong>e Neuheit für den B-Wagen waren die<br />
erstmals an Stelle von Schiebe- oder Falttüren<br />
verwendeten Außenschwenktüren. <strong>Die</strong>se<br />
gleichen denen der Stuttgarter Stadtbahnwagen,<br />
arbeiten sehr geräuscharm und<br />
reduzieren den Wartungsaufwand an der<br />
Mechanik erheblich. E<strong>in</strong>e Mittelstange im<br />
Bereich der Türöffnung gibt es nicht, weshalb<br />
auch für Rollstuhlfahrer und K<strong>in</strong>derwagen<br />
überall e<strong>in</strong> ungeh<strong>in</strong>derter Zugang<br />
möglich ist.<br />
Den E<strong>in</strong>stieg führte die Düwag nur zweistufig<br />
aus, da die Wagen ausschließlich an<br />
90 Zentimeter hohen Bahnsteigen verkehren<br />
sollten. E<strong>in</strong>e Klappstufe ermöglicht aber<br />
auch den Zustieg von 35 Zentimeter hohen<br />
Bahnsteigen. <strong>Die</strong> Schwenkstufen unterhalb<br />
der Schürze entfielen. An der vorderen rechten<br />
Doppeltür ist aber für den Fahrere<strong>in</strong>stieg<br />
vom Schienenniveau e<strong>in</strong> Steigbügel unterhalb<br />
der Schürze vorgesehen.<br />
Abweichende Lackierung<br />
bei erster Dortmunder Serie<br />
Bei den zehn 1986 nach Dortmund gelieferten<br />
B-Wagen g<strong>in</strong>gen die DSW erstmals vom<br />
zuvor üblichen braun/beigen Außenanstrich<br />
ab: <strong>Die</strong> Fahrzeuge trugen die Stadtfarben<br />
Rot/Weiß. <strong>Die</strong>se Lackierung wich jedoch <strong>in</strong><br />
der Ausführung vom „E<strong>in</strong>heitsanstrich“ der<br />
meisten B-Wagen ab, denn das Fensterband<br />
44 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
B-Wagen<br />
und die Rammbohle an den Stirnseiten waren<br />
weiß und die Wandflächen unterhalb der<br />
Fenster mit Ausnahme e<strong>in</strong>es schmalen weißen<br />
Absetzstreifens rot gehalten. <strong>Die</strong> Türen<br />
mit den ovalen Fensteröffnungen hatten<br />
ebenfalls e<strong>in</strong>e weiße Lackierung erhalten.<br />
Als gelungen bezeichnen Stadtbahnkenner<br />
die Fahrgastraumausstattung. Cremefarbene<br />
Seitenwände kontrastieren gut mit der<br />
braunen Holzmaserung der Fahrerraumtrennwände<br />
und Sitzverkleidungen an den<br />
Auffangräumen. <strong>Die</strong> weiße Decke mit Resopal-Oberfläche<br />
weist zwei durchgehende<br />
Leuchtbänder mit Alu-Raster-Abdeckung<br />
auf. <strong>Die</strong> Polstersitze s<strong>in</strong>d mit rotem Wollplüsch<br />
bezogen, die Haltestangen mit rotem<br />
Kunststoff ummantelt und der Fußboden<br />
besteht aus hellgrauem, rauen Spoknolbelag.<br />
E<strong>in</strong>e Novität für B-Wagen ist das Fehlen<br />
von Entwerteranlagen im Fahrgastraum,<br />
was die Verkabelung erheblich vere<strong>in</strong>facht.<br />
Da die Abfertigung <strong>in</strong> Dortmund an den<br />
Stationen mit Automaten und Entwertern<br />
erfolgt, konnte hierauf verzichtet werden.<br />
Der Fahrerraum ist ausschließlich durch<br />
e<strong>in</strong>e Drehtür <strong>in</strong> der Trennwand vom Fahrgastraum<br />
her zugänglich. <strong>Die</strong> Trennwand<br />
erhielt zusätzlich auf der l<strong>in</strong>ken Seite Glasscheiben<br />
für den Sichtkontakt zwischen<br />
Fahrer und Fahrgästen. <strong>Die</strong> auch bei Doppelzugbetrieb<br />
mögliche Sicht durch den<br />
ganzen Zug dient auch der Vorbeugung von<br />
Vandalismusschäden.<br />
<strong>Die</strong> L<strong>in</strong>iennummern- und Ziel-Rollbandbeschilderung<br />
an den Stirnseiten und an den<br />
Wagenseiten ist mit dem IBIS-Steuergerät<br />
auf dem Armaturenbrett e<strong>in</strong>zustellen. Wie<br />
auch die Kölner Wagen der zweiten Generation<br />
verfügen die Dortmunder Wagen<br />
über e<strong>in</strong>e Haltestellen-Perlschnur auf der Innenseite<br />
der wagenseitigen Anzeige, auf der<br />
e<strong>in</strong> roter Lichtpunkt die nächstfolgende<br />
Haltestelle anzeigt. E<strong>in</strong> roter Pfeil verweist<br />
auf die Fahrtrichtung.<br />
Parallelen zu anderen<br />
Stadtbahnwagen<br />
Wie die meisten B-Wagen anderer Städte erhielten<br />
die Dortmunder Fahrzeuge e<strong>in</strong>e<br />
Choppersteuerung mit Netzrückspeisung.<br />
Dazu baute die Düwag flüssigkeitsgekühlte<br />
Chopper e<strong>in</strong>. <strong>Die</strong> Antriebs- und Bremssteuerung<br />
ist <strong>in</strong> Mikroprozessortechnik erstellt.<br />
Für die Bordnetzversorgung wählte der Hersteller<br />
e<strong>in</strong>en statischen Umformer der Firma<br />
AEG. Der Antrieb ist für e<strong>in</strong>e Höchstgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
von 80 km/h ausgelegt.<br />
Der Stromabnahme dient der schon bei<br />
den Stadtbahnwagen N bewährte Scheren-<br />
Der noch fast werksneue Dortmunder Tw 302 kurz nach Aufnahme des Betriebes auf der L<strong>in</strong>ie<br />
U41 im Frühjahr 1987 am Hochbahnsteig der Haltestelle Immermannstraße AXEL REUTHER (2)<br />
<strong>Die</strong> Dortmunder L<strong>in</strong>ie U49 ist teils <strong>in</strong> Mittellage der B54 trassiert. Von e<strong>in</strong>er Brücke über diese<br />
Bundesstraße s<strong>in</strong>d Blicke auf das Dach der e<strong>in</strong>gesetzten B-Wagen möglich, hier der dreiteilige<br />
Tw 348 im April 2014 vor der Haltestelle Westfalenpark<br />
FELIX FÖRSTER<br />
E<strong>in</strong> von den DSW aus Bonn übernommener<br />
Stadtbahnzug erreicht im Oktober 2007 die<br />
Endstation Grevel der L<strong>in</strong>ie U42. <strong>Die</strong> ersten acht<br />
Bonner Wagen trugen zunächst alle Eigenwerbung<br />
der Stadtwerke <strong>in</strong> zwei Ausführungen<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
45
Fahrzeuge<br />
Ausschließlich <strong>in</strong> Dortmund fährt der<br />
B-Wagen auch <strong>in</strong> achtachsiger Version<br />
SLG. AXEL REUTHER (2)<br />
Seitenansicht und Grundriss<br />
der sechsachsigen<br />
Dortmunder B-Wagen<br />
Den seit mehr als zwei Jahrzehnten e<strong>in</strong>gesetzten B-Wagen der Bogestra sieht man ihr Alter nicht<br />
an, wie diese Aufnahme vom Juni 2014 im Untergrund von Herne zeigt<br />
CHRISTIAN LÜCKER<br />
stromabnehmer mit Doppelwippe der Firma<br />
Stemmann. Um die Möglichkeit des gegenseitigen<br />
Abschleppens zu gewährleisten, erhielten<br />
die B-Wagen die mit den N-Wagen<br />
identischen BSI-Kupplungen. <strong>Die</strong> Kupplungsachse<br />
liegt daher mit 450 Millimeter<br />
über SOK für Stadtbahnwagen recht niedrig.<br />
B 80 C und N8C waren dann jedoch nur<br />
mechanisch kuppelbar, nicht elektrisch.<br />
Bei den ab Januar 1991 gelieferten Serien<br />
(das Baujahr der ersten Wagen war noch<br />
1990) kam es zu e<strong>in</strong>igen Änderungen gegenüber<br />
der ersten Serie von 1986. Während im<br />
technischen Bereich nur der E<strong>in</strong>bau e<strong>in</strong>es<br />
Fehlerdiagnose-Gerätes im Fahrerstand zu<br />
erwähnen ist, betreffen die augenfälligen Veränderungen<br />
Lackierung, Fahrgastsitze (ab<br />
Tw 355) und Zielbeschilderung. <strong>Die</strong> Wagen<br />
s<strong>in</strong>d im neuen Farbschema der DSW mehrheitlich<br />
weiß lackiert. Lediglich die Rammbohle<br />
an der Stirnfront und das Wagendach<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Rot gehalten, ebenso e<strong>in</strong> umlaufendes<br />
Zierband im Bereich der Wagenschürze.<br />
Neue L<strong>in</strong>ienfilme zeigen anstatt e<strong>in</strong>er weißen<br />
Nummer auf blauem Grund e<strong>in</strong>e weiße<br />
Nummer auf der Untergrundfarbe der jeweiligen<br />
L<strong>in</strong>ie (die Wagen der ersten Serie<br />
rüsteten die DSW mit derartigen L<strong>in</strong>ienfilmen<br />
nach). Von 1990 bis 1994 lieferte die<br />
Düwag <strong>in</strong> dieser Form 44 Wagen (Tw 311 bis<br />
354) nach Dortmund. <strong>Die</strong> Wagen der Erstserie<br />
passten die DSW nach und nach dem neuen<br />
Farbschema an. <strong>Die</strong> Ziel- und Seitenbänder<br />
der Wagen s<strong>in</strong>d mittlerweile durch<br />
elektronische Anzeigen ersetzt worden.<br />
<strong>Die</strong> Idee zum Mittelteil<br />
Bereits Ende der 1970er-Jahre gab es Pläne,<br />
die Kapazität von B-Wagen durch E<strong>in</strong>fügen<br />
e<strong>in</strong>es zusätzlichen Mittelteiles zu erweitern.<br />
E<strong>in</strong> entsprechendes Vorhaben <strong>in</strong> Köln verfolgte<br />
der dortige Verkehrsbetrieb aber<br />
nicht weiter.<br />
Am Eröffnungstag der ersten Teilstrecke der Bogetra-L<strong>in</strong>ie<br />
U35 steht Tw 6001 am 2. September<br />
1989 im Betriebshof Riemke AXEL REUTHER<br />
46 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
B-Wagen<br />
Verwendete Literatur<br />
Spathmann, M. und Brunnecker, U.: <strong>Die</strong> elektrische<br />
Ausrüstung für die neuen Stadtbahnwagen<br />
B 80 D der Bochum-Gelsenkirchener<br />
Straßenbahnen AG, <strong>in</strong>: Stadtverkehr, Heft 9/1988<br />
NN: Stadtbahnwagen B80D für Bochum, <strong>in</strong>:<br />
Stadtverkehr, Heft 3/1989<br />
NN: Neues von der Stadtbahn Dortmund –<br />
Stadtbahnwagen B80 C für die Dortmunder<br />
Stadtwerke (DSW) <strong>in</strong>: Stadtverkehr, Heft 7/1987<br />
Kapazitätsengpässe und die sich ergebende<br />
Notwendigkeit, teilweise <strong>in</strong> Dreifachtraktion<br />
zu fahren, bewogen die Dortmunder<br />
Stadtwerke Ende 1994, dieses Projekt<br />
wieder aufzugreifen. Zum e<strong>in</strong>en bot das die<br />
Möglichkeit, das Platzangebot ohne neue<br />
Fahrzeuge zu erweitern, und zum anderen<br />
genügt anstatt e<strong>in</strong>er Doppeltraktion oft e<strong>in</strong><br />
achtachsiger E<strong>in</strong>zelwagen, was Fahrzeuge<br />
für andere Verstärk ungen freisetzt.<br />
Im Herbst 1995 bestellten die DSW für<br />
die elf damals jüngsten Wagen der Baujahre<br />
1993/94 je e<strong>in</strong> Mittelteil. <strong>Die</strong> damit <strong>in</strong> der<br />
zweiten Jahreshälfte 1996 ergänzten Tw<br />
344 bis 354 fuhren danach auf den L<strong>in</strong>ien<br />
U41 und U42 im Zugverband mit Sechsachsern,<br />
nach Abschluss der Streckenanpassungen<br />
ab Herbst auch e<strong>in</strong>zeln auf der<br />
U47 nach Aplerbeck.<br />
Durch das Mittelteil erhöhte sich die Länge<br />
der Wagen um zehn auf 38 Meter, das<br />
Gewicht stieg von 37,5 auf 50 Tonnen und<br />
das Platzangebot vergrößerte sich um 80<br />
Plätze auf 260, davon 96 Sitze.<br />
Der Tw 343 erhielt im Mai 1998 ebenfalls<br />
e<strong>in</strong> Mittelteil, das <strong>in</strong> den Abmessungen<br />
zwar den Stahlbauten der Düwag entsprach,<br />
aber mehrheitlich aus glasfaserverstärktem<br />
Kunststoff (GFK) gefertigt war<br />
und als Erprobungsträger diente. <strong>Die</strong>se Bauweise<br />
sollte e<strong>in</strong>e Gewichtsreduzierung von<br />
etwa 25 Prozent gegenüber der Stahlbauweise<br />
ermöglichen. In der Praxis bewährte<br />
sie sich jedoch nicht, so dass die DSW das<br />
Mittelteil 2001 entfernen ließen. Seitdem<br />
verkehrt Tw 343 wieder als Sechsachser.<br />
Parallel zum Versuch mit dem GFK-Mittel<br />
lieferte die Düwag <strong>in</strong> den Jahren<br />
1998/99 zehn ab Werk achtachsige B-Wagen<br />
– die Tw 355 bis 364 (jeweils mit Mittelteilen<br />
aus Stahl). Doch damit war der<br />
Fahrzeugbedarf <strong>in</strong> Dortmund noch immer<br />
nicht gedeckt. Daraufh<strong>in</strong> übernahmen die<br />
DSW im Jahr 2004 aus Bonn 13 gebrauchte<br />
B-Wagen der ersten Generation. Davon<br />
rüsteten die Stadtwerke letztendlich aber<br />
nur zehn als Tw 401 bis 410 für den L<strong>in</strong>iendienst<br />
<strong>in</strong> Dortmund um. Zwei dienten<br />
von Anfang an als Ersatzteilspender, beim<br />
13. Wagen hatten die Werkstattmitarbeiter<br />
mit dem Umbau für den L<strong>in</strong>iendienst bereits<br />
Der 1994 gebaute Dortmunder Tw 353 erhielt nachträglich e<strong>in</strong> Mittelteil. André Rogalla fotografierte<br />
ihn im warmen Abendlicht an der Stadtbahnhaltestelle Obernette<br />
Aktuelle Beiträge über B-Wagen im <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Heft Titel Untertitel<br />
9/13 Vom Kompromiss zum Erfolgsmodell 40 Jahre Stadtbahnwagen B<br />
10/13 Das Vorbild vieler Sechsachser 40 Jahre Stadtbahnwagen B – Teil 2<br />
11/13 Reif für Veränderungen 40 Jahre Stadtbahnwagen B – Teil 3<br />
12/13 <strong>Die</strong> Geschichte geht weiter Dritte Generation B-Wagen für Köln und Bonn<br />
1/14 Neuer Anblick – aber alte Wagen Veränderungen an B-Wagen für Bonn und Köln<br />
5/14 Vielfalt statt E<strong>in</strong>heitsbrei Stadtbahnwagen B <strong>in</strong> Düsseldorf und Duisburg<br />
7/14 Nicht nur anders lackiert Stadtbahnwagen B <strong>in</strong> Mülheim und Essen<br />
begonnen, brachen ihn aber ab. Er diente<br />
danach ebenfalls als Ersatzteilspender, ehe<br />
ihn die DSW 2013 gänzlich zerlegen ließen.<br />
<strong>Die</strong> Stadtbahnwagen der Bogestra<br />
Für die erste normalspurige Stadtbahnl<strong>in</strong>ie<br />
der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen<br />
(Bogestra) lieferte die Düwag <strong>in</strong> den<br />
Jahren 1988/89 e<strong>in</strong>e Serie von 13 Wagen<br />
(Tw 6001 bis 6013) mit e<strong>in</strong>er elektrischen<br />
Ausrüstung von Siemens und Kiepe aus.<br />
<strong>Die</strong>se Fahrzeuge s<strong>in</strong>d der zweiten Generation<br />
zuzurechnen und entsprechen vom<br />
Grundpr<strong>in</strong>zip her den an andere Betriebe<br />
gelieferten Wagen. Wie schon die Dortmunder<br />
Wagen haben sie ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zeltüren<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
47
Fahrzeuge<br />
Seitenansicht und Grundriss der Bogestra-B-Wagen<br />
Stadtbahnwagen B für den Rhe<strong>in</strong>-Ruhr-Raum<br />
Nummern Stück Baujahr Type Bemerkung Türanordnung Art Stromabnehmer<br />
BOGESTRA<br />
6001–6013 13 1988/89 B 80 D 0-2-2/2-2-0 D V<br />
6014–6025 12 1992/93 B 80 D 0-2-2/2-2-0 D V<br />
Summe 25<br />
DORTMUND<br />
301–310 10 1986 B 80 C (B6) 2. Gen. 0-2-2/2-2-0 D V<br />
311–324 14 1990/91 B 80 C (B6) 2. Gen. 0-2-2/2-2-0 D V<br />
325–334 10 1992 B 80 C (B6) 2. Gen. 0-2-2/2-2-0 D V<br />
335–343*** 9 1993 B 80 C (B6) 2. Gen. 0-2-2/2-2-0 D V<br />
344 1 1993 B 80 C (B8*) 2. Gen. 0-2-2/2-2-0* D V<br />
345–354 10 1994 B 80 C (B8*) 2. Gen. 0-2-2/2-2-0* D V<br />
355–364 10 1998/99 B 80 C (B8) 2. Gen. 0-2-2/2/2-2-0 D V<br />
Summe 64<br />
DÜSSELDORF<br />
4001–4012 12 1981 B 80 D 2. Gen. 1-2-2/2-2-1 ** F E<br />
4101–4104 4 1988 B 80 D 2. Gen. **** 1-2-2/0-2-0 F V<br />
4201–4243 43 1985/86 B 80 D 2. Gen. Alu 1-2-2/2-2-0 F V<br />
4244–4255 12 1987 B 80 D 2. Gen. Alu 1-2-2/2-2-0 F V<br />
4256–4269 14 1988 B 80 D 2. Gen. Alu 1-2-2/2-2-0 F V<br />
4270–4288 19 1992/93 B 80 D 2. Gen. Alu 1-2-2/2-2-0 F V<br />
Summe 104<br />
DUISBURG<br />
4701–4714 14 1983/84 B 80 C 2. Gen. 1-2-2/2-2-0 F E<br />
4715–4718 4 1984/85 B 80 C 2. Gen. **** 1-2-2/0-2-0 F E<br />
Summe 18<br />
ESSEN<br />
5101–5111 11 1976 B 80 C ex B100S 1-2-2/2-2-1** S E<br />
5121–5128 8 1978 B 80 C ex B100S 1-2-2/2-2-1 F E<br />
5141–5145 5 1985 B 80 C 2. Gen. 0-2-2/2-2-0 F E<br />
Summe 24<br />
MÜLHEIM/RUHR<br />
5012–5016 5 1976 B 80 S 1-2-2/2-2-1** S E<br />
5031–5032 2 1985 B 80 C 2. Gen. 0-2-2/2-2-0 S E<br />
Summe 7<br />
SLG. AXEL REUTHER<br />
Türanordnung: 0 = ke<strong>in</strong>e Tür; 1 = e<strong>in</strong>fache Tür; 2 = Doppeltüren; ** = nachträglich E<strong>in</strong>zeltüren ausgebaut;<br />
D = Drehschwenktür; F = Falttür; S = Schwenkschiebetür<br />
Stromabnehmer: E = E<strong>in</strong>holm; V = Vollschere<br />
Umbauten:<br />
* = nachträglicher Umbau von Sechs- <strong>in</strong> Achtachser; *** = Tw 343 1998–2001 versuchsweise mit GFK-<br />
Mittelteil als B8; **** mit Speiseabteil (bei den Duisburger Tw 4715–4718 im Jahr 2000 ausgebaut)<br />
mehr an den Wagenenden und auch ke<strong>in</strong>e<br />
Entwerter im Wagen<strong>in</strong>neren, da Verkauf<br />
und Abfertigung an den Stationen stattf<strong>in</strong>den.<br />
Auch die Schwenktüren entsprechen<br />
der Dortmunder Ausführung. Im Gegensatz<br />
zu allen bisherigen B-Wagen gibt es ke<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>gangsstufen mehr, da der E<strong>in</strong>satz ausschließlich<br />
an 90 Zentimeter hohen Bahnsteigen<br />
stattf<strong>in</strong>det. Als erster erfüllt somit<br />
der Bogestra-Wagen vollständig die Kriterien<br />
e<strong>in</strong>es Schnellbahnfahrzeuges.<br />
Der Wagenkasten ist <strong>in</strong> selbsttragender<br />
Leichtstahlbauweise erstellt. Für den Untergestellrahmen<br />
verwendete die Waggonfabrik<br />
normalen Stahl, für den Wagenkastenaufbau<br />
nichtrostenden Stahl. Infolge der<br />
entfallenen Klappstufen führte die Düwag<br />
die Außenprofile durchgehend aus, wodurch<br />
sich das Wagengewicht reduzierte.<br />
Das Leergewicht e<strong>in</strong>es Bogestra-Wagens<br />
liegt dadurch bei 37,5 Tonnen. E<strong>in</strong>e weiterer<br />
Besonderheit stellt die Motorisierung<br />
der Bochumer B-Wagen dar: Jedes Fahrzeug<br />
wird anstelle der bisher üblichen Tandemantriebe<br />
von vier neuentwickelten kle<strong>in</strong>en<br />
E<strong>in</strong>zelachsmotoren mit je 136 Kilowatt Leistung<br />
angetrieben.<br />
Der Wagenkasten hat gegenüber den B-<br />
Wagen anderer Betriebe e<strong>in</strong> kantigeres Aussehen,<br />
da Stirn- und Seitenwände nach oben<br />
h<strong>in</strong> leicht e<strong>in</strong>gezogen und Schürze und<br />
Dachkante etwas stärker abgew<strong>in</strong>kelt s<strong>in</strong>d.<br />
Das dadurch gefälligere Aussehen wird<br />
auch durch die Lackierung unterstrichen,<br />
die erstmals für Stadtbahnwagen den vom<br />
Verbund für Schnellverkehrsl<strong>in</strong>ien vorgegebenen<br />
Kriterien entspricht. Der Wagenkasten<br />
ist <strong>in</strong> weiß gehalten, die Fensterpartien<br />
s<strong>in</strong>d durch e<strong>in</strong> hellgraues Band abgesetzt. Je<br />
e<strong>in</strong> roter Absetzstreifen verläuft unter der<br />
Dachkante und im Bereich der Wagenschürze<br />
und e<strong>in</strong> orangefarbener Absetzstreifen<br />
am Schürzenrand. Im Bereich der<br />
Schürze tragen die Fahrzeuge den Schriftzug<br />
und das Markenlogo des „City-Express“.<br />
Insgesamt 25 B-Wagen bei Bogestra<br />
Bei den Farben im Wagen<strong>in</strong>neren überwiegen<br />
helle Farbtöne. <strong>Die</strong> Schalensitze verfügen<br />
über e<strong>in</strong>e hellblaue Wollplüschauflage<br />
auf Sitzfläche und Rückenlehne. E<strong>in</strong> beh<strong>in</strong>dertengerechter<br />
Sitz ist auch <strong>in</strong> den Bochumer<br />
Wagen zu f<strong>in</strong>den. Der Führerraum ist<br />
vom übrigen Wagen<strong>in</strong>neren abgetrennt, der<br />
Zugang erfolgt aus dem Fahrgastraum<br />
durch e<strong>in</strong>e Tür mit großem Fenster. Anstelle<br />
e<strong>in</strong>es weiteren Fensters s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Führerstandsrückwand<br />
der Bochumer Wagen<br />
Steuer- und Überwachungsgeräte e<strong>in</strong>gebaut.<br />
Aus Sicherheitsgründen achtet die Bogestra<br />
auf e<strong>in</strong>e gute Überschaubarkeit des Innenraumes,<br />
gläserne Trennscheiben an den E<strong>in</strong>stiegräumen<br />
und die Ausführung der Gelenkverb<strong>in</strong>dung<br />
gestatten freie Durchsicht<br />
fast über die gesamte Wagenbreite.<br />
48 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
B-Wagen<br />
Lieferung von Stadtbahn -<br />
wagen B – Gesamtzahlen<br />
Stadt Stück Bemerkungen<br />
Bochum 25<br />
Bonn 75 52 Stück SWB; 23 Stück SSB<br />
Dortmund 64 davon 21 B8 (elf umgebaut)<br />
Duisburg 18 davon vier mit Speiseabteil<br />
Düsseldorf 104 davon vier mit Bistro-Abteil<br />
Essen 24 davon elf durch SRR<br />
beschafft<br />
Köln 172 davon 13 Stück für KBE<br />
Mülheim 7 davon fünf durch SRR<br />
beschafft<br />
Summe 489<br />
Der Tw 6024, e<strong>in</strong> B-Wagen der zweiten Bogestra-Lieferung, verlässt 2011 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Doppelzug<br />
die Haltestelle Ruhr-Universität <strong>in</strong> Richtung Innenstadt AXEL REUTHER (2)<br />
Auch <strong>in</strong> den Bochumer Wagen s<strong>in</strong>d die<br />
Türen beh<strong>in</strong>dertengerecht ohne mittlere<br />
Haltestange ausgeführt. <strong>Die</strong> Türsicherung<br />
erfolgt über Druckschwellenkontakte im<br />
Gummiprofil sowie durch Lichtschranken<br />
und Motorstromüberwachung. Das Öffnen<br />
der Türen kann zentral vom Fahrerplatz aus<br />
oder <strong>in</strong>dividuell durch den Fahrgast erfolgen.<br />
Während dazu im Innenraum die entsprechenden<br />
Druckknöpfe vorhanden s<strong>in</strong>d,<br />
erfolgt das Öffnen von außen erstmalig mit<br />
Hilfe e<strong>in</strong>es Bewegungsmelders. Über der<br />
Tür bef<strong>in</strong>det sich e<strong>in</strong>e entsprechende E<strong>in</strong>richtung,<br />
der die Tür bei Erfassen des Fahrgastes<br />
automatisch öffnet. Im Falle e<strong>in</strong>er<br />
Türsteuerung wird dies durch e<strong>in</strong>e Leuchtschrift<br />
<strong>in</strong>nen und außen an den jeweiligen<br />
Türen angezeigt. Das Fahrzeug verfügt über<br />
e<strong>in</strong>e IBIS-Ausrüstung zur Ansteuerung der<br />
Zuglenkung, Fahrziel- und Fahrwegmarkierung<br />
mit Haltestellenmarkierung und<br />
Lautsprecheransage.<br />
Mehrere kle<strong>in</strong>e Veränderungen<br />
E<strong>in</strong>e nach Nummer und Ziel getrennte Rollfilmanzeige<br />
an den Fronten und Fahrweganzeigen<br />
an den Wagenseiten gewähr leisteten<br />
e<strong>in</strong>e gute Fahrgast<strong>in</strong>formation.<br />
Mittlerweile haben elektronische Anzeigen<br />
die Rollbänder an den Fronten ersetzt, während<br />
die L<strong>in</strong>ienkästen an den Wagenseiten<br />
mit e<strong>in</strong>er Folie mit der aufgedruckten L<strong>in</strong>iennummer<br />
„U35“ verschlossen s<strong>in</strong>d. Im<br />
Wagen<strong>in</strong>neren wird die nächste Haltestelle<br />
durch e<strong>in</strong>e an den Gelenkbögen montierte<br />
Leuchtschrift angezeigt.<br />
In technischer H<strong>in</strong>sicht handelt es sich bei<br />
dem Wagen für Bochum um e<strong>in</strong>e Ausführung<br />
mit umrichtergespeisten Drehstromantrieben<br />
und Mikroprozessorsteuerung und e<strong>in</strong>er<br />
Höchstgeschw<strong>in</strong>digkeit von 80 km/h. <strong>Die</strong><br />
technische Ausstattung entspricht im Wesentlichen<br />
derjenigen anderer Betriebe. Neu ist der<br />
E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>es zentralen Diagnose- und Steuergerätes,<br />
das bei der Fehlersuche und Wartung<br />
hilft sowie e<strong>in</strong>en sparsamen Energieverbrauch<br />
im Fahrbetrieb sicherstellt. Zur Verlängerung<br />
der normalspurigen Stadtbahnl<strong>in</strong>ie U35 kamen<br />
1992/93 zwölf gleichartige Wagen (die<br />
Tw 6014 bis 6025) h<strong>in</strong>zu. Sie s<strong>in</strong>d bis heute im<br />
täglichen Betrieb zu f<strong>in</strong>den. AXEL REUTHER<br />
<strong>Die</strong> B-Wagen bestritten lange Zeit den Gesamtverkehr auf der U35. <strong>Die</strong> 25 Exemplare reichten aber wegen des deutlich gestiegenen Fahrgastaufkommens<br />
irgendwann nicht mehr aus, so dass die Bogestra ihnen <strong>in</strong>zwischen sechs Stadtbahnwagen vom Typ Tango zur Seite stellen musste<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
49
Geschichte<br />
50 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
E<strong>in</strong>st & Jetzt<br />
E<strong>in</strong>st<br />
&Jetzt<br />
Am 2. Mai 1990 erreichte e<strong>in</strong> Zweiachser-Zweiwagenzug des<br />
VEB Städtischer Nahverkehr Halberstadt die Endhaltestelle <strong>in</strong><br />
der Voigtei. Hier musste er über e<strong>in</strong> Gleisdreieck wenden. Den<br />
Tw 42 vom Gotha-Typ T2D hatte ČKD im Jahre 1968 gebaut<br />
und bis 1972 der Verkehrsbetrieb von Halle an der Saale genutzt.<br />
Den Bw 54 vom Typ B57 lieferte die Waggonfabrik Gotha 1961<br />
nach Magdeburg, er kam 1968 <strong>in</strong> die Stadt am Fuße des Harzes.<br />
Im Aufnahmejahr gab es <strong>in</strong> Halberstadt ausschließlich zweiachsige<br />
Fahrzeuge, mit denen 6,2 Millionen Fahrgäste unterwegs<br />
waren. In der im Zweiten Weltkrieg großteils zerstörten Altstadt<br />
bestanden viele Baulücken und zahlreiche Fachwerkhäuser waren<br />
dem Verfall preisgegeben. Um neuen Wohnraum zu schaffen,<br />
ersetzte die Stadtverwaltung <strong>in</strong> den letzten DDR-Jahren alte<br />
Bausubstanz systematisch durch Plattenbauten. E<strong>in</strong>e rühmliche<br />
Ausnahme bildete das Haus Voigtei Nr. 48, dessen Fassade sich<br />
<strong>in</strong> schön renoviertem Zustand zeigte.<br />
Knapp 24 Jahre später ist die Straßenbahn – trotz hartnäckiger<br />
Stilllegungsdiskussionen – immer noch <strong>in</strong> Betrieb, wenn auch<br />
die Fahrgastzahlen mittlerweile um fast zwei Drittel gesunken<br />
s<strong>in</strong>d. Bald nach der politischen Wende kam es zur Erneuerung<br />
der Infrastruktur und am 4. August 1993 g<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>gleisige<br />
Neubaustrecke zum Wohngebiet Nordr<strong>in</strong>g (Sargstedter Weg)<br />
<strong>in</strong> Betrieb. Von 1991 bis 2003 schaffte der Verkehrsbetrieb <strong>in</strong>sgesamt<br />
18 Gelenktriebwagen Typ GT4 aus Stuttgart, Freiburg<br />
und Nordhausen (ex Freiburg) an. Heute reichen gewöhnlich<br />
die fünf, 2006/07 beschafften „Leol<strong>in</strong>er“-Niederflurwagen<br />
für den Betrieb der L<strong>in</strong>ien 1 und 2 aus, als Reserve stehen aber<br />
noch die GT 4 Nr. 156, 167 und 168 zur Verfügung. <strong>Die</strong> Aufnahme<br />
mit Tw 156 entstand am 26. März 2014.<br />
TEXT & FOTOS: WOLFGANG KAISER<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
51
Geschichte<br />
<strong>Juwelenjagd</strong><br />
<strong>in</strong> Essl<strong>in</strong>gen<br />
Am 27. Februar 1978, dem<br />
vorletzten Betriebstag der <strong>END</strong>,<br />
fährt Tw 6 die 70-Promille-Steigung<br />
von Scharnhausen nach Neuhausen h<strong>in</strong>auf<br />
WOLFGANG MEIER<br />
52 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
<strong>END</strong><br />
Er<strong>in</strong>nerungen an die <strong>END</strong> Auch mehr<br />
als 35 Jahre nach ihrer E<strong>in</strong>stellung und dem<br />
Abriss besteht die Straßenbahn Essl<strong>in</strong>gen –<br />
Nell<strong>in</strong>gen – Denkendorf <strong>in</strong> der Er<strong>in</strong>nerung<br />
vieler Menschen fort. Doch was macht<br />
den Nimbus dieser eheamligen Überlandstraßenbahn<br />
im Schwäbischenaus?<br />
Am letzten Betriebstag der <strong>END</strong> – am 28. Februar 1978 – s<strong>in</strong>d die Wagen bis abends gut gefüllt. Neben<br />
Straßenbahnfreunden nehmen auch viele E<strong>in</strong>heimische von der Straßenbahn Abschied DIETER SCHLIPF<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
53
Geschichte<br />
<strong>Die</strong> Wagen- und Werkstatthalle <strong>in</strong> Nell<strong>in</strong>gen nach ihrer Fertigstellung im Jahr 1926; drei Jahre später<br />
ergänzte die <strong>END</strong> den Bau um e<strong>in</strong>e zweite Halle dieser Form SLG. GOTTFRIED BAUER (2)<br />
Spricht man ältere Straßenbahnfreunde<br />
auf die Straßenbahn Essl<strong>in</strong>gen–<br />
Nell<strong>in</strong>gen–Denkendorf (<strong>END</strong>) an,<br />
beg<strong>in</strong>nen die Augen aller zu leuchten,<br />
die diesen reizvollen Überlandbetrieb<br />
noch kennengelernt haben. Doch was<br />
machte die Attraktivität dieser Strecken<br />
aus? Spontan fallen Aussagen wie „die Steigung<br />
zum Zollberg“, „der Wagene<strong>in</strong>satz“,<br />
„die abwechslungsreiche Trassierung“ oder<br />
„der dichte Takt <strong>in</strong> der Hauptverkehrszeit“.<br />
<strong>Die</strong> Aktionen zur Dokumentation der letzten<br />
E<strong>in</strong>satzmonate glichen entsprechend oft<br />
e<strong>in</strong>er <strong>Juwelenjagd</strong> – ke<strong>in</strong> Weg war zu weit,<br />
um den Straßenbahnbetrieb noch e<strong>in</strong>mal <strong>in</strong><br />
Aktion zu erleben.<br />
Mit ihren Aufnahmen, Filmen und Erzählungen<br />
haben die Zeitzeugen von damals<br />
längst auch jüngere Straßenbahnfreunde<br />
für die <strong>END</strong> begeistert, obwohl<br />
deren Schienenverkehr seit 1978 Geschichte<br />
ist und Omnibusse die Aufgaben der<br />
Straßenbahnwagen übernommen haben.<br />
<strong>Die</strong> Ausgangssituation<br />
im 19. Jahrhundert<br />
<strong>Die</strong> Nachbargeme<strong>in</strong>den von Essl<strong>in</strong>gen (bis<br />
Oktober 1964 offiziell Eßl<strong>in</strong>gen geschrieben)<br />
im Neckartal s<strong>in</strong>d bereits seit 1845/46<br />
durch die württembergische Ostbahn erschlossen.<br />
Aufgrund der Tallage Essl<strong>in</strong>gens<br />
entstanden aber nach der Genehmigung<br />
zum Bau von Eisenbahnen untergeordneter<br />
Bedeutung ab 1878 ke<strong>in</strong>e Nebenstrecken <strong>in</strong><br />
die nördlich und südlich der Stadt gelegenen<br />
Orte und Geme<strong>in</strong>den. Auch die ab 1885<br />
verfolgten Pläne zum Bau e<strong>in</strong>er Eisenbahn<br />
von Eßl<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> die Fildergeme<strong>in</strong>den südlich<br />
der Stadt ließen sich nicht umsetzen. So liefen<br />
aus diesen Geme<strong>in</strong>den täglich etwa<br />
2.000 Menschen die Zollbergsteige zu ihren<br />
Arbeitsstellen im Neckartal zu Fuß h<strong>in</strong>ab –<br />
und zum Feierabend wieder h<strong>in</strong>auf ...<br />
Mit fortschreitender Industrialisierung und<br />
parallel wachsender Bevölkerung wuchs das<br />
Bedürfnis nach e<strong>in</strong>em Nahverkehrsmittel ab<br />
1900 weiter an. Doch zunächst waren es wieder<br />
die Menschen im Neckartal, denen e<strong>in</strong><br />
weiteres öffentliches Verkehrsmittel zur Ver-<br />
54 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
<strong>END</strong><br />
fügung stand: die Eßl<strong>in</strong>ger Städtische Straßen -<br />
bahn. Sie verband ab dem 24. Mai 1912<br />
Ober türkheim (1922 nach Stuttgart e<strong>in</strong>geme<strong>in</strong>det)<br />
mit Mett<strong>in</strong>gen, dem Bahnhof Eßl<strong>in</strong>gen<br />
und Obereßl<strong>in</strong>gen (1913 <strong>in</strong> Eßl<strong>in</strong>gen e<strong>in</strong>geme<strong>in</strong>det).<br />
<strong>Die</strong>ser 7,5 Kilometer langen<br />
Durchgangsl<strong>in</strong>ie folgte im Sommer 1912 e<strong>in</strong>e<br />
Stadtl<strong>in</strong>ie, sie schloss die Eßl<strong>in</strong>ger Altstadt an<br />
den Bahnhof an. Auf Grundlage e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen<br />
Gesellschaftervertrages führte die<br />
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) den Betrieb<br />
der Eßl<strong>in</strong>ger Städtischen Straßenbahn.<br />
Kriegsbed<strong>in</strong>gt stellte die SSB den Verkehr auf<br />
der Stadtl<strong>in</strong>ie 1915 e<strong>in</strong> – und nahm ihn auch<br />
nach 1918 nicht mehr auf. (Der Betrieb auf<br />
der Durchgangsl<strong>in</strong>ie endete am 7. Juli 1944,<br />
Obusse übernahmen diese Leistungen.)<br />
E<strong>in</strong>e Straßenbahn soll es richten<br />
Nachdem weder vor noch im Ersten Weltkrieg<br />
der Bau e<strong>in</strong>er Eisenbahnstrecke von Eßl<strong>in</strong>gen<br />
auf die Filderebene zustande gekommen war,<br />
unternahmen nach der Wirtschaftskrise An-<br />
Sowohl den Verlauf<br />
der Städtischen Straßenbahn<br />
Eßl<strong>in</strong>gen<br />
als auch <strong>END</strong> sowie<br />
der später eröffneten<br />
Bus- und Stadtbahnl<strong>in</strong>ien<br />
verdeutlicht<br />
diese Übersicht<br />
GRAFIK: IVONNE WINKLHOFER<br />
Der Fotograf der<br />
Stuttgarter Straßenbahnen<br />
hielt im<br />
Dezember 1926 e<strong>in</strong>e<br />
Probefahrt <strong>in</strong> der<br />
zweiten Zollbergkehre<br />
auf e<strong>in</strong>er<br />
Glasplatte fest.<br />
<strong>Die</strong> Häuser im Neckartal<br />
gehören zur<br />
Pliens auvorstadt<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
55
Geschichte<br />
Auf dem Essl<strong>in</strong>ger Bahnhofsvorplatz<br />
warteten im Frühjahr 1973<br />
die Fahr gäste auf „ihre“ Straßenbahn<br />
oder den Obus. <strong>Die</strong>ser hatte<br />
1944 die Eßl<strong>in</strong>ger Städtische<br />
Straßenbahn von Ober türkheim<br />
nach Obereß l<strong>in</strong>gen abgelöst<br />
ULLRICH MÜLLER<br />
Vom Pliensauturm am Neckarufer war der Verlauf der <strong>END</strong> gut zu überschauen. So entstand am<br />
25. Februar 1978 sowohl diese Aufnahme des Tw 2 auf der Rampe zur Pliensaubrücke …<br />
… als auch von Tw 8, der gerade mit e<strong>in</strong>em Bw<br />
<strong>in</strong> der Gegenrichtung fahrend den Neckar zum<br />
Bahnhofsvorplatz überquert DIETER SCHLIPF (2)<br />
Daten & Fakten: <strong>END</strong><br />
Betreiber:<br />
Straßenbahn Essl<strong>in</strong>gen-Nell<strong>in</strong>gen-Denkendorf GmbH<br />
Betriebsführung:. Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)<br />
Spurweite:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Millimeter<br />
Konzessionserteilung: . . . . . . . . . . . . . . 24.06.1926<br />
Eröffnungen:<br />
Essl<strong>in</strong>gen – Denkendorf: . . . . . . . . . 18.12.1926<br />
Nell<strong>in</strong>gen – Neuhausen: . . . . . . . 21.09.1929<br />
Streckenlänge: . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,6 Kilometer<br />
Zweigleisigkeit: . . . . . . Pliensauturm – Weilstraße und<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Zollberg – Mutzenreisstraße<br />
Hersteller Fahrzeuge: . . . . . Masch<strong>in</strong>enfabrik Eßl<strong>in</strong>gen<br />
erhaltene Fahrzeuge:. . . . . . . sechs Tw und vier Bw<br />
E<strong>in</strong>stellung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.02.1978<br />
fang der 1920er-Jahre die Schultheißen von<br />
Berkheim, Nell<strong>in</strong>gen auf den Fildern, Denkendorf<br />
sowie Neuhausen auf den Fildern e<strong>in</strong>en<br />
neuen Anlauf. Geme<strong>in</strong>sam mit dem Oberbürgermeister<br />
von Essl<strong>in</strong>gen beschlossen sie<br />
am 19. August 1924 e<strong>in</strong>e Gesellschaft zum<br />
Bau e<strong>in</strong>er Überlandstraßenbahn zu gründen.<br />
Knapp e<strong>in</strong> halbes Jahr später setzten sie dieses<br />
Vorhaben <strong>in</strong> die Tat um. An der per 27. Januar<br />
1925 mit e<strong>in</strong>em Stammkapital von<br />
750.000 Reichsmark gegründeten Gesellschaft<br />
hielt die Stadt Eßl<strong>in</strong>gen mit 375.000<br />
Reichsmark die Hälfte der Anteile. E<strong>in</strong> Fünftel<br />
übernahm die Stuttgarter Straßenbahnen<br />
AG; die Geme<strong>in</strong>de Nell<strong>in</strong>gen auf den Fildern<br />
beteiligte sich mit 113.000 Reichsmark (etwa<br />
15,1 Prozent) und Denkendorf mit 112.000<br />
Reichsmark (etwa 14,9 Prozent).<br />
Am 24. Juni 1926 erhielt die Straßenbahn<br />
Eßl<strong>in</strong>gen–Nell<strong>in</strong>gen–Denkendorf GmbH die<br />
Konzession zum Bau und Betrieb e<strong>in</strong>er meterspurigen<br />
Überlandstraßenbahn von Eßl<strong>in</strong>gen<br />
über die Zollbergsteige h<strong>in</strong>auf nach Nell<strong>in</strong>gen<br />
und weiter nach Denkendorf. Sechs<br />
Monate später war es soweit: <strong>Die</strong> <strong>END</strong> eröffnete<br />
am 18. Dezember 1926 den Betrieb,<br />
drei Jahre später – am 21. September 1929 –<br />
nahm sie die Verlängerung von Nell<strong>in</strong>gen<br />
über Scharnhausen nach Neuhausen <strong>in</strong> Betrieb.<br />
Im Vorfeld dieser Erweiterung hatten<br />
sich im Februar 1928 auch die Geme<strong>in</strong>den<br />
Scharnhausen und Neuhausen auf den Fildern<br />
der Gesellschaft angeschlossen und das<br />
Stammkapital erhöht, welches die Gesellschafter<br />
danach prozentual umverteilten. Für<br />
den von den SSB geführten Betrieb beschaffte<br />
die Gesellschaft bei der Masch<strong>in</strong>enfabrik<br />
Eßl<strong>in</strong>gen 1926 zunächst fünf vierachsige<br />
Trieb- und sieben zweiachsige Beiwagen. In<br />
den Jahren 1927, 1929 und 1942 folgten<br />
weitere fünf baugleiche Triebwagen sowie<br />
schließlich 1955 – da die Konstruktion für<br />
56 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
<strong>END</strong><br />
e<strong>in</strong> Ganzstahlfahrzeug noch nicht fertiggestellt<br />
war – der vermutlich letzte neue Holzkastenwagen<br />
Deutschlands, mit e<strong>in</strong>er Sondergenehmigung<br />
nach den Orig<strong>in</strong>alplänen<br />
aus dem Jahr 1926.<br />
In den Jahren 1927, 1929 und 1941 kamen<br />
aber auch acht gleichartige Beiwagen<br />
zur <strong>END</strong>. Sie alle waren <strong>in</strong> der viergleisigen<br />
Wagenhalle mit angeschlossener Werkstadt<br />
<strong>in</strong> Nell<strong>in</strong>gen stationiert, an welche die <strong>END</strong><br />
1929 e<strong>in</strong>e weitere viergleisige Halle anbauen<br />
ließ. Damit stellte Nell<strong>in</strong>gen zugleich den<br />
Betriebsmittelpunkt der Straßenbahngesellschaft<br />
dar.<br />
<strong>Die</strong> Trassierung der <strong>END</strong><br />
<strong>Die</strong> <strong>END</strong> begann anfangs <strong>in</strong> Eßl<strong>in</strong>gen auf<br />
der Eisenbahnstraße neben der Post (ab<br />
1953 auf dem Bahnhofsvorplatz) und überquerte<br />
von dort zunächst auf der Pliensaubrücke<br />
die Eisenbahngleise und anschließend<br />
den Neckar. Auf dessen südlicher Seite<br />
durchfuhr die Straßenbahn e<strong>in</strong>en Teil der<br />
Pliensauvorstadt und folgte den Serpent<strong>in</strong>en<br />
der Zollbergstraße h<strong>in</strong>auf nach Nell<strong>in</strong>gen<br />
auf den Fildern. Dabei erklomm sie knapp<br />
130 Höhenmeter. Von Nell<strong>in</strong>gen führte die<br />
Trasse auf der Hochebene weiter nach Denkendorf,<br />
welches sich bis <strong>in</strong>s Körschtal erstreckt.<br />
<strong>Die</strong> Endstation Denkendorf befand<br />
sich jedoch am oberen Ortsrand <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
kle<strong>in</strong>en Senke, dadurch lag das zum Umfahren<br />
genutzte Gleisende <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Steigung.<br />
Es ermöglichte das Umsetzen von gerade e<strong>in</strong>em<br />
Triebwagen und endete mitten auf der<br />
Schäfersteige.<br />
<strong>Die</strong> 1929 eröffnete Stichstrecke von Nell<strong>in</strong>gen<br />
nach Neuhausen war zunächst zweigleisig<br />
<strong>in</strong> der H<strong>in</strong>denburgstraße verlegt, dann<br />
führte sie e<strong>in</strong>gleisig auf eigener Bahntrasse<br />
h<strong>in</strong>unter <strong>in</strong>s Körschtal zunächst zur Ausweichhaltestelle<br />
Krähenbach und danach<br />
weiter zur ebenfalls zweigleisigen Haltestelle<br />
Scharnhausen. <strong>Die</strong>se lag etwa 600 Meter<br />
vom Ort entfernt, der Bau e<strong>in</strong>er Stichstrecke<br />
<strong>in</strong> die Geme<strong>in</strong>de blieb <strong>in</strong> der Planungsphase.<br />
Danach g<strong>in</strong>g es mit 70 Promille bergauf <strong>in</strong><br />
Richtung Neuhausen. <strong>Die</strong>se Geme<strong>in</strong>de erreichte<br />
die <strong>END</strong> am nördlichen Ortsrand.<br />
Nach e<strong>in</strong>er dort angelegten Haltestelle folgte<br />
etwa 500 Meter weiter die Endausweichstelle.<br />
Das von dort ungefähr 60 Meter weiterführende<br />
Stumpfgleis wurde nur selten<br />
von Solowagen befahren.<br />
Weitere betriebliche Besonderheiten<br />
Bis zum Wiederaufbau der 1945 gesprengten<br />
Pliensaubrücke im Oktober 1946 lag die Endstation<br />
Essl<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> der Ausweiche Weilstraße.<br />
Während der Erweiterung der neuen Pliens aubrücke<br />
im Jahr 1964 über die vierspurig ausgebaute<br />
Bundesstraße 10 konnten die Wagen<br />
der <strong>END</strong> den Essl<strong>in</strong>ger Bahnhofsvorplatz<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
57
Geschichte<br />
58 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
<strong>END</strong><br />
Am 27. Februar<br />
1978 nutzte e<strong>in</strong><br />
Großvater den<br />
letzten Betriebssonntag<br />
für e<strong>in</strong>e<br />
letzte Fahrt mit<br />
se<strong>in</strong>em Enkel mit<br />
der <strong>END</strong>, hier bei<br />
der E<strong>in</strong>fahrt des<br />
Tw 3 <strong>in</strong> die<br />
Ausweichstelle<br />
Scharnhausen<br />
WOLFGANG MEIER<br />
Nach dem Passieren<br />
des Durchlasses<br />
unter der Autobahn<br />
A8 – hier<br />
am 9. Februar<br />
1969 – s<strong>in</strong>d es nur<br />
noch wenige Hundert<br />
Meter bis<br />
Neuhausen<br />
DIETER SCHLIPF<br />
Mitten auf der Pliens aubrücke<br />
lichtete <strong>Die</strong>ter<br />
Schlipf am 22. Oktober<br />
1977 mit Tw 9 e<strong>in</strong>en der<br />
Altbauwagen der <strong>END</strong> ab<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
59
Geschichte<br />
Schichtwechsel am Nachmittag des 29. September<br />
1961: Alles was rollen kann, ist auf<br />
der <strong>END</strong> im E<strong>in</strong>satz – hier Tw 9 mit zwei Bw<br />
sowie Tw 3 mit Bw 22 und ganz h<strong>in</strong>ten Tw 2.<br />
Der Solowagen bediente die Haltestelle Zollberg,<br />
wo Züge aufgrund der Steigung bergwärts<br />
nicht hielten<br />
JÖRG ZIMMER (2)<br />
<strong>Die</strong> <strong>END</strong> <strong>in</strong> den 1950er- und 1960er-Jahren<br />
Sie war e<strong>in</strong>e der letzten neueröffneten Straßenbahnen<br />
<strong>in</strong> Deutschland. Seit 1926 ersparte die <strong>END</strong> täglich<br />
mehreren Tausend Arbeitern e<strong>in</strong>en viele Kilometer<br />
langen beschwerlichen Anmarsch von den<br />
Filderorten über die Zollbergsteige <strong>in</strong> die Eßl<strong>in</strong>ger<br />
Fabriken und abends den ermüdenden Heimweg<br />
bergauf. <strong>Die</strong> Straßenbahn entwickelte sich zum Segen<br />
für Stadt und Land.<br />
<strong>Die</strong> Endstation <strong>in</strong> Eßl<strong>in</strong>gen lag zunächst <strong>in</strong> der Eisenbahnstraße<br />
neben der Post, die nach der großen<br />
Innenstadtschleife am Schelztor vorbei erreicht wurde.<br />
Dann aber kamen sich zunehmender Autoverkehr<br />
der Wirtschaftswunderzeit und die den Bahnhofsvorplatz<br />
kreuzende Straßenbahn immer mehr <strong>in</strong>s Gehege.<br />
<strong>Die</strong> <strong>END</strong> wich 1953 auf e<strong>in</strong>e neue und für sie günstigere<br />
Schleife direkt vor dem Bahnhofsgebäude aus.<br />
<strong>Die</strong> <strong>END</strong> bot <strong>in</strong> den 1950er- und 1960er-Jahren –<br />
je nach Tageszeit und Wochentag – e<strong>in</strong>en 12- bis 48-<br />
M<strong>in</strong>uten-Verkehr an. <strong>Die</strong> Kurse bestanden entweder<br />
aus Solo-Triebwagen oder aus e<strong>in</strong>em Triebwagen mit<br />
e<strong>in</strong>em bzw. zwei Beiwagen.<br />
Hoch her g<strong>in</strong>g es im Berufsverkehr: E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelner<br />
Triebwagen fuhr voraus h<strong>in</strong>auf auf den Zollberg, ihm<br />
folgten im Sichtabstand zwei Dreiwagenzüge über die<br />
ganze Strecke. Alles was rollen konnte, war unterwegs!<br />
Er<strong>in</strong>nerungen an den Streckenverlauf<br />
Vom Bahnhof Eßl<strong>in</strong>gen verlief die Strecke über e<strong>in</strong>e<br />
Rampe auf die mittelalterliche Pliensaubrücke –<br />
hier war die Strecke zweigleisig. In der Pliensauvorstadt<br />
am l<strong>in</strong>ken Neckarufer begann der 72 Promille<br />
steile Anstieg mit drei Kehren h<strong>in</strong>auf auf den<br />
Zollberg. <strong>Die</strong> Trasse lag, nicht immer profilfrei, meist<br />
auf oder unmittelbar neben der Straße – mit allen<br />
Konsequenzen für den übrigen Verkehr. Dann folgte<br />
der ebenere Abschnitt nach Nell<strong>in</strong>gen (damals<br />
noch nicht Ostfildern). Hier befand sich der Betriebsmittelpunkt<br />
mit dem Depot an der Schillerstraße.<br />
In Nell<strong>in</strong>gen war die <strong>END</strong> die Beherrscher<strong>in</strong> der<br />
Durchgangsstraße mit zwei Ausweichen, geradeaus<br />
Richtung Denkendorf, nach rechts Richtung Neuhausen.<br />
E<strong>in</strong>- und ausgestiegen wurde über die Fahrbahn,<br />
dazu kamen mehrfach täglich Rangiermanöver<br />
mit an- und abzuhängenden Beiwagen. <strong>Die</strong> Folge<br />
war, dass der schon damals nicht unbedeutende<br />
Autoverkehr regelmäßig zum Stillstand kam. Das<br />
war für die Gegner des Straßenbahnverkehrs e<strong>in</strong><br />
„Beweis“ dafür, dass das Schienenverkehrsmittel<br />
nichts anderes als e<strong>in</strong> Störfaktor sei und verschw<strong>in</strong>den<br />
müsse …<br />
Geradeaus g<strong>in</strong>g es nach Denkendorf. Der Ort liegt<br />
am Hang über dem Körschtal, die Endstelle lag, für<br />
die Fahrgäste eher ungünstig, am oberen Rand, <strong>in</strong><br />
der steilen Dorfstraße <strong>in</strong>s Tal h<strong>in</strong>ab lagen ke<strong>in</strong>e Gleise<br />
– das war e<strong>in</strong> Schwachpunkt der <strong>END</strong>.<br />
Der Ast nach Neuhausen<br />
Seit 1929 führte die Straßenbahn von Nell<strong>in</strong>gen<br />
nach Neuhausen. Nach dem Abstieg <strong>in</strong>s Körschtal<br />
und der 70-Promille-Steigung wieder bergauf bedienten<br />
die Wagen die Haltestelle Scharnhausen.<br />
Dass diese über e<strong>in</strong>en halben Kilometer von der<br />
ebenfalls nicht erreichten. Sie wendeten <strong>in</strong> dieser<br />
Zeit mittels e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>fachen Wendeschleife<br />
westlich der Brückenrampe <strong>in</strong> der Pliensauvorstadt.<br />
<strong>Die</strong>se dazu neu errichtete Anlage<br />
diente während der Brückensperrung zugleich<br />
als provisorische Endhaltestelle. Damit sich<br />
ihre Schuhsohlen weniger abnutzten, fuhren<br />
von Juni 1945 bis Mitte 1947 besonders viele<br />
Menschen mit der Straßenbahn. Der Andrang<br />
<strong>in</strong> den Wagen war umso größer als dass<br />
die <strong>END</strong> <strong>in</strong> dieser Zeit zwei Trieb- und zwei<br />
Beiwagen an die Filderbahn ausleihen musste.<br />
Im Jahr 1958 beschaffte die <strong>END</strong> je zwei von<br />
der Masch<strong>in</strong>enfabrik Eßl<strong>in</strong>gen gebaute vierachsige<br />
Großraumtrieb- und beiwagen. Sie<br />
versahen fortan geme<strong>in</strong>sam mit den Altbauwagen<br />
den <strong>Die</strong>nst.<br />
<strong>Die</strong> E<strong>in</strong>stellung<br />
Für die am 28. Februar 1978 erfolgte E<strong>in</strong>stellung<br />
des Straßenbahnbetriebes werden<br />
heute unterschiedliche Gründe angeführt.<br />
Am häufigsten – und sicherlich tatsächlich<br />
ausschlaggebend – nennt man wirtschaftliche<br />
Gründe. Spätestens <strong>in</strong> den 1980er-<br />
Jahren hätte die <strong>END</strong> sowohl <strong>in</strong> die Gleise<br />
als auch elektrischen Anlagen nicht<br />
unerheblich <strong>in</strong>vestieren müssen, um e<strong>in</strong>en<br />
sicheren Weiterbetrieb zu garantieren.<br />
Gleichzeitig war die Bevölkerung <strong>in</strong> den<br />
1970er-Jahren auf den Pkw- und Bus-Verkehr<br />
fixiert. Da die selbst motorisierten<br />
Menschen die Straßenbahn vor allem an<br />
60 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
<strong>END</strong><br />
Nell<strong>in</strong>gen im August 1975: Tw 13 nach Denkendorf passiert den zweigleisigen Abzweig <strong>in</strong> die H<strong>in</strong>denburgstraße<br />
(nach Neuhausen). Der Tw fährt <strong>in</strong> die Ausweiche e<strong>in</strong>, an die das Depot anschließt<br />
Am letzten Betriebstag, am 28. Februar 1978,<br />
trugen mehrere Fahrzeuge der <strong>END</strong> Trauerkränze,<br />
so auch Triebwagen 11 DIETER SCHLIPF<br />
H<strong>in</strong>ter der Endstelle Denkendorf befand sich das letzte Gleisstück auf der Schäfersteige. Das<br />
Umsetzen erforderte Konzentration, wie hier Ende 1976 vom Fahrer des Tw 6 GOTTFRIED BAUER<br />
Ortsmitte entfernt lag, war e<strong>in</strong> weiterer Schwachpunkt<br />
der <strong>END</strong>.<br />
Während des Baus der Reichsautobahn entstand<br />
<strong>in</strong> den 1930er-Jahren e<strong>in</strong> enger Durchlass für die<br />
Straßenbahn – an dieser Stelle bef<strong>in</strong>det sich an der<br />
heutigen A 8 e<strong>in</strong> H<strong>in</strong>weisschild. Dann endete die<br />
<strong>END</strong> im nördlichen Teil von Neuhausen. Von der<br />
End-Ausweiche verlief e<strong>in</strong> Stumpfgleis bis zur Ortsmitte,<br />
das damals noch unregelmäßig von E<strong>in</strong>zeltriebwagen<br />
befahren wurde.<br />
der Zollbergsteige als Verkehrsh<strong>in</strong>dernis<br />
empfanden, baute sich e<strong>in</strong> lokalpolitischer<br />
Druck auf, den Störfaktor Schienenverkehr<br />
zu beseitigen. Unter diesen Umständen<br />
traf die Geschäfts führung der <strong>END</strong><br />
die Entscheidung, den Straßenbahnbetrieb<br />
zu beenden und den Weg für Busse frei zu<br />
machen.<br />
Dazu übergab sie Ende Februar 1978<br />
die Betriebsführung an den Städtischen<br />
Verkehrsbetrieb Essl<strong>in</strong>gen am Neckar<br />
<strong>Die</strong> <strong>END</strong> war <strong>in</strong> den 1950er- und 1960er-Jahren<br />
mit jährlich drei bis vier Millionen Fahrgästen<br />
unentbehrlich. Was die Zukunft br<strong>in</strong>gen würde,<br />
war unklar, aber als im Jahr 1958 zwei neue moderne<br />
Züge (Tw 12 + 13, Bw 36 + 37) <strong>in</strong> Betrieb<br />
g<strong>in</strong>gen, schien der Anfang für e<strong>in</strong>e neue <strong>END</strong> gemacht.<br />
Sogar Erweiterungspläne gab es, unter<br />
anderem von Neuhausen über Sielm<strong>in</strong>gen nach<br />
Bernhausen und nach Berkheim. Doch es blieb<br />
bei den Plänen …<br />
JÖRG ZIMMER<br />
(SVE), der als Ersatz für die beiden Straßenbahnl<strong>in</strong>ien<br />
zwei Busl<strong>in</strong>ien e<strong>in</strong>richtete:<br />
• die ED (Essl<strong>in</strong>gen – Denkendorf),<br />
seit 1985 L<strong>in</strong>ie 119<br />
• EN (Essl<strong>in</strong>gen – Neuhausen),<br />
seit 1985 L<strong>in</strong>ie 120<br />
Für diese L<strong>in</strong>ien beschaffte der SVE erstmals<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Geschichte Gelenkbusse des Daimler-Benz-Typs<br />
O305G. Für diese Bauart war<br />
das zugleich der erste kommerzielle E<strong>in</strong>satz.<br />
<strong>Die</strong> Straßenbahn Essl<strong>in</strong>gen–Nell<strong>in</strong>gen–Denkendorf<br />
GmbH existiert übrigens bis heute,<br />
sie firmiert allerd<strong>in</strong>gs seit März 1978 als<br />
<strong>END</strong> Verkehrsgesellschaft GmbH & Co.<br />
KG und erbr<strong>in</strong>gt vor allem im Landkreis<br />
Essl<strong>in</strong>gen lokale Verkehrsleistungen mit<br />
Bussen. <strong>Die</strong>sen Geschäftszweig hatte die<br />
<strong>END</strong> 1955 mit der Busl<strong>in</strong>ie Fi von Essl<strong>in</strong>gen<br />
nach Echterd<strong>in</strong>gen eröffnet und danach<br />
schrittweise ausgebaut.<br />
Museumspläne nach der E<strong>in</strong>stellung<br />
Da das Depot <strong>in</strong> Nell<strong>in</strong>gen und e<strong>in</strong> Großteil<br />
des Wagenparks nach der E<strong>in</strong>stellung 1978<br />
zunächst unverändert erhalten blieben, plante<br />
der damals bestehende Vere<strong>in</strong> „Straßenbahnmuseum<br />
Stuttgart e. V.“ (SMS), zwischen<br />
Nell<strong>in</strong>gen und Neuhausen e<strong>in</strong>en<br />
Museumsstraßenbahnbetrieb e<strong>in</strong>zurichten.<br />
Doch da der <strong>END</strong> <strong>in</strong> Nell<strong>in</strong>gen bereits Anfang<br />
März e<strong>in</strong>en längeren Abschnitt der<br />
Fahrleitung demontieren ließ, waren Fahrten<br />
bis Neuhausen nicht mehr möglich. Im Bereich<br />
des Depots und auf der Schillerstraße<br />
fanden nach der offiziellen E<strong>in</strong>stellung des<br />
Straßenbahnbetriebes dennoch mehrere Rangierfahrten<br />
statt. Möglich war das, weil sich<br />
e<strong>in</strong>es der Unterwerke direkt neben der Wagenhalle<br />
befand. Nach dem Ende der Strome<strong>in</strong>speisung<br />
<strong>in</strong> die Fahrleitung verschoben die<br />
Straßenbahnfreunde die verbliebenen Wagen<br />
per Muskelkraft oder mit Hilfe e<strong>in</strong>es Rüstwagens.<br />
Im April 1979 entschied der Geme<strong>in</strong>derat<br />
von Ostfildern, das Depotgelände<br />
<strong>in</strong> Nell<strong>in</strong>gen anderen Zwecken zuzuführen.<br />
Als Ausgleich bot er dem SMS e<strong>in</strong> Grundstück<br />
am Rand von Nell<strong>in</strong>gen zur Errichtung<br />
e<strong>in</strong>er Wagenhalle mit Museum an. <strong>Die</strong> paral-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
61
Geschichte<br />
Am Montag, dem 27. Februar 1978, waren die Tage der <strong>END</strong> längst gezählt. Ab Mittwoch dieser Woche fuhren die hier am Endpunkt <strong>in</strong> Denkendorf<br />
nicht weit vom Rathaus e<strong>in</strong>steigenden Schüler mittags mit dem Bus! Weitere <strong>END</strong>-Aufnahmen folgen im nächsten Heft<br />
WOLFGANG MEIER<br />
Er<strong>in</strong>nerungen an die letzten Jahre der <strong>END</strong><br />
Seit frühester K<strong>in</strong>dheit habe ich mich für Straßenbahnen<br />
<strong>in</strong>teressiert, vor allem für Fahrzeuge aus der<br />
Vorkriegszeit. Geboren und aufgewachsen <strong>in</strong> Düsseldorf,<br />
musste ich mich leider im Herbst 1974 von<br />
den letzten Vorkriegswagen <strong>in</strong> me<strong>in</strong>er Heimatstadt<br />
verabschieden. So blieb es nicht aus, me<strong>in</strong>en Bahnhorizont<br />
Richtung Süddeutschland zu erweitern,<br />
denn ich hatte gehört, dass es <strong>in</strong> Baden-Württemberg<br />
noch e<strong>in</strong>e Überlandstraßenbahn mit Vorkriegsfahrzeugen<br />
und Pendelschaffnern gab.<br />
Erster Besuch 1975<br />
Im August 1975 hatte ich zum ersten Mal die Gelegenheit,<br />
die Straßenbahn Essl<strong>in</strong>gen – Nell<strong>in</strong>gen – Denkendorf<br />
mit ihrem Abzweig nach Neuhausen zu besuchen.<br />
Von ihrer Existenz wusste ich erst seit kurzer Zeit,<br />
aber als jemand, der grade se<strong>in</strong>e Ausbildung begann,<br />
waren me<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>anziellen Möglichkeiten, was die Reisekasse<br />
ang<strong>in</strong>g – und vor allem die F<strong>in</strong>anzierung von<br />
Diafilmen – sehr e<strong>in</strong>geschränkt. Was mich besonders<br />
an der <strong>END</strong> reizte, waren die großen und für Meterspur<br />
sehr breiten alten Wagen aus der Vorkriegszeit,<br />
teilweise mit zweiachsigen Beiwagen und Schaffnern.<br />
<strong>Die</strong> Fahrzeuge waren völlig anders, als die, die<br />
ich aus dem Großstadtverkehr kannte. Zu dieser Zeit<br />
gab es <strong>in</strong> der alten Bundesrepublik Deutschland<br />
kaum noch Vorkriegswagen.<br />
Von Essl<strong>in</strong>gen fuhren die Straßenbahnen abwechselnd<br />
nach Denkendorf bzw. Neuhausen. Interessant<br />
war für mich vor allem die Streckenführung.<br />
<strong>Die</strong> meisten Streckenabschnitte im Netz waren e<strong>in</strong>gleisig.<br />
Es g<strong>in</strong>g von der Endhaltestelle <strong>in</strong> Essl<strong>in</strong>gen<br />
zweigleisig über die Pliensaubrücke, die den Neckar<br />
und die Eisenbahnstrecke Stuttgart – Essl<strong>in</strong>gen –<br />
Ploch<strong>in</strong>gen überquert. E<strong>in</strong> Stück h<strong>in</strong>ter der Brücke<br />
g<strong>in</strong>g es dann e<strong>in</strong>gleisig weiter. <strong>Die</strong> Strecke führte<br />
steil und serpent<strong>in</strong>enartig den Berg h<strong>in</strong>auf Richtung<br />
Zollberg. Bergwärts fuhren die Züge <strong>in</strong> Teilabschnitten<br />
gegen den talwärts fahrenden Autoverkehr.<br />
Mir war damals schon klar, dass dies e<strong>in</strong>e große<br />
Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer bedeutete.<br />
Der Betriebsmittelpunkt war Nell<strong>in</strong>gen mit dem<br />
dortigen Depot. Hier teilten sich auch die Strecken<br />
nach Neuhausen und Denkendorf.<br />
Besonders gut gefiel mir die Strecke nach Neuhausen.<br />
Es g<strong>in</strong>g über Wiesen und Felder mit Überwegen<br />
und Andreaskreuzen, teilweise sehr steil ansteigend<br />
Neuhausen entgegen. Zwischendr<strong>in</strong> gab<br />
es noch zwei romantische Ausweichen – Krähenbach<br />
und Scharnhausen Brücke. So bekam ich e<strong>in</strong>en<br />
ersten E<strong>in</strong>druck der Straßenbahn <strong>END</strong>. Es sollte<br />
nicht me<strong>in</strong> letzter Besuch se<strong>in</strong>.<br />
Letzter Besuch im Februar 1978<br />
1978 ergab sich e<strong>in</strong>e zweite und letzte Möglichkeit,<br />
kurz vor ihrer Still legung zur <strong>END</strong> zu fahren. Mit weiteren<br />
Straßenbahnfreunden besuchte ich am letzten<br />
Februarwochenende 1978 samstags die Stuttgarter<br />
Straßenbahn und sonntags die <strong>END</strong>. Das Wochenende<br />
war völlig verregnet, und wir konnten kaum<br />
Fotos machen. Eigentlich sollte die Rückfahrt am<br />
Sonntag se<strong>in</strong>. Wir fuhren die gesamte Strecke ab und<br />
entschlossen uns dann, e<strong>in</strong>e weitere Nacht zu bleiben.<br />
Wir hatten gehört, dass es am Morgen Schülerkurse<br />
mit zwei Beiwagen nach Neuhausen gab.<br />
Deshalb wollten wir die letzte Möglichkeit für Aufnahmen<br />
davon nutzen.<br />
Am nächsten Morgen überraschte uns die Sonne.<br />
Wir marschierten entlang der Strecke von Nell<strong>in</strong>gen<br />
nach Neuhausen und es entstanden schöne<br />
Bilder. Wir hatten noch leichten Bodennebel,<br />
der sich langsam mit der aufsteigenden Sonne<br />
verzog. <strong>Die</strong> Wege entlang der Strecke waren matschig,<br />
wodurch unsere Schuhe litten. Aber das war<br />
sehr schnell vergessen, denn wir bekamen landschaftlich<br />
schönste Motive geboten, auch erlebten<br />
wir die versprochenen Dreiwagenzüge.<br />
Gegenverkehr am Zollberg erlebt<br />
Dann fuhren wir auch noch den Abschnitt nach<br />
Denkendorf ab. Auf dieser Strecke verkehrten die<br />
zwei modernen Garnituren. So konnten wir –<br />
zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> der HVZ – die Umfahrung des Beiwagens<br />
<strong>in</strong> der dortigen Kuppelendstelle fotografieren.<br />
Zu guter Letzt marschierten wir noch die Strecke<br />
vom Zollberg nach Essl<strong>in</strong>gen h<strong>in</strong>unter. Jetzt erlebte<br />
auch ich persönlich, dass die e<strong>in</strong>gleisige<br />
Streckenführung e<strong>in</strong> echtes H<strong>in</strong>dernis darstellte.<br />
Parallel fuhren probeweise schon Gelenkbusse die<br />
Strecke entlang. Zwei Tage später übernahmen sie<br />
den Verkehr und die <strong>END</strong> war Geschichte. Wir<br />
konnten so noch den vorletzten Tag der <strong>END</strong> im<br />
vollen Betrieb erleben und sie bleibt mir – vor allem<br />
beim Anblick der Bilder – immer <strong>in</strong> guter Er<strong>in</strong>nerung.<br />
WOLFGANG MEIER AUS NEUSS IM JUNI 2014<br />
62 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
<strong>END</strong><br />
lel beg<strong>in</strong>nende Umgestaltung von Straßen <strong>in</strong><br />
Nell<strong>in</strong>gen und Neuhausen ließ für e<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>nvollen<br />
Museumsstraßenbahnbetrieb ke<strong>in</strong>en<br />
Raum. Am 2. Dezember 1981 kam das endgültige<br />
Aus für das Museumsprojekt. Am Ersatzdomizil<br />
im badischen Schönau unterhielten<br />
die Mitglieder des SMS auch mehrere<br />
ehemalige <strong>END</strong>-Fahrzeuge, bis sich die Vere<strong>in</strong>igung<br />
1995 auflöste und fast alle Wagen<br />
den Weg alten Eisens g<strong>in</strong>gen.<br />
Spurensuche 2014<br />
Anstelle der 1926/29 gebauten Nell<strong>in</strong>ger<br />
Wagenhalle entstand an gleicher Stelle bis<br />
1989 nach deren Baupr<strong>in</strong>zipien e<strong>in</strong> Kulturzentrum,<br />
das den Namen „Halle“ trägt.<br />
Im Bereich der ehemaligen Ausweichstellen<br />
Krähenbach und Scharnhausen haben<br />
vier Strommasten die Jahrzehnte seit der<br />
Stilllegung überdauert. <strong>Die</strong> Stadt Ostfildern<br />
sieht den Erhalt dieser Zeitzeugen vor, dazu<br />
wäre jedoch e<strong>in</strong>e Sicherung der Substanz<br />
dr<strong>in</strong>gend notwendig – die Korrosion ist an<br />
allen vier Masten nicht zu übersehen. <strong>Die</strong><br />
e<strong>in</strong>stige Strecke der <strong>END</strong> ist an vielen Stellen<br />
noch zu sehen, auch wenn sonst nur noch<br />
wenig an die Straßenbahn er<strong>in</strong>nert.<br />
Von den Fahrzeugen aus den 1920er-Jahren<br />
werden der Tw 2 im Zustand von 1978<br />
sowie der Tw 4 im Zustand von ca. 1930 <strong>in</strong><br />
der Straßenbahnwelt Stuttgart erhalten. Der<br />
nach E<strong>in</strong>stellung der <strong>END</strong> geme<strong>in</strong>sam mit<br />
dem Bw 22 am Zollberg als Denkmal aufgestellte<br />
Tw 3 (Baujahr 1926) bef<strong>in</strong>det sich<br />
seit 1981 (mit dem Beiwagen) für die Öffentlichkeit<br />
nicht zugänglich im Landesmuseum<br />
für Technik und Arbeit <strong>in</strong> Mannheim.<br />
Der bis vor kurzem im Hannoverschen Straßenbahn-Museum<br />
<strong>in</strong> Sehnde-Wehm<strong>in</strong>gen<br />
erhaltene Tw 8 wurde im Jahr 2012 aufgrund<br />
se<strong>in</strong>es schlechten Zustandes ver-<br />
Das Gestrüpp sowie der Baum wachsen auf der alten <strong>END</strong>-Trasse nach Neuhausen, während<br />
im H<strong>in</strong>tergrund e<strong>in</strong> Zug der U7 nach Ostfildern-Nell<strong>in</strong>gen fährt<br />
DIETER SCHLIPF<br />
Per Stadtbahn zum Zollberg?<br />
Seit dem Jahr 2000 ist das <strong>in</strong> Ostfildern aufgegangene<br />
Nell<strong>in</strong>gen mit den L<strong>in</strong>ien U7 und U8 an<br />
das Stuttgarter Stadtbahnnetz angeschlossen. E<strong>in</strong><br />
Wiederaufbau der Straßenbahn als Stadtbahn bis<br />
zum Bahnhof Essl<strong>in</strong>gen wird seit Jahren untersucht.<br />
Pläne für die Verlängerung der U7 bis nach<br />
Essl<strong>in</strong>gen s<strong>in</strong>d vorhanden. Der Verlauf sieht nach<br />
der Ortsdurchfahrt von Nell<strong>in</strong>gen e<strong>in</strong>en Tunnel<br />
schrottet. Von den beiden 1982 an die Rittnerbahn<br />
nach Südtirol verkauften Ganzstahlwagen<br />
aus dem Jahr 1958 ist Tw 12<br />
als Reservewagen<br />
noch <strong>in</strong> Oberbo-<br />
Freuen Sie sich auf viele weitere<br />
Bildraritäten aus dem Alltag der<br />
<strong>END</strong> <strong>in</strong> der kommenden Ausgabe!<br />
zen vorhanden,<br />
Tw 13 h<strong>in</strong>gegen<br />
bef<strong>in</strong>det sich seit<br />
Dezember 2012<br />
<strong>in</strong> der Stuttgarter Straßenbahnwelt, muss<br />
aber noch restauriert werden. Erhalten geblieben<br />
ist auch Tw 20 II (Essl<strong>in</strong>gen 1950, bis<br />
1965 SSB Nr. 297). Er bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> Geilenkirchen-Gillrath<br />
<strong>in</strong> Privateigentum.<br />
Neben diesen sechs Triebwagen und dem<br />
Bw 22 gibt es noch drei ehemalige <strong>END</strong>-<br />
und e<strong>in</strong>e mit modernen Stadtbahnzügen heutzutage<br />
zu bewältigende Steigungsstrecke den Zollberg<br />
h<strong>in</strong>unter vor. Anschließend wäre e<strong>in</strong>e neue<br />
Brücke über den Neckar notwendig. Doch noch ist<br />
nichts entschieden, aber die Chancen stehen nicht<br />
schlecht, dass anstelle der früheren meterspurigen<br />
blau-grünen <strong>END</strong> <strong>in</strong> Zukunft e<strong>in</strong>e normalspurige<br />
gelbe Stadtbahn verkehren könnte. JÖRG ZIMMER<br />
Beiwagen: Der Bw 21 wird vom Vere<strong>in</strong><br />
„Stuttgarter Historische Straßenbahnen<br />
e.V.“ als nicht betriebsfähiges Exponat erhalten.<br />
Bw 23 wird als<br />
stationäres Café „Alte<br />
Achse“ genutzt. Der von<br />
1951 bis 1965 als Bw 41<br />
von der <strong>END</strong> geführte<br />
Bw 22 der Eßl<strong>in</strong>ger<br />
Städtischen Straßenbahn bef<strong>in</strong>det sich ebenfalls<br />
<strong>in</strong> der Stuttgarter Straßenbahnwelt.<br />
Aufgrund der Begeisterung auch jüngerer<br />
Straßenbahnfreunde für die <strong>END</strong> sehen die<br />
noch erhaltenen Fahrzeuge der e<strong>in</strong>stigen Überlandstrecke<br />
e<strong>in</strong>er gesicherten Zukunft entgegen.<br />
Der Nimbus <strong>END</strong> lebt! ANDRÉ MARKS<br />
In der Stuttgarter Straßenbahnwelt werden neben den Tw 2, 4 und 13 auch noch die Bw 21,<br />
23 und 41 (als ESS-Bw 22) sowie e<strong>in</strong> Schleifwagen und e<strong>in</strong>e Verschublore der Nachwelt<br />
erhalten. <strong>Die</strong> letzten Oberleitungsmasten der <strong>END</strong> stehen h<strong>in</strong>gegen im Körschtal bei Scharnhausen,<br />
hier Ende 2013 fotografiert<br />
HANS-JOACHIM KNUPFER (LINKS), JÜRGEN DAUR (RECHTS)<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
63
Geschichte<br />
<strong>Die</strong> so genannte Begerburg <strong>in</strong> Dresden-Dölzschen<br />
war e<strong>in</strong> beliebtes Fotomotiv im Plauenschen<br />
Grund . Inzwischen ist sie von der hier<br />
das Tal über querenden Autobahn aus zu sehen.<br />
Daran war am 17. Mai 1974 noch nicht zu<br />
denken – als die L<strong>in</strong>ie 3 noch bis Freital fuhr<br />
FRANK EBERMANN<br />
Ablösung durch den Bus<br />
Details zum Ende von L<strong>in</strong>ie 3 nach Freital Am zeitigen Morgen des 26. Mai 1974 fuhr die<br />
letzte Straßenbahn von Freital-Ha<strong>in</strong>sberg nach Dresden-Löbtau. Dann übernahmen Busse diese<br />
Leistung. Doch es war nicht der erste E<strong>in</strong>satz dieses Verkehrsmittels auf L<strong>in</strong>ie 3 …<br />
Ab 7. Oktober 1902 verband die<br />
Staatsstraßenbahn Löbtau – Deuben<br />
den Anfang 1903 <strong>in</strong> Dresden<br />
e<strong>in</strong>geme<strong>in</strong>deten Stadtteil der sächsischen<br />
Residenzstadt mit Deuben im<br />
Döhlener Becken, wo 1921 durch den Zusammenschluss<br />
mehrerer bis dah<strong>in</strong> selbstständiger<br />
Geme<strong>in</strong>den die Stadt Freital entstand.<br />
<strong>Die</strong> Vorgeschichte dieser <strong>in</strong> 1.450-mm-<br />
Stadtspur errichteten Straßenbahn, ihren<br />
Bau, ihre Verlängerungen nach Ha<strong>in</strong>sberg<br />
und (Ha<strong>in</strong>sberg-)Coßmannsdorf sowie den<br />
Betrieb bis 1974 stellte bereits der Beitrag<br />
im <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 7/2014<br />
vor. Nach dessen Ersche<strong>in</strong>en meldeten sich<br />
viele Straßenbahnfreunde und berichteten<br />
von den letzten Betriebsmonaten der L<strong>in</strong>ie 3<br />
<strong>in</strong> Freital. <strong>Die</strong>se Informationen folgen hier<br />
nun zusammengefasst.<br />
In den 1960er-Jahren hatte der schaffnerlose<br />
OS-Verkehr mit Zahlboxen den ZZ-<br />
Betrieb auch auf der L<strong>in</strong>ie 3 nach Freital abgelöst.<br />
Im Jahr 1973 löste wiederum das<br />
Fahrsche<strong>in</strong>-Entwerter-System diese Abfertigungsmethode<br />
ab. Dazu erhielten die auf<br />
dieser Strecke vom Wilden Mann bis nach<br />
Freital-Ha<strong>in</strong>sberg noch verwendeten Vorkriegswagen<br />
– allesamt städtische Normalwagen<br />
teils auf MAN-Untergestellen – entsprechende<br />
Entwerterboxen. In den letzten<br />
Betriebsjahren der L<strong>in</strong>ie 3 gab es dabei mehrere<br />
Freitaler „Stammwagen“. Zu ihnen<br />
zählten unter anderem die Tw 203 660, 203<br />
664, 203 666, 203 672, 203 677, 203 679,<br />
203 680, 203 683, 203 707, 203 712 und<br />
203 716. Sie waren im Normalfall mit jeweils<br />
zwei Beiwagen unterwegs.<br />
Anfang der 1970er-Jahre fiel die Entscheidung,<br />
die Straßenbahn von Dresden-<br />
Löbtau nach Freital e<strong>in</strong>zustellen und auf<br />
Busbetrieb umzustellen. <strong>Die</strong> Straßenbahn<br />
wurde zu dieser Zeit e<strong>in</strong>erseits als H<strong>in</strong>dernis<br />
für den Straßenverkehr angesehen, andererseits<br />
fehlte es an Kapazitäten, die Gleise<br />
im Plauenschen Grund zu erneuern, um<br />
auf der Strecke regulär vierachsige Tatrawagen<br />
e<strong>in</strong>setzen zu können.<br />
Der Bus-Test<br />
Ende 1973 trafen Verkehrsbetriebe und Rat<br />
der Stadt Freital die Entscheidung, die Straßenbahn<br />
nach Ha<strong>in</strong>sberg e<strong>in</strong>zustellen und<br />
auf Busbetrieb umzustellen. Um zu überprüfen,<br />
ob die Straßen die Voraussetzungen für<br />
den Betrieb mit Gelenkbussen erfüllten, fand<br />
am Sonntag, dem 10. Februar 1974 e<strong>in</strong> Probebetrieb<br />
statt. An diesem Tag blieben alle<br />
Straßenbahnwagen im Depot <strong>in</strong> Freital, was<br />
die im Heft 7/14 abgedruckte Aufnahme auf<br />
64 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Dresden/Freital<br />
Quelle<br />
Holger Michel, Ralph Gruner, Bodo Nienerza:<br />
<strong>Die</strong> ehemalige Straßenbahnstrecke Dresden –<br />
Freital, <strong>in</strong>: Verkehrsgeschichtliche Blätter 5/1984<br />
den Seiten 62/63 beweist. Denn dieses Dia<br />
entstand nicht im Mai 1974, sondern an<br />
eben jenem 10. Februar 1974, wie se<strong>in</strong> Urheber<br />
Hans-<strong>Die</strong>ter Rändler der Redaktion<br />
nachträglich mitteilte, nachdem er bei Redaktionsschluss<br />
von Heft 7 im Urlaub war.<br />
Der Dresdner Eisenbahn- und Straßenbahnfreund<br />
war an jenem Sonntag auf dem<br />
Weg zur Weißeritztalbahn. Anders als gewohnt<br />
hieß es jedoch am damaligen Willi-Ermer-Platz<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Ikarus 180 des VEB Kraftverkehr<br />
Freital Dresden umzusteigen. <strong>Die</strong>ser<br />
bediente an diesem Tag alle Haltestellen der<br />
L<strong>in</strong>ie 3. Bei der Vorbeifahrt am Straßenbahndepot<br />
<strong>in</strong> Freital sah Rändler die vollgestellte<br />
Halle. Er stieg daraufh<strong>in</strong> aus dem Bus aus und<br />
lichtete diese tagsüber an regulären Betriebstagen<br />
der L<strong>in</strong>ie 3 undenkbare Parade ab.<br />
Vor zwei Wochen wies der Dresdner aber<br />
auch auf e<strong>in</strong>e Besonderheit der Aufnahme<br />
auf Seite 60 im vorigen Heft h<strong>in</strong>: Unter dem<br />
Haltestellenschild der Straßenbahnl<strong>in</strong>ie 3<br />
war am 17. Mai bereits e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>es Schild<br />
mit der Nummer „3A“ angebracht – obwohl<br />
es die Busl<strong>in</strong>ie 3A noch gar nicht gab,<br />
sondern e<strong>in</strong>zig die Straßenbahnl<strong>in</strong>ie 3 die<br />
Haltestellen im Plauenschen Grund und<br />
Freital bediente. Demnach waren bereits<br />
vor E<strong>in</strong>stellung des Straßenbahnbetriebes<br />
die Busl<strong>in</strong>iennummernschilder an den Haltestellen<br />
befestigt worden.<br />
Der 25./26. Mai 1974<br />
Verkehrte die L<strong>in</strong>ie 3 am 25. Mai 1974 zwar<br />
noch im vollen Umfang bis Freital, so räumten<br />
die Verkehrsbetriebe dennoch bereits das<br />
dortige Depot. Am Abend waren alle Fahrzeuge<br />
von dort abgezogen, so dass sich nach<br />
der Rückfahrt des letzen Zuges am Morgen<br />
des 26. Mai 1974 nach Dresden ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ziger<br />
Straßenbahnwagen mehr <strong>in</strong> Freital befand.<br />
<strong>Die</strong> L<strong>in</strong>ie 3 verkehrte mit Betriebs -<br />
beg<strong>in</strong>n 4 Uhr vom Wilden Mann über<br />
Hauptbahnhof bis Plauen Nöthnitzer Straße<br />
– erstmals mit Tatrawagen. Dresden-Löbtau<br />
und Freital-Ha<strong>in</strong>sberg verband fortan der<br />
VEB Kraftverkehr mit der Busl<strong>in</strong>ie 3A.<br />
<strong>Die</strong> Wendeschleife Freial-Ha<strong>in</strong>sberg<br />
<strong>Die</strong> Bildunterschrift zur im Heft 7 auf Seite<br />
63 oben abgedruckten Aufnahme enthält ver -<br />
sehentlich e<strong>in</strong>en Fehler. So blickte Frank<br />
Ebermann für diese Fotografie nicht auf die<br />
E<strong>in</strong>fahrweiche zur Wendeschleife Freital-<br />
Ha<strong>in</strong>sberg, sondern auf die Ausfahrweiche.<br />
Was durch die heutige Bebauung des Areals<br />
mit e<strong>in</strong>em Neubaublock kaum noch vorstellbar<br />
ist – die Straßenbahn führte bis auf die<br />
Am 24. April 1974 fand e<strong>in</strong>e Sonderfahrt mit dem Fahrschulwagen 724 012 nach Freital statt. <strong>Die</strong><br />
Aufnahme zeigt ihn auf der E<strong>in</strong>fahrweiche zur Wendeschleife am Endpunkt Ha<strong>in</strong>sberg im 1933 e<strong>in</strong>geme<strong>in</strong>deten<br />
Coßmansdorf. Vor 1961 endete die Straßenbahn hier stumpf HANS-DIETER RÄNDLER (2)<br />
Nicht im Mai, sondern am Sonntag, dem 10. Februar 1974, entstand diese Aufnahme der an diesem<br />
Tag im Depot Freital-Deuben gebliebenen Wagen der L<strong>in</strong>ie 3. An jenem Tag verkehrten probeweise<br />
Gelenkbusse vom Typs Ikarus 180 des VEB Kraftverkehr Dresden auf dieser L<strong>in</strong>ie<br />
Höhe des Stationshäuschens der Schmalspurbahn<br />
parallel zu dieser 750-mm-Strecke<br />
und bog erst mehrere Meter weiter nach l<strong>in</strong>ks<br />
<strong>in</strong> den Schleifenbogen ab.<br />
In diesem befand sich der<br />
Abzweig zum Ausweichgleis<br />
– siehe Grafik.<br />
Auch wenn die heutige<br />
Bebauung der Wendeschleife<br />
das vor Ort<br />
nicht mehr nachvollziehen<br />
lässt, so ist doch das<br />
1961 e<strong>in</strong>geweihte Haltestellengebäude<br />
der Straßenbahn<br />
bis heute er halten.<br />
ANDRÉ MARKS<br />
<strong>Die</strong> Wendeschleife<br />
Ha<strong>in</strong>sberg <strong>in</strong><br />
Coßmannsdorf<br />
GRAFIK:<br />
MÜLLER/vb 5/84<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
65
Geschichte<br />
Vor dem Neubeg<strong>in</strong>n …<br />
<strong>Die</strong> Münchner Straßenbahn vor 20 Jahren 1994 befand sich die Tram <strong>in</strong> der bayerischen<br />
Landeshauptstadt auf ihrem historischen Tiefpunkt: Noch wenige Monate zuvor hatte es Streckenstilllegungen<br />
gegeben – aber wie fand Stefan H<strong>in</strong>der aus Oldenburg den Betrieb vor?<br />
Es dürfte selten vorkommen, dass Tagestouristen<br />
München besuchen und<br />
ihr Interesse nicht der Frauenkirche,<br />
dem Hofbräuhaus, dem Englischen<br />
Garten oder vielleicht dem Deutschen Museum<br />
gilt, sondern hauptsächlich der „Trambahn“,<br />
wie sie von den Münchnern umgangs -<br />
sprachlich genannt wird. Um mich nicht mit<br />
dem dichten Straßenverkehr von Münchens<br />
Umgebung herumquälen zu müssen, reiste<br />
ich im Rahmen me<strong>in</strong>es Privatprojektes „Bayerntram“<br />
(siehe SM 6/2014, Seite 64ff.) am<br />
24. März 1994 per Zug von Augsburg nach<br />
München und wieder zurück.<br />
Das Tauziehen um die Zukunft der Straßenbahn<br />
<strong>in</strong> München war damals schon<br />
Jahrzehnte im Gange und hatte allerhand<br />
jähe Wendungen, Lippenbekenntnisse und<br />
Querschüsse hervorgebracht. 1994 befand<br />
sich die Münchner Tram auf ihrem historischen<br />
Tiefpunkt: Noch wenige Monate zuvor<br />
hatte es Streckenstilllegungen gegeben<br />
(im Mai 1993 die SL 16 zum Lorettoplatz<br />
und im November 1993 die SL 12 und 13<br />
nach Harthof bzw. Hasenbergl). Laufend<br />
stellte der Verkehrsbetrieb weitere Wagen<br />
ab, der Fahrzeugpark hatte mittlerweile den<br />
– verglichen mit früheren Zeiten – für Münchener<br />
Verhältnisse bescheidenen Umfang<br />
von 118 Trieb- und 112 Beiwagen erreicht.<br />
Das Straßenbahnnetz umfasste noch acht<br />
L<strong>in</strong>ien, von denen aber die L<strong>in</strong>ien 15/25<br />
und 20/21 praktisch je e<strong>in</strong>e L<strong>in</strong>ie darstellten:<br />
<strong>Die</strong> L<strong>in</strong>ien 15 und 21 verdichteten nur<br />
den jeweils stärker belasteten Abschnitt der<br />
zugeordneten Stamml<strong>in</strong>ien.<br />
Niederflurwagen sehr schadanfällig<br />
– dreiachsige M/m-Züge dom<strong>in</strong>ieren!<br />
Zwar waren seit 1990/91 drei Niederflurwagen<br />
des MAN/AEG-Typs als Prototypen e<strong>in</strong>er<br />
geplanten neuen Fahrzeuggeneration vorhan-<br />
66 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
München<br />
Am Hauptbahnhof zeigten sich<br />
die beiden 1994 <strong>in</strong> München<br />
im Wesentlichen e<strong>in</strong>ge setzten<br />
Typen von Straßenbahnwagen:<br />
L<strong>in</strong>ks e<strong>in</strong> klassischer M-Dreiachserzug<br />
mit Tw 2519 und<br />
Bw 3531 auf L<strong>in</strong>ie 20.<br />
Auf dem Gegengleis steht e<strong>in</strong><br />
P-Zug der L<strong>in</strong>ie 21<br />
Auch <strong>in</strong> München gab es schon e<strong>in</strong> Stück Straßenbahn <strong>in</strong> der Fußgängerzone – und zwar<br />
<strong>in</strong> der Maffeistraße, die von e<strong>in</strong>em Gebäudeflügel der Bayerischen Vere<strong>in</strong>sbank überbaut ist.<br />
E<strong>in</strong> P-Zug mit Tw 2009 an der Spitze passiert gerade diese Stelle<br />
ALLE FOTOS: STEFAN HINDER<br />
L<strong>in</strong>iennetz der Münchner<br />
Straßenbahn 1994<br />
12 Scheidplatz – Amalienburgstraße<br />
15 St.-Mart<strong>in</strong>s-Platz – Großhesseloher Brücke<br />
(nur tagsüber)<br />
18 Effnerplatz – Gondrellplatz<br />
19 Pas<strong>in</strong>g, Marienplatz – St.-Veit-Straße<br />
20 Effnerplatz – Moosach<br />
21 Sendl<strong>in</strong>ger Tor – Hanauer Straße<br />
25 St.-Mart<strong>in</strong>s-Platz – Grünwald<br />
27 Petuelr<strong>in</strong>g – Schwanseestraße<br />
An der Strecke nach Grünwald gab es<br />
zahlreiche hübsche Wartehäuschen, so wie<br />
hier an der Haltestelle Menterschwaige.<br />
Der von Tw 2535 geführte Zug der L<strong>in</strong>ie 15<br />
wird <strong>in</strong> wenigen hundert Metern die Stadtgrenze<br />
und damit se<strong>in</strong> Fahrtziel erreichen<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
67
Geschichte<br />
Wagenpark der Münchner Straßenbahn im März 1994 (nur betriebsfähige Wagen des Personenverkehrs)<br />
Triebwagen<br />
Tw-Nr. Typ Bauart Hersteller Baujahr Anzahl<br />
2003 bis 2017, 2019 bis 2044 P3.16 4x ER-Gel-Tw Rathgeber 1966 bis 1968 41<br />
2701 bis 2703 R1.1 6x ER-Gel-Tw Nfl MAN 1990/91 3<br />
2403/-08/-10/-11/-14/-20/-24/-25/ M4.65 3x ER-Tw Rathgeber 1956 bis 1959 17<br />
-28/-31/-43/-51/-53/-58/-62/-64/-66<br />
2502, 2506 bis 2509, 2511 bis 2513/-16, M5.65 3x ER-Tw Rathgeber 1963 20<br />
2518 bis 2526, 2529, 2535<br />
2602 bis 2614, 2616 bis 2620, 2651, 2653 bis 2670 M5.65 3x ER-Tw Rathgeber 1964/65 37<br />
Gesamt 118<br />
Beiwagen<br />
Bw-Nr. Typ Bauart Hersteller Baujahr Anzahl<br />
3003 bis 3040 p3.17 4x ER-Gel-Bw Rathgeber 1966 bis 1968 38<br />
3402/-03/-08/-11/-12/-14/-16 bis -18, 3427/-30/-36/-39/ m4.65 3x ER-Bw Rathgeber 1956 bis 1959 29<br />
-41/-48/-49/-60, 3462 bis 3467/-69/-71/-75/-91/-97/-98<br />
3501 bis 3545 m5.65 3x ER-Bw Ratgeber 1963/64 45<br />
Gesamt 112<br />
Am Maxmonument<br />
kreuzt der Dreiachszug<br />
Tw 2609 + Bw 3417<br />
auf L<strong>in</strong>ie 20 die Strecke<br />
der L<strong>in</strong>ie 19. Der<br />
Beiwagen gehört noch<br />
zur älteren Spielart<br />
m4.65. Im H<strong>in</strong>tergrund<br />
das Maximilianeum<br />
(Sitz des bayerischen<br />
Landtages)<br />
68 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
München<br />
den, und e<strong>in</strong>e erste Rate von 20 Serienfahrzeugen<br />
war fest bestellt – aber trotzdem: Ich<br />
traute dem Frieden nicht so ganz, denn immer<br />
wieder gab es widersprüchliche Signale. Beispielsweise<br />
hatten die Verkehrsbetriebe noch<br />
Anfang 1994 angekündigt, die Strecke zum<br />
Petuelr<strong>in</strong>g nur noch im Auslaufbetrieb zu befahren<br />
und mittelfristig stilllegen zu wollen.<br />
Glücklicherweise ist es dazu nicht gekommen.<br />
<strong>Die</strong> lange Zeit modernsten Münchner<br />
Straßenbahnwagen, die Gelenkzüge vom<br />
Typ P (Tw) bzw. p (Bw), waren noch fast alle<br />
da; ausgeschieden waren bis dah<strong>in</strong> lediglich<br />
die beiden Probezüge sowie der unfallbeschädigte<br />
Tw 2018. Ihr E<strong>in</strong>satzgebiet umfasste<br />
die L<strong>in</strong>ien 19 und 21, teilweise auch<br />
die 20. Auf der L<strong>in</strong>ie 19 waren auch die drei<br />
erwähnten Niederflur-Prototypen 2701 bis<br />
2703 zu f<strong>in</strong>den – wenn sie denn fuhren, sie<br />
galten als recht schadanfällig. Ich bekam nur<br />
e<strong>in</strong>en von ihnen zu Gesicht, den Tw 2701.<br />
<strong>Die</strong> drei Niederflur-Prototypen kamen 1994 – je nach Verfügbarkeit – auf der L<strong>in</strong>ie 19 zum<br />
E<strong>in</strong>satz. Hier Triebwagen 2701 am 24. März am Max-Weber-Platz. <strong>Die</strong>ser Wagen läuft heute<br />
<strong>in</strong> Norrköp<strong>in</strong>g unter der Nummer 22 und dem Taufnamen „München“<br />
Alles andere war noch <strong>in</strong> der Hand der dreiachsigen<br />
M/m-Züge, und das war aus me<strong>in</strong>er<br />
Sicht auch gut so. Auf diese Weise konnte ich<br />
noch das typische Gesicht der Münchener<br />
Tram der 1950er- bis 1980er-Jahre erleben –<br />
spät, aber nicht zu spät. Trotz des geschrumpften<br />
Streckennetzes reichte e<strong>in</strong> Tag natürlich<br />
nicht, um es komplett kennen zu lernen. Ich<br />
steuerte zunächst e<strong>in</strong>ige markante <strong>in</strong>nenstadtnahe<br />
Knotenpunkte an, wie zum Beispiel den<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
69
Geschichte<br />
An der Zwischenwendeschleife der Strecke nach Grünwald an der Großhesseloher Brücke bot das „Weiß-Blaue Stand’l“ Brotzeiten und Erfrischungen.<br />
Der Fahrer des Tw 2661 hat es damit offenbar so eilig, dass er das Zielschild noch gar nicht für die Rückfahrt umgestellt hat ...<br />
Und 20 Jahre danach?<br />
München hat se<strong>in</strong>en Fahrzeugpark <strong>in</strong>zwischen<br />
fast komplett auf Niederflurwagen umgestellt,<br />
von denen es <strong>in</strong>zwischen sogar vier unterschiedliche<br />
Typen gibt. Trotzdem hält sich zäh e<strong>in</strong><br />
sehr kle<strong>in</strong>er Rest des Altbestandes – aktuell vier<br />
Trieb- und drei Beiwagen des Typs P/p.<br />
Das Straßenbahnnetz ist gewachsen und umfasst<br />
mittlerweile wieder 13 L<strong>in</strong>ien. Den 1996/97 wiederaufgebauten<br />
Abschnitten Hauptbahnhof –<br />
Romanplatz und Ostfriedhof – Wörthstraße folgten<br />
ab 2009 die neuen Strecken zur Münchner<br />
Freiheit, nach Schwab<strong>in</strong>g Nord und nach St. Emmeram.<br />
Weitere Neubaustrecken s<strong>in</strong>d geplant.<br />
„Stachus“ oder das Maxmonument, das die<br />
Straßenbahn an allen vier Seiten umfährt. <strong>Die</strong><br />
Überlandstrecke nach Grünwald befuhr ich<br />
aus Zeitgründen nur bis zur Großhesseloher<br />
Brücke, wo auch die Züge der Verstärkungsl<strong>in</strong>ie<br />
15 wendeten.<br />
Alte M4.65 waren schon selten<br />
E<strong>in</strong>e bedauerliche Panne passierte mir: Der<br />
Bestand an Dreiachsern umfasste im Wesentlichen<br />
nur noch deren neueste Spielart<br />
M5.65 (Tw) bzw. m5.65 (Bw), die sich von<br />
ihren Vorläufern durch Außenschwenktüren<br />
und e<strong>in</strong>e vor die Mittelachse verlegte<br />
Mitteltür unterschied. <strong>Die</strong> älteren Typen<br />
M4.65 bzw. m4.65 mit ihren charakteristi-<br />
schen Teleskop-Schiebtüren waren selten<br />
geworden, besonders die Triebwagen. <strong>Die</strong>se<br />
fuhren nur noch e<strong>in</strong>zelne Kurse auf der<br />
L<strong>in</strong>ie 12, was ich aber erst im Laufe des Tages<br />
herausbekam. Me<strong>in</strong>e wenigen Aufnahmen<br />
von diesen Fahrzeugen entstanden daher<br />
schon <strong>in</strong> der Dämmerung und gerieten<br />
nicht allzu gut.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs war dies nicht der wesentliche<br />
Grund, warum ich die abendliche Rückreise<br />
nach Stadtbergen <strong>in</strong> eher gedämpfter Stimmung<br />
antrat. Es lag mehr daran, dass der<br />
Münchner Straßenbahnbetrieb auf mich<br />
noch nicht so richtig zukunftsträchtig wirkte<br />
– vor allem nicht im Vergleich mit dem quirligen<br />
Augsburger Betrieb. STEFAN HINDER<br />
Am Karlsplatz, dem „Stachus“, gab es bei der E<strong>in</strong>fahrt <strong>in</strong> die Bahnsteige<br />
oft Parallelfahrten von Straßenbahnzügen, hier zwischen dem<br />
Tw 2043 auf L<strong>in</strong>ie 21 und Tw 2520 auf der 27<br />
Ihn traf Stefan H<strong>in</strong>der bei se<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>tägigen Münchenbesuch erst <strong>in</strong><br />
der Dämmerung: den M4.65 aus den 1950er-Jahren. Tw 2403 verlässt<br />
mit e<strong>in</strong>em Beiwagen die Endschleife Amalienburgstraße<br />
70 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Geschichte<br />
Am Endpunkt Kugelbake steht 1914 der Triebwagen 3 mit Honoratioren. <strong>Die</strong> Fahrzeuge waren „gefällig rot und gelb gestrichen“, wie e<strong>in</strong> Chronist<br />
bemerkte. Lediglich die Motorhaube war nicht lackiert, um Abblätterungen beim Öffnen zu vermeiden FOTOS: STADTARCHIV CUXHAVEN (2)<br />
Ganze 28 Tage <strong>in</strong> <strong>Die</strong>nst<br />
<strong>Die</strong> Straßenbahn <strong>in</strong> Cuxhaven 2014 ist das Jahr des Gedenkens an den Beg<strong>in</strong>n des Ersten<br />
Weltkriegs. Unmittelbar damit verknüpft ist aber auch die Er<strong>in</strong>nerung an die kurze Betriebszeit<br />
der Straßenbahn <strong>in</strong> Cuxhaven: Nach nicht e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>em Monat war das Kapitel zu Ende ...<br />
In Cuxhaven – ganz an der Spitze des<br />
„Nassen Dreiecks“ zwischen Weser und<br />
Elbe gelegen – begann der See-Tourismus<br />
vor über 100 Jahren sprunghaft zu<br />
wachsen. E<strong>in</strong> neues Verkehrsmittel sollte die<br />
Verkehrsströme lenken. Aber: Alles sollte<br />
günstig se<strong>in</strong>! <strong>Die</strong> Stadtverwaltung fand dazu<br />
tatsächlich e<strong>in</strong>e Möglichkeit für e<strong>in</strong>en<br />
Trambetrieb ohne Oberleitung und ohne<br />
Neufahrzeuge. Sie erwarb 1914 von der<br />
Schmöckwitz-Grünauer Uferbahn bei Berl<strong>in</strong><br />
drei regelspurige Benzoltriebwagen, die<br />
sich dort nicht e<strong>in</strong>mal fünf Monate vom<br />
9. März bis zum 24. Juli 1912 im E<strong>in</strong>satz<br />
befunden hatten. Dass diese kurze E<strong>in</strong>satzzeit<br />
<strong>in</strong> Cuxhaven noch unterboten werden<br />
sollte, ahnte niemand …<br />
Betrieb nur unter Bed<strong>in</strong>gungen<br />
Als Anfang der 1910er-Jahre die Diskussion<br />
aufkam, auch <strong>in</strong> Cuxhaven zur Bewältigung<br />
zunehmender Verkehrsbedürfnisse von E<strong>in</strong>wohnern<br />
und Erholungssuchenden e<strong>in</strong>en<br />
Straßenbahnverkehr e<strong>in</strong>zuführen, lag der<br />
Gleiskörper, auf dem die Tram verkehren<br />
sollte, bereits seit längerem: Seit 1891 gewährleistete<br />
e<strong>in</strong>e von den Gleisgruppen des<br />
Hauptbahnhofs ausscherende Schienenverb<strong>in</strong>dung<br />
e<strong>in</strong>en Direktanschluss des etwa<br />
vier Kilometer (1) weiter nördlich gelegenen<br />
Forts Kugelbake, das vor allem der Verteidigung<br />
des Schifffahrtswegs Elbe diente.<br />
Dass die Wagen der Städtischen Bahn Cuxhaven<br />
aus zweiter Hand stammten, sah man ihnen,<br />
hier Tw 1, nicht an. An ihrem zweiten E<strong>in</strong>satzort<br />
zierte sie die Kugelbake – e<strong>in</strong> weith<strong>in</strong> sichtbares<br />
Seezeichen und zugleich das Stadtwappen<br />
72 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Tram Cuxhaven<br />
<strong>Die</strong>se im Volksmund als „Kanonenbahn“<br />
bezeichnete Strecke unterstand der Kaiserlichen<br />
Mar<strong>in</strong>e und somit war klar, dass nur<br />
unter deren Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>e Benutzung<br />
für Personenverkehr möglich se<strong>in</strong> würde.<br />
E<strong>in</strong>e eigene Strecke wollte die Stadt aus<br />
Kostengründen nicht errichten. <strong>Die</strong> Mehrheit<br />
der Stadtvertretung stellte vielmehr fest,<br />
„dass die Militärbahn nur <strong>in</strong> Frage kommen<br />
kann, da die Stadt sonst der hohen Kosten<br />
wegen <strong>in</strong> absehbarer Zeit ke<strong>in</strong>e Straßenbahn<br />
erhalten wird.“ Außerdem erschien<br />
der Streckenverlauf über die Poststraße,<br />
durch Grimmershörn und dann schnurstracks<br />
die Wasserkante entlang bis <strong>in</strong> die<br />
Nähe der Kugelbake auch für den Personenverkehr<br />
als durchaus geeignet. Doch es<br />
mussten weitgehende Vorgaben der Mar<strong>in</strong>e<br />
akzeptiert werden.<br />
<strong>Die</strong> Mar<strong>in</strong>e hat Vorrang<br />
In e<strong>in</strong>er „Zusammenstellung der Bed<strong>in</strong>gungen,<br />
unter welchen die Kaiserliche Kommandantur<br />
den Antrag der Stadt betr. Betrieb<br />
e<strong>in</strong>er Strassenbahn auf dem Gleis der<br />
Militärverb<strong>in</strong>dungsbahn bei dem Reichsmar<strong>in</strong>eamt<br />
befürworten wird“, ist unter<br />
Punkt 2. das Folgende vermerkt:<br />
„Der Mar<strong>in</strong>efiskus behält sich das Recht<br />
vor, die Militärverb<strong>in</strong>dungsbahn jeder Zeit<br />
im mar<strong>in</strong>efiskalischen Interesse zu benutzen.<br />
In jedem solchen Falle ist das Gleis auf<br />
die erste Aufforderung der betreffenden Behörde<br />
sofort von der Stadt frei zu machen,<br />
und der Straßenbahnbetrieb solange e<strong>in</strong>zustellen,<br />
bis von der die Bahn benutzenden<br />
Behörde die Beendigung ihres Transportes<br />
der Stadt mitgeteilt und das Gleis wieder<br />
frei gegeben ist.“<br />
In diesen Fällen war man zu Entschädigungszahlungen<br />
bereit. Ausdrücklich ausgenommen<br />
war jedoch jeglicher Anspruch,<br />
„wenn im Falle e<strong>in</strong>es Krieges oder aus andern<br />
militärischen Gründen der Strassenbahnbetrieb<br />
ohne vorherige Kündigung auf<br />
längere Zeit oder dauernd e<strong>in</strong>gestellt werden<br />
muss.“<br />
Um bei kurzfristig erforderlich werdenden<br />
Fahrten der Mar<strong>in</strong>e die Straßenbahnwagen<br />
schnell vom Gleis zu bekommen,<br />
musste die Stadt auf eigene Rechnung am<br />
Anfangs- und Endpunkt der Strecke Abstellmöglichkeiten<br />
und bei Grimmershörn<br />
e<strong>in</strong>e Ausweichstelle errichten. <strong>Die</strong>se waren<br />
so auszulegen, „dass sie von allen Betriebsmitteln<br />
der Staatseisenbahn benutzt werden<br />
können.“ Ganz so günstig, wie sich die<br />
Stadt die Gleisnutzung vorgestellt hatte,<br />
g<strong>in</strong>g es also doch nicht vonstatten. (2)<br />
Zweifel an Effektivität<br />
von Oberleitung<br />
Über die Betriebsform der neuen Bahn gab<br />
es e<strong>in</strong>gehende Diskussionen. Kostengünstig<br />
sollte sie se<strong>in</strong> und somit ließen sich Zweifel<br />
an der Effektivität e<strong>in</strong>er normalen, also<br />
im Oberleitungsbetrieb verkehren Bahn<br />
nicht ausräumen. Generell wollte man zwar<br />
die Umstellung auf Oberleitungsbetrieb zu<br />
e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt nicht ausschließen.<br />
Gleich zu Beg<strong>in</strong>n erschien e<strong>in</strong>e solche<br />
Anlage vielen Verantwortlichen jedoch als<br />
unkalkulierbares Wagnis. Das schließlich<br />
mit der Betriebsführung beauftragte Ingenieur-Bureau<br />
Arnold Clamer & Comp. aus<br />
Hamburg (Cuxhaven gehörte bis 1937 zur<br />
Hansestadt) sollte sich auch um die Fahrzeugbeschaffung<br />
bemühen. E<strong>in</strong> Angebot<br />
der <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> ansässigen Cont<strong>in</strong>entalen<br />
Eisenbahn Bau- und Betriebsgesellschaft<br />
schien genau der Cuxhavener<br />
Bedürfnislage zu entsprechen.<br />
E<strong>in</strong>e Delegation<br />
reiste nach Schmöckwitz<br />
und nahm die angebotenen<br />
Fahrzeuge anlässlich e<strong>in</strong>er<br />
Probefahrt genauestens <strong>in</strong> Augensche<strong>in</strong>.<br />
Alle Beteiligten waren schließlich<br />
überzeugt. Man erwarb drei gut erhaltene<br />
Triebwagen mit benzol-elektrischem Antrieb,<br />
die auf der Grünauer Uferbahn nur<br />
viere<strong>in</strong>halb Monate im E<strong>in</strong>satz gestanden<br />
Stadtverkehr Cuxhaven heute<br />
Bis 1974 lag der ÖPNV <strong>in</strong> Cuxhaven <strong>in</strong> den Händen<br />
der Cuxhavener Omnibus-Gesellschaft<br />
(COG), die vor 40 Jahren von der Kraftverkehr<br />
GmbH & Co. KG (KVG) Stade übernommen wurde.<br />
Deren „Betrieb Cuxhaven“ unterhält heute<br />
sieben vom ZOB direkt am Bahnhof startende<br />
Busl<strong>in</strong>ien, von denen e<strong>in</strong>e nur dann verkehrt,<br />
wenn e<strong>in</strong>e Helgoland-Fähre e<strong>in</strong>- oder ausläuft.<br />
<strong>Die</strong> L<strong>in</strong>ie 1006 verb<strong>in</strong>det die Aussichtsplattform<br />
„Alte Liebe“ direkt mit dem ZOB und br<strong>in</strong>gt den<br />
Fahrgast auch an die Anleger für Hafenrundfahrten<br />
und Seetörns zu den Seehundsbänken.<br />
Mit der L<strong>in</strong>ie 1007 kann man die Kugelbake erreichen<br />
und sich am Endpunkt der se<strong>in</strong>erzeitigen<br />
Städtischen Bahn umsehen.<br />
<strong>Die</strong> KVG Stade gehört seit 1996 zu 60 Prozent<br />
der Osthannoverschen Eisenbahn AG und zu 40<br />
Prozent der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe<br />
Elbe Weser GmbH. Weitere Omnibusl<strong>in</strong>ien vom<br />
ZOB Cuxhaven <strong>in</strong> die Region werden von dem<br />
Verkehrsunternehmen Maass erbracht.<br />
hatten, bis deren Umrüstung auf Oberleitungsbetrieb<br />
erfolgte.<br />
Personen statt Kanonen –<br />
aber nur für kurze Zeit<br />
<strong>Die</strong> drei Fahrzeuge erwarb die Stadt verhältnismäßig<br />
günstig für jeweils 14.000 Mark,<br />
Mitte Juni trafen sie <strong>in</strong> Cuxhaven e<strong>in</strong>. Probefahrten<br />
und Schulungen fanden noch im<br />
selben Monat statt. Nach Fertigstellung aller<br />
erforderlichen Anlagen wie der Wagenhalle<br />
<strong>in</strong> der Nähe des Hauptbahnhofes an<br />
der Kapitän-Alexander-Straße und der<br />
von der Mar<strong>in</strong>e geforderten Ausweichstelle<br />
<strong>in</strong> Grimmershörn<br />
eröffnete die Stadt am<br />
Verlauf der Städtischen<br />
Tram Cuxhaven<br />
ZEICHNUNG: DIETER HÖLTGE<br />
<strong>Die</strong> Fahrzeuge der Straßenbahn Cuxhaven<br />
Triebwagen 1 bis 3 Beiwagen 4 und 5<br />
Hersteller: Gasmotorenfabrik Deutz/ Falkenried, Hamburg<br />
Bergmanns Electricitätsunternehmungen<br />
van der Zypen & Charlier<br />
Baujahr: 1912 1914<br />
Empfänger: Schmöckwitz-Grünauer Uferbahn; Städtische Bahn Cuxhaven<br />
6/1914 an Städtische Bahn Cuxhaven<br />
Verbleib: 1921 an Moerser Kreisbahn 1921 an Moerser Kreisbahn<br />
nur Tw 3 bis 1952 noch im E<strong>in</strong>satz<br />
bis 1952 bzw. 1968 im E<strong>in</strong>satz<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
73
Geschichte<br />
E<strong>in</strong> Jahrzehnt nach ihrem E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> Cuxhaven entstand 1924 diese Aufnahme auf der Strecke von<br />
Moers nach Sevelen am Bahnhof Schaephuysen. Nach langer Standzeit hatten die Fahrzeuge 1921<br />
bei der Moerser Kreisbahn e<strong>in</strong>en neuen E<strong>in</strong>satzort gefunden<br />
SLG. PETER BOEHM, SLG. AXEL REUTHER<br />
6. Juli den Betrieb. <strong>Die</strong> Fahrten der als „Städtische<br />
Bahn Cux haven“ firmierenden Tram<br />
auf der mit elf Unterwegshalten ausgestatteten<br />
Strecke gerieten zum großen Erfolg. Am<br />
ersten Betriebs-Sonntag fuhren 3.000 Personen<br />
mit ihr an die Kugelbake. Ab und an seien<br />
die Wagen kurzzeitig liegengeblieben, vermerken<br />
Zeitungsnotizen und auch von<br />
e<strong>in</strong>igen Unfällen – teils zwischen zwei Triebwagen,<br />
teils mit anderen Verkehrsteilnehmern<br />
– wird berichtet. So sehen eben Alltagssorgen<br />
e<strong>in</strong>es Verkehrsbetriebes aus!<br />
Doch e<strong>in</strong> solcher „Alltag“ sollte sich <strong>in</strong><br />
Cuxhaven nicht e<strong>in</strong>stellen. Am 3. August<br />
1914 erschien e<strong>in</strong>e lapidare Bekanntmachung<br />
<strong>in</strong> der Ortspresse: „Der Betrieb der<br />
Städtischen Bahn ist auf Anordnung der<br />
Kaiserlichen Kommandantur bis auf weiteres<br />
e<strong>in</strong>gestellt worden.“ – der Erste Weltkrieg<br />
hatte begonnen.<br />
Das Betriebsende<br />
<strong>Die</strong> Anordnung der Allgeme<strong>in</strong>en Mobilisierung<br />
von Heer und Flotte am 1. August<br />
1914 bedeutete gemäß der mit der Mar<strong>in</strong>e<br />
getroffenen Vere<strong>in</strong>barung das Ende des<br />
Tramverkehrs. Am 2. August allerd<strong>in</strong>gs verkehrte<br />
die Städtische Bahn noch – geme<strong>in</strong>sam<br />
mit Kanonenzügen! Danach hieß es<br />
wieder „Kanonen statt Personen“. Zwischen<br />
Mar<strong>in</strong>e-Kommandantur und der<br />
Stadt gab es noch Differenzen über e<strong>in</strong>e verme<strong>in</strong>tliche<br />
Betriebsbereitschaft, welche<br />
während des gesamten Monats August<br />
1914 seitens der städtischen Bahn für das<br />
Militär bestanden hätte. <strong>Die</strong> Kommandantur<br />
behauptete jedoch, niemals solche<br />
<strong>Die</strong>nste beansprucht zu haben. Vor dem<br />
H<strong>in</strong>tergrund dessen, was nun die Welt bewegte,<br />
verblassten solche Fragen schnell.<br />
Nach Kriegsende setzte die Stadt auf e<strong>in</strong><br />
anderes Verkehrsmittel: Ab Dezember 1919<br />
fuhren entlang der Kanonenbahn Busse. <strong>Die</strong><br />
kle<strong>in</strong>e Bahn, deren Ausweitung durchaus <strong>in</strong><br />
Betracht gezogen worden war, konnte ihre<br />
Leistungsfähigkeit nicht unter Beweis stellen.<br />
<strong>Die</strong> Fahrzeuge der<br />
Cuxhavener Straßenbahn<br />
<strong>Die</strong> von der Schmöckwitz-Grünauer Uferbahn<br />
erworbenen drei Triebwagen waren<br />
nach dem dortigen etwa viere<strong>in</strong>halbmonatigen<br />
E<strong>in</strong>satz nahezu neuwertig. Sie boten jeweils<br />
23 Sitzplätze auf Querbänken sowie<br />
zehn bequeme Stehplätze und galten als komfortabel<br />
und laufruhig. Der 30 PS leistende<br />
<strong>Die</strong> h<strong>in</strong>tere Bühne von Tw 2 nach Betriebsaufnahme 1912 <strong>in</strong> Grünau. Über dem Fahrwerk prangt<br />
der Schriftzug der Cont<strong>in</strong>entalen Eisenbahn-Bau und Betriebsgesellschaft SLG. SIGURD HILKENBACH<br />
Benzolmotor war direkt gekuppelt mit e<strong>in</strong>er<br />
20 Kilowatt leistenden Dynamomasch<strong>in</strong>e, die<br />
Strom von 500-Watt-Klemmspannung erzeugte.<br />
E<strong>in</strong>e Edison-Akkubatterie diente der<br />
Erregung des Dynamos und der Sicherstellung<br />
der Wagenbeleuchtung im Ruhestand. <strong>Die</strong><br />
beiden auf den Achsen angebrachten Elektromotoren<br />
lieferten jeweils 20 PS.<br />
Zwar konnten die Fahrzeuge e<strong>in</strong>e Höchstgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
von 30 km/h erzielen, doch legte<br />
die Stadt für Cuxhaven 25 km/h als zulässige<br />
Höchstgeschw<strong>in</strong>digkeit auf der freien<br />
Strecke fest. Ansonsten lag sie <strong>in</strong> unübersichtlichen<br />
Streckenabschnitten deutlich darunter.<br />
E<strong>in</strong> Umbau der Fahrzeuge auf Oberleitungsbetrieb<br />
war im Pr<strong>in</strong>zip nach Bewährung vorgesehen.<br />
Ergänzend erfolgte die Beschaffung<br />
von zwei Beiwagen bei Falkenried.<br />
Der Betrieb mit den für 30 Personen ausgelegten<br />
Beiwagen bereitete bei der Probefahrt<br />
e<strong>in</strong>ige Schwierigkeiten. Das Protokoll<br />
verzeichnet: „<strong>Die</strong> Steigung 1:70 zwischen<br />
der Deichstrasse und Neufelderstrasse wurde<br />
nur schwer erstiegen und es ist zu befürchten,<br />
dass der Zug bei voller Besetzung<br />
stecken bleibt.“(2) Doch e<strong>in</strong> herbeigerufener<br />
Fachmann wusste Rat: Man sollte statt<br />
des billigeren Cit<strong>in</strong> besser Benzol als Brennstoff<br />
verwenden, warf er e<strong>in</strong>. Dann ließe<br />
sich dieses Problem beheben. Im Jahr 1921<br />
verkaufte die Stadt Cuxhaven den gesamten,<br />
aus diesen fünf E<strong>in</strong>heiten bestehenden Wagenpark<br />
an die Moerser Kreisbahn. Während<br />
zwei Triebwagen um 1937 aus dem<br />
Verkehr schieden, lief e<strong>in</strong>er bis 1952. E<strong>in</strong> Unfall<br />
setzte se<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>satz schließlich ebenfalls<br />
e<strong>in</strong> Ende, er wurde danach gleichfalls verschrottet.<br />
So er<strong>in</strong>nert heute an den vor 100<br />
Jahren eröffneten Cuxhavener Trambetrieb<br />
ke<strong>in</strong> Fahrzeug mehr. ANDREAS MAUSOLF<br />
Anmerkungen & Dank<br />
(1)<br />
Über die Länge gibt es unterschiedliche Angaben.<br />
In offiziellen Schriftstücken ist von 3,2 Kilometern<br />
Länge der Tramstrecke die Rede, viele andere<br />
Veröffentlichungen nennen jedoch fünf<br />
Kilometer Streckenlänge; wahrsche<strong>in</strong>lich ist<br />
damit jedoch die Gesamtstrecke der „Kanonenbahn“<br />
geme<strong>in</strong>t. <strong>Die</strong> Tram begann an der Kreuzung<br />
e<strong>in</strong>es Fußweges bei den Wasserturmanlagen<br />
am Bahnhof und endete vor dem Fort<br />
Kugelbake an der Abzweigung von der Deichtrift;<br />
(2)<br />
Zitate nach Protokollen und Schriftverkehr<br />
1913–1915, Stadtarchiv Cuxhaven; e<strong>in</strong> herzlicher<br />
Dank geht an das Stadtarchiv Cuxhaven,<br />
hier besonders an Frank Weyer;<br />
Ferner lagen weitere Unterlagen aus dem Stadtarchiv<br />
Cuxhaven, Aufzeichnungen des Autors sowie<br />
der Artikel „<strong>Die</strong> Cuxhavener Straßenbahn“<br />
von Michael Neubauer im <strong>STRASSENBAHN</strong><br />
<strong>MAGAZIN</strong> 10 vom November 1973 zugrunde.<br />
E<strong>in</strong> weiterer Dank geht an Axel Reuther <strong>in</strong> Köln<br />
für se<strong>in</strong>e Unterstützung bei der Bildrecherche.<br />
74 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
Fundstück des Monats<br />
FOLGE 18<br />
Málaga<br />
Calle Marques<br />
de Larios<br />
E<strong>in</strong> roter Teppich für Tw 63? Der letzte erhaltene Straßenbahnwagen Málagas war es den Stadtvätern und den Mitgliedern<br />
des Vere<strong>in</strong>s „Tran-Bus“ ab Mai 2014 <strong>in</strong> der Fußgängerzone der südspanischen Stadt wert<br />
JENS PERBANDT<br />
Filmheld auf rotem Teppich<br />
Im Frühsommer 2014 präsentierte <strong>in</strong> der spanischen Stadt Málaga die örtliche Vere<strong>in</strong>igung zur<br />
Erhaltung von historischen Straßenbahnen und Bussen „Tran-Bus“ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er belebten E<strong>in</strong>kaufspassage<br />
e<strong>in</strong>en restaurierten Triebwagen. Aber was hat es mit dem zweiachsigen Tw 63 genau auf sich?<br />
Wer Ende des vorigen Jahrzehntes <strong>in</strong> Málaga an der Küstenstraße<br />
nach dem viele Jahre dort aufgestellten Triebwagen Ausschau hielt,<br />
suchte ihn vergebens! Der e<strong>in</strong>st <strong>in</strong> dieser südspanischen Stadt e<strong>in</strong>gesetzte<br />
Zweiachser war vor mehreren Jahren von se<strong>in</strong>em langjährigen<br />
Denkmalsockel verschwunden …<br />
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um e<strong>in</strong>en 1922 vom belgischen<br />
Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi (ACEC) gebauten<br />
Triebwagen. Das Fahrgestell vom Typ Brill 21-E hatte die USamerikanische<br />
J. G. Brill Company Philadelphia gebaut.<br />
In Málaga pendelte ab 1891 e<strong>in</strong>e Pferdebahn, 1906 begann der<br />
elektrische Betrieb. Im Jahr 1923 umfasste das Straßenbahnnetz <strong>in</strong><br />
der Stadt an der Costa del Sol sechs L<strong>in</strong>ien, auf denen 37 Triebwagen<br />
verkehrten. Während der Franco-Diktatur erfolgte ab 1949 die<br />
schrittweise E<strong>in</strong>stellung – am 31. Dezember 1961 fuhr die letzte Straßenbahn.<br />
Im Juli dieses Jahres soll e<strong>in</strong>e neu gebaute Metrol<strong>in</strong>ie den<br />
Betrieb aufnehmen. Der Triebwagen 63 diente e<strong>in</strong> Jahr nach se<strong>in</strong>er<br />
Außerdienststellung (1961) bei den Dreharbeiten für den englischen<br />
K<strong>in</strong>ofilm „Lawrence von Arabien“ als Requisite. Danach ungenutzt<br />
abgestellt, ließ die Stadtverwaltung den Triebwagen 20 Jahre später<br />
als Denkmal auf e<strong>in</strong>em Sockel an der Paseo Maritimo Pablo Ruiz<br />
Picasso aufstellen. <strong>Die</strong>ser unüberdachte Standplatz <strong>in</strong> Küstennähe<br />
war für das Fahrzeug allerd<strong>in</strong>gs nicht gut. <strong>Die</strong> hölzernen Aufbauten<br />
litten erheblich. Deshalb holte der Vere<strong>in</strong> Tran-Bus den Wagen<br />
am 20. November 2008 zur Restaurierung von se<strong>in</strong>em Sockel. In<br />
den folgenden knapp zwei Jahren erneuerten die Straßenbahnfreunde<br />
den kompletten Holzaufbau und arbeiteten das Fahrgestell äußerlich<br />
auf. <strong>Die</strong> Stirnfronten des Wagens fertigten sie aus Blech neu an.<br />
Am 18. September 2010 präsentierten sie das restaurierte Fahrzeug<br />
mit authentischer, neuer blauen Farbgebung, wie es bis 1961<br />
auf den Straßen von Málaga unterwegs gewesen war, erstmalig der<br />
Öffentlichkeit. Seitdem ist er regulär im Busdepot der städtischen<br />
Verkehrsgesellschaft EMT für die Öffentlichkeit unzugänglich h<strong>in</strong>terstellt.<br />
In diesem Sommer zeigte der Vere<strong>in</strong> ihn nun aber erstmals<br />
<strong>in</strong> der Fußgängerzone Málagas.<br />
JENS PERBANDT<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
75
n M<strong>in</strong>iatur-Nahverkehr: Anlagen, Fahrzeuge, Tipps und Neuheiten<br />
m sm-modell@geramond.de<br />
Aus der kle<strong>in</strong>en Tankstelle (unten) ist <strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong> Fast-Food-Restaurant<br />
geworden. Als Blickfang dient e<strong>in</strong> Straßenkreuzer auf dem Dach<br />
<strong>Die</strong> gleiche Stelle während der Bauphase. Der Bus hat schon se<strong>in</strong>en<br />
festen Platz gefunden, die Tankstelle und viele Gebäude fehlen noch<br />
76
Anlagenbau<br />
<strong>Die</strong>ser Wuppertaler Tw 115 ist e<strong>in</strong> schon älterer Eigenbau von Guido Mandorf.<br />
Das H0-Modell entstand noch aus Res<strong>in</strong>. Heute nutzt er den 3-D-Druck<br />
Idyll mit H<strong>in</strong>terhof,<br />
Manta und Mülleimer<br />
E<strong>in</strong> Stück Ruhrgebiet <strong>in</strong> H0 n SM-Autor Guido Mandorf hat se<strong>in</strong>e Straßenbahnanlage nach<br />
Motiven aus dem Kohlenpott und dem Bergischen Land um e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Ecke erweitert<br />
Me<strong>in</strong>e ja schon häufiger<br />
für Modellfotos im SM<br />
genutzte Tramanlage<br />
besteht <strong>in</strong> ihrer Form<br />
bereits e<strong>in</strong>ige Jahre. Von kle<strong>in</strong>eren<br />
Detailänderungen abgesehen, ist das<br />
Grundkonzept der Gleisführung und<br />
Bebauung stets gleich geblieben. <strong>Die</strong><br />
Anlage ist sehr betriebssicher, doch<br />
getreu Murphys Gesetz bereitete die<br />
am schlechtesten erreichbare Stelle,<br />
e<strong>in</strong>e Kurve der Meterspurstrecke,<br />
doch stets irgendwelche Probleme:<br />
Beim Bau hatte ich sie etwas zu eng<br />
In dieser Kurve wird es für die H0-Autofahrer immer recht eng, wenn e<strong>in</strong><br />
Gelenkwagen wie der Bochumer Tw 279 an der Haltestelle steht<br />
e<strong>in</strong>gerichtet, was später besonders<br />
bei Gelenkwagen immer wieder für<br />
Ärger der Anlass war.<br />
Kürzlich hatte ich nun die Möglichkeit,<br />
die Anlage etwas zu erweitern<br />
und damit auch diese Schwachstelle<br />
zu beheben. <strong>Die</strong> Anlage sollte <strong>in</strong> Zukunft<br />
über Eck gehen und über e<strong>in</strong>e<br />
Überlandstrecke mit e<strong>in</strong>er dörflichen<br />
Endstelle verbunden werden. <strong>Die</strong> Erweiterung<br />
betraf ausschließlich die<br />
Meterspurstrecken. <strong>Die</strong> Normalspurstrecke<br />
blieb unverändert, wenn man<br />
von e<strong>in</strong>em zusätzlichen Abstellgleis<br />
Zwei <strong>in</strong> den 1970er-Jahren moderne Fahrzeuge: Neben dem Mercedes /8<br />
wartet e<strong>in</strong> Düwag-M-Wagen der EVAG, den Mandorf <strong>in</strong> Mess<strong>in</strong>g fertigte<br />
strassenbahn magaz<strong>in</strong> 8|2014 77
Straßenbahn im Modell<br />
Der Wuppertaler Zug mit dem zweiachsigen Tw 115 und passendem Beiwagen verlässt die Ortschaft Mandorf auf dem Weg <strong>in</strong>s Umland g. mandorf (12)<br />
im Betriebshof absieht. Im Schattenbereich,<br />
der bei mir von e<strong>in</strong>er hochgelegten<br />
Eisenbahnstrecke getarnt<br />
wird, teilt sich nun die Meterspur<br />
auf, um entweder zur Überlandstrecke<br />
zu führen oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er großzügig<br />
geschwungenen Gleisführung<br />
<strong>in</strong> Straßenlage <strong>in</strong> die mit Dreischienengleis<br />
ausgebaute Schleife um<br />
die Fabrikanlage zu münden. <strong>Die</strong><br />
Überlandstrecke liegt schon vor dem<br />
Ortsausgangsschild <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er langgezogenen<br />
Steigung, die sie dann bis<br />
zur Endstelle beibehält.<br />
Für mich ist wichtig, dass das „Drumherum“<br />
stimmt und die Atmosphäre<br />
e<strong>in</strong>er Ruhrgebietsstadt authentisch<br />
vermittelt wird. So mussten viele<br />
Gebäude modifiziert und gealtert<br />
werden. Hierbei ist zu beklagen, dass<br />
von den e<strong>in</strong>schlägigen Zubehörherstellern<br />
auch im Jahr 2014 überwiegend<br />
Gebäude nach süddeutschem<br />
Vorbild angeboten werden. Ergänzt<br />
wird die Szenerie durch charakteristische<br />
Straßenmöbel, wie z. B. den<br />
Pilzmülleimer, der früher an vielen<br />
Stellen <strong>in</strong> Essen zu f<strong>in</strong>den war. E<strong>in</strong><br />
passender fotorealistischer H<strong>in</strong>tergrund<br />
trägt dazu bei, die Stimmung<br />
Dank des fotorealistischen H<strong>in</strong>tergrunds ist die Illusion nahezu perfekt:<br />
Erst beim zweiten Blick erkennt man, dass es sich um Modelle handelt<br />
auch jenseits der Anlagenkante zu<br />
erhalten. Das Ersche<strong>in</strong>ungsbild me<strong>in</strong>er<br />
Anlage ist daher e<strong>in</strong> deutlicher<br />
<strong>Die</strong>ses „Luftbild“ des im Bau bef<strong>in</strong>dlichen Anlagenteils zeigt die Gleislage,<br />
die später im fertigen Zustand h<strong>in</strong>ter den Gebäuden versteckt ist<br />
und gewollter Widerspruch zur kitschig<br />
bunten Darstellung von Modellbahnanlagen<br />
<strong>in</strong> Katalogen und<br />
Fachzeitschriften.<br />
Der digitale Fahrbetrieb erfolgt über<br />
Oberleitung, die ich auf diesem Anlagensegment<br />
aus 0,2 Millimeter<br />
starkem Silberdraht gebaut habe.<br />
Das Material ist erstaunlich stabil und<br />
zeigt bisher weniger Neigung zu Oxidation<br />
als der zuvor verwendete Mess<strong>in</strong>gdraht.<br />
E<strong>in</strong>e vorbildgerechte Abspannung<br />
ist zw<strong>in</strong>gend notwendig.<br />
<strong>Die</strong> oft unreflektierte Behauptung,<br />
dass Digital- und Oberleitungsbetrieb<br />
nicht funktionieren, widerlegt der jahrelang<br />
sichere Betrieb. Auch e<strong>in</strong>e öffentliche<br />
Präsentation <strong>in</strong> diesem Jahr<br />
zeigte e<strong>in</strong>en höchst stabilen Betrieb.<br />
Etwa e<strong>in</strong> Drittel der Anlagenfläche<br />
ist gleisfrei. Hier f<strong>in</strong>det man beispielsweise<br />
den typischen H<strong>in</strong>terhof,<br />
<strong>in</strong> dem K<strong>in</strong>der Fußball spielen, die<br />
Wäsche zum Trocknen hängt und der<br />
neue Bolide, hier natürlich e<strong>in</strong> Manta<br />
mit Fuchsschwanz, der Nachbarschaft<br />
vorgestellt wird.<br />
E<strong>in</strong>e fürs Ruhrgebiet typische H<strong>in</strong>terhofidylle mit Opel Manta. Auf dem<br />
Moped durften die Halbstarken damals noch ohne e<strong>in</strong>en Helm fahren<br />
78 strassenbahn magaz<strong>in</strong> 8|2014
B<br />
Anlagenbau<br />
Das Depot wurde auf fünf Gleise vergrößert. <strong>Die</strong> Niederflur-Tw der Rhe<strong>in</strong>bahn und der B-Wagen s<strong>in</strong>d Eigenbauten aus Mess<strong>in</strong>g oder als 3-D-Druck<br />
E<strong>in</strong> anderes Grundstück kann als<br />
Besonderheit mit unterschiedlichen<br />
Bebauungen versehen werden. Zum<br />
e<strong>in</strong>en kann es als unbebaute und<br />
vollständig begrünte Brachfläche<br />
dargestellt werden. Zum anderen<br />
bietet sie Platz für e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Tankstelle,<br />
die noch ke<strong>in</strong> Supermarkt mit<br />
angeschlossener Zapfstelle war. Um<br />
die Szene <strong>in</strong> die Gegenwart zu holen,<br />
die für derart kle<strong>in</strong>e Tankstellen leider<br />
ke<strong>in</strong>en Platz mehr bietet, besteht<br />
die Möglichkeit, die Tankstelle durch<br />
e<strong>in</strong> amerikanisches Restaurant zu<br />
ersetzen, das das historische Tankstellengebäude<br />
heute nutzt. E<strong>in</strong> alter<br />
amerikanischer Straßenkreuzer soll<br />
dazu die Kundschaft anlocken.<br />
Nur wenig entfernt von der Stadtstraße,<br />
deren Häuser reichlich Pat<strong>in</strong>a<br />
angesetzt haben, liegt e<strong>in</strong> Wäldchen,<br />
an dessen Rand sich die Straßenbahn<br />
auf den Weg <strong>in</strong>s Umland macht. Der<br />
Insider wird hier erkennen, dass ich<br />
mich von der ehemaligen Bergischen<br />
Kle<strong>in</strong>bahn <strong>in</strong>spirieren ließ. E<strong>in</strong>st überzog<br />
sie die Gegend zwischen Essen<br />
und Wuppertal mit e<strong>in</strong>em verzweigten<br />
Überlandstraßenbahnnetz. E<strong>in</strong>gleisig<br />
und neben der Straße trassiert<br />
beg<strong>in</strong>nt hier e<strong>in</strong>e Überlandstrecke,<br />
deren unübersehbare Steigung für<br />
das Fahrpersonal e<strong>in</strong>e große Herausforderung<br />
darstellt.<br />
GM<br />
Mehr von Guido Mandorfs Tramanlage<br />
sehen Sie im nächsten SM.<br />
Der früher <strong>in</strong> Essen <strong>in</strong> vielen Straßen aufgestellte Pilzmülleimer entstand<br />
als 3-D-Druck bei Shapeways und ist dort jetzt für jedermann erhältlich<br />
ANZEIGEN<br />
Straßenbahn-Bücher und Nahverkehrs-Literatur<br />
Im Versand, direkt nach Haus<br />
NEU Der klassische Düwag-Gelenkwagen (Meschede, Reuther, Schöber – EK), ~ 250 S., A4, ~ 300 Fotos 45,00 €<br />
ganz NEU KT 4 der erfolgreichste Gelenkzug der ČKD (H. Peters, Endisch-V.), 256 S., 17 x 24 cm, ~ 200 Abb. 35,00 €<br />
ganz NEU Stadtbahnwagen Typ B 40 Jahre Dauere<strong>in</strong>satz ... Rhe<strong>in</strong> + Ruhr (EK, Bildarchiv), 96 S., 23 x 17, ~ 100 Farbf. 19,80 €<br />
NEU Moderne Trams deel 1 Vierassers (v. d. Gragt, Reuther, Wolf), 296 S., A4, ~ 500 Farb-Aufn., Tabellen 43,00 €<br />
ganz NEU Auf Meterspur durchs Wirtschaftswunder (Reimann, DGEG), 100 S., 24 x 22 cm, 100 Abb. 24,80 €<br />
ganz NEU Von der Dampfbahn zur City-Bahn (Chemnitz), Broschüre mit 72 Seiten, A4, ~ 145 Abb., teils Farbe 15,90 €<br />
ganz NEU <strong>Die</strong> Duisburger Straßenbahn (Suton) 19,99 € · Chemnitzer Straßenbahn im Stadtbild (Matthes) 18,95 €<br />
Ende AUG. Bitte zusteigen! Mit der L<strong>in</strong>ie 4 von der Volme an die Ruhr – Hagen (Göbel, Rudat), 352 S., A4 39,00 €<br />
ganz NEU <strong>Die</strong> Straßenbahn <strong>in</strong> Hannover 1945–1985 (Fröhberg, Sutton), 120 S., 200 Abb., davon 40 <strong>in</strong> Farbe 19,99 €<br />
NEU <strong>Die</strong> Rhe<strong>in</strong>-Haardtbahn 100 Jahre ... Rhe<strong>in</strong> Haardt <strong>in</strong> Bildern (Blaul, Kaiser), 160 S., A4, > 300 Farb-Abb. 34,00 €<br />
ganz NEU Straßen- + Stadtbahn <strong>in</strong> D, Bd. 15, Württemberg, Straßenbahn + Obus (EK), 304 S., ~ 398 Abb. 45,00 €<br />
ganz NEU Tram-Atlas Frankreich mit Metro + Obus 19,50 € · Tram-Atlas Nordeuropa Skand<strong>in</strong>avien & Baltikum 19,50 €<br />
ganz NEU Wiener Hilfsfahrzeuge (Lillich, Prof.Mar<strong>in</strong>cig), 160 S., A4, alle Arbeitswagen, 365 SW- + 218 Farb-Abb. 49,90 €<br />
ganz NEU Straßenbahnjournal-Jahrbuch 2013 (Wien, Stütz), 74 S., A4, komplett farbig bebildert 27,80 €<br />
ganz NEU De Buitenlijnen van de HTM (Johan Blok, de Alk), alle Überlandl<strong>in</strong>ien, 400 S., A4, 700 Abb. 43,00 €<br />
ganz NEU Tramwaje w Polsce (polnisch), 312 S., A4, alle ehem. + heutigen Betriebe, 39 Karten, 577 SW-Abb. 25,00 €<br />
Alle Straßenbahn-Neuheiten (auch von Betrieben)/zzgl. Porto/Verpackung (1,50 bis 4,00 €)<br />
TS: T t<br />
TramShop, Rolf Hafke, Sieben-Schwaben-Weg 22, 50997 Köln<br />
t 0 22 33-92 23 66 F 0 22 33-92 23 65 m Hafke.Koeln@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
B<br />
strassenbahn magaz<strong>in</strong> 8|2014 79
Ihre Seiten: Ergänzungen, Anmerkungen, Kritik und Anregung<br />
<br />
ö<br />
:<br />
*<br />
0 89 – 13 06 99-720<br />
0 89 – 13 06 99-700<br />
redaktion@geramond.de<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Postfach 40 02 09 · 80702 München<br />
Zu „Kuriosa am Stadtrand“<br />
(SM 6/2014)<br />
Längste e<strong>in</strong>gleisige<br />
Strecke <strong>in</strong> Mahlsdorf<br />
<strong>Die</strong> mit gut 1,5 Kilometer längste e<strong>in</strong>gleisige<br />
Straßenbahnstrecke Berl<strong>in</strong>s bef<strong>in</strong>det<br />
sich nicht <strong>in</strong> He<strong>in</strong>ersdorf, sondern zwischen<br />
der Ausweiche an der Haltestelle<br />
„Rahnsdorfer Straße“ (im Zuge des Hultsch<strong>in</strong>er<br />
Damms) und der Treskowstraße<br />
Ecke Hönower Straße unmittelbar vor der<br />
Endhaltestelle „S Mahlsdorf“ auf der L<strong>in</strong>ie<br />
62. Zum Wagene<strong>in</strong>satz auf der L<strong>in</strong>ie 71<br />
sei noch erläutert, dass sowohl Mischgarnituren<br />
aus (Vorkriegs-)Maximum-Triebwagen<br />
und (Nachkriegs-)LOWA-Beiwagen<br />
als auch re<strong>in</strong>e Vorkriegsgarnituren<br />
zum E<strong>in</strong>satz kamen, letztere überwiegend,<br />
aber nicht nur als Verstärkungszüge<br />
(„E“). <strong>Die</strong>sen Wagene<strong>in</strong>satz habe ich<br />
aufsummiert und als „überwiegend mit<br />
Vorkriegsgarnituren“ so <strong>in</strong> me<strong>in</strong>em Beitrag<br />
„In 25 M<strong>in</strong>uten vom Alex aufs Dorf“<br />
im SM 1/2014 bezeichnet.<br />
Bernhard Kußmagk, Berl<strong>in</strong><br />
Zu „Augsburg vor 20 Jahren“<br />
(SM 7/2014)<br />
Beschleunigung der<br />
GT5 war e<strong>in</strong>e Wucht!<br />
Mit Interesse und Freude habe ich den<br />
Augsburg-Artikel von Stefan H<strong>in</strong>der gelesen.<br />
Er weckt unheimlich viele Er<strong>in</strong>nerun-<br />
gen! Hervorragend! Denn auch ich war<br />
1994 zum ersten Mal so richtig <strong>in</strong> Augsburg.<br />
E<strong>in</strong> Jahr zuvor b<strong>in</strong> ich lediglich e<strong>in</strong>mal<br />
durchgefahren und <strong>in</strong> den Folgejahren war<br />
ich ebenfalls noch e<strong>in</strong>ige Male dort, eben<br />
wegen der GT5. Das waren geniale<br />
Fahrzeuge. Es ist für mich bis heute unverständlich,<br />
wieso diese Fahrwerkskonstruktion<br />
(vorne Dreiachser, h<strong>in</strong>ten aufgesattelter<br />
Drehgestellwagen) e<strong>in</strong>e derart gute<br />
Kurvenlage hatte. <strong>Die</strong> im Artikel erwähnten<br />
Beschleunigungswerte kann ich voll und<br />
ganz bestätigen. <strong>Die</strong> Wagen vom Typ<br />
Mannheim hatten mich als gebürtigen<br />
Mannheimer dagegen auch enttäuscht ...<br />
Jürgen Niemeyer, Mannheim<br />
Zu „120 Jahre Dessauer<br />
Straßenbahn“ (SM 6/2014)<br />
<strong>Die</strong> KWU nahmen<br />
andere Entwicklung<br />
In diesem Beitrag werden auch die<br />
Kommunalwirtschaftsunternehmen (abgekürzt<br />
KWU) erwähnt. Dazu e<strong>in</strong>e Korrektur:<br />
<strong>Die</strong> Gründung der KWU erfolgte auf der<br />
Grundlage der von der Deutschen Wirtschaftskommission<br />
(zivile Zentralregierung<br />
der sowjetischen Besatzungszone) am<br />
21. November 1948 erlassenen „Kommunalwirtschaftsverordnung“.<br />
Aufgrund der<br />
damals langsamen Nachrichtenwege war<br />
die Gründung e<strong>in</strong>es KWU frühestens am<br />
1. Januar 1949 möglich. Deshalb gehe ich<br />
davon aus, dass der Dessauer Verkehrsbetrieb<br />
nicht 1948, sondern 1949 dem KWU<br />
angegliedert worden ist.<br />
Außerdem gliederte die Stadtverwaltung<br />
im Jahre 1951 nicht den Verkehrsbetrieb<br />
aus dem KWU aus. Vielmehr mussten alle<br />
KWU auf Grund der am 22. Januar 1951<br />
von der Regierung der DDR erlassenen<br />
„Verordnung über die Organisation der<br />
örtlichen Industrie und der kommunalen<br />
E<strong>in</strong>richtungen“ aufgelöst werden. <strong>Die</strong><br />
e<strong>in</strong>zelnen Betriebsteile der KWU wurden<br />
danach als selbständige Volkseigene<br />
Betriebe (VEB) weitergeführt.<br />
Mario Schatz, Dresden<br />
Zu „Fahrzeuge der Bonner<br />
Straßenbahn“ (SM 6/2014)<br />
Richtige Firmierung<br />
der Hersteller beachten<br />
Der Autor des Beitrages schreibt, dass<br />
die elektrische Straßenbahn <strong>in</strong> Bonn am<br />
21. Mai 1902 ihren Betrieb aufnahm. Den<br />
elektrischen Teil der zu diesem Zeitpunkt<br />
vorhandenen Fahrzeuge hätten die Siemens-Schuckertwerke<br />
gebaut. Letzteres ist<br />
jedoch unmöglich, denn die Firma Siemens<br />
& Halske <strong>in</strong> Charlottenburg bei Berl<strong>in</strong> und<br />
die Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals<br />
Schuckert & Co. <strong>in</strong> Nürnberg schlossen erst<br />
im März 1903 e<strong>in</strong>en Vertrag zur Zusammenlegung<br />
ihrer Starkstromproduktion <strong>in</strong><br />
der neuen Firma „Siemens-Schuckert-Werke<br />
G.m.b.H.“ (so die offizielle Schreibweise)<br />
mit Sitz <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> und Nürnberg.<br />
Korrektur zur Verwendung der neuen BVG-Busse<br />
Im „E<strong>in</strong>steigen, bitte …“ beschrieb ich<br />
im Heft 7 auf Seite 3 aktuelle Probleme<br />
der Bremer Straßenbahn AG mit den<br />
Niederflurwagen vom Typ GT8N. Ich kritisierte<br />
aus diesem Grund die zuvor erfolgte<br />
Abstellung und den Verkauf der<br />
letzten Wegmannwagen als voreilig.<br />
Kurz vor Redaktionsschluss aus Berl<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>gegangene Aufnahmen und Informationen<br />
<strong>in</strong>terpretierte ich falsch: So hat die<br />
BVG die erwähnten 15 Busse nicht zur<br />
Verstärkung von Straßenbahnkursen erworben,<br />
sondern um den Buspark für die<br />
mit dem Land vere<strong>in</strong>barten Mehrleistungen<br />
zu erweitern. Durch die Angebotserweiterung<br />
auf Straßen und Schienen benötigt<br />
die BVG zusätzliche Busse – nicht<br />
Straßenbahnwagen. Während die bisher<br />
für baustellenbed<strong>in</strong>gte Straßenbahn-Ersatzverkehre<br />
genutzten Busse seit April im<br />
regulären Busl<strong>in</strong>iendienst verwendet werden,<br />
dienen die aus Amsterdam und Stuttgart<br />
erworbenen Busse seitdem vor allem<br />
dem Ersatzverkehr von baustellenbed<strong>in</strong>gt<br />
verkürzt fahrenden oder unterbrochenen<br />
Straßen- oder U-Bahnl<strong>in</strong>ien. Ich bitte den<br />
Fehler zu entschuldigen. Durch die stetige<br />
Auslieferung weiterer Niederflurwagen<br />
werden modernisierte KT4D frei,<br />
welche die bestellten Mehrleistungen<br />
auf anderen L<strong>in</strong>ien übernehmen bzw. als<br />
Schüler- oder Verstärker züge zum E<strong>in</strong>satz<br />
kommen – beispielsweise auf den L<strong>in</strong>ien<br />
M4, M6 oder M8.<br />
Leser des <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
berichten, dass – nach bislang unbestätigten<br />
Meldungen – 20 modernisierte<br />
KT4D e<strong>in</strong>e erneute Hauptuntersuchung<br />
bekommen sollen. André Marks<br />
<strong>Die</strong> elektrische Ausrüstung der ersten<br />
Fahrzeuge <strong>in</strong> Bonn stammte von Siemens<br />
& Halske – so der Firmenkatalog dieses<br />
Unternehmens. Erkennbar ist es aber<br />
auch an der Bauart der Triebwagen mit<br />
ovalem Vorbaufahrschalter. Noch e<strong>in</strong><br />
Punkt: Im Jahr 1906 konnte die Firma Siemens<br />
& Halske die Straßenbahn nicht umspuren,<br />
da sie sich zu diesem Zeitpunkt nur<br />
noch mit Schwachstromtechnik befasste.<br />
Hier werden es wohl die Siemens-Schuckert-Werke<br />
gewesen se<strong>in</strong>, die den elektrischen<br />
Teil der Umspurung besorgten oder<br />
vielleicht auch als Generalauftragsnehmer<br />
aufgetreten s<strong>in</strong>d. M. Müller, Berl<strong>in</strong><br />
Zu „Wagen der DWM/Waggon<br />
Union“ (SM 6/2014)<br />
Oft wechselnde Firmen<br />
<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Re<strong>in</strong>ickendorf<br />
Zum auf Seite 44 abgedruckten Kasten<br />
noch e<strong>in</strong>ige H<strong>in</strong>weise, da sich die jüngere<br />
Geschichte des Standortes <strong>in</strong> Re<strong>in</strong>ickendorf<br />
etwas vielschichtiger darstellt<br />
und der heutige Zustand eigentlich nicht<br />
beschrieben wurde:<br />
ADtranz als Nachfolger von ABB Henschel<br />
verlagerte die Re<strong>in</strong>ickendorfer Fertigung<br />
im Jahre 1997 zum neu gebauten Werk <strong>in</strong><br />
Berl<strong>in</strong>-Wilhelmsruh auf dem Gelände der<br />
ehemaligen Bergmann-Werke (heute Gewerbegebiet<br />
„PankowPark“, Stammsitz<br />
der Stadler Pankow GmbH). Als Fertigungsstandort<br />
wurde Re<strong>in</strong>ickendorf seitens<br />
ADtranz aufgegeben und das verbliebene<br />
Gelände unter wechselnden<br />
Betreibern als Gewerbepark fortgeführt<br />
(aktuell „Holzhauser Markt“). Das Areal<br />
wird heute von Fach- und Supermärkten<br />
dom<strong>in</strong>iert. Allerd<strong>in</strong>gs verblieb die Lackiererei<br />
als aktive Produktionsstätte unter anderem<br />
für Schienenfahrzeuge und zugehörige<br />
Komponenten <strong>in</strong>habergeführt als<br />
„Dangelmayr Oberflächentechnik<br />
GmbH“. Somit blieb auch der Gleisanschluss<br />
zum Gelände erhalten. E<strong>in</strong>e gegenüber<br />
der Lackiererei bef<strong>in</strong>dliche und<br />
über e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Schiebebühne erreichbare<br />
Fertigungshalle nutzte ADtranz<br />
ab 1999 wieder als Standort für den Servicebereich<br />
(Modernisierungen, Reparaturen,<br />
auch Montage von Neufahrzeugen).<br />
80<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014<br />
81<br />
Nummer 298 • 8/2014 • Juli • 45. Jahrgang<br />
In diesen Fachgeschäften erhalten Sie das <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Term<strong>in</strong>e<br />
20. Juli, Bochum: „MuseumsExpress“<br />
Bochum Hbf – Bf Dahlhausen (S); fünf<br />
Abfahrten <strong>in</strong> Bochum zwischen 11.02<br />
und 17.02 Uhr sowie von Dahlhausen<br />
zwischen 11.51 und 17.51 Uhr<br />
20. Juli, Leipzig: Der „Historische Straßenbahnhof<br />
Leipzig-Möckern“ hat von<br />
10 bis 17 Uhr geöffnet. Stündlich pendelt<br />
im Zubr<strong>in</strong>gerverkehr die L<strong>in</strong>ie 29E<br />
mit historischen Wagen zwischen dem<br />
Museum und der Innenstand und es f<strong>in</strong>den<br />
Sonderfahrten mit historischen Wagen<br />
statt. Weitere Informationen unter:<br />
www.strassenbahnmuseum.de<br />
26./27. Juli, Bad Schandau: Sonderbetrieb<br />
anlässlich des Kirnitzschtalfestes<br />
mit historischen Wagen<br />
27. Juli, München: Öffnungstag des<br />
MVG-Museums <strong>in</strong> der Ständlerstraße 20<br />
von 11 bis 17 Uhr<br />
Postleitzahlgebiet 0<br />
Thalia-Buchhandlung, 02625 Bautzen,<br />
Kornmarkt 7 · Fachbuchhandlung<br />
Hermann Sack, 04107 Leipzig,<br />
Harkortstr. 7<br />
Postleitzahlgebiet 1<br />
Schweitzer Sortiment, 10117 Berl<strong>in</strong>,<br />
Französische Str. 13/14 · Loko Motive<br />
Fachbuchhandlung, 10777 Berl<strong>in</strong>,<br />
Regensburger Str. 25 · Modellbahnen<br />
& Spielwaren Michael Turberg, 10789<br />
Berl<strong>in</strong>, Lietzenburger Str. 51 · Buchhandlung<br />
Flügelrad, 10963 Berl<strong>in</strong>,<br />
Stresemannstr. 107 · Modellbahn-<br />
Pietsch, 12105 Berl<strong>in</strong>, Prühßstr. 34<br />
Postleitzahlgebiet 2<br />
Roland Modellbahnstudio,<br />
28217 Bremen, Wartburgstr. 59<br />
Postleitzahlgebiet 3<br />
Buchhandlung Decius, 30159 Hannover,<br />
Marktstr. 52 · Tra<strong>in</strong> & Play, 30159<br />
Hannover, Breite Str. 7 · Pfankuch<br />
Buch, 38023 Braunschweig, Postfach<br />
3360 · Pfankuch Buch, Kle<strong>in</strong>e Burg<br />
10, 38100 Braunschweig<br />
Postleitzahlgebiet 4<br />
Menzels Lokschuppen, 40217 Düsseldorf,<br />
Friedrichstr. 6 · Goethe-Buchhandlung,<br />
40549 Düsseldorf, Will -<br />
stätterstr. 15 · Modellbahnladen Hilden,<br />
Hofstr. 12, 40723 Hilden · Fach -<br />
buchhandlung Jürgen Donat, 47058<br />
Duis burg, Ottilienplatz 6<br />
Postleitzahlgebiet 5<br />
Technische Spielwaren Kar<strong>in</strong> L<strong>in</strong>denberg,<br />
50676 Köln, Blaubach 6-8 ·<br />
Modellbahn-Center Hünerbe<strong>in</strong>, 52062<br />
Aachen, August<strong>in</strong>ergasse 14 · Mayersche<br />
Buchhandlung, 52064 Aachen,<br />
Matthiashofstr. 28-30 · Buchhandlung<br />
Karl Kerst<strong>in</strong>g, 58095 Hagen, Berg -<br />
str. 78<br />
Postleitzahlgebiet 6<br />
Kerst & Schweitzer, 60486 Frankfurt,<br />
Solmsstr. 75<br />
Postleitzahlgebiet 7<br />
Stuttgarter Eisenbahn-u.Verkehrsparadies,<br />
70176 Stuttgart, Leuschnerstr.<br />
35 · Buch hand lung Wilhelm Messerschmidt,<br />
70193 Stuttgart, Schwabstr.<br />
96 · Buchhandlung Albert Müller,<br />
70597 Stutt gart, Epplestr. 19C · Eisen -<br />
bahn-Treffpunkt Schweickhardt,<br />
71334 Waibl<strong>in</strong>gen, Biegelwiesenstr.<br />
31 · Osiandersche Buch handlung,<br />
72072 Tüb<strong>in</strong>gen, Unter dem Holz 25 ·<br />
Buch verkauf Alfred Jung<strong>in</strong>ger, 73312<br />
Geis l<strong>in</strong>gen, Karlstr. 14 · Service rund<br />
ums Buch Uwe Mumm, 75180 Pforzheim,<br />
Hirsauer Str. 122 · Modellbahnen<br />
Mössner, 79261 Gutach, Landstr.<br />
16 A<br />
Postleitzahlgebiet 8<br />
Fachbuchzentrum & Antiquariat Stiletto,<br />
80634 München, Schulstr. 19 ·<br />
Augsburger Lok schuppen, 86199<br />
Augsburg, Gögg<strong>in</strong>ger Str. 110 · Verlag<br />
Benedikt Bickel, 86529 Schroben -<br />
hausen, Ingolstädter Str. 54<br />
Postleitzahlgebiet 9<br />
Buchhandlung Jakob, 90402 Nürnberg,<br />
Hefners platz 8 · Modellbahnvertrieb<br />
Gisela Scholz, 90451 Nürnberg,<br />
Nördl<strong>in</strong>ger Str. 13 · Modell spielwaren<br />
Helmut Sigmund, 90478 Nürnberg,<br />
Schweiggerstr. 5 · Buchhandlung<br />
Rupprecht, 92648 Vohenstrauß, Zum<br />
Beckenkeller 2 · Fried rich Pustet & .,<br />
94032 Passau, Nibe lun gen platz 1 ·<br />
Schön<strong>in</strong>gh Buchhandlung & ., 97070<br />
Würz burg, Franziskanerplatz 4<br />
Österreich<br />
Buchhandlung Herder, 1010 Wien,<br />
Wollzeile 33 · Modellbau Pospischil,<br />
1020 Wien, Novaragasse 47 · Technische<br />
Fachbuch handlung, 1040 Wien,<br />
Wiedner Hauptstr. 13 · Leporello – die<br />
Buchhandlung, 1090 Wien, Liechtenste<strong>in</strong>str.<br />
17 · Buchhandlung Morawa,<br />
1140 Wien, Hack<strong>in</strong>ger Str. 52 · Buchhandlung<br />
J. Heyn, 9020 Klagenfurt,<br />
Kramergasse 2-4<br />
Belgien<br />
Musée du Transport Urba<strong>in</strong> Bruxellois,<br />
1090 Brüssel, Boulevard de Smet de<br />
Naeyer 423/1<br />
Tschechien<br />
Rezek Pragomodel, 110 00 Praha 1<br />
Klimentska 32<br />
Dänemark<br />
Peter Andersens Forlag, 2640 Hede -<br />
husene, Brandvaenget 60<br />
Spanien<br />
Librimport, 8027 Barcelona, Ciudad<br />
de Elche 5<br />
Großbritannien<br />
ABOUT, GU46 6LJ, Yateley,<br />
4 Borderside<br />
Ob Tag der offenen Tür, Sonderfahrt oder Sym posium:<br />
Veröffentlichen Sie Ihren Term<strong>in</strong> hier kostenlos.<br />
Fax (0 89) 13 06 99-700 · E-Mail: redaktion@geramond.de<br />
2. August, Bochum: Nostalgischer Straßenbahnverkehr<br />
Gelsenkirchen Hbf – Essen<br />
Hbf; sieben mal stündlich ab 11.17<br />
Uhr bzw. von Essen Hbf ab 11.04 Uhr bis<br />
nach 18 Uhr<br />
2. August, Döbeln: Öffentliche Fahrtage<br />
der Pferdestraßenbahn, jeweils 10 bis<br />
12.30 und 14 bis 17 Uhr. <strong>Die</strong> Fahrten beg<strong>in</strong>nen<br />
am Pferdebahnmuseum, Niederwerder<br />
6. Das Museum ist <strong>Die</strong>nstag bis<br />
Freitag 10 bis 17 Uhr und sonnabends<br />
9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet (an den o. g.<br />
Fahrtagen bis 17 Uhr)<br />
2. August, Freiburg: die Oldtimerl<strong>in</strong>ie 7<br />
verkehrt aufgrund von Bauarbeiten 2014<br />
auf der Route Haid/Munz<strong>in</strong>ger Straße –<br />
We<strong>in</strong>garten – Technisches Rathaus – Hauptfriedhof<br />
– Hornusstraße – Zähr<strong>in</strong>gen/Gundelf<strong>in</strong>ger<br />
Straße; die Mitfahrt ist kostenfrei,<br />
es werden aber limitierte Spenden-Sonderfahrsche<strong>in</strong>e<br />
zum Erhalt der Wagen angeboten,<br />
Betriebszeit 9.26 bis 17.19 Uhr<br />
Niederlande<br />
van Stockum Boekverkopers, 2512<br />
GV, Den Haag, Weste<strong>in</strong>de 57 · Norsk<br />
Modell jernbane AS, 6815 ES, Arnheim,<br />
Kluizeweg 474<br />
die historische Burgr<strong>in</strong>gl<strong>in</strong>ie 15 entlang<br />
der Nürnberger Altstadt<br />
17. August, Bochum: „MuseumsExpress“<br />
Bochum Hbf – Bf Dahlhausen<br />
(S); fünf Abfahrten <strong>in</strong> Bochum zwischen<br />
11.02 und 17.02 Uhr sowie von Dahlhausen<br />
zwischen 11.51 und 17.51 Uhr<br />
17. August, Leipzig: Der „Historische<br />
Straßenbahnhof Leipzig-Möckern“ hat<br />
von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Stündlich<br />
pendelt im Zubr<strong>in</strong>gerverkehr die L<strong>in</strong>ie<br />
29E mit historischen Wagen zwischen<br />
dem Museum und der Innenstand und<br />
es f<strong>in</strong>den Sonderfahrten mit historischen<br />
Wagen statt. Weitere Informationen unter:<br />
www.strassenbahnmuseum.de<br />
6. September, Augsburg: Rundfahrten<br />
von avg und „Freunden der Augsburger<br />
Straßenbahn e.V.“ (F.d.A.S.) mit<br />
KSW Nr. 506, bei technischen Defekten<br />
GT 8; Abfahrt Königsplatz, B2: 14.05,<br />
15.05 und 16.05 Uhr, Fahrsche<strong>in</strong>e beim<br />
Schaffner im Wagen, Erwachsene 3<br />
Euro, K<strong>in</strong>der 1,50 Euro (Mitglieder von<br />
Straßenbahnvere<strong>in</strong>en frei)<br />
Betriebe<br />
Fahrzeuge<br />
Geschichte<br />
www.strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de<br />
Redaktionsanschrift:<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Postfach 40 02 09 · D-80702 München<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.720<br />
Fax + 49 (0) 89.13 06 99.700<br />
redaktion@strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de<br />
Verantw. Redakteur:<br />
André Marks, andre.marks@geramond.de<br />
Redaktion:<br />
Michael Krische (Chefredakteur),<br />
Thomas Hanna-Daoud, Mart<strong>in</strong> Weltner<br />
Redaktion Straßenbahn im Modell:<br />
Jens-Olaf Griese-Bande low,<br />
jobandelow@geramond.de<br />
Redaktionsteam:<br />
Berthold <strong>Die</strong>trich-Vandon<strong>in</strong>ck, Wolfgang Kaiser,<br />
Michael Kochems, Bernhard Kuß magk,<br />
Ronald Glembotzky, Hans Immer,<br />
Dr. Mart<strong>in</strong> Pabst, Axel Reuther, Robert Schrempf,<br />
Michael Sperl, Guido Mandorf<br />
Redaktionsassistenz: Brigitte Stuiber<br />
ABO –HOTLINE<br />
Leserservice, GeraMond-Programm<br />
Tel. 0180 – 532 16 17 (14 ct/m<strong>in</strong>.)<br />
Fax 0180 – 532 16 20 (14 ct/m<strong>in</strong>.)<br />
leserservice@strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de<br />
Gesamtanzeigenleitung:<br />
Rudolf Gruber<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.527<br />
rudolf.gruber@verlagshaus.de<br />
Anz.-leitung <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>:<br />
Helmut Gassner<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.520<br />
helmut.gassner@verlagshaus.de<br />
Anzeigendispo <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>:<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.130<br />
anzeigen@verlagshaus.de<br />
www.verlagshaus-media.de<br />
Es gilt Anzeigenpreisliste Nr. 24 vom 1.1.2014<br />
Layout: Kar<strong>in</strong> Vierheller<br />
Litho: Cromika, Verona<br />
Druck: Stürtz GmbH, Würzburg<br />
Verlag:<br />
GeraMond Verlag GmbH,<br />
Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
Geschäftsführung:<br />
Clemens Hahn<br />
Herstellungsleitung:<br />
Sandra Kho<br />
Leitung Market<strong>in</strong>g und Sales Zeitschriften:<br />
Andreas Thorey<br />
Vertriebsleitung:<br />
Dr. Reg<strong>in</strong>e Hahn<br />
Vertrieb/Auslieferung Handel:<br />
MZV, Unterschleißheim<br />
Im selben Verlag ersche<strong>in</strong>en außerdem:<br />
AUTO CLASSIC TRAKTOR CLASSIC SCHIFF CLASSIC<br />
FLUGMODELL MODELLFAN MILITÄR & GESCHICHTE<br />
FLUGZEUG CLASSIC SCHIFFSMODELL CLAUSEWITZ<br />
2. August, Augsburg: Rundfahrten<br />
Preise: E<strong>in</strong>zelheft Euro 8,50 (D), Euro 9,50 (A),<br />
sFr. 15,90 (CH), bei E<strong>in</strong>zelversand zzgl. Porto;<br />
von avg und „Freunden der Augsburger<br />
2., 16. August, Halle (Saale): <strong>Die</strong> Halleschen<br />
Straßenbahnfreunde e.V. laden von<br />
Jahresabopreis (12 Hefte) Euro 91,80 (<strong>in</strong>cl. MwSt.,<br />
Straßenbahn e.V.“ (F.d.A.S.) mit KSW Nr.<br />
im Ausland zzgl. Versandkosten)<br />
506, bei technischen Defekten GT 8; Abfahrt<br />
Königsplatz, B2: 14.05, 15.05 und<br />
11 bis 17 Uhr <strong>in</strong>s Historische Straßenbahndepot<br />
auf die Seebener Straße 191 e<strong>in</strong> 6. September, Bochum: Nostalgischer<br />
<strong>Die</strong> Abogebühren werden unter der Gläubiger-Identifikationsnummer<br />
DE63ZZZ00000314764 des Gera -<br />
Nova Bruckmann Verlagshauses e<strong>in</strong>gezogen. Der<br />
16.05 Uhr, Fahrsche<strong>in</strong>e beim Schaffner 2./3. August, Nürnberg: Öffnungstag Straßenbahnverkehr Gelsenkirchen Hbf E<strong>in</strong>zug erfolgt jeweils zum Ersche<strong>in</strong>ungsterm<strong>in</strong> der<br />
im Wagen, Erwachsene 3 Euro, K<strong>in</strong>der im Historischen Straßenbahndepot St. Peter<br />
von 10 bis 17.30 Uhr (17 Uhr letzter 11.17 Uhr bzw. von Essen Hbf ab 11.04 Impressum. <strong>Die</strong> Mandatsreferenznummer ist die auf<br />
– Essen Hbf; sieben mal stündlich ab Ausgabe, der mit der Vorausgabe ankündigt wird. Den<br />
aktuellen Abopreis f<strong>in</strong>det der Abonnent immer hier im<br />
1,50 Euro (Mitglieder von Straßenbahnvere<strong>in</strong>en<br />
frei)<br />
E<strong>in</strong>lass), während der Öffnungszeiten fährt Uhr bis nach 18 Uhr<br />
dem Adressetikett e<strong>in</strong>gedruckte Kundennummer.<br />
Ersche<strong>in</strong>en und Bezug: <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
ersche<strong>in</strong>t monatlich. Sie erhalten die Reihe <strong>in</strong> Deutsch -<br />
land, <strong>in</strong> Österreich und <strong>in</strong> der Schweiz im Bahnhofs buch -<br />
Selbige verlagerte aber ab 2008 wiederum Stadler Re<strong>in</strong>ickendorf GmbH gegründet. handel, an gut sortierten Zeitschriftenki os ken, im Fachbuchhandel<br />
sowie direkt beim Verlag.<br />
ihre Aktivitäten nach Hennigsdorf. Letzteres übernahm 2011 die Lackiererei<br />
© 2013 by GeraMond Verlag. <strong>Die</strong> Zeitschrift und alle ihre<br />
<strong>Die</strong> erneut frei gewordene Halle dient von Dangelmayr und nutzt den Standort enthaltenen Beiträge und Abbildungen s<strong>in</strong>d urheberrechtlich<br />
geschützt. Durch Annahme e<strong>in</strong>es Manu skripts erwirbt<br />
nun seit 2010 der Firma Stadler als Fertigungsstätte<br />
für Alum<strong>in</strong>ium-Rohbauten; ren und weitere Servicetätigkeiten.<br />
Für unverlangt e<strong>in</strong> gesandte Fotos wird ke<strong>in</strong>e Haftung<br />
<strong>in</strong>zwischen außerdem für Unfallreparatu-<br />
der Verlag das aus schließ liche Recht zur Ver öffentlichung.<br />
übernommen. Gerichtsstand ist München.<br />
hierfür wurde das Tochterunternehmen<br />
Ivo Köhler, Potsdam Ver antwortlich für den redaktionellen Inhalt: André Marks;<br />
verantwortlich für Anzeigen: Rudolf Gruber, beide Infanteriestr.<br />
11a, 80797 München.<br />
ISSN 0340-7071 • 10815<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 8 | 2014 81<br />
Der ADtranz-Nachfolger Bombardier verlegte<br />
den Service im Herbst 2002 nach<br />
Halle-Ammendorf (und 2005 nach Hennigsdorf).<br />
Nachmieter <strong>in</strong> der Re<strong>in</strong>ickendorfer<br />
Fabrikhalle war die neu gegründete<br />
Fahrzeugwerke Miraustraße GmbH (FWM).
<strong>Vorschau</strong><br />
SLG. THÜRINGERWALDBAHN UND <strong>STRASSENBAHN</strong> GOTHA GMBH<br />
Liebe Leser,<br />
Sie haben<br />
Freunde, die<br />
sich ebenso<br />
für die<br />
Straßenbahn<br />
mit all Ihren<br />
Facetten begeistern<br />
wie Sie? Dann empfehlen<br />
Sie uns doch weiter! Ich freue mich<br />
über jeden neuen Leser<br />
André Marks,<br />
Verantwortlicher Redakteur<br />
Mit der Straßenbahn <strong>in</strong>s grüne Herzen Thür<strong>in</strong>gens<br />
Sie kennt jeder Straßenbahnfreund – die Thür<strong>in</strong>gerwaldbahn von Gotha nach Waltershausen bzw. Tabarz. Verkehrt dieses<br />
Kle<strong>in</strong>od <strong>in</strong>zwischen seit exakt 85 Jahren, so schaute die Straßenbahn Gotha im Mai 2014 auf e<strong>in</strong>e 120-jährige Betriebsgeschichte<br />
zurück. Am 20./21. September wird dieses Doppeljubiläum zünftig gefeiert. Im Vorfeld der Veranstaltungen ersche<strong>in</strong>t<br />
im <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 9 e<strong>in</strong> großes Porträt der beiden Meterspurbahnen bzw. des heutigen Betriebs TWSB.<br />
Weitere Themen der kommenden Ausgabe<br />
Bremen: Auf <strong>in</strong>s dritte Jahrzehnt!<br />
<strong>Die</strong> erste Serie von Niederflurwagen der Hansestadt ist im<br />
dritten E<strong>in</strong>satzjahrzehnt angekommen. Ihre Unterhaltung wird<br />
zeitaufwendiger, es gibt Probleme – das nehmen wir zum Anlass<br />
für e<strong>in</strong>en Rückblick auf 20 Jahre GT8N <strong>in</strong> Bremen. Der<br />
von den Herstellerfirmen MAN/GHH und Kiepe geme<strong>in</strong>sam<br />
mit der BSAG entwickelte Wagentyp setzte 1990 <strong>in</strong>ternational<br />
Maßstäbe: Es war der weltweit erste Straßenbahnwagen mit<br />
durchgehend niederflurigem Wagenboden.<br />
Durch Schwer<strong>in</strong> mit der L<strong>in</strong>ie 3<br />
Sie durchquert die alte Großherzogliche Residenzstadt von<br />
Nordwest nach Südost und verb<strong>in</strong>det dabei zwei große Plattenbaugebiete<br />
mite<strong>in</strong>ander – Schwer<strong>in</strong>s L<strong>in</strong>ie 3. Das Porträt<br />
stellt alles Sehenswerte um deren Streckenverlauf vor.<br />
ULF LIEBERWIRTH<br />
Goldene Zeit <strong>in</strong> Nürnberg?<br />
<strong>Die</strong> Straßenbahn war 1994 <strong>in</strong> Nürnberg längst nicht mehr<br />
Hauptträger des ÖPNV, diese Rolle hatte sie an die U- und<br />
S-Bahn abgetreten. Aber ihr Weiterbetrieb war vor 20 Jahren<br />
bereits gesichert gewesen. Davon zeugten unter anderem<br />
die neuen Niederflurwagen. Aber was gehörte <strong>in</strong> Nürnberg<br />
damals noch zum Betriebsalltag der Straßenbahn?<br />
STEFAN HINDER<br />
<strong>Die</strong> Beiwagen der<br />
Darmstädter Straßenbahn<br />
Bei westdeutschen Straßenbahnbetrieben ist der Beiwagenbetrieb<br />
e<strong>in</strong>e Besonderheit geworden. HEAG mobilo hält an<br />
dieser bewährten Lösung dennoch fest. Der Beitrag stellt sowohl<br />
die e<strong>in</strong>st als auch heute noch <strong>in</strong> Darmstadt e<strong>in</strong>gesetzten<br />
Beiwagentypen vor, deren jüngste Generation 2014 bereits<br />
auf zwei E<strong>in</strong>satzjahrzehnte zurückblickt.<br />
Ende gut …?<br />
Bahn frei für<br />
neue Sounds<br />
Nächster Halt: Jazz Tube ´14. <strong>Die</strong> Stadtwerke<br />
Bonn sorgen auch <strong>in</strong> diesem Jahr<br />
wieder für besonderen Sound im Untergrund.<br />
An den drei U-Bahn-Stationen<br />
Bonn Hbf/Thomas-Mann-Straße, Universität/Markt<br />
und Museumsmeile/Heussallee<br />
geben Musiker aus Bonn und Umgebung<br />
seit 23. Mai sowie an drei noch<br />
folgenden Tagen den Ton an. E<strong>in</strong>e Mischung<br />
aus Jazz, Blues, Lat<strong>in</strong>, Soul und<br />
Improvisation wartet dann auf die Besucher<br />
– live an der Haltestelle.<br />
Geboten wird das Spektakel jeweils freitags<br />
17 bis 20 Uhr noch am 25. Juli, 29.<br />
August sowie 26. September. Weitere Informationen<br />
gibt es unter www.jazztube-bonn.de.<br />
Das Abschlusskonzert am 24. Oktober<br />
f<strong>in</strong>det im LVR-LandesMuseum Bonn mit<br />
den Gew<strong>in</strong>nern des Vot<strong>in</strong>gs statt – dieser<br />
Veranstaltungsort ist dann natürlich<br />
ebenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
zu erreichen.<br />
Und was soll uns das am Ende sagen? Bei<br />
der Jazz Tube ´14 handelt es sich um e<strong>in</strong>e<br />
etwas andere Art und e<strong>in</strong>en etwas anderen<br />
Ort, um für den Verkehrsbetrieb zu<br />
werben – e<strong>in</strong>schließlich „nachhaltiger“<br />
An- und Abreise mit den Stadtbahnl<strong>in</strong>ien<br />
16, 63 und 66. Genau deshalb ist es am<br />
Ende e<strong>in</strong>e wirklich gute Sache! TE/AM<br />
DAS <strong>STRASSENBAHN</strong>-<strong>MAGAZIN</strong> 9/2014 ersche<strong>in</strong>t am 22. August 2014<br />
82<br />
… oder schon 2 Tage früher mit bis zu 36 % Preisvorteil und Geschenk-Prämie! Jetzt sichern unter www.strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de<br />
Plus Geschenk<br />
Ihrer Wahl:<br />
z.B. DVD »Trams<br />
im Wirtschafts -<br />
wunderland«
Das besondere Bild<br />
Das besondere Bild<br />
Das besondere Bild<br />
Am 5. August 1976 trafen sich <strong>in</strong> Neapel <strong>in</strong> der Via Vannella<br />
Gaetani an der Piazza Vittorio zwei Triebwagen der Serie<br />
951 bis 1054. <strong>Die</strong>se von der Waggonfabrik IMAM Volturnio<br />
gebauten Fahrzeuge stammten aus den 1930er-Jahren.<br />
Um 1960 wurden ca. 50 Wagen durch das ortsansässige Unternehmen<br />
AERFER modernisiert und erhielten leicht stroml<strong>in</strong>ienförmige Plattformen<br />
– so auch die fotografierten Tw 961 und 1031. Letzterer trug<br />
anstelle des „Mussol<strong>in</strong>igrüns“ bereits e<strong>in</strong>e orange -graue Lackierung.<br />
Ab den 1970er-Jahren erhielten viele der Fahrzeuge neue Wagenkästen.<br />
Zwischen Mai 2003 und Januar 2004 ruhte der Gesamtbetrieb<br />
der Straßenbahn. In dieser Zeit fanden umfangreiche Gleiserneuerungen<br />
sowie die Umstellung der gesamten Fahrleitungsanlage<br />
auf Betrieb mit Pantographen statt. <strong>Die</strong> auf diese Weise umgerüsteten<br />
Vierachser der hier vorgestellten Serie lösten zwischen 2004<br />
und 2007 letztendlich 22 Niederflurwagen vom Typ Sirio der Firma<br />
Ansaldo/Breda ab. Der Tw 1029 wird als Museumswagen genutzt,<br />
e<strong>in</strong>ige neukarrossierte Vierachser s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>gegen als Reserve<br />
vorhanden.<br />
TEXT & FOTO: WOLFGANG MEIER