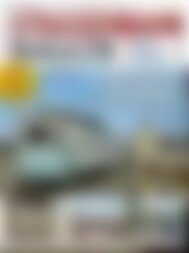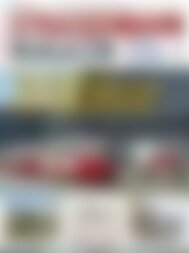STRASSENBAHN MAGAZIN Berlin nach dem Mauerfall (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Österreich: € 9,50<br />
1/2013 | Jan. € 8,50<br />
Schweiz: sFr. 15,90<br />
NL: LUX: € € 9,90<br />
Europas größte Straßenbahn-Zeitschrift<br />
9,90<br />
<strong>Berlin</strong> <strong>nach</strong> <strong>dem</strong> <strong>Mauerfall</strong> • »Schüttelrutschen« und »Schaukelpferde« • Münchner Maximumtriebwagen • Tram und Obus Schaffhausen <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1/2013<br />
Die letzten »Schaukelpferde«<br />
und »Schüttelrutschen«<br />
Maximum-Triebwagen in<br />
München: 550 Exemplare!<br />
Betriebe<br />
Fahrzeuge<br />
Geschichte<br />
Die Geschichte von Obus<br />
und Tram in Schaffhausen
Die schönsten<br />
Seiten der Bahn<br />
Das<br />
neue Heft<br />
mit DVD –<br />
jetzt am<br />
Kiosk!<br />
Online blättern oder Testabo mit Prämie sichern unter:<br />
www.bahn-extra.de/abo
Einsteigen, bitte …<br />
»Fahrt frei« ins neue Tram-Jahr!<br />
Stimmen Sie ab<br />
Traditionell kommt die Januar-Ausgabe des<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong>-<strong>MAGAZIN</strong> bereits im<br />
Dezember in den Handel. Durch die Weih<strong>nach</strong>tsfeiertage<br />
wird gerade dieses Heft stets<br />
sehr aufmerksam studiert. Gleichzeitig lassen<br />
dann viele Leser die vergangenen zwölf Monate<br />
noch einmal Revue passieren: Welche<br />
Trambetriebe haben sie selbst besucht? Was<br />
hat sich bei den heimischen Straßenbahnen im<br />
Vergleich zum Vorjahr alles verändert?<br />
Eine wertvolle Erinnerungshilfe ist dabei<br />
ganz sicher das neue <strong>STRASSENBAHN</strong>-<br />
JAHRBUCH 2013, was hiermit je<strong>dem</strong> Tramfreund<br />
wärmstens empfohlen sei.<br />
Im Dezember stellt sich aber ganz automatisch<br />
auch die Frage: Was wird das neue<br />
Jahr für die Trams bringen? Natürlich werden<br />
zahlreiche Betriebe in Deutschland,<br />
Österreich und der Schweiz neu gebaute Niederflurwagen<br />
in Betrieb nehmen. Das Erscheinungsbild<br />
der Trams ist dadurch weiter<br />
im Wandel begriffen.<br />
Wie umfangreich sollte die Berichterstattung über Tram-<br />
Neueröffnungen in Frankreich 2013 sein?<br />
• ich wünsche mir ausführliche, mehrseitige Berichte, illustriert mit<br />
tollen Aufnahmen<br />
• mir genügt eine kurze Berichterstattung im Journal-Teil<br />
• zusätzlich zu den Kurzberichten im Journal würde ich mich über zwei,<br />
drei Seiten mit Aufnahmen freuen<br />
Stimmen Sie online ab: www.strassenbahn-magazin.de<br />
Im Gegenzug wird in Deutschland die Anzahl<br />
der regulär eingesetzten N-Wagen weiter<br />
sinken, in den östlichen Bundesländern die der<br />
dort noch vorhandenen Tatras.<br />
Doch in den nächsten Monaten stehen in<br />
den drei deutschsprachigen Ländern auch wieder<br />
mehrere Streckenverlängerungen und<br />
Netzerweiterungen an. Über diese zu berichten,<br />
wird einer der Schwerpunkte im Jahrgang<br />
2013 von <strong>STRASSENBAHN</strong>-<strong>MAGAZIN</strong>.<br />
Bei aller Freude über den weiteren Ausbau<br />
der Trams in Deutschland, Österreich und der<br />
Schweiz – im Vergleich zu den Vorhaben in<br />
Frankreich müssen sie jedoch als Marginalien<br />
bezeichnet werden. Mehrere Autoren stehen<br />
bereit, über die neuen Betriebe im westlichen<br />
Nachbarland der Bundesrepublik auf das Ausführlichste<br />
zu berichten. Doch interessiert die<br />
deutsche Leserschaft die Entwicklung in<br />
Frankreich wirklich bis ins kleinste Detail?<br />
Durch die Abstimmung zu dieser Frage möchte<br />
ich Sie am Umfang der Berichterstattung<br />
2013 teilhaben lassen. Bitte machen Sie von<br />
dieser Möglichkeit zur Mitbestimmung regen<br />
Gebrauch! Immerhin sollen auch<br />
die nächsten Ausgaben 2013 für<br />
so viel wie mögliche Leser interessante<br />
Lektüre bieten!<br />
In diesem Sinne wünscht Ihnen<br />
die Redaktion ein frohes<br />
und gesegnetes Weih<strong>nach</strong>tsfest<br />
sowie einen guten Start ins neue<br />
Jahr! ANDRÉ MARKS<br />
Jedes Jahr stellt sich<br />
erneut die Frage:<br />
Haben wir eine<br />
„Weiße Weih<strong>nach</strong>t“?<br />
2010 gab es diese –<br />
bis in die obere Rheinebene<br />
zog sich die<br />
weiße Pracht, als der<br />
AVG-Wagen 920 – ein<br />
2005 von Siemens<br />
gebauter GT8-100D-<br />
M-2S – am 26. Dezember<br />
den Bahnhof<br />
Wörth am Rhein in<br />
Richtung Germersheim<br />
verließ<br />
U. MÜLLER<br />
André<br />
Marks<br />
Verantwortlicher<br />
Redakteur<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
3
Inhalt<br />
Inhalt<br />
TITEL<br />
Das <strong>Berlin</strong>er Nahverkehrsnetz <strong>nach</strong> 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />
Betriebe<br />
Wenn die Blätter fallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />
Fotowetter im Herbst – In den Monaten September und Oktober<br />
bäumt sich die Natur in Deutschland ein letztes Mal vor <strong>dem</strong> Winter<br />
auf. Farben frohes Laub wertet dann viele Motive auf – so auch z.B. in<br />
Essen und Mülheim an der Ruhr<br />
Fluss-Perlen an der Warnow . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
Rostocks Linie 1 im Porträt – Sie ist nicht die längste und auch<br />
nicht die kürzeste Linie in der Hansestadt – aber links und rechts der<br />
Strecke gibt es viele interessante Dinge zu entdecken: Stadttore,<br />
Häfen, Kirchen und ein Depot mit Museumsfahrzeugen<br />
Klein und sympathisch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />
Die Tram der kroatischen Stadt Osijek – In den vergangenen<br />
Jahren erfuhr das Streckennetz eine nennenswerte Erweiterung. Der<br />
Wagenpark setzt sich heute aus modernisierten Tatras und gebraucht<br />
übernommenen Düwags zusammen<br />
Per Tram in die Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />
Frankreich setzt auf Straßenbahnen – In unserem Nachbarland<br />
erleben Trams derzeit eine Renaissance. Dabei entstehen sowohl<br />
Verlängerungen als auch ganze Betriebe neu. Sie gelten als Zeichen<br />
eines zukunftsfähigen Nahverkehrs<br />
Besuch aus England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
60 Jahre O-Bus in<br />
Solingen – Im Juni 2012<br />
blickte Deutschland größter<br />
Trolleybusbetrieb auf<br />
sechs Einsatzjahrzehnte<br />
zurück. Anlässlich des<br />
Jubiläums waren zahlreiche<br />
Gastfahrzeuge <strong>nach</strong><br />
Solingen gekommen –<br />
darunter sogar ein Originalfahrzeug<br />
von 1952!<br />
RUBRIKEN<br />
»Einsteigen, bitte …« . . . . 3<br />
Bild des Monats. . . . . . . . . 6<br />
Journal . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
Nächster Halt. . . . . . . . . . . 25<br />
Einst & Jetzt. . . . . . . . . . . . 52<br />
Forum, Bücher,<br />
Termine, Impressum. . . . . . 78<br />
<strong>Vorschau</strong> . . . . . . . . . . . . . . 82<br />
Das Allerletzte ... . . . . . . . . 82<br />
Das besondere Bild . . . . . . 83<br />
4 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> FOTOEDITION Nr. 1<br />
Rostock: Die Linie 1 im Porträt 18<br />
Tw 322 der Vestischen Straßenbahnen in den 1960er-Jahren auf<br />
<strong>dem</strong> Weg von Recklinghausen <strong>nach</strong> Marl E. J. BOUWMAN, SLG. A. REUTHER<br />
Im Jahr 2013 machen wir unseren Abonnenten ein ganz besonderes<br />
Geschenk: Mit jeder <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>-<br />
Ausgabe des Jahrgangs liefern wir Ihnen ein faszinierendes,<br />
historisches Foto der interessantesten Fahrzeugtypen. Die<br />
Bilder sind auf hochwertigem Chromolux-Karton gedruckt<br />
und können auch als Ansichtskarten verschickt werden.<br />
Osijek/Kroatien: bunter Trambetrieb 28<br />
Übrigens: Wer sich jetzt entschließt, das <strong>STRASSENBAHN</strong><br />
<strong>MAGAZIN</strong> künftig bequem <strong>nach</strong> Hause geschickt zu bekommen,<br />
erhält die komplette zwölfteilige Foto-Edition und<br />
spart gegenüber <strong>dem</strong> Heft-Einzelkauf im Handel bares Geld!<br />
Fahrzeuge<br />
Auf großem Rad durch Bayerns Herz . . . . . . 38<br />
Münchens Maximum-Drehgestell-Triebwagen – Mit 550 Stück<br />
gab es in der bayerischen Metro pole hinter <strong>Berlin</strong> die meisten Maximum-Triebwagen.<br />
1898 gingen die ersten in Betrieb, die letztgebauten<br />
1930. Teil 1 widmet sich der Zeit bis zum Kriegsende 1945<br />
Von »Schüttelrutschen«<br />
und »Schaukelpferden« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46<br />
Tram-Raritäten der frühen 1980er-Jahren – In den 1950er- und<br />
1960er- Jahren waren in vielen westdeutschen Betrieben zwei- und<br />
vierachsige Fahrzeuge zu Gelenkwagen umgebaut worden. Andreas<br />
Mausolf stellt die letzten Einsätze dieser Fahrzeuge in Bielefeld,<br />
Mülheim, Duisburg, Wuppertal und Kassel vor<br />
TITEL<br />
TITEL<br />
Geschichte<br />
Anschluss unter neuer Nummer . . . . . . . . . . . . 54<br />
Die Zusammenführung von Bus und Straßenbahn in <strong>Berlin</strong><br />
<strong>nach</strong> 1990 – Nach 1990 waren die Verkehrsnetze in der zuvor mehr<br />
als 40 Jahre politisch geteilten Stadt zusammenzuführen. Dabei kam<br />
es 1991 und 1993 zu zwei tiefgreifenden Liniennetzreformen, aber<br />
auch Veränderungen im Wageneinsatz<br />
Elektrisch zum Rheinfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />
Der Tram- und Trolleybusbetrieb in Schaffhausen – Ab 1901<br />
verkehrten 65 Jahre lang Straßen bahnen in Schaffhausen. Seit 1966<br />
sichern Trolleybusse den Personennahverkehr in der Region am Rheinfall<br />
ab. Im Güterverkehr blieben die Tram-Gleise hingegen bis 1993 in<br />
Nutzung<br />
TITEL<br />
TITEL<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> im Modell<br />
Mit der Tram durchs Klostertor . . . . . . 74<br />
Schon lange bringt die Freiburger Straßenbahn Ausflügler in<br />
den hübschen Ort Günterstal, dessen Mitte Jürgen Jaeschke<br />
im Maßstab 1:87 und mit H0m-Gleisen <strong>nach</strong>empfunden hat.<br />
Titelmotiv<br />
Vor <strong>dem</strong> Friedrichstadt -<br />
palast in <strong>Berlin</strong> begegneten<br />
sich 1990 ein Tatra- und ein<br />
Rekozug. Mehr zur Situation<br />
damals ab Seite 54<br />
B. KUSSMAGK<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
5
Bild des Monats<br />
Bild des Monats<br />
In der österreichischen Hauptstadt Wien sind auch in den Abend- und<br />
Nachtstunden reizvolle Aufnahmen möglich. So fotografierte Christian Sacher<br />
am 12. Oktober 2012 den Tw 4010 vom Typ E 2<br />
auf der Fahrt von Gersthof<br />
zum Schottentor unterhalb der Stadtbahn-Station Währinger Straße.<br />
Die Wiener „Bim“ besitzt das fünftgrößte Straßenbahnnetz der Welt. Einen<br />
ausführlichen Bericht über die aktuelle Lage und die Zukunft der Straßenbahn<br />
in der Hauptstadt Österreichs inklusive eines detailierten Streckenplans<br />
finden Sie im neuen <strong>STRASSENBAHN</strong> JAHRBUCH 2013, das nun am Kiosk<br />
erhältlich ist. Der Sonderband informiert natürlich auch topaktuell über<br />
die Lage bei allen Deutschen Betrieben und den Straßenbahnen in ganz Europa!<br />
6<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Bild des Monats<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
7
Meldungen aus Deutschland,<br />
aus der Industrie und aus aller Welt<br />
Hamburg: Der Probeeinsatz des DT5 führte den neuen Fahrzeugtyp durch das gesamte U-Bahn-Netz. Am 13. November<br />
fährt der Zug über die eingleisige Betriebsstrecke von Schlump zur Christuskirche<br />
L. BRÜGGEMANN<br />
U-Bahn Hamburg: DT5 in Betrieb genommen und HafenCity-U-Bahn eingeweiht<br />
Neue Fahrzeuge, neue Strecke<br />
ONLINE-UMFRAGE<br />
Klares »Ja« zu Holzsitzen<br />
in modernen Bahnen<br />
Im <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12/<br />
2012 haben wir in der Rubrik „Einsteigen,<br />
bitte …“ die Problematik verunreinigter<br />
Sitze in Trams thematisiert. Neben der<br />
Frage der Hygiene stand dabei auch der<br />
Reinigungsaufwand im Mittelpunkt.<br />
Nach<strong>dem</strong> sich die Tram-Fahrgäste in Basel<br />
mehrheitlich dafür ausgesprochen haben,<br />
werden in der Metropole am Hochrhein<br />
<strong>dem</strong>nächst Flexity mit Holzsitzen in<br />
Dienst gestellt. Dies nahm die Redaktion<br />
zum Anlass, an die Leser die Frage zu stellen,<br />
wie sie über eine Wiedereinführung<br />
von Holzsitzen in Trams denken.<br />
Das Ergebnis der Umfrage war überraschend<br />
eindeutig: 96,8 Prozent aller Teilnehmer<br />
sind Sitzen aus Holz gegenüber<br />
aufgeschlossen. Sie haben scheinbar wie<br />
die Basler bereits mehrfach schlechte Erfahrungen<br />
mit der Sauberkeit von Stoffsitzen<br />
gemacht.<br />
Nur 1,1 Prozent der an der Umfrage<br />
teilnehmenden Leser sprachen sich klar<br />
und deutlich gegen Holzsitze aus. Für sie<br />
wäre es eine Zumutung, darauf Platz nehmen<br />
zu müssen.<br />
Der Satz der unschlüssigen Leser war<br />
mit 1,9 Prozent nur geringfügig höher. Sie<br />
zweifeln die Notwendigkeit von Holzbänken<br />
zwar nicht an, bezeichnen sie aber als<br />
nicht mehr zeitgemäß.<br />
AM<br />
Zum Ende ihres Jubiläums-Jahres<br />
konnte die Hamburger Hochbahn AG<br />
noch einmal zwei besondere Ereignisse<br />
feiern. Nach der Abnahme der neuen<br />
DT5-Züge durch die Technische Aufsichtsbehörde<br />
dürfen diese im Fahrgastverkehr<br />
eingesetzt werden. Nach<br />
einer Feierstunde am 7. November in<br />
der Hauptwerkstatt Barmbek mit anschließender<br />
Jungfernfahrt, kommen<br />
Hamburg: Mit<br />
geladenen<br />
Gästen verlässt<br />
der DT5 auf<br />
seiner ersten<br />
Fahrgastfahrt<br />
die Hallen der<br />
Hauptwerk -<br />
statt in Barm -<br />
bek J. PERBRANDT<br />
drei der bisher vorhandenen Züge zum<br />
Einsatz. Um die Zuverlässigkeit im rauen<br />
Alltagsbetrieb zu erproben, werden<br />
die Wagen zunächst im Verstärkungsverkehr<br />
eingesetzt. Die Hochbahn beabsichtigt<br />
insgesamt 67 Einheiten<br />
dieser Fahrzeugreihe zu beschaffen.<br />
Während die ersten Züge noch zur Verstärkung<br />
des vorhandenen Fahrzeugparks<br />
benötigt werden, sollen weitere<br />
Fahrzeuge die alten, noch im Einsatz<br />
befindlichen Triebwagen vom Typ DT3-<br />
LZB und DT3E ersetzen. Aufgrund der<br />
Fahrzeuglänge, die eine Bildung von<br />
90-Meter-Zügen erlaubt, wird der Einsatz-Schwerpunkt<br />
dieser Fahrzeuge<br />
auf der alten Ringlinie, der heutigen<br />
U3, liegen. Hier besitzen einige der<br />
100 Jahre alten Bahnhöfe nicht die bei<br />
der Hochbahn übliche Bahnsteignutzlänge<br />
von 120 m. Der wagenbauliche<br />
Teil der Züge wird bei Alstom in Salzgitter<br />
hergestellt, die elektrische Ausrüstung<br />
liefert Bombardier.<br />
Retro-Design<br />
Gemäß den Vorgaben der Hochbahn<br />
ist der Wagenkasten komplett aus<br />
Edelstahl gefertigt, dabei kommt ein<br />
neuartiges Leichtbaukonzept zum Einsatz.<br />
Dem Betrachter der neuesten<br />
Hamburger Fahrzeuggeneration mag<br />
8 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Deutschland<br />
Hamburg: Die Station Überseequartier ist für Fahrgäste vorerst der Endpunkt der neuen U4 – eine Station weiter<br />
zur HafenCity Universität fahren die Züge zum Wenden<br />
J. PERBRANDT<br />
zuerst die Ähnlichkeit mit den alten<br />
Fahrzeugen der Baureihen DT2 und<br />
DT3 auffallen. Die Hochbahn knüpft<br />
damit an das Erscheinungsbild der für<br />
Hamburg typischen U-Bahn-Züge an.<br />
Jedoch verspricht dieses „Hamburger<br />
Outfit“ nicht nur einen hohen Wiedererkennungswert<br />
sondern hat auch<br />
praktische Gründe. So lassen sich die<br />
in Edelstahl belassenen Flächen leichter<br />
reinigen und machen den Verzicht<br />
auf aufwendige Lackierungen möglich.<br />
HafenCity-U-Bahn eröffnet<br />
Als weiteres Highlight nahm die Hochbahn<br />
am 28. November ihre neue U-<br />
Bahn-Linie U4 in die HafenCity in Betrieb.<br />
Nach fünf Jahren Bauzeit steht<br />
damit die rund vier km lange Verbindung<br />
der Hamburger Öffentlichkeit zur<br />
Verfügung. Nach der Abnahme durch<br />
die Technische Aufsichtsbehörde am<br />
2. November fanden zunächst Probeund<br />
Schulungsfahrten ohne Fahrgäste<br />
statt. Ab <strong>dem</strong> 28. November konnten<br />
Fahrgäste die Strecke bereits im Zehn-<br />
Minuten-Takt bereisen und im Rahmen<br />
von so genannten Schnupperfahrten<br />
erkunden. Seit <strong>dem</strong> Fahrplanwechsel<br />
am 9. Dezember verkehrt die<br />
U-Bahn-Linie U4 fahrplanmäßig von<br />
Billstedt zur neuen Endhaltestelle HafenCity<br />
Universität. Dabei nutzt sie<br />
zwischen Billstedt und <strong>dem</strong> Jungfernstieg<br />
die Strecke der Linie U2, ab dort<br />
führt sie in den neuen Hamburger<br />
Stadtteil, der mit zwei Haltestellen erschlossen<br />
wird.<br />
Kompletteröffnung erst 2013<br />
Der Großteil der neuen Tunnelstrecke,<br />
immerhin fast 2,8 km, entstanden als<br />
Doppelröhre im Schildvortriebsverfahren.<br />
Der restliche Tunnelabschnitt wurde<br />
in offener Bauweise errichtet. Rund<br />
324 Mio. Euro kostete der aufwendige<br />
Bau der Strecke, die sowohl die Innenstadt,<br />
als auch einige Hafenbecken unterquert.<br />
Da jedoch die Bebauung der<br />
HafenCity noch nicht so weit fortgeschritten<br />
ist, entschieden sich die Verantwortlichen<br />
zunächst nur die Haltestelle<br />
Überseequartier für die Fahr -<br />
gäste zu eröffnen. Die Endhaltestelle<br />
HafenCity Universität dient zunächst<br />
nur <strong>dem</strong> Wenden der Züge. Am Wochenende<br />
zwischen 10 und 18 Uhr<br />
können Fahrgäste zwar an der Endstation<br />
aussteigen – aber nur um die Station<br />
zu besichtigen, denn der Übergang<br />
zur Oberfläche bleibt zunächst<br />
versperrt. Die Planungen für einen<br />
Weiterbau der Strecke sind bereits in<br />
vollem Gange: Zunächst ist eine Fortführung<br />
der Strecke bis an die Elbe angedacht,<br />
der langfristig auch eine Elbquerung<br />
folgen könnte.<br />
JEP<br />
Düsseldorf<br />
Umleitungen wegen<br />
Hochstraßenabriss<br />
Weil ab Februar 2013 der so genannte<br />
Tausendfüßler, eine markante<br />
Hochstraße über den Jan-Wellem-<br />
Platz, abgerissen werden soll und<br />
daher die darunter liegende Straßenbahntrasse<br />
in der Relation Steinstraße/Königsallee<br />
– Jan-Wellem-Platz –<br />
Sternstraße nicht befahrbar sein wird,<br />
müssen die dort verkehrenden Linien<br />
701 (Rath – Benrath), 706 (Am Steinberg<br />
– Jan-Wellem-Platz – Am Steinberg)<br />
und 715 (Unterrath – Eller) von<br />
Ende Februar bis voraussichtlich Mitte<br />
Juni 2013 umgeleitet werden.<br />
Die Linie 701 fährt ab der Halte -<br />
stelle Dreieck über Schloss Jägerhof,<br />
Jacobistraße, Jan-Wellem-Platz, Heinrich-Heine-Allee,<br />
Graf-Adolf-Platz und<br />
weiter über <strong>Berlin</strong>er Allee <strong>nach</strong> Holthausen/Benrath.<br />
Die Linien 706 und<br />
715 fahren ab Dreieck bzw. Marienhospital<br />
ebenfalls über die Haltestelle<br />
Jacobistraße zum Jan-Wellem-Platz,<br />
wo sie auf ihren angestammten Linienweg<br />
treffen.<br />
MKO<br />
Leizpig<br />
Tatra-Beiwagen vor<br />
<strong>dem</strong> Aus<br />
Auch in Leipzig geht die Ära der<br />
Tatra-Hochflur-Beiwagen zu Ende. Im<br />
Jahr 2012 sind bislang 16 der modernisierten<br />
B4D-M ausgemustert worden,<br />
zuletzt im Oktober die Wagen<br />
737, 738, 741, 742 und 758. Letzter<br />
einsatzbereiter Wagen der einst 45<br />
Wagen umfassenden Reihe war im<br />
November Bw 736, doch auch sein Ende<br />
steht kurz bevor. Es verbleiben au-<br />
Düsseldorf: Wieder einmal wird in der ersten Jahreshälfte 2013 die Linie<br />
706 vom Jan-Wellem-Platz kommend über Schloss Jägerhof Richtung<br />
Brehmplatz fahren<br />
M. KOCHEMS<br />
Cottbus<br />
Ab 2013 sollen in den Cottbuser<br />
Straßenbahnen die Ansagen<br />
zehn ausgewählter Haltestellen<br />
zweisprachig in Deutsch und<br />
Sorbisch erfolgen. Bei den zehn<br />
Ansagen handelt es sich um Haltestellen,<br />
in deren Nähe sich sorbische<br />
Einrichtungen befinden<br />
z. B. Altmarkt. Etwa 60.000 Sorben<br />
gibt es noch in der Lausitz.<br />
Die Beschilderung der Straßen<br />
und Orte ist im Gebiet der<br />
Sorben, darunter auch in der<br />
Stadt Cottbus, zweisprachig. Die<br />
Ansagen wurden am 17. September<br />
von sechs Schülerinnen<br />
des Niedersorbischen Gymnasiums<br />
Cottbus eingesprochen. SM<br />
Kassel<br />
Die Kasseler RegioTram wird<br />
von Dezember 2013 bis Dezember<br />
2023 von einem Konsortium<br />
aus Hessischer Landesbahn<br />
(HLB) und der Kasseler Verkehrsgesellschaft<br />
(KVG), unter deren<br />
Regie auch die Kasseler Straßenbahn<br />
fährt, betrieben. An der<br />
„RegioTram Betriebsgesellschaft“,<br />
die aktuell den Betrieb<br />
abwickelt, sind neben <strong>dem</strong><br />
Mehrheitseigner Deutsche Bahn<br />
auch die HLB und KVG beteiligt.<br />
Der Vertrag umfasst nur die Linien<br />
RT3, RT4 und RT5 – die Linie<br />
RT9 <strong>nach</strong> Treysa soll ab Dezember<br />
2014 wieder als Regionalbahn<br />
betrieben werden. PKR<br />
Köln<br />
Seit <strong>dem</strong> Fahrplanwechsel am<br />
9. Dezember wird die Haltestelle<br />
Rathaus als neue unterirdische<br />
Haltestelle der Stadtbahnlinie 5<br />
bedient. Aus Ossendorf kommend<br />
fahren die Bahnen der Linie<br />
5 neuerdings über Dom/Hbf<br />
zum Rathaus als vorläufige Endhaltestelle.<br />
Die Haltestellen Breslauer<br />
Platz/Hbf, Ebertplatz und<br />
die bisherige Endstelle Reichenspergerplatz<br />
werden nicht mehr<br />
von der Linie 5 angefahren. Mit<br />
der Inbetriebnahme des Linienabschnittes<br />
zwischen Dom/Hbf<br />
und Rathaus wurde der erste Abschnitt<br />
der Nord-Süd-Stadtbahn<br />
eröffnet.<br />
SM<br />
rz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
9
Aktuell<br />
Hagen: Tw 337 war am 3. November<br />
anlässlich einer Buchvorstellung zu<br />
Besuch vor <strong>dem</strong> alten Bahnhofsgebäude<br />
in Breckerfeld R. HAFKE<br />
Eine GT6N-Doppeltraktion zwängt sich am 20. November durch die Neue Schönhauser Straße<br />
<strong>Berlin</strong><br />
Planverkehr auf Betriebsstrecken<br />
ßer<strong>dem</strong> noch vier der in den Jahren<br />
2002-2004 aus Hochflurwagen umgebauten<br />
B4D-NF mit abgesenktem,<br />
mittlerem Niederflureinstieg im Einsatz<br />
(Nr. 792, 795, 797 und 798), die<br />
anderen vier dieser Serie sind ebenfalls<br />
bereits ausgemustert. Langfristig<br />
werden in Leipzig als Beiwagen nur<br />
Gleich drei Betriebsstrecken – zwei<br />
kurze Gleisverbindungen im Bereich<br />
des Alexanderplatzes und die Strecke<br />
durch die Neue und Alte Schönhauser<br />
Straße im Scheunenviertel – wurden<br />
Ende November von planmäßigen<br />
Straßenbahnzügen befahren.<br />
Wegen Bauarbeiten im Bereich<br />
Alexanderplatz wurde die Linie M6<br />
am 19. und 20. November 2012 von<br />
der Mollstraße her kommend über<br />
die Torstraße und die Betriebsstrecke<br />
durch die Alte und Neue Schönhauser<br />
Straße, die in etwa zwischen den<br />
Tramhaltestellen Rosa-Luxemburg-<br />
Platz und Hackescher Markt verläuft,<br />
umgeleitet. Die jahrzehntelang stark<br />
frequentierte Straßenbahnstrecke<br />
durch die Neue und die Alte Schönhauser<br />
Straße im Scheunenviertel in<br />
<strong>Berlin</strong>-Mitte hatte mit der Wiedereröffnung<br />
der Straßenbahn über den Alexanderplatz<br />
viel Verkehr verloren. Seit<br />
auch die Linie M2 über die Neubaustrecke<br />
„Alex II“ zum Alexanderplatz<br />
fährt, wurde die Strecke am 30. Mai<br />
2007 zur Betriebsstrecke herabgestuft.<br />
Als Besonderheit müssen die Trams in<br />
beiden Richtungen durch die als Einbahnstraße<br />
ausgeschilderte Neue<br />
Schönhauser Straße fahren.<br />
Neue Wege am »Alex«<br />
Ebenfalls am 19. und 20. November<br />
wurden die Linien M4 und M5 vom<br />
Hackeschen Markt bis zum Alexanderplatz<br />
zurückgezogen und wendeten<br />
dort unter Nutzung des Betriebsgleises<br />
noch die 2001 beschafften, vollständig<br />
niederflurigen Bw 901-938 eingesetzt.<br />
Sie kommen bislang in der Regel hinter<br />
hochflurigen Tatra T4D-M (Einzeloder<br />
Doppeltraktions-)Triebwagen<br />
zum Einsatz, deren vollständiger Ersatz<br />
erst in mehreren Jahren vorgesehen<br />
ist.<br />
BUD<br />
B. KUSSMAGK<br />
von der Haltestelle U-Bahnhof Alexanderplatz<br />
der Linien M4, M5 und<br />
M6 zur 2007 eröffneten Haltestelle<br />
Alexanderplatz der Linie M2.<br />
Vom 21. November bis zum 30.<br />
November wurden die Linien M4, M5<br />
und M6 zwar wieder zum Hackeschen<br />
Markt geführt, mussten aber anderweitig<br />
umgeleitet werden. Hierbei<br />
befuhren sie eine kurze Betriebsstrecke<br />
entlang der Karl-Liebknecht-Straße<br />
im Bereich der S-Bahn-Unterführung<br />
am Alexanderplatz, mit der die<br />
Strecke der Linie M2 aus Heinersdorf<br />
und die Strecke der Linien M4, M5<br />
und M6 zum Hackeschen Markt direkt<br />
– also ohne Bedienung einer Haltestelle<br />
am Alexanderplatz – verbunden<br />
werden.<br />
BEKUS<br />
Leipzig: Die hochflurigen B4D-M Beiwagen – hier als letztes Glied in einem Tatra-Großzug – werden in Leipzig<br />
bald der Vergangenheit angehören<br />
K. BIESEL<br />
Hagen<br />
Straßenbahnwagen in<br />
Breckerfeld<br />
Bis zum 2. November 1963 verkehrte<br />
zwischen Hagen und Breckerfeld die<br />
Straßenbahnlinie 11. 49 Jahre später<br />
kam am 3. November 2012 der heute<br />
bei den Bergischen Museumsbahnen<br />
im Einsatz stehende zweiachsige<br />
Triebwagen 337 zu einem Besuch an<br />
den Streckenendpunkt. Das Bahnhofsgebäude<br />
der kleinen Hansestadt im<br />
Märkischen Kreis zeigt sich noch heute<br />
weitgehend im Originalzustand. Anlass<br />
für den Besuch, bei <strong>dem</strong> der 1957<br />
bei der Düsseldorfer Waggonfabrik gebaute<br />
Zweiachser mit einem Straßentieflader<br />
vom Museumsdepot in Kohlfurth<br />
auf fast 400 m Höhe gebracht<br />
wurde, war die Vorstellung eines Buches<br />
über die Linie 11. Ein Schwerlastkran<br />
hob das Fahrzeug samt eines kurzen<br />
Gleisstücks auf den Bahnhofsplatz<br />
und <strong>nach</strong> einigen Stunden wieder zurück<br />
auf den Tieflader. Die modern ausgestatteten<br />
Zweiachser der Hagener<br />
Straßenbahn fuhren in den 1950er-<br />
Jahren auch auf die Höhen des Mär -<br />
kischen Kreises, ehe sie bis zur Ein -<br />
stellung des Schienenverkehrs von<br />
vierachsigen Großraum- und sechsachsigen<br />
Gelenktriebwagen abgelöst<br />
wurden. Zweiachsige Beiwagen kamen<br />
zusammen mit diesen bis 1963<br />
<strong>nach</strong> Breckerfeld.<br />
AR<br />
Stuttgart<br />
Baurecht für U12<br />
ins Neckartal<br />
Seit <strong>dem</strong> 7. November liegt für die<br />
1,1 km lange Stadtbahnstrecke vom<br />
Hallschlag ins Neckartal zur Aubrücke<br />
(zwischen den Haltestellen Elbestraße<br />
und Wagrainäcker gelegen) der Planfeststellungsbeschluss<br />
und damit Baurecht<br />
vor – der Baubeginn soll Anfang<br />
2013 stattfinden. Die Strecke schließt<br />
am Hallschlag an die Strecke vom Löwentor<br />
zum Hallschlag, die erst im<br />
September 2013 eröffnet wird, an. Im<br />
Neckartal wird die neue Schiene<strong>nach</strong>se<br />
auf die Gleise der U14 in Richtung<br />
Remseck treffen. Eine neue Station<br />
Bottroper Straße, die in Tieflage aber<br />
<strong>nach</strong> oben offen entstehen soll, wird<br />
als einzige Zwischenstation den Ost-<br />
10 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Deutschland<br />
teil der Siedlung Hallschlag erschließen.<br />
Nach einem kurzen oberirdischen<br />
Abschnitt wird die neue Strecke in einem<br />
Tunnel, der aufgrund des zu starken<br />
Gefälles des Oberflächenniveaus<br />
notwendig ist, vom Hallschlag hinunter<br />
zum Neckar führen.<br />
Bedient werden soll die neue Strecke<br />
ab 2016 von der U12, der bis dahin<br />
auch im Süden (Wallgraben – Dürrlewang)<br />
und nördlich des Stadtzentrums<br />
(Hauptbahnhof – Budapester Platz –<br />
Milchhof) Neubaustrecken zur Verfügung<br />
stehen werden. Künftig wird die<br />
U12 von Dürrlewang im Südwesten<br />
<strong>nach</strong> Remseck im Nordosten fahren. PKR<br />
Frankfurt am Main<br />
Aus für U2-Tw auf<br />
A-Strecke<br />
Seit <strong>dem</strong> 5. November sind die<br />
Planeinsätze der U2-Tw auf der A-Strecke,<br />
der ersten U-Bahn-Stammstrecke<br />
in Frankfurt, Geschichte. Die U-Bahn-<br />
Wagen des Typ U2 gehörten zur Erstausstattung<br />
der Frankfurter U-Bahn.<br />
Zwischen 1968 und 1978 geliefert, trugen<br />
sie lange die Hauptlast des Verkehrs<br />
auf der A-Strecke von Ginnheim/Oberursel/Bad<br />
Homburg und<br />
Heddernheim zum Südbahnhof, den<br />
heutigen Linien U1, U2 und U3. Neu<br />
abgelieferte Wagen der U5-Typen nehmen<br />
ihnen ihr Einsatzgebiet. Die 97<br />
U2-Wagen wurden im Lauf der Jahre<br />
zu zwei verschiedenen Untertypen<br />
Esslingen: Bei einem Schrotthändler in Deckenpfronn endete im Oktober 2012 der Lebenslauf des Beiwagens 31<br />
der einstigen Überlandstraßenbahn END<br />
M. LUTZ<br />
umgebaut: U2h für die 80 cm hohen<br />
Bahnsteige der A-Strecken und U2e für<br />
die 87 cm hohen der B- und C-Strecken.<br />
Aus <strong>dem</strong> Liniennetz haben sich<br />
aktuell aber nur die U2h-Wagen verabschiedet;<br />
auf der C-Strecke werden<br />
die U2e noch mindestens bis Ende<br />
2013 im Einsatz bleiben. Die beiden<br />
ersten Serienwagen, 303 und 304,<br />
werden als historische Fahrzeuge in<br />
Frankfurt erhalten bleiben. Im Gegensatz<br />
zu den anderen Wagen, die in<br />
Orange und Subaru-Vista-Blue unterwegs<br />
sind, tragen diese beiden wieder<br />
die rot-weiße Originallackierung. JÖS<br />
Esslingen<br />
Alte END-Fahrzeuge<br />
verschrottet<br />
Der Beiwagen 31 der einstigen<br />
Straßenbahn Esslingen – Nellingen –<br />
Denkendorf (END) wurde im Oktober<br />
2012 verschrottet. Seit <strong>dem</strong> Ende des<br />
Schienenverkehrs bei der END anno<br />
1978 hatte der Veteran beim Dressurplatz<br />
des Reit- und Fahrvereins Gärtringen<br />
bei Böblingen als Aufenthaltsraum<br />
gedient. Inzwischen war der<br />
Wagen stark verrottet. In der Straßenbahnwelt<br />
Stuttgart werden bereits<br />
zwei gleichartige Wagen museal präsentiert.<br />
Ebenso hat das Landesmuseum<br />
für Technik und Arbeit in Mannheim<br />
einen solchen Wagen im Fundus.<br />
Auch die Stadt Esslingen winkte<br />
ab. Deshalb nahm sich ein Schrotthändler<br />
des Gefährtes an. Ein Radsatz<br />
wird künftig auf der Schauanlage des<br />
Heimatgeschichtsvereins Nagold zu<br />
sehen sein, die dort an die Schmalspurbahn<br />
<strong>nach</strong> Altensteig erinnert.<br />
Ebenfalls 2012 wurde im Hannoverschen<br />
Straßenbahnmuseum der Triebwagen<br />
8 der END wegen des schlechten<br />
Zustandes verschrottet, <strong>nach</strong><strong>dem</strong><br />
er seit rund 30 Jahren dort gestanden<br />
hatte. Schon vor etlichen Jahren traf<br />
dies aus <strong>dem</strong> gleichen Grund den<br />
Triebwagen 6, der an das Fahrzeugmuseum<br />
Marxzell gelangt war. Als Bilanz<br />
zeigt sich die nicht neue Erkenntnis,<br />
dass Straßenbahn- oder Eisenbahnfahrzeuge<br />
nicht erhalten werden<br />
können, wenn sie auf Dauer im Freien<br />
stehen.<br />
HJK/RBÜ<br />
Erfurt<br />
Innenstadtstrecke vor<br />
Vollsperrung<br />
Rund acht Monate muss Erfurts bedeutendste<br />
Innenstadtstrecke vom<br />
Domplatz zum Anger im nächsten Jahr<br />
für den Straßenbahnbetrieb komplett<br />
gesperrt werden. Grund ist die zu sanierende<br />
Schlösserbrücke über den<br />
querenden Fluss Gera. Zeitgleich sollen<br />
der Fischmarkt und die Straßenbahngleise<br />
umfangreich saniert werden.<br />
Gegenüber den ursprünglichen<br />
Planungen, diesen Streckenabschnitt<br />
unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen<br />
Straßenbahnbetriebes bereits<br />
2012 zu sanieren, wird die Komplettsperrung<br />
schwerwiegendere Auswirkungen<br />
für das Erfurter Straßenbahnnetz<br />
haben.<br />
Stuttgart: Die vorläufige Planung der Haltestelle Bottroper Straße, die als<br />
einzige auf <strong>dem</strong> jetzt planfestgestellten Abschnitt Hallschlag – Aubrücke<br />
neu entstehen soll<br />
SSB<br />
Frankfurt am Main: Am 5. November wurden die U2-Triebwagen von der<br />
A-Strecke zurückgezogen – das Bild von 1992 zeigt einen Drei-Wagen-Zug<br />
auf der U2<br />
J. SCHRAMM<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
11
Aktuell<br />
ANZEIGE<br />
Erfurt: Der Combino 623 befährt die Erfurter Schlösserbrücke, die im Jahr 2013 für acht Monate nicht von<br />
Straßenbahnen befahren werden kann<br />
R. GLEMBOTZKY<br />
In Vorbereitung der Verkehrsplanung<br />
und eines angepassten Liniennetzes<br />
führten die Erfurter Verkehrsbetriebe eine<br />
Fahrgastbefragung durch, an der<br />
sich 1.341 Bürger beteiligt haben. Dabei<br />
standen ausgewählte Umleitungsrouten<br />
und die Überbrückung des gesperrten<br />
Abschnittes per Fußweg zur<br />
Wahl. Die Gesamtreisezeit wird sich, je<br />
<strong>nach</strong> gewählter Alternativroute, bei einer<br />
momentanen Reisezeit von vier Minuten<br />
auf zwischen zehn und ca. 22 Minuten<br />
verlängern. Ein adäquater Schienenersatzverkehr<br />
wird dagegen nicht<br />
realisiert werden, lediglich in einer Art<br />
Ringverkehr zwischen Anger und Domplatz<br />
sollen Ersatzbusse in eine Richtung<br />
angeboten werden. Für zahlreiche<br />
Fahrgäste aus <strong>dem</strong> Bereich Nordhäuser<br />
Straße und Universität mit <strong>dem</strong> Ziel<br />
Hauptbahnhof und darüber hinaus wird<br />
somit ein mehrfaches Umsteigen mit<br />
erheblichen Umwegen über acht Monate<br />
erforderlich.<br />
ROG<br />
Bielefeld<br />
Neue Strecken kommen<br />
voran<br />
In Bielefeld wird derzeit konkret an<br />
sechs Stadtbahnerweiterungen geplant.<br />
Die größten Projekte dabei sind<br />
die Verlängerung der Linie 1 von Senne<br />
<strong>nach</strong> Sennestadt und der Neubau einer<br />
in der Innenstadt oberirdisch fahrenden<br />
Linie 5 <strong>nach</strong> Heepen. Nach<strong>dem</strong> das<br />
Land Nordrhein-Westfalen im Herbst<br />
für beide Projekte die Aufnahme in das<br />
Zwickau<br />
Konzept für künftiges Tramnetz vorgestellt<br />
Am 6. November stellten Vertreter<br />
von Stadt, Verkehrsverbund Mittelsachsen<br />
und <strong>dem</strong> beauftragten<br />
Ingenieurbüro Pläne für die künftige<br />
Entwicklung des ÖPNV in Zwickau<br />
vor. Im Mittelpunkt stand dabei<br />
das Straßenbahnnetz, für das verschiedene<br />
Varianten für eine künftige<br />
Entwicklung untersucht wurden.<br />
Sowohl hinsichtlich der erwarteten<br />
Fahrgastzahlen als auch der Betriebskosten<br />
schnitt eine Variante<br />
am besten ab, in der das Straßenbahnnetz<br />
auf ein klares Achsenkreuz<br />
aus zwei Linien, die sich am<br />
Neumarkt kreuzen, reduziert wird.<br />
Dazu müssten die beiden Linienäste<br />
zum Hauptbahnhof und zum Städtischen<br />
Klinikum quasi zusammengelegt<br />
werden, was durch eine etwa<br />
500 m lange Neubaustrecke vom<br />
Hauptbahnhof zur Haltestelle Kopernikusstraße<br />
realisiert werden<br />
soll. Die einen Kilometer lange Strecke<br />
zwischen Georgenplatz und Kopernikusstraße<br />
mit der Haltestelle<br />
Als ein aus zwei Linien bestehendes Achsenkreuz könnte sich das Zwickauer Netz künftig darstellen STADT ZWICKAU<br />
Brunnenstraße würde dann stillgelegt.<br />
Der Vorteil dieser Variante wäre,<br />
dass keine Parallelverkehre verschiedener<br />
Straßenbahnlinien notwendig<br />
wären und der Hauptbahnhof besser<br />
ins Netz eingebunden wäre. Zu<strong>dem</strong><br />
sollen die wichtigen Umsteigeknoten<br />
auf die Stationen Hauptbahnhof und<br />
Neumarkt konzentriert und die Haltestelle<br />
Zentralhaltestelle weitestgehend<br />
von dieser Funktion entlastet<br />
werden. Die Stationen Neumarkt und<br />
Hauptbahnhof sollen zu<strong>dem</strong> umgestaltet<br />
werden. Dem Hauptbahnhof<br />
wird künftig auch deshalb eine wichtigere<br />
Rolle zugesprochen, da er im<br />
Dezember 2013 mit der Inbetriebnahme<br />
des Leipziger City-S-Bahn-<br />
Tunnels zur Station der Mitteldeutschen<br />
S-Bahn wird, womit deutliche<br />
Fahrgastzuwächse erwartet werden.<br />
Am 13. Dezember stand das<br />
Konzept auch auf der Agenda des<br />
Stadtrates.<br />
PKR<br />
12 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Deutschland · Industrie<br />
Ein Bielefelder E-Wagen passiert die Industriebrücke der ehemaligen Dürkopp-Werke.<br />
Eine kurze Neubaustrecke soll auch das Entwicklungsgebiet<br />
Dürkopp Tor 6 erschließen<br />
P. KRAMMER<br />
Bundesförderprogramm GVFG beantragt<br />
hatte, wurden nun beide Projekte<br />
im entsprechenden Bundesprogramm<br />
aufgenommen. Bis Mitte 2013 muss die<br />
Planung der beiden Linien – insbesondere<br />
die Frage ob auf der Linie 5 Hochoder<br />
Niederflurfahrzeuge eingesetzt<br />
werden sollen – weiter konkretisiert<br />
und eine standardisierte Bewertung<br />
zum Nachweis der volkswirtschaftlichen<br />
Sinnhaftigkeit erstellt werden.<br />
Vor einer kurzfristigeren Realisierung<br />
steht die Verlängerung der Stadtbahn<br />
von Milse <strong>nach</strong> Milse Ost, bei der<br />
der Planfeststellungsbeschluss für Anfang<br />
2013 und der Baubeginn Mitte<br />
2013 erwartet wird. Darüber hinaus<br />
wird für die kurze, bei Anwohnern umstrittenen<br />
Neubaustrecke von der Haltestelle<br />
August-Schroeder-Straße <strong>nach</strong><br />
Dürrkopp Tor 6 2013 mit der Einleitung<br />
des Planfeststellungsverfahrens gerechnet.<br />
Für die anvisierte Verlängerung<br />
von Stieghorst Zentrum <strong>nach</strong> Hillegossen<br />
ist selbiges für ein Jahr später<br />
geplant. Weiter ist man da bei der Verlängerung<br />
der Linie 4 zum Campus<br />
Lange Lage, wo schon 2014 gebaut<br />
werden soll.<br />
PKR<br />
Der Bau der Tw 3000 für die Stadtbahn<br />
Hannover steht unmittelbar bevor.<br />
Erste Probeschweißarbeiten wurden<br />
bereits durchgeführt. Die Unter -<br />
lieferanten sind ausgewählt und<br />
beauftragt. Das Gebäude der Fertigungshalle<br />
in Leipzig ist errichtet und<br />
wird momentan ausgestattet. Im ersten<br />
Quartal 2013 beginnen dann die<br />
Rohbauarbeiten am Wagenkasten. Ein<br />
erstes Fahrzeug wird voraussichtlich<br />
Ende 2013 geliefert. Der erste Fahrgasteinsatz<br />
ist für Anfang 2014 geplant.<br />
Seit der Präsentation des originalgroßen<br />
Modells im Maßstab 1:1 im<br />
Januar 2012 wurden einige Optimierungen<br />
vorgenommen. So wurde zum<br />
Beispiel ein „Auffindeton“ für Seheingeschränkte<br />
eingebaut, der es blinden<br />
Fahrgästen ermöglicht, die Tür und<br />
den Türknopf einfacher zu finden. Wie<br />
der neue Tw 3000 für die Stadtbahn<br />
Hannover genau aussieht, veranschaulicht<br />
erstmalig ein originalgetreues<br />
Modell im Maßstab 1:20.<br />
Vossloh<br />
Kiepe/Alstom:<br />
Das endgültige<br />
Design des<br />
Tw 3000 für<br />
Hannover<br />
wurde fest -<br />
gelegt und in<br />
einem 1:20-<br />
Modell ver -<br />
anschaulicht<br />
ÜSTRA<br />
Im April hatte das hannoversche<br />
Verkehrsunternehmen üstra einen Vertrag<br />
über die Lieferung von 50 25 m<br />
langen und 2,65 m breiten Tw 3000<br />
mit Alstom und Vossloh Kiepe geschlossen.<br />
Der Vertrag sieht eine Option<br />
auf 96 weitere Fahrzeuge des gleichen<br />
Typs vor.<br />
SM<br />
Doppelmayr<br />
Seilbahnprojekte für<br />
Koblenz und Hamburg<br />
Die zur Bundesgartenschau 2011<br />
erbaute Koblenzer Seilbahn vom Deutschen<br />
Eck zur Festung Ehrenbreitstein<br />
soll <strong>nach</strong> <strong>dem</strong> Willen des Koblenzer<br />
Oberbürgermeisters Joachim Hofmann-Göttig<br />
bis mindestens bis 2015<br />
fahren. Ursprünglich war ein Betrieb<br />
nur für das Gartenschau-Jahr vorgesehen,<br />
der bereits bis 2013 verlängert<br />
worden ist. Da die Bahn aber auch<br />
<strong>nach</strong> der Großveranstaltung von der<br />
Firma Doppelmayr eigenwirtschaftlich<br />
betrieben werden kann und <strong>nach</strong> wie<br />
vor merklich zur Attraktivität der Stadt<br />
beiträgt, soll sie weiter bestehen bleiben.<br />
Die dafür notwendige Genehmigung<br />
ist allerdings noch nicht eingeholt.<br />
Auch <strong>nach</strong> 2015 scheint ein Weiterbetrieb<br />
denkbar. Nach etwa 25<br />
Jahren Betriebszeit müsste die Bahn<br />
aber spätestens abgebaut werden, da<br />
dann die technische Lebensdauer erreicht<br />
ist.<br />
Auch für Hamburg plant Doppelmayr<br />
gemeinsam mit <strong>dem</strong> Musical-Betreiber<br />
Stage Entertainment eine Seilbahn.<br />
Sie soll vom U-Bahnhof St. Pauli<br />
über die Elbe zur Station Elbufer führen.<br />
Sie soll mindestens zehn Jahre betrieben<br />
werden. Die „Seilbahn Hamburg“<br />
würde einerseits eine Touristenattraktion,<br />
andererseits aber auch eine<br />
Ergänzung des ÖPNV-Netzes darstellen.<br />
PKR<br />
JushMash<br />
Neuer Wagentyp K1M<br />
in Betrieb<br />
Seit 2001 baut die Maschinenfabrik<br />
„JushMash“ in Dnipropetrowsk Standard-Vierachser<br />
mit der Typenbezeichnung<br />
K1 für den heimischen Markt.<br />
Der Typ stellt eine Weiterentwicklung<br />
des CKD-Typs T6B5 dar, den<br />
„JushMash“ ab 1994 im Rahmen eines<br />
Joint Ventures unter der Bezeichnung<br />
„Tatra-Jug“ baute. Wegen der<br />
schlechten wirtschaftlichen Lage bei<br />
den ukrainischen Straßenbahnbetrieben<br />
konnten bis 2011 nur 74 K1 gebaut<br />
werden, die in Donezk (28), Kiew<br />
(9), Krywyh Rih (7), Luhansk (5), Mariupol<br />
(7), Mykolajiw (7), Odessa (10)<br />
und Saporischja (1) zum Einsatz kommen.<br />
Nunmehr gibt es diesen Typ unter<br />
der Bezeichnung K1M auch mit einem<br />
Niederfluranteil im Bereich des<br />
mittleren Einstiegs. Kiew nahm im ver-<br />
Industrie<br />
Vossloh Kiepe/Alstom<br />
Tw 3000 geht in Bau<br />
Doppelmayr: Eigentlich als Verkehrsmittel für die Bundesgartenschau geplant, könnte die Koblenzer Seilbahn bis<br />
etwa 2025 den ÖPNV in der Rheinstadt ergänzen<br />
P. KRAMMER<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
13
Aktuell<br />
JushMash: Als „K1M“ weist der vordere Wagen des Gespanns K1M 342 + K1 327, hier im Einsatz auf der Schnellstraßenbahnlinie<br />
3 in Kiew, einen Niederfluranteil auf<br />
W. KAISER<br />
gangenen Sommer drei derartige<br />
Exemplare (Nr. 341–343) in Betrieb,<br />
die sich von der Standardversion äußerlich<br />
nur durch die in Wagenmitte<br />
weiter herabgezogenen Fenster unterscheiden.<br />
Die K1M kommen – jeweils<br />
in Doppeltraktion mit einem K1 – auf<br />
den kürzlich sanierten Schnellstraßenbahnlinien<br />
1 und 3 im Westen der<br />
Stadt zum Einsatz.<br />
WOK<br />
Weltweit<br />
Frankreich: Rouen<br />
Austausch der<br />
Niederflurflotte<br />
Alstom liefert derzeit 27 neue Straßenbahnzüge<br />
vom Typ Citadis 402<br />
<strong>nach</strong> Rouen. Sie ersetzen seit Juli 2012<br />
<strong>nach</strong> und <strong>nach</strong> die 28 TFS-Niederflur-<br />
Züge, die seit 1994 in Betrieb sind. Die<br />
neuen Citadis 402 für Rouen sind<br />
leichter und haben einen geringeren<br />
Energieverbrauch als die alten TFS. Mit<br />
einer Kapazität von 300 Fahrgästen<br />
pro 44-Meter-Zug wird auch die Kapazität<br />
auf den zwei Straßenbahnlinien<br />
um 60 Prozent vergrößert. An den Beschaffungskosten<br />
von 80 Mio. Euro beteiligt<br />
sich die Region Haute-Normandie<br />
mit 14,4 Mio. Euro. Neben der<br />
Fuhrparkerneuerung wurde auch in<br />
die Erneuerung der Gleisanlagen und<br />
die Modernisierung eines wichtigen<br />
Umsteigeknotens, Saint-Sever, investiert.<br />
Die 28 TFS-Züge sollen für 5,2 Mio.<br />
Euro <strong>nach</strong> Gaziantep in der Türkei verkauft<br />
werden. Ursprünglich war Grenoble,<br />
wo schon viele TFS-Züge laufen,<br />
für den Ankauf der Wagen ein ernsthafter<br />
Interessent. Gaziantep hatte im<br />
Jahr 2011 mit ex-Frankfurter Pt-Wagen<br />
einen Straßenbahnbetrieb eröffnet,<br />
der trotz des inzwischen erneut erfolgten<br />
Ankaufs von Pt-Wagen überlastet<br />
ist und künftig erweitert werden<br />
soll.<br />
VLC/BEKUS<br />
Estland: Tallinn<br />
Neufahrzeuge und<br />
Nulltarif<br />
Der spanische Hersteller CAF gewann<br />
die Ausschreibung der Nahverkehrsgesellschaft<br />
„Tallinna Linnatranspordi<br />
AS“ (TL) über die Lieferung<br />
von 15 Niederflur-Triebwagen inklusive<br />
einer Option auf 15 weitere Exemplare.<br />
Die klimatisierten, 2,3 m breiten<br />
und rund 30 m langen Niederflurtrams<br />
werden bis 2015 in die estnische<br />
Hauptstadt Tallinn geliefert und<br />
auf der Linie 4 (Tondi – Ülemiste) zum<br />
Einsatz kommen. Gegenwärtig besteht<br />
der Fuhrpark aus Tatra KT4SU,<br />
gebraucht übernommenen KT4D und<br />
12 mit einem Niederflur-Mittelteil<br />
ausgestattete KT6T. Der Auftrag hat<br />
einen Wert von 44,25 Mio. Euro. Ungewöhnlich<br />
erscheint die Finanzierung,<br />
die aus <strong>dem</strong> Verkauf von estnischen<br />
CO 2 -Emissionszertifikaten im<br />
Wert von 45 Mio. EUR an Spanien zustande<br />
kommt. Zusätzlich wird mit<br />
Mitteln aus <strong>dem</strong> EU-Kohäsionsfonds<br />
die Infrastruktur der Linie 4 für die<br />
neuen Fahrzeuge ertüchtigt.<br />
Auch führt Tallinn als erste Großstadt<br />
zum 1. Januar 2013 den Null -<br />
tarif im städtischen ÖPNV ein. Vorausgegangen<br />
war ein kommunales<br />
Referendum, das mit einer Wahlbeteiligung<br />
von 20 % und einer Zustimmung<br />
für den Nulltarif von 76 % endete.<br />
ROS/PKR<br />
Schweiz: Bern<br />
Tram erreicht den<br />
Bahnhof Wankdorf<br />
Am 9. Dezember wurde mit der Verlängerung<br />
der Tramlinie 9 der fahrplanmäßige<br />
Betrieb auf der Tramstrecke<br />
von der bisherigen Endstelle Guisanplatz<br />
zum Bahnhof Wankdorf<br />
aufgenommen. An der Strecke liegen<br />
die neuen Haltestellen Wankdorf Center<br />
(Fussballstadion der Young Boys<br />
Bern), Wankdorfplatz und Wankdorf<br />
Bahnhof. An letzterem bestehen gute<br />
Umsteigeverbindungen auf die S-<br />
Bahnlinien S1, S2, S3/31 und S4/44 sowie<br />
auf die Buslinien 20 in Richtung<br />
Bern Hauptbahnhof sowie 28 zum Eigerplatz.<br />
Die Strecke wird im Sechs-<br />
Minutentakt befahren. Mit <strong>dem</strong> Umbau<br />
der chronisch überlasteten Straßenkreuzung<br />
am Wankdorfplatz durch<br />
einen unterirdischen Straßenkreisel<br />
wurde die Voraussetzung für den Tramausbau<br />
geschafft.<br />
AS<br />
Tschechien: Olomouc<br />
Neue Straßenbahn -<br />
strecke geplant<br />
Die Straßenbahn der tschechi -<br />
schen Stadt Olomouc (Olmütz) mit ihren<br />
fünf Linien 1, 2, 4, 6 und 7 erweitert<br />
ihr Streckennetz. Derzeit existiert<br />
eine große eiförmige Strecke, die die<br />
Innenstadt und das östlich angrenzende<br />
Stadtgebiet bis hin zum Hauptbahnhof<br />
umschließt. Von dieser zweigen<br />
drei Strecken ab. Eine vierte, die<br />
südlich der Innenstadt nahe der Haltestelle<br />
Trznice abgehen wird und mit<br />
einem Gleisdreieck an die bestehende<br />
Strecke an der Polská angeschlossen<br />
werden kann, soll folgen. Bis 2014 ist<br />
zunächst eine 1,4 km lange Neubaustrecke<br />
mit drei Haltestellen bis Trnkova<br />
vorgesehen. Ein zweiter Bauabschnitt<br />
mit 1300 m Länge soll anschließend<br />
bis Družební führen. Der<br />
endgültige Ausbau sieht sogar noch<br />
Rouen: Ein neuer Citadis 403 (rechts) neben zwei TFS-Zügen an der um ein<br />
zusätzliches Gleis erweiterten Endstelle Technopôle<br />
F. DROISY<br />
Bern: Als erstes Tram erreicht Siemens Combino 662 am 23. Oktober im Rahmen<br />
einer Probefahrt die neue Endstelle am Bahnhof Wankdorf A. SCHMUTZ<br />
14 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Weltweit<br />
Olomouc: Etwa 550 m östlich dieser Kreuzung (Haltestelle Okresní soud)<br />
soll eine Neubaustrecke von der Bestandsstrecke abzweigen B. KUSSMAGK<br />
La Coruña: Die seit 2011 eingestellte Touristenstraßenbahn soll saniert<br />
werden und bereits im Sommer 2013 wieder fahren<br />
D. BUDACH<br />
eine dritte Verlängerung dieser Strecke<br />
<strong>nach</strong> Jižní vor. Erschlossen werden<br />
Gebiete mit vielen Neubauten. BEKUS<br />
Schweden: Stockholm<br />
Linie 7 wird verlängert<br />
Stockholms neue Tramlinie 7, die<br />
in ihrem ersten Betriebsjahr 2011 einen<br />
Fahrgastzuwachs von über 20 %<br />
gegenüber <strong>dem</strong> früheren Busverkehr<br />
verzeichnete, soll wegen ihres großen<br />
Erfolges verlängert werden.<br />
Konkret ist vorgesehen, die aktuell<br />
drei km lange Linie einerseits an den<br />
Hauptbahnhof anzubinden und andererseits<br />
von der Djurgarden-Brücke<br />
durch das östliche Hafengebiet <strong>nach</strong><br />
Ropsten zu verlängern. Dort soll die<br />
Linie mit der südlichen Lidingöbahn<br />
verknüpft werden. Die Lidingöbahn<br />
wird deshalb ab Sommer 2013 für anderthalb<br />
Jahre eingestellt. Sie erhält<br />
u.a. mehr Doppelgleis und ein neues<br />
Depot.<br />
Während des Sommers 2012 wurde<br />
auf der Linie 7 der aus Norrköping ausgeliehene<br />
Triebwagen 34 zusätzlich<br />
eingesetzt, wodurch ein Sechs-Minutentakt<br />
möglich war. Um das Fahrplanangebot<br />
zu ergänzen, verkehrten von<br />
Juni bis August täglich Museumswagen<br />
als Linie 7N auf <strong>dem</strong> Streckenabschnitt<br />
Normalmstorg – Skansen. Auch<br />
darüber hinaus stehen Museumswagen<br />
auf diesem Abschnitt im Einsatz –<br />
von April bis Mai und von September<br />
bis Dezember allerdings nur an Wochenenden.<br />
D. E. GÖRANSSON<br />
trieb gesetzt. Die Gleise, insbesondere<br />
an der Strecke entlang der Uferpromenade<br />
der Playa Orzán und der Playa<br />
Riazor, sollten in der Folge erneuert<br />
werden. Dieser zuletzt eröffnete Abschnitt<br />
hatte von Anfang an unter der<br />
schlecht ausgeführten Gleislage zu<br />
kämpfen.<br />
Österreich: Graz<br />
Nahverkehrsdrehscheibe eröffnet<br />
Am 22. November 2012 verkehrten<br />
die Straßenbahnlinien 1, 3, 6 und<br />
7 letztmalig durch die bisherige Unterführung<br />
Eggenberger Straße unter<br />
den Bahngleisen hindurch. Seit<br />
Betriebsbeginn am 26. November<br />
2012 steht stattdessen zwischen den<br />
zwei neu errichteten Unterführungen<br />
– unter den Eisenbahngleisen<br />
sowie unter <strong>dem</strong> Bahnhofgürtel<br />
durchführend – die in Tieflage gelegene,<br />
aber <strong>nach</strong> oben hin offene Station<br />
Hauptbahnhof zur Verfügung.<br />
Rund 40.000 Fahrgäste sollen die<br />
großzügig gestaltete Station Tag für<br />
Tag nutzen. Die neue Haltestelle bietet<br />
keinen direkten Zugang zum Bahnsteigtunnel<br />
des Bahnhofs. Stiegen,<br />
Rolltreppen und Aufzüge führen hinauf<br />
zum Bahnhofsvorplatz. Die Investitionskosten<br />
von 90 Mio. Euro wurden<br />
von der Stadt Graz, <strong>dem</strong> Land Steiermark<br />
und der ÖBB-Infrastruktur AG<br />
getragen.<br />
Zwischenzeitlich hatte die Stadtverwaltung<br />
angesichts der angespannten<br />
Haushaltslage verkündet, die Bahn<br />
(vorerst) nicht wieder eröffnen zu wollen.<br />
Angesichts der ebenfalls vertagten<br />
Pläne zur Umwandlung und Einbeziehung<br />
der Bahn in ein neues Niederflur-<br />
Straßenbahnnetz sah man keine Notwendigkeit,<br />
die Tram in ihrer bisherigen<br />
Form weiter zu betreiben. Der<br />
Druck der Bevölkerung bewirkte bei<br />
den lokalen Entscheidungsträgern<br />
aber ein Umdenken: Wenn alles gut<br />
läuft, könnte die Bahn im nächsten<br />
Sommer bereits wieder in Betrieb genommen<br />
werden.<br />
BUD<br />
Ziel des Projektes war zum einen<br />
die Entlastung der Straßenkreuzung<br />
Bahnhofgürtel/Annenstraße, welche<br />
die vier betroffenen Straßenbahnlinien<br />
oberirdisch zu queren hatten, und<br />
zum anderen die Heranführung aller<br />
vier, statt zuvor zwei, Straßenbahn -<br />
linien in diesem Bereich an den<br />
Hauptbahnhof. Auch kann der Bahnhof<br />
jetzt aus den westlichen Stadtteilen<br />
direkt angefahren werden.<br />
ROS<br />
Graz: Zwei Tage vor Eröffnung fanden in der <strong>nach</strong> oben hin offenen Station Hauptbahnhof bereits Probefahrten<br />
statt<br />
R. SCHREMPF<br />
Spanien: La Coruña<br />
Comeback für<br />
Touristentram<br />
Überraschend wurden Ende November<br />
die Bauarbeiten zur Wiederherstellung<br />
der kleinen Touristenstraßenbahn<br />
ausgeschrieben. Vor anderthalb<br />
Jahren wurde die Bahn <strong>nach</strong> einer<br />
Entgleisung am 2. Juli 2011 außer Be-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
15
Betriebe<br />
Goldener Oktober in Essen-<br />
Margarethenhöhe: Vor der Kulisse der<br />
markanten, mit wil<strong>dem</strong> Wein bewachsenen<br />
Wohnhäuser werden die Tw 5122 und<br />
5125 der EVAG auf <strong>dem</strong> Weg zur Endstelle<br />
in wenigen Sekunden in das letzte,<br />
eingleisige Streckenstück einfahren.<br />
M. KOCHEMS<br />
16 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Essen/Mülheim a.d. Ruhr<br />
Wenn die<br />
Blätter fallen …<br />
Fotowetter im Herbst<br />
In den Monaten<br />
September und Oktober<br />
bäumt sich die Natur in<br />
Deutschland ein letztes<br />
Mal vor <strong>dem</strong> Winter auf.<br />
Farben frohes Laub<br />
wertet dann viele<br />
Motive auf – so auch<br />
z.B. in Essen und<br />
Mülheim an der Ruhr<br />
Für Christen übernimmt es<br />
natürlich Gott persönlich,<br />
für andere die personifizierte<br />
Natur, was auch immer<br />
sie damit meinen, das Ergebnis<br />
ist identisch: zauberhafte<br />
Farben an Bäumen und Sträuchern,<br />
wohin das Auge im<br />
Herbst auch blickt. Die Vielfalt<br />
ist jedes Jahr erneut ein Schauspiel:<br />
Innerhalb weniger Tage<br />
wechselt Grün in mannigfaltige<br />
Töne von Gelb, Braun oder gar<br />
Rot.<br />
Bei diesen das Herz erwärmenden<br />
Anblicken ziehen wir Tramfreunde<br />
besonders gern mit der<br />
Kamera durch die Städte. Die<br />
Redaktion wählte zwei Fotografien<br />
von Christian Lücker und<br />
Michael Kochems aus Nordrhein-Westfalen<br />
aus, um zu zeigen,<br />
wie schön sich im Oktober<br />
Trams in Szene setzen lassen. AM<br />
Im Herbst seines „Lebens“ angekommen<br />
ist der Mülheimer M8S 270:<br />
2004 wurde er aus Essen übernommen,<br />
2008 <strong>nach</strong> einem Unfall aus<br />
Teilen des M8S 1011 neu aufgebaut.<br />
Heute ist er der letzte M8 in Mülheim<br />
mit Schützensteuerung und<br />
verrichtet mit seinen 36 Jahren noch<br />
zuverlässig seine Dienste, wie hier<br />
am 21. Oktober kurz vor der Haltestelle<br />
Buchenberg<br />
C. LÜCKER<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
17
Betriebe<br />
Fluss-Perlen<br />
an der Warnow<br />
Noch sehr jung ist der 27. Juli 2012<br />
als Tw 705 die Petribrücke überquert.<br />
Im Hintergrund sind mit<br />
St. Marien und St. Petri zwei der<br />
großen Rostocker Stadtpfarrkirchen<br />
zu sehen. Sonnen fotos sind an dieser<br />
Stelle so nur von Mitte Mai bis<br />
Ende Juli früh morgens möglich<br />
FOTOS, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN: M. JUNGE<br />
18 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Rostock<br />
Am 8. Oktober 2012 ist T6A2M 801 auf <strong>dem</strong> einzigen Rasengleisabschnitt der Linie 1 unterwegs<br />
und passiert die Haltestelle Fischerdorf, die <strong>nach</strong> einem Naherholungsgebiet benannt ist<br />
Rostocks Linie 1 im Porträt Sie ist nicht die längste und auch<br />
nicht die kürzeste Linie in der Hansestadt – aber links und rechts<br />
der Strecke gibt es viele interessante Dinge zu entdecken: Stadttore,<br />
Häfen, Kirchen und ein Depot mit Museumsfahrzeugen<br />
Die Endhaltestelle Hafenallee in<br />
Rostock: Ein bisschen abseits der<br />
Bebauung, fast auf freiem Feld gelegen;<br />
von der Ferne grüßen der<br />
Kirchturm von St. Petri und die Häuser<br />
Gehlsdorfs. Hier beginnt die Linie 1: Wir beginnen<br />
unsere Fahrt in einem der 17 noch im<br />
Einsatz befindlichen Tatrazüge aus T6A2M<br />
und 4NBWE, die hier montags bis freitags<br />
fast ausschließlich eingesetzt werden. Seit der<br />
Streckeneröffnung zur Hafenallee am 1. Dezember<br />
1990 hat die zu diesem Zeitpunkt<br />
wieder eingerichtete Linie 1 hier ihren Ausgangspunkt.<br />
Zum Dierkower Kreuz<br />
Obwohl Toitenwinkel ein Stadtteil mit typischen<br />
Plattenbauten ist, säumt die Strecke<br />
bis zum Dierkower Kreuz links und<br />
rechts viel Grün. Interessanterweise verläuft<br />
das Trassee fernab von größeren Straßen, so<br />
dass ein Schienenersatzverkehr mit Bussen<br />
stets nur schwer einzurichten ist. Nach der<br />
Haltestelle Friedensforum, an der sich auch<br />
ein kleiner See befindet, wird ein scharfer<br />
Rechtsbogen durchfahren, an dessen Ende<br />
wir den Ortsteil Dierkow West mit kleinen<br />
Einfamilienhäusern erreichen. Die Dierkower<br />
Mühle, eine Holländerwindmühle aus<br />
<strong>dem</strong> Jahre 1880, ist gleich da<strong>nach</strong> auf der<br />
rechten Seite zu sehen. Heute befindet sich<br />
darin ein Restaurant.<br />
Betrieblich interessant ist der nun folgende<br />
Streckenabschnitt: Unser Wagen biegt <strong>nach</strong><br />
rechts in Richtung Dierkower Kreuz ab, während<br />
geradeaus eine kurze Betriebsstrecke<br />
zum Streckenast der Linie 4 führt und dabei<br />
auch das Gleis der Linie 2 kreuzt. Nach einander<br />
münden nun die Streckenäste vom Kurt-<br />
Schumacher-Ring und vom Haltepunkt Dierkow<br />
in unser Gleis ein. Links befindet sich die<br />
im Linienverkehr nicht benutzte Wendeschleife<br />
Dierkower Kreuz. Die gleichnamige<br />
Haltestelle ist die bedeutendste Umsteigestelle<br />
im Rostocker Nordosten. Stadt- und Regionalbusse<br />
übernehmen von hier aus die Bedienung<br />
der nicht von der Straßenbahn erreichten<br />
Stadtviertel wie auch der in der Nähe<br />
befindlichen Gewerbegebiete.<br />
Ans Warnow-Ufer<br />
Bis zum Dierkower Kreuz fährt die Straßenbahn<br />
bereits seit <strong>dem</strong> 21. April 1987, als<br />
die Linien 2 und 4 eröffnet wurden. Nun ändert<br />
sich auch der Charakter der Strecke<br />
schlagartig und <strong>nach</strong> der Überquerung des<br />
Dierkower Damms wird das Gewerbegebiet<br />
Osthafen erreicht, wo vorwiegend mittelständische<br />
Betriebe ansässig sind. Einige Gebäude<br />
stehen bereits länger leer und verfallen<br />
langsam.<br />
Aus <strong>dem</strong> Fenster ist jetzt wieder der Turm<br />
der Petrikirche zu sehen, der mit 117 m Höhe<br />
eine beeindruckende Landmarke darstellt<br />
und als Orientierungspunkt auch in Seekarten<br />
verzeichnet ist. 1994 hat die Kirche ihr<br />
ursprüngliches Aussehen wiedererhalten: Bei<br />
den Bombenangriffen auf Rostock wurde der<br />
ursprüngliche Turm zerstört und erst <strong>nach</strong><br />
1990 begannen die Planungen zum Wieder-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
19
Betriebe<br />
LINKS Vor <strong>dem</strong> Trambetriebshof der RSAG ist ein<br />
Tatrazug in schneller Fahrt unterwegs. Hinter<br />
den Bäumen befindet sich das Naherholungsgebiet<br />
„Schwanenteich“ mit der Kunsthalle<br />
Daten & Fakten: Linie 1<br />
Linienlänge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 km<br />
Spurweite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.435 mm<br />
Anzahl Haltestellen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />
(abends und am Wochenende 38)<br />
Fahrzeugeinsatz: . . . . . . . . T6A2M und 4NBWE<br />
abends und am Wochenende nur 6NGTWDE<br />
Fahrzeit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Minuten<br />
Takt:. . . . 15 Minuten (<strong>nach</strong>mittags 12 Minuten)<br />
Tarif: . Einzelfahrkarte 1,80 € · Tageskarte 4,60 €<br />
aufbau. Heute hat man von einer Aussichtsplattform<br />
bei schönem Wetter einen<br />
weiten Blick über Rostock und Umgebung.<br />
Zwischen Stadthafen<br />
und Stadtmauer<br />
Jetzt überqueren wir auf der Alten Petribrücke<br />
die Warnow. Diese Brücke, ursprünglich<br />
als Klappbrücke ausgeführt, nutzte auch<br />
schon die erste Straßenbahn <strong>nach</strong> Dierkow<br />
und Gehlsdorf – die 1948 eröffnete und bereits<br />
1974 wieder eingestellte Linie 4. Da<strong>nach</strong><br />
ist die Stelle erreicht, an der die Besiedlung<br />
Rostocks mit einer slawischen Burg<br />
ihren Anfang nahm.<br />
Die Haltestelle Stadthafen ist erst 2006 fest<br />
eingerichtet worden und war vorher nur zeitweilig<br />
zur Hanse Sail in Betrieb. Hier hat sich<br />
Rostock binnen weniger Jahre stark verändert,<br />
es entstand eine neue Bebauung mit einem<br />
Parkhaus, das in diesem städtebaulich<br />
sensiblen Bereich keine Meisterleistung der<br />
Architekten ist und <strong>dem</strong>zufolge starke Proteste<br />
hervorrief.<br />
Die Trasse führt nun in sanften Bögen unterhalb<br />
der Stadtmauer entlang und passiert<br />
dabei das noch im Entstehen begriffene jüngste<br />
Wohngebiet Rostocks am Gerberbruch.<br />
Hier befand sich bis 2009 eine Wendeschleife,<br />
die den ihr ursprünglich zugedachten Zweck<br />
– eine Wen<strong>dem</strong>öglichkeit vor <strong>dem</strong> Stadtzentrum<br />
zu bieten, wenn am 1. Mai die Demonstrationen<br />
durch die Lange Straße zogen – nur<br />
wenige Male erfüllen konnte. Nach<strong>dem</strong> seit<br />
2006 eine alternative Streckenführung zur Verfügung<br />
steht, war die Wendeschleife obsolet<br />
geworden und wich einer veränderten Straßenführung<br />
und zukünftiger Wohnbebauung.<br />
In Fahrtrichtung rechts können wir zunächst<br />
einen kurzen Blick in die Straße „Am Bagehl“<br />
schweifen lassen, die bis 1974 auch von der<br />
Straßenbahn befahren wurde und zur zweiten<br />
Altstadtkirche – St. Nikolai – führt. Außergewöhnlich<br />
sind die im Dach des Kirchenschiffes<br />
befindlichen Wohnungen und der Stra-<br />
20 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Niederflurtriebwagen<br />
kommen auf der<br />
Linie 1 vor allem<br />
abends und am Wochenende<br />
zum Einsatz.<br />
Am 3. März<br />
2012 fotografierte<br />
Mirco Czerwenka den<br />
6NGTWDE 676 in der<br />
Ernst-Barlach-Straße<br />
kurz vor der Haltestelle<br />
Steintor. Am<br />
Gebäude im Hintergrund<br />
gibt es noch<br />
eine Wandrosette<br />
der alten Linie 4<br />
M. CZERWENKA<br />
Rostock<br />
Nach einem Wintereinbruch Ende Januar 2010 waren die Tatras auf allen Linien auch am Wochenende im Einsatz. Der 2009<br />
wieder ins für Rostock typische Elfenbein umlackierte Tw 704 ist am 31. Januar 2010 in der Doberaner Straße unterwegs<br />
Nur noch die sogenannte „Heinkelmauer“ zeugt von der früheren Bebauung<br />
und Bedeutung der heute brachliegenden Fläche des Flugzeugbauers<br />
und der späteren Schiffswerft. Seit 1982 fährt die Straßenbahn<br />
unmittelbar am Denkmal entlang<br />
RECHTS Die Straßenbahn<br />
gehört zum<br />
Stadtbild Rostocks<br />
ganz selbstverständlich<br />
dazu. Der<br />
Neue Markt ist ein<br />
gelungenes Beispiel<br />
für die Verbindung<br />
von Nahverkehr und<br />
Stadtgestaltung<br />
ßendurchbruch „Schwibbogen“ unter <strong>dem</strong><br />
Kirchenchor. Die Altstadtquartiere sind in den<br />
vergangenen Jahren aufwändig restauriert und<br />
umgestaltet worden. Ein Besuch in Rostocks<br />
„guter Stube“ lohnt sich, denn an der Nikolaikirche<br />
liegen immer noch Gleisreste der Linie<br />
4, die ihren Weg durch die engen Altstadtstraßen<br />
nahm. Kurz darauf ergibt sich die<br />
Möglichkeit, aus <strong>dem</strong> Fenster auf die Grubenstraße<br />
und das älteste Stadttor Rostocks,<br />
das Kuhtor, zu schauen während auf der gegenüberliegenden<br />
Straßenseite neuentstandene<br />
Wohnhäuser zu erkennen sind. Dort befand<br />
sich der erste Bahnhof Rostocks, der <strong>nach</strong> der<br />
Schließung für den Personenverkehr 1905<br />
noch bis in die 1990er-Jahre hinein als Güterbahnhof<br />
genutzt wurde. Pläne, die S-Bahn aus<br />
Warnemünde bis in die Innenstadt zu verlängern,<br />
scheiterten. Das Empfangsgebäude dient<br />
heute als Seniorenwohnheim. Nichts erinnert<br />
mehr daran, dass noch bis 1993 eine Anschlussbahn<br />
mitten durch die Grubenstraße<br />
verlief, die den Hauptgüterbahnhof und den<br />
Stadthafen miteinander verband.<br />
Schönster Marktplatz Deutschlands?<br />
Am Steintor befindet sich ein weiterer wichtiger<br />
Umsteigepunkt, treffen sich hier doch<br />
alle Straßenbahnlinien und zahlreiche Buslinien.<br />
Seit 2009 bedienen die Stadtbusse die<br />
Haltestellen der Straßenbahn mit und sorgen<br />
so für einen bequemen Umstieg zwischen<br />
den Verkehrsmitteln an dieser ansonsten<br />
weitläufigen und durch Ampeln getrennten<br />
Haltestellenanlage.<br />
Nach <strong>dem</strong> Abbiegen in die Steinstraße sehen<br />
wir ein weiteres der vier erhaltenen Rostocker<br />
Stadttore und den Namensgeber der<br />
Haltestelle Steintor. Die kurze Steinstraße<br />
passierend erreicht unser T6A2M nun den<br />
Neuen Markt, mithin einen der schönsten<br />
Marktplätze in Norddeutschland. Ursprünglich<br />
auf drei Seiten bebaut, ist die<br />
Nordseite des Marktes 1942 zerstört und<br />
später nicht wieder aufgebaut worden. Die<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
21
Betriebe<br />
Lichtenhagen<br />
Mecklenburger<br />
Allee<br />
Rügener Straße<br />
Lütten Klein<br />
Lütten Klein-Zentrum<br />
Th.-Morus-Str.<br />
Evershagen<br />
Reutershagen<br />
Schematisch<br />
dargestellter<br />
Verlauf der<br />
Rostocker<br />
Linie 1<br />
M. JUNGE<br />
Marienehe<br />
Reutershagen<br />
Kunsthalle<br />
Holbeinplatz<br />
Kröpeliner Tor -<br />
Vorstadt<br />
Giebelhäuser auf der Südseite des Marktes<br />
entstanden erst in den 1950er-Jahren und beherbergen<br />
heute die Hauptpost und das<br />
Landgericht Rostock. Dominiert wird der<br />
Platz aber durch das Rathaus mit seiner barocken<br />
Laube, die das eigentliche, im Stile<br />
der Backsteingotik schon seit <strong>dem</strong> 13. Jahrhundert<br />
bestehende Gebäude verdeckt.<br />
Die Haltestelle auf <strong>dem</strong> heute autofreien<br />
Neuen Markt existiert seit 1999 an dieser Stelle.<br />
Ursprünglich verlief die Straßenbahnstrecke<br />
quer über den Neuen Markt und durch<br />
den heutigen Boulevard, die Kröpeliner Straße.<br />
Erst 1961 konnte dieses Nadelöhr beseitigt<br />
werden, als Straßenbahn- und Autoverkehr<br />
in die Lange Straße verlegt wurde.<br />
Beim Abbiegen in die Lange Straße fällt<br />
der Blick auf die größte Stadtkirche Rostocks,<br />
die St.-Marien-Kirche. Ein unbedingtes<br />
Muss für Besucher ist die astronomische<br />
Toitenwinkel<br />
Hafenallee<br />
Innenstadt<br />
Doberaner Platz<br />
Steintor<br />
M.-Niemöller-Str.<br />
Dierkower Kreuz<br />
Stadthafen<br />
Dierkow<br />
Uhr aus <strong>dem</strong> Jahre 1472 in der Kirche, bei<br />
der täglich zur Mittagszeit ein Apostelumgang<br />
stattfindet.<br />
Die Lange Straße, die von der Straßenbahn<br />
in voller Länge durchfahren wird, ist im Stile<br />
einer repräsentativen Magistrale im Rahmen<br />
des Nationalen Aufbauwerkes (NAW)<br />
gebaut worden. Hier vermischt sich der Zuckerbäckerstil<br />
mit Elementen der Backsteingotik.<br />
Die Haltestelle Kröpeliner Tor ist<br />
an dieser Stelle erst seit 2006 zu finden,<br />
rechts bietet sich nun ein schöner Ausblick<br />
auf die Warnow und das gegenüberliegende<br />
Ufer mit <strong>dem</strong> Stadtteil Gehlsdorf. Am Doberaner<br />
Platz trennen sich die Strecken der<br />
Linien 3 und 6 zum Zoo sowie zum Neuen<br />
Friedhof und die der Linien 1, 4 und 5 in den<br />
Nordwesten Rostocks. Bis 2001 bog auch<br />
die Linie 1 <strong>nach</strong> links zum Neuen Friedhof<br />
ab, wendete dann aber in der Schleife am<br />
Platz der Jugend. Oft haben die Linienwagen<br />
am Doberaner Platz einen Moment Aufenthalt<br />
für einen Fahrerwechsel.<br />
An der Brauerei vorbei<br />
Da<strong>nach</strong> führen die Gleise in die für eine Stadt<br />
an der Küste ungewöhnlich steile Doberaner<br />
Straße zur Haltestelle Volkstheater. Auf der<br />
linken Seite ist das Gelände der Rostocker<br />
Brauerei zu sehen. Im Jahre 1982 sorgte ein<br />
nächtlicher Straßenbahngüterverkehr dafür,<br />
dass die Bierfässer von der Brauerei zu den<br />
Gaststätten in der Stadt gelangten. Diese Episode<br />
der Rostocker Straßenbahn, die ansonsten<br />
nie <strong>dem</strong> Güterverkehr diente, ging<br />
allerdings recht bald wieder zu Ende. Rechts<br />
säumen Klinikgebäude die Straße, etwas zurückgesetzt<br />
erblickt man das Volkstheater.<br />
Bergab fährt der Tatrawagen jetzt auf einem<br />
Geradezu ländliche Idylle in der Großstadt gibt<br />
es an der Haltestelle Martin-Niemöller-Straße,<br />
die der Triebwagen 706 gerade in Richtung Innenstadt<br />
verlässt. In der Holländerwindmühle<br />
befindet sich heute eine Gaststätte<br />
22 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Rostock<br />
Idyllisch zwischen Gärten und einzelnen Häusern verläuft die Straßenbahntrasse zwischen Reutershagen<br />
und Marienehe. An der Haltestelle Rahnstädter Weg begegnen sich am frühen Nachmittag<br />
des 27. Juli 2012 zwei Tatrazüge der Linie 1<br />
Etwas farblos und kühl wirken die Innenräume<br />
von Rostocks T6A2M <strong>nach</strong> der Modernisierung,<br />
die Sitze sind dennoch bequem M. KORUP<br />
der wenigen noch verbliebenen Abschnitten<br />
in Straßenmittellage in Rostock.<br />
Von der nächsten Haltestelle Kabutzenhof<br />
aus ist in wenigen Minuten der Anleger der<br />
Fähre <strong>nach</strong> Gehlsdorf zu erreichen. Der nun<br />
folgende Streckenabschnitt wird erst seit<br />
1936 befahren und führt zunächst zum sogenannten<br />
Werftdreieck, einem Platz, an <strong>dem</strong><br />
sich bis zur Schließung des Betriebes der<br />
Haupteingang zur Neptunwerft befand. Die<br />
Straßenbahn ist seit 1982 auf eigenem Bahnkörper<br />
neben der Lübecker Straße trassiert<br />
und passiert die sogenannte „Heinkelmauer“.<br />
Diese ist ein Rest der Fabrikfassade des<br />
Unternehmers Ernst Heinkel, der hier eine<br />
Fertigungsstätte für Flugzeuge betrieb. Die<br />
Mauer steht heute unter Denkmalschutz und<br />
soll in eine Neubebauung des Geländes integriert<br />
werden.<br />
Am Holbeinplatz bestehen gute Umsteigemöglichkeiten<br />
zur S-Bahn, bevor sich unser<br />
Tatrawagen in die Kurve legt und die<br />
Hamburger Straße erreicht. Linkerhand lädt<br />
der Botanische Garten zum Verweilen ein.<br />
Nach wenigen Hundert Metern erreichen<br />
wir die Einfahrt zum Straßenbahnbetriebshof<br />
Hamburger Straße mit der markanten,<br />
seit 1956 bestehenden Abstellhalle, die heute<br />
jedoch als Werkstatt benutzt wird. Die<br />
Straßenbahnwagen stehen stattdessen auf einer<br />
Freiabstellfläche. Ein Tipp nicht nur für<br />
Tramfreunde ist das Betriebsrestaurant der<br />
RSAG, welches an Werktagen preiswertes<br />
und schmackhaftes Mittagessen für jedermann<br />
anbietet.<br />
Auf <strong>nach</strong> Reutershagen!<br />
Gegenüber <strong>dem</strong> Depotgelände liegt das Naherholungsgebiet<br />
„Schwanenteich“ und die<br />
Rostocker Kunsthalle, der einzige Museumsneubau<br />
in der DDR. Kurz darauf sind<br />
die ersten Häuser des Stadtteiles Reutershagen<br />
und des Wiener Viertels zu erkennen.<br />
Neben der Straßenbahntrasse rechts erstreckt<br />
sich eine große Wiese und dahinter<br />
zahlreiche Einfamilienhäuser. Die Haltestelle<br />
Reutershagen verfügt über drei Gleise,<br />
zwei an der Strecke und eines als Ankunftshaltestelle<br />
für die seit 2000 nicht mehr im regulären<br />
Linienbetrieb benutzten Wendeschleife.<br />
Noch bis in die 1970er-Jahre hinein<br />
war der Streckenabschnitt <strong>nach</strong> Marienehe<br />
eingleisig.<br />
Depot für Museumsfahrzeuge<br />
Mit einem engen Rechtsbogen wendet sich<br />
die Straßenbahnstrecke von der Hamburger<br />
Straße ab und verläuft mitten zwischen Gärten<br />
und Mehrfamilienhäusern auf besonderem<br />
Bahnkörper.<br />
Wer den Ort Rahnstädt sucht, <strong>nach</strong> <strong>dem</strong><br />
die nächste Haltestelle benannt ist, wird auf<br />
Landkarten nicht fündig werden: Der Ort<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
23
Betriebe<br />
Nur noch wenige<br />
Meter hat der<br />
T6A2M 812 mit <strong>dem</strong><br />
Beiwagen 862 am<br />
15. August 2011 bis<br />
zur Endhaltestelle<br />
Hafenallee zurückzulegen<br />
entstammt einer Erzählung des niederdeutschen<br />
Schriftstellers Fritz Reuter.<br />
Jetzt ist Marienehe erreicht. Die Gebäude<br />
dieses heutigen Gewerbegebietes stammen<br />
ganz überwiegend noch aus der Zeit des<br />
Flugzeugbaus, auch die sich auf der anderen<br />
Seite der S-Bahngleise befindliche Sporthalle.<br />
Auf der linken Seite befindet sich die Abstellanlage<br />
in Marienehe mit einer großen<br />
Halle, in der unter anderem die verkehrsgeschichtliche<br />
Ausstellung „depot12“ untergebracht<br />
ist. Auch die Traditionsfahrzeuge<br />
sowie Arbeitswagen finden hier ihr Domizil.<br />
Die folgende, fast 1,5 km lange Strecke bis<br />
zur nächsten Haltestelle wird mit großer<br />
Geschwindigkeit befahren, der T6A2M vibriert<br />
und mit viel Schwung unterqueren wir<br />
den Schmarler Damm, um die Rampe hinauf<br />
zur Brücke über die Stadtautobahn zu erklimmen.<br />
Diese Brücke ist neben der schon<br />
erwähnten Unterführung das aufwändigste<br />
Kunstbauwerk der Straßenbahnnetz er wei -<br />
terung in den Nordwesten Rostocks. In<br />
Evers hagen Süd ermöglicht eine Kombihaltestelle<br />
das bequeme Umsteigen zwischen<br />
Straßenbahn und der Buslinie 38.<br />
Ein Stück mit Rasengleis<br />
In Mittellage der Bertolt-Brecht-Straße, die<br />
mehrgeschossige, sanierte Plattenbauten säumen,<br />
erreicht die Linie 1 die Haltestelle Thomas-Morus-Straße<br />
und damit das Ende des<br />
ersten, am 24. Juni 2000 eröffneten, Streckenabschnittes<br />
in den Nordwesten. Kurz<br />
zuvor fällt rechts der Blick auf das Stelzenhochhaus<br />
„Rasmus“. Die Wendeschleife<br />
Thomas-Morus-Straße dient heute nur noch<br />
Betriebsfahrten. Nach <strong>dem</strong> Verlassen der<br />
Haltestelle wechseln die Gleise in die Seitenlage<br />
der Straße. Hier ist Rasengleis ver-<br />
Neben der Haltestelle Marienehe befindet sich<br />
das „depot12“ mit den Traditionswagen<br />
baut worden, was gestalterisch sehr gut mit<br />
der linkerhand gelegenen Grünanlage „Fischerdorf“<br />
harmoniert.<br />
Nach zwei weiteren Haltestellen und einem<br />
scharfen Linksbogen in die Warnowallee<br />
ist die Umsteigehaltestelle Lütten Klein-<br />
Zentrum erreicht, die wie der gesamte<br />
Streckenabschnitt am 7. Juli 2001 eröffnet<br />
worden ist. In der Nähe befinden sich ein<br />
Großkino und der Boulevard Lütten Kleins,<br />
außer<strong>dem</strong> ein großes Einkaufszentrum.<br />
Nach einem Rechtsbogen hält die Straßenbahn<br />
vor <strong>dem</strong> markanten Hyparschalenbau<br />
der Mehrzweckhalle, in der sich heute lediglich<br />
noch ein Supermarkt und ein Café<br />
befinden. In Seitenlage zur Turkuer Straße<br />
und <strong>nach</strong> <strong>dem</strong> Passieren der Haltestelle gleichen<br />
Namens überquert der Tatrawagen<br />
nochmals eine Straße und hält kurz darauf<br />
in der Haltestelle Rügener Straße. Hier endet<br />
die Linie 1 von Montag bis Freitag im<br />
Tagesverkehr, während die Linien 4 und 5<br />
bis zur Mecklenburger Allee weiterfahren.<br />
Lediglich am Wochenende sowie im Abendverkehr<br />
und mit zwei Einzelfahrten im Frühverkehr<br />
verkehrt auch Linie 1 bis <strong>nach</strong> Lichtenhagen.<br />
MARTIN JUNGE<br />
Weblinks<br />
• Rostocker Straßenbahn AG:<br />
www.rsag-online.de<br />
• St.-Petri-Kirche Rostock:<br />
www.petrikirche-rostock.de<br />
• Astronomische Uhr in St. Marien:<br />
www.astronomischeuhr.de<br />
• Kunsthalle Rostock:<br />
www.kunsthallerostock.de<br />
24 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Nächster Halt: …<br />
Die Mitarbeiter des Bereiches Stromversorgung der Jenaer Nahverkehr GmbH führen im September 2012 Instandhaltungsarbeiten durch.<br />
Der Haltestelle „An der Eule“ nähert sich NGT6 MZR Nr. 614 (Adtranz 1997). Auf <strong>dem</strong> 11 km langen Weg von Zwätzen <strong>nach</strong> Lobeda West<br />
durchquert er als Linie 4 die Stadt von Nord <strong>nach</strong> Süd<br />
KONRAD SPATH<br />
Nächster Halt:<br />
An der Eule<br />
Ende des 19. Jahrhundert erlebte Jena einen<br />
rasanten wirtschaftlichen Aufschwung mit<br />
schnell wachsenden Einwohnerzahlen. In Erwartung<br />
einer weiteren Ausdehnung wurden<br />
somit bei der Planung der Straßenbahn nicht<br />
nur Strecken innerhalb der „Universitätsund<br />
Residenzstadt Jena“ vorgesehen.<br />
Einen reichlichen Monat <strong>nach</strong> Vollendung<br />
der vier Linien im Stadtgebiet erfolgte am<br />
25. Juni 1901 die Eröffnung der „Weißen<br />
Linie“ zwischen der „Centrale“ (heute das<br />
alte Depot in der Dornburger Straße) und<br />
den erst in den 1920er-Jahren eingemeindeten,<br />
damals aber noch selbständigen Dörfern<br />
Löbstedt und Zwätzen. Die Strecke folgte<br />
eingleisig in Seitenlage der Chaussee <strong>nach</strong><br />
Naumburg und führte am uralten Flurstück<br />
„Eulengeschreyge“ entlang, einem Berghang,<br />
an <strong>dem</strong> Wein angebaut wurde. Bereits<br />
1382 wird in einer Kaufurkunde der Jenaer<br />
Ratsherren dieser Weinberg, „... der da heysit<br />
daz Ulengeschrey ...“ erwähnt. Der Name<br />
geht mit Sicherheit auf die damals dort wohnenden<br />
Eulen zurück. Der Weinbau in der<br />
Umgebung von Jena war im Mittelalter so<br />
verbreitet, dass die Weintraube sogar Eingang<br />
ins Jenaer Stadtwappen gefunden hat.<br />
1907 entsteht gegenüber der Straßenbahnhaltestelle<br />
ein Lazarett für das in Jena stationierte<br />
94. Preußische Infanteriebataillon.<br />
Ab 1910 wird es kurze Zeit als kommunales<br />
Versorgungshaus (Altersheim) genutzt, später<br />
fast 100 Jahre lang als Städtisches Krankenhaus.<br />
Heute befinden sich in <strong>dem</strong> mehrfach<br />
umgebauten Gebäude verschiedene<br />
Institute der Biologisch-pharmazeutischen<br />
Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität<br />
Jena.<br />
In den 1930er-Jahren entsteht am Berghang<br />
eine Reihenhaussiedlung und die bergan<br />
führende Straße erhält den Namen „An<br />
der Eule“. Heute um viele Neubauten ergänzt,<br />
bildet das Eulenhof-Viertel ein freundliches<br />
Wohnquartier. Weiter oben am Berg<br />
befinden sich Kleingärten und dort hört man<br />
in lauen Sommernächten noch immer das<br />
Rufen junger Waldohreulen.<br />
Die Haltestelle, die schon „Garnison-Lazarett“,<br />
„Versorgungshaus“, „Städtisches<br />
Krankenhaus“ und zuletzt „Krankenhaus“<br />
hieß, trägt seit 1997 den Namen „An der<br />
Eule“.<br />
KONRAD SPATH<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
25
Betriebe<br />
Anlässlich „60 Jahre O-Bus in Solingen“ kamen viele Gastfahrzeuge im Juni 2012 in die Klingenstadt. Aus <strong>dem</strong> ostenglischen Lowestoft in der<br />
Nähe von Norwich reiste auch der einst in Baden-Baden eingesetzte O-Bus 231 an<br />
M. FEY<br />
Besuch aus England<br />
60 Jahre O-Bus in Solingen Ende Juni 2012 blickte Deutschlands größter Trolleybusbetrieb auf<br />
sechs Einsatzjahrzehnte zurück. Anlässlich des Jubiläums waren zahlreiche Gastfahrzeuge <strong>nach</strong><br />
Solingen gekommen – darunter sogar ein Originalfahrzeug von 1952<br />
Der Fahrer nimmt es mit Galgenhumor:<br />
„Da haben Sie das dann auch<br />
mal erlebt!“ Laut waren kurz zuvor<br />
die Stromabnehmerstangen des historischen<br />
O-Busses Nr. 42 aus <strong>dem</strong> Fahrdraht<br />
gesprungen und auf das Wagendach heruntergefallen.<br />
Der MAN-Bus bleibt stehen. Waren<br />
die Fahrgäste des Busses zunächst erschrocken,<br />
so beobachten sie nun, wie Fahrer<br />
und Begleiter mit Seilen die Stromabnehmer<br />
wieder an den Fahrdraht anlegen.<br />
Gerade solche Pannen sind die „Sahnehäubchen“<br />
eines Sonderverkehrs, den das O-<br />
Bus-Museum Solingen aus Anlass des 60.<br />
Der ÜH IIIs Nr. 1 war für die Solinger der Stargast.<br />
Er war 1952 als erster in Dienst gestellt<br />
worden, befindet sich aber heute ebenfalls im<br />
Eigentum von zwei Sammlern im ostenglischen<br />
Lowestoft. In Solingen traf er nun den dortigen<br />
Museums-O-Bus Nr. 59 wieder<br />
M. FEY<br />
26 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
O-Bus Solingen<br />
Geburtstages des größten deutschen Trolleynetzes<br />
am letzten Juniwochenende 2012<br />
aufgezogen hatte. Neben den fünf Schätzchen<br />
aus <strong>dem</strong> eigenen Museumsbestand waren<br />
noch weitere O-Bus-Veteranen anderer<br />
Betriebe und Sammler zum Jubiläum in die<br />
Klingenstadt gekommen.<br />
Dicht umlagert auf <strong>dem</strong> Freigelände des<br />
Betriebshofes Weidenstraße stand der eigentliche<br />
Methusalem des Solinger Betriebs,<br />
der „ÜH IIIs“ Nr. 1, gebaut 1952 von Henschel<br />
und der Waggonfabrik Uerdingen. Er<br />
war der erste O-Bus, der beim Start des Solinger<br />
Netzes 1952 auf die Strecke ging. Heute<br />
gehört er zwei Sammlern im ostenglischen<br />
Lowestoft in der Nähe von Norwich. Aus<br />
Anlass des Jubiläums ließen sie das Fahrzeug<br />
eigens über den Kanal <strong>nach</strong> Solingen transportieren.<br />
Es pendelte auf beiden Sonderrouten<br />
zwischen Betriebshof und Wuppertal-Vohwinkel<br />
bzw. Schloss Burg.<br />
Zusammen mit <strong>dem</strong> ÜH IIIs kam auch der<br />
O-Bus 231 über den Kanal. Gebaut von<br />
Henschel in den 1960er-Jahren tat er früher<br />
in Baden-Baden auf der Trolleylinie vom<br />
Bahnhof Oos in die Innenstadt von Baden-<br />
Baden Dienst.<br />
Weitere Gäste waren der belgische Gelenk-<br />
O-Bus 11 (van Hool Typ 280 T) aus Gent<br />
sowie Dieselbusse von Nachbarbetrieben,<br />
die den kostenlosen Zubringerverkehr von<br />
der City zum Betriebshof besorgten. Blickfänger<br />
war dabei der Magirus-Reisebus 0<br />
3500 aus Düsseldorf aus den 1950er-Jahren,<br />
ein Ex-Trierer Henschel-Gelenkbus vom Typ<br />
HS 160 OSL sowie ein bei den Essener Verkehrsbetrieben<br />
gehegt und gepflegter Anderthalbdeck-Mercedes-Benz<br />
O 315 der legendären<br />
Bauart „Gebr. Ludewig“ aus den<br />
1960er-Jahren.<br />
Seit 2009 nicht mehr benötigt wird die einzige O-Bus-Drehscheibe der Welt an der Endstelle<br />
„Schloss Burg“ in Solingen. Als technisches Denkmal bleibt sie jedoch erhalten L. SCHIEFFER<br />
Rückkehr aus Argentinien<br />
Neben <strong>dem</strong> eingangs beschriebenen dreiachsigen<br />
Bus Nr. 42, hergestellt 1986 vom MAN-<br />
Tochterunternehmen Gräf und Stift sowie<br />
Kiepe Elektrik, besteht die Sammlung des Solinger<br />
O-Bus-Museums aus einem Portfolio<br />
aller Epochen des heimatlichen Betriebs: ein<br />
MAN-Gelenkbus SG 200 aus <strong>dem</strong> Jahre<br />
1984 und ein ÜH IIIs aus <strong>dem</strong> Jahre 1959 mit<br />
Anhänger (Hersteller Orion). Der „Exot“ der<br />
Sammlung ist ein Schweizer O-Bus vom Typ<br />
FBW 91-GTL aus Bern (Baujahr 1974).<br />
Ein Typ fehlte allerdings bisher: Die Baureihe<br />
TS („Trolley-Bus Solingen“, Hersteller<br />
Gebrüder Ludewig, Essen) aus den 1970er-<br />
Jahren. Ende der 1980er-Jahre waren diese<br />
ins argentinische Mendoza verkauft worden.<br />
Bei einem Vororttermin bekam der „Obus-<br />
Museum Solingen“-Verein im Mai 2012 den<br />
Wagen 68 geschenkt. Aufgrund eines fehlenden<br />
Zolldokumtes konnte dieser Bus jedoch<br />
bisher nicht <strong>nach</strong> Deutschland zurückkehren.<br />
Der Regelbetrieb in Solingen<br />
Mittlerweile ist der Fahrzeugpark der Solinger<br />
Netzes komplett auf moderne Gelenkfahrzeuge<br />
der Hersteller Berkhof, Hess und<br />
Van Hool umgestellt. 50 Fahrzeuge rollen<br />
auf den sechs Linien bei einer Gesamtstreckenlänge<br />
von fast 50 km.<br />
Bei der Umstellung auf Gelenkbusse blieb<br />
2009 ein Unikum buchstäblich auf der Strecke:<br />
die einzige O-Bus-Drehscheibe der Welt<br />
an der Endstelle „Schloss Burg“. Tief im engen<br />
Tal der Wupper war sie 1959 am ehemaligen<br />
Endpunkt der Straßenbahn angelegt<br />
worden, da sich bei Aufnahme des O-Bus-<br />
Betriebes kein Raum für eine weiträumige<br />
Wendeschleife geboten hatte. Die Drehscheibe<br />
war nur im Notfall mit Muskelkraft,<br />
später mit Motorbetrieb zu betätigen.<br />
Am 16. November 2009 eröffneten die Solinger<br />
Verkehrsbetriebe auf der Linie 683<br />
eine neue Wendeschleife. Seit<strong>dem</strong> verkehren<br />
dort regulär Gelenkzüge, diese fahren zum<br />
Wenden auf der Hauptstraße durch den<br />
Ortskern von Schloss Burg hindurch und<br />
drehen außerhalb. Dabei gibt es ein neues<br />
Kuriosum: Die Bürger des Ortes hatten sich<br />
bei Einführung des Gelenkwagenverkehrs<br />
massiv gegen weitere Fahrdrähte auf ihrer<br />
Hauptstraße ausgesprochen. So müssen die<br />
O-Busse jetzt an der letzten Haltestelle vor<br />
der Ortseinfahrt „abbügeln“ und einen<br />
Hilfsdiesel anwerfen. Mit <strong>dem</strong> geht es dann<br />
durch den Ortskern zur Wendeanlage …<br />
Die O-Bus-Drehscheibe bleibt indes für<br />
das Obus-Museum und eventuelle Einsatzfahrten<br />
des ÖPNV erhalten.<br />
LUDWIG SCHIEFFER/AM<br />
Zu den Gästen der 60-Jahr-Feier zählte auch die neueste Trolleybus-Generation, wie hier der Salzburger Niederflur-Trollino vom Typ 18 „Metrostyle“<br />
von Hersteller Solaris<br />
L. SCHIEFFER<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
27
Betriebe<br />
Klein und sympathisch<br />
Die Tram der kroatischen Stadt Osijek In den vergangenen Jahren erfuhr das Streckennetz<br />
eine nennenswerte Erweiterung. Der Wagenpark setzt sich heute aus modernisierten Tatras und<br />
gebraucht übernommenen Düwags zusammen<br />
Die 107.000 Einwohner zählende<br />
Stadt Osijek (deutsch: Esseg; ungarisch:<br />
Eszék) ist der wirtschaftliche<br />
und kulturelle Mittelpunkt der Region<br />
Slawonien und Verwaltungssitz der politischen<br />
Provinz Osijek-Baranja. Die am rechten<br />
Ufer der Drau (kroatisch: Drava) gelegene<br />
Stadt besitzt zwei voneinander unabhängige<br />
Stadtzentren. Zum einen handelt es sich dabei<br />
um den barocken und auch heute noch<br />
teilweise von einer Fortifikation umgebenen<br />
Festungsbezirk (Tvrda) und zum anderen um<br />
die Oberstadt (Gornji grad), die heute alle<br />
Funktionen eines modernen Stadtzentrums<br />
auf sich vereinigt. Dazwischen liegen ausgedehnte<br />
Parkanlagen, die Universität und villenähnliche<br />
anmutende Mietshäuser aus der<br />
Zeit der Donaumonarchie.<br />
In <strong>dem</strong> Anfang der 1990er-Jahre wütenden<br />
„Kroatienkrieg“ verlief die Front teilweise<br />
mitten durch Osijek und an zahlreiche<br />
Häuserfassenden kann man die Spuren der<br />
Kampfhandlungen auch heute noch deutlich<br />
erkennen. Abgesehen davon hat sich Osijek<br />
in den vergangenen 15 Jahren sehr gut entwickelt<br />
und besitzt mit einer Fußgängerzone,<br />
einer vielfältigen Lokalszene und gepflegten<br />
Grünanlagen zahlreiche Attribute<br />
einer modernen und lebenswerten Stadt.<br />
1884–1926: 42 Jahre Pferdetram<br />
Die damals zur ungarischen Reichshälfte der<br />
Donaumonarchie gehörende Kleinstadt erhielt<br />
am 10. September 1884 eine meterspurige<br />
Pferdetramway, die in Ost-West-<br />
Richtung verlief und die wachsenden<br />
28 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Kroatien: Osijek<br />
In der Regel sind alle 17 T3PV.O mit Werbefolien beklebt. Die Miete beträgt für 12 Monate nur<br />
13.300 Euro und ist damit um ein Vielfaches günstiger als bei deutschen Verkehrsbetrieben. Der<br />
T3PV.O 0603 befährt am 10. Mai 2012 die Schleife Zeleno Polje<br />
Auch die Trams in Osijek<br />
sind vor Graffiti nicht sicher.<br />
So passiert der GT6 0933 am<br />
9. Mai 2012 mit übermalter<br />
zweiter Wagenhälfte auf der<br />
Fahrt <strong>nach</strong> Visnjevac die renovierte<br />
katholische Kirche<br />
ALLE FOTOS: W. KAISER<br />
Das aktuelle Straßenbahnnetz in Osijek<br />
Stadtteile Oberstadt und Unterstadt (Donji<br />
Grad) mit <strong>dem</strong> zentral gelegenen Festungsbezirk<br />
verband. Damit verfügte Osijek bereits<br />
sieben Jahre früher über ein schienengebundenes<br />
Nahverkehrsmittel als die<br />
heutige kroatische Hauptstadt Zagreb.<br />
Das Netz wurde in den Folgejahren um<br />
zwei Linien Richtung Süden erweitert, und<br />
zwar vom Hauptplatz der Oberstadt zum<br />
Bahnhof und vom Hauptplatz der Festung<br />
in die Gartenstadt (Perivoja Grad). Entlang<br />
dieser Route gab es auch einen schienengleichen<br />
Übergang mit der Eisenbahnstrecke<br />
<strong>nach</strong> Pécs bzw. Vukovar. Weiters gab es auch<br />
ein Anschlussgleis zum Hafen, das für den<br />
Güterverkehr der Relation Bahnhof – Hafen<br />
benötigt wurde. Im Jahre 1895 standen für<br />
den Betrieb des zwölf Kilometer langen Netzes<br />
15 Personenwagen, acht Güterwagen<br />
und zwei Postwagen zur Verfügung.<br />
Bereits 1898 gab es Pläne zur Elektrifizierung<br />
der Straßenbahn, diese scheiterten aber<br />
zunächst an der fehlenden Infrastruktur für<br />
die Stromerzeugung. Auch in den Jahren des<br />
Ersten Weltkrieges und <strong>dem</strong> darauffolgenden<br />
Zerfall der Donaumonarchie war nicht<br />
an eine Erneuerung der Straßenbahn zu denken.<br />
So wurde der Betrieb mit Pferden bis<br />
weit in die 1920er-Jahre beibehalten.<br />
Die Eröffnung der elektrischen Straßenbahn<br />
erfolgte am 31. März 1926. Die Linie<br />
in die Gartenstadt wurde aber nicht mehr<br />
betrieben, die Hauptlinie im Bereich des Festungsbezirkes<br />
außerhalb der Befestigungsmauern<br />
neu trassiert und die Bahnhofslinie<br />
zu einem Rundkurs ausgebaut. Man begann<br />
W. KAISER<br />
nun auch mit <strong>dem</strong> zweigleisigen Ausbau des<br />
Streckennetzes, wobei man die Gleise fast<br />
durchwegs an die beiden Bordsteinkanten<br />
rückte. Dieses Konzept zur Vermeidung von<br />
Behinderungen durch den Individualverkehr<br />
ist in allen ehemals jugoslawischen Betrieben<br />
bis heute weit verbreitet. Zur Grundausstattung<br />
des elektrischen Betriebes gehörten<br />
zwölf zweiachsige Triebwagen von<br />
Skoda mit den Betriebsnummern 1 bis 12.<br />
Ausbau und Rückbau<br />
In den Jahren <strong>nach</strong> <strong>dem</strong> Zweiten Weltkrieg<br />
wurden an den Endpunkten Zeleno Polje<br />
und Retfala Gleisschleifen angelegt und die<br />
Strecke ab Retfala in die westlichen Vororte<br />
verlängert. Zunächst bestand allerdings<br />
hier nur ein einziges Streckengleis und eine<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
29
Betriebe<br />
Daten & Fakten: Osijek<br />
Spurweite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 mm<br />
Eröffnung Pferdebahnbetrieb: . . . . . 10.09.1884<br />
Eröffnung elektrischer Betrieb:. . . . . 31.03.1926<br />
Aktueller Wagenbestand: . . . . . . . . . . 17 T3PV.O<br />
9 GT6<br />
2 T3YU<br />
Anzahl Linien:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />
Netzlänge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 km<br />
Nur auf einem kurzen Streckenabschnitt zwischen Festung und der Oberstadt von Osijek passiert<br />
die Linie 1 großstädtisch anmutende Bebauung aus der Zeit um 1900 (Foto: Mai 2012)<br />
Im Juli 2012 war der T3PV.O 0713 ausnahmsweise ohne Werbung unterwegs. Am 4. Juli wartet<br />
er in der Endstelle Visnjevac auf Fahrgäste<br />
stumpfe Endstelle, weshalb dieser Abschnitt<br />
nur von einem solo fahrenden Pendelwagen<br />
bedient werden konnte. Mitte der 1960er-<br />
Jahre erfolgten der zweigleisige Ausbau und<br />
die Verlängerung bis zum heutigen Endpunkt<br />
Visnjevac.<br />
Um 1970 wurde schließlich die bisher<br />
zweigleisige und in auch in beiden Richtungen<br />
befahrene Bahnhofrundlinie rückgebaut<br />
und seither besteht hier nur noch ein Streckengleis,<br />
auf <strong>dem</strong> gegen den Uhrzeigersinn<br />
gefahren wird.<br />
Eine Erneuerung des Wagenparks fand zunächst<br />
nicht statt, zusätzliche Kapazitäten<br />
konnten aber durch die Anschaffung von gebrauchten<br />
Fahrzeugen geschaffen werden.<br />
So erhielt Osijek 1949 vier zweiachsige<br />
Triebwagen aus Rijeka (Nr. 13 bis 16; gebaut<br />
1922 in der Hauptwerkstätte der Zagreber<br />
Straßenbahn) und 1958 weitere 14<br />
Zweiachser, die durch die Stilllegung des Betriebes<br />
in Ljubljana vakant wurden. Die<br />
1931/32 von Duro Dakovic gebauten Fahrzeuge<br />
erhielten die Betriebsnummern 17 bis<br />
30. Im Jahre 1961 erhielt der Betrieb dann<br />
erstmals seit der Elektrifizierung fabrikneue<br />
Triebwagen. Es handelte sich um die Stahlkastenzweiachser<br />
TMK 101 von Duro Dakovic,<br />
die auch für Zagreb produziert wurden.<br />
Der Verkehrsbetrieb Osijek erhielt acht<br />
Exemplare (Nr. 31 bis 38), die solo oder auch<br />
mit zu Beiwagen umfunktionierten Altbau-<br />
Triebwagen zum Einsatz kamen.<br />
Modernisierung mit Tatrawagen<br />
Im Jahre 1968 konnte der mittlerweile recht<br />
bunte Wagenpark mit zehn Tatrawagen vom<br />
Typ T3YU erneuert werden. Die Wagen erhielten<br />
zwar die logischen Betriebsnummern<br />
39 bis 48, es wurden aber die letzten beiden<br />
Ziffern des Anschaffungsjahres vorangesetzt<br />
und die Nummern lauteten daher 6839 bis<br />
6848. Ein zweite Lieferung von zwölf T3YU<br />
folgte im Jahre 1972 und zwecks Vereinheitlichung<br />
des Wagenparks gab der Verkehrsbetrieb<br />
gleichzeitig die TMK 101 <strong>nach</strong><br />
Zagreb (dort Nr. 164 bis 171) ab.<br />
Der T3PV.O 0609 wirbt am 3. Juli 2012 für einen<br />
Besuch des Zoos. Er verlässt soeben im<br />
Einsatz auf Linie 2 die Endstelle am trg Ante<br />
Starcevica<br />
30 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Kroatien: Osijek<br />
Die Neubaustrecke der Linie 2 führt durch die ulica Martina Divalta und ist durchwegs eingleisig ausgeführt. Bei der Endstelle Bikara liegt das Streckengleis<br />
in Mittellage und ist von den beiden Richtungsfahrbahnen nur durch Leitlinien abgegrenzt, hier am 10. Mai 2012 mit <strong>dem</strong> T3PV.O 0609<br />
Die T3YU des Baujahres 1968 erhielten<br />
nun die neuen Betriebsnummern 6801 bis<br />
6810 und der „Jahrgang“ 1972 wurde mit<br />
den Nummern 7211 bis 7222 in Betrieb genommen.<br />
Der Verkehr konnte nun typenrein mit den<br />
Tatrawagen abgewickelt werden und die<br />
Fahrzeit auf der neun Kilometer langen<br />
Durchmesserlinie wurde von 30 auf 22 Minuten<br />
gekürzt. Linienbezeichnungen gab es<br />
<strong>nach</strong> wie vor keine und in den Liniennummernkästen<br />
der Tatrawagen wurden die für<br />
betriebsinterne Zwecke wichtigen Kursnummern<br />
angezeigt.<br />
Neue Wagen ab 1982<br />
Fahrgastzuwächse veranlassten den Verkehrsbetrieb<br />
im Jahre 1981 zur Bestellung<br />
von vier weiteren T3YU samt dazu passenden<br />
Beiwagen B3YU, die schließlich 1982<br />
eintrafen und die Betriebsnummern 8223 bis<br />
8226 (T3YU; Fabr.-Nr. 170691 bis 170694/<br />
1981) und 8201 bis 8204 (B3YU; Fabr.-Nr.<br />
170687 bis 170690/1981) erhielten. Diese<br />
Fahrzeuge entsprechen mit Ausnahme der<br />
meterspurigen Drehgestelle exakt den für<br />
Chemnitz und Schwerin gebauten T3D/B3D,<br />
was vor allem an den großen Zielschildkästen<br />
der Triebwagen zu erkennen ist. Nach<br />
Aussagen des Fahrpersonals waren bei der<br />
Seit Mai 2012 bereichern drei GT6 vom Typ<br />
„Mannheim“ den Wagenpark. Sie sind ohne<br />
Linien- und Zielangaben unterwegs. Der Wagen<br />
1238 hält am 4. Juli 2012 an der Festung<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
31
Betriebe<br />
Die GT6 1238 und 1239 sind als Bestandteil des Projektes „Osijek – Stadt der guten Nachrichten“ mit entsprechenden Slogans (hier „Osijek im<br />
Herzen“) verziert. Der GT6 9530 passiert auf seinem Weg ins Stadtzentrum im Mai 2012 den historischen Festungsbezirk Trvda<br />
LINKS Fallweise kommt 2012 im Schülerverkehr<br />
einer der beiden nicht modernisierten T3YU<br />
zum Einsatz, hier am 9. Mai auf der ul. Kapucinska.<br />
Die Graffiti-Bemalung des Wagens<br />
8225 soll auf das globale Umweltprojekt „Art<br />
& Earth“ aufmerksam machen<br />
Lieferung sogar die Anschriften am Bedienpult<br />
des Fahrers deutschsprachig. Bei den<br />
vier B3YU handelt es sich um die einzigen<br />
je hergestellten B3 in Meterspurausführung.<br />
Bis etwa 1986 wurden planmäßig alle vier<br />
Beiwagenzüge eingesetzt, wegen der deutlich<br />
schlechteren Beschleunigung mussten jedoch<br />
die Fahrzeiten aller Kurse verlängert werden.<br />
Bald entschied man sich daher, die Züge nur<br />
noch in den Spitzenzeiten als Verstärker einzusetzen<br />
und das Stadtbild wurde wieder von<br />
solo fahrenden Tatrawagen geprägt.<br />
Der Kroatienkrieg hinterlässt Spuren<br />
Eine Zäsur in der Geschichte der Stadt und<br />
des Straßenbahnbetriebes stellte der „Kroatienkrieg“<br />
von 1991 bis 1995 dar, denn in<br />
der ersten Phase des Krieges war die Stadt<br />
unmittelbar von den Kampfhandlungen betroffen.<br />
So fuhr die Straßenbahn von September<br />
1991 bis November 1992 meist nur<br />
im weniger umkämpften westlichen Teil der<br />
Stadt und wegen Beschädigungen an der Infrastruktur<br />
war zeitweise gar kein Betrieb<br />
möglich. Auch Fahrzeuge und Personal fielen<br />
den Kampfhandlungen zum Opfer, an<br />
Fahrbetriebsmitteln wären die Wagen 6805,<br />
7211 und 8224 sowie 8204 zu nennen.<br />
Ab 1993 konnte der Betrieb wieder ohne<br />
Behinderungen abgewickelt werden, Infrastruktur<br />
und Wagenpark zeigten sich aber in<br />
einem beklagenswerten Zustand. Dazu kam<br />
ein eklatanter Wagenmangel, da einige Tatrawagen<br />
bereits in den 1980er-Jahren <strong>nach</strong><br />
Unfällen und Bränden verschrottet werden<br />
mussten (6801, 6803, 6807, 7218) und stets<br />
einige Wagen wegen notorischem Ersatzteilmangel<br />
nicht einsatzbereit waren.<br />
In dieser prekären Lage konnte die Stadt<br />
Mannheim aushelfen und gab im Jahre 1995<br />
fünf sechsachsige Düwag-Gelenktriebwagen<br />
der Baujahre 1960–62 kostenlos <strong>nach</strong> Osijek<br />
ab. Die Wagen erhielten gemäß <strong>dem</strong> geltenden<br />
Schema die Betriebsnummern 9527<br />
bis 9531 und verstärkten an Werktagen den<br />
32 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Kroatien: Osijek<br />
Der T3YU 7216 (heute T3PV.O 0604) präsentiert sich im Mai 2005 noch im Neulack <strong>nach</strong> CKD-Norm und verlässt soeben die Endstelle Višnjevac.<br />
Heute wird dieser Bereich von der Brücke einer Umfahrungsstraße überspannt<br />
zehn Kurse umfassenden Auslauf der Hauptlinie.<br />
Wiederum wurde der Liniennummernkasten<br />
zur Anzeige der Kursnummer<br />
verwendet. Die Fahrzeit in der Relation<br />
Visnjevac – Zeleno Polje betrug wegen des<br />
schlechten Oberbaues und des zunehmenden<br />
Individualverkehrs nun wiederum 30<br />
Minuten.<br />
Sanierung von Netz und Wagenpark<br />
Nach der Jahrtausendwende fiel die Entscheidung<br />
zur Sanierung des Bestandnetzes,<br />
zur Verlängerung der Linie 2 und zur Modernisierung<br />
des Wagenparks. Unter Rücksichtnahme<br />
auf die vorhandenen finanziellen<br />
Mittel wurden 2006/07 siebzehn T3YU<br />
bei Pragoimex in Ostrava modernisiert und<br />
erhielten dabei einen neuen – durchgehend<br />
hochflurigen – Wagenkasten und die Choppersteuerung<br />
„TV Progress“ von Cegelec.<br />
Die neue Typenbezeichnung lautet T3PV.O<br />
(T3 mit Progress-Steuerung und Wagenkasten<br />
VarCB3, Variante Osijek) und die Wagen<br />
erhielten in der Reihenfolge der Rückkehr<br />
<strong>nach</strong> Osijek die neuen Nummern 0601<br />
bis 0611 und 0712 bis 0717. An nicht modernisierten<br />
Tatras standen jetzt nur noch<br />
die Wagen 8223, 8225 und 8226 zur Verfügung,<br />
die bis 2009 noch sporadisch mit den<br />
zugehörigen Beiwagen zum Einsatz kamen.<br />
Im Frühjahr 2006 starteten die Bauarbeiten<br />
zur Verlängerung der Bahnhofrundlinie<br />
um zunächst einen Kilometer Richtung Süden<br />
bis zur Endstelle „Mackamama“.<br />
Osijek – Wagenpark Stand August 2012<br />
Nummer Typ Hersteller Baujahr Herkunft<br />
0601 T3PV.O CKD 1968 UB 2006, ex T3YU 6809 (1972, ex 6847)<br />
0602 T3PV.O CKD 1972 UB 2006, ex T3YU 7212<br />
0603 T3PV.O CKD 1972 UB 2006, ex T3YU 7213<br />
0604 T3PV.O CKD 1971 UB 2006, ex T3YU 7216<br />
0605 T3PV.O CKD 1972 UB 2006, ex T3YU 7220<br />
0606 T3PV.O CKD 1972 UB 2006, ex T3YU 7214<br />
0607 T3PV.O CKD 1971 UB 2006, ex T3YU 7217<br />
0608 T3PV.O CKD 1968 UB 2006, ex T3YU 6806 (1972, ex 6844)<br />
0609 T3PV.O CKD 1968 UB 2006, ex T3YU 6810 (1972, ex 6848)<br />
0610 T3PV.O CKD 1968 UB 2006, ex T3YU 6804 (1972, ex 6842)<br />
0611 T3PV.O CKD 1971 UB 2006, ex T3YU 7219<br />
0712 T3PV.O CKD 1971 UB 2007, ex T3YU 7218<br />
0713 T3PV.O CKD 1968 UB 2007, ex T3YU 6802 (1972, ex 6840)<br />
0714 T3PV.O CKD 1968 UB 2007, ex T3YU 6808 (1972, ex 6846)<br />
0715 T3PV.O CKD 1972 UB 2007, ex T3YU 7215<br />
0716 T3PV.O CKD 1971 UB 2007, ex T3YU 7221<br />
0717 T3PV.O CKD 1972 UB 2007, ex T3YU 7222<br />
8223 T3YU CKD 1981<br />
8225 T3YU CKD 1981<br />
9527 GT6 Düwag 1960 1995, ex Mannheim 323<br />
9528 GT6 Düwag 1960 1995, ex Mannheim 325<br />
9530 GT6 Düwag 1962 1995, ex Mannheim 371<br />
0933 GT6 Düwag 1960 2009, ex Zagreb 911; 1994, ex Mannheim 322<br />
0934 GT6 Düwag 1960 2009, ex Zagreb 914; 1994, ex Mannheim 347<br />
0936 GT6 Düwag 1960 2009, ex Zagreb 917; 1995, ex Mannheim 319<br />
1237 GT6 „Mannheim“ Düwag 1971 2012, ex Zagreb 942; 1996, ex Mannheim 466<br />
1238 GT6 „Mannheim“ Düwag 1971 2012, ex Zagreb 944; 1996, ex Mannheim 463<br />
1239 GT6 „Mannheim“ Düwag 1971 2012, ex Zagreb 941; 1996, ex Mannheim 462<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
33
Betriebe<br />
Der T3PV.O 0717 macht im Juli 2012 Werbung für die ortsansässige Brauerei und erreicht soeben<br />
den zentralen trg Ante Starcevica<br />
Bereits kurz <strong>nach</strong> der Inbetriebnahme musste der GT6 Typ „Mannheim“ 1237 schadhaft abgestellt<br />
werden und ging erst wieder Mitte Juli 2012 in Betrieb. Nur er ist in Blau-Weiß lackiert<br />
Die Eröffnung am 2. Dezember 2006<br />
brachte auch die Einführung einer dritten<br />
Linie und die erstmalige Verwendung von<br />
Liniensignalen mit sich. Neben der unverändert<br />
verkehrenden Hauptlinie (jetzt Linie<br />
1) und der gegen den Uhrzeigersinn fahrenden<br />
Bahnhofrundlinie (jetzt Linie 2) gab es<br />
nun auch die in der Relation Zeleno Polje –<br />
Mackamama verkehrende Linie 3. Diese<br />
Maßnahmen brachten jedoch ein Überangebot<br />
an Bahnen im Bereich des wenig<br />
frequentierten Bahnhofes und bereits im Januar<br />
2007 wurden die Linienführungen angepasst.<br />
Bei gleichzeitigem Entfall der Bahnhofrundlinie<br />
erhielt die bisherige Linie 3 das<br />
Liniensignal 2. Seither kann der Bahnhof<br />
vom Stadtzentrum aus nicht mehr direkt und<br />
umsteigefrei erreicht werden. Beide Linien<br />
verkehrten in 10-Minuten-Intervallen und<br />
der Wagenbedarf umfasste acht Kurse für die<br />
Linie 1 und sechs Kurse für die Linie 2.<br />
Eingleisige Neubaustrecke<br />
Das Ausbauprogramm war damit aber noch<br />
nicht beendet, denn am 24. August 2009<br />
wurde die Linie 2 um knapp vier Kilometer<br />
bis in den Außenbezirk Bikara verlängert.<br />
Aus Kosten- und teilweise auch aus Platzgründen<br />
konnte die Strecke nur eingleisig<br />
ausgeführt werden, sechs Ausweichen sorgen<br />
aber für eine halbwegs flexible Betriebsabwicklung.<br />
Da die Ausweichen mit<br />
platzsparenden und fahrgastfreundlichen<br />
Mittelbahnsteigen ausgestattet sind, werden<br />
sie im Linksverkehr befahren. Die Linie 2<br />
verkehrt nun in der Relation Stadtzentrum<br />
(trg Ante Starcevica) – Bikara, wobei die<br />
<strong>nach</strong> wie vor eingleisige Bestandstrecke der<br />
ehemaligen Bahnhofrundlinie weiterhin nur<br />
gegen den Uhrzeigersinn befahren wird. Der<br />
Bahnhof sowie der neue und sehr groß bemessene<br />
Busbahnhof werden daher nur auf<br />
der Fahrt Richtung Stadtzentrum an das<br />
Straßenbahnnetz angebunden. Die Linie 2<br />
verkehrt alle elf Minuten und für den Betrieb<br />
werden sechs T3PV.O benötigt. Die Tatsache,<br />
dass hier eine – größtenteils eingleisige<br />
– Neubaustrecke in ein Gebiet mit teilweise<br />
fast ländlichen Strukturen und eher geringem<br />
Fahrgastaufkommen (max. 4.000 Fahrgäste<br />
pro Tag) verwirklicht wurde, ist durchaus<br />
bemerkenswert und zukunftsweisend,<br />
denkt doch so mancher deutsche Betrieb laut<br />
über die Stilllegung derartiger Strecken <strong>nach</strong>!<br />
Die Verlängerung der Linie 2 und steigende<br />
Fahrgastzahlen auf der Linie 1 machten<br />
eine Aufstockung des Wagenparks notwendig.<br />
Da in Zagreb ex-Mannheimer GT6<br />
wegen der Inbetriebnahme von Niederflurwagen<br />
entbehrlich wurden, konnte der Verkehrsbetrieb<br />
fünf Fahrzeuge kostengünstig<br />
erwerben, von denen vier mit den Nummern<br />
0932 bis 0934 und 0936 in Betrieb genommen<br />
wurden. Der Wagen 0935 (ex Zagreb<br />
916, ex Mannheim 357) diente von Anfang<br />
an nur als Ersatzteilspender und steht heute<br />
noch in teilweise ausgeschlachtetem Zustand<br />
im Freigelände des Depots.<br />
Wagen mit Klimaanlage<br />
Der Wagen 0932 hatte bald <strong>nach</strong> der Indienststellung<br />
einen Unfall mit einem Lkw<br />
und wurde gemeinsam mit den schon längere<br />
Zeit abgestellten GT6 9529 und 9531 verschrottet.<br />
Der Verschrottungsaktion der Jahre<br />
2009/10 fielen auch die B3YU 8202 bis<br />
8204 sowie der T3YU 8226 zum Opfer. Im<br />
Februar 2012 trafen dann nochmals drei GT6<br />
aus Zagreb ein. Diesmal handelte es sich aber<br />
um Wagen des Typs „Mannheim“, die auch<br />
mit einer Klimaanlage ausgestattet sind. Die<br />
34 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Kroatien: Osijek<br />
Der trg Ante Starcevica – Hauptplatz der Oberstadt<br />
von Osijek – wurde 2005 neu gestaltet und mit einem<br />
unterirdischen Einkaufszentrum ausgestattet.<br />
Zumindest der im Juli 2012 fotografierte T3PV.O<br />
passt zu den neuen Beleuchtungskörpern und<br />
<strong>dem</strong> Abgang zum Tiefgeschoss<br />
Wagen 1237 bis 1239 wurden am 10. Mai<br />
2012 am trg Ante Starcevica gemeinsam mit<br />
der Aktion „Osijek – Stadt der guten Nachrichten“<br />
der Öffentlichkeit präsentiert. Die<br />
Wagen 1238 und 1239 waren bereits mit einigen<br />
Slogans verziert, die zu mehr Miteinander<br />
und positivem Denken anregen sollen.<br />
Als „gute Nachricht“ wurde in der Presse<br />
auch gewertet, dass nun erstmals Straßenbahnen<br />
mit Klimaanlage durch Osijek rollen.<br />
Der aktuelle Betrieb<br />
Der aktuelle Wagenpark umfasst 17<br />
T3PV.O, neun GT6 und zwei T3YU, die allerdings<br />
nur noch sporadisch in den Spitzenzeiten<br />
auf der Linie 1 zum Einsatz kommen.<br />
Auf der Linie 1 verkehren ganztägig<br />
zwölf Kurse in 6-Minuten-Intervallen und<br />
im Schülerverkehr (7 bis 8 sowie 11 bis 15<br />
Uhr) kommt ein 13. Kurs zum Einsatz. Prinzipiell<br />
stehen also für die Deckung von insgesamt<br />
19 Kursen (Linie 1 und 2) derzeit genügend<br />
Fahrzeuge zur Verfügung. Da jedoch<br />
die Stadt als Eigentümer des Verkehrsbetriebs<br />
jährlich nur geringe Mittel für Ausbesserungen<br />
und Ersatzteilhaltung zur Verfügung<br />
stellt (für 2012 nur 1 Mio. Kuna statt<br />
der beantragen 12 Mio. Kuna) kommt es<br />
dennoch immer wieder zu Engpässen am<br />
Fahrzeugsektor, da schadhafte oder verunfallte<br />
Wagen oft monatelang auf ihre Ausbesserung<br />
warten müssen. So beträgt beispielsweise<br />
die Lieferzeit einer Front- oder<br />
Heckscheibe eines T3PV.O bis zu acht Wochen<br />
und aus Kostengründen können solche<br />
Teile nicht auf Lager gelegt werden.<br />
Weitgehend unkompliziert zu warten und<br />
zu reparieren sind dagegen die GT6, die aber<br />
wegen des höheren Stromverbrauchs (Stromrückspeisung<br />
bei den T3PV.O!) nur in zweiter<br />
Linie zum Einsatz kommen. Dennoch<br />
kann man aber an Schultagen auf der Linie<br />
1 mit bis zu fünf und während der Schulferien<br />
mit bis zu drei GT6 rechnen. An Samstagen,<br />
Sonn- und Feiertagen werden ausschließlich<br />
T3PV.O verwendet.<br />
Mit 1. September 2008 führte der Verkehrsbetrieb<br />
GPP (Gradski prijevoz putnika)<br />
das elektronische Fahrkartensystem „Butra“<br />
mit Chipkarten und Lesegeräten ein. Lesegeräte<br />
gibt es nur beim vorderen Einstieg der<br />
Triebwagen und der Fahrer überwacht das<br />
ordnungsgemäße Entwerten der Karten. Einzelfahrscheine<br />
zum erhöhten Tarif von 10<br />
Kuna (EUR 1,33) können auch beim Fahrer<br />
erworben werden. Das Zusteigen ist daher<br />
nur vorne gestattet, was bei stark frequentierten<br />
Haltestellen oft zu minutenlangen<br />
Aufenthalten und letztlich zu unregelmäßigen<br />
Intervallen am gesamten Streckennetz<br />
führt. Ein Einzelfahrschein ist 45 Minuten<br />
lang gültig und berechtigt innerhalb dieser<br />
Zeitspanne auch zum Umsteigen bzw. zur<br />
Rückfahrt. Leider kennt das System keine Tages-<br />
bzw. 24-Stunden-Karten.<br />
Bei der Fahrgastinformation wird keine<br />
klare Linie verfolgt: Während die meisten<br />
Haltestellen frei von jeglicher Information<br />
sind, gibt es auf der Homepage des Verkehrsbetriebs<br />
eine interaktive Karte, die nicht<br />
nur den genauen Standort jedes Kurses anzeigt,<br />
sondern auch Auskunft über die aktuelle<br />
Fahrgeschwindigkeit, die Entfernung<br />
und die Fahrzeit bis zur nächsten Haltestelle<br />
sowie über Wagentype und Betriebsnummer<br />
gibt. Die Informationen sind unter<br />
www.gpp-osijek.com/gppmap/ abrufbar,<br />
wobei für die Linie 1 „T1“ bzw. „T2“ (getrennte<br />
Karten für die beiden Fahrtrichtungen)<br />
und für die Linie 2 „T513“ auszuwählen<br />
ist.<br />
WOLFGANG KAISER<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
35
Betriebe<br />
Per Tram in die Zukunft<br />
In Dijon ist es am<br />
Morgen des 2. September<br />
2012 an der<br />
Haltestelle Univer -<br />
sité noch ruhig.<br />
Nach 51 Jahren<br />
kehrte am Vortag<br />
die Tram in die<br />
Hauptstadt des<br />
Burgunds zurück,<br />
am 8. Dezember<br />
2012 fand die Eröffnung<br />
der zweiten<br />
Linie statt<br />
B. KUSSMAGK<br />
36 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>
In Nizza an der Côte d’Azur gab es von 1879 bis 1953 schon Trams.<br />
Seit November 2007 verkehren nun 33 Meter lange Citadis 302 von<br />
Alstom. Aus ästhetischen Gründen fahren sie an der place Masséna<br />
mit Batteriebetrieb<br />
W. KAISER<br />
Frankreich: Nizza & Dijon<br />
Frankreich setzt auf Straßenbahnen<br />
In unserem Nachbarland<br />
erleben Trams derzeit<br />
eine Renaissance. Dabei entstehen<br />
sowohl Verlängerungen als<br />
auch ganze Betriebe neu. Sie<br />
gelten als Zeichen eines zukunftsfähigen<br />
Nahverkehrs<br />
In Frankreich stehen Trams derzeit so<br />
hoch im Kurs wie seit 100 Jahren<br />
nicht mehr. Allein 2012 haben drei<br />
Städte einen neuen Straßenbahnbetrieb<br />
eröffnet: Im Juni Brest in der Bretagne,<br />
im September die Hauptstadt der<br />
Region Burgund, Dijon, sowie jetzt im<br />
Dezember Le Havre.<br />
In der französischen Hauptstadt Paris<br />
gehen hingegen von Ende November bis<br />
Ende Dezember 2012 innerhalb von vier<br />
Wochen etwa 24 Kilometer neue Straßenbahnstrecken<br />
in Betrieb!<br />
In fünf weiteren Städten ist die Eröffnung<br />
neuer Tram-Betriebe in Vorbereitung:<br />
2013 in Tours, 2014 in Aubagne,<br />
2015 in Besancon, 2016 in Avignon sowie<br />
voraussichtlich 2018 in Caen.<br />
Die neuen Strecken in Frankreich sind<br />
für Tram-Freunde aus <strong>dem</strong> deutschsprachigen<br />
Raum ein beliebtes Reiseziel. In der<br />
Redaktion gehen fast wöchentlich interessante<br />
Aufnahmen ein – davon wollen wir<br />
Ihnen auf dieser Doppelseite ein, zwei<br />
Motive zeigen.<br />
AM<br />
Die östliche Endstelle<br />
befindet sich derzeit<br />
noch bei der<br />
Pont Michel, wo die<br />
Zweirichtungs -<br />
wagen an zwei<br />
Stumpfgleisen mit<br />
Mittelbahnsteig<br />
wenden. Das rechte<br />
Gleis wird erst <strong>nach</strong><br />
der Verlängerung<br />
für den Linienverkehr<br />
benötigt und<br />
steht für Probe- und<br />
Fahrschulfahrten zur<br />
Verfügung<br />
W. KAISER<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
37
Fahrzeuge<br />
Auf großem Rad<br />
durch Bayerns Herz<br />
Münchens Maximum-Drehgestell-Triebwagen Mit 550 Stück gab es in der bayerischen Metro -<br />
pole hinter <strong>Berlin</strong> die meisten Maximum-Triebwagen. 1898 gingen die ersten in München in Betrieb,<br />
die letztgebauten 1930. Teil 1 widmet sich der Zeit bis zum Kriegsende 1945<br />
Mit 550 Maximum-Vierachsern<br />
lag München hinter <strong>Berlin</strong> auf<br />
Platz 2, was die Stückzahl an<br />
Fahrzeugen in Deutschland betrifft.<br />
Zu<strong>dem</strong> war die bayerische Metropole<br />
im Jahre 1898 einer der ersten Besteller<br />
von Wagen mit dieser amerikanischen Drehgestellbauart<br />
überhaupt und auch derjenige,<br />
der sie 1930 als letzter in Dienst stellte.<br />
Eine Besonderheit war ab 1908 die Typenbezeichnung<br />
der einzelnen Serien mit<br />
Buchstaben und Ziffern, die eine eindeutige<br />
Zuordnung der einzelnen Bauarten ermöglichte.<br />
Den fortlaufenden Buchstaben (groß<br />
für Triebwagen, klein für Beiwagen) folgte<br />
eine durch Punkt getrennte Zifferngruppe.<br />
Dabei gibt die erste Position die Lieferserie<br />
bzw. die Ausführung des Wagenkastens an,<br />
die Ziffern <strong>nach</strong> <strong>dem</strong> Punkt die Fahrgestellbauart.<br />
Unterschiede in den Ausführungen<br />
werden innerhalb dieser Nummernblöcke<br />
fortlaufend gekennzeichnet. In dieses System<br />
waren auch die Arbeitsfahrzeuge mit einbezogen.<br />
Bei der Nummerierung ihrer Fahrzeuge<br />
war die Münchner Straßenbahn immer<br />
sehr geradlinig und Umzeichnungen<br />
blieben die große Ausnahme. Sie wurden<br />
<strong>nach</strong> Lieferungen fortlaufend aneinander gereiht.<br />
Rathgeber übernimmt Planung<br />
Mit Umstellung der Pferdebahn auf elektrischen<br />
Betrieb ab 1895 erhielt auch München<br />
zunächst eine recht geringe Zahl zweiachsige<br />
Triebwagen. Mit Ausnahme einer kleinen<br />
Serie von Neubauten 1897 wurden Beiwagen<br />
dazu aus <strong>dem</strong> vorhandenen Bestand für<br />
die Pferde- und Dampfbahn umgebaut. Es<br />
zeigte sich schon bald, dass die kleinen und<br />
38 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Maximumwagen München<br />
OBEN Triebwagen<br />
287 der Type A 4.2<br />
zeigt sich bei dieser<br />
Aufnahme der späten<br />
1940er-Jahre im<br />
Umbauzustand der<br />
1920er-Jahre mit<br />
drei großen Seitenfenstern<br />
H. ENGEL, SLG. A. REUTHER<br />
OBEN LINKS Als Friedrich Grünwald<br />
den Triebwagen 331 im Jahre 1936<br />
am Karlsplatz fotografierte, befand<br />
sich der Wagen der Type A noch<br />
weitgehend im Originalzustand.<br />
Die Typenbezeichnung war deutlich<br />
sichtbar bei allen Wagen auf einer<br />
kleinen Blechtafel am Rahmen<br />
mittig angebracht<br />
F. GRÜNWALD, BILDARCHIV VDVA (2)<br />
Als Typ D1.7. weist die kleine Tafel am Rahmen unter der Seitenwand den 1936 fotografierten<br />
Tw 496 aus. Er entstand durch Umbau eines C-Wagen von 1913 von Laternen- auf Schleppdach<br />
leistungsschwachen Zweiachser nur ungenügend<br />
in der Lage waren, das mit der Umstellung<br />
auf elektrischen Betrieb rasch steigende<br />
Fahrgastaufkommen zu bewältigen.<br />
Die in Fachzeitschriften beschriebenen großen<br />
Vierachser, die sich in Nordamerika<br />
rasch verbreiteten, fanden auch das Interesse<br />
der Münchner. So erhielt der Hauslieferant,<br />
die Waggonfabrik Josef Rathgeber in<br />
Moosach, den Auftrag, einen für Münchner<br />
Verhältnisse angepassten vierachsigen Triebwagen<br />
zu entwerfen.<br />
Der Blick der Konstrukteure richtete sich<br />
dabei auch <strong>nach</strong> <strong>Berlin</strong>, wo bereits 1897 damit<br />
begonnen worden war, derartige Fahrzeuge<br />
zu beschaffen. Das Münchner Gleisnetz<br />
mit seinen engen Radien schien für diese<br />
Wagen eher ungeeignet, das in Amerika zur<br />
Serienreife entwickelte Maximum-Traction-<br />
Untergestell versprach Abhilfe, da es mit seinen<br />
unterschiedlich großen Achsen eine bessere<br />
Anlenkung in Bogenfahrten ermöglichte<br />
und die Last des Aufbaus besser auf die<br />
Antriebsachse steuerte.<br />
Type A<br />
Nach<strong>dem</strong> die Fabrikantenfamilie Böker in<br />
Remscheid damit begonnen hatte, diese<br />
Drehgestellbauart zu importieren und über<br />
die Bergische Stahlindustrie-Gesellschaft<br />
auch in Lizenz bauen zu lassen, fiel die Entscheidung<br />
in München dafür sehr schnell.<br />
Eine erste Serie umfasste sofort 100 Triebwagen<br />
und wurde in den Jahren 1898/99 geliefert<br />
(Nr. 51 bis 150).<br />
Im Vergleich zu amerikanischen Wagen und<br />
auch den in späteren Jahren für andere Betriebe<br />
in Deutschland gebauten Maximum-Vierachser<br />
waren die Münchner Fahrzeuge zunächst<br />
recht kurz. Nur neun Meter maßen sie in den<br />
ersten zehn Jahren ihrer Anschaffung. Die Breite<br />
betrug 2,10 Meter. Als große Besonderheit<br />
im deutschen Waggonbau hatten die Fahrzeuge<br />
von Beginn an geschlossene Plattformen.<br />
Der Fahrgastraum war mit sechs gleichgroßen<br />
Bogenfenstern ausgestattet, in den Trennwänden<br />
zur Plattform befand sich eine Schiebetüre,<br />
die nicht mittig sondern asymetrisch zur<br />
Seitenwand hin verschoben war. Im Bereich<br />
dieser Türe ragten auch die Längsbänke nicht<br />
bis an die Trennwand heran. Es fanden 22 Personen<br />
Sitzgelegenheit, die Zahl der möglichen<br />
Stehplätze war mit 18 festgelegt.<br />
Die elektrische Ausrüstung lieferte die<br />
Union Elektrizitäts-Gesellschaft (UEG). Die<br />
zwei Motoren zu je 25 kW boten eine nur<br />
mäßige Antriebsleistung. Für den Beiwa-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
39
Fahrzeuge<br />
Für München gebaute Maximum-Wagen<br />
genbetrieb konnten nur die leichten aus Pferdebahnwagen<br />
umgerüsteten Fahrzeuge verwendet<br />
werden und dies auch nur auf Strecken<br />
ohne Steigungen. Gebremst wurde mit<br />
Druckluft, die Einrichtungen für den Kompressor<br />
samt Luftbehälter befanden sich unter<br />
<strong>dem</strong> Fahrzeugboden. Das Gewicht der ab<br />
Seitenansicht der<br />
Type A in der Originalausführung<br />
mit sechs kleinen<br />
Seitenfenstern<br />
SLG. AXEL REUTHER (2)<br />
Type A <strong>nach</strong> Umbau<br />
eines Teiles<br />
der Wagen auf<br />
drei große Seitenfenster<br />
(Type<br />
A3.1/A4.1)<br />
Stück Baujahr Hersteller E-Teil Wagennummern Bemerkungen<br />
100 1898/99 Rg/BIG U/A/B 51–150 Type A 1.1, 51-100 1908<br />
UN = 301-350<br />
150 1899-02 Rg/BIG U/A/B 151–300 Type A 2.2<br />
5 1908 Rg/BIG AEG 375–379 Type B 1.3, zunächst Lenk-2 x<br />
45 1908 Rg/BIG AEG 380–424 Type B 2.3<br />
10 1910 Rg/BIG SSW 425–434 Type C 1.4<br />
10 1910 MAN/TB B 435–444 Type C 4.5<br />
12 1911 Li/TB B 445–456 Type C 3.5<br />
38 1911 Rg/MAN SSW 457–494 Type C 1.6<br />
1 1912 Rg/MAN SSW 495 Type D 1.6, Ausst.-Tw<br />
3 1913 Rg/MAN SSW 503–505 Type C 2.7<br />
27 1913 Rg/BIG A/S/B 496–502, 506–525 Type C 2.4<br />
60 1925/26 LHW SSW 526–585 Type E 2.8<br />
20 1925 MAN SSW 586–605 Type E 1.8<br />
20 1926 SD SSW 606–625 Type E 3.8<br />
8 1926 MAN SSW 4–11 Type P 2.8 Posttriebwagen<br />
1 1929 MAN S/A/B 626 Type F 1.9<br />
40 1929/30 HAWA B 627–666 Type F 2.10<br />
550 gesamt<br />
Abkürzungen: Rg: Rathgeber, BIG: Bergische Industrie-Gesellschaft, TB: Trelenberg, Li: Lindner, SD: Schöndorff<br />
U: UEG, A: AEG, B: Bergmann, S: Siemens<br />
1908 als Type A1.1 bezeichneten Serie betrug<br />
zwölf Tonnen.<br />
In den Jahren 1899 bis 1902 folgten weitere<br />
150 weitgehend gleichartige Fahrzeuge<br />
(Nr. 151 bis 300). Sie wiesen im Zusammenbau<br />
einige <strong>nach</strong> Außen nicht sichtbare<br />
Verbesserungen auf, was sie um 100 Kilogramm<br />
gegenüber der Erstlieferung schwerer<br />
machte. Ab 1908 erhielten sie die Typenbezeichnung<br />
A2.2.<br />
Mit der beachtlichen Stückzahl von 250<br />
vierachsigen Triebwagen standen bis in das<br />
erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts für<br />
die Bedienung des wachsenden Netzes ausreichend<br />
Fahrzeuge zur Verfügung.<br />
Type B<br />
Die vollständige Übernahme der bisherigen<br />
Aktiengesellschaft als stadteigenen Betrieb<br />
machte Mitte 1907 den Weg frei für einen<br />
großzügigen Ausbau des Streckennetzes. Dies<br />
zog auch Bedarf an neuen Fahrzeugen <strong>nach</strong><br />
sich, so dass zur Lieferung 1908 bei Rathgeber<br />
50 weitere Triebwagen bestellt wurden.<br />
Die Firma Hermann-Heinrich Böker in<br />
Remscheid bot neu zweiachsige Lenkuntergestelle<br />
an, die es ermöglichen sollten, Wagenkästen<br />
von gleicher Länge wie die Vierachser<br />
darauf zu setzen, was eine erhebliche Ersparnis<br />
an Kosten und Wartung versprach. Neben<br />
einer Serie von 45 Maximumwagen (Nr. 380<br />
bis 424) kamen zu Versuchszwecken auch fünf<br />
Zweiachser (Nr. 375 bis 379) zur Ablieferung.<br />
Die Unterbrechung der Nummernfolge erklärt<br />
sich aus der Umnummerierung der Fahrzeuge<br />
mit bisher zweistelligen Nummern in 301<br />
bis 350 (ex 4x-Tw 51 bis 100) und 351 bis 374<br />
(ältere Zweiachser). Die Lenkzweiachser, bezeichnet<br />
als Type B 1, hatten eine Länge von<br />
9,10 Metern. Ihr Platzangebot mit 22 Sitz- und<br />
22 Stehplätzen war vergleichbar mit den Vierachsern.<br />
Die elektrische Ausrüstung stammte<br />
nun von AEG, welche die UEG im Jahre 1904<br />
übernommen hatte. Zwei Motoren à 36 kW<br />
boten eine erheblich größere Leistung und<br />
machte den Einsatz mit Beiwagen leichter. Die<br />
45 als Type B 2.3 bezeichneten Maximum-<br />
Vierachser hatten zwar die gleichen Abmessungen<br />
wie die Type A, wiesen aber einige Veränderungen<br />
auf. Geändert waren die Form und<br />
Einteilung der Fenster im Fahrgastraum mit<br />
zwei kleinen zu den Enden hin und zwei großen<br />
dazwischen und die nunmehr gerundeten<br />
Plattformen. Lieferant der Fahrwerke war hier<br />
ebenfalls Böker, der sie zumeist im Original<br />
aus den Vereinigten Staaten importierte. Auch<br />
hier war die Motorleistung auf 2 x 36 kW erhöht<br />
worden. Mit 12,5 Tonnen wogen sie genauso<br />
viel wie die Lenkzweiachser. Deren Erfolg<br />
im täglichen Betrieb lässt sich am besten<br />
daran ablesen, dass der erste bereits ein Jahr<br />
später ebenfalls Maximum-Untergestelle bekam,<br />
während die Restserie im Jahr darauf entsprechend<br />
umgerüstet wurde. Die an die Lieferung<br />
B 2.3 angepassten Wagen erhielten nun<br />
die Bezeichnung B 1.3.<br />
Type C<br />
Das ständig steigende Fahrgastaufkommen<br />
war mit einer zunehmenden Zahl eingesetzter<br />
Triebwagen nicht sinnvoll zu bewältigen,<br />
da die Hauptachsen eine Vermehrung der<br />
40 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Maximumwagen München<br />
Offensichtlich während<br />
einer Ausstellung<br />
ist dieses Bild<br />
mit zwei Posttriebwagen<br />
des Jahres<br />
1926 entstanden,<br />
da zusätzlich auch<br />
noch Wagen anderer<br />
Städte zu erkennen<br />
sind. Das Arrangement<br />
mit den<br />
geöffneten Seitenrollos<br />
gibt einen guten<br />
Eindruck von<br />
der Nutzung der<br />
Postwagen<br />
SLG. P. H. PRASUHN,<br />
SLG. AXEL REUTHER<br />
Zugzahlen kaum noch zuließen. Der Betrieb<br />
beschloss daher ab 1910, verstärkt zur Zugbildung<br />
mit Beiwagen überzugehen. Dazu<br />
waren nicht nur neue, leichte zweiachsige<br />
Beiwagen zu beschaffen, sondern auch die<br />
Motorleistung der vorhandenen und zukünftig<br />
zu beschaffenden Triebwagen so zu<br />
erhöhen, dass sie in der Lage waren, bis zu<br />
zwei Beiwagen zu ziehen. Dem Vorhaben der<br />
Erhöhung der Motorleistung kam auch der<br />
Umstand entgegen, dass es der technische<br />
Fortschritt ermöglichte, nunmehr auch Motoren<br />
höherer Leistung in einer Größe zu<br />
bauen, welche in die vorhandenen Maximumgestelle<br />
passte. In den Jahren 1910 bis<br />
1913 wurden daher nicht nur über 200 zweiachsige<br />
Beiwagen von verschiedenen Herstellern<br />
beschafft, sondern auch die Vierachser<br />
der Baureihe A mit neuen, nunmehr<br />
45 kW leistenden Motoren ausgestattet.<br />
1911 erstmals MAN-Fahrgestelle<br />
Die Neulieferungen der Jahre 1910 bis 1913<br />
fielen mit 101 Einheiten vergleichsweise bescheiden<br />
aus, zumal sie sich auch noch auf<br />
mehrere kleinere Lieferlose verteilten und<br />
verschiedene Hersteller zum Zuge kamen.<br />
Den Anfang machte 1910 Rathgeber mit einer<br />
Lieferung von zehn Wagen (Nr. 425 bis<br />
434). Sie waren erstmals zehn Meter lang<br />
und hatten im Fahrgastraum Querbänke für<br />
insgesamt 24 Personen, deren Sitzlehnen<br />
<strong>nach</strong> Fahrtrichtung umklappbar waren. Die<br />
als Type C1.4 bezeichneten Triebwagen besaßen<br />
weiterhin die bekannten Böker-Fahr-<br />
Type B mit abgerundeten<br />
Plattformen<br />
und vier<br />
Seitenfenstern<br />
Typ C mit achtfenstrigem Wagenkasten SLG. AXEL REUTHER (2)<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
41
Fahrzeuge<br />
Im November 2008 leuchtet die tief stehende Herbstsonne das Fahrwerk des Tw 490 gut aus.<br />
Die Menge der Mitfahrenden zeigt die hohe Attraktivität des Museumswagens P. SCHRICKER<br />
Type C4.5 von MAN mit abweichender Fensteranordnung und Trelenberg-Untergestellen; die<br />
C-Wagen besaßen Quersitze, z.T. mit <strong>nach</strong> Richtungen umklappbaren Rückenlehnen<br />
Seitenansicht des Einzelstücks D1.6. Er diente später als Büchereiwagen SLG. AXEL REUTHER (2)<br />
Erhaltene Fahrzeuge<br />
Nummer Typ Bemerkung<br />
Tw 256 Type A2.2 Zustand 1926, Rath -<br />
geber 1901<br />
Tw 490 Type D6.3 Zustand 1960er-Jahre,<br />
Neuaufbau 1955,<br />
Rathgeber 1911<br />
Tw 539 Type E2.8 Zustand 1960er-Jahre,<br />
LHW 1925/26<br />
Tw 624 Type E3.8 Zustand 1960er-Jahre,<br />
Schöndorff 1926<br />
Tw 670 Type G1.8 Zustand 1960er-Jahre,<br />
Neuaufbau 1944,<br />
LHW 1925/26<br />
Atw 2973 Type G1.8 Zustand 1970er-Jahre,<br />
Neuaufbau 1944, LHW<br />
1926<br />
gestelle, der Fahrgastraum hatte aber nun<br />
acht Fenster, wobei die beiden zu den Plattformen<br />
hin gelegenen etwas größer waren<br />
als die sechs dazwischen befindlichen. Mit<br />
14,5 Tonnen waren sie zwei Tonnen schwerer<br />
als ihre Vorgänger. Mit 2 x 45 kW waren<br />
sie so gut motorisiert, dass das Mitführen<br />
von zwei zweiachsigen Beiwagen kein<br />
Problem darstellte. Der Lieferant der elektrischen<br />
Ausrüstung hatte bei dieser Serie gewechselt<br />
– sie stammte von den Siemens-<br />
Schuckertwerken (SSW).<br />
Für eine weitere Serie von zehn Triebwagen<br />
(Nr. 435 bis 444) im gleichen Jahr wurde<br />
die Münchner Straßenbahn ihrem Hauslieferanten<br />
Rathgeber erstmals untreu, die<br />
als Type C4.5 bezeichneten Wagen kamen<br />
von MAN. Die von den Eisenwerken Trelenberg<br />
in Breslau zugelieferten Maximumgestelle<br />
waren von einer leicht abweichenden<br />
Bauart. Im Innenraum gab es weiterhin<br />
Quersitze für 24 Reisende, der Wagenkasten<br />
war aber nur fünffenstrig, wobei die zu den<br />
Plattformen hin liegenden Fenster dieses Mal<br />
kleiner waren als die drei innen liegenden.<br />
Die elektrische Ausstattung lieferte Bergmann<br />
in <strong>Berlin</strong>, 2 x 45 kW waren auch hier<br />
Standard. Die 50 Triebwagen des Baujahres<br />
1911 entsprachen in Maßen und Fensteranordnung<br />
wieder der Type C1.4 mit<br />
achtfenstrigem Fahrgastraum. Die ersten<br />
zwölf Wagen (Nr. 445 bis 456) lieferte Lindner<br />
in Ammendorf, die Untergestelle kamen<br />
von Trelenberg und die elektrische Ausrüstung<br />
steuerte Bergmann bei. Die Typenbezeichnung<br />
lautete hier C3.5.<br />
Auch die 38 im gleichen Jahr mal wieder<br />
bei Rathgeber gefertigten Einheiten (Nr. 457<br />
bis 494) der Type C1.6 gehörten zur achtfenstrigen<br />
Bauform. Die Fahrgestelle lieferte<br />
bei dieser Serie erstmalig MAN zu, damit<br />
kam die in Nürnberg entwickelte Bauart mit<br />
Pressträgern und Blattfedern erstmals auch<br />
in München zur Verwendung. Bei den ersten<br />
zwölf Tw kam die Ausrüstung von SSW,<br />
die übrigen bestückte die AEG.<br />
Nachschub im Jahre 1930<br />
Ehe die Modernisierung und Erweiterung<br />
des Fahrparks der Münchner Straßenbahn<br />
durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges<br />
für zwölf Jahre stockte, konnte der Bestand<br />
1913 noch einmal durch 30 Maximum-<br />
Triebwagen (Nr. 496 bis 525) aufgestockt<br />
werden. Von der Bauform des Wagenkastens<br />
entsprachen sie <strong>dem</strong> Rathgeber-Achtfenstertyp<br />
mit Quersitzen, bei den Drehgestell<br />
und der elektrischen Ausrüstung gab es aber<br />
Unterschiede. Drei Stück besaßen MAN-<br />
42 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Maximumwagen München<br />
Drehgestelle, Elektrik von SSW und liefen<br />
als Type C2.7. Bei den übrigen 27 Wagen<br />
war der Betrieb wieder zur Ausrüstung mit<br />
den ursprünglichen Böker-Gestellen <strong>nach</strong><br />
Brill-Vorbild zurückgekehrt, weshalb sie als<br />
C2.4 bezeichnet wurden. Die elektrische<br />
Ausstattung verteilte sich auf die Lieferanten<br />
AEG, Bergmann und Siemens, allen gemeinsam<br />
war eine Motorleistung von 2 x 45<br />
kW und ein Gewicht von 14,6 Tonnen. Bei<br />
den drei Tw mit MAN-Gestellen (Nr. 503 bis<br />
505) erfolgte 1924 ein Nummerntausch mit<br />
den Wagen 496 bis 498.<br />
Das Einzelstück D<br />
Ab 1912 bereicherte ein Einzelstück den<br />
Bestand an vierachsigen Maximumwagen<br />
(Nr. 495) in Form eines ebenfalls zehn Meter<br />
langen aber mit sechs gleichgroßen Seitenfenstern<br />
ausgestatteten Wagens von Rathgeber<br />
und Fahrgestellen der MAN. Er war<br />
von den Herstellern als Referenzwagen für<br />
eine Ausstellung gebaut und <strong>nach</strong> deren<br />
Ende von der Stadt München gekauft worden.<br />
Er verfügte im Innenraum wieder über<br />
Längsbänke. Die Typenbezeichnung lautete<br />
D1.6, zeitweise war er als Sonderfahrzeug<br />
X1.6 bezeichnet. 1928 entstand aus diesem<br />
Wagen eine „Wanderbücherei“ der Stadt<br />
München. Neben München besaß nur noch<br />
Budapest eine derartige Einrichtung. Er wurde<br />
<strong>nach</strong> einem festen Plan im Netz stundenweise<br />
aufgestellt. Die Typenbezeichnung lautete<br />
nun WB 1.6, <strong>nach</strong> der Modernisierung<br />
1959 geändert in WB 1.3. Im April 1970 löste<br />
ein Gelenkbus diese Rarität ab, das Fahrzeug<br />
kam später ins Straßenbahnmuseum<br />
Hannover.<br />
Aus der letzten Lieferung von Maximumwagen an München in den Jahren 1929/30 stammt der<br />
Triebwagen der Type F mit fünf Seitenfenstern. Die Bogenfahrt lässt einen schönen Blick auf die<br />
ausgestellten Maximum-Untergestelle zu<br />
F. GRÜNWALD, SLG. P. BOEHM, ARCHIV A. REUTHER<br />
Seitenansicht eines<br />
zur Type D umgebauten<br />
C-Wagens<br />
mit Schleppdach<br />
SLG. AXEL REUTHER (3)<br />
Seitenansicht der<br />
Type E mit sechs<br />
gleichgroßen Fenstern.<br />
Die Plattformen<br />
waren erstmalig<br />
mit Türen<br />
vollständig verschließbar<br />
Seitenansicht der<br />
Type F der Jahre<br />
1929 mit fünf Fenstern<br />
in unterschiedlicher<br />
Größe im Lieferzustand<br />
Umbauten der Type A<br />
und neue Type E<br />
1920 begann in den Werkstätten der städtischen<br />
Straßenbahn ein Umbau des Wagenkastens<br />
der Erstlieferung, bei <strong>dem</strong> die sechs<br />
kleinen Seitenfenster in drei große umgewandelt<br />
wurden. Die Fahrzeuge gewannen<br />
dadurch ein eleganteres Aussehen. Durch<br />
den Umbau wechselte auch die Typenbezeichnung,<br />
aus A1.1 wurde A3.1 und A2.2<br />
zu A4.2.<br />
Erst Mitte der 1920er-Jahre erlaubten es<br />
die gefestigten wirtschaftlichen Verhältnisse<br />
wieder, neue Fahrzeuge anzuschaffen. Der<br />
Nachholbedarf war auf Grund der langen<br />
Beschaffungspause hoch und es wurden mit<br />
einem Schlag 100 vierachsige Trieb- und 200<br />
dazu passende zweiachsige Beiwagen bestellt.<br />
Sie sollten ebenfalls wieder als Dreiwagenzüge<br />
auf stark belasteten Linien eingesetzt<br />
werden.<br />
Eigentlich war der Maximumwagen zum<br />
Zeitpunkt der Bestellung technisch nicht<br />
mehr auf der Höhe der Zeit, denn die Fortschritte<br />
im Motorenbau erlaubte es mittlerweile,<br />
gleichrädrige Fahrzeuge mit vier kleinen<br />
Antrieben auszustatten und damit ein<br />
besseres Fahrverhalten zu erreichen. Die<br />
Münchner Straßenbahn war aber mit ihren<br />
Maximumwagen zufrieden und sah bei<br />
Fahrzeugen mit anderen Drehgestellen Probleme<br />
beim Durchfahren von sehr engen<br />
Gleisbögen, was entsprechende Einsatzbeschränkungen<br />
zur Folge gehabt hätte. Daher<br />
blieb es auch bei den 100 neuen Triebwagen<br />
beim Maximumgestell. Drei verschiedene<br />
Waggonfabriken beteiligten sich am Bau; 20<br />
Triebwagen (Nr. 586 bis 605) der Type E1.8<br />
lieferte 1925 die MAN, 60 Einheiten (Nr.<br />
526 bis 585) 1925/26 Linke-Hofmann-<br />
Lauchhammer in Breslau als Type E2.8 und<br />
schließlich 20 Stück (Nr. 606 bis 625) im<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
43
Fahrzeuge<br />
Triebwagen 564 gehört zur sechsfenstrigen Type E aus den Jahren 1925/26. Die aufgesteckte<br />
kleine Ziffer über der Stirnlampe ist die Kursnummer. Der achte Zug der Linie 6 wurde 1936<br />
von Friedrich Grünwald am Karlsplatz aufgenommen<br />
FRIEDRICH GRÜNWALD, BILDARCHIV VDVA<br />
Im November 2008 fanden anlässlich des<br />
100. Jubiläums der Tram <strong>nach</strong> Pasing Sonderfahrten<br />
mit <strong>dem</strong> Museumswagen 490<br />
statt, der hier gerade die Haltestelle Westbad<br />
in Richtung Willibaldplatz verlässt<br />
P. SCHRICKER<br />
Quellen<br />
Um einen 1944 neuaufgebauten Wagen vom Typ G1.8 handelt es sich beim Münchner Museumswagen<br />
Tw 670, hier 2009 im Trambahnmuseum in der Ständlerstraße. Auf den Nachkriegseinsatz<br />
der Maxiumwagen geht der Teil 2 im nächsten Heft ein<br />
A. REUTHER<br />
div. Autoren: 100 Jahre Münchner Strassenbahn,<br />
München 1972<br />
Höltge, D. u. a.: Straßen- und Stadtbahnen in<br />
Deutschland, Band 10, Freiburg 2006<br />
Koffmann, J. L.: Das Maximum-Drehgestell, in:<br />
Straßenbahn-Magazin 13, 08/1974<br />
Koffmann, J. L.: John A. Brills Maximum Traction<br />
Drehgestell, in: Der Stadtverkehr, Heft 10/1978<br />
Sappel, A.: Städtische Straßenbahn München,<br />
Villigen AG (CH) 1979<br />
Jahre 1926 die Gebrüder Schöndorff in Düsseldorf<br />
als Type E3.8.<br />
Die Maße aller Wagen waren identisch:<br />
Länge 10,84 Meter, Breite 2,05 Meter, Gewicht<br />
16,5 Tonnen. Die elektrische Ausrüstung<br />
kam für alle Wagen von Siemens-Schuckert<br />
und mit 2 x 60 kW waren die neuen<br />
Vierachser erheblich besser motorisiert. Der<br />
Innenraum hatte einen Wagenkasten mit<br />
sechs gleichgroßen Seitenfenstern und Längsbänke<br />
für 28 Personen. Die Plattformen waren<br />
hier erstmals mit Schiebetüren vollständig<br />
zu verschließen.<br />
Umbau der Type C in die Type D<br />
In den Jahren 1926 bis 1931 durchliefen die<br />
Wagen der Type C ein Modernisierungsprogramm,<br />
was nicht nur zu einem Wechsel<br />
der Ziffern bei der Typisierung, sondern<br />
auch zu einem neuen Gattungsbuchstaben<br />
führte. Dabei wurden die bisher auf den Innenraum<br />
beschränkten Laternendächer zu<br />
Schleppdächern bis zu den Fronten hin verlängert.<br />
Auf der Front gab es ein neues Liniennummernschild<br />
in einem Kasten, welches<br />
von innen zu beleuchten war. Die<br />
Fahrzeuge erhielten auch neue stärkere Motoren,<br />
wobei auch der Hersteller wechselte:<br />
C1.4 wurde zu D3.4 mit 55-kW-Motoren<br />
von Bergmann, C1.6 zu D2.6 ebenfalls mit<br />
Bergmann-55-kW-Motoren, C4.5 zu D5.5<br />
mit AEG-Motoren von 71 kW, C3.5 zu D4.5<br />
behielten Bergmann-Ausstattung bekamen<br />
aber 55-kW-Antriebe. Aus C2.7 wurden<br />
D1.7 mit 55-kW-Bergmann-Motoren und<br />
C2.4 erhielten als D1.4 ebenfalls Bergmann-<br />
55-kW-Antriebe. Aus <strong>dem</strong> ursprünglich den<br />
Buchstaben D belegenden Probewagen von<br />
1912 war bereits 1924 ein Arbeitswagen geworden.<br />
Nach Abschluss der Umbauten war<br />
1931 die Typengruppe C verschwunden.<br />
Letzte Neubauten: Type F<br />
Ende der 1920er-Jahre waren die ersten Vierachser<br />
am Ende ihrer Lebensdauer angelangt<br />
und die weitere Verkehrszunahme machte<br />
Verstärkungen notwendig. Um geplante<br />
Neuerungen, besonders im Innenraum, erproben<br />
zu können, entstand 1929 zunächst<br />
ein Probwagen (Nr. 626). Das Fahrgestell lieferte<br />
MAN, eine Münchner Karosseriefirma<br />
für Autobau fertigte den hölzernen Wagenkasten.<br />
Die Wagenlänge betrug 10,60 Meter,<br />
die Breite war auf 2,15 Meter vergrößert<br />
worden. Der Innenraum hatte eine Einrichtung<br />
aus Quer- und Längsbänken mit 26<br />
Sitzgelegenheiten und fünf Seitenfenster in<br />
44 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
zwei Größen. Zwei SSW-Motoren zu je 60<br />
kW trieben ihn an. Mit <strong>dem</strong> als F1.9 bezeichneten<br />
Wagen kehrte man zum traditionellen<br />
blau-weißen Anstrich zurück, <strong>nach</strong><strong>dem</strong><br />
die Lieferungen ab 1908 ganz in blau<br />
mit weißen Fensterrahmen angestrichen hatte.<br />
Den Auftrag für die Serienlieferung erhielt<br />
die Hannoversche Waggonfabrik. Von<br />
dort wurden bis 1930 40 Triebwagen (Nr.<br />
627 bis 666) mit elektrischer Ausrüstung von<br />
Bergmann geliefert, welche die Typenbezeichnung<br />
F 2.10 erhielten. Damit war die<br />
Lieferung von Maximum-Triebwagen in<br />
München <strong>nach</strong> 31 Jahren abgeschlossen. Insgesamt<br />
wurden 542 Einheiten gebaut.<br />
Die Münchner Vierachser erfuhren im Laufe<br />
ihres weiteren Lebens eine Vielzahl von<br />
Umbauten, von denen hier aus Platzgründen<br />
nur die wichtigsten genannt werden können.<br />
Entsprechend den Vorgaben des Bezeichnungsschemas<br />
war damit auch immer die Einordnung<br />
in eine neue Baureihe verbunden.<br />
Umbau von A-Wagen<br />
zu Zwillingswagen<br />
Eine besondere Bauform stellten die in den<br />
Jahren 1936/37 aus vier Triebwagen der Type<br />
A entstandenen zwei Zwillingstriebwagen der<br />
Type Z4.2 dar (Nr. 351“ und 352“). Dabei<br />
wurde bei den Vierachsern jeweils eine Plattform<br />
abgetrennt und die Wagen Heck an Heck<br />
gekuppelt. Für den Schaffner entstand ein<br />
Übergang, der mit einem Faltenbalg verkleidet<br />
wurde. Durch diesen Umbau sollte es möglich<br />
werden, dass zwei Wagen durch einen<br />
Schaffner bedient werden konnte. Die beiden<br />
Pärchen waren, da beide Hälften angetrieben,<br />
gut motorisiert. Der Stangenstromabnehmer<br />
wurde je <strong>nach</strong> Richtung auf <strong>dem</strong> vorderen<br />
oder hinteren Wagen angelegt. Da die Bedienung<br />
von zwei Wagen durch nur einen Schaffner<br />
in der Praxis nicht funktionierte, schloss<br />
man später die Übergangstüren und entfernte<br />
den Faltenbalg. Dieser hatte sich auch beim<br />
Anlegen des Stangenstromabnehmers als äußerst<br />
hinderlich erwiesen. Ein Zug erlitt<br />
Kriegsschaden, der zweite wurde noch bis<br />
1954 und in den letzten Jahren als Personalzug<br />
der Hauptwerkstätte verwendet.<br />
Wiederaufbauten der Type G<br />
Bereits 1943 wurden zahlreiche Fahrzeuge bei<br />
Bombenangriffen stark beschädigt. 19 Vierachser<br />
der Type E erhielten darauf hin im<br />
Reichsbahn-Ausbesserungswerk (RAW) Neuaubing<br />
einen neuen Wagenkasten. Sie erhielten<br />
die Typenbezeichnung G1.8 und eine an<br />
die Reihe F anschließende eigene Nummerngruppe<br />
(Nr. 667 bis 685). Besonders Merkmal<br />
dieser Fahrzeuge war das bis an die Plattformenden<br />
durchgezogene Laternendach mit der<br />
das Ende des Daches integrierten Zielbeschilderung.<br />
Im Inneren gab es keine Trennwände<br />
zu den Plattformen und nur wenige Sitzgelegenheiten<br />
auf Längsbänken an den Plattformseiten<br />
des Fahrgastraumes. Damit sollte ein<br />
hohes Stehplatzangebot erreicht werden.<br />
wird fortgesetzt · AXEL REUTHER<br />
»Erfahre München!«, so heißt das<br />
neue Spiel der MVG, und so lautet<br />
auch die Aufgabe für zwei bis fünf<br />
Spieler ab 10 Jahren. Jeder Spieler<br />
muss mit seiner Tram einen<br />
geheimen Streckenauftrag verfolgen<br />
und sich den Schienenweg<br />
zum Ziel legen. Beim Bauen können<br />
aber andere Weichensteller<br />
in die Quere kommen ...<br />
Das unterhaltsame Brettspiel von<br />
Spieleautor Stefan Dorra wurde<br />
speziell für München und die<br />
Münchner Verkehrsgesellschaft<br />
(MVG) weiterentwickelt und<br />
be sticht durch eine detailreiche,<br />
liebevolle Gestaltung sowie eine<br />
hochwertige Verarbeitung.<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Fahrzeuge<br />
Von hinten schauen wir uns den Kasseler Tw 260 mit seiner „Sänfte“ in der Mitte an der Endstelle Baunatal an<br />
»Schüttelrutschen«<br />
und »Schaukelpferde«<br />
Tram-Raritäten der frühen 1980er-Jahre In den 1950er- und 1960er- Jahren<br />
waren in vielen westdeutschen Betrieben zwei- und vierachsige Fahrzeuge<br />
zu Gelenkwagen umgebaut worden. Andreas Mausolf stellt die letzten Einsätze<br />
dieser Fahrzeuge in Bielefeld, Mülheim, Duisburg, Wuppertal und Kassel vor<br />
Mit <strong>dem</strong> Blick auf einen wirtschaftlich<br />
effektiveren Wageneinsatz<br />
sowie einen „optimierten<br />
Personalschlüssel“ gingen viele<br />
Trambetriebe in den 1950er- und 1960er-<br />
Jahren daran, zwei- und vierachsige Fahrzeuge<br />
in Gelenkwagen umzubauen. Diese<br />
verschnörkelten Formulierungen findet man<br />
in nahezu sämtlichen Betriebschroniken.<br />
Dahinter verbergen sich sowohl fortschreitende<br />
„Personalfreisetzung“ als auch Fehleinschätzungen<br />
davon, wie schnell und umfassend<br />
der motorisierter Individualverkehr<br />
(mIV) im wahrsten Sinne des Wortes „an Boden<br />
gewinnen“ würde. Eigentlich hätte es<br />
keine Zeit für Provisorien sein dürfen! Die<br />
Trambetriebe hätten vielmehr verstärkte Anstrengungen<br />
unternehmen müssen, um ihren<br />
Fahrgästen die gesamte Bandbreite des<br />
Dienstleistungspotentials vor Augen zu führen.<br />
Doch stattdessen wollte man durch oft<br />
recht einfache Umbauten in vielen Fällen<br />
noch die Bestellung von Neuwagen hinauszögern.<br />
Bei manchen Städten wurde dies<br />
denn auch nicht mehr nötig: Sie stellen ihren<br />
Trambetrieb ein! Aus heutiger Sicht ein großer<br />
Fehler …<br />
In dieser Zeit entstanden prägnante Einzelgänger<br />
und Kleinserien, wobei es sich um<br />
Um- und Neubauten handelte, die vor allem<br />
aufgrund ihrer Durabilität – nicht unbedingt<br />
gepaart mit Bequemlichkeit für den Fahrgast<br />
– oftmals erstaunlich lange im Einsatz blieben.<br />
Sie brachten in der ersten Hälfte der<br />
1980er-Jahre noch so manche „Farbe“ in das<br />
alltägliche Verkehrsgeschehen. Wir greifen<br />
einige Verkehrsbetriebe heraus, die besonders<br />
im Gedächtnis gebliebene Fahrzeuge<br />
einsetzten und spannen den Bogen vom Umbau<br />
zweiachsiger bis vierachsiger Fahrzeuge<br />
zu Gelenkwagen unterschiedlicher Längen.<br />
Doch wir beginnen mit einem Neubau,<br />
der eigentlich gar nicht da<strong>nach</strong> aussieht …<br />
Kassel<br />
Der Triebwagen mit der Nummer 260 war<br />
in Kassel ein Einzelgänger und Vorbild für<br />
eine abgewandelte Serienfertigung. Lediglich<br />
die Bogestra in Bochum stelle im Eigenbau<br />
eine ähnliche Serie von fünf Einheiten ab<br />
1956 her. Die <strong>dem</strong> Kasseler Tw 260 <strong>nach</strong>folgende<br />
Serie erhielt bereits ein deutlich eleganteres<br />
Äußeres. Ähnliche Wagen waren<br />
später auch in Würzburg eingesetzt.<br />
Am Kasseler Prototypen 260 – er dürfte<br />
der erste Neubaugelenkwagen Nachkriegsdeutschlands<br />
gewesen sein – wird noch die<br />
Herkunft aus der „Verbandstyp“-Philosophie<br />
deutlich. Der Wagen ging im Herbst<br />
1955 zur Bundesgartenschau in Betrieb und<br />
wurde schließlich 1983 an das DSM Hannover<br />
abgegeben, wo er erhalten ist. Die Serienfahrzeuge<br />
261 bis 288 (Bj. 1956 bis<br />
1958) fuhren bis 1991 in ihrer Heimatstadt,<br />
wobei noch zehn Einheiten <strong>nach</strong> Gorzów<br />
(Landsberg, Polen) weitergereicht werden<br />
konnten.<br />
Mülheim an der Ruhr<br />
An der Ruhr ließ man 1961 fünf Einrichtungs-Gelenkwagen<br />
mit schweben<strong>dem</strong> Mittelteil<br />
aus Fahrzeugen des Typs „KSW“ von<br />
46 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Umbauten NRW & Kassel<br />
OBEN Kassels Tw 260 im August 1981 ≠in Oberzwehren<br />
auf <strong>dem</strong> Weg zur Ottostraße. Ein gutes<br />
Jahr sollte er noch im Einsatz stehen, bevor er<br />
dann 1983 an das damalige DSM abgegeben<br />
wurde FOTOS, WENN NICHT ANDERS VERMERKT: A. MAUSOLF<br />
1948 herstellen. Die zunächst als 260 bis 264<br />
bezeichneten Einheiten erhielten später die<br />
Nr. 240 bis 244 und gingen bereits zwischen<br />
1976 und 1979 den Weg des alten Eisens.<br />
Bis auf einen Vertreter: Wagen 240 – entstanden<br />
aus den KSW-Wagen 93 und 99 –<br />
stand bis 1984 im täglichen Einsatz! Die auffälligen<br />
Fahrzeuge verkehrten zeitweise sogar<br />
mit vierachsigen Beiwagen! Unser Bild<br />
entstand im Frühjahr 1982 in Mülheim-<br />
Auf interessanten Mehrspurgleisanlagen in<br />
Mülheims Stadtmitte – auf der Normalspur<br />
verkehrt die Linie 901 aus Duisburg, während<br />
die Mülheimer Tram auf Meterspur fährt –<br />
kommt uns im Frühjahr 1982 der letzte Vertreter<br />
einer kleinen Umbauserie entgegen, die<br />
aus Kriegstraßenbahnwagen entstand<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
47
Fahrzeuge<br />
OBEN Auch dieses Mülheimer Fahrzeug hatte<br />
nur noch eine kurze Zeit im aktiven Dienst vor<br />
sich! Den zweiten Blick werfen wir auf den<br />
Wagen am Kaiserplatz, wo er mitten im abendlichen<br />
Hauptverkehrszeitentrubel steckt<br />
Stadtmitte und zeigt den Wagen im Einsatz<br />
auf Linie 114.<br />
Bielefeld<br />
Gleich zwei Stilepochen fanden sich im Bielefelder<br />
Gelenk-Triebwagen 209, der 1962<br />
bei Düwag entstand: Das Vorderteil war ein<br />
Aufbau-Triebwagen (Tw 26), das Hinterteil<br />
ein KSW-Beiwagen, der aus Solingen stammte.<br />
Ab 1968 war der Sonderling unter der<br />
Nummer 799 unterwegs. Seit 1978 stand er<br />
als Partywagen im Einsatz, brannte 1986 aus<br />
und sollte eigentlich renoviert werden. Daraus<br />
wurde nichts – am Ende ging er 1998<br />
auf den Schrott. Inzwischen verkehrt ein Düwag-Achtachser<br />
als Partytram („Sparren-Express“).<br />
Auf <strong>dem</strong> Gelände des Betriebshofes Bielefeld-Sieker steht der „Zwitter“, der sein Einsatz-<br />
„Leben“ als Partywagen beschloss. Ein Aufbau- und ein KSW-Wagen waren der Ursprung, aus<br />
<strong>dem</strong> dieses Unikum entstand<br />
Wuppertal<br />
Versuch und Irrtum: In zeitloser Design-Vollendung,<br />
technisch jedoch nie wirklich<br />
befriedigend präsentiert sich eine Düwag-Entwicklung,<br />
für die ursprünglich zur Kostenminimierung<br />
Altgestelle Verwendung finden<br />
sollten. Gerne bezeichnet als „Schüttelrutsche“<br />
oder „Sänfte“ – wobei die Bezeichnungen<br />
gegenseitiger kaum sein können –<br />
48 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Umbauten NRW & Kassel<br />
W. R. REIMANN<br />
Elegant, doch keineswegs der „große Wurf“: Die Wuppertaler „Schüttelrutschen“ überzeugten nicht, obwohl bei ihnen schon neue Fahrgestelle<br />
verwendet wurden. Das Bild oben zeigt Tw 4001 am 1. Mai 1966 unter der Schwebebahn in Wuppertal-Elberfeld, unten links fährt Tw 3407 im<br />
Jahr 1981 durch die Schwarzbach und auf <strong>dem</strong> rechten Bild hat der gleiche Tw die Haltestelle Alter Markt in Barmen soeben verlassen<br />
wurden 1961 die Wagen 4001 bis 4008 (später<br />
3401 bis 3408) als vierachsige Zweirichtungswagen<br />
hergestellt. Im Gegensatz zu<br />
1959 gefertigten, ähnlichen Fahrzeugen für<br />
Essen, die tatsächlich auf Altgestellen aufgebaut<br />
wurden und Anlass zu zahlreichen, unvermeidlichen<br />
Nachbesserungen gaben, lieferte<br />
Düwag die Wuppertaler Einheiten<br />
bereits mit neuen Fahrgestellen. Trotz<strong>dem</strong><br />
blieben die Fahrzeuge hinter den in sie gesetzten<br />
Erwartungen zurück.<br />
Vier Einheiten gingen zusammen mit der<br />
Achtachserflotte bei Einstellung der Wuppertaler<br />
Straßenbahn im Mai 1987 <strong>nach</strong><br />
Graz, wo sie jedoch nie eingesetzt und bis<br />
1990 verschrottet wurden.<br />
Eigenwillige Gelenkwagen<br />
Zurück zu den Umbauten: Nicht nur aus<br />
Zweiachsern, sondern auch aus Großraumwagen<br />
stellten Verkehrsbetriebe Gelenkwagen<br />
her. So warteten u.a. Duisburg und<br />
Wuppertal mit eigenwilligen Umbauten auf:<br />
Hier waren in unterschiedlicher Bauformen<br />
aus Vierachsern Achtachser geworden! Man<br />
sah ihnen die Herkunft anhand der Fensteraufteilung<br />
und anderer Kleinigkeiten an, was<br />
ihnen eigenwilligen Charme verlieh. Während<br />
in Wuppertal aus 16 Großraumwagen<br />
des Baujahres 1953 und 1954 zwischen<br />
1958 und 1963 von vornherein Achtachser<br />
entstanden, war die Sache in Duisburg komplizierter:<br />
Hier baute man Vierachser der<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
49
Fahrzeuge<br />
Wuppertal-Barmen: Kurz vor Stilllegung der Linie 608 ist im Juli 1984 Tw 3816 in der Schönebecker Straße unterwegs. Auch bei diesem Fahrzeug<br />
handelt es sich um einen ehemaligen Großraumwagen, der <strong>nach</strong> seinem Umbau nun noch mehr Fahrgäste aufnehmen kann<br />
LINKS Längst schon ist die Kulturstraße in Duisburg<br />
kein Linienweg mehr – im Juni 1983 war<br />
sie es noch. Und auch die Linie 904 <strong>nach</strong> Hüttenheim<br />
ist inzwischen Geschichte. Triebwagen<br />
1231 ist eines von vier Unikaten, die ursprünglich<br />
Großraumwagen waren<br />
In Wuppertal dagegen sieht es seit 1987<br />
recht düster aus. 2012 jährte sich das Ende<br />
der Straßenbahn zum 25. Male; das SM berichtete<br />
darüber. 1985 war das Ende des<br />
Trambetriebs längst absehbar, als uns Triebwagen<br />
3816 (ex Großraumwagen 1005) in<br />
Barmen auf der Linie 608 <strong>nach</strong> Langerfeld<br />
entgegenkommt.<br />
Baujahre 1952 bis 1954 zunächst im Jahre<br />
1962 in Sechsachser um, im Jahre 1974<br />
reichte auch dies nicht mehr und die Wagen<br />
wurden zu Achtachsern geadelt. Auf der<br />
Linie 904 begegnet uns im April 1984 einer<br />
von ihnen: Es ist Triebwagen 1231 – der ehemalige<br />
Großraumwagen 231 – auf <strong>dem</strong> Weg<br />
<strong>nach</strong> Hüttenheim. Er kommt uns in der Kulturstraße,<br />
seinerzeit noch Linienweg der Linie<br />
904, entgegen. Inzwischen gibt es die 904<br />
nicht mehr und auch die Kulturstraße sieht<br />
nur noch zu Aus- und Einrückfahrten des Betriebshofes<br />
Grunewald Trambahnen. Aber<br />
das ist alles halb so schlimm.<br />
Sechs Jahrzehnte im Einsatz<br />
Nach der Einstellung der Tram in Wuppertal<br />
konnten auch die Umbauwagen dieser Serie<br />
noch <strong>nach</strong> Graz veräußert werden, wo<br />
der letzte von ihnen im Mai 1997 aus <strong>dem</strong><br />
Verkehr gezogen wurde, bevor er ins dortige<br />
Trammuseum kam.<br />
Wagen 566 – ex Wuppertal 3813 und damit<br />
der ehemalige Großraumwagen 1007 –<br />
bleibt damit als anschauliches Beispiel für<br />
die Haltbarkeit von Provisorien bestehen: Er<br />
stand immerhin fast 35 Jahre als Umbauwagen<br />
im regulären Einsatz und kann – nun<br />
als Museumswagen – im Jahr 2013 in Graz<br />
seinen 60. „Geburtstag“ begehen.<br />
ANDREAS MAUSOLF<br />
50 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Exklusiv und gratis<br />
nur für Abonnenten –<br />
die Fotoedition »Die schönsten Straßenbahnen«<br />
2013 erhalten Sie als Abonnent von <strong>STRASSENBAHN</strong><br />
<strong>MAGAZIN</strong> mit jeder Ausgabe ein Exemplar der Fotoedition<br />
»Die schönsten Straßenbahnen«. Die Karten –<br />
zum Sammeln, zum Aufhängen oder Weiterverschicken<br />
– sind aus hochwertigem Chromokarton,<br />
12 x 17 cm groß und erscheinen in limitierter Auflage.<br />
Sie sind noch nicht Abonnent?<br />
Dann bestellen Sie am besten heute noch Ihr Vorteilspaket unter<br />
www.strassenbahn-magazin.de/abo Telefon 0180-532 16 17 *<br />
Fax 0180-532 16 20 *<br />
* (14 ct/min.)
Geschichte<br />
Einst<br />
&Jetzt<br />
52 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Einst & Jetzt<br />
Prag 1969: Am Karfreitagmorgen verlässt der Tw 2151 mit einem Mitteleinstiegsbeiwagen die Haltestelle Praha hlavni<br />
nadrazi (Prag Hbf). Der in der Zwischenkriegszeit gebaute Triebwagen zeigt sich mit Scherenstromabnehmern bereits<br />
recht modern. Zu diesem Zeitpunkt lief gerade die Umrüstung von Stange auf Bügel, so dass baugleiche Fahrzeuge noch<br />
mit ihrer ursprünglichen Technik unterwegs waren.<br />
Der 1969 schaffnerlos („S“) eingesetzte Tw 2151 blieb nicht erhalten, die Linie 26 gibt es hingegen bis heute. Sie fährt<br />
von Divoká Sárka zwar nicht mehr am Hauptbahnhof vorbei, bedient aber noch immer die alte Endstation am Bahnhof<br />
im Ortsteil Strasnice. Die heutige Endstation ist <strong>nach</strong> insgesamt 20 km schließlich am Bahnhof von Hostivar erreicht.<br />
Karfreitag 1969 war in der Tschechoslowakei ein normaler Arbeitstag. Am Hbf ging es dennoch recht ruhig zu. Heute<br />
befindet sich an gleicher Stelle eine vierspurige Straße, die zu überqueren zu Fuß nicht mehr möglich ist. Wo einst die<br />
Tram hielt, schwimmen heute Busse im Verkehr mit. Links des Bahnhofes befindet sich jedoch eine Grünanlage, an<br />
deren Rand heute verschiedene Prager Straßenbahnlinien halten. Von dort aus führt ein Tunnel in den Bahnhof sowie<br />
zur U-Bahn.<br />
TEXT: WOLFGANG WALPER/AM · FOTO: WOLFGANG WALPER<br />
53
Titel<br />
Anschluss unter<br />
neuer Nummer<br />
54 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
<strong>Berlin</strong><br />
Die Zusammenführung von Bus und Straßenbahn<br />
in <strong>Berlin</strong> <strong>nach</strong> 1990 Nach 1990 waren die Verkehrsnetze<br />
in der zuvor mehr als 40 Jahre politisch geteilten<br />
Stadt zusammenzuführen. Dabei kam es 1991 und<br />
1993 zu zwei tiefgreifenden Liniennetzreformen, aber<br />
auch Veränderungen im Wageneinsatz<br />
In Oberschöneweide<br />
biegt 1991 eine 88<br />
aus der Wilhelminenhofstraße<br />
in die<br />
Edisonstraße ein.<br />
Kurz da<strong>nach</strong> wurde<br />
aus ihr die 81, im<br />
Juni 1992 verschwand<br />
sie ganz<br />
B. KUSSMAGK<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
55
Titel<br />
Einstellige Liniennummern kennzeichneten bei der BVG fast immer Ringlinien.<br />
Prominenteste war der Stadtring 1, als dessen Rudiment im Fahrplan<br />
1960 die 1 (Ost) verkehrte. Bis 1920 gab es in <strong>Berlin</strong> mehrere „Einsen“,<br />
woran 1969 der HTw 10 der Cöpenicker Tram erinnerte L. HABRECHT (2)<br />
Die Linie 4 der BVB, hier 1993 auf <strong>dem</strong> Rondell des Bersarinplatzes, befuhr den Ostteil der früher<br />
Ost-West-Ring genannten alten 4. Ihr südlicher Endpunkt war <strong>nach</strong> der Netzteilung zunächst eine<br />
Kuppelendstelle im Gefälle vor <strong>dem</strong> U-Bf. Warschauer Brücke, später die Häuserblockumfahrung<br />
Revaler Straße. Beschildert wurde dieses Ziel allerdings mit „S-Bf. Warschauer Str.“ B. KUSSMAGK<br />
Vor mehr als 20 Jahren geschah im<br />
Großraum <strong>Berlin</strong> etwas in der deutschen<br />
Tramgeschichte Einmaliges:<br />
Die Zusammenführung der Verkehrsnetze<br />
in der mehr als 40 Jahre politisch<br />
geteilten Stadt. Das brachte in zwei Etappen<br />
eine Liniennetzumgestaltung bei den Oberflächenverkehrsmitteln<br />
Bus und Tram von bisher<br />
unbekanntem Umfang mit sich. Im <strong>nach</strong>folgenden<br />
Beitrag soll auf die Einzelheiten der<br />
Reform im Bereich Straßenbahn zu den beiden<br />
maßgebenden Zeitpunkten, <strong>dem</strong> 1. Juni<br />
1991 und <strong>dem</strong> 23. Mai 1993, eingegangen<br />
werden, doch ist ein Exkurs zu den anderen<br />
Verkehrsmitteln zum Verständnis des Gesamtzusammenhangs<br />
geboten. Die Veränderungen<br />
spielte sich auch für das Tramnetz<br />
<strong>Berlin</strong>s in einem Tempo ab, das der Umbruchsituation<br />
entsprach, die <strong>dem</strong> Fall des Eisernen<br />
Vorhangs und seiner wirtschaftlichen<br />
Folgen geschuldet war. Während allerdings<br />
für S-Bahn, U-Bahn und Bus sofort mit Grenzöffnung<br />
der betriebliche Handlungsbedarf in<br />
bisher nie gekannter Dimension von der<br />
Macht des Faktischen diktiert wurde, war für<br />
den Bereich Straßenbahn ein etwas planmäßigeres<br />
Vorgehen möglich, wenngleich auch<br />
die Reform schon das betriebsorganisatorisch<br />
bemerkenswerteste Ereignis der Nachwendezeit<br />
war. Eingebettet war sie in die Startphase<br />
intensiver Infrastrukturverbesserungen<br />
insbesondere an Gleis- und Fahrleitungsanlagen<br />
und der beschleunigten Erneuerung des<br />
Fahrzeugparks durch Außerdienststellung der<br />
Reko- und Gotha-Fahrzeuge<br />
Ausgangspunkt und Ziel der Reform<br />
Der Ausgangszustand waren in <strong>Berlin</strong> die gewachsenen<br />
Liniennummernsysteme der BVG<br />
in Ost und West, bei denen noch bis Mitte<br />
der 1960er-Jahre halbherzig darauf geachtet<br />
wurde, dass eine Liniennummer möglichst<br />
nicht gleichzeitig auf beiden Seiten der<br />
politischen Grenze vorkam. Für die Tram<br />
hatte sich dieses Problem mit der Einstellung<br />
des Straßenbahnverkehrs in Westberlin 1967<br />
erledigt.<br />
Zur bis 1989 üblichen Praxis im Ostteil<br />
der Stadt zählte, dass eine Liniennummer<br />
nicht bei Bus und Tram zugleich vorkam.<br />
Dafür war – anders als in West-<strong>Berlin</strong> – auf<br />
den Gebrauch des Buchstabens A zur Kennung<br />
von Buslinien im Laufe der Zeit <strong>nach</strong><br />
Abschaffung von Doppelungen (Bus und<br />
Tram) verzichtet worden.<br />
In den Randgebieten und im übrigen Brandenburg<br />
bestand im Regionalbusverkehr zunächst<br />
das bezirksweise strukturierte System<br />
der Liniennummern mit vorangestelltem<br />
Buchstaben des in der DDR üblich gewesenen<br />
Kraftfahrzeug-Kennzeichens fort. In den<br />
Städten mit Stadtverkehren gab es isolierte<br />
56 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
<strong>Berlin</strong><br />
Auf der Linie 22 waren Anfang der 1990er-Jahre Einrichtungs-Rekowagen unterwegs. Am U-Bahnhof Dimitroffstraße (heute Danziger Straße) befand<br />
sich zeitweise der Endpunkt der Linie in einer Gleisschleife mit Unterfahrung der Hochbahntrasse der heutigen U2, damals Linie A<br />
Schema mit Tücken: Die Linien 21 und 27 wurden nummernmäßig <strong>dem</strong><br />
Tangentialnetz zugeordnet, bedienen aber auch radiale Verkehre, wie<br />
diese Darstellung von 1993 belegt<br />
M. SPERL<br />
Während einer Veranstaltung in der Wuhlheide warten am 16. April 1990<br />
zwei Züge aus Einrichtungs-Rekowagen der Linie 25E und einige Gotha-Großraumzüge<br />
auf ihren Einsatz <strong>nach</strong> Schöneweide B. KUSSMAGK (2)<br />
Nummernsysteme, mit Ziffernkennzeichnung<br />
für Tramlinien und – in der Regel –<br />
Buchstabenkennzeichnung für Buslinien.<br />
Das Erfordernis, <strong>nach</strong> Überwindung der<br />
Teilung <strong>Berlin</strong>s zu einem plausiblen, kundenverständlichen<br />
und zugleich zukunftsorientierten,<br />
d. h. mit <strong>dem</strong> Umland harmonierenden<br />
System zu kommen, lag auf der<br />
Hand. Zu<strong>dem</strong> ist die Liniennummer nicht<br />
nur „Sprache“ gegenüber <strong>dem</strong> Nutzer, sondern<br />
sie wird auch in unzähligen unternehmensinternen<br />
Prozessen als eindeutiges<br />
Planungs-, Durchführungs- und Abrechnungsmerkmal<br />
benötigt.<br />
Das Reformereignis war keineswegs nur<br />
eine <strong>Berlin</strong>er und Randgebietsangelegenheit,<br />
sondern es versuchte Weichen zu stellen, für<br />
eine konsequente linienmäßige Systematisierung<br />
des gesamten Verkehrsraums beider<br />
Bundesländer. Hier vorbereitend tätig zu<br />
werden, ergab sich auch aus <strong>dem</strong> Auftrag des<br />
Einigungsvertrages, in <strong>Berlin</strong> und Brandenburg<br />
– ohne explizit zu sagen, ob hier das<br />
ganze Bundesland gemeint sein soll – einen<br />
Verkehrsverbund zu schaffen. Getragen war<br />
es – außer selbstverständlich von den Aufsichtsgremien<br />
der Betriebe – deshalb auch<br />
von Vereinbarungen zweier Unternehmensgemeinschaften,<br />
der damaligen (engeren)<br />
Verkehrsgemeinschaft in <strong>Berlin</strong>-Branden-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
57
Titel<br />
Der am 26. Mai 1901 von der GBSt eröffnete Betriebshof Niederschönhausen lag zwar peripher, war aber in der DDR-Zeit Heimat der Linien 1,<br />
3, 11, 22, 46, 49 und 70 sowie der Nachtlinie 120. Ausgelegt war er für ca. 120 Fahrzeuge. Während die Rekowagen das Farbschema der 1980er-<br />
Jahre tragen, pausiert 1990 rechts ein Schlepp-ATw der Güterlinie zum Hauptwerk des Transformatorenwerks Oberschöneweide B. KUSSMAGK<br />
Die Linien 46 und 46E wurden 1993 mit der<br />
Reform zur 52 und mit Einführung der Metrolinien<br />
zum Niederschönhausener östlichen Ast<br />
der M1. Bis zum Ersatz durch Reko-Züge bestand<br />
die typische Zugbildung aus Mitteleinstiegs-Tw<br />
und LOWA-Bw<br />
L. HABRECHT<br />
burg (ViBB) und den Omnibusbetrieben der<br />
<strong>Berlin</strong>-Umland-Gemeinschaft (BUG). Damit<br />
entstand der Anspruch, dass das was in <strong>Berlin</strong><br />
und seinem direkten Umland vorgenommen<br />
wurde, dauerhaft kompatibel zu sein<br />
hatte mit <strong>dem</strong>, was in den übrigen Landesteilen<br />
Brandenburgs im Hinblick auf die<br />
Kennzeichnung von Fahrten des öffentlichen<br />
Verkehrs geschah und (aus damaliger Sicht)<br />
künftig unter Obhut eines Verkehrsverbundes<br />
zu organisieren sein würde. Die Straßenbahnen<br />
im Verkehrsraum waren hierbei<br />
selbstverständlich einzubeziehen.<br />
Neuausrichtung in Diskussion<br />
In <strong>Berlin</strong> ergab sich beschleunigte Handlungsnotwendigkeit<br />
beim Bus schon daraus,<br />
dass sich hier recht schnell ein stabiles Liniennetz<br />
über die bisherige Ost-West-Grenze herausgebildet<br />
hatte und 1991 eine Linienbeziehungsneuordnung<br />
objektiv als 1. Etappe<br />
anstand. Im Bereich der Tram fehlte dieser<br />
Auslöser „Verkehr über die Grenze“. Hier war<br />
vielmehr zu hinterfragen, ob das Verschwinden<br />
alter Pendlerbeziehungen durch Wegfall<br />
von Industriearbeitsplätzen Anlass sein kann,<br />
das Tramliniennetz vom bisherigen Verästelungsnetz<br />
mit möglichst viel Direkt bezie -<br />
hungen in ein Netz mit konsequenter Ausrichtung<br />
auf Radialen, Tangentialen und ggf.<br />
Lokalnetze umzuwandeln. Überhastetes Vorgehen<br />
war hier nicht vonnöten, so dass diese<br />
fundamentale Liniennetzanpassung im vorgenannten<br />
Sinn zusammen mit einer Neunummerierung<br />
schließlich am 23. Mai 1993<br />
als zweite Etappe geschah.<br />
Welche Grundsätze sollten gelten?<br />
Der Umfang des zu Systematisierenden verlangte<br />
unter Beachtung des späteren Ge -<br />
samtverkehrsraums prinzipiell ein drei stelliges<br />
System (im Verständnis eines Maximums), in<br />
<strong>dem</strong> aber auch ein- und zweistellige Linienbezeichnungen<br />
benutzbar bleiben sollten.<br />
58 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
<strong>Berlin</strong><br />
Mit traditionell vier, zeitweise sogar fünf, jetzt nur noch zwei Linien (davon aber eine Metrolinie) ist der Abschnitt Oranienburger Tor – Kupfergraben<br />
<strong>nach</strong>fragegerecht versorgt. Bis zur Reform 1993 verkehrten dort noch die Linien 22, 46, 70 und 71, bis Mai 1990 auch die 11. Einen Fahrgastgewinn<br />
brachte die Streckenführung direkt unter der Bahnhofsbrücke Friedrichstraße sowie die Fahrzeitverkürzung durch Neubauwagen<br />
B. KUSSMAGK<br />
Eckpunkte der neuen Grundsystematik 1991<br />
• Tramlinien in <strong>Berlin</strong> und seinem direkten Umland benutzen das Nummernbündel 1 bis 99<br />
• Buslinien der konzessionierten Betreiber in <strong>Berlin</strong> erhalten das Nummernbündel 100 bis 399<br />
• Buslinien der konzessionierten Betreiber in Brandenburg verwenden das Nummernbündel 400 bis 999<br />
• andere Verkehrsmittel werden durch vorangestellte Buchstaben gekennzeichnet (R, S, U, F). Sie können<br />
ihre Linien <strong>nach</strong> eigener, auch bisher gebrauchter Ordnung nummerieren. Buchstaben können<br />
aber auch Linien besonderen Charakters der Oberflächenverkehrmittel Tram und Bus (z. B. X für<br />
Expresslinien) markieren<br />
• bisherige E-Linien, im Verständnis „Führung nicht über die gesamte Fahrstrecke der Stammlinie oder<br />
von ihr abweichend“ werden nicht mehr gekennzeichnet<br />
• markante Linien, sei es im Stadtverkehr <strong>Berlin</strong> oder sei es im Regionalbusverkehr der Fläche, können<br />
vornehmlich leicht merkbare, volle Hunderternummern nutzen (z. B. in <strong>Berlin</strong> die beiden City-Ost-City-<br />
West-Verbinder-Linien 100 und 200, in der Brandenburger Fläche die Altkreisstädteverbindung Beeskow<br />
– Eisenhüttenstadt Linie 400)<br />
• „kleine“ Stadtverkehre können ihrem eigenen System folgen, sind aber intern mit einem Dreisteller<br />
zu hinterlegen<br />
Auch zeichnete sich deutlich ab, dass Linienbezeichnungen<br />
in einem Flächenzonentarifgebilde<br />
kaum mehr tariflich relevant sein würden,<br />
es sei denn, sie sollen eine besondere<br />
Produktqualität markieren, die sich auch in<br />
einem höheren Preis ausdrücken könnte oder<br />
Betrieben wurden innerhalb der Verkehrsgemeinschaft<br />
(später Verkehrsverbund) linienbezogene<br />
Binnen-Tarifierungen zugestanden<br />
wie z. B. bei den <strong>Berlin</strong>er Randstraßenbahnen.<br />
Die damaligen Entscheider beschlossen, einer<br />
Grundsystematik zu folgen, die mehrere<br />
Eckpunkte hatte (s. Kasten). In Brandenburg<br />
werden die Hunderterstellen regionsweise – zumeist<br />
an den Bediengebieten der Verkehrsunternehmen<br />
der Altkreise orientiert – verwendet.<br />
So trifft man die 900er-Nummern heute<br />
zwischen Eberswalde, Strausberg, Seelow und<br />
Frankfurt, hier einschließlich der Frankfurter<br />
Stadtbuslinien. Die beiden Eberswalder O-Bus-<br />
Linien allerdings wurden als Nr. 861 und 862<br />
eingereiht, entstammen also einem Nummernkreis,<br />
der aus den Altkreisen Bernau und<br />
Oranienburg „hereingeschwappt“ ist.<br />
In den Zehner-Stellen kann <strong>nach</strong> Maßgabe<br />
der bisherigen Betriebesystematik vorgegangen<br />
werden. Selbst das konnte über<br />
ganz Brandenburg gesehen Doppelvergaben<br />
nötig machen, die hingenommen werden,<br />
wenn die Bediengebiete geografisch auseinander<br />
liegen und Kundenirritation ausgeschlossen<br />
ist.<br />
Diese Grundsystematik ließ genügend<br />
Spielräume für plausible Nummernvergaben<br />
für alle Verkehrsmittel, eben auch für die<br />
Straßenbahn und damit in <strong>Berlin</strong> auch für<br />
das Schaffen bestimmter „Wiedererkennungshilfen“<br />
für die Kunden. Darauf war<br />
die Akzeptanz eines dreistelligen Systems im<br />
Busbereich durchaus angewiesen.<br />
Auswirkungen 1991 auf Tramlinien<br />
Zunächst wurde in Vorbereitung der Aktion<br />
1. Juni 1991 erst einmal in <strong>Berlin</strong> der Begriff<br />
„Tram“ anstelle „Straßenbahn“ gesetzt.<br />
Das war für die Entscheider keineswegs risikofrei,<br />
gehörte doch für die „Alt“-<strong>Berlin</strong>er<br />
unverrückbar eine Tram <strong>nach</strong> Zürich, eine<br />
Trambahn <strong>nach</strong> München oder eine Tramwaj<br />
allenfalls <strong>nach</strong> Warschau oder Moskau<br />
und war das Wort „Tram“ als alemannisch/süddeutsches<br />
Wort an Spree und Havel<br />
in hauptstädtischer Überheblichkeit unterschwellig<br />
pejorativ belegt. In <strong>Berlin</strong>, zumal<br />
als neue Hauptstadt Deutschlands eine<br />
Tram statt einer Straßenbahn – das war damals<br />
anfangs unvorstellbar!<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
59
Titel<br />
Der Terminologiewechsel musste aber, um<br />
in der Palette der ÖPNV-Produkte <strong>Berlin</strong>s<br />
eine den anderen Verkehrsmitteln ebenbürtige<br />
griffige Wort- und Bildmarke kreieren<br />
zu können, dringend versucht werden. Und<br />
– er gelang, die <strong>Berlin</strong>er zeigten sich genug<br />
weltoffen und anpassungsbereit (natürlich<br />
nicht ohne anfängliches „Gebrubbel“, was<br />
das denn solle).<br />
Insbesondere die Bildmarke im roten Quadrat<br />
konnte fortan im Marketing und im gesamten<br />
Wegeleitsystem in <strong>Berlin</strong> und Umland<br />
erfolgreich eingesetzt werden und ist<br />
fester Bestandteil des Corporate Design der<br />
Unternehmen und inzwischen von den Kunden<br />
voll akzeptiert.<br />
Kein Sonderzug <strong>nach</strong>, sondern ein 50er-Linienzug in Pankow: Der bereits in Mittenwalde rekonstruierte<br />
und in BVG-Gelb lackierte T6/B6-Zug auf Linie 50 (früher 49) biegt bei der Pankower<br />
Kirche aus der <strong>Berlin</strong>er Straße zur weiteren Fahrt <strong>nach</strong> Französisch-Buchholz ab B. KUSSMAGK<br />
Tram-Linien-Nummern ab 23. Mai 1993<br />
Neu bisher von Endpunkt <strong>nach</strong> Endpunkt<br />
Linien 1 bis 8 bilden das Radial-Hauptnetz<br />
1 71 Schwartzkopffstr. Heinersdorf<br />
2 24 Hackescher Markt Weißensee, Pasedagplatz<br />
3 28 Hackescher Markt Hohenschönhausen, Zingster Str.<br />
4 58 Hackescher Markt Falkenberg (über Greifswalder Str.)<br />
5 63 Hackescher Markt Hohenschönhausen, Zingster Str.<br />
6 6 Schwartzkopffstr. Hellersdorf, Riesaer Str.<br />
7 14 Petersburger/Landsberger A. Ahrensfelde<br />
8 18 Schwartzkopffstr. Ahrensfelde<br />
Linen 13 bis 18 bilden das Radial-Ergänzungsnetz<br />
13 70 Schwartzkopffstr. Hohenschönhausen, Zingster Str.<br />
15 15 Hackescher Markt Falkenberg (über Landsberger Allee)<br />
17 12 Müggelstr. Ahrensfelde<br />
18 10 Weißensee, Pasedagplatz Hellersdorf, Riesaer Str.<br />
Linien 20 bis 27 bilden das Tangentialnetz<br />
20 4 Eberswalder Str. Revaler Str.<br />
21 21 Eberswalder Str. Bf. Schöneweide<br />
22 20 Lichtenberg, Gudrunstr. Revaler Str.<br />
23 3 Björnsonstr. Revaler Str.<br />
26 16 Köpenick, Krankenhaus Hohenschönhausen, Zingster Str.<br />
27 17 Petersburger/Landsberger Allee Bf. Schöneweide<br />
Linien 50 bis 53 bilden das Regionalnetz Nord (»Pankower Netz«)<br />
50 49 Schwartzkopffstr. Buchholz, Kirche<br />
52 46 Hackescher Markt Niederschönhausen, Schillerstr.<br />
53 22 Hackescher Markt Rosenthal<br />
Linien 60 bis 68 bilden das Regionalnetz Südost (»Köpenicker Netz«)<br />
60 84 S-Bf. Adlershof Friedrichshagen, Wasserwerk<br />
61 25 Johannisthal, Haeckelstr. Rahnsdorf, Waldschänke<br />
62 83 S-Bf. Mahlsdorf Wendenschloß<br />
67 26 Johannisthal, Haeckelstr. S-Bf. Mahlsdorf<br />
68 86 S-Bf. Köpenick Alt-Schmöckwitz<br />
Anmerkung: Die vorübergehend vorhandene, auffällige Belegungsdichte der Endstellen Schwartzkopffstraße und Hackescher<br />
Markt ist den seinerzeitigen Baumaßnahmen an der Weidendammer Brücke und der damit verbundenen Sperrung des Abschnitts<br />
Oranienburger Tor – Mitte, Am Kupfergraben geschuldet<br />
Erstmals Linien-Nr. am Stadtrand<br />
Für die terminologisch gewandelte Straßenbahn<br />
brachte der erste Reformschritt am<br />
1. Juni 1991 außer<strong>dem</strong> die Einführung von<br />
Liniennummern erstmals überhaupt bei den<br />
Bahnen am östlichen Stadtrand:<br />
Die Tram Wolterdorf erhielt die Nummer<br />
87, die Schöneiche-Rüdersdorfer die Nummer<br />
88 und die Strausberger Eisenbahn die<br />
Nummer 89. Die Straßenbahnlinien des Verkehrsbetriebs<br />
Potsdam erhielten Nummern<br />
der 90er-Reihe in der Weise, dass sich die bisherigen<br />
Potsdamer Nummern als Einerstelle<br />
wiederfanden.<br />
Bei der BVB blieben die Liniennummern<br />
– bei Beibehalt der bisherigen Linienführungen<br />
– zunächst bis auf zwei Ausnahmen<br />
erhalten: Aus der 16E (Hohenschönhausen,<br />
Zingster Str. – Bf. Schöneweide) wurde die<br />
36 und die Berufsverkehrslinie 88 wurde zur<br />
81 (wenig später eingestellt), weil die 88 fortan<br />
<strong>nach</strong> Schöneiche gehörte.<br />
Das Vorgehen ließ Raum dafür, in einem<br />
zweiten Schritt der gewollten Systematik zu<br />
folgen: Einstellige Nummern und die 1 bis 7<br />
in der Zehnerstelle sind der BVG vorbehalten.<br />
Sie verfährt innerhalb dieser Gruppen<br />
<strong>nach</strong> ihrer Logik: Radiallinien-Hauptnetz<br />
Einsteller, Radiallinien-Ergänzungsnetz Zehnerreihe,<br />
Tangentiallinien Zwanzigerreihe,<br />
Pankower Netz Fünfzigerreihe, Köpenicker<br />
Netz Sechzigerreihe. Die 8 in der Zehnerstelle<br />
ist Kennzeichen der Randstraßen bahnen.<br />
Linien des Potsdamer Tramnetzes<br />
werden mit der 9 in der Zehnerstelle gekennzeichnet.<br />
Tramlinien der kreisfreien<br />
Städte können in numerischer, in der Regel<br />
einstelliger Bezeichnung fortbestehen.<br />
»Übungsfall« Busliniennummern<br />
Im Busnetz war der am 1. Juni 1991 erfolgte<br />
Umbruch hingegen ein wirklich gewaltiger:<br />
Die künftig vereinigte BVG hatte im Busbereich<br />
die Nummernreihen 100 bis 300<br />
zugewiesen bekommen. Sie ordnet im Einzelnen<br />
in der Hunderterstelle und in der Zehnerstelle<br />
<strong>nach</strong> plausiblen Grundsätzen, z. B.<br />
60 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
<strong>Berlin</strong><br />
zentrumsorientierte, nicht zentrumsorientierte<br />
Linien, Radiallinien, Tangentiallinien.<br />
Die Zehnerstelle bezeichnet die Stadtregion<br />
(z. B. 5 – Nordost). Wo irgend möglich, wurde<br />
ein Bezug zur bisherigen Liniennummer<br />
hergestellt, sei es durch Voranstellen der Ziffer<br />
1 oder 2, sei es durch Zahlendreher als<br />
Merkhilfe, z. B. 54 wird 145, weil 154 systembedingt<br />
in Nordost vergeben wurde.<br />
Stadtteillinien (Kiezlinien) erhielten Nummern<br />
im 300er-Bereich.<br />
Eine in die Haushalte verteilte Pappdrehscheibe<br />
sollte <strong>dem</strong> Fahrgast eine Umschlüsselungshilfe<br />
bieten. Die Verkehrsbetriebe<br />
BVG und BVB bemühten sich <strong>nach</strong> Kräften,<br />
alle notwendigen Umstellungen, vor allem<br />
an den Haltestellen, zeitgerecht zu erledigen.<br />
Obwohl am Tag des „Neustarts“ sicher noch<br />
manche Ungereimtheit zu beobachten war,<br />
kann aber den <strong>Berlin</strong>ern – bekannt als<br />
„schwierige“ Dienstleistungskonsumenten<br />
– bescheinigt werden, dass sie sich schnell<br />
und mit erstaunlich wenig Kritik an das neue<br />
Linienschema gewöhnten und ihren „Hundertfünfundvierziger“<br />
anstelle der „Vierundfünfzigers“<br />
bestiegen.<br />
Was geschah im Tramnetz 1993?<br />
Am Morgen des 23. Mai 1993 nahm die wiedervereinigte<br />
BVG den Betrieb in einem<br />
linienmäßig in Teilen neu organisierten Straßenbahnnetz<br />
auf.<br />
OBEN Hochbetrieb<br />
1992 in der Schleife<br />
Björnsonstraße: Die<br />
3 – im einheitlichen<br />
Straßenbahnbetrieb<br />
Teil des so genannten<br />
„Großen Rings“<br />
mit 28 km Linienlänge,<br />
mit der Reform<br />
von 1993 zur Linie<br />
23 mutiert – teilt<br />
sich die Wendeanlage<br />
noch mit der 22,<br />
einer der <strong>Berlin</strong>er<br />
„Dorflinien“ mit<br />
eingleisiger Strecke<br />
in ländlichem Milieu<br />
B. KUSSMAGK<br />
Dem Pankower Netz<br />
wurde 1993 die<br />
fünfziger Reihe zugeteilt<br />
und die Rosenthaler<br />
mussten<br />
sich (ohne Esels -<br />
brücke) an die 53<br />
gewöhnen<br />
SLG. L. HABRECHT<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
61
Titel<br />
Die Linie 25 (hier 1990 in der Seelenbinderstraße) entstand <strong>nach</strong> <strong>dem</strong> Tramende auf der Radiale Treptow – Schöneweide und ersetzte zwischen<br />
Schöneweide und Rahnsdorf die traditionelle 87, die mit 21,5 km Länge lange Zeit die zweitlängste Linie im Ostberliner Netz war B. KUSSMAGK (2)<br />
In der Schleife Eberswalder Straße wendete bis zu ihrer Verlängerung zum Nordbahnhof die aus<br />
der 4 entstandene 20. Das GT6N-Zeitalter hatte 1994 bereits begonnen und die sonstige Trassierung<br />
der 20 sollte die folgende Umstellung auf Stadtbahn-Level relativ einfach gestalten<br />
Es erfolgten mit der Reform <strong>nach</strong>stehende<br />
Neuzuweisungen von Tram-Liniennummern<br />
(siehe Kasten Seite 54).<br />
Im Nachtliniennetz blieben von den ehemals<br />
elf Linien, die insgesamt mit 40 Zügen<br />
(Umläufen) bedient werden mussten, <strong>nach</strong><br />
<strong>dem</strong> 23. Mai 1993 noch die vier Straßenbahn-Nachtlinien<br />
mit 15 erforderlichen<br />
Zügen übrig. Ihre Nummerierung passt einerseits<br />
in die Regionenstruktur des Busliniennetzes<br />
und wurde andererseits durch die<br />
Nachtnetzstruktur bestimmt. Die alte Ostberliner<br />
120er-Nummerreihe für Nacht-<br />
Trams war folgerichtig bereits im vorhergehenden<br />
Schritt aufgegeben worden (siehe<br />
Kasten Seite 57).<br />
Es bleibt hier anzumerken, dass es bei der<br />
Nachtnetzneuordnung vor allem darum ging,<br />
die Ost-/West-Teilnetze besser zu verzahnen,<br />
wozu eine dominante Maßnahme auch die<br />
Bildung eines Nachtknotens (Hauptanschlusspunkt)<br />
am Hackeschen Markt war,<br />
eben mit Übergangsmöglichkeit auf die<br />
Nacht-Tram in die nordöstlichen Stadtteile.<br />
Symptomatisch für <strong>Berlin</strong> ist auch, dass hier<br />
längst „Nachsteuerungen“ erfolgen mussten,<br />
weil die Nachfragebeziehungen sich nicht<br />
mehr <strong>nach</strong> Wohnplatz-Arbeitsplatz-Relationen<br />
richteten, sondern sich mit Wandel der<br />
„Szene-Orte“ verändern. So ist heute wohl<br />
die M10 – übrigens als ex 20, ex 4 Teil einer<br />
„uralten“ Ringlinie – wohl die <strong>nach</strong>fragestärkste<br />
Tram-Nachtlinie in Deutschland, u.a.<br />
62 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
<strong>Berlin</strong><br />
RECHTS Die Liniennummer 88 wurde gleich dreimal „recycelt“. In ihrer<br />
dritten Vergabeperiode war sie eine Berufsverkehrslinie, die ab 1. Oktober<br />
1984 Ober- mit Niederschöneweide verband und zu jener Zeit die<br />
einzige Tageslinie, die mit Zweiachs-Solo-Tw bedient wurde L. HABRECHT<br />
Neue Nachtnummern ab 1993<br />
Linie wie Tageslinie von <strong>nach</strong><br />
N54 4 Hackescher Markt Falkenberg<br />
N55 20/5 Eberswalder Str. Hohenschönhausen,<br />
Zingster Straße<br />
N92 8 Hackescher Markt Ahrensfelde<br />
N93 6 Petersburger Str./ Hellersdorf, Riesaer Straße<br />
Landsberger Allee<br />
weil sie die Szene-Kieze Friedrichshain und<br />
Prenzlauer Berg verbindet.<br />
Für <strong>Berlin</strong> bedeutete die Neunummerierung<br />
den endgültigen Abschied von der Liniensystematik<br />
bei der Straßenbahn, wie sie<br />
über die drei Epochen, nämlich GBSt, Einheitlicher<br />
Straßenbahnbetrieb/BVG und Teilnetz<br />
Ost/Teilnetz West gewachsen war. Natürlich<br />
wurde manche Liniennummer dabei<br />
auch zum dritten Mal recycelt, wie Liebhaber<br />
von Linienchroniken feststellen konnten.<br />
Die Illustration dieses Beitrages bietet hier<br />
einige Erinnerungen und Kuriositäten.<br />
Bewertung durch BVG<br />
Interessant ist auch, wie die BVG in einem<br />
internen Papier die Absicht der Reform und<br />
das Umfeld, in <strong>dem</strong> sie geschah, selbst wertet,<br />
zumal hier der (in die öffentliche Debatte<br />
sinnvoller Weise nicht eingebrachte) Begriff<br />
„Stadtbahn“ benutzt wird /2/: „Mit der<br />
Neuordnung des Liniennetzes zum Fahrplanwechsel<br />
1993/1994 wurde die Grundlage<br />
für ein den veränderten Bedingungen<br />
entsprechendes attraktives Verkehrsangebot<br />
gelegt, das auch den geplanten Netzerweiterungen<br />
gerecht wird. Damit verbunden ist<br />
eine veränderte Angebotsphilosophie, die der<br />
bedarfsweisen Stärkung einzelner Linie<strong>nach</strong>sen<br />
den Vorrang vor der Einführung neuer<br />
Linienbeziehungen einräumt.<br />
Zur Neuordnung zählen u. a. die stärkere<br />
Orientierung auf ein Achsennetz, die Schaffung<br />
eines besser gegliederten Verkehrsangebots<br />
sowie eine übersichtliche Linienummernstruktur.<br />
Insbesondere durch den<br />
geplanten Einsatz moderner Niederflurstadtbahnfahrzeuge<br />
und die sukzessive Umstellung<br />
der Trassen auf Stadtbahnbetrieb ergibt<br />
sich ein weiterer Attraktivitätszuwachs,<br />
der von einer durchgehenden Beschleunigung<br />
der Straßenbahn begleitet sein muß ...“<br />
Auswirkungen auf Wagenpark<br />
Die nächste Tabelle zeigt, wie der Zeitpunkt<br />
der Linienneuordnung vor <strong>dem</strong> Hintergrund<br />
des umfassenden Wandels im Wagenpark<br />
eingeordnet werden muss, der natürlich auch<br />
Vor der Reform 1993 stand die 6 in der Zehnerstelle für den (geografischen) <strong>Berlin</strong>er Osten.<br />
Die 62 war mit 36,6 km Länge die längste Linie der GBSt. Bei der größten <strong>Berlin</strong>er Gesellschaft<br />
wurden die Liniensignale als hinterleuchtete Kopfscheiben mit Steckzahlen geführt L. HABRECHT<br />
auf Fahrzeitgewinne durch Wegfall von<br />
Decklinienbetrieb mit alter und neuer Fahrzeuggeneration<br />
aus war. Altbaufahrzeuge –<br />
gemeint sind in diesem Fall Reko-Zweiachser<br />
und Gotha-Vierachser – verkehrten <strong>nach</strong><br />
<strong>dem</strong> 23. Mai 1993 nur noch auf den Linien<br />
52, 53, 60 und 68. Damit hatten sie nur noch<br />
sehr beschränkt und im vor allem im Innerstadtbereich<br />
Deck linienbetrieb mit Neubaufahrzeuglinien<br />
und waren nicht Verhinderer<br />
von möglichen Fahrzeitkürzungen.<br />
Im Rückblick auf das vor fast 20 Jahren<br />
Artikulierte und in der Zwischenzeit Realisierte<br />
kann nur bestätigt werden, dass mit<br />
der Netzneuformierung 1993 das Zweckmäßige<br />
zum richtigen Zeitpunkt geschah.<br />
Das gilt selbst dann, wenn bedacht wird,<br />
dass die „Haltbarkeit“ in Teilen nur bis zur<br />
Schaffung des Metroliniennetzes 2005 währte<br />
und die „Westausdehnung“ der Tram weit<br />
hinter <strong>dem</strong> damals formulierten Tempo und<br />
erst recht schon hinter den Wünschen grüner<br />
Kommunalpolitik zurück blieb. Die heute<br />
zu besichtigenden Gleisbauvorleistungen<br />
auf der Oberbaumbrücke und in der Leipziger<br />
Straße und das juristische Hick-Hack<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
63
Titel<br />
Optisch gut gelungen<br />
– Metrolinien<br />
werden<br />
in den aktuellen<br />
Netzplänen<br />
Tram der BVG<br />
hervorgehoben<br />
kommuniziert<br />
SLG. L. HABRECHT<br />
Die Linie 22 passte in Rosenthal mehr ins dörflich geprägte Idyll der eingleisigen<br />
Vorortstrecke als die heutige M1 mit Niederflurwagen neben<br />
Katzenkopfpflaster. Die Gabelung der M1 am Nordende in zwei Äste ist<br />
eine bis dato bei der <strong>Berlin</strong>er Tram nicht praktizierte Lösung B. KUSSMAGK (2)<br />
1993 geplante Entwicklung des Fahrzeugeinsatzes<br />
Typ 1993 1994 1995 1996 1999<br />
TE/TZ 25 9 – – –<br />
BE/BZ 48 18 – – –<br />
TDE 11 11 – – –<br />
BDE 11 11 – – –<br />
KT4D 359 372 358 296 222<br />
T6 92 89 92 90 100<br />
B6 45 45 47 43 52<br />
GT6N – 12 50 74 146<br />
GT8N – – – 24 100<br />
Anm.: TE/TZ und BE/BZ bezeichnen in der <strong>Berlin</strong>er Nomenklatur Ein- und Zweirichtungs-<br />
Reko-Wagen, TDE bzw. BDE die Gotha-Vierachsfahrzeuge; der tatsächliche Einsatz wich in<br />
den angegebenen Jahren davon leicht ab; Quelle Tabelle: 2<br />
um die Hauptbahnhofsanbindung durch die<br />
Invalidenstraße sprechen dazu eine eigene<br />
Sprache.<br />
Metrolinien der Tram<br />
Die letzte größere Anpassung am Liniennummersystem<br />
der Straßenbahn geschah mit<br />
der Einführung der Metrolinien in <strong>Berlin</strong> in<br />
Umsetzung des Unternehmenskonzepts<br />
„BVG 2005 plus“. Aus solchen Rückgratlinien,<br />
gebildet im Bus- und Trambereich, formiert<br />
sich ein sogenanntes 24/20-Stunden-<br />
Netz als gut vermarktbare, stabile Offerte<br />
an die Kunden mit hoher Verlässlichkeit.<br />
Eingebracht wurden von der Tram – vereinfacht<br />
übertragen – die Radiallinien 52/53 (M<br />
1), 1 (M2), 3/4 (M4), 5 (M5), 6 (M6), 8 (M8)<br />
und die Tangentiallinien 20 (M10), 23<br />
(M13) und 26 (M17).<br />
Anlagenseitig sind die von diesen Linien befahrenen<br />
Strecken zum großen Teil bereits in<br />
„Stadtbahnmanier“ ausgeführt, wenn auch<br />
zum Teil noch mit modernisierten Tatra-Fahrzeugen<br />
bedient und also fernab von durchgängigem<br />
Behindertengerechtsein. (Mit der<br />
weiteren Anschaffung von Flexity-Fahrzeugen<br />
dürfte dieser Mangel behoben werden.)<br />
Kennzeichnung und Herausstellung der<br />
Metrolinien erfolgte <strong>nach</strong> einem produktbezogenen<br />
corporate identity-Konzept über<br />
beide Verkehrsmittel, Tram und Bus, vom M<br />
vor der Liniennummer über die entsprechende<br />
Haltestellenkennzeichnung bis zu<br />
64 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
<strong>Berlin</strong><br />
Im Oktober 2012 ist die Tramverbindung Köpenick – Adlershof 100 Jahre alt geworden. Seit 1922 wird sie von der 84 Altglienicke – Friedrichshagen,<br />
Wasserwerk befahren (zuvor 184). Damit ist sie die <strong>Berlin</strong>er Linie mit der zeitlängsten unveränderten Linienführung. 1992 verließ ein Reko-<br />
Zweierzug die Ausweiche Adlershof Benzolwerk. Wegen der Kuppelendstellen der 84 beschaffte die BVG 1969 übrigens Zweirichtungs-Rekos<br />
Die 90er-Reihe war in <strong>Berlin</strong> bereits unbelegt,<br />
als sie 1991 Potsdam zugeordnet wurde. In<br />
(Ost-)<strong>Berlin</strong> war die 92 die Linie, mit der die<br />
Tram aus den Ortsteilen Baumschulenweg und<br />
Oberspree verschwand, hier ein Wagen im Betriebshof<br />
Treptow<br />
L. HABRECHT<br />
den Netzplänen mit der Signalfarbe orange.<br />
Dabei wurden zur guten Marktdurchdringung<br />
konsequent auch die Verkehrsmittelkennungen<br />
und Logos Tram rot und Bus<br />
violett ersetzt.<br />
Die für die sonstigen Fahrgastinformationsprodukte<br />
gefundenen Lösungen sind sehr<br />
gut einprägsam. Die Metrolinien verstehen<br />
sich als eine Ergänzung des Schnellbahnnetzes<br />
und bieten in einer langen Kernzeit (Mo.<br />
bis Fr. von 6 bis 22 Uhr) mindestens einen<br />
10-Minuten-Takt.<br />
MetroTrams (somit durchaus Angebote<br />
mit Stadtbahncharakter) stellten im Fahrplan<br />
2010/11 z. B. 126 der insgesamt durchschnittlich<br />
240 werktäglichen eingesetzten<br />
Wagenumläufe der <strong>Berlin</strong>er Straßenbahn.<br />
Von ihrer verkehrlichen Funktionalität<br />
dürfen MetroTram-Linien wie die M2, M4<br />
und M5 heute als nahezu vollwertiger Ersatz<br />
für die in ihren Relationen fehlende Schnellbahn<br />
der zweiten Ebene angesehen werden<br />
mit den angenehmen „Beigaben“ der ebenerdigen<br />
Zugangspunkte und der gleichzeitigen<br />
Übernahme der Feinverteilung im Bediengebiet.<br />
Vor diesem Hintergrund muss<br />
auch die in vielen Planungen mitgeschleppte<br />
U-Bahn-Anbindung von Weißensee mittlerweile<br />
als wirklichkeitsfremd bezeichnet<br />
werden.<br />
Liniennummernsystem im Rückblick<br />
Das im heutigen VBB-Verkehrsraum gewählte<br />
System ist durchaus zukunftsorientiert<br />
und der Entscheid, bei maximal einer<br />
Dreistelligkeit zu bleiben, war grundsätzlich<br />
richtig, selbst wenn es damit nicht beliebig<br />
erweiterungsfähig ist. So nahm, als die Linien<br />
des früheren Zweckverbands öffentlicher<br />
Verkehr Lausitz-Spreewald (ZÖLS) in<br />
den VBB-Verkehrsraum zu integrieren waren,<br />
die Doppelbelegung von Liniennummern<br />
zu. Das erwies sich aber nicht als am<br />
Fahrgastmarkt relevantes Thema und ge-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
65
Titel<br />
Zwei TDE der Nachtlinie 124 warten im Oberschöneweider Betriebshof Nalepastraße in der Gleisharfe vor der westlichen Halle auf ihren Einsatz.<br />
Die Linie von Alt-Schmöckwitz <strong>nach</strong> Rahnsdorf war mit 23,2 km die längste der <strong>Berlin</strong>er Tram-Nachtlinien<br />
B. KUSSMAGK<br />
schah weitestgehend konfliktfrei. Auch waren<br />
hier die Beteiligten im Namen der reibungslosen<br />
Einbindung Südbrandenburgs<br />
zu bislang nicht gewollten Kompromissen<br />
bereit und akzeptierten so z. B. zweistellige<br />
Busliniennummer im Regionalverkehr der<br />
Betriebe Cottbusverkehr und Neißeverkehr,<br />
deren Ziffernfolgen auch als Tramliniennummern<br />
in <strong>Berlin</strong> existieren.<br />
Das Liniennummernsystem, in das die<br />
Trambetriebe eingebunden sind, erfüllt auch<br />
heute den ihm zugedachten Zweck in<strong>dem</strong> es<br />
die ÖPNV-Nutzung erleichtert, und zwar in<br />
der komplizierten Liniengemengelage Ber-<br />
lins ebenso gut wie in der Brandenburger Fläche,<br />
beim Bürgerbus der Kleinstädte oder im<br />
Bahn-Regionalverkehr.<br />
Fazit<br />
Das <strong>Berlin</strong>-Brandenburger Vorgehen darf –<br />
über 20 Jahre zurückgeblickt – als durchaus<br />
bewährt und flexibel genug für alle notwendigen<br />
Anpassungen bewertet werden.<br />
Bleibt festzustellen, dass <strong>Berlin</strong> und Brandenburg<br />
nicht zuletzt durch Unterstützung<br />
des beide Länder umfassenden Verkehrsverbunds<br />
auch im bundesdeutschen Maßstab<br />
liniennummersystematisch vorbildhaft<br />
agiert hat und agiert, sind doch im Bus-Regionalverkehr<br />
anderer Bundesländern z. T.<br />
noch immer vierstellige „Uralt“-Nummernsysteme<br />
der alten Zeit von Bahnbus- und gar<br />
Postbus Normalität.<br />
Wie gut, dass sich kein <strong>Berlin</strong>er oder Brandenburger<br />
die Linie „siebentausendvierhundertundfünfunddreißig“<br />
merken muss!<br />
LUTZ HABRECHT<br />
Literatur<br />
Der HTw 5256 vor der später abgebrannten Wagenhalle Schmöckwitz soll daran erinnern, dass es<br />
nicht nur im Bus-Ausflugsverkehr der BVG das Dreieck als Liniensignal gab. Vielmehr waren auch<br />
<strong>nach</strong> 1945 Tram-Ausflugslinien und teils Messelinien der BVG (West) so gekennzeichnet L. HABRECHT<br />
1 BVGplus, diverse Ausgaben<br />
2 Positionspapier BVG BAP 1, Teil Grundsätze<br />
3 BVG-Fahrplanhefte, div. Ausgaben<br />
4 Straßenbahn-Archiv, Band 5, Transpress,<br />
<strong>Berlin</strong> 1987<br />
66 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
I n Bratislava fährt die Tram mitten<br />
durch das Stadtzentrum und passiert<br />
dabei auch das Slowakische<br />
Nationaltheater, aufgenommen im<br />
März 2007. Auch heute noch fährt<br />
hier kein einziger Wagen mit Niederfluranteil<br />
I Wolfgang Kaiser<br />
Außergewöhnliche Begegnung bei<br />
der Hannoverschen üstra: Am 14. Mai<br />
2011 brachte der Fotograf zwei<br />
6000er-Triebwagen und das Binnenschiff<br />
»Tom Burmeste«“ an der<br />
Limmer Schleuse zeitgleich ins Bild<br />
Erik Wendorff<br />
Vorsicht, Seitenwind! Der Basler Tw 459 überquert auf der Linie 15 die Mittlere Brücke<br />
über den Rhein bei stürmischem Wetter I Herbert Schaudt<br />
27.10. Ende der Sommerzeit<br />
1.4. Ostermontag<br />
Wien ist immer noch eine Hochburg<br />
der klassischen Düwags, die von<br />
österreichischen Firmen in Lizenz<br />
gebaut wurden. Hier ist der Wagen<br />
4829 am 14. April 2008 in der<br />
Währinger Straße stadteinwärts<br />
unterwegs<br />
Wolfgang Kaiser<br />
Wegen Problemen mit den neuen Niederflurbahnen musste der Sechsachser-Einsatz in Graz im Jahr 2010 verlängert werden. Hier befährt<br />
der Wagen 263 die Erzherzog-Johann-Brücke über die Mur, aufgenommen am 8. April 2010 I Wolfgang Kaiser<br />
21.6. Sommeranfang<br />
20.11. Buß- und Bettag | 24.11. Totensonntag<br />
Seit mehr als 80 Jahren sind die<br />
Vierachser des Typs »Ventotto« auf<br />
<strong>dem</strong> Mailänder Straßenbahnnetz<br />
unterwegs. Die orange Farbgebung<br />
ist jedoch ein Auslaufmodell. Sie<br />
weicht langsam einer gelb-beigen<br />
Lackierung I Wolfgang Kaiser<br />
Zug um Zug, Tag für Tag<br />
Jetzt noch bestellen!<br />
Lieferung solange<br />
Vorrat reicht!<br />
www.geramond.de<br />
Straßenbahn 2013<br />
Bitte einsteigen: Stimmungsvolle Motive<br />
aus der ganzen Welt der Straßenbahnen<br />
begleiten Sie durchs Tram-Jahr 2013. Von<br />
altgedienten Klassikern wie <strong>dem</strong> Düwag-<br />
Triebwagen bis hin zu den topmodernen<br />
Trams bietet dieser Kalender spannende<br />
Szenen aus <strong>dem</strong> Straßenbahn-Alltag.<br />
27 Blätter / 36,5 x 25,5 cm<br />
€ [A] 15,95<br />
sFr. 24,90 € 15,95<br />
ISBN 978-3-86245-781-6<br />
Januar<br />
Mo 7<br />
Di 8<br />
Mi 9<br />
Do 10<br />
Fr 11<br />
Sa 12<br />
So 13<br />
Mo 14<br />
Di 15<br />
Mi 16<br />
Do 17<br />
Fr 18<br />
Sa 19<br />
So 20<br />
12013<br />
April<br />
Mo 1<br />
Di 2<br />
Mi 3<br />
Do 4<br />
Fr 5<br />
Sa 6<br />
So 7<br />
Mo 8<br />
Di 9<br />
Mi 10<br />
Do 11<br />
Fr 12<br />
Sa 13<br />
So 14<br />
42013<br />
Juni<br />
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So<br />
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 62013<br />
Juli /<br />
August<br />
Mo 22<br />
Di 23<br />
Mi 24<br />
Do 25<br />
Fr 26<br />
Sa 27<br />
So 28<br />
Mo 29<br />
Di 30<br />
Mi 31<br />
Do 1<br />
Fr 2<br />
Sa 3<br />
So 4<br />
82013<br />
November<br />
Mo 11<br />
Di 12<br />
Mi 13<br />
Do 14<br />
Fr 15<br />
Sa 16<br />
So 17<br />
Mo 18<br />
Di 19<br />
Mi 20<br />
Do 21<br />
Fr 22<br />
Sa 23 11<br />
So 24 2013<br />
Oktober<br />
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So<br />
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10<br />
2013<br />
Faszination Technik<br />
www.geramond.de<br />
oder gleich bestellen unter<br />
Tel. 0180-532 16 17 (0,14 €/Min.)
Geschichte<br />
Elektrisch zum Rheinfall<br />
Der Tram- und Trolleybusbetrieb in Schaffhausen Ab 1901 verkehrten 65 Jahre lang Straßen<br />
bahnen in Schaffhausen. Seit 1966 sichern Trolleybusse den Personennahverkehr in der Region<br />
am Rheinfall ab. Im Güterverkehr blieben die Tram-Gleise hingegen bis 1993 in Nutzung<br />
Der Tourismus, die Ansiedlung von<br />
Industriebetrieben und die wachsende<br />
Wohnbevölkerung ließen<br />
Ende des 19. Jahrhunderts zwischen<br />
Schaffhausen und Neuhausen am<br />
Rheinfall ein erhöhtes lokales Verkehrsbedürfnis<br />
entstehen. Verschiedene Initiativen<br />
führten dann schlussendlich zum Bau einer<br />
ursprünglich eingleisigen 2,670 km langen<br />
elektrischen Straßenbahn mit 1.000 mm<br />
Spurweite von Schaffhausen Bahnhof in das<br />
oberhalb des Rheinfalls gelegene Dorfzentrum<br />
von Neuhausen, die am 11. Mai 1901<br />
offiziell eröffnet wurde. An den Endstationen<br />
endete die Strecke jeweils in einem<br />
Stumpfgleis ohne Umsetzgleis, was bei Beiwagenbetrieb<br />
einen in Sichtweite <strong>nach</strong> -<br />
folgenden Solowagen erforderte, der dann<br />
auf der Rückfahrt die Beiwagen übernahm.<br />
Der vorher führende Triebwagen fuhr nun<br />
als Solowagen <strong>dem</strong> Wagenzug hinterher, um<br />
am anderen Ende wiederum die Beiwagen<br />
zu übernehmen. Das war so Praxis bis zur<br />
Einstellung.<br />
Die Erstausstattung bestand aus neun<br />
zweiachsigen Motorwagen und 29 Festangestellten<br />
mit denen ein 10-Minuten-Takt<br />
durchgeführt wurde. Hersteller der Fahrzeuge<br />
waren die Maschinenfabrik Oerlikon<br />
(MFO) und die SIG Neuhausen.<br />
Als zweiter elektrischer Straßenbahnbetrieb<br />
kam 1905 die ebenfalls meterspurige<br />
und vom Kanton Schaffhausen erbaute<br />
68 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Schweiz: Schaffhausen<br />
OBEN Endhaltestelle Neuhausen Rheinfall im Mai 1964: Tw 1 (Bj. 1901) war bis zur Einstellung 1966 ununterbrochen in<br />
Betrieb. Dem Vater des Berichtsurhebers sei es verziehen, dass er für diese Aufnahme seines Sohnes die Wagenfront nicht<br />
vollständig abgelichtet hat<br />
H. MÜLLER, SLG. U. MÜLLER<br />
LINKS Im August 1956 begegnen sich auf <strong>dem</strong> Bahnhofsvorplatz in Schaffhausen der 1901 gebaute Tw 8 der Städtischen<br />
Straßenbahn als Linie 2 und der 1905 gebaute Tw 1 „Straßenbahn Schaffhausen – Schleitheim – Oberwiesen“ (StSS). Im<br />
Hintergrund der badische Teil des Empfangsgebäudes<br />
STADTPOLIZEI SCHAFFHAUSEN, SLG. STADTARCHIV SCHAFFHAUSEN<br />
„Straßenbahn Schaffhausen – Schleitheim –<br />
Oberwiesen“ (StSS) mit 19,6 km Länge hinzu.<br />
Beide Bahnen benutzten ab Schaffhausen<br />
Bahnhof bis zur Haltestelle „Scheidegg“<br />
(bei Neuhausen) die Gleise gemeinsam. Außerorts<br />
befanden sich die Gleise in Seitenrandlage,<br />
innerorts mitten auf den Straßen.<br />
Die Fahrleitung war an Holzmasten montiert.<br />
Neben <strong>dem</strong> Berufsverkehr hatte die<br />
Bahn ein hohes Aufkommen im Post- und<br />
Stückgutverkehr. Auch <strong>nach</strong> Einstellung der<br />
StSS zum 1. Oktober 1964 änderte sich das<br />
nicht. Nur das jetzt die Autobusse („Gummitrams“)<br />
einen Lkw-Kastenanhänger für<br />
das Post- und Stückgut mit sich führten.<br />
Straßenbahnbetrieb<br />
und Güterverkehr<br />
Im April 1911 erfolgte die Verlängerung der<br />
Straßenbahn vom Depot – heute steht dort<br />
das Feuerwehr-Zentrum – am SSB-Güterbahnhof<br />
vorbei in zwei steilen S-Bögen in<br />
das Industriegebiet auf <strong>dem</strong> Ebnat und zum<br />
Abkürzungen<br />
NAW<br />
Nutzfahrzeuggesellschaft Arbon &<br />
Wetzikon bis 2008<br />
Berna Nutzfahrzeugbau Olten bis 1978<br />
SML Schweizerische Maschinen- und Lokomotivfabrik<br />
Winterthur<br />
VBSH Verkehrsbetriebe Schaffhausen<br />
Fuße des Waldfriedhofes. Zur Bedienung der<br />
rund zwölf Industrie- und Gewerbebetriebe<br />
dienten 800 m Anschlussgleis. Die Zustellung<br />
des Stückgutes übernahm ein vierachsiger<br />
Gepäcktriebwagen, die Zustellung der<br />
Normalspurwagen auf Rollschemeln („Rollwagen“)<br />
erfolgte bis zum Bau eines normalspurigen<br />
Anschlussgleises im März 1970<br />
mit zwei vierachsigen Elektrolokomotiven.<br />
Die guten Erfahrungen mit <strong>dem</strong> kombinierten<br />
Straßenbahn- und Güterverkehr, der<br />
in Meißen an der Elbe (SM 2/2008) bis Anfang<br />
1968 in ähnlicher Weise durchgeführt<br />
wurde, bewog die Georg Fischer AG (+GF+)<br />
und den Stadtrat zum Bau einer weiteren<br />
kombinierten Straßenbahnstrecke in das<br />
Mühlental, die die Liniennummer 2 erhielt.<br />
Ab Juni 1913 bediente die Straßenbahn diese<br />
Strecke im Einmannbetrieb, während die<br />
+GF+ mit zwei- und vierachsigen E-Loks<br />
den Güterverkehr besorgte.1916 beförderten<br />
beide Güterstraßenbahnbetriebe<br />
11.065 t Stückgut und 17.454 t an Wagenladungen,<br />
1926 waren es 15.400 t Stückgut<br />
und 56.000t Wagenladungen.<br />
Der Personenverkehr auf der Mühlentallinie<br />
fand 1957 sein Ende. Die Verlagerung<br />
der Produktion aus <strong>dem</strong> engen Mühlental<br />
heraus verringerte das Güteraufkommen so<br />
stark, dass ab 1980 der elektrische Betrieb<br />
aufgegeben und eine zweiachsige Diesellok<br />
die wenigen Waggontransporte übernahm.<br />
Im Juli 1993 kam der Gütertransport infolge<br />
Werksschließung ganz zum Erliegen. Bereits<br />
1928 musste die Zweiglinie zur „Brei-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
69
Geschichte<br />
Ein Triebwagen aus der letzten Lieferung von 1921 im Juni 1965 auf <strong>dem</strong> Bahnhofsvorplatz von<br />
Schaffhausen U. MÜLLER (2)<br />
Die Güterelloks 75 und 76 der Georg Fischer AG (+GF+) rangieren im Februar 1973 im Mühlental.<br />
Beide Lokomotiven hatte die SLM Winterthur 1913 geliefert<br />
te“ zu Gunsten des Autobusses und der<br />
wachsenden Motorisierung ihren Betrieb<br />
aufgeben. Die als „echte“ Straßenbahn eben<br />
mitten auf der Straße verkehrenden Tramzüge<br />
bereiteten den Kraftfahrern zunehmend<br />
Probleme, weil diese beim Fahrgastwechsel<br />
zum Anhalten gezwungen wurden. An engen<br />
Stellen war ein Überholen des langsamen<br />
Trams nicht möglich.<br />
Die Längssitzer-Tramwagen von 1901, die<br />
letzte Lieferung stammte von 1921, entsprachen<br />
schon in den 1930er-Jahren nicht<br />
mehr den von den Fahrgästen geforderten<br />
Komfort. Seit <strong>dem</strong> kursierte immer wieder<br />
die Frage <strong>nach</strong> einer Umstellung auf Trolleyoder<br />
Autobus. Für die Direktion der Straßenbahn<br />
kam wegen der Gummireifen- und<br />
Kraftstoffbeschaffungs-Unsicherheit damals<br />
eine Umstellung auf Autobus absolut nicht<br />
in Frage, auf Trolleybus aufgrund des damals<br />
herrschenden Kupfermangels ebenfalls<br />
nicht.<br />
Modernisierung verhindert<br />
1947 hatte die SIG Neuhausen einen von<br />
drei neu entwickelten und für die Tramway<br />
Neuchatel (TN) bestimmten kurzen, vierachsigen<br />
Motorwagen Nr. 82 (siehe SM<br />
2/2011) zu Vorführungszwecken auf <strong>dem</strong> fabriknahen<br />
Netz der Schaffhauser Straßenbahn<br />
eingesetzt. In der Folgezeit beschäftigten<br />
sich die verantwortlichen Gremien<br />
mehrfach mit der Erneuerung des Straßenbahnwagenparks,<br />
der dann aber jedes Mal<br />
von der Stimmbürgerschaft, zuletzt im März<br />
1957, abgelehnt wurde. Dies war wohl auch<br />
der Grund, den Personenverkehr auf der<br />
Mühlentallinie im April 1957 auf Autobus<br />
umzustellen um den überalterten Wagenpark<br />
Die Bedeutung des Trolleybusses in der Schweiz<br />
Seit Inbetriebnahme der ersten modernen Linie im<br />
Jahre 1932 in Lausanne hat sich der Trolleybus<br />
als umweltfreundliches Nahverkehrsmittel durchgesetzt.<br />
Von den seit dieser Zeit als Straßenbahnersatz-<br />
oder Ergänzung eröffneten 15 städtischen<br />
Trolleybusbetrieben wurden nur zwei, in Lugano<br />
2001 und 2008 in Basel, komplett stillgelegt. Für<br />
deutsche Verhältnisse (noch?) unvorstellbar ist die<br />
Tatsache, dass der Trolleybus in Kleinstädten unter<br />
50.000 Einwohnern, wie in Freiburg oder Neuenburg,<br />
wie auch in Schaffhausen, die Hauptlast<br />
des öffentlichen Verkehrs trägt.<br />
Die Betriebslänge der Straßenbahnen betrug<br />
2010 rund 300 km, die der Trolleybusse rund 320<br />
km, wobei trotz Betriebseinstellungen beim Trolleybus<br />
die Streckenlänge seit 1995 relativ konstant<br />
geblieben ist. Die Straßenbahnstrecken nahmen<br />
von 1995 mit 185 km um 115 km auf 300 km in<br />
2010 zu. Der enorme Zuwachs ist nicht nur durch<br />
Neubauten begründet, sondern auch damit, dass<br />
vorher als Eisenbahnen konzessionierte Unternehmungen<br />
wie die Bern-Worb-Bahn (SM 9/2012)<br />
nun als Straßenbahnen betrieben werden.<br />
Ausblick<br />
Sollen die Absichtserklärungen des Kyoto-Protokolls<br />
<strong>nach</strong> Senkung der Treibhausgase und die Minderung<br />
der Schadstoffe ernst genommen werden, dann wäre<br />
es höchste Zeit, die in Deutschland propagierte<br />
„Elektromobilität“ sich nicht auf den MIV beschränken<br />
zu lassen, sondern auch endlich auf den<br />
ÖV auszudehnen. Wie das Beispiel Schaffhausen<br />
zeigt, macht es ökologisch wie wirtschaftlich Sinn<br />
gerade in straßenbahnlosen Mittelstädten stark<br />
belasteten Dieselbuslinien durch fahrleitungs -<br />
gespeiste Elektrobusse zu ersetzen. Dazu darf der<br />
Treibhausgas-Emissionshandel nicht nur u. a. die<br />
Elektrokraftwerke als Versorger für elektrisch angetriebene<br />
Verkehrsmittel betreffen, sondern muss<br />
auch auf den Straßen-Transportsektor ausgeweitet<br />
werden, der z. B. im Jahr 2007 immerhin 24 % der<br />
Treibhausgasemissionen verursacht hat.<br />
Die „Aufklärungsarbeit“ gewisser Verbände hat<br />
den Eindruck erwecken lassen, dass es bei der Verwendung<br />
der elektrischen Traktion besonders auf die<br />
Art der Stromerzeugung ankomme. Das legt dann<br />
den Schluss nahe, dass ein Straßenbahn- oder Obusbetrieb,<br />
der „schmutzigen Strom“ aus einem ineffizienten<br />
Braunkohlekraftwerk oder gar AKW bezieht<br />
(beziehen muss) und obendrein den Emissionshandel<br />
finanzieren muss, wesentlich umweltunfreundlicher<br />
einzustufen sei als ein Diesel- oder Gasbus, die<br />
vom Emissionshandel befreit sind. Dabei wird gerne<br />
vergessen, dass bei Transport und Produktion von<br />
Treibstoffen aus Erdöl Treibhausgase produziert werden.<br />
Die Schadstoffausstoßzahlen der Bushersteller<br />
wären gerechter Weise mit <strong>dem</strong> Faktor 1,4 zu beaufschlagen,<br />
um echte Emissionswerte zu erhalten.<br />
Selbst Saudi-Arabien als das Erdölförderland Nr. 1<br />
hat es bis Ende 2011 fertig gebracht, mit klimatisierten<br />
Trolleybussen auf einer 11 km langen Strecke<br />
im 3-Minuten-Takt den Medizin-Campus der Universität<br />
Riad zu befahren.<br />
U. MÜLLER<br />
70 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Schweiz: Schaffhausen<br />
zu schonen. Der damals 1947 in Schaffhausen<br />
vorgeführte Wagen befindet sich seit<br />
2002 als Ausstellungsstück auf <strong>dem</strong> Gelände<br />
der Modellbahnwelt in Wiehe (Sachsen-<br />
Anhalt).<br />
Auch die kantonale Straßenbahn <strong>nach</strong><br />
Schleitheim (StSS) wurde als unzeitgemäß<br />
eingestuft. Die Eigentümerin selbst hatte<br />
wenig in den Erhalt der Bahn investiert, über<br />
eine Probefahrt mit <strong>dem</strong> vierachsigen Beiwagen<br />
Nr.765 der Züricher Verkehrsbetriebe<br />
im Oktober 1953 kamen die Moder nisierungsbestrebungen<br />
nicht hinaus. Trotz<strong>dem</strong><br />
hatte die StSS auch ihre Befürworter, denn<br />
in einem Volksentscheid 1961 über deren<br />
Weiterbestand gab es 7.861 (57 %) Stimmen<br />
für die Umstellung auf Autobusbetrieb bei<br />
5.946 (43 %) Stimmen dagegen. Am 1. Oktober<br />
1964 wurde dann die nördlichste Tram<br />
der Schweiz durch einen Autobusbetrieb ersetzt.<br />
Die Umstellung auf den Trolleybus<br />
In Schaffhausen war die Stimmung gegen das<br />
Tram wesentlich gereizter und die „Ersetzung<br />
durch den Trolleybus raschest möglich“<br />
gefordert. In einer Volksabstimmung im September<br />
1964 entschieden sich die Stimmbürger<br />
mit 5.454 Stimmen (89,5 %) zu einer<br />
Gewährung eines Kredites in Höhe von<br />
4,0 Mio. SF für die Einrichtung eines Ersatzbetriebes<br />
mit Trolleybussen. Nur 460<br />
Bürger stimmten dagegen, also für den Erhalt<br />
der Straßenbahn. Eine etwas unver-<br />
Tw 82, bestimmt für die Straßenbahn in Neuchatel, wird im März 1947 in Schaffhausen für Vorführungsfahrten genutzt. Der Wagen steht seit<br />
2002 im Freigelände der „ModellbahnWelt“ in Wiehe (Sachsen-Anhalt) SIG NEUHAUSEN, SLG. STADTARCHIV SCHAFFHAUSEN<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
71
Geschichte<br />
Gelenk-Trolleybus Nr. 106 im Mai 1993 auf <strong>dem</strong> Bahnhofsvorplatz von Schaffhausen. Er wurde 1975 für den Einsatz auf der Verstärkerlinie 9 angeschafft,<br />
hier ist er aber als Linie 1 vor <strong>dem</strong> Bahnhof SBB/DB zu sehen. 1999 wechselte er <strong>nach</strong> Luzern<br />
U. MÜLLER<br />
ständliche Entscheidung, entsprach doch die<br />
Linienführung des Trolleybusses genau die<br />
der Straßenbahn. Spätere Erweiterungen hätten<br />
auch auf Schienen erfolgen können. Aber<br />
egal, ob in Frankreich, West-Deutschland<br />
oder <strong>dem</strong> übrigen westeuropäischen Staaten,<br />
die Straßenbahn wurde als veraltetes Verkehrshindernis<br />
zum ungeliebten Kind. Wie<br />
die Stimmung damals gegen die Tram eingestellt<br />
war, geben am Besten die markigen<br />
Worte des damaligen Stadtpräsidenten Bringolf<br />
wieder: „Das Feld ist geräumt, der Platz<br />
frei für das Neue, das Zeitgemässe“; der 24.<br />
September 1966 sei ein Freudentag.<br />
So oder so ähnlich dachte man auch in<br />
Deutschland über den schienengebundenen<br />
Nahverkehr, nicht bedenkend, dass veraltete<br />
Straßenbahnwagen aus <strong>dem</strong> Jahr 1901<br />
nicht mit Omnibussen neuester Bauart verglichen<br />
werden können. Aber immerhin<br />
blieb die Bevölkerung in Schaffhausen der<br />
elektrischen Antriebsenergie treu, zu einem<br />
Zeitpunkt, da in Deutschland begonnen<br />
wurde, die <strong>nach</strong> Kriegszerstörungen der Straßenbahnen<br />
eingerichteten O-Bus-Netze wieder<br />
zu <strong>dem</strong>ontieren. Deren größte Ausdehnung<br />
in den beiden Teilen Deutschlands<br />
betrug einstmals knapp 1.000 km, von denen<br />
heute nur noch rund 75 km übrig geblieben<br />
sind.<br />
Am 23. September 1966 ging dann der<br />
Trambetrieb fast nahtlos in den Trolleybusbetrieb<br />
über (siehe SM 5/2007). Monate vorher<br />
wurde die neue Trolleybus-Fahrleitung<br />
über der Straßenbahnfahrleitung montiert.<br />
Nicht mehr benötigte Wagen wurden mit<br />
Eintreffen der neuen Trolleys, die jetzt im<br />
Tramdepot untergebracht wurden, auf einem<br />
Abstellgleis auf <strong>dem</strong> Ebnat hinterstellt<br />
und die letzten Tramkurse des Nachmittages<br />
fuhren statt ins gewohnte Depot direkt<br />
auf den Schrottplatz. Nachts wurde die<br />
Tramfahrleitung <strong>dem</strong>ontiert und mit Betriebsbeginn<br />
am folgenden Sonntag, <strong>dem</strong> 24.<br />
September, gingen die ersten Trolleybusse,<br />
ebenso wie tags zuvor noch die Straßenbahnen,<br />
als Linie 1 auf Kurs. Außer <strong>dem</strong> Beiwagen<br />
C 55 der im Trammuseum Zürich als<br />
C 455 erhalten ist, erinnert nur noch die<br />
massive Wartehalle auf <strong>dem</strong> Ebnat und einige<br />
Gleisreste in den ehemaligen +GF+-<br />
Werkhöfen an die Straßenbahn.<br />
Trolleybus versus Diesel-,<br />
Gas- oder Hybridbus?<br />
Die strengeren Abgasnormen in Verbindung<br />
mit entschwefeltem Dieselöl, CRT-Abgassysteme<br />
(das dafür überproportional Stickstoffdioxyd<br />
produziert), Gas-EEV-Diesel-<br />
Hybrid- oder Brennstoffzellenbusse führten<br />
zur Überlegung, zukünftig auf den Trolleybus<br />
zu verzichten, wie eine von den VBSH<br />
2007 in Auftrag gegebene Studie empfahl.<br />
Das kam allerdings in Schaffhausen nicht<br />
gut an, wohl aber in der Nachbargemeinde<br />
Neuhausen. Hier musste nahe des Badischen<br />
Bahnhofes wegen des Baues einer Eisenbahnüberführung<br />
die Fahrleitung zu den<br />
„Herbstäckern“ temporär <strong>dem</strong>ontiert werden.<br />
Durch Verzicht einer Wiedermontage<br />
der Fahrleitung sollte auf kaltem Wege der<br />
Trolleybus abgeschafft werden, obwohl ein<br />
Hauptargument für den Bau der Überführung<br />
war, zukünftige Fahrplanstabilität zu<br />
haben und den sich bei Elektrifizierung der<br />
Badischen Bahn ergebenden Konflikt zwischen<br />
Bahn- und Trolleybusfahrleitung so<br />
umgehen zu können. Ganze 450.000 SFr<br />
hätten bei <strong>dem</strong> 25 Mio. Projekt eingespart<br />
werden können. Vergessen wurde dabei, dass<br />
dieser „Einsparung“ Rückbaukosten der<br />
vollkommen intakten Fahrleitungsanlage von<br />
etwa 5 bis 6 Mio. SFr gegenüber gestanden<br />
wären.<br />
In der Öffentlichkeit löste die Stilllegungsdebatte<br />
einen Sturm der Entrüstung<br />
aus. Ein überparteiliches Komitee „Pro Trolleybus“<br />
sammelte 3.000 Unterschriften und<br />
bereitete somit den Weg für die Beschaffung<br />
von sieben neuen Trolleybussen im Jahr<br />
2011. Die Sanierung der Fahrleitungen und<br />
elektrischen Anlagen im Bestandsnetz wurde<br />
2012 umgesetzt. Ausschlaggebend für die<br />
Genehmigung eines Investitionspaketes in<br />
Höhe von 10,5 Mio. SFr waren für den<br />
Stadtrat die ökologischen Vorteile des Elektroantriebes<br />
gegenüber <strong>dem</strong> Verbrennungsmotor.<br />
Allein durch den elektrischen Betrieb<br />
auf der Linie 1 können jährlich rund 300.000<br />
72 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Schweiz: Schaffhausen<br />
Hinter der Etzwiler Unterführung biegt der Trolleybus 111 II im März<br />
2011 in Schaffhausen in die Bahnhofstraße ein P. KRAMMER<br />
Der Gelenktrolleybus 103 III am 25. September 2011 im Töbeliweg<br />
(Herbstäcker). Mit Dieselbussen wäre dieser Abschnitt im 10-Minuten-Takt<br />
unmöglich zu befahren U. MÜLLER (2)<br />
Trolleybus 107 III in der Endstelle Herbstäcker. Die 18,61 m langen Wagen<br />
sind auf der zweiten und dritten Achse angetrieben, fahrleitungslose<br />
Abschnitte meistern sie mit einem 50-kw-Deutz-Diesel-Aggregat<br />
Liter Dieselöl eingespart werden, was rund<br />
2.000 t CO 2<br />
entspricht. Obendrein wird der<br />
Fahrstrom zu 97,5 % direkt aus einem an<br />
der Strecke liegenden Wasserkraftwerk bezogen.<br />
Den Rest liefern Solarstrom-Biomasse-<br />
und Windkraftanlagen.<br />
Bei etwa gleicher Beförderungsleistung<br />
und trotz eines doppelt so hohen Wirkungsgrades<br />
beim Elektromotor gegen über<br />
beim Verbrennungsmotor liegen die Stromkosten<br />
bezogen auf die Beförderungsleistung<br />
der Linie 1 um rund 30.000 SFr pro Jahr höher<br />
als der Diesel für die Linie 3. Es liegt auf<br />
der Hand, dass willkürliche Energie-Preisund<br />
Subventionspolitik die elektrische Traktion<br />
auch in der Schweiz bewusst verteuern.<br />
Auch bei den Betriebskosten schneidet der<br />
Trolleybus gegenüber <strong>dem</strong> Dieselbus ebenfalls<br />
nur marginal mit 1,8 Rappen pro Fahrgast<br />
teurer ab, einschließlich Kosten für<br />
Fahrleitung und Stromversorgung.<br />
Sobald Ersatzbeschaffungen für Dieselbusse<br />
erforderlich sind, soll eine Netzerweiterung<br />
in Betracht gezogen werden. Wenn<br />
diese Absichten in konkreter Umsetzung enden,<br />
würden von <strong>dem</strong> 50,1 km langen Busnetz<br />
15,6 km oder 31,2 % elektrisch betrieben<br />
werden. Bei einem Aufkommen der<br />
Linien 1 und 3 von 6,34 Mio. der jährlichen<br />
13,5 Mio. Fahrgäste entspräche das einer Beförderungsleistung<br />
von zukünftig 47 % mit<br />
elektrischer Traktion. Tagtäglich benutzen<br />
im Durchschnitt rund 8.800 Passagiere die<br />
Linie 1, weitere 8.575 die Linie 3. Nach Ansicht<br />
von Verkehrsexperten wäre eine mit<br />
8.000 Fährgästen täglich belastete Buslinie<br />
sogar straßenbahnwürdig.<br />
Die neuen Trolleybusse<br />
Die Verkehrsbetriebe Schaffhausen (VBSH)<br />
haben bis Mitte September 2011 ihre Trolleybusflotte<br />
in nun dritter Generation erneuert.<br />
Nach 20 Betriebsjahren folgte die Ablösung<br />
der NAW/Hess/ABB-Gelenktrolleybusse<br />
durch sieben Hess/Kiepe-„SwissTrolleys 3“,<br />
während die Berna/SWS-Trolleys der erste<br />
Generation 25 Einsatzjahre schafften.<br />
Neun weitere Schweizer Städte haben sich<br />
2010/11 zur Beschaffung der „SwissTrolley<br />
3“ mit insgesamt 160 Fahrzeugen entschieden,<br />
auch in Solingen verkehren 15 Exemplare<br />
dieses Typs. Die vollklimatisierte dritte<br />
Trolleybus-Generation ist für eine<br />
problemfreie Einsatzdauer von 25 Jahren<br />
ausgelegt, die wirtschaftliche Einsatzdauer<br />
der Dieselbusse liegt bei 15 Jahren. Niederflur-Portalachsen<br />
erlauben zu 100 % Niederflurigkeit.<br />
Zwei auf die zweite und dritte<br />
Achse wirkenden Drehstrom-Asynchronmotoren<br />
von je 160 kW Leistung erlauben<br />
Steigungen bis15 % und in der Ebene eine<br />
V/max von 65 km/h. Das Fassungsvermögen<br />
liegt bei 132 Passagieren. Mit <strong>dem</strong> Kiepe-Stromabnehmer-System<br />
ist ein seitliches<br />
Ausweichen von bis zu vier Metern möglich.<br />
Von der Erstlieferung ist in Schaffhausen<br />
kein Trolleybus geblieben, auch kein Straßenbahnwagen.<br />
Aktuell sollen mit über 45<br />
Betriebsjahren die Wagen 102 und 203 noch<br />
in Valparaiso (Chile) im täglichen Einsatz<br />
stehen. Wagen 202 befindet sich im Besitz<br />
des Trolleybus-Vereins Schweiz (TVS).<br />
Quellen<br />
ULLRICH MÜLLER<br />
Stadtarchiv Schaffhausen, mit freundlicher<br />
Genehmigung zur Bildveröffentlichung<br />
Maschinenfabrik Oerlikon, Firmenreferenzen<br />
‘ca. 1927<br />
Zimmermann/Gerbig: „Die Schaffhauser<br />
Straßenbahnen“, Schaffhausen 1976<br />
Geschäftsberichte VBSH 2000 bis 2010<br />
„Bus Zytig“, Ausgabe August 2011, Kunden -<br />
zeitung VBSH<br />
LITRA, Informationsdienst für den ÖV, 75 Jahre<br />
Trolleybus in der Schweiz<br />
Schweizerisches Bundesamt für Statistik<br />
VST(tt)-Revue, Organ der Schweizerischen Transportunternehmungen,<br />
Nr. 9/1991 + Nr.3/1987<br />
„Pro Trolleybus“ – Komitee zur Erhaltung des<br />
Trolleybus, div. Internet-Ausgaben Auskunft der<br />
BVSH über die Energiekosten, Mail vom 22. September<br />
2011<br />
VISEON-Internetauftritt Trolleybusse für Riad,<br />
2011<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
73
■ Miniatur-Nahverkehr: Anlagen, Fahrzeuge, Tipps und Neuheiten<br />
Das H0-Tor hat zwar nur wenig Ähnlichkeit mit <strong>dem</strong><br />
Günterstaler Tor des Vorbilds, Jürgen Jaeschke<br />
ging es aber beim Bau dieses Straßenbahnmoduls<br />
vorwiegend darum, die interessante Situation<br />
im Freiburger Ortsteil als Modell festzuhalten<br />
Mit der Bahn<br />
durchs Klostertor<br />
Wohlstand dank Tram ■ Jürgen Jaeschke hat die Mitte von Günterstal <strong>nach</strong>empfunden.<br />
Schon lange bringt die Straßenbahn viele Ausflügler mit ihrem Geld in den hübschen Ort<br />
Es gibt einige markante Straßenbahnmotive<br />
im Original,<br />
die mich schon immer beeindruckt<br />
haben und meiner<br />
Meinung <strong>nach</strong> zum Nachbau im Modell<br />
einladen. Vor einiger Zeit habe<br />
ich mich entschlossen, eines dieser<br />
Motive in Angriff zu nehmen. Der<br />
letzte Auslöser hierzu war die Vorstellung<br />
des Luna-Straßenbahngleises<br />
vor einigen Jahren. Ich wollte<br />
dieses Gleissystem einfach mal ausprobieren.<br />
So begann ich die Endstation<br />
der Freiburger Straßenbahn<br />
in Günterstal im Maßstab 1:87 als<br />
Modell <strong>nach</strong>zubauen.<br />
Zuerst ein paar Worte über Günterstal.<br />
Dies ist der südlichste Freiburger<br />
Stadtteil, er hat rund 1.600<br />
Einwohner. Zwischen Günterstal<br />
und Freiburg befindet sich ein etwa<br />
zwei Kilometer breiter unbebauter<br />
Grünstreifen. Der dörflich wirkende<br />
Ortsteil liegt landschaftlich reizvoll<br />
inmitten eines Schwarzwaldtales.<br />
Dort ist auch der 1.284 Meter hohe<br />
Berg Schauinsland, der mit einer<br />
Kabinenseilbahn erschlossen wird.<br />
Diese Bahn gehört mittlerweile zur<br />
Freiburger Straßenbahn. Günterstal<br />
entstand um ein Zisterzienserinnenkloster<br />
herum, dessen Anlagen auch<br />
74 strassenbahn magazin 1|2013
Anlagenba<br />
Neben der Tordurchfahrt<br />
soll das Arkadenhaus am anderen<br />
Ende des Platzes den<br />
Eindruck der Günterstaler<br />
Ortsmitte wiedergeben. Das<br />
prägende Vorbild hat allerdings<br />
ein Stockwerk weniger<br />
Jaeschke verwendete einen H0-Bausatz von Faller für sein Torhaus.<br />
Beim Vorbild ist die Durchfahrt mittig und das Gebäude ohne Fachwerk<br />
Beim Vorbild haben die Häuser Vorgärten und Parkplätze, Hobbyfreund<br />
Jaeschke hat sich für eine Belebung mit einem Wochenmarkt entschieden<br />
heute noch ortsprägend sind. Einige<br />
Jahre <strong>nach</strong> der Auflösung des Klosters<br />
erfolgte im Jahre 1890 die Eingemeindung<br />
<strong>nach</strong> Freiburg.<br />
Die Straßenbahn erreichte 1901 von<br />
Freiburg her Günterstal. Mit dieser<br />
Verbindung kam der Wohlstand auch<br />
in dieses Tal. Die Freiburger entdeckten<br />
den Schauinsland und Günterstal<br />
als leicht erreichbares Ausflugsziel.<br />
Die Strecke wurde ursprünglich eingleisig<br />
im Straßenplanum der Schauinslandstraße<br />
erbaut, später zweigleisig<br />
erweitert und auf eigenem<br />
Bahnkörper verlegt. Am Günterstaler<br />
Ortsrand wird die Strecke eingleisig,<br />
um sogleich das Torhaus des Klosters<br />
zu durchfahren. Neben <strong>dem</strong> Martinstor<br />
und <strong>dem</strong> Schwabentor ist dies<br />
die dritte Tordurchfahrt im Netz der<br />
Freiburger Straßenbahn. Zusätzlich<br />
führt durch dieses enge Tor auch<br />
die Schauinslandstraße hindurch. Es<br />
passt jeweils nur eine Straßenbahn<br />
oder ein Auto durchs Tor. Beim sonntäglichen<br />
Ausflugsverkehr kommt es<br />
regelmäßig zu entsprechenden Verkehrsproblemen.<br />
Seit einigen Jahren<br />
gibt es aber eine Ampelbevorrechtigung<br />
für die Straßenbahn. Viele Jahre<br />
befand sich direkt hinter <strong>dem</strong> Tor auf<br />
<strong>dem</strong> Klosterplatz die Endstation. Es<br />
gab dort ein Ausweichgleis zum Umsetzen<br />
von Beiwagen. Im Jahre 1982<br />
wurde die Strecke zur neuen Endhaltestelle<br />
Dorfstraße um etwa 200 Meter<br />
verlängert, das Ausweichgleis am<br />
Klosterplatz ausgebaut. An der Dorfstraße<br />
gibt es mehr Platz und daher<br />
günstigere Umsteigmöglichkeiten für<br />
den Anschlussbus zum Schauinsland<br />
und zur Seilbahn. Nach der Einstellung<br />
der Lörracher Straßenbahn und<br />
vor der Eröffnung der neuen Straßenbahn<br />
in Weil am Rhein war dies die<br />
südlichste Stelle in Deutschland, wo<br />
eine Straßenbahn fährt. Traditionell<br />
verkehrt die Linie 2, die im Zehnminutentakt<br />
unterwegs ist. Es können<br />
nur Zweirichtungsfahrzeuge eingesetzt<br />
werden. Im Laufe der Jahrzehnte<br />
waren alle Freiburger Fahrzeugtypen<br />
mit Ausnahme der Einrichtungsachtachser<br />
und der Combini unterwegs.<br />
Kein sklavischer Nachbau<br />
Als Basis für meine Anlage dienten<br />
Aluminiumprofile (30 x 30 mm), die in<br />
der Industrie eingesetzt werden und<br />
universell verwendbar sind. Darauf<br />
ist eine zehn Millimeter starke Holzplatte<br />
(160 x 45 cm) aufgeschraubt.<br />
Ich wollte keinen sklavischen Nachbau<br />
des Vorbildes realisieren, es war<br />
mir nur wichtig, die Situation und die<br />
Stimmung des Vorbildes am Klosterplatz<br />
in Günterstal vor der Verlängerung<br />
<strong>nach</strong>zubilden. Die markanten<br />
strassenbahn magazin 1|2013 75
aßenbahn im Modell<br />
Für den Transport hat Jürgen Jaeschke seine Anlage mit einer Haube<br />
versehen. Sie ist mit vier Schrauben befestigt und schnell abnehmbar<br />
So sieht es dann unter <strong>dem</strong> Transportdeckel aus. Auf einer 160 mal 45<br />
Zentimeter großen Grundplatte erstand die Ortsmitte von Günterstal<br />
Dinge des Vorbildes sind vorhanden.<br />
An erster Stelle das Torhaus, das in<br />
ähnlicher Ausführung als Bausatz von<br />
Faller erhältlich ist. Die Toröffnung<br />
ist für die Straßenbahn ausreichend<br />
groß. Als zweites prägendes Gebäude<br />
ist das bis an das Gleis reichende Arkadenhaus<br />
vorhanden. Die Arkaden<br />
dienen auch als Überdachung der<br />
Haltestelle. Der Baustil der Häuser vor<br />
Ort entspricht ziemlich genau <strong>dem</strong> der<br />
Kleinstadthäuserserie von Faller.<br />
Ich habe einige Häuser fast im Akkord<br />
zusammengebaut. Zur Fixierung<br />
wurde in deren Grundplatte ein zehn<br />
Millimeter breites Holzstück eingepasst.<br />
Es wurde dann auf der Grundplatte<br />
festgeklebt. So können die<br />
Häuser jederzeit abgenommen werden.<br />
Natürlich wurden die Gebäude<br />
gealtert. Allerdings gibt es abweichend<br />
vom Vorbild drei Baulücken<br />
in der Häuserreihe, da es von der<br />
Faller-Serie keine Winkelhäuser gibt<br />
und ich mir den Selbstumbau nicht<br />
zumuten wollte. Auch war es mir ein<br />
Anliegen, die passenden Endhäuser<br />
zur Auflockerung mit zu verwenden.<br />
Man könnte die Anlage fast für eine<br />
Faller-Werbeanlage halten. Auf der<br />
nicht dargestellten gegenüberliegenden<br />
Straßenseite muss man sich das<br />
Kloster-Hauptgebäude mit der Kirche<br />
vorstellen.<br />
Ich habe die H0m-Tramgleise von Luna<br />
mit Kopfsteinmuster verwendet.<br />
Die Schienen sind mit bastlerischem<br />
Geschick sehr einfach zu verbauen,<br />
allerdings muss man auch genau<br />
arbeiten. Das Kopfsteinpflaster wäre<br />
aus Kunststoff mit profilierten<br />
Pflastersteinen sicher schöner als<br />
die jetzige aufgedruckte Ausführung.<br />
Hierfür wären aber Spritzgussformen<br />
notwendig, die die Kosten <strong>nach</strong> oben<br />
treiben würden. Über die langfristige<br />
Betriebssicherheit des Gleissystems<br />
kann ich keine Aussage treffen, da<br />
ich noch nicht viel darauf fahren<br />
konnte. Ich habe drei Weichen in die<br />
Anlage eingebaut. Abweichend zum<br />
Vorbild ist ein Abstellgleis zusätzlich<br />
vorhanden. Dies entspricht <strong>dem</strong><br />
Gleisplan der früheren Endstationen<br />
in Offenbach sowie in Reutlingen auf<br />
<strong>dem</strong> Karlsplatz. Die gepflasterten<br />
Platz- und Straßenbeläge stammen<br />
überwiegend von Evergreen. Für die<br />
asphaltierten Straßenteile habe ich<br />
einen Millimeter dicke Kunststoffplatten<br />
aus <strong>dem</strong> Flugzeugmodellbau<br />
verwendet.<br />
Ein Brunnen als Belebung<br />
Während des fortgeschrittenen Anlagenbaus<br />
musste ich feststellen, dass<br />
die Häuser beim Vorbild näher an<br />
den Gleisen stehen. Ich hätte die Abzweigung<br />
des Ausweichgleises wohl<br />
besser auf die andere Seite verlegen<br />
sollen. Eine Alternative wäre auch<br />
gewesen, die Häuser weiter vorzuziehen.<br />
Ich beschloss aber, diese<br />
kleine Abweichung zu belassen und<br />
den breiten Platz zwischen Gleisen<br />
und Häuserflucht zu beleben. So<br />
Nach vorne hat Jaeschke seine Anlage mit einer Hecke von Heki abgeschlossen. Beim Günterstaler Vorbild gibt es die Bepflanzung nicht J. jaeschke (7)<br />
76 strassenbahn magazin 1|2013
Anlagenba<br />
Weil auf der H0-Anlage der Abstand zwischen Häusern und Straßenbahngleis breiter als in Wirklichkeit ausfiel, füllt jetzt ein Brunnen den Raum<br />
wurde in der Mitte des Platzes ein<br />
Brunnen gestellt, links und rechts<br />
von einem Wochenmarkt und einem<br />
Dorffest eingerahmt. Die Dekoration<br />
des Platzes erfolgte hauptsächlich<br />
mit Biergarten- und Marktteilen von<br />
Busch. Allerdings musste ich beim<br />
Zusammenbasteln und Dekorieren<br />
der vielen kleinen Kohlköpfe sowie<br />
Biertische mit Gläsern und Flaschen<br />
häufige Erholungspausen einlegen.<br />
Für die Beleuchtung des Platzes verwende<br />
ich Brawa-Lampen. Dabei<br />
habe ich nur welche mit Sockel eingebaut,<br />
die bei einem Ausfall erneuert<br />
werden können. Auch die Häuser<br />
haben innen eine Beleuchtung, so<br />
dass ich auf meiner Tramanlage<br />
Günterstal Tag und Nacht Betrieb<br />
machen kann. Nach kompletter Fertigstellung<br />
konnte ich nun zufrieden<br />
feststellen, dass die ganze Anlage<br />
dank der Belebung um den Brunnen<br />
auf <strong>dem</strong> Markt sehr gewonnen hat.<br />
Bei vorbildentsprechend schmalem<br />
Haus-Gleis-Abstand hätte das Motiv<br />
sicherlich etwas verlassen gewirkt.<br />
Eine weitere Abweichung vom Vorbild<br />
ist die Hecke im Vordergrund. Sie<br />
dient als Abgrenzung zur Straße. So<br />
eine Bepflanzung war bei der früheren<br />
Endstation in Hall bei Innsbruck<br />
zu sehen. Die Gärten hinter den Häusern<br />
sowie vor <strong>dem</strong> Tor wurden den<br />
Vorbildern ähnlich gestaltet.<br />
Holzkiste für den Transport<br />
Die Einfachoberleitung habe ich aus<br />
0,7-Millimeter-Draht gelötet. Dieser<br />
dickere Draht ist zwar nicht maßstabsgerecht,<br />
ich habe mich aber<br />
wegen der Stabilität für ihn entschieden.<br />
Nach der Lackierung wirkt er<br />
nun zierlicher. Der Fahrdraht hängt<br />
an modernen Sommerfeldt-Masten.<br />
Ich steuere die Anlage konventionell<br />
über ein separates Stellpult. Zum<br />
sicheren Transport habe ich einen<br />
stabilen Holzkasten um die Anlage<br />
gebaut. Um sie auch verpackt von<br />
oben einsehen zu können, ist der<br />
Deckel des Kastens aus Plexiglas. Er<br />
lässt sich einfach durch Lösen von<br />
vier Schrauben abheben.<br />
3-D von i-Phone ausgetrickst<br />
■ Wirbelsturm Sandy war zwar<br />
schuld am Ausfall des New Yorker<br />
Internetservers vom 3-D-Drucker<br />
Shapeways (SM 12/12), dass aber<br />
die Website mit Modellen unseres<br />
Autoren Guido Mandorf auch da<strong>nach</strong><br />
nicht auffindbar war, lag an seinem<br />
i-Phone. Mit <strong>dem</strong> »klugen Fernsprecher«<br />
hatte er die Seitenadresse<br />
an die Redaktion übermittelt. Dabei<br />
schmuggelte seine Rechtschreibkontrolle<br />
einige Großbuchstaben rein,<br />
was das Internet nun gar nicht mag.<br />
Richtig lautet die Zugangsadresse:<br />
shapeways.com/shops/tramspotters<br />
Übrigens stammen auch die von<br />
Brandenburger und Essener Vereinen<br />
angebotenen 3-D-Trammodelle<br />
von Mandorf. Er selbst verdient am<br />
Verkauf seiner Entwürfe nichts. Auch<br />
von Shapeways bekommt er keinen<br />
Anteil vom Verkaufserlös. JOG<br />
An einem Anlagenende wurde das<br />
Gleis bis unmittelbar an die Kante<br />
geführt. Durch die Verwendung von<br />
Luna können die Übergänge von einem<br />
Modul zum anderen sehr sicher<br />
gebaut werden. Durch das Hohlschienenprofil<br />
mit den Verbindungszapfen<br />
ist die elektrische und mechanische<br />
aNZeIGeN<br />
Verbindung sehr stabil und kann<br />
einfach hergestellt werden. Es lassen<br />
sich also noch weitere Anlagenmodule<br />
anschließen. Meine Anlage »Klosterplatz<br />
in Günterstal« wird nicht lange<br />
alleine bleiben. Ein weiteres Modul<br />
mit einer markanten Betriebssituation<br />
ist zur Zeit im Bau. JÜRGEN JAESCHKE<br />
www.bus-und-bahn-und-mehr.de<br />
DÜWAG-<br />
Verschiedene<br />
Varianten<br />
Lieferbar<br />
ab<br />
Januar '13<br />
Sie finden uns im Internet oder fordern Sie einfach unsere kostenlose<br />
Versandliste an vom: Versandhandel BUS UND BAHN UND MEHR<br />
Geschwister-Scholl-Straße 20 · 33613 Bielefeld · Telefon 0521-8989250<br />
Fax 03221-1235464 · E-Mail: info@bus-und-bahn-und-mehr.de<br />
Straßenbahn-Bücher und Nahverkehrs-Literatur<br />
Im Versand, direkt <strong>nach</strong> Haus<br />
ganz NEU TRAMS 2013 (niederl.), 272 S., 15 x 21 cm, 306 Farbaufnahmen, Sonderthema „Überlandbahnen CH“ 20,00 €<br />
ganz NEU Die LOWA-Straßenbahnwagen ET 50/54 + EB 50/54 (Kalbe, Möller, Vondran), 256 S., 17 x 24 cm, ~220 Abb. 28,50 €<br />
NEU U-Bahn, S-Bahn & Tram in <strong>Berlin</strong> (Schwandl), 128 Seiten, 17 x 24 cm, 200 Abb., diverse Netzpläne 14,50 €<br />
ganz NEU 130 Jahre Straßenbahn in <strong>Berlin</strong>-Köpenick (J. Kubig, Neddermeyer-V.), 96 Seiten, A4, 120 Aufn. 12,80 €<br />
ganz NEU Die Freiburger Straßenbahn heute (EK-Bildarchiv, Band 2), 96 S., 24 x 17, ~ 100 SW- + Farbf. 19,80 €<br />
ganz NEU Bitte umsteigen. Mit Linie 11 ins Grüne, Haspe Voerde Breckerfeld (Göbel, Rudat), 348 S., A4 39,00 €<br />
NEU Tram von Paderborn <strong>nach</strong> Detmold im Bild (Reim., Bimmerm.), 240 S., ~24 x 17 cm, 438 SW- + 20 Farbfotos, 86 Zeichn. 29,80 €<br />
ganz NEU Die Straßenbahn in Kleve (Kenning-Verlag), 96 Seiten, A 4, 36 Farb- + 141 SW-Fotos, 14 Zeichnungen 24,95 €<br />
ganz NEU Die Wormser Straßenbahn (Häussler, Sutton) 128 S., 17 x 24 cm, 200 SW-Abb. (Halle Frühj. 2013) 18,95 €<br />
ganz NEU Mit 5 + 25 unterwegs Zeitreise ... Straßenbahn Wuppertal Solingen (Eidam, Reim.), 224 S., 525 F. 29,80 €<br />
ganz NEU Subways & Light Rail in den USA – 2: Westen 160 Seiten, 17 x 24 cm, Netzpläne, ~ 300 Farbfotos 19,50 €<br />
ganz NEU Yellow trams – orange Busses 66 S., 24 x 21, 100 Farbf., Lissabon + alle Betriebe Portugal 16,00 €<br />
ganz NEU Bydgoskie tramwaje (Bromberger Straßenbahn, Eurosprinter), 352 Seiten, A4, 530 Abb., Netzpläne, polnisch 35,00 €<br />
ganz NEU Wiener Straßenbahnlinien 71 ~ 82 160 S., 15 x 22, >100 SW- + ~ 50 Farbf. (noch lieferbar: ... 51 ~ 60 + 61 ~ 70) 24,90 €<br />
ganz NEU Belgian Vicinal Tram&Light Rail Fleet 1885-1991 (Maase, LRTA), 246 Seiten, A4, viele Fotos, 56 Zeichnungen 65,80 €<br />
ganz NEU Tussen stad en land (Moerland, Hoogerhuis), 208 S., A4, 300 Farbabb.+Karten, von Überlandbahnen bis Stadtbahn 35,00 €<br />
Alle Straßenbahn-Neuheiten (auch von Betrieben)/zzgl. Porto/Verpackung (1,50 bis 4,00 €)<br />
TS: T t<br />
Foto: Archiv Stadtwerke Bielefeld<br />
– <br />
✕<br />
Gelenkwagen GT6<br />
Bielefeld<br />
!<br />
Mehr Infos im Internet<br />
oder Infoblatt anfordern<br />
TramShop, Rolf Hafke, Sieben-Schwaben-Weg 22, 50997 Köln<br />
t 0 22 33-92 23 66 F 0 22 33-92 23 65 m Hafke.Koeln@t-online.de<br />
strassenbahn magazin 1|2013 77
Ihre Seiten: Ergänzungen, Anmerkungen, Kritik und Anregung<br />
0 89 – 13 06 99-720<br />
ö 0 89 – 13 06 99-700<br />
: redaktion@geramond.de<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Postfach 40 02 09 · 80702 München<br />
Der Atw 4092 im Juli 2012 im Prager<br />
Straßenbahnmuseum im Betriebshof<br />
Stresovice<br />
C. MUCH<br />
Zu »60 Jahre Schörling-Schleifwagen«<br />
(SM 11/2012)<br />
Wagen jetzt im Museum<br />
Zu diesem Beitrag von Winfried Wolff<br />
kann ich folgende ergänzende Informationen<br />
geben: Der Prager Atw 4092 befindet<br />
sich inzwischen im Straßenbahnmuseum<br />
im Betriebshof Stresovice und<br />
ist dort für Besucher zugänglich. Im 2005<br />
von den Prager Verkehrsbetrieben herausgegebenen<br />
Buch »Kolejova vozidla<br />
prazske mestske hromadne dopravy« ist<br />
eine ganze Seite mit Daten, Zeichnungen<br />
und weiteren Informationen zum Atw<br />
4092 enthalten. Christian Much, <strong>Berlin</strong><br />
Zu »Das besondere Bild«<br />
(SM 11/2012)<br />
Fehler bei Fotostandort<br />
Die Aufnahmen zeigt den OEG-Triebwagen<br />
19 mit den vier Schotterwagen<br />
nicht auf der (eingleisigen) »C«-Strecke<br />
<strong>nach</strong> Heddesheim, sondern unweit des<br />
Bahnhofes Käfertal auf der (zweigleisigen)<br />
Strecke <strong>nach</strong> Weinheim der damaligen Linie<br />
»A«.<br />
Am Bahnhof Käfertal gehen, von<br />
Mannheim kommend, zwei Strecken ab<br />
– und zwar einerseits die eingleisige <strong>nach</strong><br />
Heddesheim und andererseits die zweigleisige<br />
<strong>nach</strong> Weinheim. Der Fotostandpunkt<br />
mit <strong>dem</strong> Tg 19 ist nur etwa 100<br />
Meter <strong>nach</strong> Ausfahrt aus <strong>dem</strong> Bahnhof zu<br />
finden, im Hintergrund sieht man den<br />
Bahnübergang Ladenburger Straße. Die<br />
Heddesheimer Strecke führt östlich davon<br />
unter dieser und der B38 drunter durch.<br />
Von <strong>dem</strong> im Text erwähnten »recht eigentümlichen<br />
Zugverband« mit den Rastatter<br />
Triebwagen hab ich eine Aufnahme,<br />
entstanden im Bahnhof Edingen. Das<br />
Arbeitsfahrzeug wird dabei von den Tw<br />
71 (355) und 74 (356) flankiert.<br />
Jürgen Niemeyer, Mannheim<br />
Zu »Vorzeigebetrieb an der<br />
Elster« (SM 10/2012)<br />
Tw-Rest in Naumburg<br />
In <strong>dem</strong> Artikel wird ausgeführt: »Aus<br />
Jena holte man den Gotha-T57 Tw 106<br />
(ex Gera Tw 150) zurück ...« Nach meinem<br />
Kenntnisstand wurde der Jenenser<br />
Tw 106 zwar <strong>nach</strong> Gera zurückgeholt, jedoch<br />
<strong>nach</strong> einer Zustandsanalyse nicht<br />
aufgearbeitet, so dass stattdessen der<br />
LOWA-Tw 16 mit den Gotha-Bw 248 einen<br />
Zugverband bildet.<br />
Zum Tw 106 wird bei www.ringbahnnaumburg.de<br />
ausgeführt:<br />
1962 ex Gera 150; 1964 in 126 umgezeichnet;<br />
1981 umgezeichnet in 7-6600/<br />
061, 1993 umgezeichnet in 106II, am 13.<br />
März 2003 <strong>nach</strong> Gera, 2004 verschrottet.<br />
Siehe dazu auch www.gothawagen.de/<br />
gothawagen/staedte/gera/tabelletwgera.html<br />
Uwe Möckel, Zwickau<br />
Ergänzend traf dazu der Hinweis ein:<br />
»Im Herbst 2004 wurde in Gera der<br />
Aufbau des Tw 106 verschrottet. Aus seinem<br />
Fahrwerk sollte anschließend eine<br />
Transportlore entstehen. Da es sich jedoch<br />
für diesen Umbau nicht eignete, kam es<br />
im März 2005 im Tausch gegen das Fahrwerk<br />
des Beiwagens 007 <strong>nach</strong> Naumburg.<br />
Dort wird es zur Ersatzteilgewinnung verwendet<br />
bzw. soll in einen »Hunt« umgebaut<br />
werden. R. Däubner, per E-Mail<br />
Bevor der Hagener Tw 81 am 14. Mai<br />
1963 in Dienst gestellt worden ist,<br />
absolvierte er am 12. Mai eine letzte<br />
Probe- und Abnahmefahrt. Die Aufnahme<br />
von Dr. Rolf Löttgers entstand<br />
zwischen <strong>dem</strong> Bahnhof und der Trennungsweiche<br />
Voerde SLG. J. RUDAT<br />
Zu »Letzte von einst Dreien«<br />
(SM 10/2012)<br />
Düwag klassischer<br />
Bauart<br />
Seite 24 oben zeigt den Wagen 159.<br />
Es handelt sich aber nicht um einen »Typ<br />
Mannheim«, sondern um einen Düwag-<br />
Achtachser der »klassischen« Bauart. Wagen<br />
vom »Typ Mannheim« (in Mannheim<br />
und Ludwigshafen übrigens alles Sechsachser)<br />
sind nie auf den Ludwigshafener<br />
Binnenlinien eingesetzt worden.<br />
Jürgen Niemeyer, Mannheim<br />
Zu »Ebbelwei-Express«<br />
(Journal SM 12/2012)<br />
Keine Aufbauwagen<br />
Auf Seite 13 ist im Bericht über die Sanierung<br />
des Frankfurter Ebbelwei-Express<br />
(kurz EEx) <strong>dem</strong> Autor ein Fehler unterlaufen.<br />
Die Wagen des EEx sind keine Aufbauwagen,<br />
sondern Verbandstyp-I-Wagen,<br />
da sie auf neuen Fahrgestellen<br />
aufgebaut wurden.<br />
Es gab in Frankfurt zwei Serien der K-<br />
Wagen: Die Wagen 101–125, aus denen<br />
später viele Arbeitswagen und auch die<br />
Fahrzeuge des EEx entstanden, wurden<br />
von Credé als Verbandstyp-I-Wagen auf<br />
Neubau-Fahrgestellen gebaut.<br />
Die Wagen 461–500 wurden von<br />
Düwag auf alten Fahrgestellen kriegszerstörter<br />
CF-, CFv, F- und G-Triebwagen aufgebaut<br />
und sind somit tatsächlich Aufbauwagen,<br />
aber diese wurden nicht zum<br />
EEx umgebaut.<br />
Bertram Barten, Frankfurt<br />
Zu »50. Geburtstag in der<br />
Ferne« (SM 11/2012)<br />
Hagener Tw mit<br />
»Storchenschnabel«<br />
Mit Freude habe ich den Artikel aus<br />
der Feder von Andreas Mausolf bezüglich<br />
des »Geburtstags in der Fremde« über die<br />
Hagener Sechsachser gelesen. Eine wirklich<br />
sehr nette Idee.<br />
Da ich mit diesen Wagen quasi als<br />
Fahrgast und Bewohner eines Straßenbahner-Hauses<br />
groß geworden bin und<br />
das Betriebsende sowie deren Abtransport<br />
»hautnah« miterlebt habe, sind mir<br />
ein paar winzige Recherchefehler aufgefallen,<br />
die einer Berichtigung bedürfen:<br />
1. Die HAGENER <strong>STRASSENBAHN</strong> AG beschaffte<br />
die erwähnten 26 Gelenkwagen<br />
nicht bis 1963, sondern bis 1968. Der<br />
Tw 84 wurde am 20. März 1968, Tw 85<br />
am 23. März 1968 in Dienst gestellt (siehe<br />
auch SM 4/2008).<br />
2. Die zwölf <strong>nach</strong> Würzburg verkauften<br />
Wagen gingen nicht erst 1976 <strong>nach</strong> der<br />
Gesamteinstellung, sondern bereits <strong>nach</strong><br />
Stilllegung der Linien 2 und 3 unmittelbar<br />
vor Umbaubeginn des Betriebshofes<br />
Oberhagen ab <strong>dem</strong> 8. Oktober 1975 per<br />
Bahn in die Frankenmetropole.<br />
3. Die 1963 gelieferte Serie der Tw 76 bis<br />
81 verfügte bereits ab Werk über einen<br />
Stemmann-Bügel vom Typ BS-70, der in<br />
Hagen liebevoll »Storchenschnabel« genannt<br />
wurde. Bis auf Tw 79, der unfallbedingt<br />
seinen Bügel mit Tw 75 tauschen<br />
musste, wurden alle Tw des 1963er Bauloses<br />
mit diesem Bügel von der HST an<br />
die WSB geliefert (s. Foto).<br />
78 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013
Termine<br />
22. Dezember, Halle (Saale): Adventsfahrten mit historischen<br />
Straßenbahnen, jeweils 12 bis 18 Uhr, Informationen<br />
über Hallesche Straßenbahnfreunde e.V., Seebener<br />
Straße 191, 06114 Halle (Saale).<br />
23. Dezember, Karlsruhe:Trams aus den 1920er- bis<br />
1940er-Jahren verkehren von 13 bis ca. 19 Uhr auf der<br />
vom TSNV in Zusammenarbeit mit den VBK betriebenen<br />
historischen Adventsringlinie. Gefahren wird im Uhrzeigersinn<br />
vom Hbf über Karlstraße, Europaplatz, Marktplatz,<br />
Ettlinger Straße zurück zum Hbf. Die Fahrten sind kostenlos,<br />
eine Spende zur Erhaltung der Museumsfahrzeuge<br />
ist willkommen. Informationen unter www.tsnv.de.<br />
23. Dezember, Stuttgart: Der Glühwein-Express (DoT4<br />
917) auf Tour! Eine Platzreservierung ist erforderlich –<br />
siehe http://express.shb-ev.info oder unter Telefon<br />
0711/822 210 donnerstags von 17 bis 19 Uhr.<br />
22. Dezember, Halle (Saale): Adventsfahrten mit historischen<br />
Straßenbahnen, jeweils 12 bis 18 Uhr, Informationen<br />
über Hallesche Straßenbahnfreunde e.V., Seebener<br />
Straße 191, 06114 Halle (Saale).<br />
Ob Tag der offenen Tür, Sonderfahrt oder Sym posium:<br />
Veröffentlichen Sie Ihren Termin hier kostenlos.<br />
Fax (0 89) 13 06 99-700 · E-Mail: redaktion@geramond.de<br />
5. Januar 2013, Dresden: Das Straßenbahnmuseum<br />
Dresden auf <strong>dem</strong> Gelände des Betriebshofes Dresden-<br />
Trachenberge hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet; Besichtigung<br />
der Museumshallen, des Werkstattbereiches und<br />
der historischen Wagen; bis 15 Uhr stündlich Führungen,<br />
Eintrittspreis: 3 EUR pro Person.<br />
7. Januar 2013, Braunschweig: traditionelle Neujahrsrundfahrt<br />
der Braunschweiger Interessengemeinschaft<br />
Nahverkehr e.V. Etwa dreistündige Sonderfahrt<br />
mit zwei Trams; Abfahrt 10.15 Uhr am Hauptbahnhof<br />
(Bahnsteig A)/Nahverkehrsterminal; Erwachsene 4,50<br />
EUR, Kinder 2,50 EUR; Karten sind ausschließlich im Vorverkauf<br />
beim Touristbüro der Stadt am Burgplatz erhältlich;<br />
Restkarten am Fahrtag – siehe www.bin-info.de.<br />
2. Februar 2013, Dresden: Das Straßenbahnmuseum<br />
Dresden auf <strong>dem</strong> Gelände des Betriebshofes Dresden-<br />
Trachenberge hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet; Besichtigung<br />
der Museumshallen, des Werkstattbereiches und<br />
der historischen Wagen; bis 15 Uhr stündlich Führungen,<br />
Eintrittspreis: 3 EUR pro Person.<br />
Lesen<br />
Sie noch oder<br />
sammeln<br />
<br />
Sie schon?<br />
4. Nach den guten Erfahrungen hat die IVB <strong>nach</strong> Inbetriebnahme<br />
des letzten »Hagener« Tw 69 (IVB 89) in<br />
Belgrad versucht, von dort »Hagener« anzukaufen. Dies<br />
ist aber – <strong>nach</strong> Aussage der IVB Geschäftsleitung von<br />
2005 – vornehmlich aus politischen Gründen und durch<br />
die Intervention der Tiroler Verwaltung zu Beginn der<br />
1980er-Jahre nicht möglich gewesen. Der mittlerweile<br />
ramponierte Zustand und der teilweise vorgenommene<br />
radikale Umbau zu Einrichtungswagen mögen ein zusätzliches<br />
Hindernis gewesen sein.<br />
Da der Zukauf der »Hagener« durch die GSP in Belgrad<br />
1977 quasi nur einen »Großversuch« darstellte,<br />
mit welchem Fahrzeugtyp der Wagenpark zukünftig<br />
modernisiert werden sollte, ist ein Ankauf von zusätzlichen<br />
Wagen aus Innsbruck völlig abwegig (siehe SM<br />
4/2008). Jörg Rudat, Hagen<br />
Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens hat der<br />
Verein »Straßenbahnmuseum Dresden e.V.« im Sommer<br />
2012 mit Unterstützung der Dresdner Verkehrsbetriebe<br />
AG einen großformatigen Kalender herausgegeben.<br />
Auf den 19 Seiten im Format 42 x 30 cm<br />
befinden sich meist Collagen aus zwei bis sieben Aufnahmen,<br />
die ganz unterschiedlichen Themen gewidmet<br />
sind. Dabei werden, wie vermutlich von allen Käufern<br />
erwartet, sowohl die großen Hechte als auch die<br />
für Dresden typischen Tatra-Fahrzeuge in origineller<br />
Weise vorgestellt. Doch auch Aufnahmen von großen<br />
MAN-Wagen, der meterspurigen Fahrzeuge im Lockwitzgrund<br />
sowie von der ebenfalls meterspurigen Industriebahn<br />
Deuben füllen die jeweiligen<br />
Kalenderblätter.<br />
Ein »Hingucker« sind die Aufnahmen<br />
des heutigen Museumswagens<br />
309 – z.B. von 1967 als<br />
»München 153« für einen DEFA-<br />
Film.<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
Zu Fotografien im <strong>STRASSENBAHN</strong><br />
<strong>MAGAZIN</strong><br />
Verschlusszeiten beachten<br />
Ein Kalender für eineinhalb Jahre!<br />
Viele früher allgemein bekannte handwerkliche Fotografier-Techniken<br />
sind mit den digitalen Kameras samt<br />
deren Automatik-Funktionen oder durch Mobiltelefone<br />
mit integrierten Kameras untergegangen. Das beobachte<br />
ich mit Sorge, denn an meiner ersten Spiegelreflexkamera<br />
der Marke »Edixa« musste ich 1966 noch<br />
Belichtungszeit und Blende von Hand einstellen.<br />
Beim Betrachten von aktuellen Aufnahmen im<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> fällt mir auf, dass die elektronischen<br />
Zielanzeigen der Trams manchmal nicht lesbar<br />
sind. Anstatt der Stationsnamen sieht man dunkle<br />
Streifen oder Fehlstellen – so z.B. im SM 10/2012 auf<br />
Mit den teils eher klein, dafür aber zahlreich abgedruckten<br />
Aufnahmen bietet der Kalender eine<br />
will kommene Abwechslung zu den Standard-Produkten,<br />
auf denen sich jeweils ein Motiv in fester Größer<br />
befindet. Auf den Kalenderseiten in gelben Info-Kästen<br />
abgedruckte Erklärungen bieten viel Hintergrund -<br />
wissen zur Dresdner Tramgeschichte, so dass <strong>dem</strong><br />
Betrachter ein lästiges Umblättern auf die Rückseiten<br />
erspart bleibt.<br />
Erhältlich ist der Kalender beim Straßenbahn -<br />
museum Dresden e.V., Trachenberger Str. 38 in 01129<br />
Dresden (zzgl. Porto auch per Post) oder an allen Servicepunkten<br />
der DVB in Dresden.<br />
AM<br />
20 Jahre Straßenbahnmuseum<br />
Dresden e.V., gegründet am 2.<br />
Juni 1992; Kalender 2012/2013;<br />
Format 42 x 30 cm; 20 Innenseiten,<br />
meist mit farbigen Aufnahmen<br />
illustriert; Preis: 9,90 EUR<br />
Diese hochwertigen Acryl-Sammelkassetten<br />
helfen Ihnen, Ihre <strong>STRASSENBAHN</strong>-<br />
<strong>MAGAZIN</strong>-Ausgaben zu ordnen. In jede<br />
Kassette passt ein kompletter Jahrgang.<br />
1 Acryl-Kassette<br />
€ 18,95<br />
Best.-Nr. 75000<br />
15% gespart bei 5 Acryl-Kassetten<br />
€ 79,95<br />
Best.-Nr. 75001<br />
Jetzt bestellen unter:<br />
www.strassenbahn-magazin.de oder<br />
Telefon 0180-532 16 17<br />
(14 Cent/Minute von 8-18 Uhr)
Leserbriefe · Impressum<br />
Nummer 279 • 1/2013 • Januar • 44. Jahrgang<br />
Der im SM 12/2012 auf <strong>dem</strong><br />
»Besonderen Bild« vorgestellte<br />
Tw 143 existiert in Porto bis<br />
heute, hier in seinem aktuellen<br />
Zustand im Mai 2009 an der gleichen<br />
Stelle wie das Bild von 1976!<br />
Er erhielt in den 1940er-Jahren<br />
einen modifizierten Wagenkasten<br />
<strong>nach</strong> Brill-Vorbildern.<br />
Postleitzahlgebiet 0<br />
Thalia-Buchhandlung, 02625 Bautzen,<br />
Kornmarkt 7 · Fachbuchhandlung<br />
Hermann Sack, 04107 Leipzig, Harkortstr.<br />
7<br />
Postleitzahlgebiet 1<br />
Schweitzer Sortiment, 10117 <strong>Berlin</strong>,<br />
Französische Str. 13/14 · Struppe &<br />
Winckler <strong>Berlin</strong>, 10117 <strong>Berlin</strong>,<br />
Kronenstr. 42 · Loko Motive Fachbuchhandlung,<br />
10777 <strong>Berlin</strong>, Regensburger<br />
Str. 25 · Modellbahnen & Spielwaren<br />
Michael Turberg, 10789 <strong>Berlin</strong>,<br />
Lietzenburger Str. 51 · Buchhandlung<br />
Flügelrad, 10963 <strong>Berlin</strong>, Stresemannstr.<br />
107 · Modellbahn-Pietsch,<br />
12105 <strong>Berlin</strong>, Prühßstr. 34<br />
Postleitzahlgebiet 2<br />
Boysen + Mauke, 22772 Hamburg,<br />
Postfach 570333 · Buchhandlung<br />
Bernd Kohrs, 22927 Großhansdorf,<br />
Eilbergweg 5A · Roland Modellbahnstudio,<br />
28217 Bremen, Wartburgstr.<br />
59<br />
Postleitzahlgebiet 3<br />
Buchhandlung Decius, 30159 Hannover,<br />
Marktstr. 52 · Train & Play, 30159<br />
Hannover, Breite Str. 7 · Buchhandlung<br />
Graff, 38012 Braunschweig, Postfach<br />
2243 · Pfankuch Buch, 38023 Braunschweig,<br />
Postfach 3360<br />
Postleitzahlgebiet 4<br />
Buchhaus Antiquariat, 40217 Düsseldorf,<br />
Friedrichstr. 24-26 · Menzels Lokschuppen,<br />
40217 Düsseldorf, Friedrichstr.<br />
6 · Goethe-Buchhandlung,<br />
40549 Düsseldorf, Will stätterstr. 15 ·<br />
Modellbahnladen Hilden, 40704 Hilden,<br />
Postfach 408 · Buchhandlung<br />
Irmgard Barnes, 42855 Remscheid,<br />
80<br />
D. BUDACH<br />
den Seiten 16, 50 oben sowie 66. Dieses<br />
Phänomen wird durch die Stromtaktung<br />
verursacht, die nicht immer mit der Automatikfunktion<br />
einer Digitalkamera kompatibel<br />
ist. Um die Zielanzeigen fehlerfrei<br />
zu fotografieren, wäre eine langsamere<br />
Verschlusszeit (1/160 oder 1/125 Sekunde)<br />
notwendig gewesen.<br />
Derart entstellte Aufnahmen genügen<br />
meinem fotografischen Qualitätsanspruch<br />
an aktuelle, jederzeit wiederholbare Fotos<br />
überhaupt nicht – auch wenn das Motiv<br />
insgesamt schön ist! Bei historischen Fotos<br />
sehe ich das natürlich anders, weil<br />
nicht wiederholbar – doch da gab es noch<br />
keine LED-Anzeigen.<br />
Es würde mich freuen, wenn die Redaktion<br />
des <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
zur Veröffentlichung bestimmte Aufnahmen<br />
in Zukunft etwas sorgfältiger auswählt.<br />
Die Zeitschrift sollte sich von manchen<br />
Straßenbahnfan-Blogs und der<br />
Qualität der dort gezeigten Fotos positiv<br />
abheben.<br />
Ernst-Otto Tetzner, Königswinter<br />
Zu »Linie G über die Traun?«<br />
(SM 12/2012)<br />
Welche ist die Steilste?<br />
Im Bericht über die Gmundener Straßenbahn<br />
wird eine Steigung von 96 bzw.<br />
100 ‰ genannt. Dabei taucht für mich<br />
die Frage auf, welche Straßenbahnstrecke<br />
in Deutschland aktuell die steilste, in<br />
Betrieb befindliche ist: Mainz mit 96 ‰?<br />
In diesen Fachgeschäften erhalten Sie das <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Hastener Str. 41 · Rolf Kerst Fachbuchhandlung,<br />
47051 Duisburg, Ton -<br />
hallenstr. 11a · Fach buchhandlung Jürgen<br />
Donat, 47058 Duis burg,<br />
Ottilienplatz 6 · WIE – MO, 48145<br />
Münster, Warendorfer Str. 21<br />
Postleitzahlgebiet 5<br />
Technische Spielwaren Karin Lindenberg,<br />
50676 Köln, Blaubach 6-8 · Modellbahn-Center<br />
Hüner bein, 52062<br />
Aachen, Markt 11-15 · Mayersche<br />
Buchhandlung, 52064 Aachen, Matthiashofstr.<br />
28-30 · Buchhand lung<br />
Carl Machwirth, 55221 Alzey, Postfach<br />
1380 · Buchhandlung Karl Kersting,<br />
58095 Hagen, Bergstr. 78 · A. Stein -<br />
sche Buchhand lung, 59457 Werl,<br />
Postfach 6064<br />
Postleitzahlgebiet 6<br />
Kerst & Schweitzer, 60486 Frankfurt,<br />
Solms str. 75 · Thalia Medienservice,<br />
65205 Wies baden, Otto-von-Guericke-Ring<br />
10 · Buch handlung Dr. Kohl,<br />
67059 Ludwigs hafen, Ludwigstr. 44-<br />
46 · Modelleisen bahnen Alexander<br />
Schuhmann, 69214 Eppelheim, Schützenstr.<br />
22<br />
Postleitzahlgebiet 7<br />
Stuttgarter Eisenbahn-u.Verkehrsparadies,<br />
70176 Stuttgart, Leuschnerstr. 35<br />
· Buchhandlung Wilhelm Messerschmidt,<br />
70193 Stuttgart, Schwabstr.<br />
96 · W. Kohlhammer Verlag, 70565<br />
Stuttgart, Heßbrühlstr. 69 · Buchhandlung<br />
Albert Müller, 70597 Stutt gart,<br />
Epplestr. 19C · Eisen bahn-Treffpunkt<br />
Schweickhardt, 71334 Waiblingen,<br />
Biegel wiesenstr. 31 · Osiandersche<br />
Buch handlung, 72072 Tübingen, Unter<br />
<strong>dem</strong> Holz 25 · Buch verkauf Alfred<br />
Junginger, 73312 Geis lingen, Karlstr.<br />
14 · Buchhandlung Robert Baier,<br />
74564 Crailsheim, Karlstr. 27 · Service<br />
rund ums Buch Uwe Mumm, 75180<br />
Pforzheim, Hirsauer Str. 122 · Modellbahnen<br />
Mössner, 79261 Gutach,<br />
Landstr. 16 A<br />
Postleitzahlgebiet 8<br />
Fachbuchhandlung Schweitzer Sortiment,<br />
80295 München, Postfach ·<br />
Fachbuchzentrum & Antiquariat Stiletto,<br />
80634 München, Schulstr. 19 ·<br />
Buchhandlung & Antiquariat Heinrich<br />
Hugen dubel, 80636 München, Albrechtstr.<br />
14 · Buch handlung Am Gasteig,<br />
81669 München, Ro sen heimer<br />
Str. 12 · Adler Präzisonsmodelle,<br />
82054 Sauerlach, Hirschbergstr. 33 ·<br />
Augsburger Lok schuppen, 86199<br />
Augsburg, Gögginger Str. 110 · Verlag<br />
Benedikt Bickel, 86529 Schroben -<br />
hausen, Ingolstädter Str. 54<br />
Postleitzahlgebiet 9<br />
Buchhandlung Jakob, 90402 Nürnberg,<br />
Hefners platz 8 · Modellbahnvertrieb<br />
Gisela Scholz, 90451 Nürnberg,<br />
Nördlinger Str. 13 · Modell spielwaren<br />
Helmut Sigmund, 90478 Nürnberg,<br />
Schweiggerstr. 5 · Buchhandlung<br />
Rupprecht, 92648 Vohenstrauß, Zum<br />
Beckenkeller 2 · Fried rich Pustet & .,<br />
94032 Passau, Nibe lun gen platz 1 ·<br />
Schöningh Buchhandlung & ., 97070<br />
Würz burg, Franziskanerplatz 4<br />
Österreich<br />
Buchhandlung Herder, 1010 Wien,<br />
Wollzeile 33 · Modellbau Pospischil,<br />
1020 Wien, Novaragasse 47 · Technische<br />
Fachbuch handlung, 1040 Wien,<br />
Wiedner Hauptstr. 13 · Leporello – die<br />
Sicher, wenn es um Steigung ohne All -<br />
achsantrieb geht.<br />
Inzwischen habe ich herausgefunden:<br />
Der Abschnitt in der Bismarckstraße von<br />
Remscheid war mit einer Steigung von<br />
10,8 % der damals steilste Straßenbahnabschnitt<br />
im Deutschen Reich. Prag hat<br />
zahlreiche 85-‰-Steigungen mit engen<br />
Bögen, Brest fährt auf 85,9 ‰, die meterspurige<br />
MVG befährt in Mainz die Gaustraße<br />
mit 96 ‰ ohne Allradantrieb; die<br />
Rampe zum Heuchelhof in Würzburg weist<br />
110 ‰ auf, ist aber nur im Allachsantrieb<br />
zulässig, ebenso die Stadtbahn im englischen<br />
Sheffield; die Pöstlingbergbahn in<br />
Linz (Österreich) darf mit Allachsantrieb<br />
sogar 116 ‰ hinausklettern.<br />
Ernst-Otto Tetzner, Königswinter<br />
Buchhandlung, 1090 Wien, Liechtensteinstr.<br />
17 · Buchhandlung Mora wa,<br />
1127 Wien, Postfach 99 · Buchhandlung<br />
Johannes Heyn, 9020 Klagenfurt,<br />
Kramergasse 2-4<br />
Belgien<br />
Musée du Transport Urbain Bruxellois,<br />
1090 Brüssel, Boulevard de Smet de<br />
Naeyer 423/1 · Ferivan Modelbouw,<br />
2170 Merksem (Antwer pen), Postbus<br />
55<br />
Schweiz<br />
Zeitschriftenagentur Huber & Lang,<br />
3000 Bern 9 Postfach<br />
Tschechien<br />
Rezek Pragomodel, 110 00 Praha 1<br />
Klimentska 32<br />
Dänemark<br />
Peter Andersens Forlag, 2640 Hedehusene,<br />
Brandvaenget 60<br />
Spanien<br />
Librimport, 8027 Barcelona, Ciudad<br />
de Elche 5<br />
Großbritannien<br />
A B O U T, GU46 6LJ, Yateley, 4 Borderside<br />
Luxemburg<br />
G.A.R. Dokumentation, 8398 Roodt,<br />
Nouspelterstrooss 2<br />
Niederlande<br />
van Stockum Boekverkopers, 2512 GV,<br />
Den Haag, Westeinde 57 · Railpress<br />
Papendrecht, 2951 GN, Alblasserdam,<br />
Plantageweg 27-D · NVBS Winkel,<br />
3800 BJ, Amersfoort, Postbus 1384 ·<br />
Norsk Modelljernbane AS, 6815 ES,<br />
Arnheim, Kluizeweg 474<br />
Betriebe<br />
Fahrzeuge<br />
Geschichte<br />
www.strassenbahn-magazin.de<br />
Redaktionsanschrift:<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Postfach 40 02 09 · D-80702 München<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.720<br />
Fax + 49 (0) 89.13 06 99.700<br />
redaktion@strassenbahn-magazin.de<br />
Verantw. Redakteur:<br />
André Marks, andre.marks@geramond.de<br />
Redaktion:<br />
Michael Krische (CvD), Thomas Hanna-Daoud<br />
Redaktion Straßenbahn im Modell:<br />
Jens-Olaf Griese-Bande low,<br />
jobandelow@geramond.de<br />
Redaktionsteam:<br />
Berthold Dietrich-Vandoninck, Michael Kochems,<br />
Philipp Krammer, Bernhard Kuß magk,<br />
Dr. Martin Pabst, Axel Reuther, Robert Schrempf,<br />
Michael Sperl<br />
Redaktionsassistenz: Brigitte Stuiber<br />
ABO –HOTLINE<br />
Leserservice, GeraMond-Programm<br />
Tel. 0180 – 532 16 17 (14 ct/min.)<br />
Fax 0180 – 532 16 20 (14 ct/min.)<br />
leserservice@strassenbahn-magazin.de<br />
Gesamtanzeigenleitung:<br />
Helmut Kramer<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.270<br />
helmut.kramer@verlagshaus.de<br />
Anz.-leitung <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>:<br />
Helmut Gassner<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.520<br />
helmut.gassner@verlagshaus.de<br />
Anzeigendispo <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>:<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.130<br />
anzeigen@verlagshaus.de<br />
www.verlagshaus-media.de<br />
Es gilt Anzeigenpreisliste Nr. 23 vom 1.1.2013<br />
Layout: Axel Ladleif<br />
Litho: Cromika, Verona<br />
Druck: Stürtz GmbH,<br />
Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg<br />
Verlag:<br />
GeraMond Verlag GmbH,<br />
Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
Geschäftsführung:<br />
Clemens Hahn, Carsten Leininger<br />
Herstellungsleitung:<br />
Sandra Kho<br />
Vertrieb Zeitschriften:<br />
Dr. Regine Hahn<br />
Vertrieb/Auslieferung Handel:<br />
MZV, Moderner Zeitschriftenvertrieb<br />
GmbH & Co. KG, Unterschleißheim<br />
Im selben Verlag erscheinen außer<strong>dem</strong>:<br />
Preise: Einzelheft Euro 8,50 (D), Euro 9,50 (A),<br />
sFr. 15,90 (CH), bei Einzelversand zzgl. Porto;<br />
Jahresabopreis (12 Hefte) Euro 91,80 (incl. MwSt.,<br />
im Ausland zzgl. Versandkosten)<br />
Erscheinen und Bezug: <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
erscheint monatlich. Sie erhalten die Reihe in Deutsch -<br />
land, in Österreich und in der Schweiz im Bahnhofs buch -<br />
handel, an gut sortierten Zeitschriftenki os ken, im Fachbuchhandel<br />
sowie direkt beim Verlag.<br />
© by GeraMond Verlag. Die Zeitschrift und alle ihre<br />
enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Durch Annahme eines Manu skripts erwirbt<br />
der Verlag das aus schließ liche Recht zur Ver öffentlichung.<br />
Für unverlangt ein gesandte Fotos wird keine Haftung<br />
übernommen. Gerichtsstand ist München.<br />
100%-Gesellschafterin der GeraMond Verlag GmbH<br />
ist die GeraNova Bruckmann Verlagshaus GmbH.<br />
Geschäftsführender Gesellschafter: Clemens Schüssler.<br />
Ver antwortlich für den redaktionellen Inhalt: André Marks;<br />
verantwortlich für Anzeigen: Helmut Kramer, beide Infanteriestr.<br />
11a, 80797 München.<br />
ISSN 0340-7071 • 10815<br />
80
12x <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
+ Geschenk<br />
Ihr<br />
Willkommensgeschenk<br />
GRATIS!<br />
GT8SU<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>-Tasse<br />
Auf der neuen <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>-Tasse ist der<br />
Triebwagen der Siebengebirgs- und Siegburger Bahn<br />
abgebildet. Die Tasse ist in limitierter Auflage erschienen.<br />
✁<br />
Mein Vorteilspaket<br />
✓ Ich spare 10% (bei Bankeinzug sogar 12%)!<br />
✓ Ich erhalte mein Heft 2 Tage vor<br />
<strong>dem</strong> Erstverkaufstag (nur im Inland)<br />
bequem <strong>nach</strong> Hause und verpasse<br />
keine Ausgabe mehr!<br />
✓ Ich kann <strong>nach</strong> <strong>dem</strong> ersten Jahr<br />
jederzeit abbestellen und erhalte<br />
zuviel bezahltes Geld zurück!<br />
✓ Zusätzlich 2013 in jeder Ausgabe:<br />
Ein Exemplar der Fotoedition<br />
✗<br />
»Die schönsten Straßenbahnen«<br />
❑ JA, ich möchte mein <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>-Vorteilspaket<br />
Bitte schicken Sie mir das <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> ab sofort druckfrisch und mit 10% Preisvorteil für<br />
nur €7,65* pro Heft (Jahrespreis: €91,80*) monatlich frei Haus. Ich erhalte als Will kommens geschenk<br />
die neue <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>-Tasse**. Versand erfolgt <strong>nach</strong> Bezahlung der ersten Rechnung.<br />
Ich kann das Abo <strong>nach</strong> <strong>dem</strong> ersten Bezugsjahr jederzeit kündigen.<br />
Bitte informieren Sie mich künftig gern per E-Mail, Telefon oder Post über interessante<br />
❑ Neuigkeiten und Angebote (bitte ankreuzen).<br />
Sie möchten noch mehr sparen?<br />
TW 316<br />
Das <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>-Vorteilspaket<br />
Dann zahlen Sie per Bankab bu chung (nur im Inland möglich)<br />
und Sie sparen zusätzlich 2 % des Abopreises!<br />
Ja, ich will sparen und zahle künftig per Bankabbuchung<br />
❑ pro Quartal nur €22,50 ❑ pro Jahr nur €89,90<br />
WA-Nr. 620SM60163 – 62189179<br />
Ihr Geschenk<br />
Vorname/Nachname<br />
Straße/Hausnummer<br />
PLZ/Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail (für Rückfragen und weitere Infos)<br />
✗<br />
Datum/Unterschrift<br />
Kreditinstitut<br />
Kontonummer<br />
✗<br />
Datum/Unterschrift<br />
Bankleitzahl<br />
Bitte ausfüllen, ausschneiden oder kopieren und gleich senden an:<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> Leserservice, Postfach 1280, 82197 Gilching<br />
oder per Fax an 0180-532 16 20 (14 ct/min.),<br />
per E-Mail: leserservice@strassenbahnmagazin.de<br />
www.strassenbahn-magazin.de/abo<br />
* Preise inkl. Mwst., im Ausland zzgl. Versandkosten<br />
** Solange Vorrat reicht, sonst gleichwertige Prämie
<strong>Vorschau</strong><br />
Liebe Leser,<br />
Sie haben<br />
Freunde, die<br />
sich ebenso<br />
für die<br />
Straßenbahn<br />
mit all Ihren<br />
Facetten begeistern<br />
wie Sie? Dann empfehlen<br />
Sie uns doch weiter! Ich freue mich<br />
über jeden neuen Leser<br />
C. GRONECK<br />
TOPTHEMA Köln im Wandel:<br />
Von der Tramstadt zur Stadtbahn-Metropole<br />
Am 9. Dezember 2012 ging in Köln die Stadtbahnlinie 5 bis in die neue U-Bahnhaltestelle Rathaus in Betrieb, im<br />
Bild die 2011 eröffnete Station Breslauer Platz/Hbf. In einem Jahr soll die Nord-Süd-Stadtbahn die nächste Station<br />
Heumarkt erreichen. Christoph Groneck beleuchtet in diesem Beitrag sowohl den Ausbau des Stadtbahnnetzes als<br />
auch die Geschichte Kölns als Tramstadt.<br />
Im Klassiker auf der U75<br />
von Neuss <strong>nach</strong> Eller<br />
Die Düsseldorfer Linie U75 im Portrait; mit einer echten<br />
U-Bahn hat sie nicht viel zu tun – auf vielen Abschnitten<br />
verkehrte sie als klassische Straßenbahn. Dabei geht es<br />
durch den Neusser Hafen, über den Rhein und durch enge<br />
Häuserschluchten. Und das auch noch mit den letzten<br />
Düsseldorfer Klassikern: den GT8SU!<br />
Aus den neuen Ländern<br />
in den tiefen Osten<br />
Weitere Themen der kommenden Ausgabe<br />
Nach 1990 gaben zahlreiche Betriebe aus den östlichen<br />
Bundesländern nicht mehr benötigte Gotha- und Tatra-<br />
Trams an Städte in Osteuropa ab. Andreas Mausolf stellt im<br />
dritten Teil seiner „Exportwagen“-Geschichte diese Umsetzungen<br />
vor. Berücksichtigung finden dabei natürlich auch<br />
die ab 1997 von Dessau, Nordhausen und Halle (Saale)<br />
weiterverkauften Düwag-Wagen.<br />
A. MAUSOLF<br />
Geschichte: Die drei Endstellen<br />
»Kleinzschocher«<br />
Peter Schäfer hat bereits mehrmals über die Leipziger Tram<br />
in Kleinzschocher berichtet. In diesem Bericht stellt er nun<br />
neue Forschungsergebnisse zu einem 1921 an der Ring -<br />
straße in Betrieb genommenen Gleisdreieck vor. Mit seiner<br />
eigenwilligen Gleisgeometrie ermöglichte es gleichzeitig<br />
einen besseren Zugang zum Depot …<br />
Brest (Bretagne): Tram mit Blick<br />
auf die große Bucht<br />
Seit Juni 2012 verkehrt in Brest wieder eine Straßenbahn.<br />
Die neue Linie verändert das Stadtbild von Brest und die<br />
Alstom-Citadis-Züge bringen Farbe in die Stadt – Victor<br />
Lecaenais schildert die Rückkehr der Tram mit vielen Hintergründen<br />
und stellt die darauf aufbauenden neuen Pläne für<br />
den Nahverkehr der Region vor.<br />
V. LECAENAIS<br />
André Marks,<br />
verantwortlicher Redakteur<br />
Ende gut …<br />
Schulmaterial zum<br />
Fahren mit der Tram<br />
In den vergangenen Jahren ist nun auch<br />
den deutschen Schulministerien immer<br />
deutlicher bewusst geworden ist, wie<br />
selten viele Eltern schulpflichtiger Kinder<br />
selbst öffentliche Nahverkehrsmittel<br />
nutzen. Konnte man einst voraussetzen,<br />
dass Mädchen und Jungen von<br />
ihren Müttern und Vätern die Benutzung<br />
von Bussen und (Straßen-)Bahnen<br />
beigebracht bekommen, so ist dies in<br />
der vom „Automobil geprägten“ heutigen<br />
Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich<br />
…<br />
Seit September 2012 gibt es aus diesem<br />
Grund im Bundesland Nordrhein-<br />
Westfalen (NRW) für Dritt- und Viertklässler<br />
ein Arbeitsbuch zum sicheren<br />
Umgang auch mit der Tram. Der Titel<br />
dieser brandneuen ÖPNV-Unterrichtsmaterialien<br />
lautet „Bus- & Bahn-Detektive<br />
– Wir erforschen Verkehrsmittel<br />
und Verkehrswege!“<br />
Das auf der Basis moderner Unterrichtsformen<br />
erstellte Schülerbuch mit<br />
begleitenden Arbeitsblättern erlaubt es<br />
den Kindern, sich <strong>dem</strong> Thema Bus und<br />
Bahn entdeckend und handlungsorientiert<br />
zu nähern. Mit <strong>dem</strong> neuen Unterrichtsmaterial<br />
können sie den Nahverkehr<br />
im Umfeld ihrer Schule unter<br />
die Lupe nehmen. Als Detektive mit<br />
vielfältigen Forscheraufgaben gewinnen<br />
sie spielerisch und fantasievoll Sicherheit<br />
im Umgang mit Bus und Bahn.<br />
Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg hatte<br />
bereits vor zwei Jahren Unterrichtsmaterialien<br />
für die Verkehrserziehung an<br />
weiterführenden Schulen herausgegeben.<br />
Aufgrund der hohen Nachfrage<br />
wurde nun das Lehrbuch für Grundschulen<br />
konzipiert. AM/PM<br />
DAS <strong>STRASSENBAHN</strong>-<strong>MAGAZIN</strong> 2/2013 erscheint am 18. Januar 2013<br />
82<br />
… oder schon 2 Tage früher mit bis zu 36 % Preisvorteil und Geschenk-Prämie! Jetzt sichern unter www.strassenbahn-magazin.de<br />
Plus Geschenk<br />
Ihrer Wahl:<br />
z.B. DVD »Trams<br />
im Wirtschafts -<br />
wunderland«
Das besondere Bild<br />
Das besondere Bild<br />
Das Jahr 2012 neigt sich <strong>dem</strong> Ende zu. Vor 32 Jahren besuchte Bernhard Kußmagk in dieser Zeit wieder einmal die Innsbrucker Straßenbahn.<br />
Dabei entstand an der Endstelle der Überlandlinie 6 in Igls am 29. Dezember 1980 diese Aufnahme, als der Schaffner gerade seine Jause auspackte.<br />
Wie die Eisblumen an den Fenstern beweisen, herrschte klirrende Kälte, aber die Sonne beschien den alten, schweren Vierachser 3<br />
(Grazer Waggonfabrik/AEG 1909) vor <strong>dem</strong> prächtigen Panorama der Nordkette im Hintergrund. Ein gutes Jahr später waren die alten Wagen<br />
Geschichte, denn ab Februar 1981 kamen Düwag-Gelenkwagen auf der Linie 6 zum Einsatz. TEXT & FOTO: BERNHARD KUSSMAGK<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 1 | 2013<br />
83
Faszination Nahverkehr<br />
GT8SU<br />
GT8S 3052<br />
Jetzt am Kiosk oder unter:<br />
www.strassenbahn-magazin.de