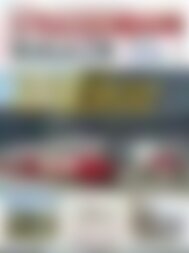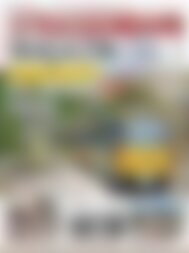STRASSENBAHN MAGAZIN Sie Straßenbahn in Dresden (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Österreich: € 9,50<br />
12/2012 | Dez. € 8,50<br />
Schweiz: sFr. 15,90<br />
NL: LUX: € € 9,90<br />
Europas größte <strong>Straßenbahn</strong>-Zeitschrift<br />
9,90<br />
Die <strong>Straßenbahn</strong> <strong>in</strong> <strong>Dresden</strong> • Tramoffensive <strong>in</strong> München • Hamburgs <strong>Straßenbahn</strong> 1962 • N8C: Schluss nun auch <strong>in</strong> Kassel <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12/2012<br />
Die <strong>Straßenbahn</strong> <strong>in</strong><br />
<strong>Dresden</strong><br />
Geschichte<br />
Fahrzeuge<br />
Zukunft<br />
Schluss nun auch <strong>in</strong> Kassel:<br />
<strong>Straßenbahn</strong>wagen N8C<br />
Lücken im Netz: Hamburgs<br />
<strong>Straßenbahn</strong> vor 50 Jahren<br />
Betriebe<br />
Fahrzeuge<br />
Geschichte<br />
Rumäniens Trams 1982:<br />
Abenteuer per Interrail<br />
Tramoffensive <strong>in</strong> München:<br />
Neue Bahnen, mehr Verkehr
Alle DB-Lokomotiven<br />
auf e<strong>in</strong>en Blick!<br />
nur<br />
€ 9,90<br />
Jetzt am Kiosk oder unter:<br />
www.eisenbahnwelt.de
E<strong>in</strong>steigen, bitte …<br />
Rückkehr der Holzstühle?<br />
Stimmen <strong>Sie</strong> ab<br />
Nach e<strong>in</strong>em herrlichen Herbst s<strong>in</strong>d die warmen<br />
Tage dieses Jahres <strong>in</strong>zwischen endgültig<br />
vorbei. Nun hat die kalte, die ungemütliche<br />
Jahreszeit begonnen, <strong>in</strong> der wir dick e<strong>in</strong>gemummelt<br />
zur Tram laufen und es uns dort<br />
bequem machen.<br />
Wehmütig mag sich dabei so mancher<br />
Mann an die heißen Sommerwochen er<strong>in</strong>nern,<br />
<strong>in</strong> denen junge, schlanke Frauen mit<br />
kurzen Röcken e<strong>in</strong>- und ausstiegen. Andere<br />
haben h<strong>in</strong>gegen womöglich noch den Fahrgast<br />
gegenüber vor Augen, von dem im Juli<br />
der Schweiß unter den Armen auf die Sitzpolster<br />
tropfte. Das ist doch eklig? Ja, stimmt!<br />
Dah<strong>in</strong>gehend hygienisch unbedenklich<br />
s<strong>in</strong>d mit wasserfesten Stiften auf die mit Stoff<br />
überzogenen Tramsitze geschmierte Krakeleien<br />
– egal welchen „Inhalts“, handelt es sich<br />
dabei allerd<strong>in</strong>gs ganz klar um Sachbeschä -<br />
digung.<br />
In beiderlei Fällen – bei Schweiß wie Farbe<br />
– lassen sich die mit Stoff überzogenen<br />
S<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Trams wieder Holzsitze angebracht?<br />
• Ja, denn manchmal empf<strong>in</strong>de ich es als eklig, mich auf die<br />
Polstersitze zu setzen.<br />
• Ne<strong>in</strong> – das wäre für mich e<strong>in</strong>e Zumutung!<br />
• Aufgrund verschiedener Vandalen wäre es vielleicht angebracht,<br />
aber das Holzbänke-Zeitalter liegt doch def<strong>in</strong>itiv h<strong>in</strong>ter uns!<br />
Stimmen <strong>Sie</strong> onl<strong>in</strong>e ab: www.strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de<br />
Tramsitze nur mit großem Aufwand re<strong>in</strong>igen<br />
bzw. des<strong>in</strong>fizieren.<br />
Das wird auch zunehmend mehr Fahrgästen<br />
bewusst – zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Basel. Denn<br />
hier gab es im ersten Halbjahr 2012 e<strong>in</strong>e Abstimmung<br />
mit überraschendem Ergebnis: Die<br />
bis 2013/14 von Bombardier für die Schweizer<br />
Stadt gebauten 60 Flexity werden mit<br />
Holzsitzen angeliefert! Das ist das Ergebnis<br />
e<strong>in</strong>er von den BVB <strong>in</strong>itiierten Abstimmung.<br />
Wie für viele D<strong>in</strong>ge <strong>in</strong> der Schweiz typisch,<br />
entschieden die Basler selbst, ob sie zukünftig<br />
wie gewohnt auf Stoff oder wie <strong>in</strong> verme<strong>in</strong>tlich<br />
vergangenen Zeiten auf Holzsitzen<br />
Platz nehmen wollen. Im Frühjahr 2002 war<br />
dazu e<strong>in</strong> speziell mit Holzschalen-Sitzen ausgestatteter<br />
„Comb<strong>in</strong>o“ etwa drei Wochen<br />
lang im BVB-Netz unterwegs. Knapp 60 Prozent<br />
der <strong>in</strong> diesem Zeitraum Befragten sprachen<br />
sich für die Holzsitze aus, nicht e<strong>in</strong>mal<br />
30 Prozent dagegen. Als Hauptargumente<br />
pro Holzbänke galten deren Vandalismus-<br />
Resistenz und Sauberkeit.<br />
In Karlsruhe lösen h<strong>in</strong>gegen<br />
spätestens 2014 von Vossloh gebaut<br />
Wagen die letzten zehn<br />
„Holz klasse“-Achtachser ab.<br />
Der Alt-VBK-Geschäftsführer<br />
Dr. Ludwig bezeichnete diese<br />
kürzlich als „Arschbetrüger“.<br />
Tja – und wie sehen <strong>Sie</strong> das?<br />
ANDRÉ MARKS<br />
Für e<strong>in</strong>e Abstimmung<br />
war im Frühjahr 2012<br />
e<strong>in</strong> mit Holzsitzen ausgerüsteter<br />
„Comb<strong>in</strong>o“<br />
<strong>in</strong> Basel unterwegs.<br />
Die Fahrgäste überzeugte<br />
deren Sitz -<br />
komfort – Bombardier<br />
liefert 2013/14 <strong>in</strong>s -<br />
gesamt 60 Flexity<br />
mit e<strong>in</strong>er derartigen<br />
Bestuhlung<br />
BVB<br />
André<br />
Marks<br />
Verantwortlicher<br />
Redakteur<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
3
Inhalt<br />
Inhalt<br />
TITEL<br />
140 Jahre Dresdner <strong>Straßenbahn</strong>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />
TITEL<br />
Betriebe<br />
Angebotsoffensive und Rückfallebenen. . 16<br />
München: Verstärkungsl<strong>in</strong>ien, Taktverdichtungen, zusätzliche<br />
Fahrzeuge – Ab 9. Dezember fährt Münchens Tram öfter – solange<br />
die Variobahnen mitspielen. Zur Verstärkung der Fahrzeugflotte wurden<br />
Altwagen aufgearbeitet und acht neue Niederflurbahnen bestellt<br />
Fasz<strong>in</strong>ation zwischen Styrum<br />
und Hauptfriedhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
Mülheims L<strong>in</strong>ie 110 im Porträt – Von der klassischen Ruhrpott-<br />
Industriekulisse über e<strong>in</strong>e kurze Tunnelfahrt bis zur idyllischen Steigungsstrecke:<br />
Die 110 ist e<strong>in</strong>e Reise wert – solange sie noch fährt.<br />
Ger<strong>in</strong>ge Fahrgastzahlen machen der L<strong>in</strong>ie nämlich schwer zu schaffen<br />
Unterwegs mit »Tante Frieda«. . . . . . . . . . . . . . 26<br />
100 Jahre Forchbahn Zürich – Essl<strong>in</strong>gen – <strong>Straßenbahn</strong>, Überlandbahn,<br />
U-Bahn – oder alles zusammen? Die Forchbahn bietet <strong>in</strong><br />
der Tat von allem etwas. Dieses Jahr feiert sie ihr 100-jähriges<br />
Bestehen<br />
L<strong>in</strong>ie G bald über die Traun?. . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
Vorbereitung für Verb<strong>in</strong>dung der Gmundener <strong>Straßenbahn</strong><br />
mit Lokalbahn – Vor 100 Jahren wurde <strong>in</strong> Oberösterreich die meterspurige<br />
Traunseebahn Gmunden – Vorchdorf eröffnet. In den nächsten<br />
Jahren soll sie nun endlich mit der <strong>Straßenbahn</strong> Gmunden verbunden<br />
werden<br />
Titelmotiv<br />
Dresdner Wahrzeichen:<br />
Tw 1813 „Kle<strong>in</strong>er Hecht”<br />
präsentiert sich im<br />
Oktober 1969 vor dem<br />
„Goldenen Reiter”<br />
J. RICHTER<br />
RUBRIKEN<br />
»E<strong>in</strong>steigen, bitte …« . . . . 3<br />
Bild des Monats. . . . . . . . . 6<br />
Journal . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
Nächster Halt. . . . . . . . . . . 25<br />
E<strong>in</strong>st & Jetzt. . . . . . . . . . . . 40<br />
Forum, Bücher,<br />
Term<strong>in</strong>e, Impressum. . . . . . 78<br />
<strong>Vorschau</strong> . . . . . . . . . . . . . . 82<br />
Das Allerletzte ... . . . . . . . . 82<br />
Das besondere Bild . . . . . . 83<br />
4 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
Mülheim/Ruhr: Die L<strong>in</strong>ie 110 im Porträt 20 Gmunden: <strong>Straßenbahn</strong> über die Traun? 30<br />
Stuttgart: Neue Fahrzeuge von Stadler 34 Rumänien: Interrail-Tour im Jahr 1982 68<br />
Fahrzeuge<br />
Stuttgarts neue Berl<strong>in</strong>er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
DT8.12 für die Stuttgarter <strong>Straßenbahn</strong>en – Erstmals liefert<br />
Stadler Pankow Fahrzeuge nach Stuttgart. Im Juni begann die Endmontage<br />
des ersten Doppeltriebwagens <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Hohenschönhausen.<br />
Ende dieses Jahres geht er voraussichtlich <strong>in</strong> den Fahrgastbetrieb<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> im Modell<br />
TITEL<br />
Neul<strong>in</strong>g zur Bundesgartenschau. . . . . . . . . . . . 42<br />
NGT8 verdrängen Kasseler N8C – Von 1981 bis 1986 bekam die<br />
Kasseler Verkehrsgesellschaft anlässlich der Bundesgartenschau und<br />
zum Ersatz älterer Zweiachser <strong>in</strong>sgesamt 22 Wagen des Typs N8C.<br />
Nun scheiden sie langsam aus dem Regeldienst aus<br />
Tram-Modelle aus dem PC . . . . . . . . . . . . 74<br />
Die neue Art des Fahrzeugbaus: Kostenlose Programme<br />
aus dem Internet helfen beim Verwirklichen eigener Tramwünsche.<br />
Vorm Konstruieren ist aber Recherche angesagt.<br />
Geschichte<br />
Tram im Barock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />
140 Jahre Dresdner <strong>Straßenbahn</strong> – Die wechselvolle Geschichte<br />
der Tram <strong>in</strong> Elbflorenz von der 1872 eröffneten Pferdebahn über<br />
Große und Kle<strong>in</strong>e Hechte bis h<strong>in</strong> zu Tatrawagen und <strong>in</strong>s Niederflur -<br />
zeitalter. Mit 134 km Netzlänge gehört die Dresdner <strong>Straßenbahn</strong><br />
heute zu den größeren Betrieben <strong>in</strong> Deutschland<br />
TITEL<br />
Netzverlust und Neubau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />
Hamburgs Nahverkehrssituation vor 50 Jahren – Während das<br />
Tramnetz schrumpfte, wuchs das U-Bahnnetz 1961/62 weiter an.<br />
Parallel setzte auf der Hochbahn e<strong>in</strong> Generationswechsel e<strong>in</strong>. Zahl -<br />
reiche neue Fahrzeuge bestimmten fortan das Bild der Hansestadt<br />
Auf dem Trittbrett über<br />
gebrochene Schienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />
Auf Interrail-Tour zu Rumäniens Trams – 1982 erkundete<br />
Bernhard Kußmagk aus Berl<strong>in</strong> die <strong>Straßenbahn</strong>-Betriebe <strong>in</strong> Bukarest,<br />
im Banat sowie <strong>in</strong> <strong>Sie</strong>benbürgen. 30 Jahre danach er<strong>in</strong>nert er sich<br />
an diese Reise und an die heute nur noch schwer vorstellbaren<br />
Erlebnisse<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
5
Bild des Monats<br />
6<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Bild des Monats<br />
Bild des Monats<br />
Die türkische Stadt Istanbul war von 1961 im europäischen<br />
Teil sowie von 1966 im asiatischen Teil bis 1992<br />
straßenbahnfrei. Die Wiedere<strong>in</strong>führung der „Tramvay“<br />
ist e<strong>in</strong>e Erfolgsgeschichte. Auf der sichtbaren L<strong>in</strong>ie T1,<br />
die die Stadt <strong>in</strong> Ost-West-Richtung durchquert, verkehren<br />
die Züge <strong>in</strong> sehr kurzen Intervallen. Seit e<strong>in</strong>igen Jahren<br />
s<strong>in</strong>d zur Verstärkung des Wagenparks ex Kölner B-Wagen<br />
<strong>in</strong> Doppeltraktion im E<strong>in</strong>satz. Die Aufnahme von Bernhard<br />
Kußmagk entstand am 25. März 2011 <strong>in</strong> der Turgut<br />
Özal Caddesi westlich der Haltestelle Aksaray vor der<br />
Pertevniyal Valide Sultan Moschee.<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
7
Meldungen aus Deutschland,<br />
aus der Industrie und aus aller Welt<br />
Die letzten beiden T4D-Doppeltraktionen 1272-1248 l<strong>in</strong>ks und 1244-1245 rechts begegnen sich an der Alexanderstraße<br />
auf der L<strong>in</strong>ie 1 Sudenburg – Lerchenwuhne – <strong>in</strong>teressanterweise <strong>in</strong> zwei unterschiedlichen Varianten<br />
der MVB-Hauslackierung<br />
F. V. RAPCZYNSKI<br />
ONLINE-UMFRAGE<br />
Erhöhungen der Fahrpreise<br />
wirklich angebracht?<br />
Im Heft 11/2012 haben wir <strong>in</strong> der<br />
Rubrik „E<strong>in</strong>steigen, bitte …“ die Er -<br />
höhung der M<strong>in</strong>eralölpreise und<br />
zeitverzögert der Tram-Fahrsche<strong>in</strong>e<br />
thematisiert. Abschließend waren <strong>Sie</strong><br />
aufgefordert, uns im Internet Ihre<br />
Me<strong>in</strong>ung zu schreiben: S<strong>in</strong>d die<br />
Erhöhungen der Fahrpreise wirklich<br />
angebracht?<br />
Lediglich 0,8 % der Teilnehmer an der<br />
Umfrage s<strong>in</strong>d auf dem Standpunkt<br />
„leider ja, denn die Kosten der Ver -<br />
kehrsbetriebe steigen ja auch.“<br />
H<strong>in</strong>gegen sagten 6,8 % der Leser ganz<br />
klar ne<strong>in</strong>! Die Gesellschaften hätten<br />
ihrer Me<strong>in</strong>ung nach genügend Spiel -<br />
raum, um das auszugleichen.<br />
Die überwältigende Mehrheit der Um -<br />
frageteilnehmer – 92,3 % – gaben<br />
h<strong>in</strong>gegen zu, dass ihnen die Trans pa -<br />
renz fehle. <strong>Sie</strong> schlugen vor, die Gesell -<br />
schaften sollten besser offen legen,<br />
warum sie die Preise anziehen. AM<br />
Magdeburg: Dem T4D-Abschied folgt im Dezember das »Aus« für die T6A2<br />
Tatra-Tw verabschieden sich aus dem Planbetrieb<br />
Über 43 Jahre gehörten sie zum<br />
Straßenbild der sachsen-anhaltischen<br />
Landeshauptstadt – die Tatrawagen<br />
vom Typ T4D/B4D. Jetzt g<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>e Ära<br />
<strong>in</strong> der Elbstadt zu Ende. Am 18. Oktober<br />
verabschiedeten sich die letzten<br />
T4D-Doppeltraktionen <strong>in</strong> Magdeburg<br />
aus dem fahrplanmäßigen Personen-<br />
verkehr. Zuletzt waren noch die Tw<br />
1244 mit 1245 und 1272 mit 1248 unterwegs.<br />
Die letzten B4D-Beiwagen<br />
waren schon zu Beg<strong>in</strong>n der Sommerferien<br />
abgestellt worden. Grund für das<br />
Ausscheiden der T4D ist die fortschreitende<br />
Auslieferung der aktuellen Serie<br />
von elf NGT8D und die weitere Indienststellung<br />
elf umgebauter ex Berl<strong>in</strong>er<br />
B6A2-Beiwagen, die h<strong>in</strong>ter den<br />
NGT der ersten Lieferserie laufen. Dadurch<br />
wurden die T4D nach und nach<br />
entbehrlich.<br />
Zuletzt waren die Doppeltraktionen<br />
vorwiegend auf den verknüpften L<strong>in</strong>i-<br />
Auch <strong>in</strong> Magdeburg wurden <strong>in</strong> der<br />
Vergangenheit auf stark frequentierten<br />
L<strong>in</strong>ien, wie hier auf der L<strong>in</strong>ie<br />
1, T4D/T4D/B4D-Großzüge e<strong>in</strong>gesetzt<br />
P. KRAMMER<br />
8<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Deutschland<br />
Am 17. Oktober fuhr um 16.30 Uhr<br />
zum letzten Mal e<strong>in</strong> Zug der L<strong>in</strong>ie 9<br />
mit T4Ds, im Speziellen den E<strong>in</strong>heiten<br />
1272 und 1248, von der Leipziger<br />
Chaussee <strong>in</strong> Richtung Innenstadt<br />
ab<br />
J. HAUGK<br />
en 1 und 10 sowie auf 8 und 9 anzutreffen.<br />
Auf letzterer endete der E<strong>in</strong>satz<br />
bereits e<strong>in</strong>en Tag eher am 17. Oktober.<br />
Am 18. Oktober waren Tw 1244<br />
mit 1245 auf der L<strong>in</strong>ie 8 und Tw 1272<br />
mit 1248 auf der L<strong>in</strong>ie 1/10 im E<strong>in</strong>satz.<br />
Erster typenre<strong>in</strong>er<br />
Verkehrsbetrieb mit T4D<br />
Insgesamt wurden an die Magdeburger<br />
Verkehrsbetriebe 274 T4D der Baujahre<br />
1968 bis 1986 geliefert; dazu kamen<br />
142 B4D der Baujahre 1969 bis<br />
1987. Nachdem die ersten T4D am<br />
3. April 1969 <strong>in</strong> Magdeburg e<strong>in</strong>trafen,<br />
begann am 20. April 1969 der planmäßige<br />
E<strong>in</strong>satz auf der L<strong>in</strong>ie 3 Diesdorf –<br />
Leipziger Chaussee; zunächst zur Probe<br />
als Solowagen, später als Hängerzüge<br />
(T4D/B4D). Im Juni 1970 wurden<br />
dann die ersten Großzüge (T4D/T4D/<br />
B4D) auf der L<strong>in</strong>ie 3 e<strong>in</strong>gesetzt. Die gesamte<br />
erste Serie umfasste 36 Triebund<br />
13 Beiwagen. Nachdem 1975 die<br />
letzten Vorkriegswagen ausgesondert<br />
wurden und am 2. Juni 1978 auch die<br />
letzten Gothawagen aus dem Bestand<br />
g<strong>in</strong>gen, waren die Magdeburger Verkehrsbetriebe<br />
die ersten <strong>in</strong> der DDR,<br />
die über e<strong>in</strong>en typenre<strong>in</strong>en Wagenpark<br />
verfügten – und das bis zum 4. Dezember<br />
1989, als der erste T6A2 <strong>in</strong><br />
Magdeburg e<strong>in</strong>traf.<br />
Modifikationen<br />
im Laufe der Jahre<br />
Ab Mai 1980 wurden mehrere Triebwagen<br />
für die Heck-an-Heck-Traktion<br />
im Baustellenverkehr hergerichtet. Da<br />
dabei immer e<strong>in</strong> leerer Triebwagen<br />
h<strong>in</strong>terhergezogen wurde, wurden ab<br />
1982 <strong>in</strong>sgesamt 12 T4D mit e<strong>in</strong>er zweiten<br />
Fahrerkab<strong>in</strong>e ausgerüstet – der<br />
„Wendezug“ war geboren.<br />
Ab 1985 wurden erste Tatrawagen<br />
mit Werbung versehen, zuerst nur an<br />
der Dachkante, ab 1987 auch an der<br />
Seite.<br />
Der erste umfangreich modernisierte<br />
T4D (1266) wurde am 16. Juni 1991<br />
präsentiert. Ihm folgten alle damals<br />
noch vorhandenen Tatrawagen. Nach<br />
der Wende wurden aufgrund s<strong>in</strong>kender<br />
Fahrgastzahlen viele Tatrawagen<br />
entbehrlich und g<strong>in</strong>gen größtenteils<br />
<strong>in</strong>s Ausland, so z. B. nach Rumänien,<br />
Russland oder Nordkorea. Mit der Lieferung<br />
von Niederflurwagen des Typs<br />
NGT8D reduzierte sich das E<strong>in</strong>satzgebiet<br />
der Tatrawagen ab 1994 weiter.<br />
T6A2-Abschied im<br />
Dezember<br />
Ende 2012 sollen <strong>in</strong>sgesamt 83 NGT<br />
und 11 ehemals Berl<strong>in</strong>er B6A2 den gesamten<br />
Verkehr <strong>in</strong> Magdeburg bewältigen.<br />
Wenn am 15. Dezember 2012 die<br />
Streckenverlängerung nach Reform eröffnet<br />
wird, werden auch die jetzt noch<br />
im Betrieb bef<strong>in</strong>dlichen letzten elf T6A2<br />
und der letzte B6A2 aus dem Jahr 1989<br />
ihren Dienst quittieren. Dann wird man<br />
T4D/B4D nur noch als historische Wagen<br />
im Ursprungszustand oder <strong>in</strong> modernisierter<br />
Form im W<strong>in</strong>terdienst bzw.<br />
als Arbeitswagen <strong>in</strong> Magdeburg sehen<br />
können. Wer die „runden Tatras“ noch<br />
im L<strong>in</strong>iendienst erleben möchte, muss<br />
künftig nach Leipzig oder Halle fahren.<br />
Auch <strong>in</strong> <strong>Dresden</strong> kann man mit Glück<br />
noch welchen begegnen – und das sogar<br />
als Dreifachtraktion.<br />
DP<br />
Bremen<br />
Nun doch zwei neue<br />
Strecken im Süden<br />
Die zuständige Deputation der Bremer<br />
Bürgerschaft zog im Oktober e<strong>in</strong>en<br />
Schlussstrich unter die öffentlich<br />
ausgetragenen Streitereien zwischen<br />
den Koalitionären zu den Tramverlängerungsprojekten<br />
im Bremer Süden:<br />
Es bleibt nun dabei, sowohl die L<strong>in</strong>ie 1<br />
<strong>in</strong> den Kern Hucht<strong>in</strong>gs als auch die L<strong>in</strong>ie<br />
8 <strong>in</strong>s niedersächsische Umland bis<br />
Weyhe/Leeste zu verlängern.<br />
Wie berichtet, hatte sich die SPD-<br />
Bürgerschaftsfraktion zuletzt gegen<br />
die Verlängerung der L<strong>in</strong>ie 1 ausgesprochen.<br />
Nachdem das Bundesverkehrsm<strong>in</strong>isterium<br />
aber für e<strong>in</strong>e ausschließliche<br />
Verlängerung der L<strong>in</strong>ie 8<br />
Auswirkungen auf die verfügbaren<br />
Bundesfördermittel <strong>in</strong> Aussicht stellte,<br />
gab die SPD-Fraktion ihre ablehnende<br />
Haltung auf. Nun sollen beide Maßnahmen<br />
– wie ursprünglich vorgesehen<br />
und beschlossen – umgesetzt werden.<br />
Da das Planfeststellungsverfahren<br />
jüngst aufgrund von anhaltenden Bürgerprotesten<br />
e<strong>in</strong>gestellt worden war,<br />
soll e<strong>in</strong> neuer Anlauf erfolgen. AMF<br />
Bochum<br />
Baubeg<strong>in</strong>n für Strecke<br />
nach Langendreer<br />
Am 21. September läutete Gisbert<br />
Schlotzhauer, Vorstand der Bochum-<br />
Gelsenkirchener <strong>Straßenbahn</strong>en AG<br />
Bremen: Würde die <strong>Straßenbahn</strong> über die Schleife Hucht<strong>in</strong>g h<strong>in</strong>aus verlängert werden, könnten sich viele den Umstieg<br />
auf den Bus sparen<br />
A. MAUSOLF<br />
Karlsruhe<br />
Vom 26. Oktober bis zum 4.<br />
November hat die Karlsruher<br />
Südostbahn e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>halb Monate<br />
nach ihrer Inbetriebnahme zum<br />
ersten Mal <strong>in</strong> größerem Stil Umleitungsverkehr<br />
für den Bau der<br />
„Kombilösung“ aufgenommen.<br />
Während dieser Zeit war der<br />
Verzweigungspunkt Durlacher<br />
Tor nicht passierbar, sodass die<br />
L<strong>in</strong>ien 1, S2, S4, S41 und S5 über<br />
die neue Strecke von der Haltestelle<br />
Tullastraße zur Ettl<strong>in</strong>ger<br />
Straße fuhren. Die L<strong>in</strong>ie 6, die<br />
normalerweise über die Südostbahn<br />
fährt, wurde dagegen zu<br />
ihrer alten Endstelle Tivoli zurückgezogen.<br />
PKR<br />
München<br />
Die im Dezember 2011 eröffnete<br />
Strecke vom Effnerplatz<br />
nach St. Emmeram wurde im Oktober<br />
mit dem „Nationalen Preis<br />
für <strong>in</strong>tegrierte Stadtentwicklung<br />
und Baukultur“ gewürdigt. Der<br />
Preis wird vom Bundesm<strong>in</strong>istierum<br />
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />
für herausragende<br />
realisierte Projekte, die zu e<strong>in</strong>er<br />
nachhaltigen Entwicklung <strong>in</strong><br />
Städten und Geme<strong>in</strong>den führen,<br />
verliehen. Gelungen sei an der<br />
„Tram St. Emeram“ unter anderem<br />
die Aufwertung der Straßenräume<br />
im Zuge der neuen <strong>Straßenbahn</strong>trasse.<br />
SM<br />
Kiel<br />
Dass die schleswig-holste<strong>in</strong>ische<br />
Landeshauptstadt Kiel ihre<br />
<strong>Straßenbahn</strong> als moderne Stadt-<br />
RegionalBahn zurückbekommt,<br />
wird wahrsche<strong>in</strong>licher. H<strong>in</strong>tergrund<br />
ist e<strong>in</strong> Spitzengespräch im<br />
zuständigen Landesm<strong>in</strong>isterium,<br />
<strong>in</strong> dessen Ergebnis das Land 25<br />
statt der bisher zugesagten 15<br />
Prozent Kosten übernehmen würde.<br />
Der Betriebskostenzuschuss<br />
bleibt bei der bisherigen Höhe.<br />
Die StadtRegionalbahn würde<br />
dem Karlsruher Modell folgen<br />
und soll Kiel mit se<strong>in</strong>em Umland<br />
verb<strong>in</strong>den. Derzeit wird der ÖPNV<br />
mit Bussen abgewickelt. FBT<br />
rz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet kurz gemeldet<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
9
Aktuell<br />
ANZEIGE<br />
Ihre Prämie<br />
Noch mehr Auswahl unter<br />
www.strassenbahnmagaz<strong>in</strong>.de/abo<br />
Bochum: Für die neue Strecke nach Langendreer, die hier an der Haltestelle Unterstraße geradeaus weitergeführt<br />
wird, war am 21. September Baubeg<strong>in</strong>n<br />
B. MARTIN<br />
(Bogestra), mit dem symbolischen ersten<br />
Spatenstich den Beg<strong>in</strong>n der Bauarbeiten<br />
für die Neubaustrecke der <strong>Straßenbahn</strong>l<strong>in</strong>ien<br />
302 und 310 von Laer<br />
über Langendreer nach Witten e<strong>in</strong>.<br />
Bis Ende 2015 wird e<strong>in</strong>e neue Schienenverb<strong>in</strong>dung<br />
im Zuge der Unterund<br />
Hauptstraße erstellt, die <strong>in</strong>klusive<br />
e<strong>in</strong>er Stichstrecke zum S-Bf. Langendreer<br />
5,4 km lang ist. <strong>Sie</strong> erschließt das<br />
Zentrum des 33.000 E<strong>in</strong>wohner zählenden<br />
Bochumer Stadtteils Langendreer<br />
und ersetzt zwischen den Haltestellen<br />
Unterstraße und Crengeldanz<br />
die weitgehend e<strong>in</strong>gleisige, am Rand<br />
der Bebauung verlaufende Bestandsstrecke<br />
der L<strong>in</strong>ie 310 über Kaltehardt<br />
und Papenholz. Es werden <strong>in</strong>sgesamt<br />
sieben Haltestellen angelegt.<br />
Begleitet wurde der Baubeg<strong>in</strong>n von<br />
anhaltenden Protesten e<strong>in</strong>er Gruppe<br />
von Bürgern aus Langendreer. Zuletzt<br />
sorgte e<strong>in</strong> Anstieg der Projektkosten<br />
von 37,4 auf 60,5 Mio. Euro, der erst<br />
spät kommuniziert wurde, für Aufregung.<br />
Die Bogestra erklärte, dass <strong>in</strong><br />
der ursprünglichen Kostenschätzung<br />
nicht alle Ausgabenposten ausgewiesen<br />
worden waren und wies auf allgeme<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong>flationsbed<strong>in</strong>gte Kostensteigerungen<br />
h<strong>in</strong>.<br />
BEM<br />
Schwer<strong>in</strong><br />
Baumaßnahme am<br />
Marienplatz beendet<br />
Zeitgleich mit dem Ende der Gleisbauarbeiten<br />
am Marienplatz trat am<br />
7. Oktober bei der Nahverkehrsgesellschaft<br />
Schwer<strong>in</strong> (NVS) der neue Fahrplan<br />
<strong>in</strong> Kraft. Ursprünglich sollte dieser<br />
bereits am 7. August, nach Beendigung<br />
der Baumaßnahmen am Marienplatz,<br />
aufgenommen werden. Der Marienplatz,<br />
welcher von drei der vier<br />
<strong>Straßenbahn</strong>l<strong>in</strong>ien sowie von sechs<br />
Busl<strong>in</strong>ien angefahren wird, ist mit täglich<br />
rund 22.000 e<strong>in</strong>- und aussteigenden<br />
Fahrgästen die zentrale Umsteigeanlage<br />
im Nahverkehr. Der Platz<br />
wurde umfassend umgebaut, wobei<br />
auch die Haltestellen sowie Gleis- und<br />
Weichenanlagen komplett erneuert<br />
wurden (s. SM 6/2012). Die Ursache<br />
für die verspätete Fertigstellung waren<br />
Lieferschwierigkeiten der <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a<br />
bestellten Pflasterste<strong>in</strong>e. Nach dem<br />
jetzt die Verkehrsflächen und die<br />
Bahnsteige größtenteils befahrbar<br />
bzw. begehbar s<strong>in</strong>d – lediglich die L<strong>in</strong>ien<br />
2 und 4 halten stadte<strong>in</strong>wärts<br />
noch an e<strong>in</strong>em provisorischen Bahnsteig<br />
– wird der Platz wieder von allen<br />
L<strong>in</strong>ien angefahren. Dabei führen die<br />
im Umfeld noch stattf<strong>in</strong>denden Baumaßnahmen,<br />
die erhebliche Flächen<br />
beanspruchen, zu starken Verkehrsbeh<strong>in</strong>derungen.<br />
Bis Ende November sollen<br />
auch die restlichen Arbeiten an der<br />
4,1 Mio. Euro teuren Baumaßnahme<br />
abgeschlossen se<strong>in</strong>.<br />
JEP<br />
Staßfurt<br />
Denkmalstraßenbahn<br />
e<strong>in</strong>geweiht<br />
In Staßfurt, etwa auf halber Strecke<br />
zwischen Magdeburg und Halle gelegen,<br />
wurde am 24. September mit kurzen<br />
Ansprachen des Oberbürgermeisters<br />
und der Initiatoren vom Geschichtsvere<strong>in</strong><br />
vor der e<strong>in</strong>stigen „Centrale“<br />
und somit an historischer Stelle<br />
der aufgearbeitete LOWA-Triebwagen<br />
20 feierlich e<strong>in</strong>geweiht. Im Innenraum<br />
veranschaulicht e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Ausstellung<br />
zur Staßfurter <strong>Straßenbahn</strong> die<br />
wechselvolle Entwicklung dieses Verkehrsmittels,<br />
das zwischen 1900 und<br />
1957 durch die Straßen Salzstadt fuhr.<br />
Tw 20 wurde 1955 als fabrikneuer<br />
DDR-E<strong>in</strong>heitsstraßenbahnwagen vom<br />
Typ ET54 nach Staßfurt geliefert. Nach<br />
der Stilllegung der <strong>Straßenbahn</strong> gelangte<br />
der Wagen nach Magdeburg<br />
und weiter nach Gera und Naumburg.<br />
Im Juni 2010 gelang es, den Wagen <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>e ursprüngliche Heimat zurückzuholen.<br />
Nach <strong>in</strong>tensiven Vorbereitungen<br />
erfolgte bis 2012 die Restaurierung<br />
im annähernden Orig<strong>in</strong>alzustand,<br />
wobei Wert auf die Staßfurter Besonderheiten<br />
wie die Lackierung und den<br />
Stangenstromabnehmer gelegt wurde.<br />
Der Triebwagen 20 er<strong>in</strong>nert nun auf<br />
orig<strong>in</strong>al geborgenen Gleisresten vor<br />
dem ehemaligen Depot an die Zeit der<br />
<strong>Straßenbahn</strong>. Künftig will der örtliche<br />
Energieversorger den Triebwagen als<br />
Kundenberatungszentrum nutzen.<br />
Schwer<strong>in</strong>: Die umfangreichen Bauarbeiten am Marienplatz konnten zum<br />
7. Oktober abgeschlossen werden J. PERBANDT<br />
Staßfurt: Tw 20 er<strong>in</strong>nert vor der e<strong>in</strong>stigen „Centrale“ an die bewegte Geschichte<br />
des 1957 e<strong>in</strong>gestellten <strong>Straßenbahn</strong>betriebs<br />
J. KARKUSCHKE<br />
10 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Deutschland<br />
Die Stadt möchte den <strong>Straßenbahn</strong>wagen<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>e touristischen Angebote<br />
e<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den und der Geschichtsvere<strong>in</strong><br />
nutzt ihn für Vorträge. Besichtigungen<br />
s<strong>in</strong>d nach vorheriger Anmeldung möglich.<br />
JEK<br />
Freiburg<br />
Generationswechsel bei<br />
den Arbeitswagen<br />
Mit der Inbetriebnahme des am 19.<br />
Juli gelieferten neuen Schienenschleifzuges<br />
der Firma W<strong>in</strong>dhoff aus Rhe<strong>in</strong>e<br />
endete, nach 30 Jahren, der E<strong>in</strong>satz<br />
des bisherigen Schienenschleiffahrzeugs<br />
ATw 405. Der ATw 405 war der<br />
letzte zweiachsige Verbandstyp-Triebwagen,<br />
der <strong>in</strong> der Stadt im Breisgau<br />
noch im alltäglichen Betrieb stand. Der<br />
von der Waggonfabrik Rastatt gefertigte<br />
Motorwagen hatte se<strong>in</strong>en ersten<br />
Betriebstag <strong>in</strong> Freiburg bereits am 13.<br />
Juni 1951 – se<strong>in</strong>erzeit noch unter der<br />
Betriebsnummer Tw 66 – im Fahrgastbetrieb.<br />
1979 folgte der erste Umbau<br />
zum Rangierfahrzeug und damit die<br />
Zuordnung des Zweiachsers zu den<br />
Arbeitstriebwagen. Nach e<strong>in</strong>em weiteren<br />
Umbau war er dann ab 1982 als<br />
Schienenschleifwagen im Freiburger<br />
<strong>Straßenbahn</strong>netz unterwegs.<br />
Zum Abschied des ATw 405 haben<br />
die Freunde der Freiburger <strong>Straßenbahn</strong><br />
e.V. am 30. September Interessierte<br />
zu e<strong>in</strong>er mehrstündigen Foto-<br />
Sonderfahrt durch Freiburg e<strong>in</strong>geladen.<br />
In e<strong>in</strong>em sicherlich e<strong>in</strong>maligen Ensemble<br />
präsentierten sich abschließend alle<br />
drei Freiburger Schienenschleiffahrzeuge<br />
von 1929 bis 2012 vor der Wagenhalle<br />
des Betriebshofs Süd <strong>in</strong> der<br />
Urachstraße. Ist der Schienenschleifwagen<br />
mit der Betriebsnummer 414<br />
von Schörl<strong>in</strong>g (Baujahr 1929) im festen<br />
Bestand des historischen Fahrzeugparks,<br />
so ist der Verbleib des ATw 405<br />
<strong>in</strong> Freiburg aktuell noch ungewiss. DG<br />
Frankfurt/Ma<strong>in</strong><br />
<strong>Straßenbahn</strong> entlang<br />
der Stresemannallee<br />
Im Jahr 2013 sollen <strong>in</strong> Frankfurt am<br />
Ma<strong>in</strong> die Bauarbeiten für e<strong>in</strong>e neue<br />
<strong>Straßenbahn</strong>strecke <strong>in</strong> der Stresemannallee<br />
beg<strong>in</strong>nen. Mit dem Beschluss<br />
des Stadtparlaments nahm das Projekt<br />
e<strong>in</strong>er 1,1 km langen Verb<strong>in</strong>dung zwischen<br />
den Stationen Stresemannallee/Gartenstraße<br />
und Stresemannallee/Mörfelder<br />
Landstraße im Oktober<br />
die letzte politische Hürde. Inklusive<br />
Straßen- und Kanalbauarbeiten soll<br />
der Bau 19 Mio. Euro kosten. Davon<br />
Überlandstrecke im M<strong>in</strong>uten-Takt: Durch den neuen Fahrplan der H-Bahnl<strong>in</strong>ie 2 fahren zwischen den beiden<br />
Dortmunder Campi jetzt bis zu 60 Bahnen <strong>in</strong> der Stunde<br />
P. KRAMMER<br />
H-Bahn Dortmund<br />
L<strong>in</strong>ie 1 verkürzt, L<strong>in</strong>ie 2 verdichtet<br />
Mit der Aufnahme der Vorlesungen<br />
zum W<strong>in</strong>tersemester an der TU<br />
Dortmund wurde die Kapazität der<br />
H-Bahnl<strong>in</strong>ie 2 ab dem 8. Oktober verdoppelt.<br />
Auf ihrer 1,1 km langen<br />
Strecke, die zwischen den beiden<br />
Campusbereichen Nord und Süd der<br />
Dortmunder Universität verläuft,<br />
fahren jetzt zu den Spitzenzeiten vier<br />
Bahnen je Richtung <strong>in</strong>nerhalb von 10<br />
M<strong>in</strong>uten. Da die Strecke zwischen<br />
Campus Nord und Süd nur e<strong>in</strong>spurig<br />
ist und auch von der alle zehn M<strong>in</strong>uten<br />
fahrenden L<strong>in</strong>ie 1 mitbenutzt<br />
wird, war e<strong>in</strong>e Reduzierung des heutigen<br />
Fünf-M<strong>in</strong>uten-Taktes auf e<strong>in</strong>en<br />
2,5-M<strong>in</strong>utentakt aber nicht möglich.<br />
Vielmehr fährt die L<strong>in</strong>ie 2 auch künftig<br />
alle fünf M<strong>in</strong>uten, dafür jeweils<br />
Freiburg: Der neue W<strong>in</strong>dhoff-Schienenschleifwagen<br />
ATw 406 posiert<br />
neben se<strong>in</strong>en Vorgängern vor dem<br />
Betriebshof Süd<br />
D. GEMANDER<br />
könnten 12,1 Mio. Euro durch Zuschüsse<br />
nach dem Geme<strong>in</strong>deverkehrsf<strong>in</strong>anzierungsgesetz<br />
(GVFG) gedeckt<br />
werden. Die neue Strecke ist politisch<br />
umstritten, da e<strong>in</strong>ige Parteien die Mittel<br />
für das Projekt lieber anderweitig<br />
ausgegeben hätten. Zudem wehren<br />
sich Anwohner gegen die <strong>Straßenbahn</strong><br />
vor ihrer Haustür, für die u.a. der Zu-<br />
Frankfurt: An der Kreuzung Strese -<br />
mannallee/Mörfelder Landstraße,<br />
wo heute die L<strong>in</strong>ie 14 und die Verb<strong>in</strong>dung<br />
zum Oberforsthaus verzweigen,<br />
wird künftig e<strong>in</strong>e neue<br />
Strecke, l<strong>in</strong>ks im Bildrand, e<strong>in</strong>münden<br />
S. KYRIELEIS<br />
mit zwei Kab<strong>in</strong>en, die sich kurz h<strong>in</strong>tere<strong>in</strong>ander<br />
folgen. Zw<strong>in</strong>gende Voraussetzung<br />
für den neuen Fahrplan war<br />
zudem der Bau e<strong>in</strong>es dritten Bahnsteiges<br />
an der Station Campus Süd, der<br />
mit gut drei Mio. Euro zu Buche schlug.<br />
Bislang war dort nur e<strong>in</strong> Durchgangsgleis<br />
für die L<strong>in</strong>ie 1 und e<strong>in</strong> Wendegleis<br />
für die L<strong>in</strong>ie 2 vorhanden, womit der<br />
zweite Wagen der L<strong>in</strong>ie 2 ke<strong>in</strong>e Wendemöglichkeit<br />
gehabt hätte.<br />
Busse zum Technologiepark<br />
Wegen e<strong>in</strong>es Unfalls im Mai 2012 – se<strong>in</strong>erzeit<br />
kollidierte e<strong>in</strong>e H-Bahn-Kab<strong>in</strong>e<br />
auf der Strecke zwischen Technologiepark<br />
und S-Bahnhof Universität mit e<strong>in</strong>em<br />
zu hoch beladenen LKW – s<strong>in</strong>d aktuell<br />
nur drei der vier H-Bahn-Kab<strong>in</strong>en<br />
und damit zu wenig für den neuen<br />
Fahrplan betriebsbereit. Deshalb muss<br />
die L<strong>in</strong>ie 1 auf dem 2003 eröffneten<br />
Abschnitt vom S-Bahnhof Universität<br />
zum Technologiepark bis auf weiteres<br />
durch Busse ersetzt werden. Nur vor 8<br />
und nach 18 Uhr, wenn auf der L<strong>in</strong>ie 2<br />
ke<strong>in</strong>e Kapazitätsausweitung notwendig<br />
ist, fahren derzeit noch H-Bahnen<br />
zum Technologiepark.<br />
Die Dortmunder H-Bahn wurde<br />
1984 als vollautomatische Hängebahn<br />
an der Dortmunder Universität<br />
eröffnet und bedient heute auf zwei<br />
L<strong>in</strong>ien und e<strong>in</strong>em Netz von 3,2 km<br />
Länge die beiden Campi der TU Dortmund<br />
mite<strong>in</strong>ander sowie mit dem<br />
benachbarten Technologiepark und<br />
dem Stadtteil Eichl<strong>in</strong>ghofen. PKR<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
11
Aktuell<br />
Wenn am Ste<strong>in</strong>tor Hochbahnsteige entstehen, soll die Station verlegt werden – die künstlerisch gestalteten<br />
Fahrgastunterstände sollen aber als „Kunst im öffentlichen Raum“ erhalten bleiben<br />
A. UHLENHUT<br />
Hannover<br />
Neue Pläne für D-Strecke<br />
Für die Modernisierung der letzten<br />
<strong>in</strong>nerstädtischen Oberflächenstrecke<br />
<strong>in</strong> Hannover, jene vom Goetheplatz<br />
zum Aegidientorplatz,<br />
zeichnet sich e<strong>in</strong>e Lösung ab. Zwischen<br />
Goetheplatz und Hauptbahnhof<br />
soll die bestehende Strecke beibehalten<br />
und für den (langfristigen)<br />
E<strong>in</strong>satz von Hochflurstadtbahnen<br />
Hochbahnsteige erhalten: Am Goetheplatz<br />
kommt e<strong>in</strong> Hochbahnsteig<br />
an alter Stelle. Der heutige, künstlerisch<br />
gestaltete Stopp Ste<strong>in</strong>tor wird<br />
aufgegeben und mit dem Halt Clevertor<br />
zusammengelegt. Die Haltestellen<br />
am Hauptbahnhof sollen von<br />
diesem weg <strong>in</strong> Richtung des neuen<br />
E<strong>in</strong>kaufszentrums rücken. Die Strecke<br />
vom Hauptbahnhof zum Aegidientorplatz<br />
soll dagegen aufgegeben und<br />
durch e<strong>in</strong>e Neubaustrecke ersetzt werden:<br />
Durch den Straßentunnel unter<br />
den Bahnsteigen des Hauptbahnhofs<br />
h<strong>in</strong>durch würden die Stadtbahngleise<br />
zu e<strong>in</strong>em neuen Stopp am Raschplatz,<br />
unter dem sich die U-Station Hauptbahnhof<br />
bef<strong>in</strong>det, verlaufen. Im breiten<br />
Mittelstreifen der Berl<strong>in</strong>er Allee<br />
würde die Neubaustrecke bis zum<br />
Platz der Kaufleute nahe der Hochschule<br />
für Musik und Theater fortführen.<br />
Für diese Streckenführung müsste<br />
e<strong>in</strong>e vierspurige Stahlbeton-Hochstraße<br />
weichen, was alle<strong>in</strong> rund 15 der auf<br />
63 Mio. geschätzten Baukosten ausmacht.<br />
Nürnberg: Während des Umbaus ist der Werk stattwagen Bw 1540 das e<strong>in</strong>zige<br />
Schienen fahrzeug im Museum St. Peter<br />
U. ROCKELMANN<br />
Die Frage, wie es mit dieser oberirdischen<br />
Innenstadtstrecke – aufgrund<br />
ihrer Planungshistorie auch D-<br />
Strecke genannt – weitergeht, wird<br />
seit Jahren heiß diskutiert. Als Alternative<br />
zum Ausbau der Strecke mit<br />
Hochbahnsteigen standen auch die<br />
Adaptierung der beiden dort fahrenden<br />
L<strong>in</strong>ien 10 und 17 zu e<strong>in</strong>em Niederflurstadtbahnsystem<br />
oder der<br />
Bau e<strong>in</strong>es vierten Stammstreckentunnels<br />
zur Debatte. Beim jetzt vorliegenden<br />
Vorschlag handelt es sich<br />
um Pläne der Region Hannover, die<br />
mit Stadt und Verkehrsunternehmen<br />
abgestimmt s<strong>in</strong>d. Ob diese künftig<br />
auch <strong>in</strong> die Realität umgesetzt werden,<br />
bleibt abzuwarten. ACU<br />
schnitt e<strong>in</strong>es Abenteuerspielplatzes<br />
verändert werden muss. Bereits ab der<br />
zweiten Jahreshälfte 2014 soll die<br />
Traml<strong>in</strong>ie 17 von ihrer bisherigen Endstelle<br />
am Hauptbahnhof über e<strong>in</strong>e<br />
neue Haltestelle an der S-Bahnstation<br />
Stresemannallee bis nach Neu-Isenburg<br />
Stadtgrenze verlängert werden.<br />
Im Gegenzug soll die L<strong>in</strong>ie 14 von<br />
Bornheim kommend bereits an der<br />
Haltestelle Louisa enden. Die neue<br />
Strecke bietet nicht nur e<strong>in</strong>e schnelle<br />
und direkte Verb<strong>in</strong>dung zwischen Neu-<br />
Isenburg und dem Frankfurter Hauptbahnhof<br />
sondern ist auch der erste Abschnitt<br />
e<strong>in</strong>er künftigen R<strong>in</strong>gstrecke, die<br />
über kurze Neubaustrecken e<strong>in</strong>e Tangentialverb<strong>in</strong>dung<br />
zwischen allen<br />
Frankfurter U-Bahnstrecken schaffen<br />
soll.<br />
SKY<br />
Nürnberg<br />
<strong>Straßenbahn</strong>museum<br />
bis Frühl<strong>in</strong>g geschlossen<br />
Das <strong>Straßenbahn</strong>museum St. Peter<br />
<strong>in</strong> Nürnberg schloss am 8. Oktober für<br />
e<strong>in</strong>ige Monate se<strong>in</strong>e Pforten. Ursache<br />
ist die komplette Erneuerung der sechs<br />
Hallengleise, wobei gleichzeitig die<br />
bislang noch vorhandenen, aber abgedeckten<br />
e<strong>in</strong>stigen Wartungsgruben<br />
entfallen sollen. Aus Feuerschutzgründen<br />
werden zudem sämtliche Holze<strong>in</strong>bauten<br />
entfernt. Daher musste man<br />
die im vorderen Hallenteil bef<strong>in</strong>dlichen<br />
Fahrzeuge zeitweise <strong>in</strong> die He<strong>in</strong>rich-<br />
Alfes-Straße auslagern. E<strong>in</strong>zig der<br />
vom Vere<strong>in</strong> als <strong>in</strong>ternes Werkstattfahrzeug<br />
genutzte Beiwagen 1540 verblieb<br />
auf e<strong>in</strong>em Stumpfgleis rechts<br />
h<strong>in</strong>ter der Wagenhalle.<br />
Die beliebten Oldtimer- und Glühwe<strong>in</strong>fahrten<br />
(u.a. Burgr<strong>in</strong>gl<strong>in</strong>ie 15)<br />
entfallen dadurch aber nicht – nur der<br />
Ausgangspunkt wird zum Hauptbahnhof<br />
verlegt. Im Stadtteil St. Peter bedienen<br />
die historischen Züge die normale<br />
Haltestelle Peterskirche anstatt<br />
des Endpunktes direkt im Museumsgelände.<br />
Am ersten Maiwochenende<br />
2013 soll dann das Museum wiedereröffnet<br />
werden.<br />
UR<br />
Braunschweig<br />
E<strong>in</strong>stige Messestrecke<br />
abgebaut<br />
Die Verb<strong>in</strong>dung von der Wolfenbütteler<br />
Straße zur Schleife Richmond wurde<br />
abgebaut und ist damit seit Oktober<br />
endgültig Geschichte. <strong>Sie</strong> wurde schon<br />
zu Pferdebahnzeiten eröffnet und gehörte<br />
1897 zu den ersten elektrisch betriebenen<br />
Strecken der Löwenstadt. Se<strong>in</strong>erzeit<br />
befand sich hier das Depot nebst<br />
Kraftwerk. Bis 1969 bediente die <strong>Straßenbahn</strong><br />
planmäßig diesen Ast. Durch<br />
die Verlängerung der damaligen L<strong>in</strong>ie 2<br />
entlang der Wolfenbütteler Straße zum<br />
Heidberg (heute L<strong>in</strong>ien M1 und 2) verlor<br />
die Strecke ihren planmäßigen Verkehr.<br />
In den Folgejahren wurde die Richmond-Schleife<br />
regelmäßig zur heute<br />
nicht mehr stattf<strong>in</strong>denden Frühjahrsmesse<br />
Harz & Heide von der Messel<strong>in</strong>ie<br />
A (zeitweise L<strong>in</strong>ie 10) sowie bei<br />
zahlreichen Sonderfahrten benutzt.<br />
Für die Nikolausfahrten bot die um<br />
1951 im Park angelegte Schleife ideale<br />
Möglichkeiten für den Nikolaus, aus<br />
se<strong>in</strong>em Versteck zu ersche<strong>in</strong>en. Ende<br />
2008 allerd<strong>in</strong>gs wurde zunächst der<br />
Anschluss zur Wolfenbütteler Straße<br />
gekappt, da im Zuge des barrierearmen<br />
Ausbaus der Haltestelle Jahnplatz<br />
12 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Deutschland · Industrie · Weltweit<br />
Der Museums-Tw 41 (ex 7356) war 2008 die letzte Bahn, der die alte Strecke<br />
nach Richmond (auf dem falschen Gleis) befuhr<br />
S. VOCKRODT<br />
Bombardier: Damit der Ebbelwei-Express auch künftig se<strong>in</strong>e Runden durch<br />
Frankfurt drehen kann, wird die Flotte derzeit saniert<br />
J. SCHRAMM<br />
die Abzweigweiche nebst Gleiswechsel<br />
störte. Nun wurden die seit rund<br />
vier Jahren nicht mehr genutzten Anlagen<br />
endgültig demontiert.<br />
SV<br />
Industrie<br />
Bombardier<br />
Weitere Flexity Outlook<br />
für Marseille<br />
Bombardier gewann die Ausschreibung<br />
für sechs weitere Niederflur–<br />
Triebwagen für das französische Straßen<br />
bahnsystem <strong>in</strong> Marseille. Die<br />
CUMPM (Communauté Urba<strong>in</strong>e Marseille<br />
Provence Métropole) orderte im<br />
Jahr 2004 bereits 26 fünfteilige Flexitiy<br />
Outlook Trams für die im Jahr 2007<br />
wiedereröffnete <strong>Straßenbahn</strong>, welche<br />
zurzeit um zwei Module von 32.5 m<br />
auf 42.5 m Länge erweitert werden.<br />
Die sechs bereits ab Werk siebenteiligen<br />
Flexity Outlook werden ab 2014<br />
für den Betrieb der 1,2 km langen Neubaustrecke<br />
Cours Sa<strong>in</strong>t-Louis – Castellane<br />
benötigt. Die Neufahrzeuge werden<br />
ebenso wie die Zwischenmodule<br />
im Bombardier-Werk Wien endmontiert.<br />
ROS<br />
Bombardier<br />
Ebbelwei-Express wird<br />
<strong>in</strong> Ungarn saniert<br />
Bombardier MÁV Kft., die ungarische<br />
Tochtergesellschaft von Bombardier<br />
Transportation, saniert derzeit <strong>in</strong><br />
Dunakeszi für die Frankfurter Verkehrsgesellschaft<br />
(VGF) den Fahrzeugpark<br />
der Nostalgie- und Touristen-<strong>Straßenbahn</strong><br />
Ebbelwei-Express. Der erste Tw<br />
und Bw sollen im November bereits<br />
wieder aus Ungarn nach Frankfurt zurückgekehrt<br />
se<strong>in</strong>. Als <strong>Straßenbahn</strong>-<br />
Stadtrundfahrt tourt der Ebbelwei-Express<br />
seit 1977 am Wochenende und an<br />
Feiertagen durch die Straßen der Ma<strong>in</strong>metropole.<br />
Derzeit wird e<strong>in</strong> von der<br />
Schleife am Zoo ausgehender Rundkurs<br />
Zürich: Der 1986 eröffnete Tramtunnel Oerlikon – Schwamend<strong>in</strong>gen wird bis 2016 grundlegend saniert. Die<br />
wichtigsten Neuerungen umfassen e<strong>in</strong>e barrierefreie Gestaltung der unterirdischen Haltestellen Tierspital, Waldgarten<br />
und Schörlistrasse sowie deren Zugänge. Ende Oktober 2012 waren die Renovierungsarbeiten an der Haltestelle<br />
Tierspittal weitgehend abgeschlossen. Diese wirkt nun heller und freundlicher<br />
R. SCHREMPF<br />
durch die Innenstadt und <strong>in</strong>nenstadtnahen<br />
Stadtteile angeboten. E<strong>in</strong>gesetzt<br />
werden Zweiachser der Typen K/k, die<br />
<strong>in</strong> der Nachkriegszeit als Aufbauwagen<br />
auf den Fahrgestellen kriegszerstörter<br />
<strong>Straßenbahn</strong>en entstanden. PKR<br />
Bombardier<br />
Servicevertrag mit den<br />
IVB abgeschlossen<br />
Die Innsbrucker Verkehrsbetriebe &<br />
Stubaitalbahn GmbH (IVB) unterzeichneten<br />
mit Bombardier e<strong>in</strong>en Servicevertrag<br />
für die Wartung der 32 Flexity Outlook-Niederflurwagen.<br />
Der Auftrag hat<br />
e<strong>in</strong>en Gesamtwert von rund 44 Mio.<br />
Euro und läuft bis Ende 2028. Bom bardier<br />
wird hierbei das gesamte Servicemanagement<br />
der IVB für die 32 Niederflurtrams<br />
übernehmen, wobei die<br />
Wartungsarbeiten von den IVB-Mitarbeitern<br />
selbst durchgeführt werden.<br />
Die IVB s<strong>in</strong>d nach den L<strong>in</strong>z AG L<strong>in</strong>ien<br />
der zweite österreichische Kunde, der<br />
sich für das neu entwickelte Servicekonzept<br />
aus dem Hause Bombardier<br />
entschied. Das Servicekonzept soll<br />
maßgeblich zu e<strong>in</strong>er hohen Verfügbarkeit<br />
und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge<br />
beitragen und somit e<strong>in</strong>e hohe Kundenzufriedenheit<br />
sicherstellen. R. Schrempf<br />
Weltweit<br />
Österreich: Innsbruck<br />
L<strong>in</strong>ie 3 <strong>in</strong> Amras<br />
verlängert<br />
Am 26. Oktober eröffneten die<br />
Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn<br />
GmbH (IVB) nach langer<br />
Projektierungsphase die erste von<br />
zwei Neubaustrecken 2012: Die L<strong>in</strong>ie 3<br />
wurde von ihrer bisherigen Endstelle<br />
am Ost-Friedhof näher an das Zentrum<br />
des Stadtteils Amras verlängert. Die<br />
380 m lange Strecke, die für 2,9 Mio.<br />
Euro errichtet wurde, folgt der Philipp<strong>in</strong>e-Welser-Straße<br />
und endet nun<br />
stumpf, sozusagen an e<strong>in</strong>em Kopfbahnhof<br />
mit zwei barrierefreien Außenbahnsteigen.<br />
Die bisherige Schleife<br />
wird abgetragen und die dortige<br />
Haltestelle von Amras <strong>in</strong> Philipp<strong>in</strong>e-<br />
Welser-Straße umbenannt. Die neue<br />
Endstation heißt, wie bisher die alte,<br />
Amras. Am anderen Ende wird die L<strong>in</strong>ie<br />
3 am 14. Dezember 2012 über e<strong>in</strong>e<br />
Innsbruck: Flexity Outlook 310 verlässt die mit e<strong>in</strong>em Umfahrungsgleis für<br />
den Beiwagenbetrieb ausgeführte neue Endstation Amras J. SCHIESTL<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
13
Aktuell<br />
Auf den häufig anzu -<br />
treffenden unbe fes -<br />
tigten Gleisanlagen<br />
machen die neuen<br />
VarioLF, hier der Tw<br />
3205 bei se<strong>in</strong>er Fahrt <strong>in</strong><br />
das Randgebiet Qo’yliq,<br />
e<strong>in</strong>e gute Figur<br />
D. MÖSCHKE<br />
Usbekistan: Toshkent<br />
Niederflurige Tschechen <strong>in</strong> Betrieb<br />
Die erste Lieferserie von VarioLF-<br />
Niederflurwagen aus dem Hause Pragoimex,<br />
e<strong>in</strong>em Nachfolgeunternehmen<br />
von CKD Tatra, wurde jüngst<br />
abgeschlossen. 2011 begann die Lieferung<br />
der ersten beiden (von zwanzig)<br />
Triebwagen des Typs „VarioLF“,<br />
die e<strong>in</strong>en Niederfluranteil von 36%<br />
bieten. 2012 wurde die Serienlieferung<br />
der verbleibenden 18 Wagen<br />
fortgesetzt. Nach <strong>in</strong>sgesamt fünf<br />
Transporten auf dem Schienenweg<br />
konnten die Neufahrzeuge allesamt<br />
pünktlich übergeben werden und gelangten<br />
bereits meist nach nur wenigen<br />
Tagen <strong>in</strong> den Fahrgaste<strong>in</strong>satz.<br />
Die Version „Toshkent“ unterscheidet<br />
sich von den europäischen Wagen<br />
auf den ersten Blick durch e<strong>in</strong>en Scherenstromabnehmer.<br />
Zudem verfügen<br />
die Fahrzeuge über ke<strong>in</strong>e elektronischen<br />
Fahrtzielanzeigen, sondern werden<br />
r<strong>in</strong>gsum mit gut lesbaren L<strong>in</strong>ientafeln<br />
bestückt. Auch s<strong>in</strong>d die VarioLF <strong>in</strong><br />
Toshkent mit e<strong>in</strong>er Pedalsteuerung ausgestatt.<br />
Diese werden von den Triebfahrzeugführern<br />
gebraucht, um den<br />
Stromabnehmer während der Fahrt unter<br />
dem teilweise sehr schlechten Fahrdraht<br />
abziehen und nach e<strong>in</strong>igen<br />
durchrollten Streckenmetern wieder<br />
anlegen zu können. Von den Außenschwenktüren,<br />
welche nur <strong>in</strong> den beiden<br />
Vorläufern verbaut wurden, kam<br />
man allerd<strong>in</strong>gs wieder ab und orderte<br />
die Restserie mit Falttüren wie man sie<br />
Czestochowa: Neue Bahn auf neuer Trasse: Twist 624 am 4. Oktober an der<br />
Haltestelle Zarecka<br />
B. KUSSMAGK<br />
auch aus dem tschechischen Brno<br />
kennt.<br />
Alle zwanzig Wagen br<strong>in</strong>gen mit<br />
der silbrig-goldenen Lackierung e<strong>in</strong>en<br />
frischen Anblick auf das Toshkenter<br />
Streckennetz, welches sich seit den<br />
massiven Stilllegungen der letzten<br />
Jahre leider nur noch auf Vorstadtstrecken<br />
beschränkt. Durch die nun<br />
stattgefundene Verjüngung des Wagenparks<br />
konnten weitere Tatra<br />
T6B5-Vierachser, von denen ohneh<strong>in</strong><br />
nicht mehr viele Fahrzeuge e<strong>in</strong>gesetzt<br />
werden, abgestellt werden. Spekulationen<br />
zufolge möchte der Verkehrsbetrieb<br />
<strong>in</strong> naher Zukunft <strong>in</strong> weitere<br />
zwanzig Wagen des gleichen Typs <strong>in</strong>vestieren.<br />
DAM<br />
1,4 km lange Neubaustrecke von der<br />
Anichstraße bis zur Hött<strong>in</strong>ger Au verlängert.<br />
ROS<br />
Österreich: Graz<br />
Tunnel vor Eröffnung<br />
Der Grazer Hauptbahnhof war bis<br />
zuletzt e<strong>in</strong>e Großbaustelle. Für <strong>in</strong>sgesamt<br />
260 Mio. Euro wird er zu e<strong>in</strong>em<br />
modernen Knotenpunkt für Fernverkehr,<br />
S-Bahn und städtischen Nahverkehr<br />
ausgebaut. Alle<strong>in</strong> 90 Mio. Euro der<br />
Investitionssumme entfallen auf e<strong>in</strong>e<br />
neue unterirdische <strong>Straßenbahn</strong>station,<br />
um die bislang etwas versetzt zum<br />
Bahnhof querende Ost-West-Strecke<br />
direkt unter den Bahnhofsvorplatz verschwenken<br />
zu können. Die Eröffnung<br />
der sogenannten Nahverkehrsdrehscheibe<br />
soll nach aktuellem Term<strong>in</strong>plan<br />
am 26. November 2012 stattf<strong>in</strong>den. Ab<br />
diesem Tag werden die <strong>Straßenbahn</strong>l<strong>in</strong>ien<br />
1, 3, 6 und 7 unterirdisch zum<br />
Bahnhofsvorplatz verkehren.<br />
Parallel zu den Bauarbeiten am Bahnhof<br />
fanden umfangreiche Sanierungsarbeiten<br />
im Oberflächennetz statt. Die<br />
<strong>Straßenbahn</strong>strecken <strong>in</strong> der Annen- und<br />
Münzgrabenstraße waren daher den<br />
gesamten Sommer über gesperrt und<br />
g<strong>in</strong>gen erst am 8. September wieder <strong>in</strong><br />
Betrieb. In der Annenstraße, der Verb<strong>in</strong>dung<br />
zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt,<br />
wurde gleichzeitig die E<strong>in</strong>fahrt<br />
<strong>in</strong> den zukünftigen Tramtunnel so<br />
weit vorbereitet, dass für den bevorstehenden<br />
Umschluss voraussichtlich nur<br />
e<strong>in</strong>e kurze Sperrung am 24. und 25. November<br />
nötig se<strong>in</strong> wird C. Groneck<br />
Polen: Czestochowa<br />
Traml<strong>in</strong>ie 3 eröffnet<br />
Am 3. September wurde <strong>in</strong> Czestochowa<br />
(Tschenstochau), gelegen <strong>in</strong><br />
Südpolen, e<strong>in</strong>e 4,5 km lange Neubaustrecke<br />
eröffnet, die den Süden der<br />
Stadt mit den Bezirken Wrzosowiak<br />
und Błeszno erschließt. Bedient wird sie<br />
von e<strong>in</strong>er neuen, <strong>in</strong>sgesamt 11,7 km<br />
langen <strong>Straßenbahn</strong>l<strong>in</strong>ie 3, die von der<br />
Schleife Fieldorfa-Nila im Norden der<br />
Stadt zur neuen Endstelle am Stadion<br />
Raków verkehrt. Die Fahrzeit von Endstelle<br />
zu Endstelle beträgt 38 M<strong>in</strong>uten.<br />
Die L<strong>in</strong>ie 3 folgt von Norden kommend<br />
zunächst den vorhandenen <strong>Straßenbahn</strong>l<strong>in</strong>ien<br />
1 und 2, um an der Haltestelle<br />
Estakada von der Bestandsstrecke<br />
abzuzweigen. Entlang der weitgehend<br />
auf eigenem Gleiskörper <strong>in</strong><br />
Mittel- oder Seitenlage bestehender<br />
Straßen angelegten Strecke werden<br />
<strong>in</strong>sgesamt zwölf neue Haltestellen bedient.<br />
Die parallelen Busl<strong>in</strong>ien wurden<br />
e<strong>in</strong>gestellt. Auf der L<strong>in</strong>ie 3 wird unter<br />
der Woche tagsüber alle zehn und zu<br />
verkehrsärmeren Zeiten alle 15 bis 20<br />
M<strong>in</strong>uten gefahren.<br />
Zum E<strong>in</strong>satz gelangen die 105Na-<br />
Doppeltraktionen, aber auch e<strong>in</strong>ige der<br />
neuen sieben achtachsigen 129Nb-Gelenkwagen<br />
aus der Fahrzeugfamilie<br />
Twist des Herstellers Pesa. Im Februar<br />
wurde der erste Twist angeliefert und<br />
am 1. Juni im Zuge e<strong>in</strong>es „Roll-out“ im<br />
Betriebshof präsentiert. Bei e<strong>in</strong>er Länge<br />
von 32 m und e<strong>in</strong>er Breite von 2,4 m<br />
bietet e<strong>in</strong> Twist Platz für 222 Fahrgäste<br />
und 59 Sitzplätze.<br />
BEKUS<br />
Schweiz: Bern<br />
Tram <strong>in</strong> die Region<br />
Mitte Oktober 2012 erteilte der Bundesrat<br />
den Verkehrsbetrieben Bernmobil<br />
die Infrastrukturkonzession zur Rea-<br />
14 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
lisierung des „Tram Region Bern“ sowie<br />
zur Verlängerung der Traml<strong>in</strong>ie 9<br />
von Wabern nach Kle<strong>in</strong>wabern. Die<br />
13 km lange Regiotram soll die südwestlich<br />
von Bern gelegenen Geme<strong>in</strong>den<br />
Köniz-Schliern mit Berns Stadtzentrum<br />
und der östlichen Nachbargeme<strong>in</strong>de<br />
Ostermundigen verb<strong>in</strong>den und<br />
die Busl<strong>in</strong>ie 10 ersetzen. Der Bund wird<br />
sich an der F<strong>in</strong>anzierung der Neubaustrecken<br />
beteiligen. Zuvor müssen die<br />
Bauvor haben <strong>in</strong> der zweiten Hälfte<br />
2014 noch durch die Geme<strong>in</strong>deabstimmungen.<br />
Bis dah<strong>in</strong> wird das Bauprojekt<br />
erstellt und das Plangenehmigungsverfahren<br />
durchgeführt.<br />
In der schweizer Bundeshauptstadt<br />
fahren heute tagsüber vier <strong>Straßenbahn</strong>-<br />
und e<strong>in</strong>e Obusl<strong>in</strong>ie zentral durch<br />
die Altstadt. Mit dem „Tram Region<br />
Bern“ wird der Schienenstrang durch<br />
die Markt- und Spitalgasse an se<strong>in</strong>e<br />
Grenzen stoßen. Dies führte zur Planung<br />
e<strong>in</strong>er zweiten Tramachse. Die<br />
auserwählte Variante „Altstadt Nord“<br />
weist den höchsten Nutzen h<strong>in</strong>sichtlich<br />
Entlastung der Innenstadt und der<br />
Umfahrungsmöglichkeiten für den<br />
Tramverkehr bei technischen Störungen,<br />
Baustellen und Großveranstaltungen<br />
<strong>in</strong> der Innenstadt auf. Diese soll<br />
vom Kocherpark über die Belp- und<br />
Laupenstrasse, den Bahnhofplatz, das<br />
Bollwerk und über die Speicher- und<br />
die Nägeligasse führen.<br />
Schon am 9. Dezember 2012 wird<br />
die L<strong>in</strong>ie 9 vom Guisanplatz zur S-<br />
Bahn-Station Wankdorf verlängert. E<strong>in</strong>e<br />
erste Probefahrt auf der 1,2 km lan-<br />
gen Neubaustrecke fand am 23. Oktober<br />
statt.<br />
R. Schrempf<br />
Ungarn: Szeged<br />
Neue Strecke, neue<br />
L<strong>in</strong>ie und neue Trams<br />
Die <strong>Straßenbahn</strong> <strong>in</strong> Szeged, der<br />
zweitgrößte ungarische Betrieb, wird<br />
weiter modernisiert und ausgebaut.<br />
Nachdem auch am Endpunkt der L<strong>in</strong>ie<br />
3F an der Fonógyari út <strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong><br />
neues Wendedreieck <strong>in</strong> Betrieb genommen<br />
werden konnte, wurde am 2. März<br />
e<strong>in</strong>e Neubaustrecke eröffnet. Diese<br />
wird von e<strong>in</strong>er neuen <strong>Straßenbahn</strong>l<strong>in</strong>ie<br />
2 bedient. Die neue L<strong>in</strong>ie fährt ab dem<br />
Hauptbahnhof geme<strong>in</strong>sam mit der L<strong>in</strong>ie<br />
1 durch die Stadt, zweigt aber an<br />
der Haltestelle Vásárhelyi Pál út von<br />
der Strecke der L<strong>in</strong>ie 1 ab und führt<br />
über e<strong>in</strong>e 1,9 km lange Neubaustrecke<br />
mit fünf Haltestellen nach Európa liget.<br />
Neben e<strong>in</strong>zelnen T6-Traktionen (aus<br />
Triebwagen und führerstandslosen<br />
Triebbeiwagen) kommen überwiegend<br />
die neuen 120Nb von Pesa, auch Sw<strong>in</strong>g<br />
Szeged genannt, auf der L<strong>in</strong>ie 2 zum<br />
E<strong>in</strong>satz. Von den neuen Sw<strong>in</strong>g-Tf wurden<br />
mittlerweile alle neun Exemplare<br />
ausgeliefert. Die Neubaustrecke bedient<br />
<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie größere Plattenbausiedlungen<br />
und ist auf eigenem<br />
Gleiskörper, teilweise mit Rasengleis,<br />
trassiert. Die L<strong>in</strong>ie 2 fährt montags bis<br />
freitags tagsüber alle 10 M<strong>in</strong>uten, <strong>in</strong><br />
der HVZ sogar alle 7,5 M<strong>in</strong>uten sowie<br />
samstags und sonntags im 15- und<br />
abends im 20-M<strong>in</strong>uten-Takt. BEKUS<br />
Szeged: Der<br />
Sw<strong>in</strong>g-Triebwagen<br />
103 (l<strong>in</strong>ks) fährt<br />
am 1. Oktober<br />
2012 <strong>in</strong> die neue<br />
Endhaltestelle<br />
Európa Liget e<strong>in</strong>,<br />
wo er se<strong>in</strong>e Tatra-<br />
Vorgänger trifft<br />
BEKUS<br />
Bern: Zusätzlich<br />
zur heutigen<br />
Tramstrecke durch<br />
die Altstadt, hier<br />
an der Haltestelle<br />
Bärenplatz (Spi-<br />
talgasse), könnte<br />
künftig e<strong>in</strong>e<br />
weitere entstehen<br />
ROS<br />
»Erfahre München!«, so heißt das<br />
neue Spiel der MVG, und so lautet<br />
auch die Aufgabe für zwei bis fünf<br />
Spieler ab 10 Jahren. Jeder Spieler<br />
muss mit se<strong>in</strong>er Tram e<strong>in</strong>en<br />
geheimen Streckenauftrag verfolgen<br />
und sich den Schienenweg<br />
zum Ziel legen. Beim Bauen können<br />
aber andere Weichensteller<br />
<strong>in</strong> die Quere kommen ...<br />
Das unterhaltsame Brettspiel von<br />
Spieleautor Stefan Dorra wurde<br />
speziell für München und die<br />
Münchner Verkehrsgesellschaft<br />
(MVG) weiterentwickelt und<br />
be sticht durch e<strong>in</strong>e detailreiche,<br />
liebevolle Gestaltung sowie e<strong>in</strong>e<br />
hochwertige Verarbeitung.<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Betriebe<br />
Angebotsoffensive<br />
und Rückfallebenen<br />
München: Verstärkungsl<strong>in</strong>ien, Taktverdichtungen, zusätzliche Fahrzeuge Ab 9. Dezember<br />
fährt Münchens Tram öfter – solange die Variobahnen mitspielen. Zur Verstärkung der Fahrzeugflotte<br />
wurden Altwagen aufgearbeitet und acht Niederflurbahnen vom Typ AVENIO bestellt!<br />
Mit 102 Niederflurbahnen, nämlich<br />
68 (von e<strong>in</strong>st 70) „kurzen“<br />
R 2.2, 20 „langen“ R 3.3 und<br />
14 Variobahnen (Typ S 1.4/1.5),<br />
plante die Münchner Verkehrsgesellschaft<br />
(MVG) ursprünglich, um das „Leistungsprogramm<br />
Tram“ realisieren zu können.<br />
Dazu waren neben der im Dezember 2011<br />
erfolgten Eröffnung der Neubaustrecke nach<br />
St. Emmeram (L<strong>in</strong>ie 16) Taktverdichtungen<br />
auf diversen Streckenabschnitten im Bestandsnetz<br />
geplant. Die seit dem ersten L<strong>in</strong>iene<strong>in</strong>satz<br />
im Dezember 2010 anhaltenden<br />
Zulassungs- und Verfügbarkeitsprobleme<br />
mit den Variobahnen e<strong>in</strong>erseits und die stetig<br />
ansteigenden Fahrgastzahlen andererseits<br />
machten nun e<strong>in</strong> Umdenken nötig.<br />
Investitionen <strong>in</strong> den Fahrzeugpark<br />
Als sich die Situation bei den Variobahnen<br />
im Laufe des Jahres 2012 zu dramatisieren<br />
drohte – die befristete Zulassung lief im August<br />
aus und an den Gummielementen der<br />
Räder traten Serienschäden auf –, handelte<br />
die MVG. Bestrebungen, gebrauchte Fahrzeuge<br />
von anderen Betrieben nach München<br />
zu holen, blieben allerd<strong>in</strong>gs erfolglos. Trotzdem<br />
wird <strong>in</strong> diese Richtung nach wie vor recherchiert!<br />
Investiert wurde aber umgehend<br />
<strong>in</strong> die Aufarbeitung der letzten verfügbaren<br />
eigenen Altwagen, die ab Herbst 2012 eigentlich<br />
endgültig Geschichte se<strong>in</strong> sollten.<br />
Ab Ende November stehen nun mit den P-<br />
Triebwagen 2006, 2010, 2021, 2028 und<br />
2031 sowie den p-Beiwagen 3004, 3005,<br />
3014 und 3039 (3037 folgt etwas später)<br />
wieder bis zu fünf kapazitätsstarke Kurzgelenkzüge<br />
für den L<strong>in</strong>iendienst zur Verfügung.<br />
Das Aufarbeitungsprogramm für diese<br />
1967–1969 gebauten Fahrzeuge kostet e<strong>in</strong>en<br />
niedrigen zweistelligen Millionenbetrag<br />
und reicht – je nach Zustand der Wagen –<br />
von e<strong>in</strong>er neuen Hauptuntersuchungen bis<br />
h<strong>in</strong> zur Kernsanierung (neue Böden, Dachaufbauten,<br />
etc.). Die P-/p-Züge werden zunächst<br />
so lange im E<strong>in</strong>satz bleiben, bis die<br />
Variobahnen zuverlässig zur Verfügung stehen<br />
und e<strong>in</strong>e unbefristete Zulassung vorliegt.<br />
Bald 125 <strong>Straßenbahn</strong>züge<br />
Zunächst soll vor allem die L<strong>in</strong>ie 17 das<br />
„Auslaufgebiet“ für die P-/p-Züge se<strong>in</strong>, die<br />
grundsätzlich auf allen L<strong>in</strong>ien fahren dürften,<br />
aber dennoch nicht wirklich flexibel e<strong>in</strong>setzbar<br />
s<strong>in</strong>d. Der Grund dafür ist e<strong>in</strong>e Auflage<br />
der Technischen Aufsichtsbehörde<br />
(TAB), wonach Zugbegegnungen von P-Wagen<br />
und Variobahnen nur erlaubt s<strong>in</strong>d, wenn<br />
e<strong>in</strong>es der beiden Fahrzeuge steht. Damit<br />
schließt sich der E<strong>in</strong>satz von P-Wagen auf<br />
den „Variobahn-L<strong>in</strong>ien“ 19 und 20/21/22<br />
im Pr<strong>in</strong>zip aus, da es zu „Dom<strong>in</strong>o-Effekten“<br />
(z.B. verpasste Ampelschaltungen) und somit<br />
zu Verspätungen kommen würde.<br />
Mittelfristig werden die „Dicken“ dann<br />
als Fahrzeugreserve dienen, auch, um weitere<br />
Verbesserungsmaßnahmen an den älteren<br />
Niederflurwagen vornehmen zu können.<br />
So soll das laufende Redesign-Programm für<br />
16 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
München<br />
Zwischen Sendl<strong>in</strong>ger Tor und Karlsplatz/Stachus begegnet dem P-Wagen<br />
2028 e<strong>in</strong> R 3.3 – die L<strong>in</strong>ie 27 erhält mit Fahrplanwechsel Verstärkung<br />
durch die neue L<strong>in</strong>ie 28 Sendl<strong>in</strong>ger Tor – Scheidplatz<br />
Fünf P-/p-Zügen wurde noch e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>e Hauptuntersuchung spendiert.<br />
<strong>Sie</strong> sollen zunächst vorrangig auf der L<strong>in</strong>ie 17 e<strong>in</strong>gesetzt werden<br />
und mittelfristig als Fahrzeugreserve dienen ALLE BILDER: M :KRISCHE<br />
GROSSES BILD LINKS Die L<strong>in</strong>ien 20 und 21 <strong>in</strong> der<br />
Betriebswendeschleife Olympiapark Süd<br />
nahe der Haltestelle Infanteriestraße, die<br />
oft zum Geraderücken e<strong>in</strong>es aus den Fugen<br />
geratenden Fahrplantaktes genutzt wird<br />
<strong>in</strong>sgesamt 50 Fahrzeuge des Typs R 2.2 (Baujahre<br />
1994–1997) beschleunigt werden, und<br />
es gibt Überlegungen, dieses auch auf die<br />
restlichen 18 Bahnen dieses Typs auszuweiten.<br />
Die 20 Bahnen vom Typ R 3.3 (Baujahre<br />
1999–2001) werden mit Videoüberwachung<br />
und „Infota<strong>in</strong>ment“ nachgerüstet.<br />
Ende September 2012 ließ die MVG<br />
schließlich mit der Bestellung von acht neuen<br />
Niederflurbahnen vom Typ AVENIO bei<br />
der Firma <strong>Sie</strong>mens aufhorchen, von denen<br />
sechs bereits im Dezember 2013 für den L<strong>in</strong>iene<strong>in</strong>satz<br />
zur Verfügung stehen sollen! Ab<br />
Anfang 2014 wird die Münchner Tramflotte<br />
somit 120 Niederflurwagen und fünf P-<br />
/p-Züge umfassen. Auch wenn es dann sehr<br />
„kuschelig“ im seit 1993 e<strong>in</strong>zigen Betriebshof<br />
an der E<strong>in</strong>ste<strong>in</strong>straße se<strong>in</strong> wird, reichen<br />
die Depotkapazitäten laut MVG für dann<br />
125 L<strong>in</strong>iendienst-Fahrzeuge noch aus.<br />
Ungewissheit bei den Variobahnen<br />
Von den 14 Variobahnen waren Anfang November<br />
2012 pr<strong>in</strong>zipiell 13 e<strong>in</strong>satzfähig – soweit<br />
ke<strong>in</strong>e Störungen/Schäden zu beheben<br />
s<strong>in</strong>d. Lediglich die „Batterie-Tram“ 2301<br />
steht derzeit nicht zur Verfügung, sie bef<strong>in</strong>det<br />
sich bei Hersteller Stadler <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>. Bereits<br />
ausgetauschte Räder/Gummielemente,<br />
Reichlich Fahrgastnachfrage<br />
an der<br />
Station Lothstraße –<br />
e<strong>in</strong> gewohntes Bild<br />
an Vorlesungstagen<br />
die über e<strong>in</strong>en längeren E<strong>in</strong>satzzeitraum und<br />
vor allem auch über die W<strong>in</strong>terperiode getestet<br />
werden müssen, s<strong>in</strong>d bislang unauffällig.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs würden weiterh<strong>in</strong> bzw. erneut<br />
auftretende Serienschäden kurzfristig<br />
zum Teilausfall der Variobahn-Flotte oder<br />
im schlimmsten Fall womöglich zum Zulassungsentzug<br />
für diesen Fahrzeugtyp führen.<br />
Die zuletzt bis 31. August 2012 befristete<br />
Auch auf der vor drei Jahren neu eröffneten<br />
L<strong>in</strong>ie 23 Münchner Freiheit – Schwab<strong>in</strong>g Nord<br />
wird zum 9. Dezember der Takt verstärkt<br />
Zulassung für den L<strong>in</strong>ienbetrieb wurde von<br />
der TAB erst wenige Tage vor dem Auslaufen<br />
bis zunächst 31. Mai 2013 verlängert.<br />
Zudem können die Variobahnen nach wie<br />
vor nur auf den L<strong>in</strong>ien 19 und 20/21/22 e<strong>in</strong>gesetzt<br />
werden. Mit Fortschritten für weitere<br />
Streckengenehmigungen rechnet die MVG<br />
erst ab Frühjahr 2013.<br />
Fahrplan mit Rückfallszenarien<br />
Trotz der somit latent ungewissen E<strong>in</strong>satzverfügbarkeit<br />
der Variobahnen hat sich die<br />
MVG entschlossen, zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>en Teil der<br />
geplanten Angebotsverbesserungen im<br />
Trambereich nun zum Fahrplanwechsel am<br />
9. Dezember 2012 zu realisieren. Weitere<br />
Taktverdichtungen könnten – sofern dann<br />
die endgültige Zulassung der TAB für die Variobahnen<br />
vorliegt – im Rahmen e<strong>in</strong>es „kle<strong>in</strong>en<br />
Fahrplanwechsels“ im Laufe des Jahres<br />
2013 folgen. Zunächst s<strong>in</strong>d die Fahr- und<br />
Dienstpläne allerd<strong>in</strong>gs so gestrickt, dass jederzeit<br />
kurzfristig „umgeswitcht“ werden<br />
kann, falls ke<strong>in</strong>e oder zu wenig Variobahnen<br />
zur Verfügung stünden. Die entsprechenden<br />
„Rückfallpläne“, u.a. mit Busersatzverkehren<br />
auf e<strong>in</strong>igen Abschnitten und kürzeren<br />
Wendezeiten an Endpunkten, liegen e<strong>in</strong>satzbereit<br />
<strong>in</strong> der Schublade.<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
17
Betriebe<br />
Das Münchner Tramnetz ab 9. Dezember 2012: Die neue Verstärkungsl<strong>in</strong>ie 28 Scheidplatz – Sendl<strong>in</strong>ger Tor stellt durch Überlagerung mit der L<strong>in</strong>ie<br />
27 unter der Woche e<strong>in</strong>en Fünf-M<strong>in</strong>uten-Takt zwischen der Innenstadt und dem Kurfürstenplatz her. Die neue L<strong>in</strong>ie 22 ergänzt die L<strong>in</strong>ien 20/21<br />
und endet <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er neuen Schleife an der Hochschule. Für e<strong>in</strong> Jahr stillgelegt ist der westliche Abschnitt der L<strong>in</strong>ie 19 Willibaldplatz – Pas<strong>in</strong>g MVG<br />
Vor allem die „Hochschultram“ (L<strong>in</strong>ien<br />
20/21) <strong>in</strong> der Dachauer Straße soll vom neuen<br />
Fahrplan profitieren.<br />
Neue Wendeschleife Hochschule<br />
Dazu wird die neue L<strong>in</strong>ie 22 e<strong>in</strong>geführt, die<br />
lediglich zwischen Karlsplatz (Stachus) und<br />
der bisherigen Haltestelle Lothstraße (künftig<br />
als Hochschule München bezeichnet)<br />
pendelt. Dort wurde e<strong>in</strong>e neue Wendeschleife<br />
gebaut, die sich im Bereich der ehemaligen<br />
E<strong>in</strong>fahrt zum 1977 aufgegebenen Betriebshof<br />
bef<strong>in</strong>det. An Vorlesungstagen fahren die<br />
L<strong>in</strong>ien 20, 21 und 22 dann jeweils im Zehn-<br />
M<strong>in</strong>uten-Takt, und <strong>in</strong> der morgendlichen<br />
Verkehrsspitze wird die L<strong>in</strong>ie 22 zusätzlich<br />
verstärkt, so dass bis zur Hochschule alle<br />
zweie<strong>in</strong>halb M<strong>in</strong>uten e<strong>in</strong>e Bahn fährt. Bei<br />
massivem Fahrzeugmangel würden diese<br />
Verstärkungskurse mit Bussen gefahren wer-<br />
E<strong>in</strong> noch nicht modernisierter R 2.2 und e<strong>in</strong> R 3.3 an der Haltestelle Nordbad. Die L<strong>in</strong>ie 27 fährt<br />
ab 9. Dezember an allen Tagen bis 22 Uhr abends im Zehn-M<strong>in</strong>uten-Takt<br />
den. Die oft hoffnungslos überfüllten <strong>Straßenbahn</strong>en<br />
<strong>in</strong> diesem Bereich und der regelmäßig<br />
völlig aus den Fugen geratende Fahrplan<br />
der L<strong>in</strong>ie 20/21 mit Taktlücken,<br />
Pulkfahrten und Ersatzwendemanövern <strong>in</strong><br />
den Betriebsschleifen Karlstraße und Olympiapark<br />
Süd sollen dann der Vergangenheit<br />
angehören. Zudem dürfte e<strong>in</strong> per Schienenaustausch<br />
Ende Oktober aufgelöstes Begegnungsverbot<br />
im Bereich Stiglmaierplatz zu<br />
e<strong>in</strong>em flüssigeren Betriebsablauf beitragen.<br />
Verstärkungsl<strong>in</strong>ie 28 zum Scheidplatz<br />
Ebenfalls neu e<strong>in</strong>geführt wird die Verstärkungsl<strong>in</strong>ie<br />
28 Scheidplatz – Sendl<strong>in</strong>ger Tor.<br />
<strong>Sie</strong> stellt <strong>in</strong> Überlagerung mit der L<strong>in</strong>ie 27<br />
zwischen der Innenstadt und dem Kurfürstenplatz<br />
tagsüber unter der Woche e<strong>in</strong>en<br />
Fünf-M<strong>in</strong>uten-Takt her. Der U-Bahnknoten<br />
Scheidplatz erhält damit seit über 30 Jahren<br />
wieder e<strong>in</strong>e reguläre Direktverb<strong>in</strong>dung<br />
per Tram mit dem Stadtzentrum! Sollte das<br />
Rückfallkonzept wegen Fahrzeugmangels<br />
aber tatsächlich greifen müssen, würde der<br />
Scheidplatz dagegen temporär vom <strong>Straßenbahn</strong>netz<br />
abgebunden und die L<strong>in</strong>ie 12<br />
am Kurfürstenplatz mit der L<strong>in</strong>ie 28 verknüpft<br />
werden. Abends wird auf der L<strong>in</strong>ie<br />
27 zudem nun täglich bis 22 Uhr im Zehn-<br />
M<strong>in</strong>uten-Takt gefahren statt wie bisher nach<br />
ca. 20 Uhr alle 20 M<strong>in</strong>uten.<br />
18 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
München<br />
Der frisch hauptuntersuchte P-Tw 2021 trifft am 26. Oktober auf Fahrschulfahrt<br />
am Stiglmaierplatz e<strong>in</strong>e Variobahn. Begegnungen dieser beiden<br />
Fahrzeugtypen s<strong>in</strong>d nur zulässig, wenn e<strong>in</strong>es der Fahrzeuge steht!<br />
Münchens engste Wendeschleife auf dem Pas<strong>in</strong>ger Marienplatz wird<br />
am 9. Dezember 2012 stillgelegt; ab Ende 2013 nutzt die L<strong>in</strong>ie 19 dann<br />
e<strong>in</strong>e neue Häuserblockumfahrung mit Haltestelle vor dem Bahnhof<br />
Verdichtet wird wegen der guten Nachfrage<br />
auch der Takt auf der Ende 2009 eröffneten<br />
L<strong>in</strong>ie 23 Münchner Freiheit –<br />
Schwab<strong>in</strong>g Nord. Hier kommt <strong>in</strong> der Hauptverkehrszeit<br />
statt bislang alle zehn M<strong>in</strong>uten<br />
nun alle sieben bzw. acht M<strong>in</strong>uten e<strong>in</strong>e Tram.<br />
Weitere Taktverdichtungen möglich<br />
Am Größten ist die Fahrplan-Ungewissheit<br />
derzeit noch bei den L<strong>in</strong>ien 15/25. Nach viermonatiger<br />
baustellenbed<strong>in</strong>gter Streckensperrung<br />
südlich des Ostfriedhofs und der<br />
Beschränkung auf die Kurzführung Max-<br />
Weber-Platz – St.- Mart<strong>in</strong>s-Platz gehen die<br />
L<strong>in</strong>ien Ende November wieder regulär <strong>in</strong> Betrieb.<br />
Sofern genug Fahrzeuge zur Verfügung<br />
stehen, soll <strong>in</strong> der Hauptverkehrszeit der<br />
7-/8-M<strong>in</strong>uten-Takt bis zur Großhesseloher<br />
Brücke durch E<strong>in</strong>satzwagen verstärkt werden.<br />
Andererseits würde bei Fahrzeugmangel<br />
der südliche Streckenteil Großhesseloher<br />
Brücke – Grünwald im Busersatzverkehr betrieben<br />
werden. Erst im Laufe des Jahres<br />
2013 ist mit e<strong>in</strong>er regulären Taktverdichtung<br />
zu rechnen, dann soll <strong>in</strong> den Hauptverkehrszeiten<br />
alle fünf M<strong>in</strong>uten e<strong>in</strong>e Bahn bis<br />
zur Großhesseloher Brücke fahren.<br />
Wenn im Laufe des Jahres 2014 alle acht<br />
AVENIO-Niederflurbahnen zur Verfügung<br />
stehen, s<strong>in</strong>d weitere Angebotsverbesserungen<br />
im Trambereich denkbar. Dann wirft<br />
auch die für 2015 anvisierte Inbetriebnahme<br />
der neuen L<strong>in</strong>ie vom Max-Weber-Platz<br />
über Ste<strong>in</strong>hausen zur S-Bahn-Station Berg<br />
am Laim schon ihre Schatten voraus.<br />
E<strong>in</strong> Jahr ke<strong>in</strong>e Tram nach Pas<strong>in</strong>g<br />
Wegen Straßen- und Streckenbaumaßnahmen<br />
temporär e<strong>in</strong>gestellt wird zum 9. Dezember<br />
2012 das westliche Endstück der L<strong>in</strong>ie<br />
19; die Bahnen wenden dann e<strong>in</strong> Jahr<br />
lang bereits <strong>in</strong> der Schleife am Willibaldplatz.<br />
Wenn die L<strong>in</strong>ie 19 ab Dezember 2013 wieder<br />
nach Pas<strong>in</strong>g fährt, wird sie anstatt der<br />
engen Wendeschleife auf dem dortigen Marienplatz<br />
e<strong>in</strong>e neue Häuserblockumfahrung<br />
mit Haltestelle direkt vor dem Pas<strong>in</strong>ger<br />
Bahnhof vorf<strong>in</strong>den. MICHAEL KRISCHE<br />
AVENIO von <strong>Sie</strong>mens bereits ab Dezember 2013 im L<strong>in</strong>iene<strong>in</strong>satz!<br />
Der Ankündigung von MVG-Chef Herbert König,<br />
ke<strong>in</strong>e Fahrzeuge mehr bei der Firma Stadler<br />
zu bestellen (für weitere Variobahnen gab<br />
es e<strong>in</strong>e Option), folgte am 28. September 2012 der<br />
„Paukenschlag“: Die Stadtwerke München (SWM)<br />
gaben die Bestellung von acht Niederflurbahnen<br />
vom Typ AVENIO für die MVG bei der <strong>Sie</strong>mens AG<br />
bekannt. Dies war das Ergebnis von Gesprächen mit<br />
allen relevanten Herstellern im Rahmen e<strong>in</strong>es Verhandlungs-<br />
und Vergabeverfahrens nach europäischem<br />
Recht. E<strong>in</strong>e Option auf weitere Bahnen be<strong>in</strong>haltet<br />
der Auftrag nicht, die Kurzfristigkeit der<br />
Designstudio<br />
des AVENIO für<br />
München<br />
MVG<br />
Beschaffung ließ dies weder rechtlich noch <strong>in</strong>haltlich<br />
zu. Die Fahrzeuge werden <strong>in</strong> Rekordzeit ausgeliefert:<br />
Sechs der acht Bahnen, die <strong>in</strong> Wien gebaut<br />
werden, sollen bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember<br />
2013 den L<strong>in</strong>iendienst aufnehmen, die beiden<br />
weiteren Fahrzeuge folgen im Jahr 2014. Die Investitionssumme<br />
beträgt rund 29 Mio. Euro. Es<br />
wurden Fördermittel beantragt, ob und <strong>in</strong> welcher<br />
Höhe die Fahrzeugbestellung öffentlich gefördert<br />
wird, ist aber unklar.<br />
Beim AVENIO handelt es sich um e<strong>in</strong> von der Firma<br />
<strong>Sie</strong>mens neu entwickeltes <strong>Straßenbahn</strong>fahrzeug<br />
mit e<strong>in</strong>em Niederfluranteil von 100 Prozent, das bereits<br />
zuvor von den Betrieben <strong>in</strong> Den Haag, Niederlande<br />
(40 Fahrzeuge) und Doha, Katar (19 Fahrzeuge)<br />
bestellt wurde. Se<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>satzpremiere wird der<br />
AVENIO aber nun an der Isar feiern. Im Gegensatz<br />
zur Variobahn ruht beim AVENIO jedes Fahrzeugteil<br />
auf e<strong>in</strong>em eigenen Fahrgestell – e<strong>in</strong>e Konstruktion,<br />
mit der man bei der MVG (Niederflurwagen des<br />
Typs R) bisher gute Erfahrungen gemacht hat. Zudem<br />
beruht das Konstruktionskonzept des AVENIO<br />
auf dem „Comb<strong>in</strong>o Plus“, der bereits seit mehreren<br />
Jahren <strong>in</strong> Budapest und bei der Metro Sul do Tejo<br />
nahe Lissabon zuverlässig im E<strong>in</strong>satz steht.<br />
Die Münchner Variante des AVENIO, der bei der<br />
MVG als Typ T 1 bezeichnet wird, ist 37,85 Meter<br />
lang, 2,3 Meter breit und rund 48 Tonnen schwer.<br />
Das vierteilige E<strong>in</strong>richtungsfahrzeug kann voraussichtlich<br />
215–220 Fahrgäste (die genaue Sitzkonfiguration<br />
steht noch nicht fest) befördern und besitzt<br />
acht Türen (Variobahn und Typ R 3.3 nur sechs), um<br />
e<strong>in</strong>en noch effektiveren Fahrgastwechsel zu gewährleisten.<br />
Die acht AVENIO-Bahnen sollen mit den<br />
ähnlich langen und kapazitätsstarken 20 R 3.3 und<br />
den 14 Variobahnen e<strong>in</strong>en Fahrzeugpool bilden und<br />
vor allem auf den nachfragestärksten L<strong>in</strong>ien 17, 19<br />
und 20/21/22 e<strong>in</strong>gesetzt werden. Es wird aber wie<br />
bei allen Münchner Fahrzeugen die freizügige E<strong>in</strong>satzmöglichkeit<br />
im gesamten Netz angestrebt. Nennenswerte<br />
Umbaumaßnahmen an der Strecken<strong>in</strong>frastruktur<br />
s<strong>in</strong>d laut MVG für den neuen<br />
Fahrzeugtypen nicht notwendig. MIK/MVG<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
19
Betriebe<br />
Fasz<strong>in</strong>ation zwischen<br />
Styrum und Hauptfriedhof<br />
W<strong>in</strong>ke-W<strong>in</strong>ke: Tw<br />
286 verlässt die im<br />
Grünen gelegene<br />
Endschleife Friesenstraße<br />
<strong>in</strong> Styrum<br />
ALLE AUFNAHMEN:<br />
CHRISTIAN LÜCKER<br />
Mülheims L<strong>in</strong>ie 110 im Porträt Von der klassischen Ruhrpott-Industriekulisse über e<strong>in</strong>e kurze<br />
Tunnelfahrt bis zur idyllischen Steigungsstrecke: Die 110 ist e<strong>in</strong>e Reise wert – solange sie noch fährt.<br />
Ger<strong>in</strong>ge Fahrgastzahlen machen der L<strong>in</strong>ie nämlich schwer zu schaffen<br />
Für Freunde der klassischen <strong>Straßenbahn</strong><br />
ist die L<strong>in</strong>ie 110 e<strong>in</strong> Muss: Auf<br />
ihr verkehren ausschließlich hochflurige<br />
M-Wagen, die der Fahrgast nicht<br />
selten direkt von der Straße aus erklimmen<br />
muss. Wer mit der 110 fährt, sieht zudem<br />
viele Facetten von Mülheim: Die Stahlhütte,<br />
die teils engen Innenstadtstraßen und das<br />
eher dörfliche Kahlenbergviertel. Ihren nördlichen<br />
Endpunkt hat die 110 an der Friesenstraße<br />
im Stadtteil Styrum. Hier beg<strong>in</strong>nt<br />
die etwa acht Kilometer lange, 25-m<strong>in</strong>ütige<br />
Fahrt zum Mülheimer Hauptfriedhof.<br />
Die Endschleife liegt etwas abseits der<br />
Straße, e<strong>in</strong>gerahmt von üppigem Grün. Doch<br />
die Idylle trügt: Direkt neben der Schleife<br />
rauscht unüberhörbar der Verkehr auf der<br />
Autobahn A40 vorbei. Bis <strong>in</strong> die 1960er-Jahre<br />
fuhr die <strong>Straßenbahn</strong> noch rund zwei Kilometer<br />
weiter durch weitgehend unbebautes<br />
Gebiet zur Akazienallee <strong>in</strong> Speldorf. Hier<br />
bestand se<strong>in</strong>erzeit Anschluss an die heutige<br />
L<strong>in</strong>ie 901 <strong>in</strong> Richtung Duisburg. E<strong>in</strong> Relikt<br />
aus dieser Zeit bef<strong>in</strong>det sich noch 100 Meter<br />
von der Schleife Friesenstraße entfernt:<br />
Der ehemalige Betriebshof Styrum. Er beherbergt<br />
heute e<strong>in</strong> Autohaus, nur die Gleise<br />
vor den ehemaligen Wagenhallen er<strong>in</strong>nern<br />
noch daran, dass hier früher <strong>Straßenbahn</strong>en<br />
zuhause waren.<br />
Heute verlassen standardmäßig M6-Wagen<br />
die Endschleife, um zunächst an e<strong>in</strong>igen<br />
schmucken Gründerzeitbauten vorbei zu rollen<br />
und nach e<strong>in</strong>em leichten Rechtsschwenk<br />
die Haltestelle Bahnhof Styrum zu erreichen.<br />
Hier trifft die 110 schon auf ihren größten<br />
Konkurrenten: Die S-Bahn! In nur drei M<strong>in</strong>uten<br />
erreichen die L<strong>in</strong>ien S1 und S3 den<br />
Mülheimer Hauptbahnhof, an den sich auch<br />
das Shopp<strong>in</strong>gcenter „Forum“ anschließt. Die<br />
110 braucht bis zur Haltestelle „Stadtmitte“<br />
h<strong>in</strong>gegen neun M<strong>in</strong>uten und fährt mit ihrem<br />
20-M<strong>in</strong>uten-Takt zudem auch noch seltener.<br />
Attraktive E<strong>in</strong>kaufsmöglichkeiten gibt es<br />
rund um die „Stadtmitte“ kaum noch – klar,<br />
wer hier den Kürzeren zieht …<br />
Die Konkurrenz fest im Blick<br />
Die 110 rollt nun weiter zur Haltestelle Meißelstraße,<br />
parallel zur DB-Strecke und zu<br />
zahlreichen Gütergleisen, auf denen nicht sel-<br />
20 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
GRAFIK: AL<br />
Mülheim a.d. Ruhr<br />
An der Friedrich-Ebert-Straße passiert die<br />
110 die Hallen der Friedrich-Wilhelms-Hütte<br />
Daten & Fakten: L<strong>in</strong>ie 110<br />
L<strong>in</strong>ienlänge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 km<br />
Spurweite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 mm<br />
Fahrzeuge<strong>in</strong>satz<br />
• M6S, Bj. 1976, ex BOGESTRA<br />
• M6D, Bj. 1984–1992<br />
Takt der L<strong>in</strong>ie 110<br />
• Mo. bis Fr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 M<strong>in</strong>.<br />
• Sa., So., Feiertage: . . . . . . . . . . . . . . 30 M<strong>in</strong>.<br />
Tarif<br />
VRR-Preisstufe A<br />
E<strong>in</strong>zelticket: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,40 Euro<br />
Tagesticket: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,70 Euro<br />
RECHTS Oberleitungs-Wirrwarr über der DB-<br />
Strecke nahe der Haltestelle „<strong>Sie</strong>gfriedbrücke“<br />
– die 110 gibt sich mit ihrem e<strong>in</strong>fachen<br />
Fahrdraht ganz bescheiden<br />
ten Röhren aus den nahen Mannesmannwerken<br />
auf ihren Abtransport <strong>in</strong> die ganze<br />
Welt warten. Die zweispurige Straße und die<br />
DB-Gleise s<strong>in</strong>d hier nur durch e<strong>in</strong>e sehr marode<br />
Mauer vone<strong>in</strong>ander getrennt, die <strong>Straßenbahn</strong>schienen<br />
liegen fast komplett <strong>in</strong><br />
Pflaster- und Schlackeste<strong>in</strong>en und auf der<br />
rechten Seite reihen sich überwiegend ältere<br />
E<strong>in</strong>familienhäuser. Diese Szenerie versprüht<br />
e<strong>in</strong> sehr ursprüngliches und morbides Flair<br />
und bietet deshalb viele <strong>in</strong>teressante Fotomotive.<br />
E<strong>in</strong>ige Meter weiter fährt die 110 e<strong>in</strong>e kurze<br />
Steigung zur Haltestelle „<strong>Sie</strong>gfriedbrücke“.<br />
Hier lichtet sich die Bebauung wieder,<br />
der Blick auf die Eisenbahntrasse wird durch<br />
e<strong>in</strong>e imposante Baumreihe etwas verdeckt.<br />
Mit e<strong>in</strong>em L<strong>in</strong>ksknick biegt die 110 auf e<strong>in</strong>e<br />
kle<strong>in</strong>e Stahlträgerbrücke, die e<strong>in</strong> Bahnanschlussgleis<br />
überspannt. Diese Brücke wird<br />
selbst von vielen Mülheimern irrtümlich<br />
meist als <strong>Sie</strong>gfriedbrücke bezeichnet. Dabei<br />
ist die <strong>Sie</strong>gfriedbrücke die nebenan gelegene<br />
Fußgängerbrücke über die DB-Strecke.<br />
Weiter geht’s zur Thyssenbrücke, hier trifft<br />
die 110 auf die aus Oberhausen kommende<br />
L<strong>in</strong>ie 112, die sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em engen 90-Grad-<br />
Bogen von der Brücke auf die geme<strong>in</strong>same<br />
Strecke Richtung Innenstadt e<strong>in</strong>fädelt. Fotografen<br />
sei die Thyssenbrücke als Motiv<br />
empfohlen, da die baufällige Brücke aus dem<br />
Jahr 1909 <strong>in</strong> den kommenden Jahren ersetzt<br />
werden muss.<br />
H<strong>in</strong>ter der Thyssenbrücke eröffnet sich<br />
kurz e<strong>in</strong> Blick auf die Mülheimer City mit<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
21
Betriebe<br />
Auf der 110 verkehren <strong>in</strong> der Regel ausschließlich M6. Wagen 296 wurde 2011 im Alter von immerh<strong>in</strong> 35 Jahren zusammen mit drei weiteren<br />
M6S aus Bochum übernommen. Hier überquert er rauschend die Brücke an der Hauskampstraße<br />
In der Mitte geht’s eher drunter als drüber: Wagen 286 taucht aus dem<br />
Tunnel an der Friedrich-Ebert-Straße auf und erreicht den Rathausmarkt<br />
Gerade der Ast zum Hauptfriedhof bee<strong>in</strong>druckt immer wieder durch<br />
schmucke Häuserreihen, wie hier an der Trooststraße<br />
ihren markanten Hochhäusern, ehe die 110<br />
über die stark befahrene Friedrich-Ebert-<br />
Straße den nächsten Halt Mülheim West S-<br />
Bahnhof ansteuert. Von Wohnbebauung ist<br />
hier weit und breit nichts zu sehen. Die alten<br />
Backste<strong>in</strong>hallen von Thyssen-Krupp<br />
Schulte bestimmten das Bild. Noch heute<br />
wird hier Baustahl verkauft – allerd<strong>in</strong>gs wird<br />
den kaum jemand mit der <strong>Straßenbahn</strong> abholen.<br />
Lediglich e<strong>in</strong>e Videothek, e<strong>in</strong> Cas<strong>in</strong>o<br />
und e<strong>in</strong>ige kle<strong>in</strong>ere Handwerksbetriebe bergen<br />
hier Fahrgastpotenzial.<br />
Als die Thyssenwerke noch massenweise<br />
Dampf und Rauch <strong>in</strong> den Mülheimer Himmel<br />
bliesen, war hier deutlich mehr los. Früher<br />
war der Bahnhof Mülheim West nämlich<br />
der Mülheimer Hauptbahnhof, so dass<br />
hunderte Arbeiter das Werksgelände bequem<br />
mit Zug und <strong>Straßenbahn</strong> erreichen konnten.<br />
Erst 1974 wurde der stadtnahe Bahnhof<br />
Mülheim-Epp<strong>in</strong>ghofen mit Ausbau der S-<br />
Bahn Rhe<strong>in</strong>-Ruhr zum heutigen Hauptbahnhof<br />
umfunktioniert. Seither rollt die<br />
110 nicht selten ohne Halt weiter Richtung<br />
Innenstadt.<br />
H<strong>in</strong>ter dem Bahnhof Mülheim West geht<br />
es für die 110 erstmals <strong>in</strong>mitten der vierspurigen<br />
Straße auf eigenem Gleiskörper<br />
weiter. Unweit der Haltestelle Sandstraße<br />
f<strong>in</strong>det sich e<strong>in</strong> weiteres Relikt aus längst vergangenen<br />
Tagen: Der ehemalige Betriebshof<br />
Friedrich-Ebert-Straße. Die Wagenhalle<br />
dient heute als Autowerkstatt. Rechts der<br />
Strecke erheben sich die mächtigen Werks -<br />
hallen der Friedrich-Wilhelms-Stahlhütte,<br />
die die M6 auf der 110 ganz schön mickrig<br />
aussehen lassen.<br />
Ab durch die Mitte<br />
An der nächsten Haltestelle „Friedrich-<br />
Ebert-Straße“ bekommt die 110 Gesellschaft<br />
von der L<strong>in</strong>ie 104 aus Essen. Der Haltstellenbereich<br />
hat sich <strong>in</strong> den vergangenen Jahren<br />
stark verändert: Früher bestimmten hier<br />
Überflieger-Brücken das Bild. Mittlerweile<br />
s<strong>in</strong>d sämtliche Brücken abgetragen worden<br />
und der Verkehr teilt sich die Kreuzung mit<br />
der <strong>Straßenbahn</strong>. Dennoch wird die Tram<br />
auf den nächsten Metern zur „M<strong>in</strong>i-U-<br />
Bahn“. In e<strong>in</strong>em kurzen Tunnel unterfahren<br />
die <strong>Straßenbahn</strong>en e<strong>in</strong>e Hauptstraße, um auf<br />
22 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Mülheim a.d. Ruhr<br />
Auf geht’s – zum<strong>in</strong>dest für Wagen 292. Bei sieben Prozent Gefälle rollt der M6S 296 <strong>in</strong> Höhe<br />
des Bismarckturms dagegen mühelos <strong>in</strong> Richtung Innenstadt<br />
der anderen Seite an der Haltestelle Rathausmarkt<br />
wieder aufzutauchen.<br />
Nun heißt es: Ducken und Stromabnehmer<br />
e<strong>in</strong>ziehen! Die 110 zwängt sich durch<br />
e<strong>in</strong>en engen Brückenbogen, über den bis <strong>in</strong><br />
die 1990er-Jahre e<strong>in</strong> Teil der Bahnstrecke<br />
Osterrath – Dortmund führte. Über e<strong>in</strong>e<br />
Million Ziegelste<strong>in</strong>e sollen für den Bau des<br />
Viadukts durch die Mülheimer Innenstadt<br />
verbaut worden se<strong>in</strong>. H<strong>in</strong>ter der Brücke wird<br />
die 110 wieder zur klassischen <strong>Straßenbahn</strong><br />
und durchfährt den Rathausbogen, ehe sie<br />
an der Haltestelle „Stadtmitte“ hält. Die<br />
Bahnsteiganlagen s<strong>in</strong>d hier relativ neu. Bis<br />
zum Jahr 2007 mussten die Bahnen noch das<br />
mittlerweile leer stehende Kaufhof-Gebäude<br />
umfahren. Selbst „Woolworth“ hat sich<br />
aus der Mülheimer City verabschiedet. So<br />
br<strong>in</strong>gt es nicht mehr allzu viel, dass die 110<br />
heutzutage direkt vor der Fußgängerzone<br />
„Schlossstraße“ hält.<br />
Umstieg zu den Bussen<br />
Immerh<strong>in</strong> ist die Stadtmitte nach wie vor e<strong>in</strong><br />
wichtiger Umsteigeknoten: Die meisten<br />
Mülheimer Busl<strong>in</strong>ien halten hier, außerdem<br />
verkehren „e<strong>in</strong>e Etage tiefer“ im Stadtbahntunnel<br />
die 102 Richtung Uhlenhorst<br />
und Oberdümpten und die normalspurige<br />
901 nach Duisburg.<br />
H<strong>in</strong>ter der Haltestelle verzweigen sich die<br />
Gleise. Die L<strong>in</strong>ien 104 und 112 biegen nach<br />
l<strong>in</strong>ks <strong>in</strong> die Le<strong>in</strong>ewebestraße e<strong>in</strong>, rechts gelangen<br />
die Bahnen über die Schlossbrücke<br />
zum Betriebshof, die 110 fährt dagegen weiter<br />
geradeaus. Auf halber Strecke zum nächsten<br />
Halt existiert e<strong>in</strong> Gleiswechsel, <strong>in</strong>teressanterweise<br />
die letzte Umsetzmöglichkeit vor<br />
der Endstelle Hauptfriedhof – und die ist immerh<strong>in</strong><br />
noch rund vier Kilometer entfernt.<br />
Vorbei am altehrwürdigen Hotel „Handelshof“<br />
kommt die Bahn nun <strong>in</strong> Straßenmitte<br />
vor dem evangelischen Krankenhaus zum<br />
stehen – die Haltestelle „Wertgasse“ ist erreicht.<br />
Von hier aus kommt man <strong>in</strong> wenigen<br />
M<strong>in</strong>uten <strong>in</strong> die Mülheimer Altstadt mit<br />
ihren kle<strong>in</strong>en Fachwerkhäusern und der Petrikirche,<br />
deren Wurzeln bis <strong>in</strong>s 7. Jahrhundert<br />
zurückgehen. Aber auch entlang der 110<br />
wird die Bebauung sehr sehenswert: Rund<br />
um die Haltstelle Wilhelmstraße stehen e<strong>in</strong>ige<br />
prunkvolle Jugendstil-Villen, reichverzierte<br />
Wohnhäuser warten nur darauf, als<br />
Motiv „erlegt“ zu werden.<br />
Der Ausstieg an der Wilhelmstraße lohnt<br />
sich doppelt. Ganz <strong>in</strong> der Nähe bef<strong>in</strong>det sich<br />
nämlich der Mülheimer Wasserbahnhof.<br />
Von dort aus starten die Ausflugsschiffe der<br />
„Weißen Flotte“ <strong>in</strong> Richtung Essen-Kettwig<br />
durch das romantische Ruhrtal.<br />
Gemütlich <strong>in</strong>s Kahlenbergviertel<br />
Die L<strong>in</strong>ie 110 verlässt h<strong>in</strong>gegen die Straße<br />
nach Essen und biegt durch den engsten<br />
Gleisbogen im Mülheimer Netz l<strong>in</strong>ks <strong>in</strong> die<br />
schmale Wilhelmstraße e<strong>in</strong>. Hier beg<strong>in</strong>nt<br />
e<strong>in</strong>e etwa 100 Meter lange Steigung, ehe die<br />
Bahn am Wilhelmplatz scharf rechts <strong>in</strong> die<br />
Kampstraße rollt. Autos fahren hier vergleichsweise<br />
wenige. Die Haltestellen auf diesem<br />
Abschnitt s<strong>in</strong>d äußerst spartanisch e<strong>in</strong>gerichtet:<br />
Richtung Hauptfriedhof muss sich<br />
der Fahrgast mit e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>fachen Haltestellenschild<br />
am Fahrbahnrand zufrieden geben,<br />
An der Haltestelle „Spielplatz“ erreicht man<br />
den wohl besten Aussichtspunkt Mülheims:<br />
den Bismarckturm<br />
<strong>in</strong> Richtung Innenstadt steht zum<strong>in</strong>dest hier<br />
und da e<strong>in</strong> Wartehäuschen. Bis zur Haltestelle<br />
„Wasserstraße“ ist die Bebauung noch<br />
sehr dicht, hier prägen schmucke Bauten –<br />
meist aus der Gründerzeit – das Bild.<br />
Ab der Wasserstraße geht es merklich<br />
bergauf, mit etwas Glück kann man rechts<br />
durch die Baumreihen e<strong>in</strong>en Blick auf das<br />
Ruhrtal erhaschen. Jetzt heißt es: Anlauf nehmen!<br />
Mit immerh<strong>in</strong> sieben Prozent Steigung<br />
erklimmt die 110 die Bismarckstraße.<br />
Nach e<strong>in</strong>em engen L<strong>in</strong>ksbogen erstrecken<br />
sich auf der rechten Seite weite Wiesen mitsamt<br />
dem stolzen Bismarckturm von 1909.<br />
Heute bietet er e<strong>in</strong>em Künstler Unterschlupf<br />
und kann zu wechselnden Zeiten bestiegen<br />
werden. Den Blick über die Stadt und das<br />
Ruhrtal ist die Kletterei allemal wert.<br />
Dann ist die Steigung geschafft – die 110<br />
hat den Kahlenberg erreicht. Inmitten e<strong>in</strong>er<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
23
Betriebe<br />
OBEN Besonders im<br />
Kahlenbergviertel<br />
ist die 110 nicht immer<br />
gut genug gefüllt.<br />
An e<strong>in</strong>em nassen<br />
Nachmittag im<br />
Dezember 2011<br />
waren dennoch e<strong>in</strong>ige<br />
Fahrgäste froh,<br />
dass ihnen Wagen<br />
291 E<strong>in</strong>lass gewährte<br />
(Bild l<strong>in</strong>ks). Auch<br />
die <strong>in</strong>neren Werte<br />
zählen: Bunt und<br />
gemütlich kommen<br />
die Mülheimer M6<br />
daher (Bild rechts)<br />
stattlichen Allee gönnen sich die M6 e<strong>in</strong>e<br />
kurze Verschnaufpause an der Haltestelle<br />
„Spielplatz“. E<strong>in</strong>en Spielplatz f<strong>in</strong>det man<br />
hier allerd<strong>in</strong>gs weit und breit nicht. Nur e<strong>in</strong>en<br />
Sportplatz, auf dem meist unermüdliche<br />
Jogger ihre schnöden Runden drehen, statt<br />
die herrlichen Wege im angrenzenden Kahlenbergwald<br />
mit Blick auf das Ruhrtal zu genießen.<br />
Mit Blick auf Wald und Wiesen geht es<br />
weiter zur Haltestelle Wasserstraße. Auch<br />
dieser Bereich ist eher dünn besiedelt. Die<br />
meisten Häuser sehen so aus, als hätten ihre<br />
Eigentümer gleich mehrere Fahrzeuge zur<br />
Auswahl <strong>in</strong> der Garage stehen.<br />
Endspurt zum Hauptfriedhof<br />
Die L<strong>in</strong>ie 110 folgt der Allee, ehe sie sich auf<br />
e<strong>in</strong>e große Hauptstraße e<strong>in</strong>fädelt und sich<br />
nach 100 Metern rechts wieder ausfädelt,<br />
um an der Witthausstraße zu halten. Neben<br />
der zweispurigen Bundesstraße geht es auf<br />
eigenem Bahnkörper weiter zum Oppspr<strong>in</strong>g.<br />
Hier biegen die Bahnen rechts <strong>in</strong> die Zeppel<strong>in</strong>straße<br />
e<strong>in</strong> und treffen damit wieder auf<br />
Gastronomie-Tipps<br />
• Pizzeria Carmelo – e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fach gehaltene<br />
Pizzeria <strong>in</strong> der Altstadt mit exzellenter Pizza<br />
und Pasta, Hagdorn 14, Haltestelle Wertgasse<br />
• Eiscafé Plati – frische Torten und köstliches Eis<br />
neben dem Wasserbahnhof, Auf dem Dudel<br />
24, Haltestelle Wilhelmstraße<br />
LINKS Die Endstelle<br />
Hauptfriedhof teilt<br />
sich die 110 zusammen<br />
mit der 104,<br />
auf der e<strong>in</strong>ige Leihwagen<br />
aus Essen im<br />
E<strong>in</strong>satz s<strong>in</strong>d<br />
die L<strong>in</strong>ie 104. Bis zur Tilsiterstraße geht es<br />
zügig durch die Häuserreihen. Den letzten<br />
Abschnitt bis zur Endstelle Hauptfriedhof<br />
bewältigt die 110 dann wieder auf eigenem<br />
Bahnkörper. Vor dem Torbogen am Hauptfriedhof<br />
endet unsere Reise.<br />
Früher g<strong>in</strong>g es hier noch auf e<strong>in</strong>em zwei<br />
Kilometer langen Überlandabschnitt weiter<br />
bis zum Gleisdreieck am Sportflughafen<br />
Mülheim <strong>in</strong> Raadt. Diesen Ast hat vor e<strong>in</strong>igen<br />
Jahren die L<strong>in</strong>ie 104 übernommen, um<br />
e<strong>in</strong>e schnellere Verb<strong>in</strong>dung von der Stadt<br />
nach Raadt herzustellen. Seit diesem Jahr ist<br />
der <strong>Straßenbahn</strong>verkehr zwischen Hauptfriedhof<br />
und Flughafen aber e<strong>in</strong>gestellt, weil<br />
die Strecke als nicht mehr betriebssicher gilt<br />
und dr<strong>in</strong>gend saniert werden muss. Dieses<br />
Geld will sich die Stadt wegen der ger<strong>in</strong>gen<br />
Auslastung der Strecke sparen und hat deshalb<br />
e<strong>in</strong>en dauerhaften Schienenersatzverkehr<br />
e<strong>in</strong>gerichtet. Wenn es nach der Stadt<br />
geht, soll es der 110 sogar auf ganzer Länge<br />
an den Kragen gehen. Der S-Bahn-Parallelverkehr<br />
<strong>in</strong> Styrum, die ger<strong>in</strong>ge Bevölkerungsdichte<br />
im Kahlenbergviertel, mit diesen<br />
Problemen hat die 110 zu kämpfen.<br />
Insgesamt s<strong>in</strong>d die kle<strong>in</strong>en M6 besonders <strong>in</strong><br />
den Randzeiten selbst werktags im 20-M<strong>in</strong>uten-Takt<br />
nicht ausreichend gefüllt. Die Bezirksregierung<br />
möchte aber, dass die 110 als<br />
umweltfreundliches Verkehrsmittel erhalten<br />
bleibt und droht der Stadt mit Rückzahlungen<br />
von Fördergeldern <strong>in</strong> Millionenhöhe, die<br />
<strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der Stadtmitte <strong>in</strong> die Sanierung<br />
der 110 gesteckt wurden. Noch besteht<br />
also Hoffnung, dass diese äußerst abwechslungsreiche,<br />
spannende und reizvolle L<strong>in</strong>ie<br />
auch weiterh<strong>in</strong> bestehen bleibt.<br />
CHRISTIAN LÜCKER<br />
24 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Nächster Halt: …<br />
Im Juli 2012 wurde die Wiener E<strong>in</strong>stiegshaltestelle, die der Tw 716 gerade verlässt, saniert und um 200 Meter verlegt<br />
A. ROGALLA<br />
Nächster Halt:<br />
Beethovengang<br />
Diesen Namen trägt e<strong>in</strong> im 19. Bezirk Wiens<br />
gelegener Flanierweg, den Ludwig van Beethoven<br />
leidenschaftlich benutzt haben soll. Auf<br />
ihn e<strong>in</strong>stimmen kann sich der heutzutage mit<br />
MP3-Player ausgerüstete Wanderer mit der<br />
Symphonie Nr. 6 – der Pastorale. Diese passt<br />
hervorragend zu dem Weg, der von schattenspendender<br />
Flora umsäumt ist und so die eher<br />
zurückgezogene Wohnumfeldarchitektur verdeckt<br />
– durchweg Häuser der gehobenen Wiener<br />
Bevölkerung. In der Nähe begegnen dem<br />
Wanderer Straßennamen, die von Beethovens<br />
Anwesenheit <strong>in</strong> Heiligenstadt und Nußdorf<br />
Zeugnis ablegen. Die Eroicagasse kreuzt den<br />
Beethovengang und teilt ihn <strong>in</strong> zwei Hälften.<br />
Schließlich folgt am Ende des Ganges die Beethovenruhe<br />
mit dem Beethovendenkmal, das<br />
am 15. Juni 1863 enthüllt wurde.<br />
Die Endhaltestelle Beethovengang ist als<br />
Wendeschleife mit Ausweiche angelegt und<br />
umfasst das ehemalige Empfangsgebäude der<br />
vor knapp 90 Jahren e<strong>in</strong>gestellten Zahnradbahn<br />
zum Kahlenberg. Das Restaurant <strong>in</strong> der<br />
e<strong>in</strong>stigen Talstation ist <strong>in</strong>zwischen ebenfalls<br />
geschlossen. Die nach dem System Riggenbach<br />
errichtete Zahnradbahn sollte 1873 als Attraktion<br />
zur Weltausstellung e<strong>in</strong>geweiht werden,<br />
g<strong>in</strong>g jedoch erst e<strong>in</strong> Jahr später <strong>in</strong> Betrieb.<br />
Infolge zweigleisigen Ausbaus und die frühe<br />
Anb<strong>in</strong>dung an die Wiener <strong>Straßenbahn</strong> bis<br />
zum Schottentor war sie damals wie heute für<br />
die Region e<strong>in</strong> unentbehrliches Verkehrsmittel,<br />
denn sie war der Vorläufer der L<strong>in</strong>ie D, die<br />
den Beethovengang gegenwärtig bedient.<br />
Für die Zahnradbahn waren der Weltkrieg,<br />
der verschlissene Schienenweg sowie der Konzessionsablauf<br />
der „Todesstoß“. <strong>Sie</strong> wurde am<br />
16. Mai 1923 e<strong>in</strong>gestellt. Wer sich heute motorisiert<br />
auf den Kahlenberg br<strong>in</strong>gen lassen<br />
will, nimmt ab Gr<strong>in</strong>z<strong>in</strong>ger Straße den Bus 38A<br />
und erreicht 22 M<strong>in</strong>uten später den Berg, der<br />
e<strong>in</strong>en herrlichen Blick auf Wien erlaubt.<br />
Zurzeit werden auf der L<strong>in</strong>ie D im Mischbetrieb<br />
E2/c3 Garnituren und ULF e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Letztere können sich nicht mit den im Innern<br />
holzverkleideten c3-Beiwagen messen, was<br />
aber durchaus e<strong>in</strong>e Geschmacksfrage ist. Die<br />
alten nach Holz duftenden c3 haben für uns<br />
heutzutage e<strong>in</strong> Flair, dass man me<strong>in</strong>en könnte,<br />
selbst Beethoven, der alte Meister, hätte sich<br />
diesen zuverlässigen Gefährten anvertraut;<br />
und immer e<strong>in</strong>e Mozartkugel zum Naschen<br />
dabei, während die Bim mit hoher Geschw<strong>in</strong>digkeit<br />
<strong>in</strong> Richtung Beethovengang brettert,<br />
was zuweilen e<strong>in</strong>en Haydnlärm produziert.<br />
ANDRÉ ROGALLA<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
25
Betriebe<br />
Unterwegs mit »Tante Frieda«<br />
100 Jahre Forchbahn Zürich<br />
– Essl<strong>in</strong>gen <strong>Straßenbahn</strong>,<br />
Überlandbahn, U-Bahn – oder<br />
alles zusammen? Die Forchbahn<br />
bietet <strong>in</strong> der Tat von allem<br />
etwas. Dieses Jahr feiert sie ihr<br />
100-jähriges Bestehen<br />
Ursprünglich gebaut, um Milch vom<br />
Land <strong>in</strong> die Stadt zu transportieren,<br />
hat sich das Gesicht von „Tante<br />
Frieda“, wie die Forchbahn im<br />
Volksmund heißt, <strong>in</strong>zwischen drastisch verändert.<br />
Der Güterverkehr wurde bereits Mitte<br />
der 1960er-Jahre e<strong>in</strong>gestellt, dafür wuchsen<br />
die Anforderungen an anderen Stellen:<br />
E<strong>in</strong>erseits wächst der Pendlerverkehr nach<br />
Zürich kont<strong>in</strong>uierlich bis heute an, andererseits<br />
hat der Ausflugsverkehr <strong>in</strong> die „Pfannenstiel“-Region<br />
massiv zugenommen, so<br />
dass die Forchbahn heute <strong>in</strong> beiden Richtungen<br />
als „vollbeschäftigt“ e<strong>in</strong>gestuft werden<br />
darf.<br />
Seit dem 27. November 1912 fährt die<br />
Forchbahn von Zürich-Stadelhofen nach<br />
Essl<strong>in</strong>gen im Kanton Zürich, feiert also <strong>in</strong><br />
diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Mit<br />
ihrer Eröffnung löste die Bahn, ungewöhnlich<br />
genug für die damalige Zeit, e<strong>in</strong>e Busl<strong>in</strong>ie<br />
ab. Ihren Namen trägt die Bahn nach<br />
dem gleichnamigen Ort, dem Betriebsmittelpunkt<br />
Forch, und dem gleichnamigen<br />
Pass, den sie auf ihrem Weg überquert.<br />
Zur Stilllegung vorgesehen<br />
In den 1950er-Jahren stand sie – wie so viele<br />
Bahnen ihrer Art – zur Disposition, Untersuchungen<br />
ergaben aber, dass sie durch<br />
Busse nicht zu ersetzen war. Die Empfehlungen,<br />
die Bahn von der Straße zu trennen,<br />
wurden folgerichtig umgesetzt, so dass der<br />
Betrieb schneller und mit weniger Kontakt<br />
zum Straßenverkehr abgewickelt werden<br />
konnte. Der Milchtransport endete 1965.<br />
26 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Schweiz: Forchbahn<br />
Im Jubiläumsjahr<br />
tragen die Fahrzeuge<br />
der Forchbahn<br />
dieses Logo<br />
Streckenplan<br />
der Forchbahn<br />
GRAFIK: M. SPERL<br />
Auf der Rückfahrt von Essl<strong>in</strong>gen nach Zürich<br />
passiert e<strong>in</strong> von Stadler gebauter Be 4/6 am<br />
4. September 2012 die Ortschaft Neuhaus<br />
ALLE AUFNAHMEN: J. SCHRAMM<br />
Zwischen Waltikon und Neue Forch passieren die Züge e<strong>in</strong>en etwa 1.800 m langen Tunnel, an<br />
dessen nördlicher E<strong>in</strong>fahrt Jörn Schramm diese Begegnung im Bild festhielt<br />
Als bedeutendste Baumaßnahme wurde die<br />
Strecke im Bereich von Zumikon <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en<br />
Tunnel verlegt.<br />
Die Strecke<br />
Endpunkt auf Zürcher Gebiet ist der Bahnhof<br />
Stadelhofen. Hier wurde <strong>in</strong> den vergangenen<br />
Jahren e<strong>in</strong>e eigene Gleisschleife parallel<br />
zu den Tramgleisen gebaut, so dass die<br />
Züge der Forchbahn unabhängig enden und<br />
starten können. Bis zur Station Rehalp, Endpunkt<br />
der Traml<strong>in</strong>ie 11, benutzen die Züge<br />
der Forchbahn auf gut 3 km die Gleise der<br />
Zürcher Tram mit, sie halten allerd<strong>in</strong>gs nicht<br />
Der modern gestaltete Endbahnhof von Essl<strong>in</strong>gen<br />
(e<strong>in</strong>em Ortsteil von Egg im Kanton Zürich)<br />
ist dreigleisig ausgeführt<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
27
Betriebe<br />
Der auf 605 m Seehöhe gelegene Bahnhof Neuhaus am Streckenkilometer 9 dient für Zugkreuzungen<br />
Im namensgebenden Ort Forch bef<strong>in</strong>det sich<br />
das Depot der Bahn, die nur von Essl<strong>in</strong>gen bis<br />
Zürich-Rehalp eigene Gleise befährt<br />
Daten & Fakten: Forchbahn<br />
Spurweite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 mm<br />
eröffnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.11.1912<br />
Länge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,06 km<br />
Stromsystem. . . . . . . . . . . . 1.200 V Gleichstrom<br />
max. Steigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Promille<br />
Stationen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />
Fahrplanfeld: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731<br />
an allen Stationen. Bis Rehalp verkehren sie<br />
auch mit der städtischen Fahrspannung von<br />
600 V. Bereits im Stadtbereich von Zürich<br />
geht es stark bergauf, was sich auch auf eigener<br />
Trasse, jetzt unter 1200 V, fortsetzt. Bis<br />
Waltikon folgt die Strecke der Forchstraße.<br />
Unmittelbar nach dieser Haltestelle taucht sie<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en 1.758 m langen Tunnel e<strong>in</strong>, <strong>in</strong> dem<br />
sich die Stationen Zumikon und Maiacher bef<strong>in</strong>den.<br />
Nächste Haltestelle nach dem Tunnel<br />
ist der Bedarfshalt Neue Forch. Ab hier ist die<br />
Strecke e<strong>in</strong>gleisig, und kurz darauf wird der<br />
Betriebsmittelpunkt Forch erreicht, mit 675<br />
m auch der höchste Punkt der Strecke. Seit<br />
1970 unterhält die Forchbahn hier e<strong>in</strong>e großzügige,<br />
modern ausgestattete Depot-Anlage.<br />
Vier Gleise mit <strong>in</strong>sgesamt drei Bahnsteigkanten<br />
erlauben e<strong>in</strong>en flexiblen Betrieb sowie<br />
das Kreuzen, Stärken und Schwächen<br />
von Zügen nach der Verkehrslage.<br />
E<strong>in</strong>gleisig auch durch Tunnel<br />
H<strong>in</strong>ter Forch geht es e<strong>in</strong>gleisig weiter, wobei<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em fast 300 m langen Tunnel zunächst<br />
die Autobahn 52 unterquert wird. Die folgende<br />
Station, Scheuren, liegt bereits wieder<br />
deutlich tiefer, und <strong>in</strong> der Folge geht es ständig<br />
bergab. Bis Forch war die Strecke auf beiden<br />
Seiten von nahezu durchgehender Bebauung<br />
begleitet. Jetzt ändert sich das Bild.<br />
An der Station Neuhaus wirkt die Umgebung<br />
bereits sehr ländlich: Viel Grün, im H<strong>in</strong>tergrund<br />
e<strong>in</strong>e Bergkette, auf der parallelen Straße<br />
mäßiger Verkehr. Damit haben wir auch<br />
bereits die Geme<strong>in</strong>de Egg erreicht, durch die<br />
wir ab jetzt fahren: Dazu gehören die Teilorte<br />
(mit jeweils e<strong>in</strong>er Station) H<strong>in</strong>teregg,<br />
Egg, Langwies, Emmat und unser Endbahnhof<br />
Essl<strong>in</strong>gen. Bis zur Endstation folgt<br />
die Strecke der Forchstraße an deren nördlichem<br />
bzw. östlichem Rand. In Essl<strong>in</strong>gen<br />
endet die Strecke <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er modernen, dreigleisigen<br />
Bahnhofshalle. Hier besteht Busanschluss<br />
nach Uster und Oetwil am See.<br />
Die Strecke ist durchgehend signalisiert<br />
und mit e<strong>in</strong>em Zugsicherungssystem ausge-<br />
28 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Schweiz: Forchbahn<br />
Im Stadtgebiet von Zürich begegnen die Wagen der Forchbahn den städtischen Trams, so auch am 4. September dieses Jahres <strong>in</strong> Stadelhofen<br />
Bt 203 der Forchbahn ist als Café bewirtschaftet<br />
– e<strong>in</strong> Service, der von den Fahrgästen<br />
gern angenommen wird<br />
rüstet. Im e<strong>in</strong>gleisigen Streckenabschnitt verfügen<br />
alle Stationen außer Langwies über e<strong>in</strong><br />
Ausweichgleis. Im unteren, zweigleisigen Abschnitt<br />
ermöglichen mehrere Gleiswechsel<br />
e<strong>in</strong> flexibles Reagieren auf Betriebsstörungen<br />
oder Baustellen; beide Gleise besitzen<br />
hier Signale für beide Richtungen.<br />
Fahrzeuge und Betrieb<br />
Die Forchbahn betreibt nur noch zwei verschiedene<br />
Fahrzeugtypen: Ab 1976 wurden<br />
von Sch<strong>in</strong>dler/SIG sechs neue Doppeltriebwagen<br />
beschafft, die auf dem Typ „Tram<br />
2000“ der Verkehrsbetriebe Zürich basieren.<br />
Im Gegensatz zu diesen bestehen die Züge der<br />
Forchbahn aus zwei kurzgekuppelten vierachsigen<br />
Wagen ohne Übergangsmöglichkeit.<br />
Diese Wagen tragen die Typenbezeichnung<br />
Be 8/8 und die Nummern 21/22 bis 31/32.<br />
Ergänzend dazu wurden vier passende<br />
vierachsige Steuerwagen geliefert, die Bt 201<br />
bis 204.<br />
1994 wurden acht weitere Triebwagen geliefert,<br />
jetzt aber als vierachsige E<strong>in</strong>zeltriebwagen,<br />
die untere<strong>in</strong>ander und mit den anderen<br />
Fahrzeugen nach Bedarf komb<strong>in</strong>iert<br />
werden können. Diese Wagen tragen die Bezeichnung<br />
Be 4/4 und die Nummern 51-58.<br />
In den Jahren 2004 und 2005 lieferte Stadler<br />
Rail 13 neue Niederflurfahrzeuge, mit denen<br />
die letzten älteren Wagen im Bestand abgelöst<br />
wurden. Bei den neuen Wagen handelt<br />
es sich um Be 4/6 – Halbzüge, welche die<br />
Nummern 61 bis 73 tragen.<br />
Zwischen Stadelhofen und Forch wird<br />
tagsüber e<strong>in</strong> Viertelstundentakt gefahren. Jeder<br />
zweite Zug fährt weiter nach Essl<strong>in</strong>gen.<br />
In der Hauptverkehrszeit verkehren zusätzliche<br />
Eilkurse, die zwischen Rehalp und<br />
Forch nicht halten.<br />
Jubiläum und Zukunftspläne<br />
Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der<br />
Bahn feiert man auf ganz besondere Weise:<br />
Neben e<strong>in</strong>em Volksfest am 2. September<br />
fährt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em morgendlichen Umlauf der<br />
„Gipfelstürmer“ mit. Hierbei handelt es sich<br />
um den zu e<strong>in</strong>em Bistro umgerüsteten Steuerwagen<br />
Bt 203, <strong>in</strong> dem morgens Kaffee und<br />
Gipfeli (schweizerisch für Croissant) angeboten<br />
werden. Der Erlös kommt sozialen<br />
Projekten zu Gute.<br />
Immer wieder diskutiert wurde e<strong>in</strong>e Verlängerung<br />
der Forchbahn durch die Zürcher<br />
Innenstadt bis zum Hauptbahnhof. Bisher<br />
wurden die Pläne nicht verworfen – von e<strong>in</strong>er<br />
nahen Realisierung ist aber auch nichts<br />
zu hören.<br />
JÖRN SCHRAMM<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
29
Betriebe<br />
L<strong>in</strong>ie G bald über die Traun?<br />
Vorbereitung für Verb<strong>in</strong>dung der Gmundener <strong>Straßenbahn</strong> mit Lokalbahn Vor 100 Jahren<br />
wurde <strong>in</strong> Oberösterreich die meterspurige Traunseebahn Gmunden – Vorchdorf eröffnet. In den nächsten<br />
Jahren soll sie nun endlich mit der <strong>Straßenbahn</strong> Gmunden verbunden werden<br />
LINKS Der Lohner-Wagen 8 im August 2012 am<br />
Franz-Josef-Platz, seit der Stilllegung des Abschnitts<br />
zum Rathausplatz die Endstelle der<br />
Gmundener <strong>Straßenbahn</strong><br />
Bereits <strong>in</strong> der Bronzezeit gab es e<strong>in</strong>en<br />
lebhaften Salzhandel zwischen dem<br />
Salzkammergut und dem heutigen<br />
Böhmen um die Stadt Budweis. Um<br />
den Warenverkehr zu erleichtern, wurde zwischen<br />
1827 und 1835 die Pferdeeisenbahn<br />
L<strong>in</strong>z – Budweis eröffnet, die bis 1836 nach<br />
Gmunden verlängert wurde. <strong>Sie</strong> diente<br />
hauptsächlich dem Transport von Salz und<br />
wurde zwischen L<strong>in</strong>z und Gmunden bis<br />
1856 auf den Betrieb mit Dampflokomo -<br />
tiven umgestellt. Fand ab 1884 e<strong>in</strong> Rollbockbetrieb<br />
statt, so wurde diese Strecke bis<br />
1903 auf Normalspur umgebaut, wobei der<br />
Abschnitt von Engelhof bis Gmunden Seebahnhof<br />
danach bis 2009 mit Dreischienengleis<br />
ausgerüstet war, um e<strong>in</strong>en Mischbetrieb<br />
mit der meterspurigen Lokalbahn<br />
Gmunden – Vorchdorf zu ermöglichen.<br />
Die Wahl der Spurweite von e<strong>in</strong>em Meter<br />
für die 15 km lange Lokalbahn erfolgte aus<br />
dem Wunsch seitens Stern & Hafferl, <strong>in</strong><br />
Gmunden auf die bereits bestehende <strong>Straßenbahn</strong><br />
überwechseln zu können – sozusagen<br />
das Urmodell für alle derartigen Betriebsabläufe<br />
der heutigen Zeit! Doch<br />
obwohl die Lokalbahn schon 1912 ihren Betrieb<br />
aufnahm, lässt die Realisierung dieser<br />
Idee noch bis heute auf sich warten.<br />
Blick <strong>in</strong> die Geschichte<br />
Kurstadt am Traunsee – das war den Stadtvätern<br />
<strong>in</strong> Zeiten der k.u.k.-Monarchie e<strong>in</strong>e<br />
Verpflichtung. So sorgte man dafür, dass man<br />
beim Bau der Salzkammergutbahn von Attnang-Puchheim<br />
über Bad Ischl nach Sta<strong>in</strong>ach-<br />
Irdn<strong>in</strong>g zwar mit e<strong>in</strong>em Bahnhof berücksichtig<br />
wurde, dieser aber andererseits weit<br />
genug von der Stadt entfernt angelegt wurde,<br />
um die „hohen Gäste“ nicht mit Rauch und<br />
Lärm zu belästigen. Schließlich erhielt die<br />
Stadt ihren Anschluss an die <strong>in</strong> den Jahren<br />
1875 bis 1877 erbaute e<strong>in</strong>gleisige Normalspurbahn<br />
der k.u.k. privilegierten Kronpr<strong>in</strong>z-<br />
Rudolf-Eisenbahngesellschaft. Doch zeigte<br />
sich bald, dass es zweckmäßig wäre, den Weg<br />
von der Rudolfs-Bahnhof genannten Bahnstation<br />
<strong>in</strong> die Stadt durch e<strong>in</strong>e <strong>Straßenbahn</strong><br />
zu erschließen. So wurde am 13. August 1894<br />
die 2,5 km lange meterspurige „Elektrische<br />
Lokalbahn Gmunden“ als dritte elektrische<br />
Bahn Österreichs vom Bahnhof zum Rat-<br />
30 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Österreich: Gmunden<br />
Die gegossenen Haltestellenschilder können<br />
auch am modernen Laternenmast gefallen<br />
<strong>Straßenbahn</strong> Gmunden<br />
Eröffnet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. August 1894<br />
Spurweite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 m<br />
Länge bei Eröffnung: . . . . . . . . . . . . . 2,543 km<br />
Länge heute: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,315 km<br />
Haltestellen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
Betriebsspannung: . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Volt<br />
Anzahl aktuell vorhandener Fahrzeuge: . . . . . . 5<br />
OBEN Noch handelte es sich hier lediglich um<br />
e<strong>in</strong>e von Stern & Hafferl <strong>in</strong> Auftrag gegebene<br />
Fotomontage – e<strong>in</strong>e moderne Tram überquert<br />
die Traun<br />
FOTOS & GRAFIK: C. TUGEMANN<br />
hausplatz eröffnet. Die Betriebsführung übertrug<br />
man an Stern & Hafferl, die auch die Lokalbahn<br />
Gmunden-Vorchdorf betrieb.<br />
Erste Fahrzeuge<br />
Zur Eröffnung der <strong>Straßenbahn</strong> standen drei<br />
von der k.u.k. Hof-Wagenfabrik J. Rohrbacher<br />
erbaute zweiachsige, zweimotorige<br />
Triebwagen (Nr. 1 bis 3) mit 2 x 13 kW Leistung<br />
zur Verfügung, denen e<strong>in</strong> Jahr später e<strong>in</strong><br />
vierter gleichartiger Wagen folgte. Die elektrische<br />
Ausrüstung stammte von der Union<br />
Electricitäts-Gesellschaft (UEG) <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>.<br />
Mit diesem Wagenpark wurde Jahrzehnte<br />
lang der Gesamtbetrieb durchgeführt. Um den<br />
Höhenunterschied zwischen dem auf Seeniveau<br />
liegenden Rathausplatz und dem Bahnhof<br />
zu überw<strong>in</strong>den, beträgt die maximale Neigung<br />
der Strecke 96 Promille, nach Angaben<br />
von Stern & Hafferl sogar 100 Promille! Im<br />
Jahr 1907 beschaffte man zwei Triebwagen<br />
bei der Grazer Waggonfabrik – heute Simmer<strong>in</strong>g-Graz-Pauker<br />
– mit je 2 x 22,5 kW<br />
Leistung. Beide waren aber zunächst nicht<br />
<strong>in</strong> Gmunden, sondern bis zu deren E<strong>in</strong>stellung<br />
bei der <strong>Straßenbahn</strong> Unterach – See als<br />
Tw 1 und 2 im E<strong>in</strong>satz und kamen erst danach<br />
als Nr. 6 und 7 nach Gmunden. Die elektrische<br />
Ausrüstung stammte von den <strong>Sie</strong>mens-<br />
Schuckert-Werken (SSW).<br />
Der offene Sommerwagen 100 <strong>in</strong> der Kuferzeile auf dem Weg zur Endstelle Franz-Josef-Platz. Er<br />
kam auf Bestreben der Befürworter des Tram-Betriebes erst vor wenigen Jahren nach Gmunden<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
31
Betriebe<br />
Der Wagen 5 wartet am 15. August 2012 vor der Remise <strong>in</strong> Gmunden<br />
auf se<strong>in</strong>en nächsten E<strong>in</strong>satz<br />
Der ex-Vestische Düwag-Tw 10 hat die unter schattigen Bäumen gelegene<br />
Endstelle Bahnhof erreicht<br />
Der zwischenzeitlich 1911 von der Grazer<br />
Waggonfabrik und SSW beschaffte Triebwagen<br />
Nr. 5 war mit zwei 26-kW-Motoren<br />
versehen. 1913 wurde der Wagen 4 durch e<strong>in</strong>en<br />
wesentlich stärkeren Wagen Nr. 4 II mit<br />
2 x 40,5 kW ersetzt, der von Ganz gebaut<br />
wurde.<br />
Niedergang nach 1946<br />
Der Betrieb der als L<strong>in</strong>ie G gekennzeichneten<br />
<strong>Straßenbahn</strong> hatte stets mit wirtschaftlichen<br />
Problemen zu kämpfen. Se<strong>in</strong> Maximum<br />
erreichte er 1946 mit 736.898 Fahrgästen.<br />
Danach setzte der zunehmende Individualverkehr<br />
der Bahn arg zu, so dass 1957 nur<br />
noch die Früh- und Spätzüge der ÖBB angedient<br />
wurden. Zugleich kam e<strong>in</strong>e heftige<br />
Stilllegungsdiskussion <strong>in</strong> Gang, die bis 1975<br />
dazu führte, dass die Bedienung des Rathausplatzes<br />
e<strong>in</strong>gestellt wurde und die Bahn<br />
zum Franz-Josef-Platz zurückgezogen wurde.<br />
Auf diesem engen, gewundenen Straßenstück<br />
waren die Triebwagen der Bahn<br />
zum Verkehrsh<strong>in</strong>dernis geworden – <strong>in</strong>sbesondere<br />
bei Fahrtrichtung Rathausplatz, da<br />
die e<strong>in</strong>gleisige Strecke hier entgegen dem<br />
stark zunehmenden Autoverkehr verlief. Die<br />
Streckenlänge reduzierte sich dadurch auf<br />
2,3 Kilometer. Das weiterführende Gleis<br />
wurde e<strong>in</strong>fach überteert und ist bis heute <strong>in</strong><br />
der Fahrbahn sichtbar. Auch der Fahrdraht<br />
hängt, abgesehen von e<strong>in</strong>er kurzen Unterbrechung<br />
an der Endstelle Franz-Josef-Platz,<br />
bis heute.<br />
Neue Fahrzeuge<br />
1978 führte man den E<strong>in</strong>mannbetrieb e<strong>in</strong>,<br />
um die Betriebskosten zu reduzieren. Schon<br />
1961 hatte man zur Steigerung der Beförderungskapazität<br />
– und zur Kostene<strong>in</strong> -<br />
sparung durch Reduzierung des Fahrplanangebotes<br />
– bei Lohner <strong>in</strong> Wien e<strong>in</strong>en<br />
vierachsigen Großraumwagen beschafft und<br />
Vorschläge zum Streckenerhalt von 1989<br />
1. Steigerung der Attraktivität der <strong>Straßenbahn</strong><br />
• E<strong>in</strong>satz historischer Fahrzeuge, um auch den<br />
touristischen Nutzen der <strong>Straßenbahn</strong> zu erhöhen<br />
• hierzu ist Wagen 5 wieder betriebsfähig herzurichten<br />
• Erwerb des Wagens IV (Grazer Waggonfabrik<br />
1898) von der Pöstl<strong>in</strong>gbergbahn <strong>in</strong> L<strong>in</strong>z, den<br />
Gmundener Verhältnissen anpassen (u. a.<br />
Ausbau der Zangenbremse und E<strong>in</strong>bau e<strong>in</strong>er<br />
Magnetschienenbremse), danach E<strong>in</strong>satz als<br />
offener Sommerwagen mit der Nummer 100<br />
im Wechsel mit Wagen 5 auf der Bestandsstrecke<br />
2. Sanierung der Bestandsstrecke<br />
• besonderes Augenmerk auf die Kuferzeile, um<br />
Lärm und Erschütterungen durch den Betrieb<br />
zur reduzieren<br />
3. Verlängerung über den bisherigen Endpunkt<br />
Franz-Josef-Platz h<strong>in</strong>aus<br />
• zweigleisige Trassierung mit Hilfe e<strong>in</strong>er<br />
Weiche an der bisherigen Endstelle, um im<br />
engen Abschnitt Rathausplatz richtungsgerecht<br />
mit dem Autoverkehr mitschwimmen<br />
zu können<br />
unter der Betriebsnummer 8 e<strong>in</strong>gereiht. Dieser<br />
<strong>in</strong> Lizenz gebaute Düwag-Nachbau stellte<br />
e<strong>in</strong>en Qualitätssprung bei der <strong>Straßenbahn</strong><br />
Gmunden dar. Ungewöhnlich ist aber die<br />
Bauart, da er als Zweirichtungs-Triebwagen<br />
ausgelegt ist, jedoch nur Türen auf der rechten<br />
Fahrzeugseite aufweist. Die elektrische<br />
Ausrüstung stammt von Kiepe, die Leistung<br />
beträgt 200 kW bei e<strong>in</strong>er Fahrzeuglänge von<br />
13,4 Metern.<br />
Zunächst als Reservefahrzeug vorgesehen,<br />
konnte man 1974 von den Vestischen Stra-<br />
4. Weiterführung bis zum Klosterplatz<br />
• Dies umfasst e<strong>in</strong>e zweigleisige Strecke über<br />
die frühere Endstelle Rathausplatz, durch das<br />
zweibogige Trauntor und über die Traunbrücke<br />
im Straßenplanum<br />
• dabei s<strong>in</strong>d besonders die Belastbarkeit der<br />
Traunbrücke und das Lichtraumprofil des<br />
Trauntors zu prüfen<br />
5. Bau e<strong>in</strong>er Verb<strong>in</strong>dung zur Lokalbahn<br />
Gmunden – Vorchdorf<br />
• umfasst den Bau e<strong>in</strong>er zweigleisigen Strecke<br />
vom Klosterplatz durch die Traunste<strong>in</strong>straße<br />
und Neubau e<strong>in</strong>er Verb<strong>in</strong>dungskurve zur<br />
Lokalbahn Gmunden – Vorchdorf<br />
• damit entsteht e<strong>in</strong>e Verknüpfung zur Regionalstadtbahn<br />
• Aufgabe des Seebahnhofs und Ersatz durch<br />
e<strong>in</strong>e Haltestelle <strong>in</strong> der Traunste<strong>in</strong>straße<br />
• Besonderheit bei Planung: Problematik der<br />
unterschiedlichen Gleichstrom-Betriebsspannungen<br />
von <strong>Straßenbahn</strong> (600 Volt) und Lokalbahn<br />
(750 Volt)<br />
6. Weiterführung der <strong>Straßenbahn</strong> zur Talstation<br />
der Grünbergbahn<br />
• umfasst e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>-, ggf. auch zweigleisige Strecke<br />
mit Stumpfendstelle<br />
CTG<br />
ßenbahnen die dort nicht mehr benötigten<br />
gleichartigen Zweirichtungs-Großraum-Vierachser<br />
340, 341 und 347 erwerben. Bereits<br />
1952 gebaut, waren sie um e<strong>in</strong>iges älter als<br />
der Lohner-Wagen. Während Tw 340 zur Ersatzteilgew<strong>in</strong>nung<br />
ausgeschlachtet und der<br />
Rest verschrottet wurde, erhielt Tw 341 <strong>in</strong><br />
Gmunden die Nummer 9 und fuhr ab 1977<br />
auf der L<strong>in</strong>ie G. 1983 wurde der Wagen 347<br />
mit der neuen Nummer 10 <strong>in</strong> Betrieb genommen.<br />
Beide wurden zuvor den Erfordernissen<br />
<strong>in</strong> Gmunden angepasst. Dabei wurden<br />
32 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Österreich: Gmunden<br />
Der Lohner-Wagen 8 <strong>in</strong> der von Stern & Hafferl mit 100 Promille angegebenen Maximalsteigung <strong>in</strong> der Alois-Kaltenbrunner-Straße. Im H<strong>in</strong>tergrund<br />
bilden der Traunsee und der Grünberg die perfekte Salzkammergut-Idylle<br />
u. a. die l<strong>in</strong>ken Türen zugunsten e<strong>in</strong>er höheren<br />
Anzahl von Sitzplätzen entfernt. Mit 14,3<br />
Metern s<strong>in</strong>d die beiden Orig<strong>in</strong>al-Düwags etwas<br />
länger und unterscheiden sich – obwohl<br />
ebenfalls von Kiepe – auch <strong>in</strong> der elektrischen<br />
Anlage vom Lohner-Wagen.<br />
Drohende E<strong>in</strong>stellung<br />
Trotz der modernen, leistungsfähigen Fahrzeuge<br />
schien 1989 die E<strong>in</strong>stellung des Gesamtbetriebes<br />
und Umstellung auf Omnibusse<br />
unvermeidlich geworden zu se<strong>in</strong>.<br />
Anstatt sich <strong>in</strong>s Unvermeidliche zu fügen,<br />
erbrachte e<strong>in</strong>e vom damaligen Betriebsleiter<br />
<strong>in</strong>itiierte Unterschriftensammlung des Vere<strong>in</strong>s<br />
„Pro Gmundener <strong>Straßenbahn</strong>“ über<br />
6.000 Unterstützer, womit sich die breite<br />
Bevölkerung der Stadt h<strong>in</strong>ter ihre <strong>Straßenbahn</strong><br />
stellte. Der <strong>in</strong> 1989 gegründete rührige<br />
Vere<strong>in</strong> engagiert sich seither mit vielfältigen<br />
Aktivitäten – <strong>in</strong>sbesondere auch durch<br />
Veranstaltungen und Sonderfahrten zu vielfältigen<br />
Anlässen und Jubiläen – für den Erhalt<br />
und Ausbau bzw. Verknüpfung der <strong>Straßenbahn</strong><br />
mit der Lokalbahn. In der Folge<br />
wurde e<strong>in</strong> Arbeitskreis gegründet, der sich<br />
der Planung, Vorbereitung und Umsetzung<br />
der Maßnahmen für die Zukunft der <strong>Straßenbahn</strong><br />
annahm. Mehrere Varianten wurden<br />
untersucht und abgewogen und führten<br />
letztendlich zu verschiedenen Vorschlägen –<br />
siehe Kasten.<br />
Die Punkte 1 und 2 s<strong>in</strong>d zwischenzeitlich<br />
realisiert. Im Sommer verkehren jeden zweiten<br />
Sonntag im Monat sowie zu besonderen<br />
Anlässen die historischen Wagen 5 und<br />
100 auf der Gesamtstrecke. In der Kuferzeile<br />
wurden Gummidämmungen <strong>in</strong>s Planum<br />
bzw. <strong>in</strong> den Asphalt e<strong>in</strong>gearbeitet. Zur<br />
weiteren Beruhigung trägt die Tatsache bei,<br />
dass der Lohner-Wagen Nr. 8 über wesentlich<br />
leisere Laufeigenschaften und Motorgeräusche<br />
verfügt, so dass dieser vor allem<br />
an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen und<br />
<strong>in</strong> den Tagesrandzeiten e<strong>in</strong>gesetzt wird. Die<br />
beiden Düwags Nr. 9 und 10 s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>gegen<br />
vorrangig tagsüber an Werktagen im E<strong>in</strong>satz.<br />
Bald über den Fluss<br />
Das aktuelle Betriebskonzept für den Streckenausbau<br />
sieht e<strong>in</strong>e Führung der <strong>Straßenbahn</strong>l<strong>in</strong>ie<br />
G vom Bahnhof zum Klosterplatz<br />
mit vertaktetem Fahrplan vor. Überlagernd<br />
sollen die Fahrten der Lokalbahn Gmunden<br />
– Vorchdorf zum Franz-Josef-Platz bzw. zum<br />
Bahnhof geführt werden. Dazu muss e<strong>in</strong>e ca.<br />
700 m lange Verb<strong>in</strong>dung geschaffen werden<br />
– und die Traun überquert werden.<br />
Am 26. August 2012 beschloss der Gmundener<br />
Verkehrsausschuss e<strong>in</strong>stimmig, zunächst<br />
die Endstation der Lokalbahn vom<br />
Seebahnhof zum Klosterplatz zu verlegen.<br />
Diese Baumaßnahme soll sowohl vom Bund,<br />
dem Land und zum Teil auch von e<strong>in</strong>em Hotelier,<br />
der dort e<strong>in</strong> neues Hotel baut und sich<br />
davon e<strong>in</strong>e bessere Auslastung se<strong>in</strong>es Hauses<br />
erhofft, f<strong>in</strong>anziert werden. Als Zeitrahmen<br />
erhofft man sich – und zeigt sich damit<br />
sehr optimistisch – e<strong>in</strong>e Fertigstellung bis<br />
Mitte 2013.<br />
Der Anschluss der <strong>Straßenbahn</strong> zum Klosterplatz<br />
soll dann nach dem anstehenden<br />
Neubau der Traunbrücke, bei der beim Bau<br />
gleich die Gleise mitverlegt werden sollen,<br />
folgen. Hierdurch würden die dort anfallenden<br />
Baukosten auf die Straßenbauverwaltung<br />
abgewälzt. Die Weiterführung zur<br />
Grünbergbahn ist (noch) Zukunftsmusik<br />
und e<strong>in</strong>e eher langfristige Planung.<br />
Aktueller Betrieb<br />
Der Fahrplan der <strong>Straßenbahn</strong> ermöglicht<br />
bei e<strong>in</strong>em Halbstundentakt die Andienung<br />
aller jeweils zur halben Uhrzeit-Stunde <strong>in</strong><br />
Gmunden kreuzenden ÖBB-Züge am Bahnhof<br />
sowie e<strong>in</strong>er Zwischenfahrt zur vollen<br />
Uhrzeit-Stunde bei Durchführung des Gesamtverkehrs<br />
mit nur e<strong>in</strong>em Triebwagen.<br />
Der e<strong>in</strong>gesetzte Wagen wird dabei <strong>in</strong> der Regel<br />
im Tagesverlauf e<strong>in</strong>mal getauscht. Dies<br />
geschieht durch e<strong>in</strong>e Zwischenfahrt vom<br />
Bahnhof während der Wendezeit zum Depot,<br />
das sich an der Haltestelle Gmundener<br />
Keramik unweit des Bahnhofs bef<strong>in</strong>det.<br />
CLAUDIA TUGEMANN<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
33
Fahrzeuge<br />
Stuttgarts neue Berl<strong>in</strong>er<br />
DT8.12 für die Stuttgarter <strong>Straßenbahn</strong>en Erstmals liefert Stadler Pankow Fahrzeuge nach<br />
Stuttgart. Im Juni begann die Endmontage des ersten Doppeltriebwagens <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Hohenschönhausen.<br />
Ende dieses Jahres geht er voraussichtlich <strong>in</strong> den Fahrgastbetrieb<br />
<strong>Straßenbahn</strong>en <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d gelb,<br />
Stadtbahnen rot-beige. Doch <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Hohenschönhausen<br />
s<strong>in</strong>d die <strong>Straßenbahn</strong>en<br />
neuerd<strong>in</strong>gs bunt und die<br />
Stadtbahnen gelb. Allerd<strong>in</strong>gs fahren sie hier<br />
nicht, es gibt am Ort ihrer Entstehung im<br />
neuen Werk von Stadler Pankow nicht e<strong>in</strong>mal<br />
Gleise. Variobahnen für Graz, Ma<strong>in</strong>z<br />
und Bergen (Norwegen) werden dort an der<br />
Gehrenseestraße montiert, aktuell auch die<br />
zu Stadlers Tango-Familie zählenden neuen<br />
Stadtbahnwagen für Stuttgart. 20 Doppeltriebwagen<br />
hat die Stuttgarter <strong>Straßenbahn</strong>en<br />
AG (SSB) bei Stadler Pankow fest bestellt.<br />
Voraussichtlich um den Jahreswechsel<br />
2012/13 sollen die ersten E<strong>in</strong>heiten des<br />
DT8.12 dann <strong>in</strong> Stuttgart den Betrieb mit<br />
Fahrgästen aufnehmen. Bis dah<strong>in</strong> gibt es<br />
noch e<strong>in</strong>ige Zwischenstationen: Der Fertigung<br />
<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Hohenschönhausen schließt<br />
sich jeweils e<strong>in</strong>e erste Inbetriebnahme <strong>in</strong> Velten<br />
(Land Brandenburg, Landkreis Oberhavel)<br />
an, bevor dann <strong>in</strong> Stuttgart die so genannte<br />
Integrationsphase <strong>in</strong> Werkstatt und<br />
Netz beg<strong>in</strong>nt, die Fe<strong>in</strong>abstimmung. Anfangs<br />
wird sich selbstverständlich auch noch e<strong>in</strong>e<br />
Ausbildung der Fahrlehrer und dann des<br />
Fahrpersonals auf der neuen Baureihe anschließen.<br />
Erst dann können erste L<strong>in</strong>iene<strong>in</strong>sätze<br />
folgen, vorsichtshalber auf L<strong>in</strong>ien<br />
nahe der Hauptwerkstatt.<br />
Kantig und doch runder<br />
Dass es e<strong>in</strong> neues Fahrzeug und nicht e<strong>in</strong>fach<br />
nur e<strong>in</strong>e neue Serie des seit 30 Jahren bekannten<br />
gelben Doppeltriebwagens ist, zeigt<br />
sich an vielen kle<strong>in</strong>en und größeren Details.<br />
Die DT8.12 s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>e Neukonstruktion,<br />
andererseits aber technisch wie<br />
optisch e<strong>in</strong>e konsequente Weiterentwicklung<br />
des bei der SSB seit spätestens seit Mitte der<br />
1980er-Jahre und <strong>in</strong>zwischen <strong>in</strong> 164 E<strong>in</strong>-<br />
34 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
DT8.12 Stuttgart<br />
Obwohl der neue<br />
DT8.12 länger und<br />
schlanker wirkt,<br />
entsprechen se<strong>in</strong>e<br />
Hauptabmessungen<br />
sehr weitgehend<br />
den vorhandenen<br />
Fahrzeugen<br />
GRAFIK: STUTTGARTER<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong>EN AG Die Wagenkastenrohbauten kommen aus Stahl geschweißt von der DB Waggonbau Niesky GmbH, e<strong>in</strong>em 100-prozen -<br />
tigen Tochterunternehmen der DB AG<br />
Technische Merkmale DT8.12<br />
• Zweirichtungsfahrzeug<br />
• Doppeltraktionstauglich<br />
• 100 Prozent Hochflur<br />
• beh<strong>in</strong>dertenfreundliche Zugangsmöglichkeiten<br />
• luftgefederte Triebdrehgestelle<br />
• pneumatische Bremsanlage<br />
• LED-Innenbeleuchtung<br />
• Klimatisierung für Fahrer- und Fahrgasträume<br />
• Crashelemente<br />
heiten bewährten Fahrzeugtyps. Fahrpersonal<br />
und Fahrgäste werden viele bekannter<br />
Merkmale wiederf<strong>in</strong>den – e<strong>in</strong> ausdrücklicher<br />
Wunsch der SSB –, doch gelang es auch, den<br />
Fahrgastraum weiter aufzuwerten und die<br />
Struktur des Doppeltriebwagens an aktuellen<br />
Normen zur Crashsicherheit auszurichten.<br />
Im Juni gewährte die SSB AG vorab bei<br />
e<strong>in</strong>em ersten Besichtigungsterm<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sam<br />
mit der Stadler Pankow GmbH e<strong>in</strong>en<br />
E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die anlaufende Endmontage.<br />
Dabei kommt es auf die Richtung der Annäherung<br />
an, ob der DT8.12 e<strong>in</strong>e vertraute<br />
oder e<strong>in</strong>e ganz neue Ersche<strong>in</strong>ung ist. Wer sich<br />
dem e<strong>in</strong>zelnen Wagenkasten von dessen<br />
Kurzkuppelende nähert, erkennt nur wenig<br />
Unterschiede zu den bislang jüngsten Serien<br />
DT8.10/11 von 1999 bis 2005. Kantig<br />
wie gewohnt ist der Kasten, gelb ohneh<strong>in</strong><br />
und auch sonst sofort als Stuttgarter Doppeltriebwagen<br />
charakterisiert. Die Seitenwandaufteilung<br />
und die Türen mit den oben<br />
und unten abgerundeten Scheiben wirken<br />
wie immer. Der Wagenkopf aber, der Bereich<br />
der Fahrerkab<strong>in</strong>e, hat e<strong>in</strong>e gänzlich neue<br />
Form. Schräger, etwas länger und nun auch<br />
abgerundet ist er: Der DT8.12 zeigt e<strong>in</strong> neues<br />
Gesicht, Kastenform adé. Zum Zeitpunkt<br />
der Besichtigung im Juni ist die Wirkung<br />
noch unvollständig, doch schon mit der aus<br />
glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigten<br />
Haube zwischen den späteren Leuchte<strong>in</strong>heiten<br />
ergibt sich die neue Form.<br />
Noch mehr Unfallschutz<br />
Die Form ist mehr als e<strong>in</strong> frisches Design.<br />
Die Gründe liegen buchstäblich tiefer. Unter<br />
der gegenüber den älteren DT8 etwas vorgezogenen<br />
Front und im Kupplungsträger<br />
f<strong>in</strong>den sich Energieverzehrelemente. <strong>Sie</strong> sollen<br />
die Folgen mögllicher Frontalkollisionen<br />
mildern. Ebenso wie die neuen Stadtbahnwagen<br />
für Bielefeld (Heiterblick, Hochflur)<br />
und die neuen Karlsruher Zweisystemwagen<br />
(Bombardier, Mittelflur) s<strong>in</strong>d die Zweiteiler<br />
für Stuttgart somit die ersten Stadtbahnen <strong>in</strong><br />
Deutschland, die aktuellen Normen <strong>in</strong> Sachen<br />
Crashsicherheit entsprechen. Die Bauteile<br />
für Stoßverzehr benötigen e<strong>in</strong>e gewisse<br />
E<strong>in</strong>bautiefe, dennoch ist der Wagen – über<br />
die Kuppelflächen gemessen – kaum länger<br />
als bisher. Der Trick ist, dass die Kontur der<br />
Front dem Schwenkradius der kaum „über<br />
Blech“ vorstehenden Scharfenbergkupplung<br />
folgt – ganz anders als bei den ersten DT8-<br />
Serien, woh<strong>in</strong>gegen die Kupplungen bei<br />
DT8.10/11 zum Betrieb herausgezogen werden<br />
mussten. Beides gibt es beim DT8.12<br />
nicht: Die Kupplung ist allzeit bereit und<br />
sieht dennoch zurückgezogen aus. Seitliche<br />
Verkleidungen, die zum Schwenken der<br />
Kupplung e<strong>in</strong>geklappt werden, verstärken<br />
diese optische Geschlossenheit im unteren<br />
Frontbereich noch. Leicht e<strong>in</strong>gezogene Wagenseiten<br />
tun e<strong>in</strong> übriges für die deutlich<br />
schlankere Wirkung der neuen Fahrzeugköpfe<br />
gegenüber den „klassisch-kantigen“<br />
DT8 der ersten Serien. Nebenbei ist die Front<br />
aber auch etwas stärker geneigt, mehr noch<br />
als beim DT8.10/11.<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
35
Fahrzeuge<br />
„Evolution“ nennt die SSB AG die Weiterentwcklung des DT8 von den ersten Serien (rechts) über den DT8.10/11 zum DT8.12 (l<strong>in</strong>ks) , der hier noch<br />
durch e<strong>in</strong>e Computergrafik vertreten ist<br />
GRAFIK: STUTTGARTER <strong>STRASSENBAHN</strong>EN AG<br />
Technische Daten von Stuttgarts DT8.1 bis DT8.12<br />
Typ/Wagennummern<br />
DT8 – Zweiteilige<br />
ZR-Stadtbahnwagen<br />
Stuttgarter <strong>Straßenbahn</strong>en AG<br />
1.435 mm, 750 V DC<br />
DT8.1<br />
3001 + 3002<br />
(Prototyp)<br />
DT8.2<br />
3003 + 3004<br />
(Prototyp)<br />
DT8.3<br />
3005 + 3006<br />
(Prototyp)<br />
DT8.4: 3007 + 3008–3085 + 3086<br />
DT8.5: 3087 + 3088–3103 + 3104<br />
DT8.6 1 : 3105 + 3106–3167 + 3168<br />
DT8.7: 3169 + 3170–3179 + 3180<br />
DT8.8 2 : 3181 + 3182–3201 + 3202<br />
DT8.9 3 : 3203 + 3204–3233 + 3234<br />
DT8.10<br />
3301 + 3302–3345 + 3346<br />
DT8.11<br />
3347 +<br />
3348–3399 + 3400<br />
DT8.12<br />
3501 + 3502–<br />
3539 + 3540<br />
Baujahre 1981 1982 1982 1985–1996<br />
1999–2000, 2003–2005<br />
(DT8.11)<br />
2012/2013<br />
Anzahl 1 1 1 114<br />
23 (DT8.10)<br />
20<br />
27 (DT8.11)<br />
(+ 40 Option)<br />
Hersteller Wagenkasten MAN Nürnberg MAN Nürnberg MAN Nürnberg DUEWAG Düsseldorf<br />
<strong>Sie</strong>mens/Fahrzeugtechnik Stadler/WBN<br />
Dessau 4<br />
Niesky<br />
Hersteller Drehgestelle SLM W<strong>in</strong>terthur SLM W<strong>in</strong>terthur SLM W<strong>in</strong>terthur SGP Graz <strong>Sie</strong>mens SGP Graz Stadler/W<strong>in</strong>dhoff<br />
Hersteller Elektrik AEG/<strong>Sie</strong>mens AEG/<strong>Sie</strong>mens BBC BBC/AEG/<strong>Sie</strong>mens <strong>Sie</strong>mens/ADtranz/Bombardier Stadler/ABB<br />
Länge über Kupplung 38.050 mm 38.050 mm 38.050 mm 38.800 mm 38.560 mm/39.120 mm 5 39.110 mm<br />
Fahrzeugbreite 2.650 mm 2.650 mm 2.650 mm 2.650 mm 2.650 mm 2.650 mm<br />
Höhe über Dachgeräte 3.715 mm 3.715 mm 3.715 mm 3.715 mm 3.715 mm 3.715 mm<br />
Fußbodenhöhe 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm<br />
Übergangsbreite – – – – 1.100 mm 1.100 mm<br />
Leermasse 67.000 kg 67.000 kg 67.000 kg 54.500–56.000 6 kg 55.600 kg ca. 59.000 kg<br />
Achsformel B’B‘ + B’B’ B’B‘ + B’B’ B’B‘ + B’B’ B’B‘ + B’B’ Bo’Bo’ + Bo’Bo’ Bo’Bo’ + Bo’Bo’<br />
max. Geschw<strong>in</strong>digkeit 80 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h<br />
M<strong>in</strong>. Bogenradius 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m<br />
Raddurchmesser 740/660 mm 740/660 mm 740/660 mm 740/660 mm 740/660 mm 740/660 mm<br />
Antrieb, Dauerleistung 4 x 263 kW 4 x 263 kW 4 x 200 kW 4 x 222 kW 8 x 120 kW 8 x 130 kW<br />
Sitzplätze (fest + Klapp) 112 + 0 108 + 16 112 110 7 + 0 108 + 0 94 + 12<br />
Stehplätze (4 Pers/m 2 ) 122 106 116 132–141 141 149<br />
1<br />
ab Auslieferung ohne Klapptrittstufen 2<br />
ab Auslieferung ohne Klapptrittstufen 3<br />
ab Auslieferung ohne Klapptrittstufen 4<br />
nur DT8.11<br />
5<br />
Kupplungen e<strong>in</strong>gezogen/ausgefahren 6<br />
mit Klapptrittstufen 7<br />
später 108, dafür K<strong>in</strong>derwagenstellplätze Quellen: SSB, Stadler u.a.<br />
Die neue, etwas längere Front mit dem<br />
rundlichen Grundriss hatte jedoch e<strong>in</strong>ige Anderungen<br />
am Fahrerarbeitsplatz zur Folge.<br />
Damit die gesetzlich vorgeschriebenen Sichtverhältnisse<br />
für den Fahrer gewahrt bleiben<br />
erhält die Armaturentafel e<strong>in</strong>e mehrfach geschwungene<br />
L<strong>in</strong>ie. Diese „Wellenlandschaft“<br />
sei aber ke<strong>in</strong>e Designfrage, so wurde betont,<br />
sondern erforderlich, um den Blick vor das<br />
Fahrzeug möglichst wenig e<strong>in</strong>zuengen und<br />
bestmögliche Sichtverhältnisse zu schaffen.<br />
Im crashoptimierten Fahrzeug sitzt der Fahrer<br />
schließlich etwas weiter h<strong>in</strong>ter der Frontverkleidung,<br />
aber er sollte nicht zugleich auch<br />
noch höher positioniert werden.<br />
Neues gibt’s zudem auch beim Blick nach<br />
h<strong>in</strong>ten: Statt Rückspiegeln br<strong>in</strong>gt der neue<br />
DT8.12 Kameras oben an den vier Ecken mit.<br />
Auch wenn es zunächst kaum auffällt: Neu<br />
ist die Verwendung von Schwenkschiebestatt<br />
Außenschw<strong>in</strong>gtüren. Erstmals s<strong>in</strong>d die<br />
Leuchttaster <strong>in</strong> die Türverglasung <strong>in</strong>tegriert,<br />
wie heute üblich mit separaten Tastern für<br />
Fahrgäste mit K<strong>in</strong>derwagen oder Rollstuhl.<br />
Die Türsicherung übernehmen senkrechte<br />
Lichtleisten. Für die Fahrgäste erst auf den<br />
zweiten Blick erkennbar ist e<strong>in</strong>e Verände-<br />
36 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
DT8.12 Stuttgart<br />
In der hellen Werkshalle von Stadler <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Hohenschönhausen begann im Juni 2012 die Endmontage des ersten Doppeltriebwagens mit<br />
3502 (vorn) und 3501 (dah<strong>in</strong>ter). <strong>Sie</strong> tragen bereits die für Stuttgart typische gelbe Lackierung<br />
Die Verkleidungen l<strong>in</strong>ks und rechts der Scharfenbergkupplung werden<br />
e<strong>in</strong>geklappt, wenn zwei Wagen gekuppelt s<strong>in</strong>d<br />
Derartige Klebezettel teilen den Beschäftigten von Stadler Pankow die<br />
wichtigsten Informationen zum jeweiligen Fahrzeug mit<br />
rung im Fahrgastraum, der nicht zufällig<br />
lichter und leichter wirken wird. Die Sitze<br />
s<strong>in</strong>d re<strong>in</strong>igungsfreundlich an den – dafür<br />
verstärkten – Seitenwänden montiert, die<br />
Gerätekästen unter den Sitzpolstern entfallen<br />
weitgehend. Wichtiger noch: Neben den<br />
Zugängen an den DT-Enden f<strong>in</strong>det der Fahrgast<br />
nun beidseits des Mittelganges Mehrzweckbereiche.<br />
Werden sie nicht für Fahrrad,<br />
Rollstuhl oder K<strong>in</strong>derwagen benötigt,<br />
können jeweils drei Klappsitze belegt werden.<br />
Daher ist auch der Gang vom Türraum<br />
her breiter als <strong>in</strong> anderen Bereichen. Technik,<br />
die nicht mehr unter den Sitzen Platz<br />
fand, wanderte teil weise auf das Dach, wo<br />
sich auch die Klimaanlagen bef<strong>in</strong>den. Der<br />
DT8.12 hat nunmehr fast über die ganze<br />
Wagenlänge durchgehende silberne Verkleidungen<br />
auf dem Dach erhalten, anders<br />
als frühere Serien. Nicht sichtbar h<strong>in</strong>gegen<br />
ist, dass auch der Wagen boden verstärkt<br />
wurde. So wird der Fahrgastraum zukunftssicher<br />
– für mehr stehende oder<br />
schwerere Kunden. Aus diesem Grund s<strong>in</strong>d<br />
auch die Achswellen stärker als bisher. Die<br />
Gewichtszunahme des neuen DT8 hat also<br />
mehrere Gründe.<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
37
Fahrzeuge<br />
Wichtig war bei allen Details der Neukonstruktion,<br />
dass die Abmessungen bestenfalls<br />
unerheblich wachsen. Die Länge von<br />
knapp 40 Meter orientiert sich nach wie vor<br />
letztlich an der früheren, <strong>in</strong> Stuttgart für viele<br />
Jahre typischen GT4-Doppeltraktion.<br />
Zwei Mal etwa 20 Meter – so lang s<strong>in</strong>d viele<br />
Haltestellen, so lang ist also auch e<strong>in</strong> DT8.<br />
Freilich s<strong>in</strong>d auf e<strong>in</strong>igen L<strong>in</strong>ien längst auch<br />
Doppeltraktionen möglich, und die Tunnelstationen<br />
haben ohneh<strong>in</strong> angemessene Länge.<br />
Da aber die E<strong>in</strong>stiegsräume aller Doppeltriebwagen<br />
zwischen den Drehgestellen<br />
liegen – wegen der Klappstrittstufen g<strong>in</strong>g es<br />
e<strong>in</strong>st auch gar nicht anders – sieht die SSB<br />
noch e<strong>in</strong>e andere Möglichkeit, zu längeren<br />
Zügen zu kommen: Die Verlängerung der<br />
E<strong>in</strong>heiten auf drei Wagen.<br />
Perspektive Drei-Wagen-Zug<br />
Während der Vorstellung des DT8.12-Konzepts<br />
wurde dies als durchaus realistische<br />
Möglichkeit genannt. Technisch dürfte dies<br />
ke<strong>in</strong>e unlösbaren Probleme aufwerfen, und<br />
bei sorgfältiger Wahl Maße aufwändige Verlängerungen<br />
mancher Hochbahnsteige zum<strong>in</strong>dest<br />
teilweise entbehrlich machen. Die<br />
Doppeltriebwagen lassen sich andererseits<br />
nämlich nicht beliebig zu Langzügen komb<strong>in</strong>ieren<br />
und auch die DT8.12 werden betrieblich<br />
nur mit ihresgleichen e<strong>in</strong>setzbar<br />
se<strong>in</strong>. Grund ist unter anderem die Software<br />
der Fahrzeugsteuerungen. Re<strong>in</strong> mechanisch<br />
aber, zum Rangieren oder Abschleppen, s<strong>in</strong>d<br />
sämtliche Doppeltriebwagen kuppelbar.<br />
Moderner Tram-Park<br />
Schon 2013 wird die SSB bis zu 184 Doppeltriebwagen<br />
e<strong>in</strong>setzen können. Ob dies<br />
ausreicht, die weiter steigenden Fahrgastzahlen<br />
aufzufangen, wird abzuwarten se<strong>in</strong>.<br />
Waren es 1991 noch 152 Mio. Fahrgäste<br />
jährlich, wuchs die Zahl b<strong>in</strong>nen zehn Jahren<br />
bis 2001 auf 179 Mio. (+ 18 Prozent) und <strong>in</strong><br />
den folgenden zehn Jahren bis 2011 um weitere<br />
10 Prozent auf 192 Mio. im Jahr. Der<br />
positive Trend wird sich aller Voraussicht<br />
nach fortsetzen, wenn nicht sogar verstärken.<br />
Die SSB verfährt daher zweigleisig und<br />
modernisiert <strong>in</strong> der eigenen Werkstatt 76 ältere<br />
E<strong>in</strong>heiten zu DT8S, leicht erkennbar an<br />
Frontretuschen und um 1000 erhöhten Wagennummern.<br />
Wichtiger ist die grundlegende<br />
Erneuerung von Teilen der Technik nebst<br />
<strong>in</strong>zwischen möglichem Verzicht auf Klapptrittstufen.<br />
Da aber voraussichtlich nicht alle<br />
älteren DT8 saniert werden – anderswo sagt<br />
man auch „zweiterstellt“ oder „rekonstruiert“<br />
–, wird wohl die Option über weitere<br />
40 Stadler-Züge zum Tragen kommen. Darüber<br />
h<strong>in</strong>aus gehenden Bedarf könnten dann<br />
die erwähnten Vierachser als dritte Wagen<br />
oder weitere DT8 decken – oder beides. Mit<br />
den jetzt bald e<strong>in</strong>treffenden 20 neuen<br />
DT8.12 jedenfalls ist die SSB AG schon e<strong>in</strong>mal<br />
für die neue Stadtbahnl<strong>in</strong>ie U12 ebenso<br />
gerüstet wie für anstehende Erweiterungen<br />
der L<strong>in</strong>ien U5 und U6. Erst für bereits<br />
diskutierte Taktverdichtungen oder zusätzliche<br />
Doppeltraktionen werden dann weitere<br />
Fahrzeuge benötigt. Der aktuelle Auftrag<br />
über 20 DT8.12, geschlossen am 20.<br />
Januar 2010, repräsentiert bei e<strong>in</strong>em Stückpreis<br />
um 3,7 Mio. Euro e<strong>in</strong>en Gesamtwert<br />
<strong>in</strong> Höhe von rund 75 Mio. Euro.<br />
Design von Herbert L<strong>in</strong>d<strong>in</strong>ger<br />
Die neuen Wagen für Stuttgart wurden bei<br />
Stadler Pankow <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> konstruiert, wobei<br />
die enge und kont<strong>in</strong>uierliche Zusammenarbeit<br />
mit den Experten der SSB herausgestellt<br />
wird. E<strong>in</strong>ige Aufgaben wurden extern vergeben:<br />
Die Formgebung lag wie bei allen<br />
Stuttgarter DT8-Serien bei Herbert L<strong>in</strong>d<strong>in</strong>ger,<br />
Hannover. Die Drehgestelle fertigt nach<br />
Stadler-Angaben im Rohbau e<strong>in</strong> Unternehmen<br />
aus dem Raum Berl<strong>in</strong>, ihre Montage<br />
übernimmt W<strong>in</strong>dhoff <strong>in</strong> Rhe<strong>in</strong>e. Das ist <strong>in</strong>sofern<br />
bemerkenswert, als die Drehgestelle<br />
der drei Prototypen im Jahr 1981 von der<br />
Schweizerischen Lokomotiv- und Masch<strong>in</strong>enfabrik<br />
<strong>in</strong> W<strong>in</strong>terthur kamen – und die gehört<br />
heute zu Stadler. Die Fahrzeugelektrik<br />
fertigt Stadler, die Antriebsumrichter liefert<br />
ABB zu. Und wie schon bei früheren Serien<br />
des elektrischen Regionaltriebzuges FLIRT<br />
38 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
DT8.12 Stuttgart<br />
Auf der InnoTrans 2012 stand<br />
der DT8.12 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> neben dem<br />
neuen Hochgeschw<strong>in</strong>digkeitszug<br />
Talgo Avril aus Spanien. Dieses<br />
Zusammentreffen wird sich wohl<br />
nicht so schnell wiederholen …<br />
A. UHLENHUT<br />
Fahrgastraum am Wagenübergang: Beidseits des Mittelganges bef<strong>in</strong>den sich wie gewohnt<br />
Doppelsitze<br />
GRAFIK: STUTTGARTER <strong>STRASSENBAHN</strong>EN AG<br />
Der Wagenübergang mit den Schaltschränken im Inneren ähnelt stark jenem der DT8.10/11<br />
bezieht Stadler auch die Rohbauwagenkästen<br />
der DT8.12 von e<strong>in</strong>em Zulieferer. Hersteller<br />
ist die DB Waggonbau Niesky GmbH,<br />
e<strong>in</strong>e 100-prozentige Tochtergesellschaft der<br />
DB Fahrzeug<strong>in</strong>standhaltung GmbH im DB-<br />
Konzern. Alle Komponenten werden zur<br />
Endmontage im Stadler-Werk Hohenschönhausen<br />
zusammengeführt.<br />
Betriebsaufnahme <strong>in</strong> Kürze<br />
Der geplante E<strong>in</strong>satz im Fahrgastverkehr beg<strong>in</strong>nt<br />
voraussichtlich um die Jahreswende<br />
2012/13 zunächst auf den L<strong>in</strong>ien U3, U5, U6<br />
und U8. Wenn man die Bezeichnung Doppeltriebwagen<br />
wörtlich nimmt und auch der separaten<br />
Nummerierung beider Wagenteile<br />
folgt, dann setzt die SSB bald schon mehr dieser<br />
seit 30 Jahren aktuellen Fahrzeuge e<strong>in</strong> als<br />
e<strong>in</strong>st von den legendären GT4. Das waren bis<br />
zu 350, doch 184 DT8 ergeben schon 368<br />
Vierachser. Plus drei optisch eng verwandte<br />
Zahnrad-E<strong>in</strong>zelwagen der „Zacke“ L<strong>in</strong>ie 10.<br />
Damit ist, auch mit e<strong>in</strong>em Seitenblick auf andere<br />
Großstädte, sicher: Das e<strong>in</strong>st gewählte<br />
Konzept hat sich offenbar rundum bewährt.<br />
Und für den aktuellen Hersteller war der DT8-<br />
Auftrag e<strong>in</strong> wichtiger Lückenschluss zum Bereich<br />
Metro. Da gab es <strong>in</strong>zwischen auch e<strong>in</strong>e<br />
erste Bestellung für das noch vergleichsweise<br />
junge Unternehmen Stadler Rail Group. Wieder<br />
<strong>in</strong> Gelb. Wieder aus Berl<strong>in</strong>. Und diesmal<br />
auch für Berl<strong>in</strong>. ACHIM UHLENHUT<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
39
Geschichte<br />
E<strong>in</strong>st & Jetzt<br />
Zwischen den beiden Aufnahmen aus Rostock an der<br />
Haltestelle Holbe<strong>in</strong>platz hat sich sche<strong>in</strong>bar nicht viel<br />
verändert. Das ältere Bild mit dem für die Stadt im<br />
Norden Mecklenburgs damals so typischen Gotha-<br />
Dreiwagenzug entstand im Frühjahr 1983 kurz nach<br />
dem Neubau der Eisenbahnbrücke für die Strecke<br />
Rostock – Warnemünde und der Verlegung der<br />
<strong>Straßenbahn</strong>strecke <strong>in</strong> die Seitenlage. Als der vom<br />
Tw 64 geführte Zug zum Hauptbahnhof aufbricht,<br />
ist von e<strong>in</strong>em S-Bahn-Haltepunkt noch nichts zu<br />
sehen, im H<strong>in</strong>tergrund erhebt sich das Haus der<br />
Hochsee fischer.<br />
Heute ist der Holbe<strong>in</strong>platz e<strong>in</strong>er der bedeutendsten<br />
Umsteigepunkte im Rostocker Nahverkehr zwischen<br />
S-Bahn, <strong>Straßenbahn</strong> und Stadtbus. Anstatt der<br />
Gotha-Dreiwagenzüge der L<strong>in</strong>ie 12 halten nun die<br />
L<strong>in</strong>ien 1, 4 und 5 an der Haltestelle. Zur Zeit der Aufnahme<br />
im Juli 2012 ist L<strong>in</strong>ie 1 noch fest <strong>in</strong> Händen<br />
der Tatrawagen vom Typ T6A2M und der Niederflurbeiwagen,<br />
deren E<strong>in</strong>satzzeit sich nun jedoch dem Ende<br />
entgegen neigt. Ab Sommer 2013 sollen sie durch<br />
13 neue Niederflurwagen von Vossloh ersetzt werden.<br />
Was dann aus Tw 702 wird, steht noch nicht fest.<br />
TEXT: MARTIN JUNGE<br />
BILDER: ARCHIV ROSTOCKER NAHVERKEHRSFREUNDE<br />
(RECHTS) UND MARTIN JUNGE (UNTEN)<br />
40 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
E<strong>in</strong>st & Jetzt<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012 41
Fahrzeuge<br />
Neul<strong>in</strong>g zur<br />
Bundesgartenschau<br />
42 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
N8C Kassel<br />
Dort wo heute die RegioTrams <strong>in</strong> den Bahnhofstunnel e<strong>in</strong>tauchen, fuhren bis 2005 – wie hier<br />
Tw 422 – noch <strong>Straßenbahn</strong>en h<strong>in</strong>e<strong>in</strong><br />
E. LÖW<br />
Am Hasselweg ist der Tw 406 unterwegs. Gekennzeichnet mit dem L<strong>in</strong>iensignal 2 ist er am<br />
3. September 2007 auf der Fahrt <strong>in</strong> den Betriebsbahnhof Wilhelmshöhe P. KRAMMER<br />
NGT8 verdrängen Kasseler N8C Von 1981 bis 1986 bekam<br />
die Kasseler Verkehrsgesellschaft anlässlich der Bundesgartenschau<br />
und zum Ersatz älterer Zweiachser <strong>in</strong>sgesamt 22 Wagen des Typs<br />
N8C. Nun scheiden sie langsam aus dem Regeldienst aus<br />
Ende 1979 war der Tw 111 aus Dortmund zu<br />
Testfahrten <strong>in</strong> Kassel. Am 12. Dezember fuhr<br />
der N8C auf der Frankfurter Straße den We<strong>in</strong>berg<br />
h<strong>in</strong>unter <strong>in</strong> Richtung Baunatal<br />
DR. H. MENZEL<br />
Wie <strong>in</strong> vielen deutschen Städten,<br />
gab es auch <strong>in</strong> Kassel <strong>in</strong> den<br />
1960er- und 1970er-Jahren die<br />
Diskussion um den Erhalt der<br />
<strong>Straßenbahn</strong>. Deshalb wurden rund zehn<br />
Jahre ke<strong>in</strong>e Neufahrzeuge angeschafft. Die<br />
1981 <strong>in</strong> Kassel stattf<strong>in</strong>dende Bundesgartenschau<br />
zwang die Kasseler Verkehrsgesellschaft<br />
Mitte 1979 jedoch, 16 Neufahrzeuge<br />
zu bestellen. Da die ortsansässige Waggonbau-Firma<br />
Wegmann und Credé aber nicht<br />
mehr bestand und e<strong>in</strong> Nachbau der Sechsachser<br />
bei der Kasseler Firma Wegmann nicht<br />
möglich gewesen wäre, musste nach e<strong>in</strong>er<br />
Alternative gesucht werden.<br />
Von November bis Dezember 1979 weilte<br />
der N8C 111 der Dortmunder Stadtwerke<br />
AG zu Testfahrten <strong>in</strong> Kassel. Am 19. November<br />
1979 wurde das Fahrzeug am<br />
Betriebshof Holländische Straße vom Güterzug<br />
abgeladen. Bei den Testfahrten lief das<br />
Fahrzeug auch im Planbetrieb, meist auf<br />
SL 7. Am 18. Dezember wurde das Fahrzeug<br />
wieder verladen und nach Dortmund zurück<br />
gebracht. Die KVG war zufrieden mit den<br />
Testfahrten und bestellte im Dezember 1979<br />
<strong>in</strong>sgesamt 16 derartige Fahrzeuge von der<br />
Firma Düwag.<br />
Die bestellen Fahrzeuge wurden 1981 angeliefert<br />
und erhielten die Wagennummern<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
43
Fahrzeuge<br />
Der Tw 409 hat am 2. September 2007 den Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe erreicht, woh<strong>in</strong> er als L<strong>in</strong>ie 7 zahlreiche Reisende von der Innenstadt<br />
gebracht hat P. KRAMMER (2)<br />
Am Königsplatz bef<strong>in</strong>det sich e<strong>in</strong>e der zentralen Haltestellen <strong>in</strong> der Innenstadt. E<strong>in</strong> N8C hat diese<br />
Station zwischen Kaufhäusern und Spr<strong>in</strong>gbrunnen gerade <strong>in</strong> Richtung Wolfsanger verlassen<br />
von 401 bis 416. Das erste Fahrzeug des<br />
Typs N8C traf <strong>in</strong> Kassel am 24. Januar 1981<br />
e<strong>in</strong>, se<strong>in</strong> Schwesterfahrzeug 402 am 6. Februar.<br />
Trotz 10 cm mehr Wagenbreite gegenüber<br />
den alten Fahrzeugen, traten nur an wenigen<br />
Stellen Probleme auf. Das letzte<br />
Fahrzeug (416) erreichte Kassel am 1. Juli<br />
1981.<br />
Merkmale der Fahrzeuge<br />
Auch die Kasseler Fahrzeuge erhielten am A-<br />
und B-Teil je e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>holmstromabnehmer.<br />
Durch den Wegfall der automatischen Kupplung<br />
konnte die Fahrzeugfront neu gestaltet<br />
werden, es kamen GFK-Bugschürzen an<br />
die Stelle, wo sonst die Kupplung ist. E<strong>in</strong>e<br />
Kasseler Besonderheit ist die zusätzliche<br />
Schutzverkleidung für den Scheibenwischerantrieb,<br />
auch e<strong>in</strong>e vergrößerte Zielanzeige<br />
kam zum E<strong>in</strong>bau. Da Kassel längere<br />
Steigungs- und Gefällstrecken hat, erhielten<br />
die Laufdrehgestelle auch e<strong>in</strong>e Federspeicherbremse.<br />
Zum E<strong>in</strong>bau kamen AEG-<br />
Chopper.<br />
Anfangs gab es Schwierigkeiten mit der<br />
Türsteuerung. Nach Behebung dieses Problems<br />
und Schulung des Fahrpersonals ab<br />
9. März 1981 wurden die Fahrzeuge dem<br />
Betriebshof Niederzwehren überstellt, der<br />
damals die Fahrzeuge der L<strong>in</strong>ie 7 zuteilte.<br />
Während der Fahrschulfahrten kam es be-<br />
44 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
N8C Kassel<br />
Die E<strong>in</strong>sätze von Tw 401 mit Bw 566 auf der L<strong>in</strong>ie 1 waren weniger häufig. Hier verlässt das Gespann am 4. Juli 1991 auf der Holländischen<br />
Straße die Haltestelle Mombachstraße <strong>in</strong> Richtung Wilhelmshöhe<br />
DR. H. MENZEL<br />
Der Fahrerstand mit se<strong>in</strong>en orig<strong>in</strong>alen Bedienelementen … … sowie der Innenraum e<strong>in</strong>es Kasseler N8C C. HECHT (2)<br />
reits zu E-Wagen-E<strong>in</strong>sätzen auf anderen L<strong>in</strong>ien.<br />
Wegen des großen Platzangebotes der<br />
Fahrzeuge waren sie meist auf den L<strong>in</strong>ien 3<br />
und 7 unterwegs.<br />
E<strong>in</strong>e zweite Serie kommt!<br />
Aufgrund der guten Erfahrungen, die die<br />
KVG von 1981 bis 1984 mit diesem Typ gesammelt<br />
hatten, bestellte die KVG 1984<br />
sechs Wagen nach. <strong>Sie</strong> erhielten die Wagennummern<br />
417 bis 422. Das erste Fahrzeuge<br />
des Typs traf am 26. Juni 1986, das letzte<br />
am 2. September des selben Jahres e<strong>in</strong>. Diese<br />
Wagen unterschieden sich nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen<br />
wenigen Details von den anderen 16 Fahrzeugen.<br />
Größter Unterschied war die Ausführung<br />
als „All-Electric-Car“ und e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>gebaute<br />
Mikroprozessor-Steuerung, die<br />
AEG-Chopper wurde beibehalten. Der Erste<strong>in</strong>satz<br />
dieser Serie war am 15. November<br />
1986 auf der L<strong>in</strong>ie 5, bis Ende November<br />
1986 waren dann alle Wagen im Betriebsdienst.<br />
Anfangs <strong>in</strong> Azurblau<br />
Die Wagen waren anfangs Azurblau (RAL<br />
5009) lackiert und hatten e<strong>in</strong>en anthrazitfarbenen<br />
Fahrwerksbereich. Allerd<strong>in</strong>gs erreichte<br />
e<strong>in</strong> Großteil der Wagen Kassel <strong>in</strong><br />
Grundfarben (z.B. 403, 405 und 406 <strong>in</strong><br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
45
Fahrzeuge<br />
Der Triebwagen 401 der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft warb auch noch im vorigen Jahr für e<strong>in</strong> Betten-Geschäft. Michael Kochems nahm ihn am<br />
3. Mai 2011 <strong>in</strong> der Holländischen Straße auf<br />
Die LCD-Anzeige e<strong>in</strong>es Kassler N8C C. HECHT (2)<br />
Wagen 421 steht zur späten Stunde am großzügig gestalteten Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe<br />
Gelb), da diese dann e<strong>in</strong>e Werbung erhielten.<br />
Die zweite Serie wurde komplett <strong>in</strong><br />
Grundfarben für Ganzreklamen angeliefert.<br />
Ab 1991/92 wurden die Fahrzeuge analog<br />
der neuen Niederflurwagen <strong>in</strong> „Himmelblau“<br />
(RAL 5015) mit g<strong>in</strong>stergelben (RAL<br />
1032) Türen umlackiert. Die jetzt neu e<strong>in</strong>treffenden<br />
Niederflurwagen tragen e<strong>in</strong>e neue<br />
Lackierung <strong>in</strong> „Verkehrsblau“.<br />
Zu Versuchszwecken wurde im April 1990<br />
der Tw 402 am B-Teil mit e<strong>in</strong>e Scharfenbergkupplung<br />
ausgestattet. Im Mai 1990 unternahm<br />
er geme<strong>in</strong>sam mit Bw 570 Testfahrten<br />
durch das Kasseler Schienennetz.<br />
Nach diesen Versuchen wurde die Kupplung<br />
abgebaut und an Tw 401 angebaut (ebenfalls<br />
am B-Teil). Das Fahrzeug 401 mit Beiwagen<br />
566 war von Juni bis 26. Juli 1990<br />
im Teste<strong>in</strong>satz, bis auf wenige E<strong>in</strong>stellungsprobleme<br />
an den Bremsen war der Teste<strong>in</strong>satz<br />
sehr erfolgreich. Vom 30. Oktober 1990<br />
bis <strong>in</strong> den Juli 1991 ist das Gespann im nor-<br />
malen Fahrgastverkehr e<strong>in</strong>gesetzt worden.<br />
Als es im Mai 1999 <strong>in</strong> Kassel e<strong>in</strong>e große L<strong>in</strong>ienänderung<br />
gab, bedeutete das <strong>in</strong> der Werkstatt<br />
e<strong>in</strong>ige Arbeit an den Rollbändern der<br />
N8C, da sich L<strong>in</strong>ie und Ziel auf e<strong>in</strong>em Band<br />
befanden. Weil die Bänder auch wartungs<strong>in</strong>tensiv<br />
und kapazitätsbed<strong>in</strong>gt erschöpft waren,<br />
musste sich die Werkstatt nach e<strong>in</strong>er neuen<br />
Lösung umsehen. Zum Jahresende 1999<br />
baute man versuchsweise an Front und Seite<br />
bei den Tw 417 und 420 e<strong>in</strong>e LCD-Zielanzeige<br />
e<strong>in</strong>. Nach erfolgreicher und ausgiebiger<br />
Erprobung wurden ab Juli 2000 die Tw 417<br />
bis 422 komplett auf LCD-Zielanzeiger umgestellt,<br />
anschließend auch die anderen 16<br />
Wagen, was sich aber bis April 2001 h<strong>in</strong>zog.<br />
Die Ablösung<br />
Zur Ablösung der N8C 401 bis 416 bestellte<br />
die Kasseler Verkehrsgesellschaft Anfang<br />
2010 bei Bombardier 18 Niederflurwagen des<br />
Typs NGT8 (gleicher Typ wie <strong>in</strong> Dortmund).<br />
Das erste Fahrzeug dieser neuen Baureihe traf<br />
am 25. November 2011 <strong>in</strong> Kassel e<strong>in</strong>. Am 24.<br />
Februar 2012 bestellte die Kasseler Verkehrsgesellschaft<br />
nochmals vier Fahrzeuge<br />
46 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
N8C Kassel<br />
Technische Daten<br />
Serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 bis 422<br />
Baujahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981/86<br />
Lieferant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Düwag<br />
elektrischer Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BBC<br />
Bauart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 x ZR<br />
Achsfolge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B’2’2’B<br />
Spurweite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.435 mm<br />
Stromsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 V =<br />
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.880 mm<br />
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300 mm<br />
Höhe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.306 mm<br />
Radstand im Drehgestell . . . . . . . . . . 1.800 mm<br />
Drehzapfenabstand . . . . . . . . . . . . . . 6.200 mm<br />
Sitzplätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />
Stehplätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />
Leergewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,5 t<br />
Gesamtgewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,7 t<br />
Leistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 150 kW<br />
Besonderheiten:<br />
417 bis 422 „all-electric-car“, 401 1990/91 mit<br />
Schaku im Beiwagen-Betrieb unterwegs<br />
Am 3. Mai 2011 nahm Michael Kochems den Wagen 416 an der Haltestelle Kl<strong>in</strong>ikum auf<br />
dieses Typs. Seit 31. März 2012 s<strong>in</strong>d die ersten<br />
Fahrzeuge ab Nummer 651 im L<strong>in</strong>iene<strong>in</strong>satz<br />
und verdrängen bis dah<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ige<br />
Hochflurkurse. Im Bestand s<strong>in</strong>d bis jetzt noch<br />
alle 22 N8C, nur nach und nach werden immer<br />
weniger Fahrzeuge unterwegs se<strong>in</strong>. Aktuell<br />
werden die Fahrzeuge noch im Schul-<br />
verkehr auf den L<strong>in</strong>ien 1E, 5E und 7 benötigt.<br />
Sollten alle NGT8 da se<strong>in</strong>, können ab<br />
Mitte 2013 alle Fahrten mit Niederflurwagen<br />
gefahren werden.<br />
Der Verbleib der N8C-Fahrzeuge ist noch<br />
nicht entschieden. Es sollen alle Wagen bis<br />
zur kompletten Auslieferung der NGT8 <strong>in</strong><br />
Kassel bleiben, wahrsche<strong>in</strong>lich auch länger<br />
als Betriebsreserve. In Kassel werden bis 2016<br />
noch die Wagen 417 bis 422 im Betrieb bleiben.<br />
Bisher (Stand: September 2012) s<strong>in</strong>d die<br />
Fahrzeuge 402, 404, 405, 406, 408, 409,<br />
410, 411, 412 und 416 als Betriebsreserve<br />
h<strong>in</strong>terstellt. CHRISTOPHER HECHT
Titel<br />
Vom ältesten Wagen des<br />
Typs Berol<strong>in</strong>a bis zum<br />
Stadtbahnwagen der<br />
neuesten Generation<br />
präsentierten sich am<br />
29./30. September 2012<br />
die Trams bei der 140-<br />
Jahr-Feier im Betriebsbahnhof<br />
Trachenberge<br />
BILDER, WENN NICHT ANDERS<br />
ANGEGEBEN M. SPERL<br />
48 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
<strong>Dresden</strong><br />
Tram im Barock<br />
140 Jahre Dresdner <strong>Straßenbahn</strong> Die wechselvolle Geschichte der Tram <strong>in</strong><br />
Elbflorenz von der 1872 eröffneten Pferdebahn über Große und Kle<strong>in</strong>e Hechte<br />
bis h<strong>in</strong> zu Tatrawagen und <strong>in</strong>s Niederflurzeitalter. Mit 134 km Netzlänge gehört<br />
die Dresdner <strong>Straßenbahn</strong> heute zu den größeren Betrieben <strong>in</strong> Deutschland<br />
<strong>Dresden</strong> bot mit se<strong>in</strong>er Lage an der<br />
Elbe, tangiert von Handelsstraßen,<br />
ideale Voraussetzungen zur Entstehung<br />
e<strong>in</strong>er Stadt. 1464 verlegte das<br />
Adelsgeschlecht der Wett<strong>in</strong>er se<strong>in</strong>en Regierungssitz<br />
für das Kurfürstentum Sachsen von<br />
Meißen hierher, seitdem wuchs die Residenzstadt<br />
zu e<strong>in</strong>em politischen, wirtschaftlichen<br />
und kulturellen Zentrum im Herzen<br />
Europas heran. 1839 fuhr erstmals e<strong>in</strong> lokomotivbespannter<br />
Zug auf der ersten deutschen<br />
Ferneisenbahn von Leipzig nach <strong>Dresden</strong>.<br />
Das neue Transportmittel – Inbegriff<br />
der Industrialisierung – konnte sich schnell<br />
gegen alle Vorbehalte behaupten und brachte<br />
wirtschaftlichen Aufschwung. Im Verlauf<br />
der Industrialisierung entstanden im 19.<br />
Jahrhundert vermehrt Fabriken, <strong>in</strong> <strong>Dresden</strong><br />
vor allem der Näh- und Schreibmasch<strong>in</strong>en<strong>in</strong>dustrie,<br />
der Genussmittelfertigung, der optischen<br />
Industrie sowie des Masch<strong>in</strong>enbaus.<br />
Damit stieg im 19. Jahrhundert das Verkehrsaufkommen<br />
sprunghaft, hatten doch<br />
die Menschen durch die zunehmende Trennung<br />
zwischen Wohn- und Arbeitsstätten<br />
weitere Wege zurückzulegen.<br />
Die Pferdebahnzeit<br />
Die Berl<strong>in</strong>er „Cont<strong>in</strong>ental-Pferdeeisenbahn-<br />
Aktiengesellschaft“ erkannte die Zeichen der<br />
Zeit und eröffnete im September 1872 östlich<br />
des Zentrums von der damals noch<br />
eigenständigen Geme<strong>in</strong>de Blasewitz durch<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
49
Titel<br />
Die erst 1889 gegründete Deutsche <strong>Straßenbahn</strong>-Gesellschaft besaß die weniger rentablen L<strong>in</strong>ien und setzte daher meist kle<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>spänner e<strong>in</strong>,<br />
wie hier Wagen Nr. 60 auf der noch sehr ländlich ersche<strong>in</strong>enden Großenha<strong>in</strong>er Straße nahe der Gaststätte „Zum wilden Mann“<br />
SLG. M. SCHATZ<br />
Blick über den Postplatz Richtung Südwesten um 1905. Der „gelbe“ Tw 225 (Bj 1896) wurde<br />
1906 beim Zusammenschluss der Gesellschaften <strong>in</strong> Nr. 847 umgezeichnet SLG: C. SACHER<br />
Nach der Jahrhundertwende zeigt sich Tw 2 der<br />
se<strong>in</strong>er Fahrt Richtung Niedersedlitz<br />
damals noch sehr lockere Bebauung zum Pirnaischen<br />
Platz <strong>in</strong> <strong>Dresden</strong> und ab November<br />
weiter zum Böhmischen Bahnhof (Standort<br />
des heutigen Hauptbahnhofs) <strong>Dresden</strong>s<br />
erste Pferdebahnl<strong>in</strong>ie. Im März 1873 nochmals<br />
vom Böhmischen Bahnhof weiter nach<br />
Plauen (bis 1903 selbständig) verlängert, boten<br />
die Wagen e<strong>in</strong> größeres Platzangebot als<br />
die schon seit 1838 verkehrenden Pferdeomnibusse.<br />
Durch e<strong>in</strong>e Phase wirtschaftlicher<br />
Stagnation, aber auch <strong>in</strong>folge der Blockade<br />
der Stadtverordneten h<strong>in</strong>sichtlich der<br />
Anlage von Gleisen im Innenstadtbereich unterblieb<br />
für e<strong>in</strong>ige Jahre der Bau neuer Strecken.<br />
Erst als 1879 die Londoner „Tramways<br />
Company of Germany Limited“ e<strong>in</strong>e<br />
Konzession zum Bau und Betrieb von <strong>Straßenbahn</strong>en<br />
<strong>in</strong> Elbflorenz erhielt, setzte e<strong>in</strong><br />
umfangreicher Ausbau des Pferdebahnnetzes<br />
e<strong>in</strong>, bereits 1880 konnte die Verb<strong>in</strong>dung<br />
Plauen – Postplatz e<strong>in</strong>geweiht werden, die<br />
bald über die Augustusbrücke zum Neustädter<br />
Markt verlängert wurde. Die Londoner<br />
Gesellschaft übernahm zudem die bestehende<br />
„Cont<strong>in</strong>entall<strong>in</strong>ie“ und zeichnete<br />
sich durch ihre gelb/weiß lackierten Wagen<br />
aus, von denen Wagen 106 (Bj. 1886) heute<br />
zum Bestand des Verkehrsmuseums <strong>Dresden</strong><br />
(VMD) gehört.<br />
Rot und Gelb <strong>in</strong> Konkurrenz<br />
Da die Londoner Tramways Company nicht<br />
alle städtischen Wünsche erfüllte, vergab der<br />
Rat weitere, der Stadtverwaltung mehr<br />
Rechte e<strong>in</strong>räumende Konzessionen ab 1889<br />
an die neu gegründete „Deutsche <strong>Straßenbahn</strong>gesellschaft<br />
<strong>in</strong> <strong>Dresden</strong>“. Zur Unterscheidung<br />
von der bestehenden „Gelben“<br />
Gesellschaft wurde sie aufgrund ihrer<br />
50 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
<strong>Dresden</strong><br />
1893 eröffnete die Deutsche <strong>Straßenbahn</strong>-Gesellschaft die erste elektrische Bahn vom Schlossplatz nach Blasewitz und Loschwitz. Hier begegnen<br />
sich zwei Züge auf dem Barteldesplatz <strong>in</strong> Blasewitz SLG. M. SCHATZ (2)<br />
Leubener Vorortsbahn auf der Leubener Straße bei<br />
SLG. M. SPERL<br />
In Mickten rangiert um 1924/25 rechts die meterspurige Lößnitzbahn Richtung Kötzschenbroda,<br />
l<strong>in</strong>ks auf der Straße die hier endende Breitspurl<strong>in</strong>ie 15 aus der Stadt<br />
rot/weiß-lackierten Wagen kurz die „Rote“<br />
genannt. Die Spurweite beider Gesellschaften<br />
betrug 1.450 mm, was geme<strong>in</strong>same Streckennutzungen<br />
vor allem an Knotenpunkten<br />
ermöglichte und sich bis heute als<br />
Dresdner Spurmaß erhalten hat. Die „Rote“<br />
erschloss weitere Stadtteile und nahm am<br />
6. Juli 1893 erstmals den elektrischen Betrieb<br />
mittels Oberleitung zwischen Schlossund<br />
Schillerplatz auf, der bereits am 15. Juli<br />
auf die andere Elbseite zum Körnerplatz <strong>in</strong><br />
die Ortschaft Loschwitz ausgeweitet wurde.<br />
Gegenüber der Pferdebahn bot die von <strong>Sie</strong>mens<br />
& Halske errichtete elektrische Bahn<br />
höhere Geschw<strong>in</strong>digkeiten und dank Beiwagenbetrieb<br />
größeres Fassungsvermögen.<br />
Erhaltene Zeugnisse dieser Gesellschaft s<strong>in</strong>d<br />
bis heute der offene Tw 761 (Baujahr 1895)<br />
des VMD sowie der „Berol<strong>in</strong>a“-Tw 309<br />
(Baujahr 1902) des <strong>Straßenbahn</strong>museums<br />
<strong>Dresden</strong> (SMD). Die Tramways Company<br />
übertrug 1894 ihren Besitz auf die neue<br />
„Dresdner <strong>Straßenbahn</strong>gesellschaft“, die<br />
drei Jahre nach der „Roten“ Konkurrenz<br />
1896 ihre erste Strecke elektrifizierte. Der<br />
letzte von der „Gelben“ Gesellschaft erhal-<br />
tene Triebwagen Nr. 296 (Baujahr 1898) hat<br />
sich – umgerüstet zum W<strong>in</strong>terdienstfahrzeug<br />
– rund acht Jahrzehnte im E<strong>in</strong>satz behaupten<br />
können und ist heute <strong>in</strong> der Museumsgaststätte<br />
„<strong>Dresden</strong> 1900“ am Neumarkt zu<br />
besichtigen.<br />
Die Oberleitung setzt sich durch<br />
Ende des 19. Jahrhundert wurden neben dem<br />
Oberleitungsbetrieb auch andere Formen der<br />
Energieversorgung <strong>in</strong> der Praxis erprobt, die<br />
sich aufgrund verschiedener Nachteile jedoch<br />
nicht durchsetzen konnten: So fuhren<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
51
Titel<br />
Im Jahre 1951 warten am Endpunkt Bühlau zwei Züge, bestehend aus vierachsigem großen Hechttriebwagen und zweiachsigem Stahlbeiwagen<br />
sowie e<strong>in</strong> Obuszug<br />
SLG. M. SCHATZ<br />
1892–95 für nur drei Jahre Gasmotorwagen<br />
zwischen Albertplatz und Trachenberger<br />
Platz und weiter zum Wilder Mann bzw. St.-<br />
Pauli-Friedhof. Auch re<strong>in</strong>en Akkumulatorenwagen<br />
war wenig Erfolg beschieden, zu<br />
groß waren Energieverlust und Zeitaufwand<br />
beim Laden der Batterien. Gleisabschnitte<br />
mit – aus Gründen der Ästhetik – unterirdischer<br />
Stromzufuhr wurden beim Altmarkt<br />
und <strong>in</strong> Blasewitz e<strong>in</strong>gerichtet. Da sich jene<br />
Systeme nicht bewährten, kam auch hier<br />
recht bald herkömmliche Oberleitung zum<br />
E<strong>in</strong>bau. In der Folge schritt bei beiden<br />
Gesellschaften der Bau von Kraftwerken,<br />
Oberleitungen und für den Triebwagene<strong>in</strong>satz<br />
verstärkten Gleisanlagen rasch voran,<br />
schließlich fuhr im August 1900 letztmals<br />
e<strong>in</strong>e Pferdebahn.<br />
Per Tram nach Kötzschenbroda<br />
Zur Zeit der Jahrhundertwende erhielten<br />
zunehmend auch benachbarte Ortschaften<br />
Anschluss an <strong>Dresden</strong>s <strong>Straßenbahn</strong>. Die<br />
„Außenstrecken“ sollten dabei nicht <strong>in</strong> Konkurrenz<br />
zu bereits vorhandenen Eisenbahnl<strong>in</strong>ien<br />
treten, weshalb diese der sächsische<br />
Staat zum Zwecke besserer Kontrolle <strong>in</strong> Eigenregie<br />
erbaute. Noch kurz vor der Jahrhundertwende<br />
g<strong>in</strong>g 1899 <strong>in</strong> nordwestliche<br />
Richtung die „Lößnitzbahn“ nach Kötzschenbroda<br />
<strong>in</strong> 1.000-mm-Spur <strong>in</strong> Betrieb.<br />
<strong>Sie</strong> bot am Dreysigplatz <strong>in</strong> Mickten Anschluss<br />
an das Stadtnetz, der Rangierbetrieb<br />
an den nebene<strong>in</strong>ander liegenden Umsetzstellen<br />
im Straßenplanum e<strong>in</strong>schließlich der<br />
Zufahrten zu den Wagenhallen entwickelte<br />
sich schon bald zu e<strong>in</strong>em H<strong>in</strong>dernis für die<br />
übrigen Verkehrsteilnehmer. Beseitigt wurde<br />
es zusammen mit e<strong>in</strong>er 1931 abgeschlossenen<br />
Streckenverlängerung nach We<strong>in</strong>böhla<br />
erst durch die Umspurung auf das<br />
Stadtspur-Maß, was e<strong>in</strong>e Durchb<strong>in</strong>dung der<br />
Stadtl<strong>in</strong>ien ermöglichte.<br />
Privat und staatlich <strong>in</strong>s Umland<br />
Mit der „Dresdner Vorortbahn“ Laubegast<br />
– Leuben – Niedersedlitz g<strong>in</strong>g auf Initiative<br />
des Industriellen Oskar Ludwig Kummer<br />
Ende Dezember 1899 e<strong>in</strong>e weitere Meterspurbahn<br />
<strong>in</strong> Betrieb. Nach dessen Firmenkonkurs<br />
übernahm die Kommune Leuben<br />
1902 se<strong>in</strong>e Bahn. Im Herbst 1906 konnte<br />
von Niedersedlitz die Streckenverlängerung<br />
nach Kle<strong>in</strong>zschachwitz realisiert werden,<br />
während der geplante „R<strong>in</strong>gschluss“ entlang<br />
der Elbe nach Laubegast nicht mehr zustande<br />
kam. Nachdem 1921 die Städtische <strong>Straßenbahn</strong><br />
die Strecke übernahm, folgte<br />
1924/25 die Umspurung auf 1.450 mm, der<br />
Ast nach Kle<strong>in</strong>zschachwitz wurde 1932 stillgelegt.<br />
Südwärts wuchs das Netz 1902 unter<br />
staatlicher Hand um knapp sechs Kilometer<br />
<strong>in</strong> Stadtspur nach Deuben, wo auch<br />
e<strong>in</strong> <strong>Straßenbahn</strong>hof entstand. Vier Jahre später<br />
folgte die erste Verlängerung nach Ha<strong>in</strong>sberg<br />
sowie 1935 bis auf Höhe des Haltepunktes<br />
Coßmannsdorf, wo bequem zur<br />
Weißeritztalbahn umgestiegen werden konnte.<br />
Ab 1903 fuhr die <strong>Straßenbahn</strong> von Loschwitz<br />
am Elbufer entlang weiter <strong>in</strong> das für<br />
se<strong>in</strong> Schloss bekannte Örtchen Pillnitz, hier<br />
hatten die Anliegerkommunen das bereits<br />
1897 von Kummer zunächst als Meterspurbahn<br />
begonnene Projekt <strong>in</strong> Stadtspur zu<br />
Ende geführt.<br />
Zur besseren Orientierung im wachsenden<br />
Streckennetz wurden 1904 L<strong>in</strong>iennummern<br />
e<strong>in</strong>geführt. Während von der<br />
„Dresdner <strong>Straßenbahn</strong>gesellschaft“ die ungeraden<br />
Nummern belegt wurden, erhielten<br />
die L<strong>in</strong>ien der „Deutschen <strong>Straßenbahn</strong>gesellschaft<br />
<strong>in</strong> <strong>Dresden</strong>“ die geraden Zahlen<br />
zugewiesen. Richtung Westen g<strong>in</strong>g 1906 die<br />
mit e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en Depot <strong>in</strong> Gohlis ausgestattete<br />
Außenbahn nach Cossebaude sowie<br />
nach Südosten die meterspurige „Lockwitztalbahn“<br />
Niedersedlitz – Kreischa <strong>in</strong> Betrieb.<br />
Vere<strong>in</strong>igung zum Kommunalbetrieb<br />
Im gleichen Jahr führten zunehmende Streitigkeiten<br />
zwischen den konkurrierenden<br />
<strong>Straßenbahn</strong>gesellschaften zur Übertragung<br />
der „Roten“ und „Gelben“ <strong>in</strong> die neue, kommunale<br />
„Städtische <strong>Straßenbahn</strong> zu <strong>Dresden</strong>“.<br />
Für knapp 47 Mio. Mark wechselten<br />
800 <strong>Straßenbahn</strong>wagen sowie die Infra-<br />
52 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
<strong>Dresden</strong><br />
Daten & Fakten DVB AG<br />
Dresdner Verkehrsbetriebe AG – www.dvb.de<br />
Netz<br />
Spurweite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450 mm<br />
Netzlänge (Strab) . . . . . . . . . . . . . . . . 134,2 km<br />
L<strong>in</strong>ien (Strab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
L<strong>in</strong>ienlänge (Strab) . . . . . . . . . . . . . . . 209,1 km<br />
Leistung<br />
Fahrgäste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,7 Mio.<br />
Kostendeckungsgrad. . . . . . . . . . . . . . . . 78,1 %<br />
Mitarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.731<br />
darunter Fahrpersonal . . . . . . . . . . . . . . . . . 883<br />
Fahrzeuge<br />
Niederflurtriebwagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166<br />
Tatratriebwagen. . . . . . . . . . ca. 30 (z. T. abgest.)<br />
Sonder-/Arbeitswagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
Historische Wagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
Stand 2011<br />
„Kle<strong>in</strong>er Hecht“ Tw 1813 am 13. Oktober 1969 unterwegs am „Goldenen Reiter“ am Neustädter<br />
Markt J. RICHTER (2)<br />
struktur – ohne die staatlichen Außenstrecken<br />
– <strong>in</strong> das Eigentum der Stadt. Nachdem<br />
1908 erstmalig die <strong>Straßenbahn</strong> im Nordosten<br />
über Bühlau bis nach Weißig fuhr, gab<br />
es 1909 e<strong>in</strong>e große Netzreform, bei der die<br />
L<strong>in</strong>ienanzahl durch Bildung von das Zentrum<br />
querenden Durchmesserl<strong>in</strong>ien von 26<br />
auf 18 reduziert werden konnte. Für die e<strong>in</strong>setzende<br />
Modernisierung des Wagenparks<br />
waren leistungsstärkere Motoren, Verglasung<br />
der Perrons und Vere<strong>in</strong>heitlichung der<br />
Fahrzeugtypen charakteristisch. Aus jener<br />
Zeit s<strong>in</strong>d Tw 598, Bw 87 (beide Bj. 1911)<br />
und Bw 307 (Bj. 1912) im SMD sowie der<br />
1911 gebaute Tw 818 <strong>in</strong> Liberec (Reichenberg)<br />
erhalten.<br />
Erster Weltkrieg und<br />
Goldene Zwanziger<br />
Im Ersten Weltkrieg behalf man sich zur<br />
Absicherung des Betriebes aufgrund der E<strong>in</strong>berufung<br />
vieler Stammpersonale zum Militärdienst<br />
damit, Schaffner<strong>in</strong>nen bei der <strong>Straßenbahn</strong><br />
e<strong>in</strong>zustellen, was sich im Zweiten<br />
Weltkrieg wiederholte.<br />
Die wirtschaftliche Lage der frühen<br />
1920er-Jahre mit ständig steigender Inflation<br />
bed<strong>in</strong>gte auch <strong>in</strong> <strong>Dresden</strong> L<strong>in</strong>iene<strong>in</strong>stellungen<br />
und Personalabbau. Die Epoche der<br />
<strong>in</strong> jenen Jahren – teils als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme<br />
<strong>in</strong> Kooperation mit ortsansässigen<br />
Firmen – <strong>in</strong> großer Zahl mit<br />
MAN-Fahrgestellen beschafften Züge vertritt<br />
im SMD der Tw 1644 (Busch Bautzen<br />
1925) mit Bw 1135 (Bj. 1918). E<strong>in</strong> besonderes<br />
Kuriosum stellen zehn noch 1927<br />
nachgebaute, kle<strong>in</strong>e dreifenstrige Bergstrecken-Tw<br />
dar, von denen Wagen 937’’ seit<br />
1972 historisches Fahrzeug ist und zum<br />
SMD-Bestand zählt. Den Abschluss der Beiwagenbeschaffungen<br />
zwischen den Weltkriegen<br />
bildeten 25 „Stahlbeiwagen“ von<br />
1929/30, die vorzugsweise im Verband mit<br />
An den meisten Endpunkten musste rangiert werden, hier hat Tw 645 am 21. August 1969 <strong>in</strong><br />
Cossebaude bereits umgesetzt<br />
Am 20. September 2009 führten Nahverkehrsfreunde e<strong>in</strong>e Fotosonderfahrt mit dem Großraumzug<br />
durch<br />
R. GLEMBOTZKY<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
53
Titel<br />
E<strong>in</strong> von Tw 213 113 angeführter Gotha-Dreiwagenzug hat auf se<strong>in</strong>er<br />
Fahrt Richtung Schlachthof am 1. August 1972 den Fucikplatz erreicht.<br />
Nach e<strong>in</strong>er 1976 im Raw Berl<strong>in</strong>-Schöneweide durchgeführten<br />
Generalreparatur stand er als Tw 213 214 bis zum E<strong>in</strong>satzende der<br />
Zweiachser <strong>in</strong> <strong>Dresden</strong> im Dienst<br />
J. RICHTER<br />
E<strong>in</strong>e Dresdner Spezialität waren die T4D-„Anderthalbrichter“ 222 801, 802, 805 und 806 mit<br />
beidseitigen Türen, aber nur e<strong>in</strong>em Fahrerstand für Wendezugverkehre. Hier als klassischer Großzug<br />
gekuppelt am Carolaplatz um 1991<br />
A. GÜNTHER<br />
den kurz darauf gelieferten „Großen Hechtwagen“<br />
fuhren und von denen im SMD der<br />
Bw 1314 (Bj. 1929) erhalten ist.<br />
Die DRÜVEG<br />
Die bislang unter staatlicher Verwaltung stehenden<br />
Außenstrecken nach Cossebaude,<br />
Freital, Hellerau, Klotzsche, Kötzschenbroda<br />
und Weißig sowie die kommunale Bahn<br />
nach Pillnitz wurden 1926 <strong>in</strong> der Dresdner<br />
Überland-Verkehrsgesellschaft (DRÜVEG)<br />
zusammengefasst, <strong>in</strong> der 1929 auch die<br />
durch das Lockwitztal führende L<strong>in</strong>ie nach<br />
Kreischa aufg<strong>in</strong>g. Von den beiden kurz zuvor<br />
für die Lockwitztalbahn beschafften Lenkachs-Tw<br />
existiert heute noch Tw 9 (Bj.<br />
1926) bei der Kirnitzschtalbahn als historisches<br />
Fahrzeug im rot/weißen Ursprungslack.<br />
Die von der DRÜVEG <strong>in</strong> jenen Jahren<br />
verfolgten Pläne e<strong>in</strong>es Schnellstraßenbahnnetzes<br />
im Ballungsraum <strong>Dresden</strong> konnten<br />
nie verwirklicht werden. Während die zu diesem<br />
Zweck beschafften Gelenkwagen 2501<br />
54 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
<strong>Dresden</strong><br />
In den „letzten Zügen“<br />
lag der Betrieb der L<strong>in</strong>ie 3<br />
am Rathaus Freital-Potschappel<br />
und damit der<br />
E<strong>in</strong>satz der letzten „Holzwagen“<br />
am 18. Mai 1974<br />
J. RICHTER<br />
und 2502 längst verschrottet s<strong>in</strong>d, zeugt die<br />
Trassierung auf eigenem Bahnkörper im Bereich<br />
Coswig/We<strong>in</strong>böhla noch heute von den<br />
e<strong>in</strong>stigen Visionen.<br />
Der »Große Hecht« kommt<br />
Ab Jahresanfang 1930 firmierte der städtische<br />
Verkehrsbetrieb als „Dresdner <strong>Straßenbahn</strong><br />
AG“, wobei das Grundkapital von öffentlicher<br />
Hand gehalten wurde. Den<br />
Höhepunkt der Fahrzeugentwicklung markierte<br />
der noch im Gründungsjahr der AG<br />
vorgestellte „Große Hecht“, der mit se<strong>in</strong>er<br />
auffällig spitz zulaufenden Wagenkastenform,<br />
wegklappbarem Führerstand, Sitzplatz<br />
für den Fahrer und druckknopfbetätigtem<br />
Schaltwerk neue Maßstäbe setzte. Vorhanden<br />
s<strong>in</strong>d von diesem bekanntesten Dresdner<br />
Wagentyp heute noch Tw 1702 (Bj. 1931) als<br />
e<strong>in</strong>er der beiden Prototypen im Bestand des<br />
VMD sowie Tw 1716’’ (ex 1722, Bj. 1931)<br />
im SMD. Ausgestattet mit e<strong>in</strong>er sehr ähnlichen<br />
Kopfform, jedoch <strong>in</strong> der Zweiachser-<br />
Ausführung folgten ab 1934 als letzte Vorkriegsbeschaffung<br />
die „Kle<strong>in</strong>en Hechte“, von<br />
denen das SMD mit Tw 1820’’ (ex Tw 1844,<br />
Bj. 1938) e<strong>in</strong> derzeit sogar betriebsfähiges<br />
Exemplar besitzt. Um den Fahrgästen den<br />
E<strong>in</strong>stieg zu erleichtern und e<strong>in</strong> ausgewogeneres<br />
Bild im Verband mit den niedrigen<br />
„Kle<strong>in</strong>en Hechten“ zu erzielen, entstanden<br />
ab 1937 durch Konstruktionsänderungen am<br />
Fahrgestell von Standardbeiwagen sogenannte<br />
„Schwebeachsbeiwagen“, von denen<br />
sich der im SMD erhaltene Bw 1219 (Bj.<br />
1925) <strong>in</strong> Aufarbeitung bef<strong>in</strong>det.<br />
Der Zweite Weltkrieg<br />
Mit Kriegsausbruch 1939 wurde als Ausgleich<br />
für von der Wehrmacht e<strong>in</strong>gezogene<br />
Kraftfahrzeuge der Güter- und Marktverkehr<br />
ausgeweitet und für diesen Zweck ältere Personenwagen<br />
adaptiert. Abgesehen von vernachlässigter<br />
Instandhaltung und Unfällen,<br />
die sich bei Dunkelheit aus mangelnder Streckensicht<br />
<strong>in</strong>folge der Luftschutz-Verdunkelung<br />
ereigneten, blieb <strong>Dresden</strong> mit se<strong>in</strong>er<br />
<strong>Straßenbahn</strong> bis Oktober 1944 von unmittelbaren<br />
Kriegse<strong>in</strong>wirkungen gänzlich verschont.<br />
Umso heftiger erfolgten die gegen die<br />
Stadt gerichteten Luftangriffe am 13./14. Februar<br />
1945, bei denen die gesamte Altstadt <strong>in</strong><br />
Schutt und Asche fiel und die etwa 25.000<br />
Menschenleben forderten. E<strong>in</strong> Folgeangriff<br />
im April 1945 traf neben Anlagen der Industrie<br />
und Reichsbahn den <strong>Straßenbahn</strong>hof<br />
Waltherstraße schwer. Als Ergebnis des Krieges<br />
mussten die Verkehrsbetriebe nicht nur<br />
zahlreiche Mitarbeiter als Kriegsopfer beklagen,<br />
auch etwa 190 Wagen verschwanden<br />
als Kriegsverlust aus den Bestandslisten.<br />
Der Materialmangel der Nachkriegszeit<br />
führte <strong>in</strong> der Folge zu e<strong>in</strong>em ständigen Fahrzeugengpass<br />
und zum Abbau sogar von nach<br />
dem Krieg zunächst reparierten Gleisen. Im<br />
Zentrum – nun ohneh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e großflächige<br />
Trümmerwüste – wurde der <strong>Straßenbahn</strong>verkehr<br />
auf nur noch e<strong>in</strong>e Ost-West- und<br />
e<strong>in</strong>e Nord-Süd-Achse gebündelt. Zehn 1947<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
55
Titel<br />
Lange Jahre „typisch <strong>Dresden</strong>“: Elbe, Platte und Tatra. Hier ist am 19. Mai 2005 die „Platte“ bereits<br />
auf dem Rückzug und wird abgebaut. Der Großzug aber bleibt im <strong>Straßenbahn</strong>museum erhalten<br />
Betriebshöfe der <strong>Straßenbahn</strong><br />
<strong>in</strong> Betrieb Besonderheit<br />
Blasewitz 1872–1936 später Obushof<br />
Bühlau 1898–2003<br />
Bünaustraße 1882–1900 nur Pferdebahn<br />
Coswig 1929–2006 Gleisschleife <strong>in</strong><br />
Betrieb<br />
Flora 1890–1898 nur Pferdebahn<br />
Freital-Deuben 1902–1974 auch 1.000-mm<br />
Friedrichstraße 1890–1926<br />
Geis<strong>in</strong>gstraße 1998–1926<br />
Gohlis 1906–1966<br />
Gorbitz seit 1996<br />
Hertelstraße 1893–1894<br />
Klotzsche 1911–1994<br />
Kle<strong>in</strong>zschachwitz<br />
1924–1932 1.000-mm-Spur<br />
Kreischa 1906–1977 1.000-mm-Spur<br />
Leuben 1903–1928 1.000-mm-Spur<br />
bis 1924<br />
Mickten 1897–1992 auch 1.000-mm<br />
Naußlitz 1900–1996<br />
Pfotenhauerstraße<br />
1894–1997<br />
Pieschen 1882– (o. A.) nur Pferdebahn<br />
Plauen 1873–1900 nur Pferdebahn<br />
Reick seit 1914<br />
Tolkewitz 1899–2007 noch Abstellhalle<br />
Trachenberge seit 1891<br />
Waltherstr. seit 1926 nur noch Arbeitswagen<br />
Wiesenthorstr. 1881–1900 nur Pferdebahn<br />
Auf vielen L<strong>in</strong>ien lange typisch: „Tatra-M<strong>in</strong>i“, hier 224 245 mit 272 317 auf L<strong>in</strong>ie 18 am Fetscherplatz,<br />
1. März 1986<br />
B. LANGER<br />
gelieferte „Werdauer Beiwagen“ entspannten<br />
den Fahrzeugmangel nur wenig, acht dieser<br />
Wagen kamen nach Umspurung 1970/71<br />
zur Lockwitztalbahn.<br />
Neuanfang unter Besatzungsmacht<br />
Im Zuge der von der Besatzungsmacht <strong>in</strong>itiierten<br />
gesellschaftlichen Neustrukturierung<br />
der Nachkriegszeit gehörten die Verkehrsbetriebe<br />
zum KWU – Kommunalwirtschaftsunternehmen<br />
– der Stadt <strong>Dresden</strong>, ab 1951<br />
firmierten sie als VEB (K) Verkehrsbetriebe<br />
der Stadt <strong>Dresden</strong>. Im Gründungsjahr des<br />
„VEB“ konnten zur L<strong>in</strong>derung des bestehenden<br />
Mangels an rollendem Material erstmals<br />
nach dem Krieg neue Triebwagen <strong>in</strong> Betrieb<br />
genommen werden, wobei es sich um<br />
vier Tw vom LOWA-Typ ET50 – ergänzt um<br />
zehn Beiwagen vom Typ EB50 – handelte.<br />
Außerhalb des zwischenzeitlich standardisierten<br />
Typenprogramms im <strong>Straßenbahn</strong>bau<br />
der DDR konnten 1954 nochmals zwei „Gro-<br />
56 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
<strong>Dresden</strong><br />
RECHTS Die letzte klassische hölzerne Wagenhalle<br />
stand <strong>in</strong> Reick, wo sich am 15. Juli 2006<br />
vier Tatrazüge <strong>in</strong> der Morgensonne wärmen<br />
ße Hechtwagen“ als Nachbauten vom Waggonbau<br />
Görlitz erworben werden, weitere<br />
Zweiachser aus Gotha – LOWA-ET/EB54<br />
und Gotha-T/B57ff. – verjüngten bis Anfang<br />
der 1960er-Jahre den Bestand. Diese DDR-<br />
E<strong>in</strong>heitstypen s<strong>in</strong>d noch mit zwei Exemplaren<br />
als Tw 201 011 (ex Tw 1584’’’, ex KMSt.<br />
Tw 801, Bj. 1959) und Tw 201 113 (ex<br />
1567’’’, ex 1585’’, Bj. 1959) im aktiven DVB-<br />
Arbeitswagenpark und darüber h<strong>in</strong>aus im<br />
SMD <strong>in</strong> verhältnismäßig großer Zahl vertreten:<br />
E<strong>in</strong> für E<strong>in</strong>richtungsbetrieb umgerüsteter<br />
LOWA-Zug aus Tw 1538’’ (ex Tw 1567’’)<br />
mit Bw 1361 und 1362 (alle Bj. 1956), e<strong>in</strong><br />
Gotha-Zweirichtungszug aus Tw 1587 (ex<br />
KMSt. Tw 804) und Bw 1413 (beide Bj.<br />
1959) sowie e<strong>in</strong> Gotha-E<strong>in</strong>richtungszug aus<br />
Tw 1512 und Bw 1422 (beide Bj. 1960). Ferner<br />
existieren e<strong>in</strong>st <strong>in</strong> <strong>Dresden</strong> e<strong>in</strong>gesetzte<br />
„Gothawagen“ noch <strong>in</strong> Chemnitz, Markkleeberg,<br />
Pirna, Wehm<strong>in</strong>gen und Woltersdorf.<br />
Modernisierung der Veteranen<br />
Parallel zu den Neubeschaffungen aus Gotha<br />
wurden ab 1959 auch verschiedene Modernisierungen<br />
an den aufgrund ihrer großen<br />
Anzahl noch unentbehrlichen MAN-Bauarten<br />
durchgeführt. Neben dem Umbau e<strong>in</strong>es<br />
Teils der MAN-Fahrzeuge zu E<strong>in</strong>richtungswagen,<br />
was vor allem e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>sparung von<br />
Türen samt zugehöriger Mechanik und Fahrschaltern<br />
bewirkte, kamen e<strong>in</strong>fachere Verglasung,<br />
Mittelsche<strong>in</strong>werfer, neue Beleuchtung<br />
und L<strong>in</strong>ien-/Fahrzielanzeiger zum<br />
E<strong>in</strong>bau. In diesem Zustand ist Tw 734’’ (ex<br />
Tw 748, Bj. 1913, mod. 1966) mit Beiwagen<br />
1029 (Bj. 1925, mod. 1966) im SMD zu sehen,<br />
weiterh<strong>in</strong> ist MAN-Tw 765 (ex 1603,<br />
Bj. 1920) noch im Zustand als Arbeitswagen<br />
vorhanden. E<strong>in</strong> 1960 gelieferter Gotha-Gelenkwagen<br />
EGT59 blieb <strong>in</strong> <strong>Dresden</strong> ohne<br />
Nachfolger und wurde nach nur zehn Jahren<br />
verschrottet. E<strong>in</strong>e noch kürzere E<strong>in</strong>satzzeit<br />
an der Elbe verbrachten die 1962–64 ausgelieferten<br />
Gotha-Großraumzüge T4-62/B4-<br />
61, die 1968–70 im Tausch gegen LOWA-<br />
Beiwagen nach Berl<strong>in</strong> abgegeben wurden.<br />
Um <strong>in</strong> der Sammlung des SMD auch diesen<br />
Fahrzeugtyp zu präsentieren, kehrte 1995/96<br />
die Garnitur Tw 1734’’ (Bj. 1962) mit Bw<br />
2015 (Bj. 1963) nach <strong>Dresden</strong> zurück.<br />
Die Schaffner werden abgeschafft<br />
Um der permanent angespannten Personalsituation<br />
entgegenzuwirken, wurde 1956 bis<br />
1958 sukzessive der „Z-Betrieb“ mit schaffnerlosen<br />
Triebwagen e<strong>in</strong>geführt, die nun-<br />
OS – „ohne Schaffner“ trugen die Züge <strong>in</strong> den 1960er-Jahren als Anschrift. Ebenso am 10. Dezember<br />
2006 die Museumswagen <strong>in</strong> Johannstadt<br />
RECHTS Tatra-T4-Nachfolger T6A2 226 001 am<br />
30. September 2012 als Museumswagen im<br />
E<strong>in</strong>satz<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
57
We<strong>in</strong>böhla<br />
4<br />
Titel<br />
Weixdorf<br />
7<br />
Coswig<br />
Lößnitzgrundbahn na Radeburg<br />
4<br />
Radebeul West<br />
Hellerau<br />
8<br />
Klotzse<br />
Topografischer<br />
Netzplan der<br />
Dresdner <strong>Straßenbahn</strong><br />
(Stand 2012)<br />
ohne Berücksich -<br />
tigung der Güter -<br />
anschlüsse<br />
ZEICHNUNG: M. SPERL<br />
Legende<br />
1<br />
<strong>Straßenbahn</strong>strecke 2-gleisig<br />
<strong>Straßenbahn</strong>strecke 1-gleisig<br />
L<strong>in</strong>iennummer (Stand 2012)<br />
<strong>Straßenbahn</strong>strecke stillgelegt<br />
<strong>Straßenbahn</strong>strecke 1.000-mm-Spur<br />
Endpunkt mit Wendeschleife<br />
<strong>in</strong> Betrieb / stillgelegt<br />
<strong>Straßenbahn</strong>-Betriebshof <strong>in</strong> Betrieb<br />
<strong>Straßenbahn</strong>-Betriebshof stillgelegt<br />
Bergbahnen<br />
normalspurige Eisenbahn<br />
schmalspurige Eisenbahn<br />
Cossebaude<br />
Pennri<br />
7<br />
Gorbitz<br />
2 6<br />
Leutewitz<br />
1 12<br />
Wölfnitz<br />
na Ha<strong>in</strong>sberg<br />
Kaditz<br />
9 13<br />
Übigau<br />
Cotta<br />
6<br />
Radebeul Ost<br />
3<br />
3<br />
Cosütz<br />
13<br />
Messe<br />
Miten<br />
10<br />
Wilder Mann<br />
Bf.<br />
Mitte<br />
1<br />
Südvorstadt<br />
8<br />
Plauen<br />
Ränitz<br />
11<br />
Zsertnitz<br />
Blasewitz<br />
Industriegelände<br />
St.-Pauli-Friedhof<br />
Hetstraße<br />
Bf. Neustadt<br />
Großer<br />
Garten<br />
Grenadierkaserne<br />
Johannstadt<br />
Leubnitz-Neuostra<br />
Prohlis<br />
1 9 13<br />
Rei<br />
Dresdner<br />
Heide<br />
Standseilbahn<br />
10 12<br />
12<br />
Tolkewitz<br />
n. Kreisa<br />
Swebebahn<br />
Loswitz<br />
4<br />
Laubegast<br />
Bühlau<br />
11<br />
Kle<strong>in</strong>zsawitz<br />
6<br />
Niedersedlitz<br />
2<br />
Weißig<br />
Pillnitz<br />
Auch Kipplore 3207 gehört zum Museumsbestand.<br />
Am 4. März 2007 war sie gezogen von<br />
Atw 201 113 unterwegs<br />
mehr nur von Zeitkarten<strong>in</strong>habern benutzt<br />
werden durften. Als weiterer Schritt zur Personale<strong>in</strong>sparung<br />
folgte 1959 der „ZZ-Betrieb“,<br />
bei dem nur noch im letzten Wagen<br />
e<strong>in</strong> Schaffner mitfuhr, <strong>in</strong> Dreiwagenzügen<br />
also die vorderen beiden Wagen den Zeitkartennutzern<br />
vorbehalten waren. Wenig<br />
später wurde ab 1962 zunächst bei Solowagen<br />
im Nachtverkehr gänzlich auf Schaffner<br />
verzichtet – dieser „OS“-Betrieb wurde bald<br />
auf den Tagesverkehr ausgedehnt. Zuletzt<br />
fuhren Schaffner lediglich aus Sicherheitsgründen<br />
noch als Zugbegleiter auf den Beiwagen<br />
der Hechtwagenzüge bis zu deren<br />
E<strong>in</strong>satzende, danach war <strong>Dresden</strong> „schaffnerfrei“.<br />
Schleifenfahrt statt umkuppeln<br />
Während bisher – von Versuchen mit dem<br />
„Kle<strong>in</strong>en Hecht“-Prototyp 1801 abgesehen<br />
– ausschließlich Zweirichtungswagen auf<br />
dem Dresdner Netz verkehrten, begann 1960<br />
mit Inbetriebnahme der „Gothaer“<br />
T59E/B59E das Zeitalter der E<strong>in</strong>richtungszüge.<br />
Neben der angestrebten Arbeitserleichterung<br />
für das Betriebspersonal durch<br />
Wegfall der Rangiertätigkeit machte vor allem<br />
die Zunahme des Bestandes dieser E<strong>in</strong>richtungswagen<br />
den Ersatz der oftmals noch<br />
vorhandenen Kuppelendstellen durch Gleisschleifen<br />
notwendig. Während an e<strong>in</strong>em Teil<br />
der Endpunkte bisher schon z.B. durch<br />
Blockumfahrungen bequem gewendet werden<br />
konnte, musste andernorts noch aufwändig<br />
umgesetzt werden. Zwischen 1950<br />
und 1971 wurden die neuen Schleifen<br />
Radebeul Ost, Wölfnitz, We<strong>in</strong>böhla, Weixdorf,<br />
Ha<strong>in</strong>sberg (Coßmannsdorf), Übigau,<br />
Pillnitz, Industriegelände, Hellerau und Coschütz<br />
eröffnet, womit das Stadtnetz abgesehen<br />
von den Streckenästen nach Leubnitz-<br />
Neuostra und Cossebaude komplett für den<br />
E<strong>in</strong>satz der E<strong>in</strong>richtungswagen ertüchtigt<br />
war. Dies ermöglichte nun auch den Umbau<br />
e<strong>in</strong>er größeren Zahl von MAN- und LOWA-<br />
Wagen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungszüge und war Grundvoraussetzung<br />
für künftige Fahrzeugbeschaffungen<br />
aus dem Hause CKD.<br />
Tatras <strong>in</strong> Großserie<br />
Da <strong>Dresden</strong> aufgrund se<strong>in</strong>er räumlichen<br />
Nähe zum Tatrawagen-Hersteller und dank<br />
se<strong>in</strong>es teils steigungs- und bogenreichen Netzes<br />
e<strong>in</strong> geeignetes „Erprobungsfeld“ dar-<br />
58 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
<strong>Dresden</strong><br />
Silvester 2002: Die letzten<br />
E<strong>in</strong>sätze der Tatras 224 530<br />
und 527 im Fahrgastverkehr.<br />
Beide bilden als<br />
201 009 und 008 seither<br />
e<strong>in</strong>en W<strong>in</strong>terdienstzug<br />
Dresdner <strong>Straßenbahn</strong>-Güterverkehr e<strong>in</strong>st und heute: Güterzug für Getreidetransport der Bienertmühle 3011 + 3311 auf der Pfotenhauer straße<br />
1954 und CargoTram für den Teiletransport zur VW-Fabrik auf der Grunaer Straße Ende 2003 BILD LINKS: SAMMLUNG M. SCHATZ<br />
stellte, wurde die Leitung für die E<strong>in</strong>führung<br />
der Tatras <strong>in</strong>nerhalb der DDR übernommen.<br />
Zunächst gab es ab Dezember 1964 e<strong>in</strong>en<br />
fünfmonatigen Praxistest mit den von den<br />
Prager Verkehrsbetrieben ausgeliehenen Tatra-T3<br />
Nr. 6401, 6402 und 6405, die mit 2,5<br />
m Wagenkastenbreite jedoch für e<strong>in</strong>en freizügigen<br />
E<strong>in</strong>satz im Streckennetz zu breit waren.<br />
Auf Grundlage e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen<br />
Pflichtenheftes der DDR-Betriebe entwickelte<br />
CKD nun den T4D mit e<strong>in</strong>er schmaleren<br />
Wagenkastenbreite von nur 2,20 m. Der Prototyp<br />
Nr. 2000 fuhr am 14. September 1967<br />
erstmalig im L<strong>in</strong>iendienst und wurde <strong>in</strong> der<br />
Folgezeit zahlreichen Tests unterzogen. Er bef<strong>in</strong>det<br />
sich heute zusammen mit T4D 222 998<br />
(ex Tw 1998, Bj. 1968) und Beiwagen B4D<br />
272 105 (Bj. 1971) im Bestand des SMD.<br />
Sechs der 1968/69 gelieferten T4D der ersten<br />
Serie eröffneten am 17. Februar 1969<br />
jeweils als Doppeltraktion gekuppelt den<br />
Tatra-L<strong>in</strong>ienbetrieb zwischen Wölfnitz und<br />
Industriegelände, ab 1970 g<strong>in</strong>gen auch die<br />
zugehörigen Beiwagen B4D <strong>in</strong> Betrieb. Für<br />
den Tatrae<strong>in</strong>satz mussten zuvor jeweils <strong>in</strong>frastrukturelle<br />
Voraussetzungen h<strong>in</strong>sichtlich<br />
Verstärkung der Bahnstromversorgung und<br />
des Oberbaus geschaffen werden. Mit <strong>in</strong>sgesamt<br />
821 bis 1984 nach <strong>Dresden</strong> gelieferten<br />
Wagen des Typs T4D/B4D sollten die „Tatras“<br />
das Bild der Verkehrsbetriebe <strong>in</strong> <strong>Dresden</strong><br />
für die nächsten vier Jahrzehnte wesentlich<br />
bestimmen.<br />
Abschied vom Zweiachser<br />
Schnell verdrängten nun die neuen Fahrzeuge,<br />
die als „Großzug“ im Verband aus zwei<br />
Trieb- und e<strong>in</strong>em Beiwagen knapp 300 Personen<br />
befördern konnten, bis Herbst 1972<br />
die letzten „Hechte“ und bis Anfang 1975<br />
auch die übrigen Vorkriegswagen aus dem<br />
L<strong>in</strong>ienverkehr. Die letzte Domäne der MAN-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
59
Titel<br />
Heute Standard: Niederflur auch auf der<br />
Überlandbahn L<strong>in</strong>ie 4, am 4. Februar 2003 ist<br />
Tw 2541 vor den Radebeuler We<strong>in</strong>bergen<br />
auf dem Weg nach We<strong>in</strong>böhla<br />
Züge war die bis 26. Mai 1974 zwischen Wilder<br />
Mann und Freital-Coßmannsdorf betriebene<br />
L<strong>in</strong>ie 3, nach E<strong>in</strong>stellung der Strecke<br />
durch den Plauenschen Grund kamen<br />
vere<strong>in</strong>zelt noch Züge auf der L<strong>in</strong>ie 9 oder<br />
als E-Wagen zum E<strong>in</strong>satz. Mit Stilllegung des<br />
Streckenastes nach Leubnitz-Neuostra am<br />
15. Dezember des gleichen Jahres verblieb als<br />
letzte Kuppelendstelle im Stadtspurnetz jene<br />
<strong>in</strong> Cossebaude. Drei Jahre später hatte am<br />
18. Dezember 1977 als letzte Meterspurbahn<br />
im E<strong>in</strong>zugsbereich der Verkehrsbetriebe der<br />
Stadt <strong>Dresden</strong> die <strong>in</strong>zwischen als L<strong>in</strong>ie 31 bezeichnete<br />
Lockwitztalbahn ausgedient, an die<br />
im SMD das Schaustück Tw 854 (Bj. 1942,<br />
ex Erfurt 107) er<strong>in</strong>nert. Nachdem am 9. April<br />
1984 der für Tatras gesperrte und daher noch<br />
komplett mit LOWA/Gotha-Zügen betriebene<br />
Pillnitzer Streckenast außer Betrieb g<strong>in</strong>g,<br />
verr<strong>in</strong>gerte sich der Zweiachserbestand auf<br />
die zur Betriebsabwicklung der L<strong>in</strong>ie 1 Cossebaude<br />
– Postplatz noch zw<strong>in</strong>gend benötigten<br />
Wagen. Mit E<strong>in</strong>stellung dieser Strecke am<br />
2. Dezember 1990 war der Gothawagene<strong>in</strong>satz<br />
bis auf fünf zunächst noch vorgehaltene<br />
Reservezüge beendet.<br />
Neben den vollzogenen Stilllegungen wenig<br />
rentabler Strecken gab es auch e<strong>in</strong>ige<br />
Netzerweiterungen, <strong>in</strong>sbesondere um die <strong>in</strong><br />
der Peripherie neu entstandenen Platten -<br />
bausiedlungen mit e<strong>in</strong>em leistungsstarken<br />
Verkehrsmittel erschließen zu können. So<br />
wurden 1976 die Neubauabschnitte nach<br />
Zschertnitz, 1980/81 nach Prohlis, 1983 zwischen<br />
Cotta und Wölfnitz (Wohngebiet Gorbitz)<br />
und zwischen 1984 und 1988 nach<br />
Gorbitz eröffnet.<br />
Für die letztgenannte, etappenweise e<strong>in</strong>geweihte<br />
Trasse wurden eigens acht Tatrawagen<br />
aufwendig für den „Wendezugverkehr“<br />
mit beidseitigen Türen ausgestattet.<br />
Weiterh<strong>in</strong> erfolgte 1971 die Inbetriebnahme<br />
der über die heutige Carolabrücke führenden<br />
„Nord-Süd-Verb<strong>in</strong>dung“ sowie 1977 der Lückenschluss<br />
zwischen Antonstraße und dem<br />
heutigen Carolaplatz.<br />
Tatra modern …<br />
Die Anfang 1986 vorgestellte, kantige Tatra-Nachfolgeserie<br />
T6A2/B6A2 konnte sich<br />
<strong>in</strong> <strong>Dresden</strong> nicht durchsetzen, dem Prototypzug<br />
folgte lediglich e<strong>in</strong> Nullseriengroßzug.<br />
E<strong>in</strong>e Serienbeschaffung erübrigte sich<br />
mit den geänderten Vorstellungen an das<br />
Verkehrsmittel <strong>Straßenbahn</strong> nach der deutschen<br />
Wiedervere<strong>in</strong>igung – Serienzüge dieses<br />
Typs erhielten noch bis 1991 Berl<strong>in</strong>, Leipzig,<br />
Magdeburg und Rostock. Für die<br />
Stadtrundfahrt fand ab 1990 der Prototypzug<br />
Verwendung, der erstgelieferte Wagen<br />
226 001 (Bj. 1985) konnte anschließend<br />
durch das SMD als e<strong>in</strong>er der weltweit jüngsten<br />
Museumswagen übernommen werden.<br />
… und modernisiert<br />
Mit den neuen technischen Möglichkeiten<br />
nach der Wiedervere<strong>in</strong>igung wurde <strong>in</strong> <strong>Dresden</strong><br />
e<strong>in</strong> umfangreiches Modernisierungsprogramm<br />
aufgelegt, um Wirtschaftlichkeit<br />
und Komfort der kurzfristig nicht verzichtbaren<br />
Tatra-Flotte zu verbessern. Nach e<strong>in</strong>em<br />
Prototyp-Umbau bei 222 557 durchliefen<br />
ab 1992 <strong>in</strong>sgesamt 180 Trieb- und 65<br />
Beiwagen die Serienmodernisierung, wobei<br />
<strong>in</strong> 55 sogenannten „Triebbeiwagen“ die Fahrerkab<strong>in</strong>e<br />
gänzlich entfiel. Nachdem 2005<br />
die letzten Beiwagen abgestellt wurden und<br />
damit die 1872 begonnene Epoche der an-<br />
60 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
<strong>Dresden</strong><br />
triebslosen Wagen endete, steht zum<strong>in</strong>dest<br />
e<strong>in</strong> Teil der modernisierten Triebwagen bis<br />
heute im Verstärkerverkehr im E<strong>in</strong>satz.<br />
Stadtbahn für <strong>Dresden</strong><br />
Parallel zur Modernisierung ihrer „Tatras“<br />
bemühten sich die Verkehrsbetriebe um die<br />
Beschaffung niederfluriger Fahrzeuge. Nachdem<br />
bereits 1994 der stadtbahnmäßige Ausbau<br />
der „Pilotl<strong>in</strong>ie 2“ begann, <strong>in</strong> deren<br />
Verlauf auf den meisten Streckenabschnitten<br />
e<strong>in</strong> vom Individualverkehr weitgehend<br />
unabhängiger Bahnkörper mit niederflurgerechten<br />
Bahnsteigen entstand, konnte im<br />
Dezember 1995 der erste 30-m-Niederflurgelenktriebwagen<br />
NGT 6 DD präsentiert<br />
werden. Bis 1998 wurden von der E<strong>in</strong>richtungsausführung<br />
47 Wagen beschafft, weitere<br />
13 Stück <strong>in</strong> Zweirichtungsausführung.<br />
Die Lieferung der längeren 42-m-Variante<br />
NGT 8 DD folgte 2001 bis 2002 <strong>in</strong> 23<br />
Exemplaren. E<strong>in</strong>e weitere Beschaffung dieser<br />
Typen unterblieb zugunsten e<strong>in</strong>er<br />
Rückkehr zu Drehgestellfahrzeugen, die <strong>in</strong><br />
den Bauformen NGT D12 DD (45 m) und<br />
NGT D8 DD (30 m) seit 2003 bzw. 2006<br />
mit bislang 43 bzw. 40 Exemplaren auf<br />
Dresdner Gleisen unterwegs s<strong>in</strong>d.<br />
Im Bereich der Infrastruktur wird neben<br />
dem sukzessiven Umbau der Strecken auf e<strong>in</strong>en<br />
größeren Gleismittenabstand der barrierefreie<br />
Ausbau der meisten Haltestellen<br />
etappenweise umgesetzt. Die Orientierung<br />
auf das aktuell laufende „Stadtbahnprogramm<br />
2020“ zeigt sich trotz <strong>in</strong> jüngster Zeit<br />
problematischer werdender f<strong>in</strong>anzieller Förderung<br />
<strong>in</strong> verschiedenen bereits realisierten<br />
bzw. geplanten Bauvorhaben. Die Neubaustrecken<br />
nach Coschütz, Kaditz, Pennrich<br />
und zur Messe lassen gleichwie die aktuell<br />
projektierten L<strong>in</strong>ien z. B. entlang des Unicampus<br />
auch <strong>in</strong> Zukunft e<strong>in</strong>e Ausrichtung<br />
auf die tatsächlichen Bedürfnisse der<br />
Dresdner Bürger erwarten – e<strong>in</strong>e gute Perspektive<br />
für die <strong>Straßenbahn</strong> <strong>in</strong> Elbflorenz.<br />
MICHAEL SPERL<br />
Die „kurzen“ 30-m-Flexity von Bombardier s<strong>in</strong>d mit 40 Wagen <strong>in</strong> <strong>Dresden</strong> vertreten. Am 22. März<br />
2010 hielt Tw 2627 am Pohlandplatz<br />
Die „langen“ 45-m-Flexity repräsentiert Tw 2825 am 11. Juni 2010 auf der Trachenberger Straße,<br />
er zählt zur 32 Stück umfassenden Lieferserie der Jahre 2003 bis 2005<br />
Jubiläum 140 Jahre <strong>Straßenbahn</strong><br />
Am 29. und 30. September feierten über 30.000<br />
Gäste das Jubiläum der Dresdner <strong>Straßenbahn</strong> auf<br />
dem Betriebshof Trachenberge. Neben dem umfangreichen<br />
kulturellen Rahmenprogramm für Groß<br />
und Kle<strong>in</strong> und der „Pferdebahn“ <strong>in</strong> Form des von<br />
Pferden gezogenen Bw 87 waren vor allem die „EM<br />
der <strong>Straßenbahn</strong>fahrer“ und die Modellstraßenbahnausstellung<br />
Anziehungspunkte. Zu Bestaunen<br />
gab es darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong>e Fahrzeugschau mehrerer<br />
historischer und aktueller Züge. Als begehrte Fotoobjekte<br />
pendelten auf der Sonderl<strong>in</strong>ie „140“ u. a.<br />
zwei Tatra-Dreifachtraktionen zwischen Festgelände<br />
und Stadtzentrum, Rundfahrten führten auch<br />
den MAN-Zug mit Tw 734 und den Tatra T6A2 bis<br />
zum Postplatz, e<strong>in</strong> abendlicher Korso aller betriebsfähigen<br />
Museumswagen über den Stadtr<strong>in</strong>g bildete<br />
den Abschluss der Feierlichkeiten.<br />
Stadtbahnprogramm 2020<br />
Die steigende Bevölkerungszahl <strong>Dresden</strong>s wird sich<br />
nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes<br />
Sachsen fortsetzen, bis zu 554.000 E<strong>in</strong>wohner s<strong>in</strong>d für<br />
2025 prognostiziert. Zweck des mit 223 Mio. EUR für<br />
Bau und Planung veranschlagten „Stadtbahnprogramms<br />
2020“ ist vor allem, die hoch frequentierten<br />
Busl<strong>in</strong>ien 61/62 abschnittsweise durch e<strong>in</strong>e Straßenbzw.<br />
Stadtbahn zu ersetzen. Angesichts des städtebaulichen<br />
Entwicklungspotenzials entlang dieser beiden<br />
L<strong>in</strong>ien ist hier von weiterer steigender Nachfrage<br />
auszugehen, die mit Bussen nicht mehr wirtschaftlich<br />
bewältigt werden kann. Das Projekt umfasste<br />
ursprünglich drei Teile: Plauen – Johannstadt,<br />
Löbtau – Südvorstadt – Strehlen sowie Bühlau –<br />
Weißig. Von diesen <strong>in</strong>sgesamt 14,9 km Tram-Neubaustrecken<br />
sollen 10,5 km auf eigenem Bahn körper<br />
verlaufen, für 1,1 km werden Straßen ver kehrsberuhigt<br />
und 1,3 km bestehendes Tramgleis werden<br />
ausgebaut. Für die Bahnstromversorgung s<strong>in</strong>d sieben<br />
neue Unterwerke vorgesehen. Der Bereich Plauen<br />
– Johannstadt ist gegenwärtig nicht mehr im Programm<br />
enthalten, die DVB hoffen jedoch, dass dieses<br />
Projekt dennoch realisiert wird.<br />
MSP<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
61
Geschichte<br />
Netzverlust und Neubau<br />
Hamburgs Nahverkehrssituation vor 50 Jahren Während das Tramnetz schrumpfte, wuchs<br />
das U-Bahnnetz 1961/62 weiter an. Parallel setzte auf der Hochbahn e<strong>in</strong> Generationswechsel e<strong>in</strong>.<br />
Zahlreiche neue Fahrzeuge bestimmten fortan das Bild der Hansestadt<br />
Als <strong>in</strong> der Nacht vom 16. auf den 17.<br />
Februar 1962 der Orkan V<strong>in</strong>c<strong>in</strong>ette<br />
an der Nordseeküste e<strong>in</strong>e schwere<br />
Sturmflut auslöste, wurde die<br />
Hansestadt Hamburg von e<strong>in</strong>er Katastrophe<br />
heimgesucht. Die elbaufwärts strömenden<br />
Wassermassen verursachten zahlreiche<br />
Deichbrüche, der tiefliegende und dicht besiedelte<br />
Stadtteil Wilhelmsburg war davon<br />
besonders betroffen. Insgesamt kamen bei<br />
der Sturmflut 315 Menschen ums Leben,<br />
zahlreiche Hamburger Wohngebiete wurden<br />
überschwemmt und die Verkehrswege unterbrochen.<br />
Neben den L<strong>in</strong>ien des Nahverkehrs war<br />
auch Hamburgs Hauptstrecke <strong>in</strong> den Süden<br />
unterbrochen, so dass die Züge durch den<br />
Freihafen umgeleitet werden mussten. Auch<br />
e<strong>in</strong>ige Bus und <strong>Straßenbahn</strong>l<strong>in</strong>ien mussten für<br />
rund 14 Tage e<strong>in</strong>gestellt werden, die nach<br />
Harburg verkehrende L<strong>in</strong>ie 11 wurde bis zum<br />
Hbf verkürzt und die normalerweise auf der<br />
Veddel endende L<strong>in</strong>ie 14 endete ab dem 17.<br />
Februar <strong>in</strong> Billbrook. Die normalerweise dorth<strong>in</strong><br />
verkehrende L<strong>in</strong>ie 19 wurde vorübergehend<br />
e<strong>in</strong>gestellt. Die Hochbahn nahm die<br />
Strecken dann abschnittsweise wieder <strong>in</strong> Betrieb.<br />
Ab dem 1. März 1962 verkehrten alle<br />
L<strong>in</strong>ien wieder planmäßig. Doch nicht nur<br />
Überschwemmungen sorgten dafür, dass die<br />
Hochbahn, die 1961 noch e<strong>in</strong>en Fahrgastzuwachs<br />
von 1,9 % verzeich net hatte, wieder<br />
rückläufige Verkehrszahlen aufwies. So macht<br />
der Geschäftsbericht aus dem Jahr 1962 für<br />
den Fahrgastrückgang von 1,7 % neben der<br />
Motorisierungsentwicklung auch die 5-Tage-<br />
Woche und das Fernsehen verantwortlich.<br />
Nicht nur die Fahrgastzahlen, auch die Verkehrsleistungen<br />
der <strong>Straßenbahn</strong> g<strong>in</strong>gen immer<br />
mehr zurück. Zahlreiche Fahrgäste nutzten<br />
die Umstellung der <strong>Straßenbahn</strong> auf den<br />
Omnibus zum Umstieg auf den eigenen Pkw.<br />
62 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Hamburg<br />
V6 Triebwagen 3110 <strong>in</strong> der Straße „Beim Schlump“ <strong>in</strong> Richtung Neues Rathaus Altona<br />
Auf dem westlichen Abschnitt der Hallerstraße fuhr die 8 bis zur Endstation auf besonderem<br />
Bahnkörper. Im Vordergrund s<strong>in</strong>d die Gleise der L<strong>in</strong>ie 18 erkennbar<br />
OBEN Der V6-Triebwagen 3110 auf der L<strong>in</strong>ie 8<br />
an der Haltestelle am Schulterblatt <strong>in</strong> Richtung<br />
Altona, wo Übergang auf die L<strong>in</strong>ien 14 und 15<br />
bestand. Am 19. August 1962 endete der Betrieb<br />
auf der L<strong>in</strong>ie 8 K.-H. LINDOW, SLG. VVM (4)<br />
Die Strecke <strong>in</strong> den Freihafen führte zunächst entlang der Zollgrenze (Zaun rechts), bevor sie<br />
durch den Zolldurchlass <strong>in</strong> den Freihafen führte<br />
So schrumpfte das <strong>Straßenbahn</strong>netz <strong>in</strong> den<br />
Jahren 1961 um 11,7 km und 1962 nochmals<br />
um 5,1 km. Gründe für e<strong>in</strong>e Umstellung auf<br />
Busverkehr waren häufig Straßenbauarbeiten,<br />
die <strong>in</strong> diesen Jahren stark zunahmen. So traf<br />
es am 29. Oktober 1961, durch den Ausbau<br />
der Kieler Straße, den Abschnitt Langenfelde<br />
– Eidelstedt der L<strong>in</strong>ie 3. Dazu gehörte auch<br />
der Streckenast nach Stell<strong>in</strong>gen, auf dem noch<br />
an Spieltagen im Volksparkstadion Verstärkungszüge<br />
verkehrten. An diesem Tag endete<br />
ebenfalls der Verkehr auf e<strong>in</strong>em Abschnitt<br />
der L<strong>in</strong>ie 14 zwischen Freihafen und der alten<br />
Landesgrenze, der e<strong>in</strong>e betriebliche Beson-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
63
Geschichte<br />
Hier ist der Tw 3033 auf dem Abschnitt <strong>in</strong> Höhe der ehemaligen Gleisbauwerkstatt unterwegs,<br />
welche bereits zum Lehmweg verlegt wurde K.-H. LINDOW SLG VVM (2)<br />
Der Z2-Zweiachser 2548 steht mit zwei Beiwagen <strong>in</strong> der Schleife am Eidelstedter Platz, bevor<br />
der Endpunkt nach Langenfelde zurückgezogen wurde<br />
HOCHBAHN, SLG. J. PERBANDT<br />
derheit aufwies. Dieser Streckenabschnitt<br />
führte <strong>in</strong> den Hamburger Freihafen und die<br />
<strong>Straßenbahn</strong>züge mussten dazu die Zollgrenze<br />
passieren. Dabei fuhren die Züge beim E<strong>in</strong>fahren<br />
<strong>in</strong> den Freihafen e<strong>in</strong> Tor, welches durch<br />
die Zöllner anschließend wieder regelmäßig<br />
verschlossen wurde. Beim Verlassen des Freihafens<br />
mussten die Passagiere den <strong>Straßenbahn</strong>zug<br />
verlassen und zu Fuß die Zollstelle<br />
passieren, während der Triebwagen nach versteckten<br />
Waren oder Personen überprüft wurde<br />
und dann leer durch die Zollgrenze fuhr.<br />
Mit der E<strong>in</strong>stellung dieses Streckenabschnittes<br />
konnte auf diese aufwendige Prozedur verzichtet<br />
werden.<br />
Interessanterweise waren auf dieser L<strong>in</strong>ie<br />
überwiegend die Hamburger Gelenktriebwagen<br />
vom Typ VG im E<strong>in</strong>satz. Insgesamt<br />
besaß die Hochbahn 30 Serienfahrzeuge,<br />
welche <strong>in</strong> den Jahren 1955–1956 von der<br />
DWM Berl<strong>in</strong> auf alten Zweiachser-Fahrgestellen<br />
gebaut wurden. <strong>Sie</strong> erhielten <strong>in</strong> dieser<br />
Zeit neue Wagennummern und waren ab<br />
1961 als Tw 3800 bis 3829 auf Hamburgs<br />
Gleisen unterwegs. Auch der von der FFG<br />
bis 1954 entwickelte VG-Prototyp war noch<br />
im E<strong>in</strong>satz und erhielt die Nr. 3890.<br />
Das Tramnetz schrumpft weiter<br />
E<strong>in</strong> Jahr später wurde das Hamburger <strong>Straßenbahn</strong>netz<br />
erneut verkle<strong>in</strong>ert. So stellte die<br />
Hochbahn am 19. August die <strong>Straßenbahn</strong>l<strong>in</strong>ie<br />
8 Neues Rathaus Altona – Alsterchaussee<br />
auf Busverkehr um, gleichzeitig verkürzte<br />
man die L<strong>in</strong>ie 15 durch E<strong>in</strong>stellung<br />
des Abschnitts Neues Rathaus Altona – Hohenzollernr<strong>in</strong>g.<br />
Inzwischen betrug die Betriebsgleislänge<br />
der Hamburger <strong>Straßenbahn</strong> Ende 1962 nur<br />
noch 285,1 km, die größte Ausdehnung hatte<br />
das Hamburger <strong>Straßenbahn</strong>netz im Jahr<br />
1938 mit e<strong>in</strong>er Betriebsgleislänge von 413,6<br />
km. Der Netzrückgang bei diesem Verkehrsträger<br />
führte natürlich auch zu e<strong>in</strong>em<br />
Rückgang der Verkehrsleistungen und 1962<br />
wurden erstmalig mehr Wagen-km mit den<br />
Omnibussen der Hochbahn erbracht als mit<br />
den Triebwagen der <strong>Straßenbahn</strong>.<br />
Trotz des <strong>in</strong>sgesamt schrumpfenden <strong>Straßenbahn</strong>netzes<br />
wurden andere Streckenabschnitte<br />
im Rahmen von Straßenneu- bzw.<br />
Ausbauten neu gestaltet. Die alte Kehranlage<br />
am <strong>Sie</strong>vek<strong>in</strong>gsplatz wurde aufgelassen<br />
und anlässlich der Internationalen Gartenbauausstellung<br />
1963 begann die Stadt den<br />
Platz und die dortigen Gleisanlagen umzugestalten.<br />
Auch fanden <strong>in</strong> diesen Jahren die<br />
Arbeiten an der neuen Trasse am Heidenkampsweg<br />
und <strong>in</strong> der Ams<strong>in</strong>gstraße ihren<br />
Abschluss.<br />
Am Klosterwall erhielt diese Strecke mit<br />
dem Ausbau des Wallr<strong>in</strong>gs ebenfalls e<strong>in</strong>en<br />
Der Tw 3054 fährt kurz vor der E<strong>in</strong>stellung <strong>in</strong><br />
die Schleife Eidelstedt e<strong>in</strong><br />
64 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Hamburg<br />
Der Gelenk-Tw VG 3055, noch mit alter Nummer, an der Schleife Hohenzollernr<strong>in</strong>g. Ab 19. August 1962 verkürzte man die L<strong>in</strong>ie 15 bis zum Altonaer<br />
Rathaus, die Busl<strong>in</strong>ie 55 übernahm dort die Verkehrsleistungen<br />
E. VOSS, SLG, VVM<br />
besonderen Bahnkörper und an der Ste<strong>in</strong>straße<br />
bestand sogar direkter Übergang zur<br />
gleichnamigen U-Bahn Haltestelle. Auf dem<br />
jetzt komplett fertiggestellten 7 km langen<br />
Streckenabschnitt, zwischen dem Hovestieg<br />
und der Spald<strong>in</strong>gstraße bzw. der Carl-Petersen<br />
Straße, fuhren die Züge der L<strong>in</strong>ien 11<br />
und 14 jetzt stadtbahnmäßig auf besonderem<br />
Bahnkörper.<br />
Noch Mittel für die <strong>Straßenbahn</strong><br />
Neben diesen umfangreichen Baumaßnahmen<br />
wurden auch kle<strong>in</strong>ere Erneuerungen<br />
durchgeführt, so mussten im Rahmen der Erneuerung<br />
auf der Klappbrücke Harburg-<br />
Nartenstraße neue Gleise e<strong>in</strong>gebaut werden<br />
und vor dem Betriebshof Langenfelde wurde<br />
die Gleislage verändert.<br />
In der von den L<strong>in</strong>ien 1 und 11 befahrenen<br />
Luruper Hauptstraße begann der Tausch der<br />
Gleise zwischen der Bahrenfelder Trabrennbahn<br />
und der Stadionstraße, da diese Strecke<br />
noch e<strong>in</strong>ige Jahre befahren werden sollte.<br />
Durch das stetig kle<strong>in</strong>er werdende <strong>Straßenbahn</strong>netz<br />
konnte die Hochbahn auch auf<br />
zahlreiche ältere Fahrzeuge verzichten. 36<br />
Trieb- und 70 Beiwagen wurden 1961/62<br />
ausgemustert. Nachdem zu diesem Zeitpunkt<br />
bereits alle älteren Z1-Zweiachser<br />
ausgemustert waren, begann mit den Tw<br />
2719 und 2724 auch das Ende der Z2-Zweiachser.<br />
Da e<strong>in</strong> weiterer Ausbau sowie umfangreiche<br />
Netzmodernisierungen für die Zukunft<br />
Hamburgs Nahverkehr 1961/62<br />
Reduzierung Tram-Netz<br />
1961: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 11,7 km<br />
1962: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 5,1 km<br />
Länge Ende 1962: . . . . . . . . . . . . . . . . 285,1 km<br />
max. Länge (1938): . . . . . . . . . . . . . . . 413,6 km<br />
Fahrgastentwicklung Hochbahn<br />
1961:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1,9 Prozent<br />
1962:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1,7 Prozent<br />
nicht mehr absehbar waren, verzichtete die<br />
Hochbahn ebenfalls auf zahlreiche <strong>Straßenbahn</strong><br />
Güter- und Arbeitswagen. Die Beschaffung<br />
moderner <strong>Straßenbahn</strong>fahrzeuge<br />
war nicht mehr vorgesehen, trotzdem fanden<br />
noch kle<strong>in</strong>ere Umbauten an den vorhandenen<br />
Fahrzeugen statt, die e<strong>in</strong>en wirtschaftlicheren<br />
Betrieb ermöglichten.<br />
So wurde der Z2-Tw 2730 für rund<br />
13.000 DM zu e<strong>in</strong>em Zweirichtungstriebwagen<br />
umgebaut und erhielt die Typenbezeichnung<br />
Z2uP. Dadurch konnte er (<strong>in</strong> Tw<br />
2760 umgezeichnet) den vorhandenen Gleiswechsel<br />
am S- und U-Bahnhof Berl<strong>in</strong>er Tor<br />
nutzen und als Verstärker auf der L<strong>in</strong>ie 19<br />
<strong>in</strong> das Industriegebiet Billbrook verkehren.<br />
Das U-Bahn-Netz der Hansestadt konnte<br />
<strong>in</strong> den Jahren 1961–62 e<strong>in</strong>en erneuten Zuwachs<br />
verzeichnen. Die 1958 begonnene,<br />
fast 5 km lange Wandsbeker U-Bahn-L<strong>in</strong>ie,<br />
welche heute Teil der U1 ist, konnte bis zur<br />
Haltestelle Wandsbek Markt <strong>in</strong> Betrieb genommen<br />
werden. Als erstes wurde am 2. Juli<br />
1961 der Streckenabschnitt zwischen den<br />
Haltestellen Lohmühlenstraße und der Lübecker<br />
Straße eröffnet, dort besteht Übergang<br />
zur R<strong>in</strong>gl<strong>in</strong>ie, heute die L<strong>in</strong>ie U3.<br />
Am 1. Oktober des gleichen Jahres wurde<br />
die Strecke noch e<strong>in</strong>mal um e<strong>in</strong>e Haltestelle<br />
bis zur Haltestelle Wartenau verlängert, bevor<br />
am 28. Oktober 1962 die Strecke bis zum<br />
Wandsbeker Markt fertiggestellt wurde.<br />
Erweiterung nach Osten<br />
Die nächste U-Bahn-L<strong>in</strong>ie, die <strong>in</strong> Hamburg<br />
realisiert werden sollte, war die Verb<strong>in</strong>dung<br />
nach Billstedt. Hier fand am 14. Mai 1962<br />
der erste Spatenstich zum viergleisigen Neubau<br />
der Haltestelle Berl<strong>in</strong>er Tor statt. Insgesamt<br />
betrug die Betriebsgleislänge der U-<br />
Bahn Ende 1962 135,3 km, allerd<strong>in</strong>gs wurde<br />
am 29. Februar 1961 die 1,6 km lange Strecke<br />
der Walddörfer-<strong>Straßenbahn</strong> zwischen<br />
Ohlstedt und Wohldorf e<strong>in</strong>gestellt. Dabei<br />
handelte es sich um die mit Oberleitung betriebene<br />
Reststrecke der ehemaligen elektrischen<br />
Kle<strong>in</strong>bahn Alt-Rahlstedt – Volksdorf<br />
– Wohldorf, die als U-Bahn der Walddörferl<strong>in</strong>ie<br />
(heute L<strong>in</strong>ie U1) zugeordnet war (siehe<br />
SM 6/2011).<br />
Auch die Modernisierung des Bestandnetzes<br />
wurde Anfang der 1960er-Jahre fortgesetzt.<br />
Die Umsteigehaltestellen Lübecker<br />
Straße und Hauptbahnhof wurden moder-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
65
Geschichte<br />
nisiert und beim Bau e<strong>in</strong>es neuen Betriebshofes<br />
<strong>in</strong> Farmsen feierte die Hochbahn das<br />
Richtfest.<br />
Neue Fahrzeuge für U-Bahn<br />
Auf Grund des wachsenden Streckennetzes<br />
wurden zusätzliche U-Bahn-Triebwagen benötigt.<br />
Die beiden DT2-Prototypen, die 1960<br />
(Tw 9100/01) bzw. 1961 (Tw 9102/03) ausgeliefert<br />
wurden, fanden <strong>in</strong> der Bestellung<br />
e<strong>in</strong>er Serie von zunächst 50 Doppel-Triebwagen<br />
ihre Fortsetzung. Die ersten 34 Wagen<br />
der ersten Lieferserie wurden bereits im<br />
Geschäftsjahr 1962 ausgeliefert, der Rest<br />
kam e<strong>in</strong> Jahr später nach Hamburg.<br />
Somit erhöhte sich der Wagenpark von<br />
497 Wagen im Jahr 1960 auf 533 Wagen im<br />
Jahr 1962. Jetzt konnte die Hochbahn auf<br />
den planmäßigen E<strong>in</strong>satz von Altbauzügen<br />
auf der R<strong>in</strong>gl<strong>in</strong>ie verzichten und dadurch<br />
Nach der Phase des Wiederaufbaus<br />
begann Mitte der 1950er-<br />
Jahre die allmähliche Umstellung<br />
des Hamburger <strong>Straßenbahn</strong>netzes.<br />
1962 wies dieses schon erhebliche<br />
Lücken auf J. PERBANDT<br />
kürzere Fahrzeiten erreichen. Aber auch bei<br />
dem noch benötigten Wagenpark der alten<br />
T-Wagen fand <strong>in</strong> diesen Jahren e<strong>in</strong>e Modernisierung<br />
statt und weitere 27 alte U-Bahn-<br />
Wagen wurden zu TU2-Wagen umgebaut.<br />
Fazit 1962<br />
Während das <strong>Straßenbahn</strong>netz immer kle<strong>in</strong>er<br />
wurde, wuchs das Omnibusnetz der<br />
Hochbahn <strong>in</strong> dem beschriebenen Zeitraum<br />
Im Design der späten 1950er-Jahre präsentierten sich die Haltestellen der Wandbeker U-Bahn-<br />
L<strong>in</strong>ie, hier e<strong>in</strong> T-Wagen-Zug an der 1962 eröffneten Haltestelle Ritterstraße NORKA, SLG. J. PERBANDT<br />
Durch den Umbau zum Zweirichtungswagen<br />
konnte Tw 2760 am Berl<strong>in</strong>er Tor den Gleiswech<br />
sel nutzen ARCHIV HOCHBAHN, SLG. J. PERBANDT<br />
66 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Freihafen: Der schon mit neuer Nummer versehene VG 3815 fährt kurz vor der E<strong>in</strong>stellung im<br />
Gebiet des Freihafens<br />
K.-H. LINDOW, SLG. VVM<br />
um 59,1 Streckenkilometer auf 423,9 km an.<br />
Gleichzeitig wurden 264 Stadt- und Schnellbusse<br />
durch die Hochbahn beschafft.<br />
Bei der Alsterschifffahrt gab es ebenfalls<br />
e<strong>in</strong>e Änderung. Die MS Isebek wurde 1961<br />
modernisiert und erhielt e<strong>in</strong>e neue Rundumverglasung<br />
und ab 1. März 1962 wurde e<strong>in</strong>e<br />
neue L<strong>in</strong>ie Jungfernstieg – Rabenstraße –<br />
Mundsburg Brücke <strong>in</strong> Betrieb genommen.<br />
Wie sich an der Fahrgastentwicklung der<br />
Verkehrsmittel der Hamburger Hochbahn<br />
aus den Jahren 1961 bzw. 1962 widerspiegelt,<br />
g<strong>in</strong>gen die E<strong>in</strong>nahmen, nach e<strong>in</strong>en Anstieg<br />
im Jahr 1961, im dem darauf folgenden<br />
Jahr wieder zurück. Jedoch konnten die<br />
Erträge durch Zuschüsse für die Beförderung<br />
von Schwerbeh<strong>in</strong>derten ausgeglichen wer-<br />
den, so dass der Gew<strong>in</strong>n des Unternehmens<br />
<strong>in</strong> den beiden Jahren mit 1,37 Mio. nahezu<br />
gleich mit dem des Vorjahres war.<br />
Quellennachweise<br />
JENS PERBANDT<br />
• Geschäftsberichte der Hamburger Hochbahn<br />
1961–1962<br />
• Freie und Hansestadt Hamburg: Schnellbahnbau<br />
<strong>in</strong> Hamburg<br />
• Horst Buchholz: Die Hamburger <strong>Straßenbahn</strong><br />
Entwicklung des L<strong>in</strong>iennetzes 1866–1978,<br />
• Hermann Hoyer: Die Hamburger <strong>Straßenbahn</strong>,<br />
Wagenpark, 3. Teil, 1945 bis 1978<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Geschichte<br />
E<strong>in</strong> recht neuer V3A-Achtachser unterwegs im Stadtzentrum von Bukarest<br />
UNTEN E<strong>in</strong> Blick auf die Piata Unirii vor dem großen Umbau <strong>in</strong> Bukarest <strong>in</strong> den späten 1980er-<br />
Jahren; heute umtost hier überbordender Autoverkehr e<strong>in</strong>e gigantische Spr<strong>in</strong>gbrunnenanlage<br />
Nahe des Bukarester Nordbahnhofs<br />
rumpelt e<strong>in</strong> Electroputere-Zug über<br />
die Weichen und Kreuzungen. Alte<br />
Bebauung prägt den Platz<br />
ALLE AUFNAHMEN: BERNHARD KUSSMAGK<br />
Auf dem Trittbrett<br />
über gebrochene Schienen<br />
Auf Interrail-Tour zu Rumäniens Trams 1982 erkundete Bernhard Kußmagk aus Berl<strong>in</strong> die<br />
<strong>Straßenbahn</strong>-Betriebe <strong>in</strong> Bukarest, im Banat sowie <strong>in</strong> <strong>Sie</strong>benbürgen. 30 Jahre danach er<strong>in</strong>nert er sich<br />
an diese Reise und an die heute nur noch schwer vorstellbaren Erlebnisse<br />
Für das Jahr 1982 stand wieder e<strong>in</strong>mal<br />
e<strong>in</strong>e Interrail-Tour an. Die seltenen Berichte<br />
über die rumänischen <strong>Straßenbahn</strong>en<br />
im <strong>Straßenbahn</strong>-Magaz<strong>in</strong> und<br />
die Bücher aus dem Verlag Eisenbahn über<br />
Osteuropa hatten mich sehr neugierig gemacht.<br />
Es drangen kaum Nahverkehrs<strong>in</strong>-<br />
formationen aus dem sozialistischen und se<strong>in</strong>en<br />
eigenen Weg gehenden Staat Rumänien<br />
nach draußen. Gleichzeitig hatte das Land<br />
mit den Karpaten, den Legenden um Dracula<br />
und den deutschsprachigen <strong>Sie</strong>benbürger<br />
Sachsen und Banater Schwaben für mich<br />
etwas Mystisches. Das Grandiose war, dass<br />
e<strong>in</strong> Interrail-Ticket auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen wenigen<br />
Ostblockländern galt, so <strong>in</strong> Ungarn, <strong>in</strong> Jugoslawien<br />
und <strong>in</strong> Rumänien. Freunde fuhren<br />
zum Bergwandern <strong>in</strong> die Steiermark und<br />
so bot es sich an, zunächst Jugoslawien und<br />
Rumänien zu erkunden, um sich danach <strong>in</strong><br />
den steirischen Alpen zu erholen.<br />
68 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Rumänien 1982<br />
Seite 2 me<strong>in</strong>es Interrail-Heftes<br />
1982:<br />
Akribisch hatte ich<br />
die gefahrenen Kilometer<br />
vermerkt<br />
schien gar nicht so<br />
schlecht, dagegen<br />
waren die Gleisanlagen<br />
recht verschlissen.<br />
Die Weichen<br />
waren stark abgenutzt,<br />
die Schienen<br />
wellig und voller<br />
Gleisbrüche.<br />
Gleislose Innenstadt<br />
Das e<strong>in</strong>fache Hotel war unglaublich teuer,<br />
so dass ich bereits am Abend des zweiten Tages<br />
die Stadt verließ. Allerd<strong>in</strong>gs hatte ich die<br />
Sehenswürdigkeiten per pedes aufgesucht,<br />
die vielen Obusse im Zentrum bewundert<br />
Nach dem Besuch von Zagreb, Osijek und<br />
Beograd g<strong>in</strong>g es mit dem e<strong>in</strong>mal am Tag von<br />
Beograd Dunav nach Bukarest fahrenden<br />
Zug los <strong>in</strong> Richtung Rumänien. Er hatte nur<br />
zwei Wagen und war fast nur von farbigen<br />
afrikanischen Studenten, die offenbar Jeans<br />
schmuggelten, belegt. An der Grenze <strong>in</strong> Stamora<br />
Moravita wurde me<strong>in</strong> wochenlang<br />
vorher besorgtes Visum kontrolliert und<br />
me<strong>in</strong> Rucksack genau <strong>in</strong>spiziert. Der Aufenthalt<br />
dauerte recht lange, e<strong>in</strong>e dreiachsige<br />
Dampflok rangierte Güterwagen, wie gerne<br />
hätte ich sie fotografiert. Auf schlechten<br />
Gleisen wurde es e<strong>in</strong>e unruhige Nacht. Müde<br />
entstieg ich nach 16 Stunden Fahrt am Bukarester<br />
Nordbahnhof dem Zug, brachte<br />
me<strong>in</strong>en Rucksack an der Gepäckaufbewahrung<br />
unter und machte mich auf Quartiersuche.<br />
Normalspurige T4R-Tatrawagen,<br />
vierachsige Electroputere-Züge und achtachsige<br />
V3A-Gelenkwagen belebten die Straßen<br />
um den Bahnhof herum. Ihr Zustand erund<br />
mich gefragt, warum man das sehr große<br />
<strong>Straßenbahn</strong>netz zwar beibehalten hatte,<br />
aber die Schienen aus der Innenstadt weitgehend<br />
herausgenommen hatte. Wenig Autoverkehr,<br />
teils breite Straßen, aber kaum<br />
e<strong>in</strong>e <strong>Straßenbahn</strong>. Zum<strong>in</strong>dest gab es noch<br />
die wichtige Strecke von der Piata Unirii zur<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
69
Geschichte<br />
E<strong>in</strong>e Tatra-T4R-Doppeltraktion<br />
ist <strong>in</strong><br />
der Nähe der Bukarester<br />
Dambovita<br />
auf verschlissenen<br />
Gleisen unterwegs<br />
LINKS Im Wendedreieck von Ras<strong>in</strong>ari steht e<strong>in</strong><br />
Zug nach Sibiu zur Abfahrt bereit. Hier geht es<br />
ländlich zu, man beachte die beiden jungen<br />
Damen mit den Heugabeln rechts im Bild<br />
Piata Sf. Gheorghe quer durch die Innenstadt,<br />
auch entlang der Dambovita fuhren<br />
damals noch <strong>Straßenbahn</strong>en. E<strong>in</strong>ige Zweiachser-Züge<br />
des Typs Vo aus den 1950er-<br />
Jahren sah ich auch an Rande des Zentrums;<br />
sie schienen überwiegend auf den weniger<br />
wichtigen L<strong>in</strong>ien unterwegs zu se<strong>in</strong>.<br />
Pochenden Herzens durch Bukarest<br />
Nun ja, Ceaucescu wollte eben e<strong>in</strong> „modernes“<br />
Zentrum <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Hauptstadt. Vom legendären<br />
„Paris des Ostens“ waren e<strong>in</strong>ige<br />
Jugendstilbauten und Monumentalbauten <strong>in</strong><br />
teilweise erbärmlichen Zustand übrig geblieben,<br />
e<strong>in</strong>ige historisch gewachsene Stadtquartiere<br />
mit alter Bebauung waren bereits<br />
abgebrochen. Uralte Kirchen hatten neben<br />
unsäglich nah an sie heran gebauten Plattenbauten<br />
überlebt, lange Schlangen standen<br />
vor fast allen Geschäften, vor allem vor den<br />
Lebensmittelläden, diese lernte ich dann<br />
auch während der gesamten Reise kennen.<br />
Bei allen Fotos von Verkehrsmitteln pochte<br />
me<strong>in</strong> Herz, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Diktatur wie dieser<br />
schien fast alles verboten zu se<strong>in</strong>, also Vorsicht,<br />
dass ke<strong>in</strong> Militär-Lkw oder e<strong>in</strong> Verkehrspolizist<br />
<strong>in</strong> der Nähe war.<br />
LINKS Soeben ist e<strong>in</strong> Zweiachser-Zug aus Sibiu<br />
an der Endstelle <strong>in</strong> Ras<strong>in</strong>ari angekommen.<br />
Er wird gleich zurück nach rechts h<strong>in</strong>ten <strong>in</strong> das<br />
Wendedreieck zurückdrücken<br />
70 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Rumänien 1982<br />
Electroputere-Vierachser<br />
mit zweiachsigen Vo-Beiwagen<br />
behängt gab es zahlreich<br />
<strong>in</strong> Oradea. Unterwegs<br />
ist hier e<strong>in</strong> solcher Zug <strong>in</strong><br />
Richtung Cartierul Nufarul.<br />
Der Zug ist stark besetzt,<br />
die erste Tür des Beiwagens<br />
ist nicht richtig geschlossen<br />
<strong>Straßenbahn</strong>betriebe <strong>in</strong> Rumänien<br />
Stand 1982<br />
Stadt Spurweite Eröffnung Stilllegung<br />
Arad 1.000 mm 1898<br />
Braila 1.435 mm 1907<br />
Bukarest 1.435 mm 1874<br />
Galati 1.435 mm 1899<br />
Iasi 1.000 mm 1900<br />
Oradea 1.435 mm 1905<br />
Sibiu/Hermannstadt 1.000 mm 1905 2011 (seitdem nur<br />
noch Sonderverkehr)<br />
Timisoara 1.435 mm 1869<br />
Betriebe, die nach 1982 eröffnet wurden<br />
Botosani 1.435 mm 1991<br />
Brasov 1.435 mm 1987 2006<br />
Cluj-Napoca 1.435 mm 1987<br />
Constanta 1.435 mm 1984 2008<br />
Craiova 1.435 mm 1987<br />
Ploiesti 1.435 mm 1987<br />
Resita 1.435 mm 1988 2011<br />
Längst Geschichte ist <strong>in</strong> Oradea die ehemalige L<strong>in</strong>ie 3, hier nahe der<br />
Piata Unirii, sie wurde damals ausschließlich mit Zweiachser-Zügen bedient<br />
und passierte auch das Theater im Stadtzentrum<br />
Die Nachtzugfahrt nach Sibiu <strong>in</strong> <strong>Sie</strong>benbürgen<br />
war e<strong>in</strong> Alptraum, ich stand stundenlang<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em proppenvollen Zug im<br />
Übergang zwischen zwei Wagen, bis ich endlich<br />
e<strong>in</strong>en Stehplatz auf der Plattform direkt<br />
am WC bekam. Vollkommen gerädert entstieg<br />
ich morgens dem Zug, schulterte me<strong>in</strong>en<br />
Rucksack und lief entlang der stillgelegten<br />
Oberstadt-<strong>Straßenbahn</strong>strecke, e<strong>in</strong>ige<br />
alte Fahrleitungsrosetten erblickend, zum<br />
Jungen Wald. Denn hier <strong>in</strong> Dumbrava, sechs<br />
Kilometer entfernt, gab es e<strong>in</strong>en Camp<strong>in</strong>gplatz,<br />
da die wenigen Hotels <strong>in</strong> der Stadt ausgebucht<br />
oder unbezahlbar für mich waren.<br />
E<strong>in</strong>en Stadtplan hatte ich nicht, aber ich kam<br />
zurecht. E<strong>in</strong>e<strong>in</strong>halb Kilometer vor dem Camp<strong>in</strong>gplatz<br />
sah ich dann die Strecke der meterspurigen<br />
Überlandstraßenbahn von Cimitir<br />
nach Ras<strong>in</strong>ari. Im Depot stand e<strong>in</strong> Zug,<br />
der so aussah, als würde er auf se<strong>in</strong>e Verschrottung<br />
warten.<br />
Nachdem ich wieder <strong>in</strong> die Stadt zurückgelaufen<br />
war und ihr schönes mittelalterliches<br />
Zentrum besichtigt und mühsam e<strong>in</strong>ige<br />
Lebensmittel e<strong>in</strong>gekauft hatte, wollte ich<br />
gegen Mittag unbed<strong>in</strong>gt nach Ras<strong>in</strong>ari. Ich<br />
lief noch e<strong>in</strong>mal bis zum Camp<strong>in</strong>gplatz, stellte<br />
me<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>kauf ab und gesellte mich zu<br />
den vielen anderen Menschen an der Haltestelle<br />
gegenüber.<br />
Nach über e<strong>in</strong>en halben Stunde fragte ich<br />
dann jemanden, ob er wisse, wann die nächste<br />
Bahn führe. In <strong>Sie</strong>benbürgen lebten damals<br />
sehr viele deutschstämmige Menschen,<br />
so dass die Verständigung ke<strong>in</strong> Problem war.<br />
Die Antwort verblüffte mich vollends: „Gestern<br />
fuhr sie nicht“. E<strong>in</strong>e Haltestelle voller<br />
Menschen mit reichlich Handgepäck, die<br />
sich offenbar <strong>in</strong> stoischer Gelassenheit <strong>in</strong> ihr<br />
ungewisses Schicksal fügten. Aber nach e<strong>in</strong>er<br />
guten Stunde erschien sie, die <strong>Straßenbahn</strong>,<br />
es war jener Zug, den ich im Depot<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
71
Geschichte<br />
gesehen hatte. Er war bereits stark besetzt,<br />
nun begann das R<strong>in</strong>gen um die Trittbrettplätze.<br />
Fahrkartenverkauf<br />
auf dem Trittbrett<br />
Die Fahrt nach Ras<strong>in</strong>ari im Karpatenvorland<br />
war e<strong>in</strong>malig, die heruntergekommenen<br />
Zweiachser der rumänischen E<strong>in</strong>heitsproduktion<br />
(Typ Vo gebaut bei ITB) schwankten<br />
stark, die Schaffner<strong>in</strong> kämpfte sich dennoch<br />
durch die Menschenmenge und<br />
kassierte auch mich ab, der ich mit e<strong>in</strong>igen<br />
anderen geme<strong>in</strong>sam auf e<strong>in</strong>em Trittbrett des<br />
Beiwagens stand.<br />
In Ras<strong>in</strong>ari wurde <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Dreieck gewendet,<br />
Pferdewagen und Schafe passierten<br />
die <strong>Straßenbahn</strong>, kaum hatte die Bahn ihre<br />
Richtung gewechselt, fuhr sie wieder ab.<br />
Ich g<strong>in</strong>g durch die Ortschaft, man war<br />
neugierig und grüßte, ich wurde zu e<strong>in</strong>em<br />
Teller Suppe e<strong>in</strong>geladen. Ich fand das wunderbar<br />
und freute mich nach der Stärkung<br />
bereits auf die Fahrt zurück. Ich fotografierte<br />
den nächsten Zug, der ebenfalls schnell wieder<br />
abfuhr, g<strong>in</strong>g noch mal <strong>in</strong> den Ort, aber<br />
dann kam sie nicht, jene Bahn, die ich gerne<br />
hätte nehmen wollen, also marschierte ich<br />
zurück <strong>in</strong> Richtung Sibiu. Nach zwei Stunden<br />
kam ich dort an, zwischendurch hatte<br />
mich e<strong>in</strong> Bus im SEV passiert, der äußerst<br />
voll war.<br />
Bereits sehr früh am nächsten Morgen lief<br />
ich zum Bahnhof nach Sibiu zurück, da ich<br />
weiter <strong>in</strong>s Banat fuhr.<br />
Zweiachser aus den Zwanzigern<br />
Nach e<strong>in</strong>em Tag Zugfahrt – meist stehend –<br />
erreichte ich nach zweimaligem Umsteigen<br />
Timisoara im Banat. Es dämmerte bereits, es<br />
goss, ich suchte nach e<strong>in</strong>em Hotel, aber die<br />
schwach beleuchteten alten Obusse und normalspurigen<br />
<strong>Straßenbahn</strong>en begeisterten<br />
mich gleich. Vier Tage verbrachte ich <strong>in</strong> der<br />
Daten & Fakten: Rumänien<br />
Rumänien 1982 1989 2012<br />
E<strong>in</strong>wohner 22,5 Mio. 23,3 Mio. 21,0 Mio.<br />
<strong>Straßenbahn</strong>betriebe<br />
8 14 11<br />
U-Bahn-Betriebe 1 1 1<br />
Obus-Betriebe 5 11 10<br />
Stadt bzw. startete von hier aus zu Tagesausflügen,<br />
leider war es überwiegend<br />
bewölkt oder regnerisch. Neben Vo-Zweiachserzügen<br />
und solo fahrenden Electroputere-Vierachsern<br />
auf der L<strong>in</strong>ie 7 gab es hier<br />
ganz modernes Wagenmaterial <strong>in</strong> Form der<br />
kantigen Timis-2-Züge.<br />
Am schönsten waren allerd<strong>in</strong>gs die Züge<br />
der L<strong>in</strong>ie 5 nach Ronat, es waren Zweiachser<br />
aus den 1920er-Jahren bestehend aus<br />
Trieb- und Steuerwagen, die sich <strong>in</strong> Details<br />
72 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Rumänien 1982<br />
Bereits deutliche Gebrauchsspuren wiesen die recht neuen Timis-2-Züge auf, hier südlich des<br />
Zentrums von Timisoara nahe der Podul Traian<br />
Aus Freidorf (seit 1950 e<strong>in</strong> Stadtteil im Südwesten von Timisoara) kommend fährt e<strong>in</strong> Zweiachser-Zug<br />
<strong>in</strong> der Nähe des Nordbahnhofs von Timisoara stadte<strong>in</strong>wärts<br />
Die Strecke nach Ronat bot <strong>in</strong> Timisoara<br />
e<strong>in</strong>e sehr ländliche Idylle, die alten Fahrzeuge<br />
passten bestens dazu<br />
auch noch vone<strong>in</strong>ander unterschieden. An<br />
der Piata Libertatii bestanden noch umfangreichere<br />
Gleisanlagen als heute, da die<br />
<strong>Straßenbahn</strong> später teilweise aus dem Zentrum<br />
herausgenommen wurde.<br />
E<strong>in</strong> Ganztagesausflug führte mich nach<br />
Oradea, die drei Stunden dorth<strong>in</strong> verbrachte<br />
ich im Zug stehend. E<strong>in</strong>ige restaurierte<br />
Jugendstilhäuser und das Theater konnten<br />
nicht über den Verfall weiter Teile der Stadt<br />
h<strong>in</strong>wegtäuschen, <strong>in</strong> der auffallend viel unga -<br />
risch gesprochen wurde.<br />
Die normal spurigen <strong>Straßenbahn</strong>en waren<br />
<strong>in</strong> unterschiedlichem Zustand, die Zweiachser<br />
der rumänischen E<strong>in</strong>heitsproduktion<br />
waren deutlich verschlis sener als die wenigen<br />
Timis-2-Züge. Interessant war die Behängung<br />
der vierachsigen Electroputere-<br />
Triebwagen mit zweiachsigen Beiwagen. Vier<br />
L<strong>in</strong>ien waren vorhanden, die <strong>Straßenbahn</strong><br />
fuhr noch durch die Innenstadt am Theater<br />
vorbei. Bevor ich abends <strong>in</strong> den Zug nach<br />
Timisoara stieg, fiel me<strong>in</strong> Blick noch auf e<strong>in</strong>ige<br />
<strong>Straßenbahn</strong>en, die im Berufsverkehr<br />
mit offenen Türen fuhren, da der starke Andrang<br />
ihr Schließen verh<strong>in</strong>derte.<br />
Film beschlagnahmt!<br />
E<strong>in</strong> weiterer Ganztagesausflug führte mich<br />
nach Arad, wo u. a. Zweiachser-Dreiwagen -<br />
züge aus rumänischer E<strong>in</strong>heitsproduktion<br />
und Tatra T4R <strong>in</strong> Meterspur im E<strong>in</strong>satz<br />
waren. Das Zentrum der Stadt war ganz ordentlich,<br />
aber <strong>in</strong> den Seitenstraßen sah es teilweise<br />
erbärmlich aus. Die alte Lokalbahn<br />
über Ghioroc nach Pancota sowie über<br />
Ghioroc nach Radna sollte zwar mit Wagen<br />
aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg fahren,<br />
aber sie war wegen Umbau zur E<strong>in</strong>gliederung<br />
<strong>in</strong> das <strong>Straßenbahn</strong>netz außer Betrieb<br />
– leider.<br />
E<strong>in</strong>en Film kassierte die Polizei, da ich versehentlich<br />
e<strong>in</strong>e Polizeistation mit aufs Celluloid<br />
gebannt hatte. So g<strong>in</strong>gen wichtige Aufnahmen<br />
aus dem Banat, auch aus anderen<br />
Städten, verloren.<br />
Über Stamora Moravita verließ ich per<br />
Zug nach Beograd das Land. Der Teil der Interrail-Reise<br />
durch Rumänien war etwas<br />
kürzer ausgefallen als geplant, da ich auf das<br />
Schlangestehen an den Lebensmittelläden,<br />
die überfüllten Züge und die schwierige<br />
Quartiersuche ke<strong>in</strong>e Lust mehr hatte.<br />
Heute bedauere ich, dass ich nicht nach<br />
Iasi, Galati und Braila gekommen war und<br />
diese <strong>Straßenbahn</strong>betriebe erst <strong>in</strong> den 1990er-<br />
Jahren kennenlernte. Damals hätte ich niemals<br />
für möglich gehalten, dass Rumänien<br />
e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong>e Demokratie und <strong>in</strong> der EU se<strong>in</strong><br />
würde oder neue <strong>Straßenbahn</strong>betriebe (<strong>in</strong> Botosani,<br />
Brasov, Cluj-Napoca, Constanta,<br />
Craiova, Ploiesti, Resita) eröffnen würde.<br />
Dass das Land e<strong>in</strong>e zweite Heimat für viele<br />
deutsche Wagen werden würde, war damals<br />
vor 30 Jahren ebenfalls jenseits jeglicher Vorstellungskraft.<br />
BERNHARD KUSSMAGK<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
73
■ M<strong>in</strong>iatur-Nahverkehr: Anlagen, Fahrzeuge, Tipps und Neuheiten<br />
Mandorf konstruiert<br />
se<strong>in</strong>e 3-D-Modelle<br />
auf e<strong>in</strong>em Mac mit<br />
dem Programm<br />
Sketch up. Die kostenlose<br />
Anwendung gibt<br />
es auch für W<strong>in</strong>dows.<br />
Die Zeichnung zeigt<br />
den OEG-Maximumtriebwagen<br />
Nr. 1. Die<br />
bläuliche Fläche an<br />
der Stirnseite ist e<strong>in</strong>e<br />
Warnung des Programms,<br />
die anzeigt,<br />
dass die Konstruktion<br />
hier noch fehlerhaft<br />
ist. Beim Dienstleister<br />
»i.materialize« hat<br />
der Autor den Wiener<br />
Typ T <strong>in</strong> H0 (unteres<br />
Bild) <strong>in</strong> der Stereolithografie-Methode<br />
fertigen lassen<br />
Modelle aus dem PC<br />
Die neue Art des Fahrzeugbaus ■ Kostenlose Programme aus dem Internet helfen beim<br />
Verwirklichen eigener Tramwünsche. Vorm Konstruieren ist aber Recherche angesagt<br />
Die unterschiedlichen Fertigungsmethoden<br />
des immer<br />
beliebter werdenden<br />
3-D-Drucks haben wir im<br />
letzten Monat bereits im SM-Modellteil<br />
vorgestellt. Nun geht es darum,<br />
wie man e<strong>in</strong> Fahrzeug als 3-D-Modell<br />
konstruiert. Vorweg sei gesagt, dass<br />
es den Umfang dieses Berichtes gesprengt<br />
hätte, wenn ich jeden e<strong>in</strong>zelnen<br />
Schritt detailliert beschreiben<br />
würde. Es soll vielmehr dargestellt<br />
werden, welche grundsätzlichen<br />
Schritte und Voraussetzungen berücksichtigt<br />
werden müssen.<br />
Fürs Entwerfen wird e<strong>in</strong> 3-D-Konstruktionsprogramm<br />
benötigt. Hier<br />
bietet der Markt von kostenfrei er-<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12|2012
Fahrzeugba<br />
Hier kann<br />
man gut sehen,<br />
was aus der Konstruktionszeichnung<br />
(kle<strong>in</strong>es Bild) geworden<br />
ist. Drucker »i.materialize« fertigte<br />
die Stereolithografie-Rohl<strong>in</strong>ge <strong>in</strong> H0, die als<br />
fertiger Wiener Typ-T-Zug auf Fahrgäste warten<br />
hältlichen Programmen, wie etwa<br />
Googles »Sketchup«, bis h<strong>in</strong> zu mehrere<br />
Tausend Euro teuren Anwendungen,<br />
wie »AutoCad« oder »Inventor«,<br />
e<strong>in</strong> großes, aber dennoch<br />
überschaubares Angebot. Welche<br />
Software man wählt, ist e<strong>in</strong>e sehr<br />
<strong>in</strong>dividuelle Entscheidung. Da ich<br />
bisher ke<strong>in</strong>e Erfahrung mit 3-D hatte,<br />
fiel me<strong>in</strong>e Wahl auf das kostenlose<br />
Sketchup. Es bietet gerade für Anfänger<br />
e<strong>in</strong>en guten E<strong>in</strong>stieg. Mit Hilfe<br />
von Videos wird die Funktionalität<br />
der Anwendung präsentiert und man<br />
kann sich langsam e<strong>in</strong>arbeiten. Falls<br />
die vorhandenen Funktionen nicht<br />
ausreichen, kann Sketchup durch<br />
»Addons« genannte Erweiterungen<br />
ergänzt werden. Davon gibt es<br />
mittlerweile e<strong>in</strong>e Vielzahl am Markt.<br />
Es empfiehlt sich, die »Tutorials«<br />
genannten Gebrauchsanweisungen<br />
Helmut Gieramm hat den L<strong>in</strong>dnerzug der <strong>Straßenbahn</strong> Halle vom 3-D-<br />
Drucker Shapeways <strong>in</strong> der Ausführung »Frosted Ultra Detail« als Rohl<strong>in</strong>g<br />
(oben) bezogen. Mit Acrylfarbe von Humbrol und Revell, Abziehbildern<br />
von Kreye sowie e<strong>in</strong>em Antrieb von Hall<strong>in</strong>gs KSW und e<strong>in</strong>em Fahrwerk<br />
von Bec-Kits für den Beiwagen wurden daraus schöne H0-Modelle<br />
von Sketchup durchzuarbeiten, um<br />
sich mit den Funktionen vertraut zu<br />
machen, bevor man mit e<strong>in</strong>er komplizierten<br />
Konstruktion beg<strong>in</strong>nt.<br />
Alte Zeichnungen oft falsch<br />
Um se<strong>in</strong> 3-D-Wunschmodell zu erstellen,<br />
ist natürlich e<strong>in</strong>e Zeichnung<br />
des Fahrzeugs erforderlich. Hier hilft<br />
e<strong>in</strong> Blick <strong>in</strong> die Literatur des entsprechenden<br />
Verkehrsbetriebes, die<br />
oftmals Konstruktionszeichnungen<br />
enthalten. Auch das Internet ist e<strong>in</strong>e<br />
ergiebige Informationsquelle. Ich<br />
möchte darauf h<strong>in</strong>weisen, dass man<br />
sich nicht ausschließlich auf e<strong>in</strong>e<br />
e<strong>in</strong>zige Konstruktionszeichnung verlassen<br />
darf. Diese stellen nicht immer<br />
exakt das Fahrzeug dar, da<br />
oftmals Änderungen nicht<br />
übernommen wurden und<br />
auch die Zeichnung teilweise<br />
ungenau erstellt worden ist.<br />
Der Vergleich mit dem Orig<strong>in</strong>al (sofern<br />
es noch vorhanden ist) oder mit<br />
Fotos ist daher unumgänglich. Bei<br />
vielen älteren Fahrzeugen s<strong>in</strong>d aufgrund<br />
der langen Zeit und der Kriege<br />
ke<strong>in</strong>e Zeichnungen mehr vorhanden.<br />
Manchmal existieren vielleicht<br />
noch grobe Skizzen, die man für<br />
se<strong>in</strong>e Arbeit zugrunde legen kann.<br />
Im schlimmsten Fall muss man sich<br />
zuvor e<strong>in</strong>e solche an Hand von Fotos<br />
selber erstellen, um e<strong>in</strong>e Konstruktionsgrundlage<br />
zu haben.<br />
Grundsätzlich muss darauf geachtet<br />
werden, dass die Proportionen<br />
des Fahrzeugs im Modell wieder zu<br />
f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d. Bei alten Konstruktionszeichnungen<br />
kommt es vor, dass<br />
Fahrzeuge verkürzt dargestellt s<strong>in</strong>d.<br />
Wenn man diese Zeichnung für<br />
den Bau verwenden will, ist es<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12|2012 75
aßenbahn im Modell<br />
ANZEIGE<br />
Wieder<br />
NEUES für<br />
Ihre Spur-IIm-Bahn<br />
Für die Liebhaber großer <strong>Straßenbahn</strong>en s<strong>in</strong>d<br />
die Holzbausätze von OcCre etwas ganz<br />
Besonderes: Jetzt kommen zu den beliebten fünf<br />
Trambahnen zwei neue Nahverkehrsmodelle dazu.<br />
Die Holzbausätze im Maßstab 1:24 von OcCre s<strong>in</strong>d<br />
perfekt durchdacht und lasergenau gefertigt! Jedes<br />
Modell wird e<strong>in</strong> Glanzstück Ihrer Sammlung.<br />
Packen <strong>Sie</strong> Ihre Modelle nicht nur aus, bauen <strong>Sie</strong><br />
sich Ihr Liebl<strong>in</strong>gsfahrzeug doch e<strong>in</strong>fach selbst!<br />
Londoner<br />
Doppeldecker-Tram<br />
NEU!<br />
NEU!<br />
Dennys-Bus<br />
B-Type<br />
erforderlich, m<strong>in</strong>destens zwei Maße<br />
<strong>in</strong> jeder Ausrichtung zu überprüfen<br />
und die Zeichnung gegebenenfalls<br />
zu verzerren. Wenn man e<strong>in</strong>e Skizze<br />
des Fahrzeugs an Hand von Fotos<br />
selbst erstellen muss, kann man sich<br />
an der Spurweite orientieren, um daraus<br />
andere Maße abzuleiten. Ist e<strong>in</strong><br />
Orig<strong>in</strong>alfahrzeug noch vorhanden, so<br />
benötigt man auf jeden Fall die Maße<br />
der Fenster und Streben.<br />
Hat man e<strong>in</strong>e passende Konstruktionszeichnung<br />
gefunden oder erstellt,<br />
dann kann man mit der Kons truktion<br />
beg<strong>in</strong>nen. Ich orientiere mich dabei<br />
an der folgenden Vorgehensweise:<br />
Zuerst importiere ich e<strong>in</strong> Bild<br />
der Draufsicht <strong>in</strong> Sketchup, skaliere<br />
es entsprechend <strong>in</strong> H0 (1:87) und<br />
zeichne den Außenumriss nach. Als<br />
Wandstärke wähle ich e<strong>in</strong>en Millimeter.<br />
Diese Größe ist mit allen<br />
Verfahren erstellbar und das Modell<br />
besitzt auch ausreichend Stabilität.<br />
Die M<strong>in</strong>destmaße von teilweise<br />
0,7 Millimeter je nach Herstellungsverfahren<br />
s<strong>in</strong>d nur für kle<strong>in</strong>e Flächen<br />
und ke<strong>in</strong>esfalls für e<strong>in</strong>e größere Seitenwand<br />
geeignet.<br />
Zu dünn ist gefährlich<br />
So kann ich e<strong>in</strong>en Körper erstellen,<br />
der der Form des Chassis bis zum<br />
Dach entspricht. Mit Hilfe von Hilfsl<strong>in</strong>ien<br />
bilde ich auf diesem Körper<br />
dann die Außenkanten der Fenster<br />
und Türen ab. Wie bei der Wandstärke<br />
ist bei der Konstruktion e<strong>in</strong>es<br />
Modells generell zu beachten,<br />
dass nicht alles exakt maßstäblich<br />
<strong>in</strong> 1:87 heruntergerechnet werden<br />
kann. Fensterstreben, die schmaler<br />
als e<strong>in</strong>en Millimeter s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d sehr<br />
fragil und brechen schnell. Auch ist<br />
zu überlegen, ob Deckleisten oder<br />
Nieten im Modell nachgebildet werden<br />
sollen. Wenn man diese korrekt<br />
darstellen will, dann s<strong>in</strong>d sie zu kle<strong>in</strong><br />
und man kann sie nicht erkennen. Also<br />
muss man sie vergrößern, um sie<br />
darstellen zu können, denn oft wirkt<br />
das Modell etwas nackt, wenn man<br />
die weglässt. E<strong>in</strong>ige Hobbyfreunde<br />
werden dann aber e<strong>in</strong>wenden, dass<br />
die Nieten nun deutlich zu groß<br />
s<strong>in</strong>d. Man muss also für sich selber<br />
entscheiden, ob man auf die Details<br />
verzichten will oder sie entsprechend<br />
vergrößert, um sie darstellen<br />
zu können. Vertiefungen, wie etwa<br />
Bretterfugen, sollten e<strong>in</strong> Maß von<br />
0,2 Millimeter nicht unterschreiten.<br />
Bei e<strong>in</strong>em Lattenrostfußboden können<br />
es auch 0,3 Millimeter se<strong>in</strong>.<br />
Bei allen Konstruktionen ist grundsätzlich<br />
darauf zu achten, dass e<strong>in</strong>e<br />
Stärke von e<strong>in</strong>em Millimeter nicht<br />
unterschritten wird. Dies ist <strong>in</strong>sbesondere<br />
an den Kanten des Daches<br />
wichtig, da sonst das Modell ke<strong>in</strong>e<br />
ausreichende<br />
Stabilität besitzt.<br />
Bei der Konstruktion<br />
kann und<br />
sollte man die Vorteile e<strong>in</strong>er computergestützten<br />
Erstellung ausnutzen.<br />
So ist es nicht erforderlich, für jedes<br />
Modell erneut Details wie Drehgestellaufnahmen,<br />
Lampen, Bl<strong>in</strong>ker<br />
oder Motoraufnahmen neu zu konstruieren,<br />
sondern man kann diese mittels<br />
Kopierbefehl aus e<strong>in</strong>er anderen<br />
Konstruktion übernehmen. Bei der<br />
Konstruktion kann man den Befehl<br />
natürlich noch weitergehender nutzen:<br />
Für e<strong>in</strong> Zweirichtungsfahrzeug<br />
reicht es so aus, nur e<strong>in</strong> Viertel des<br />
Fahrzeugs zu konstruieren, da man<br />
Auch für große Maßstäbe ist 3-D-Druck geeignet. Dieser Stereolithografie-Rohl<strong>in</strong>g<br />
<strong>in</strong> Spur 0 e<strong>in</strong>er Doppelstocktram stammt von Mark Casson.<br />
Die noch zu entfernende Stützstruktur erzeugt der Drucker automatisch<br />
den Rest durch Kopieren und Spiegeln<br />
ergänzen kann. Aufwendig s<strong>in</strong>d<br />
mit Sketchup Dachkonstruktionen<br />
wie etwa bei e<strong>in</strong>em Tonnendach, das<br />
<strong>in</strong> zwei Richtungen gewölbt ist. Hier<br />
fehlen <strong>in</strong> der kostenlosen Version<br />
entsprechende Funktionen, so dass<br />
man entweder auf Addons angewiesen<br />
ist oder man konstruiert die Rundung<br />
durch entsprechende Facetten.<br />
Ich bevorzuge letztere Vorgehensweise,<br />
da ich so stärker bee<strong>in</strong>flussen<br />
kann, wie die Grundstruktur wird. Ist<br />
die Grundkonstruktion erstellt, so ist<br />
San Franciscos<br />
Cable Car<br />
Westliche Berl<strong>in</strong>er Vorortbahn<br />
Corona Net<br />
Inh. Frank Dengler<br />
Gebelsbergstraße 115, 70199 Stuttgart<br />
Tel. 0711/6070363, Fax 0711/6403366<br />
vertrieb@corona-net.de<br />
www.coronanet.de<br />
Händleranfragen willkommen<br />
Bei der Rhe<strong>in</strong>bahn fuhr der Sechsfensterwagen 954, den Autor Guido Mandorf im Stereolithografie-Verfahren<br />
bei »i.materialize« als H0-Modell fertigen ließ. Der Druck e<strong>in</strong>es solchen Zweiachsers kostet rund 60 Euro<br />
76 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12|2012
Fahrzeugba<br />
es erforderlich, diese auf ihre Druckbarkeit<br />
zu überprüfen. Grundsätzlich<br />
gilt, dass e<strong>in</strong>e 3-D-Konstruktion<br />
»wasserdicht« se<strong>in</strong> muss, das heißt,<br />
ke<strong>in</strong>e Löcher <strong>in</strong> Ihrer Kons truktion<br />
se<strong>in</strong> dürfen. E<strong>in</strong>e Fensteröffnung ist<br />
ke<strong>in</strong> Loch <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne, da dies<br />
bewusst <strong>in</strong> die Konstruktion e<strong>in</strong>gebracht<br />
ist. Wurde aber auch nur e<strong>in</strong><br />
Teil der schmalen Fensterleibung vergessen,<br />
ist die Konstruktion löchrig<br />
und damit nicht druckbar.<br />
Programm f<strong>in</strong>det Fehler<br />
Da die Überprüfung des kompletten<br />
Modells sehr aufwendig ist, empfiehlt<br />
es sich, dafür e<strong>in</strong>e spezielle<br />
Prüfsoftware e<strong>in</strong>zusetzen. Ich verwende<br />
dazu »Netfabb«, von der<br />
im Internet e<strong>in</strong>e Version kostenfrei<br />
bezogen werden kann. Dieses Programm<br />
überprüft die wichtigsten<br />
Kriterien, wie Löcher <strong>in</strong> der Konstruktion<br />
oder überlap pende Flächen,<br />
die sich für e<strong>in</strong>en Druck als h<strong>in</strong>derlich<br />
darstellen. Für den Versand der 3-D-<br />
Zeichnung an den Druckdienstleister<br />
muss diese aus dem Dateiformat des<br />
verwendeten Programms <strong>in</strong>s STL-<br />
Format konvertiert werden, welches<br />
die 3-D-Drucker verarbeiten können.<br />
Zuvor führen diese jedoch auch<br />
noch Tests durch, ob die Datei den<br />
Druckanforderungen genügt, so dass<br />
es durchaus passieren kann, dass<br />
der Auftrag aufgrund von Fehlern <strong>in</strong><br />
der Konstruktion abgelehnt wird. Zu<br />
beachten ist natürlich, dass lediglich<br />
ANZEIGEN<br />
Der<br />
anfangs noch<br />
<strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelteilen gezeigte<br />
OEG-Maximum-Tw ist nun<br />
fertig fürs Hochladen beim Dienstleister.<br />
Mandorfs 3-D-Trammodelle kann sich jeder über<br />
shapeways.com/Shops/Tramspotters ausdrucken lassen *<br />
e<strong>in</strong>e formale Überprüfung der Konstruktion<br />
erfolgt. Für die Konstruktion<br />
des Fahrwerkes empfehle ich, e<strong>in</strong>en<br />
der handelsüblichen Antriebe genau<br />
zu vermessen und sich daran zu orientieren,<br />
wie er <strong>in</strong> anderen Modellen<br />
Dieses komplett mit Achsen und<br />
Rädern gedruckte H0-Maximumdrehgestell<br />
e<strong>in</strong>es Typ-T-Triebwagens<br />
der Wiener <strong>Straßenbahn</strong> ist<br />
rollfähig G. MANDORF (8), H. GIERAMM (2)<br />
befestigt wird. Nicht alle Hersteller<br />
bieten dazu im Internet ausführliche<br />
Maßzeichnungen an, die man heranziehen<br />
kann. Zudem sollte man<br />
sich vorher auch versichern, welche<br />
Antriebe von Fertigmodellen überhaupt<br />
als Ersatzteil lieferbar s<strong>in</strong>d.<br />
Von bekannten Herstellern s<strong>in</strong>d Stellungnahmen<br />
bekannt, die deutlich<br />
machen, dass man nicht daran <strong>in</strong>teressiert<br />
ist, durch Lieferung hauseigener<br />
Antriebe die Konkurrenz durch<br />
3-D-Modelle noch zu fördern.<br />
Wichtig ist, dass man beim Konstruieren<br />
nie die Realität aus den Augen<br />
verliert. Insbesondere wenn man <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er starken Vergrößerung an der<br />
3-D-Zeichnung arbeitet, ist schnell<br />
vergessen, dass die gerade bearbeitete<br />
Kante vielleicht nur 0,1 Millimeter<br />
lang ist und es später eigentlich egal<br />
ist, ob diese eventuell m<strong>in</strong>imal von<br />
der Vertikalen abweicht. Wenn man<br />
den E<strong>in</strong>druck hat, dass e<strong>in</strong>e Ecke zu<br />
kantig ist, so kann man dies am fertigen<br />
Rohl<strong>in</strong>g leicht rundfeilen.<br />
Nachbehandlung muss se<strong>in</strong><br />
Man muss sich aber auch darüber im<br />
Klaren se<strong>in</strong>, dass jeder 3-D-Rohl<strong>in</strong>g<br />
e<strong>in</strong>e Nachbearbeitung erforderlich<br />
macht. Das e<strong>in</strong>e Material muss<br />
geglättet, das andere aufwendig<br />
gere<strong>in</strong>igt und beim dritten müssen<br />
Grate abgefeilt werden. Vorsicht ist<br />
bei manchen Rohl<strong>in</strong>gen geboten,<br />
denn diese s<strong>in</strong>d oftmals spröder als<br />
bekannte Modelle aus Polystyrol. E<strong>in</strong><br />
Anfassen mit den sprichwörtlichen<br />
weißen Handschuhen ist aber generell<br />
nicht erforderlich. Da die Drucke,<br />
die im Laser-S<strong>in</strong>terverfahren erstellt<br />
s<strong>in</strong>d, am stabilsten s<strong>in</strong>d, verwende<br />
ich dies für Fahrgestelle. Diese<br />
müssen etwas stabiler se<strong>in</strong>, um den<br />
Antrieb aufzunehmen. Hier kommt<br />
es auch nicht darauf an, ob die Oberfläche<br />
etwas rauer ist. Beim Chassis<br />
tendiere ich jedoch lieber zu e<strong>in</strong>em<br />
im Multijet-Verfahren oder per Stereolithografie<br />
erstellten Rohl<strong>in</strong>g, da<br />
diese e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Oberflächenrauheit<br />
haben. GUIDO MANDORF<br />
* Auch der <strong>in</strong> New York stehende<br />
Shapeways-Server ist Ende Oktober<br />
e<strong>in</strong> Opfer von Wirbelsturm Sandy<br />
geworden. Wegen unterbrochener<br />
Stromleitungen war der 3-D-Drucker<br />
tagelang nicht im Internet erreichbar.<br />
Software für 3-D<br />
Konstruktionsprogramm<br />
Kostenlos für Mac und W<strong>in</strong>dows<br />
sketchup.com/<strong>in</strong>tl/de/<br />
download/gsu.html<br />
Überprüfungsprogramm<br />
Kstl. für L<strong>in</strong>ux, Mac und W<strong>in</strong>dows<br />
netfabb.com/download.php<br />
www.bus-und-bahn-und-mehr.de<br />
DÜWAG-<br />
Verschiedene<br />
Varianten<br />
In Kürze<br />
lieferbar!<br />
Foto: Archiv Stadtwerke Bielefeld<br />
– <br />
✕<br />
Gelenkwagen GT6<br />
Bielefeld<br />
!<br />
Mehr Infos im Internet<br />
oder Infoblatt anfordern<br />
<strong>Sie</strong> f<strong>in</strong>den uns im Internet oder fordern <strong>Sie</strong> e<strong>in</strong>fach unsere kostenlose<br />
Versandliste an vom: Versandhandel BUS UND BAHN UND MEHR<br />
Geschwister-Scholl-Straße 20 · 33613 Bielefeld · Telefon 0521-8989250<br />
Fax 03221-1235464 · E-Mail: <strong>in</strong>fo@bus-und-bahn-und-mehr.de<br />
<strong>Straßenbahn</strong>-Bücher und Nahverkehrs-Literatur<br />
Im Versand, direkt nach Haus<br />
ganz NEU TRAMS 2013 (niederl.), 272 S., 15 x 21 cm, 306 Farbaufnahmen, Sonderthema „Überlandbahnen CH“ 20,00 €<br />
ganz NEU Die LOWA-<strong>Straßenbahn</strong>wagen ET 50/54 + EB 50/54 (Kalbe, Möller, Vondran), 256 S., 17 x 24 cm, ~220 Abb. 28,50 €<br />
ganz NEU U-Bahn, S-Bahn & Tram <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> (Schwandl), 128 Seiten, 17 x 24 cm, 200 Abb., diverse Netzpläne 14,50 €<br />
ganz NEU 130 Jahre <strong>Straßenbahn</strong> <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Köpenick (J. Kubig, Neddermeyer-V.), 96 Seiten, A4, 120 Aufn. 12,80 €<br />
ganz NEU Bitte umsteigen. Mit L<strong>in</strong>ie 11 <strong>in</strong>s Grüne, Haspe Voerde Breckerfeld (Göbel, Rudat), 348 S., A4 39,00 €<br />
ganz NEU Die Hallesche <strong>Straßenbahn</strong> (Mey, Kluge, Schumann) 18,95 € · Die Wormser <strong>Straßenbahn</strong> (Sutton) 18,95 €<br />
ganz NEU Die PESAG Straßenb. Paderborn, Detmold, Blomberg (Kenn<strong>in</strong>g-V.), 336 S., A4, 640 Aufn. 48,95 €<br />
ganz NEU Tram von Paderborn nach Detmold im Bild (Reim., Bimmerm.), 240 S., ~24 x 17 cm, 438 SW- + 20 Farbfotos, 86 Zeichn. 29,80 €<br />
ganz NEU Mit 5 + 25 unterwegs Zeitreise ... <strong>Straßenbahn</strong> Wuppertal Sol<strong>in</strong>gen (Eidam, Reim.), 224 S., 525 F. 29,80 €<br />
NEU 100 Jahre LiLo, L<strong>in</strong>zer Lokalbahn 1912 – 2012 24,50 € · 100 Jahre Traunseebahn Gmunden - Vorchdorf 32,00 €<br />
ganz NEU Yellow trams – orange Busses 66 S., 24 x 21, 100 Farbf., Lissabon + alle Betriebe Portugal 16,00 €<br />
ganz NEU Troleybusy w Polsce (J. Pudło), 176 S., A4, Gdynia, Sopot, Lubl<strong>in</strong>, Tychy + 10 ehem. Betriebe, engl. Zusammenf. 22,00 €<br />
ganz NEU Tramwaje dolnośląskie (tom 2) Trams <strong>in</strong> Oberschlesien 376 S., A4, 670 Abb., u. a. Kottowitz >1945 38,50 €<br />
ganz NEU Belgian Vic<strong>in</strong>al Tram&Light Rail Fleet 1885-1991 (Maase, LRTA), 246 Seiten, A4, viele Fotos, 56 Zeichnungen 65,80 €<br />
ganz NEU Tussen stad en land (Moerland, Hoogerhuis), 208 S., A4, 300 Farbabb.+Karten, von Überlandbahnen bis Stadtbahn 35,00 €<br />
KALENDER Trams 2013 (Belgien)17,40 € · Skan<strong>in</strong>avien: Stockholm, Göteborg, Busse bzw. Tramways of the World je 12,50 €<br />
Alle <strong>Straßenbahn</strong>-Neuheiten (auch von Betrieben)/zzgl. Porto/Verpackung (1,50 bis 4,00 €)<br />
TS: T t<br />
TramShop, Rolf Hafke, <strong>Sie</strong>ben-Schwaben-Weg 22, 50997 Köln<br />
t 0 22 33-92 23 66 F 0 22 33-92 23 65 m Hafke.Koeln@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12|2012 77
Ihre Seiten: Ergänzungen, Anmerkungen, Kritik und Anregung<br />
0 89 – 13 06 99-720<br />
ö 0 89 – 13 06 99-700<br />
: redaktion@geramond.de<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Postfach 40 02 09 · 80702 München<br />
Zu »Das besondere Bild«<br />
(SM 6/2012)<br />
Von Martigny nach<br />
Zürich<br />
Das wundervolle Bild von Herrn Walper<br />
zeigt den Arbeitstriebwagen Xe 2/2<br />
Nr. 81 der Martigny-Châtelard-Bahn<br />
(MC). Dieses Fahrzeug hat e<strong>in</strong>e recht lange<br />
Geschichte – es war 1900 für die Limmattal-Strassenbahn<br />
(LSB) als Wagen Ce<br />
2/2 Nr. 2 von der Schweizerischen Waggons-<br />
und Aufzügefabrik <strong>in</strong> Schlieren<br />
(SWS) und im elektrischen Teil durch die<br />
BBC <strong>in</strong> Baden gebaut worden und gehörte<br />
zur Serie Ce 2/2 Nr. 1 bis 9 (10). Als die<br />
Limmattal-Strassenbahn, welche vom Letzigraben<br />
nach Altstetten, Schlieren und<br />
Dietikon mit e<strong>in</strong>er Zweigl<strong>in</strong>ie von Schlieren<br />
über die Limmat nach Unterengstr<strong>in</strong>gen<br />
und We<strong>in</strong>igen führte, im Mai 1931<br />
von der Städtischen Strassenbahn Zürich<br />
(StStZ) übernommen wurde, kam auch<br />
dieser Wagen <strong>in</strong> Besitz der StStZ und wurde<br />
zum Wagen Nr. 53 umnummeriert. Im<br />
Jahr 1934 wurde dieses Fahrzeug an die<br />
MC verkauft, um dort als Diensttriebwagen<br />
Xe 2/2 Nr. 81 e<strong>in</strong>gesetzt zu werden.<br />
Der Tw musste dort mit seitlichen Strom-<br />
Term<strong>in</strong>e<br />
17. November, Magdeburg: entfällt!<br />
1. Dezember, Halle (Saale): Adventsfahrten<br />
mit historischen <strong>Straßenbahn</strong>en,<br />
jeweils 12 bis 18 Uhr, Informationen über<br />
Hallesche <strong>Straßenbahn</strong>freunde e.V., Seebener<br />
Straße 191, 06114 Halle (Saale).<br />
1./2. Dezember, Duisburg: Nikolausfahrten<br />
mit dem Harkortwagen 177 für<br />
Jung und Alt; Abfahrt und Ankunft (nach<br />
e<strong>in</strong>er Stunde) am Betriebshof Grunewald.<br />
Abfahrt jeweils 14.30, 16 und 17:30 Uhr.<br />
2. Dezember, Bochum/Wanne-Eickel:<br />
Sonderverkehr mit zwei historischen Triebwagen<br />
der VhAG BOGESTRA zwischen<br />
Bochum und Wanne- Eickel. Zur Mitfahrt<br />
genügt e<strong>in</strong> gültiges VRR-Ticket. Der Vere<strong>in</strong><br />
freut sich aber über jede Spende. Infos unter<br />
www.vhag-bogestra.de<br />
2., 9., 16. & 23. Dezember, Stuttgart:<br />
Am 2. Dezember, ist der Nikolaus auf den<br />
Der liebevoll restaurierte LSB Ce 2/2 Nr. 2 <strong>in</strong> Zürich<br />
abnehmern für die „3. Schiene“ nachgerüstet<br />
werden. Die meterspurige MC führt<br />
von Martigny auf e<strong>in</strong>er Adhäsionsstrecke<br />
ausgerüstet mit e<strong>in</strong>er Fahrleitung nach<br />
Vernayaz. Dort beg<strong>in</strong>nt die Bergstrecke,<br />
welche teilweise mit e<strong>in</strong>er Zahnstange<br />
System Strub ausgerüstet ist, entlang des<br />
Flusses Le Trient nach Salvan, Les Marecottes,<br />
Le Tretien, F<strong>in</strong>haut und Le Châtelard<br />
zur Grenze nach Frankreich. Die Bahn<br />
führt weiter nach Vallorc<strong>in</strong>e und endet<br />
schliesslich <strong>in</strong> Chamonix. Die Bahn führt<br />
durch e<strong>in</strong>e sehr reizvolle Landschaft durch<br />
<strong>Straßenbahn</strong>-Oldtimerl<strong>in</strong>ien 21 und 23<br />
(GT4-Doppele<strong>in</strong>heit) zu Gast und am 9.,<br />
16. & 23. Dezember geht der Glühwe<strong>in</strong>-Express<br />
(DoT4 917) auf Tour. Für Letzteren ist<br />
e<strong>in</strong>e Platzreservierung erforderlich – siehe<br />
express.shb-ev.<strong>in</strong>fo oder Tel. 0711/822 210<br />
donnerstags von 17 bis 19 Uhr.<br />
2., 9. und 16. Dezember 2012, Karlsruhe:<br />
An den drei Adventssonntagen veranstaltet<br />
„stattreisen Karlsruhe“ mit dem<br />
TSNV Glühwe<strong>in</strong>fahrten. Zum E<strong>in</strong>satz kommt<br />
Tw 125. Die rund zweistündige Fahrt zum<br />
Preis von 14 Euro (ermäßigt 12 Euro) beg<strong>in</strong>nt<br />
an der Haltestelle Volkswohnung.<br />
Anmeldung erforderlich unter Telefon<br />
0721/161 36 85 oder per E-Mail an<br />
<strong>in</strong>fo@stattreisen-karlsruhe.de. Weitere Infos<br />
gibt es unter www.stattreisen-karlsruhe.de.<br />
8. Dezember, Halle (Saale): Adventsfahrten<br />
mit historischen <strong>Straßenbahn</strong>en, jeweils<br />
12 bis 18 Uhr, Informationen über<br />
H. BODMER<br />
das enge Tal des Le Trients hoch an steilen<br />
Berghängen entlang. Die Strecke ist heute<br />
noch immer abschnittweise mit e<strong>in</strong>er seitlich<br />
angeordneten so genannten 3. Schiene<br />
ausgerüstet, welche die Triebwagen<br />
mit elektrischer Energie von 850 Volt<br />
Gleichstrom versorgt. E<strong>in</strong> Umbau auf<br />
Fahrleitungsbetrieb kommt wegen des<br />
teilweise engen Profils <strong>in</strong> den langen<br />
Schneeschutzgalerien kaum <strong>in</strong> Frage. Die<br />
Strecke auf französischem Gebiet wird<br />
ebenfalls mit 3. Schiene betrieben, die Betriebsführung<br />
obliegt der SNCF.<br />
Hallesche <strong>Straßenbahn</strong>freunde e.V., Seebener<br />
Straße 191, 06114 Halle (Saale).<br />
8./9. Dezember, <strong>Dresden</strong>: Der Vere<strong>in</strong><br />
<strong>Straßenbahn</strong>museum <strong>Dresden</strong> e. V. lädt zu<br />
den „Adventsöffnungstagen“ <strong>in</strong>s <strong>Straßenbahn</strong>museum<br />
nach <strong>Dresden</strong>-Trachenberge<br />
e<strong>in</strong>; geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr, E<strong>in</strong>trittspreise:<br />
3 EUR pro Person.<br />
9. Dezember, Bochum/Hatt<strong>in</strong>gen: Advent-Sonderverkehr<br />
der VhAG BOGESTRA<br />
zwischen Bochum und Hatt<strong>in</strong>gen. Es verkehren<br />
zwei historische Triebwagen auf der<br />
L<strong>in</strong>ie 308. Zur Mitfahrt genügt e<strong>in</strong> gültiges<br />
VRR-Ticket. Der Vere<strong>in</strong> freut sich aber über<br />
jede Spende. Infos: www.vhag-bogestra.de<br />
12. Dezember, Chemnitz: Fototerm<strong>in</strong> ab<br />
16 Uhr im <strong>Straßenbahn</strong>-Betriebshof Adelsberg<br />
sowie am 5. Dez. ab 10 Uhr im Omnibus-Btf.<br />
(Werner-Seelenb<strong>in</strong>der-Str. 13) für<br />
jeweils max. zwei Stunden. Voranmeldung<br />
Als der Vere<strong>in</strong> Tram-Museum Zürich im<br />
Jahre 1967 gegründet wurde, er<strong>in</strong>nerte<br />
man sich an diesen LSB-Wagen. Da der<br />
Xe 2/2 Nr. 81 <strong>in</strong> der Zwischenzeit von der<br />
MC kaum mehr gebraucht wurde, war die<br />
Möglichkeit geboten, dieses Fahrzeug wieder<br />
nach Zürich zurückzuholen was dann<br />
im Jahr 1974 geschah. Man beabsichtigte<br />
dieses Fahrzeug als Ce 2/2 Nr. 2 der LSB<br />
<strong>in</strong> fahrtüchtigen Zustand zurückzubauen,<br />
was dann <strong>in</strong> unzähligen Frondienststunden<br />
realisiert wurde. Beim Bearbeiten der Aussenwände<br />
des Wagenkastens kam die ursprüngliche<br />
gelbe Farbe der LSB sowie der<br />
rote Schriftzug „LIMMATTAL-STRASSEN-<br />
BAHN“ mitsamt der Wagennummer 2 wieder<br />
zum Vorsche<strong>in</strong>. Der Wagenkasten war<br />
jedoch <strong>in</strong> sehr schlechtem Zustand, so dass<br />
er weitgehend neu aufgebaut wurde.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs konnten viele Teile der Innenausrüstung<br />
nach der Aufarbeitung ver -<br />
wendet werden. Das Untergestell mit den<br />
Fahrmotoren und Kontrollern konnten<br />
übernommen werden.<br />
Heute präsentiert sich der Ce 2/2 Nr. 2,<br />
liebevoll „Lisebethli“ genannt, wieder <strong>in</strong><br />
glanzvollem Zustand und kann auf dem<br />
Netz der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) e<strong>in</strong>gesetzt<br />
werden. Hans Bodmer, Zürich<br />
Ob Tag der offenen Tür, Sonderfahrt oder Sym posium:<br />
Veröffentlichen <strong>Sie</strong> Ihren Term<strong>in</strong> hier kostenlos.<br />
Fax (0 89) 13 06 99-700 · E-Mail: redaktion@geramond.de<br />
erforderlich bei A. Förster, Tel. 0371/2370-<br />
252. Veranstalter: Chemnitzer Verkehrs-<br />
AG (CVAG), Carl-von-Ossietzky-Str. 186,<br />
09127 Chemnitz, www.cvag.de.<br />
15. Dezember, Halle (Saale): Adventsfahrten<br />
mit historischen <strong>Straßenbahn</strong>en,<br />
jeweils 12 bis 18 Uhr, Informationen über<br />
Hallesche <strong>Straßenbahn</strong>freunde e.V., Seebener<br />
Straße 191, 06114 Halle (Saale).<br />
16. Dezember, Gelsenkirchen: Advent-Sonderverkehr<br />
der VhAG BOGESTRA<br />
<strong>in</strong> Gelsenkirchen. An diesem Tag verkehren<br />
zwei historische Triebwagen auf den<br />
L<strong>in</strong>ien 301 und 302. Zur Mitfahrt genügt<br />
e<strong>in</strong> gültiges VRR-Ticket.<br />
22. Dezember, Halle (Saale): Adventsfahrten<br />
mit historischen <strong>Straßenbahn</strong>en,<br />
jeweils 12 bis 18 Uhr, Informationen über<br />
Hallesche <strong>Straßenbahn</strong>freunde e.V., Seebener<br />
Straße 191, 06114 Halle (Saale).<br />
78 <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012
Zu »Letzte von e<strong>in</strong>st Dreien«<br />
(SM 10/2012)<br />
Attraktiver nach<br />
Friesenheim<br />
Dieser Beitrag im SM 10/2012 berichtet<br />
ausführlich über die Ausdünnung des<br />
<strong>Straßenbahn</strong>angebots, das für die Bürger<br />
des Ludwigshafener Stadtteils Friesenheim<br />
<strong>in</strong> den letzten Jahren immer weniger attraktiv<br />
wurde. So nimmt die verbliebene<br />
L<strong>in</strong>ie 10 auf ihrem letzten Stück nach Friesenheim<br />
entsprechend der früheren L<strong>in</strong>ie<br />
11 wieder Kurs Richtung Innenstadt, endet<br />
dann aber – ohne Anschluss dorth<strong>in</strong> – <strong>in</strong><br />
Friesenheim Mitte (siehe Plan im SM<br />
10/2012). Hier wird die <strong>Straßenbahn</strong> gewendet<br />
bzw. umgesetzt, um die Rückfahrt<br />
zum Luitpoldhafen wieder durch Friesenheim<br />
zu nehmen. Dieser Vorgang wird<br />
auch <strong>in</strong> den Darstellungen eben nur e<strong>in</strong>mal<br />
erwähnt. Auch bei den Verkehrsbetrieben<br />
wurden die negativen Auswirkungen offensichtlich<br />
unterschätzt. E<strong>in</strong>e ähnliche Untersuchung,<br />
wie ich sie durchgeführt habe,<br />
wurde vermutlich nie gemacht.<br />
Das Umsetzen e<strong>in</strong>er Bahn ist <strong>in</strong>sgesamt<br />
viel zu umständlich, zu zeitaufwändig, zu<br />
anwohner- und umweltfe<strong>in</strong>dlich. Bei<br />
64 Fahrten täglich (montags bis freitags)<br />
s<strong>in</strong>d nach me<strong>in</strong>en persönlichen Aufzeichnungen<br />
und Messungen alle<strong>in</strong> für den Umsetzungsvorgang<br />
über den Tag vier Stunden<br />
und 40 M<strong>in</strong>uten erforderlich. Durch diese<br />
Wendemanöver kommt es regelmäßig zu<br />
erheblichen E<strong>in</strong>griffen <strong>in</strong> den fließenden<br />
Straßenverkehr (vor allem <strong>in</strong> der Sternstraße,<br />
Verb<strong>in</strong>dung von der BASF nach Oggersheim).<br />
Die Folgen s<strong>in</strong>d Staubildungen, mit<br />
all ihren volkswirtschaftlichen bekannten<br />
negativen Auswirkungen – und das mehr<br />
oder weniger heftig 64 Mal am Tag. Innerhalb<br />
e<strong>in</strong>er Woche (Montag bis Sonntag) s<strong>in</strong>d<br />
genau 400 Umsetzungen erforderlich. Die<br />
hierfür aufzuwendende Zeit beträgt etwas<br />
mehr als 29 Stunden. Das s<strong>in</strong>d etwa 75 Prozent<br />
der Arbeitszeit e<strong>in</strong>es Tarifangestellten.<br />
Bei e<strong>in</strong>em Monatsverdienst von geschätzten<br />
2.000 Euro s<strong>in</strong>d das 1.500 Euro, was e<strong>in</strong>em<br />
E<strong>in</strong>sparpotenzial von 18.000 Euro jährlich<br />
entspricht. Hierbei müssten bei den Verantwortlichen<br />
eigentlich die betriebswirtschaftlichen<br />
Alarmglocken läuten.<br />
Wenn die <strong>Straßenbahn</strong> am „Endhaltepunkt“<br />
Friesenheim Mitte e<strong>in</strong>fach ohne<br />
großen Aufenthalt direkt weiter geradeaus<br />
Richtung Innenstadt – wie jahrzehntelang<br />
praktiziert – fährt, ist sie bereits nach sechs<br />
M<strong>in</strong>uten am Rathaus. Teile dieser Strecke<br />
(Carl-Bosch-Str.) wurden e<strong>in</strong> Jahr vor der<br />
Stilllegung saniert. Die wiederholt gehörte<br />
Aussage, dass auch dort die Gleise marode<br />
wären, ist def<strong>in</strong>itiv falsch.<br />
E<strong>in</strong>e weitere Voraussetzung zur Verbesserung<br />
der Rentabilität der L<strong>in</strong>ie 10 wäre:<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
Die Bahnen müssen ständig fahren. Die<br />
Stand- und Umsetzungszeiten s<strong>in</strong>d mit<br />
20 Prozent viel zu lang, mit stehenden und<br />
rangierenden Bahnen wird ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ziger<br />
Cent e<strong>in</strong>genommen. E<strong>in</strong>ige Haltestellen<br />
sollten wegen ihrer räumlichen Nähe zum<br />
nächsten Halt aufgegeben werden. Ständig<br />
wird <strong>in</strong> Ludwigshafen gejammert, dass<br />
im Bereich der Innenstadt und vor allem<br />
<strong>in</strong> der Fußgängerzone Bismarckstraße zu<br />
viele Geschäfte leer stehen.<br />
Mit e<strong>in</strong>em direkten Anschluss Friesenheims<br />
an das Rathaus und die Ludwigstraße<br />
könnte man mit Sicherheit abgewanderte<br />
Kaufkraft wieder zurückholen. E<strong>in</strong><br />
effektiver, den Wünschen der Bevölkerung<br />
entsprechend funktionierender Nahverkehr<br />
würde von den hier lebenden Bürgern sicher<br />
gerne angenommen. Das würde sich<br />
dann natürlich auch auf der E<strong>in</strong>nahmenseite<br />
des Verkehrsverbundes positiv auswirken.<br />
Ich habe der Rhe<strong>in</strong>-Neckar-Verkehr<br />
GmbH bereits e<strong>in</strong>en Vorschlag zur Verbesserung/Optimierung<br />
der <strong>Straßenbahn</strong>l<strong>in</strong>ie<br />
10 unterbreitet.<br />
Peter Theis, Ludwigshafen<br />
Zu »Ke<strong>in</strong> Platz oder ke<strong>in</strong> Herz?«<br />
(SM 10/2012)<br />
Trams ke<strong>in</strong> Museumsgut?<br />
Im Leitbeitrag wurde die Räumung des<br />
Sammlungsbereichs „Städtischer Nahverkehr“<br />
im Dresdner Verkehrsmuseum<br />
(VMD) angesprochen. Dabei wurde als positiv<br />
bemerkt, dass alle „entfernten“ Fahrzeuge<br />
gut und überdacht untergekommen<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs ist das VMD nicht das erste<br />
Verkehrsmuseum <strong>in</strong> Deutschland, das <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>en Räumen Platz für „Bobby-Car-Bahnen“<br />
und Gastronomie geschaffen hat. Im<br />
Frankfurter Verkehrsmuseum wurden bereits<br />
vor etwa zwei bis drei Jahren <strong>in</strong>sgesamt<br />
sieben <strong>Straßenbahn</strong>-Fahrzeuge aus<br />
den Museumshallen <strong>in</strong> Stadtteil Schwanheim<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong> nicht zugängliches ehemaliges<br />
<strong>Straßenbahn</strong>depot verbannt. Dadurch<br />
wurde <strong>in</strong> der Westhalle des Museums Platz<br />
für kommerzielle Veranstaltungen, für Fahrten<br />
mit e<strong>in</strong>er Fahrrad-Drais<strong>in</strong>e, Bild-Ständer<br />
und Gastronomie geschaffen, während <strong>in</strong><br />
der Osthalle e<strong>in</strong> Fahrsimulator entstehen<br />
soll.<br />
Hier stelle ich mir ähnlich wie die<br />
Dresdner Tram-Freunde die Frage nach der<br />
Kompetenz der Museumsleitung. E<strong>in</strong> Fakt<br />
dürfte allerd<strong>in</strong>gs schon jetzt klar se<strong>in</strong>: Der<br />
städtische Nahverkehr lässt sich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
Entwicklung und Historie ohne Orig<strong>in</strong>al-<br />
Fahrzeugexponate <strong>in</strong> dieser Art und Weise<br />
nicht mehr darstellen.<br />
Norbert Kühmichel, Nidderau<br />
Aus Tradition.<br />
Fasz<strong>in</strong>ation Technik<br />
NEU!<br />
<strong>Sie</strong> ist aus dem öffentlichen Leben der großen Schweizer Städte<br />
nicht wegzudenken und erfreut sich wachsender Beliebtheit: die<br />
<strong>Straßenbahn</strong>. Alles über Gegenwart und Geschichte der eidgenössischen<br />
Trams und <strong>Straßenbahn</strong>betriebe weiß dieses mit<br />
historischen Fotos anregend bebilderte Porträt. Rollmaterial,<br />
Netzerweiterungen, stillgelegte L<strong>in</strong>ien und neue Verb<strong>in</strong>dungen –<br />
Bahnexperte Ralph Bernet gibt Auskunft. Umfassend, kompetent,<br />
hoch <strong>in</strong>formativ.<br />
144 Seiten · ca. 240 Abb. · 22,3 x 26,5 cm<br />
€ [A] 30,80 · sFr. 39,90<br />
ISBN 978-3-86245-122-7 € 29,95<br />
144 Seiten · ca. 200 Abb.<br />
22,3 x 26,5 cm<br />
€ [A] 30,80 · sFr. 39,90<br />
ISBN 978-3-86245-104-3<br />
€ 29,95<br />
144 Seiten · ca. 200 Abb.<br />
22,3 x 26,5 cm<br />
€ [A] 30,80 · sFr. 39,90<br />
ISBN 978-3-86245-148-7<br />
€ 29,95<br />
NEU!<br />
www.geramond.de<br />
oder gleich bestellen unter<br />
Tel. 0180-532 16 17 (0,14 €/M<strong>in</strong>.)<br />
www.geramond.de
Literatur · Impressum<br />
Nummer 278 • 12/2012 • Dezember • 43. Jahrgang<br />
Mit der Tram <strong>in</strong> den Wald<br />
<strong>Sie</strong> dürfte unter Deutschlands Kle<strong>in</strong>en<br />
die bekannteste se<strong>in</strong>: Die Thür<strong>in</strong>gerwaldbahn,<br />
die seit 1929 von Gotha aus die Erholungsorte<br />
im Thür<strong>in</strong>gerwald wie Friedrichroda<br />
oder Tabarz erschließt. Dass sie<br />
e<strong>in</strong> „Anhängsel“ hat, die <strong>Straßenbahn</strong> <strong>in</strong><br />
Gotha, wird oft übersehen. Doch der Betrieb,<br />
der heute als „Thür<strong>in</strong>gerwaldbahn<br />
und <strong>Straßenbahn</strong> Gotha“ formiert, bietet<br />
nicht nur dem Fan viel Atmosphäre, sondern<br />
weist auch e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>teressante und abwechslungsreiche<br />
Geschichte auf.<br />
In se<strong>in</strong>er Reihe „Auf Schienen unterwegs“<br />
hat der auf Regionalgeschichte<br />
ausgerichtete Suttonverlag nun e<strong>in</strong>en<br />
Band über die Thür<strong>in</strong>gerwaldbahn samt<br />
Gothaer <strong>Straßenbahn</strong> vorgelegt, der beide<br />
Betriebsteile gleichberechtigt behandelt.<br />
Der Autor Matthias Wenzel lässt <strong>in</strong> dem<br />
Band, der wie immer als Bildband konzipiert<br />
ist, die Geschichte des meterspurigen<br />
Schienennahverkehrs <strong>in</strong> und um Gotha<br />
chronologisch Revue passieren. Immerh<strong>in</strong><br />
gehörte Gotha zu den ersten deutschen<br />
Städten, die e<strong>in</strong>e elektrische <strong>Straßenbahn</strong><br />
e<strong>in</strong>führten. Wie <strong>in</strong> anderen mittelgroßen<br />
Postleitzahlgebiet 0<br />
Thalia-Buchhandlung, 02625 Bautzen,<br />
Kornmarkt 7 · Fachbuchhandlung<br />
Hermann Sack, 04107 Leipzig, Harkortstr.<br />
7<br />
Postleitzahlgebiet 1<br />
Schweitzer Sortiment, 10117 Berl<strong>in</strong>,<br />
Französische Str. 13/14 · Struppe &<br />
W<strong>in</strong>ckler Berl<strong>in</strong>, 10117 Berl<strong>in</strong>,<br />
Kronenstr. 42 · Loko Motive Fachbuchhandlung,<br />
10777 Berl<strong>in</strong>, Regensburger<br />
Str. 25 · Modellbahnen & Spielwaren<br />
Michael Turberg, 10789 Berl<strong>in</strong>,<br />
Lietzenburger Str. 51 · Buchhandlung<br />
Flügelrad, 10963 Berl<strong>in</strong>, Stresemannstr.<br />
107 · Modellbahn-Pietsch,<br />
12105 Berl<strong>in</strong>, Prühßstr. 34<br />
Postleitzahlgebiet 2<br />
Boysen + Mauke, 22772 Hamburg,<br />
Postfach 570333 · Buchhandlung<br />
Bernd Kohrs, 22927 Großhansdorf,<br />
Eilbergweg 5A · Roland Modellbahnstudio,<br />
28217 Bremen, Wartburgstr.<br />
59<br />
Postleitzahlgebiet 3<br />
Buchhandlung Decius, 30159 Hannover,<br />
Marktstr. 52 · Tra<strong>in</strong> & Play, 30159<br />
Hannover, Breite Str. 7 · Buchhandlung<br />
Graff, 38012 Braunschweig, Postfach<br />
2243 · Pfankuch Buch, 38023 Braunschweig,<br />
Postfach 3360<br />
Postleitzahlgebiet 4<br />
Buchhaus Antiquariat, 40217 Düsseldorf,<br />
Friedrichstr. 24-26 · Menzels Lokschuppen,<br />
40217 Düsseldorf, Friedrichstr.<br />
6 · Goethe-Buchhandlung,<br />
40549 Düsseldorf, Will stätterstr. 15 ·<br />
Modellbahnladen Hilden, 40704 Hilden,<br />
Postfach 408 · Buchhandlung<br />
Irmgard Barnes, 42855 Remscheid,<br />
Städten auch, verkehrte hier ab 1894 gleich<br />
e<strong>in</strong>e Elektrische, erbaut und betrieben von<br />
der UEG (Union Electricitäts-Gesellschaft,<br />
dem deutschen Ableger von Edison). Wie<br />
damals häufiger der Fall, entstand die Tram<br />
auch als Abnehmer für e<strong>in</strong> gleichzeitig errichtetes<br />
E-Werk. Mit dem regelmäßigen<br />
Strombezug durch die Tram konnten die<br />
Kraftwerksanlagen besser ausgelastet und<br />
zusätzlich Umsatz generiert werden.<br />
In fünf reichhaltig bebilderten Hauptkapiteln<br />
stellt Wenzel zuerst die Frühzeit der<br />
Tram Gotha vor, streift dann die lange Baugeschichte<br />
der Thür<strong>in</strong>gerwaldbahn, die sich<br />
über fast zwei Jahrzehnte h<strong>in</strong>zog, und folgt<br />
der Geschichte bis 1945. Im dritten Teil bezieht<br />
er den Waggonbau <strong>in</strong> Gotha mit e<strong>in</strong>,<br />
entstand doch e<strong>in</strong> Großteil der Fahrzeuge<br />
vor Ort. Über die DDR-Zeit, als die <strong>in</strong>nerstädtischen<br />
Strecken teilweise neu verlegt<br />
wurden, kommt Wenzel zur Gegenwart, die<br />
allerd<strong>in</strong>gs nur am Rande behandelt wird.<br />
Auch im farbigen Schlusskapitel liegt der<br />
Schwerpunkt auf der Geschichte der Thür<strong>in</strong>gerwaldbahn.<br />
Die Chronologie endet<br />
pr<strong>in</strong>zipiell mit den ersten, <strong>in</strong> den 1990er-<br />
In diesen Fachgeschäften erhalten <strong>Sie</strong> das <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Hastener Str. 41 · Rolf Kerst Fachbuchhandlung,<br />
47051 Duisburg, Ton -<br />
hallenstr. 11a · Fach buchhandlung Jürgen<br />
Donat, 47058 Duis burg,<br />
Ottilienplatz 6 · WIE – MO, 48145<br />
Münster, Warendorfer Str. 21<br />
Postleitzahlgebiet 5<br />
Technische Spielwaren Kar<strong>in</strong> L<strong>in</strong>denberg,<br />
50676 Köln, Blaubach 6-8 · Modellbahn-Center<br />
Hüner be<strong>in</strong>, 52062<br />
Aachen, Markt 11-15 · Mayersche<br />
Buchhandlung, 52064 Aachen, Matthiashofstr.<br />
28-30 · Buchhand lung<br />
Carl Machwirth, 55221 Alzey, Postfach<br />
1380 · Buchhandlung Karl Kerst<strong>in</strong>g,<br />
58095 Hagen, Bergstr. 78 · A. Ste<strong>in</strong> -<br />
sche Buchhand lung, 59457 Werl,<br />
Postfach 6064<br />
Postleitzahlgebiet 6<br />
Kerst & Schweitzer, 60486 Frankfurt,<br />
Solms str. 75 · Thalia Medienservice,<br />
65205 Wies baden, Otto-von-Guericke-R<strong>in</strong>g<br />
10 · Buch handlung Dr. Kohl,<br />
67059 Ludwigs hafen, Ludwigstr. 44-<br />
46 · Modelleisen bahnen Alexander<br />
Schuhmann, 69214 Eppelheim, Schützenstr.<br />
22<br />
Postleitzahlgebiet 7<br />
Stuttgarter Eisenbahn-u.Verkehrsparadies,<br />
70176 Stuttgart, Leuschnerstr. 35<br />
· Buchhandlung Wilhelm Messerschmidt,<br />
70193 Stuttgart, Schwabstr.<br />
96 · W. Kohlhammer Verlag, 70565<br />
Stuttgart, Heßbrühlstr. 69 · Buchhandlung<br />
Albert Müller, 70597 Stutt gart,<br />
Epplestr. 19C · Eisen bahn-Treffpunkt<br />
Schweickhardt, 71334 Waibl<strong>in</strong>gen,<br />
Biegel wiesenstr. 31 · Osiandersche<br />
Buch handlung, 72072 Tüb<strong>in</strong>gen, Unter<br />
dem Holz 25 · Buch verkauf Alfred<br />
Jung<strong>in</strong>ger, 73312 Geis l<strong>in</strong>gen, Karlstr.<br />
14 · Buchhandlung Robert Baier,<br />
74564 Crailsheim, Karlstr. 27 · Service<br />
rund ums Buch Uwe Mumm, 75180<br />
Pforzheim, Hirsauer Str. 122 · Modellbahnen<br />
Mössner, 79261 Gutach,<br />
Landstr. 16 A<br />
Postleitzahlgebiet 8<br />
Fachbuchhandlung Schweitzer Sortiment,<br />
80295 München, Postfach ·<br />
Fachbuchzentrum & Antiquariat Stiletto,<br />
80634 München, Schulstr. 19 ·<br />
Buchhandlung & Antiquariat He<strong>in</strong>rich<br />
Hugen dubel, 80636 München, Albrechtstr.<br />
14 · Buch handlung Am Gasteig,<br />
81669 München, Ro sen heimer<br />
Str. 12 · Adler Präzisonsmodelle,<br />
82054 Sauerlach, Hirschbergstr. 33 ·<br />
Augsburger Lok schuppen, 86199<br />
Augsburg, Gögg<strong>in</strong>ger Str. 110 · Verlag<br />
Benedikt Bickel, 86529 Schroben -<br />
hausen, Ingolstädter Str. 54<br />
Postleitzahlgebiet 9<br />
Buchhandlung Jakob, 90402 Nürnberg,<br />
Hefners platz 8 · Modellbahnvertrieb<br />
Gisela Scholz, 90451 Nürnberg,<br />
Nördl<strong>in</strong>ger Str. 13 · Modell spielwaren<br />
Helmut Sigmund, 90478 Nürnberg,<br />
Schweiggerstr. 5 · Buchhandlung<br />
Rupprecht, 92648 Vohenstrauß, Zum<br />
Beckenkeller 2 · Fried rich Pustet & .,<br />
94032 Passau, Nibe lun gen platz 1 ·<br />
Schön<strong>in</strong>gh Buchhandlung & ., 97070<br />
Würz burg, Franziskanerplatz 4<br />
Österreich<br />
Buchhandlung Herder, 1010 Wien,<br />
Wollzeile 33 · Modellbau Pospischil,<br />
1020 Wien, Novaragasse 47 · Technische<br />
Fachbuch handlung, 1040 Wien,<br />
Wiedner Hauptstr. 13 · Leporello – die<br />
Jahren nach Gotha gekommenen ex-<br />
Mannheimer und ex-Bochumer Düwags,<br />
deren Zeit <strong>in</strong>zwischen zu Ende ist.<br />
Das Buch bietet e<strong>in</strong>e Fülle seltener, historischer<br />
Aufnahmen. Wie immer bei Sutton<br />
hat man zugunsten e<strong>in</strong>er Vielzahl an<br />
Bildern auf die bei manchem Motiv wünschenswerte<br />
großformatige Wiedergabe<br />
verzichtet. Das ist e<strong>in</strong> Manko, das aber<br />
von der Abwechslung, die das Buch bietet,<br />
wie auch dem günstigen Anschaffungspreis<br />
wettgemacht wird.<br />
STEFAN VOCKRODT<br />
Wenzel, Matthias: Die Gothaer <strong>Straßenbahn</strong><br />
und Thür<strong>in</strong>gerwaldbahn,<br />
128 S., DIN A5, Softcover, zahlreiche<br />
Abbildungen und Pläne, Suttonverlag,<br />
Erfurt 2011, ISBN 978-3-86680-<br />
914-7, Preis 18,95 EUR<br />
Buchhandlung, 1090 Wien, Liechtenste<strong>in</strong>str.<br />
17 · Buchhandlung Mora wa,<br />
1127 Wien, Postfach 99 · Buchhandlung<br />
Johannes Heyn, 9020 Klagenfurt,<br />
Kramergasse 2-4<br />
Belgien<br />
Musée du Transport Urba<strong>in</strong> Bruxellois,<br />
1090 Brüssel, Boulevard de Smet de<br />
Naeyer 423/1 · Ferivan Modelbouw,<br />
2170 Merksem (Antwer pen), Postbus<br />
55<br />
Schweiz<br />
Zeitschriftenagentur Huber & Lang,<br />
3000 Bern 9 Postfach<br />
Tschechien<br />
Rezek Pragomodel, 110 00 Praha 1<br />
Klimentska 32<br />
Dänemark<br />
Peter Andersens Forlag, 2640 Hedehusene,<br />
Brandvaenget 60<br />
Spanien<br />
Librimport, 8027 Barcelona, Ciudad<br />
de Elche 5<br />
Großbritannien<br />
A B O U T, GU46 6LJ, Yateley, 4 Borderside<br />
Luxemburg<br />
G.A.R. Dokumentation, 8398 Roodt,<br />
Nouspelterstrooss 2<br />
Niederlande<br />
van Stockum Boekverkopers, 2512 GV,<br />
Den Haag, Weste<strong>in</strong>de 57 · Railpress<br />
Papendrecht, 2951 GN, Alblasserdam,<br />
Plantageweg 27-D · NVBS W<strong>in</strong>kel,<br />
3800 BJ, Amersfoort, Postbus 1384 ·<br />
Norsk Modelljernbane AS, 6815 ES,<br />
Arnheim, Kluizeweg 474<br />
Betriebe<br />
Fahrzeuge<br />
Geschichte<br />
www.strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de<br />
Redaktionsanschrift:<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
Postfach 40 02 09 · D-80702 München<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.720<br />
Fax + 49 (0) 89.13 06 99.700<br />
redaktion@strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de<br />
Verantw. Redakteur:<br />
André Marks, andre.marks@geramond.de<br />
Redaktion:<br />
Michael Krische (CvD), Thomas Hanna-Daoud<br />
Redaktion <strong>Straßenbahn</strong> im Modell:<br />
Jens-Olaf Griese-Bande low,<br />
jobandelow@geramond.de<br />
Redaktionsteam:<br />
Berthold Dietrich-Vandon<strong>in</strong>ck, Michael Kochems,<br />
Philipp Krammer, Bernhard Kuß magk,<br />
Dr. Mart<strong>in</strong> Pabst, Axel Reuther, Robert Schrempf,<br />
Michael Sperl<br />
Redaktionsassistenz: Brigitte Stuiber<br />
ABO –HOTLINE<br />
Leserservice, GeraMond-Programm<br />
Tel. 0180 – 532 16 17 (14 ct/m<strong>in</strong>.)<br />
Fax 0180 – 532 16 20 (14 ct/m<strong>in</strong>.)<br />
leserservice@strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de<br />
Gesamtanzeigenleitung:<br />
Helmut Kramer<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.270<br />
helmut.kramer@verlagshaus.de<br />
Anz.-leitung <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>:<br />
Helmut Gassner<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.520<br />
helmut.gassner@verlagshaus.de<br />
Anzeigendispo <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>:<br />
Tel. + 49 (0) 89.13 06 99.130<br />
anzeigen@verlagshaus.de<br />
www.verlagshaus-media.de<br />
Es gilt Anzeigenpreisliste Nr. 22 vom 1.1.2012<br />
Layout: Axel Ladleif<br />
Litho: Cromika, Verona<br />
Druck: Stürtz GmbH,<br />
Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg<br />
Verlag:<br />
GeraMond Verlag GmbH,<br />
Infanteriestraße 11a, 80797 München<br />
Geschäftsführung:<br />
Clemens Hahn, Carsten Le<strong>in</strong><strong>in</strong>ger<br />
Herstellungsleitung:<br />
Sandra Kho<br />
Vertrieb Zeitschriften:<br />
Dr. Reg<strong>in</strong>e Hahn<br />
Vertrieb/Auslieferung Handel:<br />
MZV, Moderner Zeitschriftenvertrieb<br />
GmbH & Co. KG, Unterschleißheim<br />
Im selben Verlag ersche<strong>in</strong>en außerdem:<br />
Preise: E<strong>in</strong>zelheft Euro 8,50 (D), Euro 9,50 (A),<br />
sFr. 15,90 (CH), bei E<strong>in</strong>zelversand zzgl. Porto;<br />
Jahresabopreis (12 Hefte) Euro 91,80 (<strong>in</strong>cl. MwSt.,<br />
im Ausland zzgl. Versandkosten)<br />
Ersche<strong>in</strong>en und Bezug: <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> ersche<strong>in</strong>t<br />
monatlich. <strong>Sie</strong> erhalten die Reihe <strong>in</strong> Deutsch land,<br />
<strong>in</strong> Österreich und <strong>in</strong> der Schweiz im<br />
Bahnhofs buchhandel, an gut sortierten Zeitschriftenki os -<br />
ken, im Fachbuchhandel sowie direkt beim Verlag.<br />
© by GeraMond Verlag. Die Zeitschrift und alle ihre<br />
enthaltenen Beiträge und Abbildungen s<strong>in</strong>d urheberrechtlich<br />
geschützt. Durch Annahme e<strong>in</strong>es Manu skripts erwirbt<br />
der Verlag das aus schließ liche Recht zur Ver öffentlichung.<br />
Für unverlangt e<strong>in</strong> gesandte Fotos wird ke<strong>in</strong>e Haftung<br />
übernommen. Gerichtsstand ist München.<br />
Ver antwortlich für den redaktionellen Inhalt: André Marks;<br />
verantwortlich für Anzeigen: Helmut Kramer,<br />
beide Infanteriestr. 11a, 80797 München.<br />
80<br />
ISSN 0340-7071 • 10815<br />
80
12x <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong><br />
+ Geschenk<br />
Ihr<br />
Willkommensgeschenk<br />
GRATIS!<br />
GT8SU<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>-Tasse<br />
Auf der neuen <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>-Tasse ist der<br />
Triebwagen der <strong>Sie</strong>bengebirgs- und <strong>Sie</strong>gburger Bahn<br />
abgebildet. Die Tasse ist <strong>in</strong> limitierter Auflage erschienen.<br />
✁<br />
Me<strong>in</strong> Vorteilspaket<br />
✓ Ich spare 10% (bei Banke<strong>in</strong>zug sogar 12%)!<br />
✓ Ich erhalte me<strong>in</strong> Heft 2 Tage vor<br />
dem Erstverkaufstag (nur im Inland)<br />
bequem nach Hause und verpasse<br />
ke<strong>in</strong>e Ausgabe mehr!<br />
✓ Ich kann nach dem ersten Jahr<br />
jederzeit abbestellen und erhalte<br />
zuviel bezahltes Geld zurück!<br />
✓ Zusätzlich 2013 <strong>in</strong> jeder Ausgabe:<br />
E<strong>in</strong> Exemplar der Fotoedition<br />
✗<br />
»Die schönsten <strong>Straßenbahn</strong>en«<br />
❑ JA, ich möchte me<strong>in</strong> <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>-Vorteilspaket<br />
Bitte schicken <strong>Sie</strong> mir das <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> ab sofort druckfrisch und mit 10% Preisvorteil für<br />
nur €7,65* pro Heft (Jahrespreis: €91,80*) monatlich frei Haus. Ich erhalte als Will kommens geschenk<br />
die neue STRAßENBAHN <strong>MAGAZIN</strong>-Tasse**. Versand erfolgt nach Bezahlung der ersten Rechnung.<br />
Ich kann das Abo nach dem ersten Bezugsjahr jederzeit kündigen.<br />
Bitte <strong>in</strong>formieren <strong>Sie</strong> mich künftig gern per E-Mail, Telefon oder Post über <strong>in</strong>teressante<br />
❑ Neuigkeiten und Angebote (bitte ankreuzen).<br />
<strong>Sie</strong> möchten noch mehr sparen?<br />
TW 316<br />
Das <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong>-Vorteilspaket<br />
Dann zahlen <strong>Sie</strong> per Bankab bu chung (nur im Inland möglich)<br />
und <strong>Sie</strong> sparen zusätzlich 2 % des Abopreises!<br />
Ja, ich will sparen und zahle künftig per Bankabbuchung<br />
❑ pro Quartal nur €22,50 ❑ pro Jahr nur €89,90<br />
TW 316<br />
WA-Nr. 620SM60152 – 62189179<br />
Ihr Geschenk<br />
Vorname/Nachname<br />
Straße/Hausnummer<br />
PLZ/Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail (für Rückfragen und weitere Infos)<br />
✗<br />
Datum/Unterschrift<br />
Kredit<strong>in</strong>stitut<br />
Kontonummer<br />
✗<br />
Datum/Unterschrift<br />
Bankleitzahl<br />
Bitte ausfüllen, ausschneiden oder kopieren und gleich senden an:<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> Leserservice, Postfach 1280, 82197 Gilch<strong>in</strong>g<br />
oder per Fax an 0180-532 16 20 (14 ct/m<strong>in</strong>.),<br />
per E-Mail: leserservice@strassenbahnmagaz<strong>in</strong>.de<br />
www.strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de/abo<br />
* Preise <strong>in</strong>kl. Mwst., im Ausland zzgl. Versandkosten<br />
** Solange Vorrat reicht, sonst gleichwertige Prämie
<strong>Vorschau</strong><br />
Heft 1/2013 mit großem<br />
KALENDERPOSTER!<br />
Liebe Leser,<br />
<strong>Sie</strong> haben<br />
Freunde, die<br />
sich ebenso<br />
für die<br />
<strong>Straßenbahn</strong><br />
mit all Ihren<br />
Facetten begeistern<br />
wie <strong>Sie</strong>? Dann empfehlen<br />
<strong>Sie</strong> uns doch weiter! Ich freue mich<br />
über jeden neuen Leser<br />
L. HABRECHT<br />
TOPTHEMA Berl<strong>in</strong>s Trams nach dem Mauerfall<br />
Vor mehr als 20 Jahren geschah <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> etwas <strong>in</strong> der deutschen Tramgeschichte E<strong>in</strong>maliges: Die Zusammen führung<br />
der Verkehrsnetze <strong>in</strong> der zuvor mehr als 40 Jahre politisch geteilten Stadt. Damit war e<strong>in</strong>e tiefgreifende<br />
L<strong>in</strong>iennetzumgestaltung verbunden, die <strong>in</strong> zwei Etappen zum 1. Juni 1991 bzw. 23. Mai 1993 umgesetzt wurde.<br />
Der Beitrag er<strong>in</strong>nert an diese Umbruchjahre, <strong>in</strong> denen sich auch im Fahrzeugsektor – z.B. durch die Außerdienst -<br />
stellung der Reko- und Gotha-Wagen – so vieles grundsätzlich änderte.<br />
Die für diese Ausgabe des <strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> angekündigte Wagenparkliste aller deutschen Straßen- und Stadtbahnbetriebe<br />
musste aus redaktionellen Gründen leider verschoben werden. <strong>Sie</strong> ist nun als Beilage für das Heft 2/2013 vorgesehen. Mit dem nächsten<br />
Heft 1/2013 erhalten <strong>Sie</strong> als Beilage e<strong>in</strong> großformatiges Kalenderposter mit e<strong>in</strong>em Motiv der Dortmunder <strong>Straßenbahn</strong> 1964!<br />
Maximum-Triebwagen<br />
<strong>in</strong> München – Teil 1<br />
Weitere Themen der kommenden Ausgabe<br />
Mit 550 Stück gab es <strong>in</strong> der bayerischen Metropole h<strong>in</strong>ter<br />
Berl<strong>in</strong> die meisten Maximum-Triebwagen (<strong>in</strong>nerhalb<br />
Deutschlands). Ab 1898 gab es <strong>in</strong> München derartige<br />
Fahrzeuge, die letztgebauten g<strong>in</strong>gen 1930 <strong>in</strong> den Betrieb.<br />
Axel Reuther stellt die e<strong>in</strong>zelnen e<strong>in</strong>st <strong>in</strong> Bayerns Hauptstadt<br />
e<strong>in</strong>gesetzten Typen vor. Ihr E<strong>in</strong>satz nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em zweiten Teil vorgestellt.<br />
Kle<strong>in</strong> und sympathisch<br />
– die Tram <strong>in</strong> Osijek (Kroatien)<br />
Der <strong>Straßenbahn</strong>betrieb im kroatischen Osijek (Essig) hat<br />
sich <strong>in</strong> den vergangenen Jahren „gemausert“! Neben e<strong>in</strong>er<br />
Streckenerweiterung gibt es zahlreiche Änderungen im Wagenpark<br />
vorzuweisen. Wolfgang Kaiser stellt diese Entwicklung<br />
vor – wie gewohnt mit brillanten Aufnahmen illustriert,<br />
z.B. von modernisierten Tatras und gebrauchten Düwags …<br />
W. KAISER<br />
Schweiz: 111 Jahre elektrischer<br />
Nahverkehr am Rhe<strong>in</strong>fall<br />
Schaffhausen war 1966 die letzte Stadt der Schweiz, die ihren<br />
<strong>Straßenbahn</strong>betrieb auf Trolleybusbetrieb umstellte. Ullrich<br />
Müller geht <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Bericht sowohl auf den meterspurigen<br />
Tram-Betrieb von e<strong>in</strong>st e<strong>in</strong> als auch auf die<br />
Entwicklung des O-Bus-Betriebes bis <strong>in</strong> die Gegenwart.<br />
Von »Schüttelrutschen« und<br />
»Schaukelpferden«<br />
In den 1950er- und 1960er-Jahren waren <strong>in</strong> vielen westdeutschen<br />
Betrieben zwei- und vierachsige Fahrzeuge <strong>in</strong><br />
Gelenkwagen umgebaut worden. Andreas Mausolf stellt<br />
vor, wo diese im Volksmund mit mal mehr oder weniger<br />
schmeichelhaften Be<strong>in</strong>amen versehenen Trams noch <strong>in</strong> den<br />
1980er Jahren anzutreffen waren. E<strong>in</strong> Bericht mit Aufnahmen<br />
aus Bielefeld, Mülheim, Wuppertal und Kassel.<br />
W. R. REIMANN<br />
André Marks,<br />
verantwortlicher Redakteur<br />
Das Allerletzte ...<br />
Vermietung wirklich<br />
nicht möglich?<br />
In Magdeburg werden derzeit die letzten<br />
Tatra-<strong>Straßenbahn</strong>en aus dem<br />
Betrieb genommen – die Lieferung<br />
neuer vom Konsortium Alstom-Bombardier<br />
gebauten NGT8D (Citadis<br />
200) macht es möglich.<br />
Wie bei derartigen Anlässen üblich,<br />
wollen viele Tram-Freunde die zur Abstellung<br />
vorgesehenen Fahrzeuge<br />
kurz vor deren E<strong>in</strong>satzende noch e<strong>in</strong>mal<br />
nach Herzenslust fotografieren.<br />
Bei fast allen Betrieben <strong>in</strong> Deutschland<br />
ist es <strong>in</strong> solchen Fällen möglich,<br />
e<strong>in</strong>en betreffenden Zug zu chartern.<br />
Wer für so etwas zahlt, für den wird<br />
diese kommerzielle Serviceleistung erbracht.<br />
E<strong>in</strong>e solche Charterfahrt stellt<br />
für das betreffende Unternehmen also<br />
e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e, aber doch nennenswerte<br />
E<strong>in</strong>nahmequelle dar.<br />
Doch siehe da! – Die Magdeburger<br />
Verkehrsbetriebe (MVB) teilten Tram-<br />
Freunden aus Magdeburg und Umgebung<br />
im Oktober schriftlich mit,<br />
dass „ke<strong>in</strong>e Zeit“ vorhanden sei, am<br />
bestellten Tag im November die gewünschten<br />
Fahrzeuge zu vermieten.<br />
Auf schriftliche Nachfrage benannten<br />
die MVB auch ke<strong>in</strong>en Ausweichterm<strong>in</strong>,<br />
an dem e<strong>in</strong> Tatra-Zug alternativ<br />
vermietet werden könnte. Mündlich<br />
hieß es, dass ke<strong>in</strong>e geeigneten Fahrzeuge<br />
mehr vorhanden seien, obwohl<br />
diese e<strong>in</strong>erseits noch im E<strong>in</strong>satz stehen<br />
und andererseits deren Anmietung<br />
auf dem Netzauftritt der MVB<br />
auch noch zu Redaktionsschluss Ende<br />
Oktober 2012 beworben wurden …<br />
Woran klemmt es aber dann? AM<br />
DAS <strong>STRASSENBAHN</strong>-<strong>MAGAZIN</strong> 1/2013 ersche<strong>in</strong>t am 17. Dezember 2012<br />
82<br />
… oder schon 2 Tage früher mit bis zu 36 % Preisvorteil und Geschenk-Prämie! Jetzt sichern unter www.strassenbahn-magaz<strong>in</strong>.de<br />
Plus Geschenk<br />
Ihrer Wahl:<br />
z.B. DVD »Trams<br />
im Wirtschafts -<br />
wunderland«
Das besondere Bild<br />
Das besondere Bild<br />
Wem w<strong>in</strong>ken die Trittbrettfahrer<br />
vom zweiachsigen<br />
Tw 143 <strong>in</strong><br />
Porto 1976 zu? Dem<br />
Fotografen aus<br />
Deutschland – oder der<br />
schönen Passant<strong>in</strong>, die<br />
vor der im Stau steckenden<br />
Tram die<br />
Straßenseite wechselt?<br />
Die Hafenstadt<br />
Porto war die erste<br />
Stadt Portugals, die<br />
den elektrischen <strong>Straßenbahn</strong>verkehr<br />
e<strong>in</strong>führte.<br />
Bereits 1895<br />
g<strong>in</strong>g die erste L<strong>in</strong>ie <strong>in</strong><br />
Betrieb – die Hauptstadt<br />
Lissabon folgte<br />
erst 1901. Im Jahr<br />
1950 erreichte das<br />
Tram-Netz <strong>in</strong> Porto<br />
mit 82 Streckenkilometern<br />
(150 km Gleislänge)<br />
se<strong>in</strong>e größte Ausdehnung.<br />
Ab den<br />
1960er-Jahren ersetzte<br />
die Betreibergesellschaft<br />
„Sociedade de<br />
Transportes Colectivos<br />
do Porto, S.A.“ (STCP)<br />
immer mehr <strong>Straßenbahn</strong>l<strong>in</strong>ien<br />
durch Busse.<br />
Es blieb lediglich<br />
e<strong>in</strong> eher für Touristen<br />
gedachter Restbetrieb,<br />
der heute aus den L<strong>in</strong>ien<br />
1, 18 und 22 besteht.<br />
Zum E<strong>in</strong>satz<br />
kommen darauf Tw<br />
mit Stangenstromabnehmern<br />
aus den Jahren<br />
1910 bis 1940, darunter<br />
auch der hier<br />
abgebildete Tw 143. Er<br />
war 1912 gebaut worden,<br />
hat aber verschiedene<br />
Modernisierungen<br />
h<strong>in</strong>ter sich.<br />
Übrigens: Nach der<br />
Umstellung auf Busverkehr<br />
stellte sich an<br />
Steigungsstrecken heraus,<br />
dass die alten<br />
Trams den neuen Bussen<br />
überlegen gewesen<br />
waren ...<br />
FOTO: OLAF GÜTTLER<br />
Text: AM<br />
<strong>STRASSENBAHN</strong> <strong>MAGAZIN</strong> 12 | 2012<br />
83
I n Bratislava fährt die Tram mitten<br />
durch das Stadtzentrum und passiert<br />
dabei auch das Slowakische<br />
Nationaltheater, aufgenommen im<br />
März 2007. Auch heute noch fährt<br />
hier ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ziger Wagen mit Niederfluranteil<br />
I Wolfgang Kaiser<br />
Außergewöhnliche Begegnung bei<br />
der Hannoverschen üstra: Am 14. Mai<br />
2011 brachte der Fotograf zwei<br />
6000er-Triebwagen und das B<strong>in</strong>nenschiff<br />
»Tom Burmeste«“ an der<br />
Limmer Schleuse zeitgleich <strong>in</strong>s Bild<br />
Erik Wendorff<br />
Vorsicht, Seitenw<strong>in</strong>d! Der Basler Tw 459 überquert auf der L<strong>in</strong>ie 15 die Mittlere Brücke<br />
über den Rhe<strong>in</strong> bei stürmischem Wetter I Herbert Schaudt<br />
27.10. Ende der Sommerzeit<br />
1.4. Ostermontag<br />
Wien ist immer noch e<strong>in</strong>e Hochburg<br />
der klassischen Düwags, die von<br />
österreichischen Firmen <strong>in</strong> Lizenz<br />
gebaut wurden. Hier ist der Wagen<br />
4829 am 14. April 2008 <strong>in</strong> der<br />
Währ<strong>in</strong>ger Straße stadte<strong>in</strong>wärts<br />
unterwegs<br />
Wolfgang Kaiser<br />
Wegen Problemen mit den neuen Niederflurbahnen musste der Sechsachser-E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> Graz im Jahr 2010 verlängert werden. Hier befährt<br />
der Wagen 263 die Erzherzog-Johann-Brücke über die Mur, aufgenommen am 8. April 2010 I Wolfgang Kaiser<br />
21.6. Sommeranfang<br />
20.11. Buß- und Bettag | 24.11. Totensonntag<br />
Seit mehr als 80 Jahren s<strong>in</strong>d die<br />
Vierachser des Typs »Ventotto« auf<br />
dem Mailänder <strong>Straßenbahn</strong>netz<br />
unterwegs. Die orange Farbgebung<br />
ist jedoch e<strong>in</strong> Auslaufmodell. <strong>Sie</strong><br />
weicht langsam e<strong>in</strong>er gelb-beigen<br />
Lackierung I Wolfgang Kaiser<br />
Zug um Zug, Tag für Tag<br />
www.geramond.de<br />
<strong>Straßenbahn</strong> 2013<br />
Bitte e<strong>in</strong>steigen: Stimmungsvolle Motive<br />
aus der ganzen Welt der <strong>Straßenbahn</strong>en<br />
begleiten <strong>Sie</strong> durchs Tram-Jahr 2013. Von<br />
altgedienten Klassikern wie dem Düwag-<br />
Triebwagen bis h<strong>in</strong> zu den topmodernen<br />
Trams bietet dieser Kalender spannende<br />
Szenen aus dem <strong>Straßenbahn</strong>-Alltag.<br />
27 Blätter / 36,5 x 25,5 cm<br />
€ [A] 15,95<br />
sFr. 24,90 € 15,95<br />
ISBN 978-3-86245-781-6<br />
Januar<br />
Mo 7<br />
Di 8<br />
Mi 9<br />
Do 10<br />
Fr 11<br />
Sa 12<br />
So 13<br />
Mo 14<br />
Di 15<br />
Mi 16<br />
Do 17<br />
Fr 18<br />
Sa 19<br />
So 20<br />
12013<br />
April<br />
Mo 1<br />
Di 2<br />
Mi 3<br />
Do 4<br />
Fr 5<br />
Sa 6<br />
So 7<br />
Mo 8<br />
Di 9<br />
Mi 10<br />
Do 11<br />
Fr 12<br />
Sa 13<br />
So 14<br />
42013<br />
Juni<br />
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So<br />
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 62013<br />
Juli /<br />
August<br />
Mo 22<br />
Di 23<br />
Mi 24<br />
Do 25<br />
Fr 26<br />
Sa 27<br />
So 28<br />
Mo 29<br />
Di 30<br />
Mi 31<br />
Do 1<br />
Fr 2<br />
Sa 3<br />
So 4<br />
82013<br />
November<br />
Mo 11<br />
Di 12<br />
Mi 13<br />
Do 14<br />
Fr 15<br />
Sa 16<br />
So 17<br />
Mo 18<br />
Di 19<br />
Mi 20<br />
Do 21<br />
Fr 22<br />
Sa 23 11<br />
So 24 2013<br />
Oktober<br />
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So<br />
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10<br />
2013<br />
Fasz<strong>in</strong>ation Technik<br />
www.geramond.de<br />
oder gleich bestellen unter<br />
Tel. 0180-532 16 17 (0,14 €/M<strong>in</strong>.)