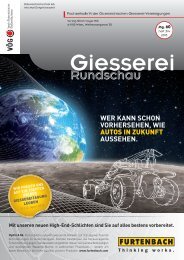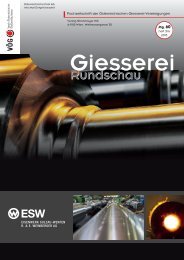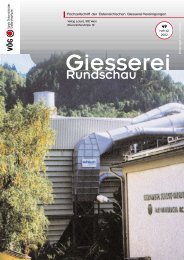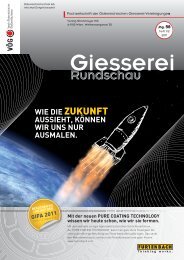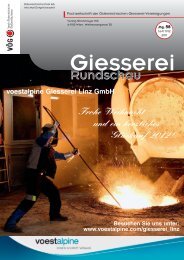9/10 - Verein österreichischer GieÃereifachleute
9/10 - Verein österreichischer GieÃereifachleute
9/10 - Verein österreichischer GieÃereifachleute
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
HEFT 9/<strong>10</strong> GIESSEREI-RUNDSCHAU 54 (2007)<br />
Bild 2:<br />
Membrangesteuerte<br />
Sprühdüse<br />
(1...Düsen-Wechselkappe,<br />
2...Anschluss für Wasser-<br />
Trennmittel-Gemisch,<br />
3...Anschluss für Sprühund<br />
Blasluft, 4...Anschluss<br />
für Steuerluft)<br />
Bild 3: Aufbau des Prüfstandes (1...Versuchsblock, 2...vertikale Linearachse<br />
mit Stellmotor, 3...horizontale Linearachse mit Stellmotor, 4...Trägerplatte für<br />
Sprühdüse, 5...Anschlussbohrungen für Temperierung)<br />
ter, so kommt es zu einem Punkt, an dem jeder Flüssigkeitstropfen<br />
beim Auftreffen auf die Oberfläche verdampft. An diesem Punkt<br />
wird die maximale Wärmeabfuhr erzielt. Unterhalb dieses Punktes<br />
beginnt der Bereich des Blasensiedens, bei dem sich Dampfblasen im<br />
direkten Kontakt mit der Oberfläche bilden und durch den darüber<br />
liegenden Flüssigkeitsfilm aufsteigen. Wird die Temperatur der Oberfläche<br />
weiter gesenkt, so wird die weitere Wärmeabfuhr durch Konvektionsvorgänge<br />
bestimmt und es kommt zu einer schlechteren<br />
Wärmeabfuhr [1, 2, 3].<br />
Das Aufbringen des Trennmittels führt zu einer abrupten Umkehr<br />
des Temperaturgradienten in der Nähe der Formoberfläche.<br />
Für die mechanischen Belastungen bedeutet dies einen Übergang<br />
vom Druck- in den Zugbereich. Da es sich beim Druckgießen um<br />
einen zyklischen Prozess handelt, wird die Druckgießform durch<br />
diese Praxis einer zyklischen Wechselbelastung ausgesetzt, welche<br />
die Form auf Dauer schädigt und zu deren Totalversagen führen<br />
kann.<br />
Ein Konsortium, bestehend aus dem MCL, dem ÖGI, Georg Fischer<br />
und Böhler Edelstahl arbeitet an einem Forschungsprojekt zur Lebensdaueroptimierung<br />
von Dauerformen. Ziel dieses Projekts ist es,<br />
die Werkzeugstandzeiten zu erhöhen und den Nachbearbeitungsaufwand<br />
zu minimieren. Dies soll unter anderem durch rechnergestützte<br />
Vorhersagen der Werkzeugbelastung geschehen. Um den gesamten<br />
Prozess des Druckgießens modellieren zu können, müssen entsprechende<br />
Eingangsdaten für die Simulation vorhanden sein. Daher<br />
wird am ÖGI zur Zeit ein Prüfstand zur Ermittlung von Wärmeübergangsdaten<br />
in Betrieb genommen. Der Prüfstand kann die relevanten<br />
Aspekte des Sprühens einer Druckgießform, wie Formtemperatur,<br />
Sprühmittelmenge, Bewegung des Sprühkopfes und Sprühdauer<br />
nachbilden. Aus den im Versuch gemessenen Temperaturdaten werden<br />
Werte für den Wärmeübergangskoeffizienten zwischen Sprühmittel<br />
und Formoberfläche abgeleitet.<br />
Aufbau des Prüfstandes<br />
Der Prüfstand besteht im Wesentlichen aus einem Block (500 mm<br />
x400 mm x75mm) aus Warmarbeitsstahl 1.2343 und einer einzelnen<br />
gegenüberliegenden Sprühdüse (Bild 2), welche über zwei Linearachsen<br />
mittels Stellmotoren waagrecht und senkrecht beweglich<br />
ist. Dabei ist die Konstruktion so ausgelegt, dass der Abstand<br />
der Düse von der Blockoberfläche variiert werden kann. Die beiden<br />
Komponenten sind auf ein gemeinsames Gestell aus Stahlprofilen<br />
montiert (Bild 3). Die Beheizung des Edelstahlblocks erfolgt mittels<br />
eines mäanderförmigen Kanals, durch welchen Temperieröl geleitet<br />
wird. Dieses wird mit einem Heizgerät, wie es im Druckguss verwendet<br />
wird, auf Temperatur gebracht. Die Blockoberfläche wird<br />
so auf Temperaturen von bis zu 350° Caufgeheizt. Die Auslegung<br />
des Temperiersystems wurde vorher mit der Software ANSYS<br />
Workbench simuliert. Ziel war es, dabei eine möglichst große, homogene<br />
Temperaturzone an der Oberfläche zu erzielen (Bild 4<br />
Seite 168). An der Blockoberfläche angepunktete Thermoelemente<br />
liefern die relevanten Temperaturwerte; diese sollen mit einer<br />
Thermokamera zusätzlich überprüft werden. Da der Sprühnebel<br />
und der bei der Verdampfung des Sprühmediums entstehende<br />
Dampf eine pyrometrische Temperaturbestimmung erschweren, ist<br />
man während des Sprühvorganges jedoch allein auf die Daten von<br />
sehr dünnen, an die Oberfläche angepunkteten Thermoelementen<br />
angewiesen. Die Kontrolle der Blockinnentemperatur erfolgt ebenfalls<br />
über Thermoelemente. Das von der Oberfläche des Blocks abfließende<br />
Wasser wird in einer Schale aufgefangen. Somit kann aus<br />
der Menge des verdampften Wassers sowie der Temperatur des<br />
abgeflossenen Wassers die dem Block entzogene Wärme abgeschätzt<br />
werden.<br />
Versuche<br />
In mehreren Versuchsreihen werden unterschiedliche Sprühparameter<br />
erprobt und Temperaturdaten aufgenommen. Augenmerk wird<br />
vor allem auf das Vorhandensein des Leidenfrost-Effektes im Bereich<br />
höherer Oberflächentemperaturen sowie einer prinzipiellen Abhängigkeit<br />
des Wärmeüberganges von der Oberflächentemperatur ge-<br />
167