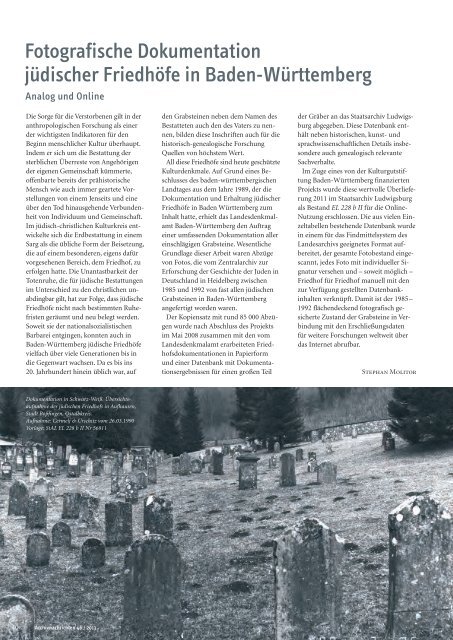Archivnachrichten Nr. 46 , März 2013 (application/pdf 2.8 MB)
Archivnachrichten Nr. 46 , März 2013 (application/pdf 2.8 MB)
Archivnachrichten Nr. 46 , März 2013 (application/pdf 2.8 MB)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fotografische Dokumentation<br />
jüdischer Friedhöfe in Baden-Württemberg<br />
Analog und Online<br />
Die Sorge für die Verstorbenen gilt in der<br />
anthropologischen Forschung als einer<br />
der wichtigsten Indikatoren für den<br />
Beginn menschlicher Kultur überhaupt.<br />
Indem er sich um die Bestattung der<br />
sterblichen Überreste von Angehörigen<br />
der eigenen Gemeinschaft kümmerte,<br />
offenbarte bereits der prähistorische<br />
Mensch wie auch immer geartete Vorstellungen<br />
von einem Jenseits und eine<br />
über den Tod hinausgehende Verbundenheit<br />
von Individuum und Gemeinschaft.<br />
Im jüdisch-christlichen Kulturkreis entwickelte<br />
sich die Erdbestattung in einem<br />
Sarg als die übliche Form der Beisetzung,<br />
die auf einem besonderen, eigens dafür<br />
vorgesehenen Bereich, dem Friedhof, zu<br />
erfolgen hatte. Die Unantastbarkeit der<br />
Totenruhe, die für jüdische Bestattungen<br />
im Unterschied zu den christlichen unabdingbar<br />
gilt, hat zur Folge, dass jüdische<br />
Friedhöfe nicht nach bestimmten Ruhefristen<br />
geräumt und neu belegt werden.<br />
Soweit sie der nationalsozialistischen<br />
Barbarei entgingen, konnten auch in<br />
Baden-Württemberg jüdische Friedhöfe<br />
vielfach über viele Generationen bis in<br />
die Gegenwart wachsen. Da es bis ins<br />
20. Jahrhundert hinein üblich war, auf<br />
den Grabsteinen neben dem Namen des<br />
Bestatteten auch den des Vaters zu nennen,<br />
bilden diese Inschriften auch für die<br />
historisch-genealogische Forschung<br />
Quellen von höchstem Wert.<br />
All diese Friedhöfe sind heute geschützte<br />
Kulturdenkmale. Auf Grund eines Beschlusses<br />
des baden-württembergischen<br />
Landtages aus dem Jahre 1989, der die<br />
Dokumentation und Erhaltung jüdischer<br />
Friedhöfe in Baden Württemberg zum<br />
Inhalt hatte, erhielt das Landesdenkmalamt<br />
Baden-Württemberg den Auftrag<br />
einer umfassenden Dokumentation aller<br />
einschlägigen Grabsteine. Wesentliche<br />
Grundlage dieser Arbeit waren Abzüge<br />
von Fotos, die vom Zentralarchiv zur<br />
Erforschung der Geschichte der Juden in<br />
Deutschland in Heidelberg zwischen<br />
1985 und 1992 von fast allen jüdischen<br />
Grabsteinen in Baden-Württemberg<br />
angefertigt worden waren.<br />
Der Kopiensatz mit rund 85 000 Abzügen<br />
wurde nach Abschluss des Projekts<br />
im Mai 2008 zusammen mit den vom<br />
Landesdenkmalamt erarbeiteten Friedhofsdokumentationen<br />
in Papierform<br />
und einer Datenbank mit Dokumentationsergebnissen<br />
für einen großen Teil<br />
der Gräber an das Staatsarchiv Ludwigsburg<br />
abgegeben. Diese Datenbank enthält<br />
neben historischen, kunst- und<br />
sprachwissenschaftlichen Details insbesondere<br />
auch genealogisch relevante<br />
Sachverhalte.<br />
Im Zuge eines von der Kulturgutstiftung<br />
Baden-Württemberg finanzierten<br />
Projekts wurde diese wertvolle Überlieferung<br />
2011 im Staatsarchiv Ludwigsburg<br />
als Bestand EL 228 b II für die Online-<br />
Nutzung erschlossen. Die aus vielen Einzeltabellen<br />
bestehende Datenbank wurde<br />
in einem für das Findmittelsystem des<br />
Landesarchivs geeignetes Format aufbereitet,<br />
der gesamte Fotobestand eingescannt,<br />
jedes Foto mit individueller Signatur<br />
versehen und – soweit möglich –<br />
Friedhof für Friedhof manuell mit den<br />
zur Verfügung gestellten Datenbankinhalten<br />
verknüpft. Damit ist der 1985–<br />
1992 flächendeckend fotografisch gesicherte<br />
Zustand der Grabsteine in Verbindung<br />
mit den Erschließungsdaten<br />
für weitere Forschungen weltweit über<br />
das Internet abrufbar.<br />
Stephan Molitor<br />
Dokumentation in Schwarz-Weiß. Übersichtsaufnahme<br />
des jüdischen Friedhofs in Aufhausen,<br />
Stadt Bopfingen, Ostalbkreis.<br />
Aufnahme: Cermelj & Urschitz vom 26.03.1990<br />
Vorlage: StAL EL 228 b II <strong>Nr</strong> 56811<br />
1<br />
40<br />
<strong>Archivnachrichten</strong> <strong>46</strong> / <strong>2013</strong>