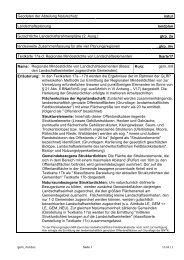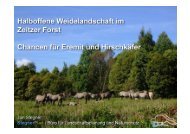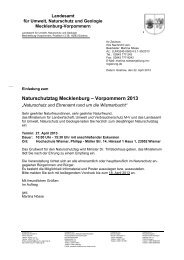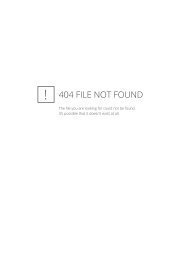Rote Liste der Moose - Landesamt für Umwelt, Naturschutz und ...
Rote Liste der Moose - Landesamt für Umwelt, Naturschutz und ...
Rote Liste der Moose - Landesamt für Umwelt, Naturschutz und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
11<br />
• Fehlende überregionale Vergleichbarkeit: Auseinan<strong>der</strong>driften von internationalen<br />
<strong>und</strong> nationalen Beurteilungsmethoden.<br />
• Fehlen<strong>der</strong> globaler Ansatz: Was bedeutet die regionale Einstufung als „vom Aussterben<br />
bedroht“ wirklich <strong>für</strong> das Aussterberisiko einer Art?<br />
• Fraglicher Beurteilungszeitraum: Ist die Zeit <strong>der</strong> höchsten Artenvielfalt in<br />
Mitteleuropa um 1850, wie in vielen <strong>Rote</strong>n <strong>Liste</strong>n, wirklich ein realistisches Leitbild<br />
<strong>für</strong> den mo<strong>der</strong>nen <strong>Naturschutz</strong>? Ist nicht schon die Stabilisierung <strong>der</strong> Arten<br />
auf heutigem (niedrigen) Niveau ein schwer zu erreichendes Ziel des <strong>Naturschutz</strong>es?<br />
• Fehlende Antwort auf natürliche Schwankungen: Ist eine negative Bestandsentwicklung<br />
einer Art wirklich bedrohlich <strong>für</strong> ihren Fortbestand <strong>und</strong> immer das<br />
Resultat anthropogener Faktoren?<br />
• Mangelnde Prioritätensetzung <strong>für</strong> den in-situ-Artenschutz: Wenn z. B. zwischen<br />
30 <strong>und</strong> 47 % <strong>der</strong> Gefäßpflanzen <strong>der</strong> deutschen B<strong>und</strong>eslän<strong>der</strong> (nach KORNECK et<br />
al. 1996) in <strong>der</strong> <strong>Rote</strong>n <strong>Liste</strong> stehen, wo soll <strong>der</strong> <strong>Naturschutz</strong> da ansetzen?<br />
Prioritätensetzung erfor<strong>der</strong>t weitere Bewertungsschritte (FITZPATRICK et al. 2007,<br />
BERG et al. 2008).<br />
• Äpfel <strong>und</strong> Birnen: Es ist schwer, Arten mit unterschiedlichsten Lebensweisen <strong>und</strong><br />
Lebenszyklen den Kategorien einer <strong>Rote</strong>n <strong>Liste</strong> zuzuordnen. Dies führt dazu,<br />
dass Arten mit recht unterschiedlichen Situationen in den jeweiligen Kategorien<br />
zusammengefasst werden.<br />
Einige dieser Unzulänglichkeiten werden also bleiben, da ein Abstellen zu neuen<br />
Problemen führt. Werden <strong>Rote</strong> <strong>Liste</strong>n zukünftig statt nach politischen Grenzen nach<br />
Naturraumgrenzen erstellt, bringt dies zwar <strong>für</strong> die einheitliche Beurteilung <strong>der</strong><br />
Objekte einen erheblichen Wissenszuwachs, hebt aber in <strong>der</strong> praktischen<br />
Durchsetzung die bisher klar geregelte politische Verantwortlichkeit <strong>für</strong> solch eine<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Liste</strong> auf. O<strong>der</strong> versucht man, die Kriterien aller <strong>Rote</strong>n <strong>Liste</strong>n <strong>der</strong> Erde zu vereinheitlichen,<br />
so wird dies bei manchen Objektgruppen zu Fehleinschätzungen<br />
führen, beispielsweise in <strong>der</strong> Frage <strong>der</strong> zeitlichen Schwellenwerte <strong>für</strong> das Kriterium<br />
„ausgestorben“ bzw. „verschollen“. So gilt es abzuwägen, welche Unzulänglichkeiten<br />
in Kauf genommen werden können. Deutschland verzichtet <strong>der</strong>zeit in seiner<br />
neu aufgestellten Methodik (LUDWIG et al. 2006) auf die internationale Vergleichbarkeit<br />
deutscher <strong>Rote</strong>r <strong>Liste</strong>n mit den IUCN-Kriterien (IUCN 2001), um wenigstens<br />
die in Deutschland erstellten <strong>Rote</strong>n <strong>Liste</strong>n nach einer einheitlichen Methode mit präzisen<br />
Kriterien bearbeiten zu lassen. Der Versuch, alle <strong>Rote</strong>n <strong>Liste</strong>n von Pflanzen<br />
<strong>und</strong> Tieren methodisch zu vereinheitlichen <strong>und</strong> zu mo<strong>der</strong>nisieren, ist lobenswert,<br />
obwohl bei einzelnen Organismengruppen wohl immer Son<strong>der</strong>lösungen geschaffen<br />
werden müssen. An<strong>der</strong>erseits ist die Abkehr von den internationalen IUCN-<br />
Standards das genaue Gegenteil von einer Vereinheitlichung <strong>der</strong> Methode, so dass<br />
Deutschland hier <strong>der</strong>zeit einen nationalen Alleingang vollzieht, <strong>der</strong> angesichts <strong>der</strong><br />
Internationalisierung des <strong>Naturschutz</strong>es durchaus in Frage gestellt werden kann.<br />
Ein Gr<strong>und</strong> <strong>für</strong> den Alleingang ist, dass die aktuellen IUCN-Standards (IUCN 2001,<br />
2006) die Aussterbewahrscheinlichkeit einer Art als alleinige Messlatte <strong>für</strong> den<br />
Gefährdungsgrad ansehen, während LUDWIG et al. (2006) in Deutschland auch den<br />
Rückzug von Arten aus <strong>der</strong> Landschaft bereits als Signal <strong>für</strong> eine Aufnahme in eine<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Liste</strong> werten möchten. Die Kritik Deutschlands ist nicht unberechtigt, führt dieser<br />
Weg doch leicht wie<strong>der</strong> zurück zum Seltenheiten-Ansatz, insbeson<strong>der</strong>e bei<br />
schlechter Datenlage (ROBBIRT et al. 2006). Lösungsvorschläge <strong>der</strong> IUCN<br />
(GÄRDENFORS et al. 2001) haben LUDWIG et al. (2006) offensichtlich nicht überzeugt.<br />
<strong>Rote</strong> <strong>Liste</strong>n sind auch in Zukunft bedeutende Instrumente des <strong>Naturschutz</strong>es. Das