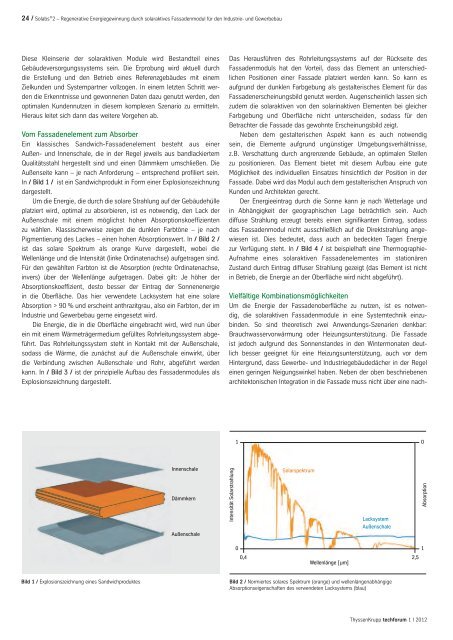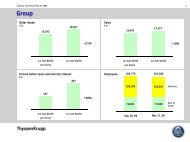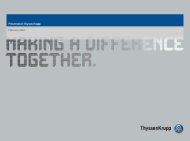Thyssenkrupp
Thyssenkrupp
Thyssenkrupp
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
24 / Solabs ® 2 – Regenerative Energiegewinnung durch solaraktives Fassadenmodul für den Industrie- und Gewerbebau<br />
Diese Kleinserie der solaraktiven Module wird Bestandteil eines<br />
Gebäudeversorgungssystems sein. Die Erprobung wird aktuell durch<br />
die Erstellung und den Betrieb eines Referenzgebäudes mit einem<br />
Zielkunden und Systempartner vollzogen. In einem letzten Schritt werden<br />
die Erkenntnisse und gewonnenen Daten dazu genutzt werden, den<br />
optimalen Kundennutzen in diesem komplexen Szenario zu ermitteln.<br />
Hieraus leitet sich dann das weitere Vorgehen ab.<br />
Vom Fassadenelement zum Absorber<br />
Ein klassisches Sandwich-Fassadenelement besteht aus einer<br />
Außen- und Innenschale, die in der Regel jeweils aus bandlackiertem<br />
Qualitätsstahl hergestellt sind und einen Dämmkern umschließen. Die<br />
Außenseite kann – je nach Anforderung – entsprechend profiliert sein.<br />
In / Bild 1 / ist ein Sandwichprodukt in Form einer Explosionszeichnung<br />
dargestellt.<br />
Um die Energie, die durch die solare Strahlung auf der Gebäudehülle<br />
platziert wird, optimal zu absorbieren, ist es notwendig, den Lack der<br />
Außenschale mit einem möglichst hohen Absorptionskoeffizienten<br />
zu wählen. Klassischerweise zeigen die dunklen Farbtöne – je nach<br />
Pigmentierung des Lackes – einen hohen Absorptionswert. In / Bild 2 /<br />
ist das solare Spektrum als orange Kurve dargestellt, wobei die<br />
Wellenlänge und die Intensität (linke Ordinatenachse) aufgetragen sind.<br />
Für den gewählten Farbton ist die Absorption (rechte Ordinatenachse,<br />
invers) über der Wellenlänge aufgetragen. Dabei gilt: Je höher der<br />
Absorptionskoeffizient, desto besser der Eintrag der Sonnenenergie<br />
in die Oberfläche. Das hier verwendete Lacksystem hat eine solare<br />
Absorption > 90 % und erscheint anthrazitgrau, also ein Farbton, der im<br />
Industrie und Gewerbebau gerne eingesetzt wird.<br />
Die Energie, die in die Oberfläche eingebracht wird, wird nun über<br />
ein mit einem Wärmeträgermedium gefülltes Rohrleitungssystem abgeführt.<br />
Das Rohrleitungssystem steht in Kontakt mit der Außenschale,<br />
sodass die Wärme, die zunächst auf die Außenschale einwirkt, über<br />
die Verbindung zwischen Außenschale und Rohr, abgeführt werden<br />
kann. In / Bild 3 / ist der prinzipielle Aufbau des Fassadenmodules als<br />
Explosionszeichnung dargestellt.<br />
Bild 1 / Explosionszeichnung eines Sandwichproduktes<br />
Innenschale<br />
Dämmkern<br />
Außenschale<br />
Das Herausführen des Rohrleitungssystems auf der Rückseite des<br />
Fassadenmoduls hat den Vorteil, dass das Element an unterschiedlichen<br />
Positionen einer Fassade platziert werden kann. So kann es<br />
aufgrund der dunklen Farbgebung als gestalterisches Element für das<br />
Fassadenerscheinungsbild genutzt werden. Augenscheinlich lassen sich<br />
zudem die solaraktiven von den solarinaktiven Elementen bei gleicher<br />
Farbgebung und Oberfläche nicht unterscheiden, sodass für den<br />
Betrachter die Fassade das gewohnte Erscheinungsbild zeigt.<br />
Neben dem gestalterischen Aspekt kann es auch notwendig<br />
sein, die Elemente aufgrund ungünstiger Umgebungsverhältnisse,<br />
z.B. Verschattung durch angrenzende Gebäude, an optimalen Stellen<br />
zu positionieren. Das Element bietet mit diesem Aufbau eine gute<br />
Möglichkeit des individuellen Einsatzes hinsichtlich der Position in der<br />
Fassade. Dabei wird das Modul auch dem gestalterischen Anspruch von<br />
Kunden und Architekten gerecht.<br />
Der Energieeintrag durch die Sonne kann je nach Wetterlage und<br />
in Abhängigkeit der geographischen Lage beträchtlich sein. Auch<br />
diffuse Strahlung erzeugt bereits einen signifikanten Eintrag, sodass<br />
das Fassadenmodul nicht ausschließlich auf die Direktstrahlung angewiesen<br />
ist. Dies bedeutet, dass auch an bedeckten Tagen Energie<br />
zur Verfügung steht. In / Bild 4 / ist beispielhaft eine Thermographie-<br />
Aufnahme eines solaraktiven Fassadenelementes im stationären<br />
Zustand durch Eintrag diffuser Strahlung gezeigt (das Element ist nicht<br />
in Betrieb, die Energie an der Oberfläche wird nicht abgeführt).<br />
Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten<br />
Um die Energie der Fassadenoberfläche zu nutzen, ist es notwendig,<br />
die solaraktiven Fassadenmodule in eine Systemtechnik einzubinden.<br />
So sind theoretisch zwei Anwendungs-Szenarien denkbar:<br />
Brauchwasservorwärmung oder Heizungsunterstützung. Die Fassade<br />
ist jedoch aufgrund des Sonnenstandes in den Wintermonaten deutlich<br />
besser geeignet für eine Heizungsunterstützung, auch vor dem<br />
Hintergrund, dass Gewerbe- und Industriegebäudedächer in der Regel<br />
einen geringen Neigungswinkel haben. Neben der oben beschriebenen<br />
architektonischen Integration in die Fassade muss nicht über eine nach-<br />
Intensität Solarstrahlung<br />
1<br />
0<br />
Solarspektrum<br />
Lacksystem<br />
Außenschale<br />
0,4 2,5<br />
Wellenlänge [µm]<br />
Bild 2 / Normiertes solares Spektrum (orange) und wellenlängenabhängige<br />
Absorptionseigenschaften des verwendeten Lacksystems (blau)<br />
Absorption<br />
ThyssenKrupp techforum 1 I 2012<br />
0<br />
1