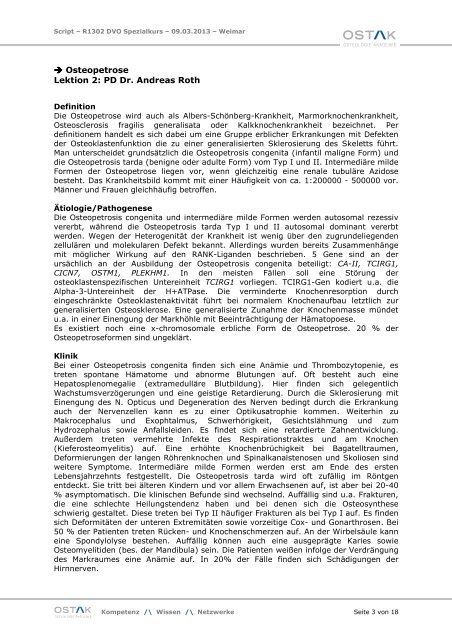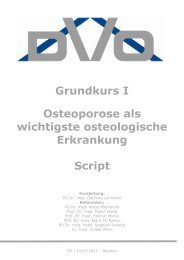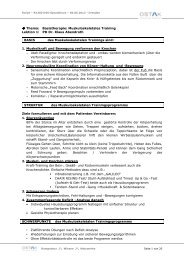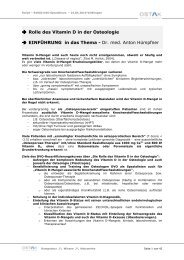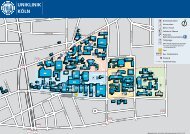R1302 Knochenerkrankungen mit erhöhter Knochendichte ... - OSTAK
R1302 Knochenerkrankungen mit erhöhter Knochendichte ... - OSTAK
R1302 Knochenerkrankungen mit erhöhter Knochendichte ... - OSTAK
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Script – <strong>R1302</strong> DVO Spezialkurs – 09.03.2013 – Weimar<br />
Osteopetrose<br />
Lektion 2: PD Dr. Andreas Roth<br />
Definition<br />
Die Osteopetrose wird auch als Albers-Schönberg-Krankheit, Marmorknochenkrankheit,<br />
Osteosclerosis fragilis generalisata oder Kalkknochenkrankheit bezeichnet. Per<br />
definitionem handelt es sich dabei um eine Gruppe erblicher Erkrankungen <strong>mit</strong> Defekten<br />
der Osteoklastenfunktion die zu einer generalisierten Sklerosierung des Skeletts führt.<br />
Man unterscheidet grundsätzlich die Osteopetrosis congenita (infantil maligne Form) und<br />
die Osteopetrosis tarda (benigne oder adulte Form) vom Typ I und II. Intermediäre milde<br />
Formen der Osteopetrose liegen vor, wenn gleichzeitig eine renale tubuläre Azidose<br />
besteht. Das Krankheitsbild kommt <strong>mit</strong> einer Häufigkeit von ca. 1:200000 - 500000 vor.<br />
Männer und Frauen gleichhäufig betroffen.<br />
Ätiologie/Pathogenese<br />
Die Osteopetrosis congenita und intermediäre milde Formen werden autosomal rezessiv<br />
vererbt, während die Osteopetrosis tarda Typ I und II autosomal dominant vererbt<br />
werden. Wegen der Heterogenität der Krankheit ist wenig über den zugrundeliegenden<br />
zellulären und molekularen Defekt bekannt. Allerdings wurden bereits Zusammenhänge<br />
<strong>mit</strong> möglicher Wirkung auf den RANK-Liganden beschrieben. 5 Gene sind an der<br />
ursächlich an der Ausbildung der Osteopetrosis congenita beteiligt: CA-II, TCIRG1,<br />
CICN7, OSTM1, PLEKHM1. In den meisten Fällen soll eine Störung der<br />
osteoklastenspezifischen Untereinheit TCIRG1 vorliegen. TCIRG1-Gen kodiert u.a. die<br />
Alpha-3-Untereinheit der H+ATPase. Die verminderte Knochenresorption durch<br />
eingeschränkte Osteoklastenaktivität führt bei normalem Knochenaufbau letztlich zur<br />
generalisierten Osteosklerose. Eine generalisierte Zunahme der Knochenmasse mündet<br />
u.a. in einer Einengung der Markhöhle <strong>mit</strong> Beeinträchtigung der Hämatopoese.<br />
Es existiert noch eine x-chromosomale erbliche Form de Osteopetrose. 20 % der<br />
Osteopetroseformen sind ungeklärt.<br />
Klinik<br />
Bei einer Osteopetrosis congenita finden sich eine Anämie und Thrombozytopenie, es<br />
treten spontane Hämatome und abnorme Blutungen auf. Oft besteht auch eine<br />
Hepatosplenomegalie (extramedulläre Blutbildung). Hier finden sich gelegentlich<br />
Wachstumsverzögerungen und eine geistige Retardierung. Durch die Sklerosierung <strong>mit</strong><br />
Einengung des N. Opticus und Degeneration des Nerven bedingt durch die Erkrankung<br />
auch der Nervenzellen kann es zu einer Optikusatrophie kommen. Weiterhin zu<br />
Makrocephalus und Exophtalmus, Schwerhörigkeit, Gesichtslähmung und zum<br />
Hydrozephalus sowie Anfallsleiden. Es findet sich eine retardierte Zahnentwicklung.<br />
Außerdem treten vermehrte Infekte des Respirationstraktes und am Knochen<br />
(Kieferosteomyelitis) auf. Eine erhöhte Knochenbrüchigkeit bei Bagatelltraumen,<br />
Deformierungen der langen Röhrenknochen und Spinalkanalstenosen und Skoliosen sind<br />
weitere Symptome. Intermediäre milde Formen werden erst am Ende des ersten<br />
Lebensjahrzehnts festgestellt. Die Osteopetrosis tarda wird oft zufällig im Röntgen<br />
entdeckt. Sie tritt bei älteren Kindern und vor allem Erwachsenen auf, ist aber bei 20-40<br />
% asymptomatisch. Die klinischen Befunde sind wechselnd. Auffällig sind u.a. Frakturen,<br />
die eine schlechte Heilungstendenz haben und bei denen sich die Osteosynthese<br />
schwierig gestaltet. Diese treten bei Typ II häufiger Frakturen als bei Typ I auf. Es finden<br />
sich Defor<strong>mit</strong>äten der unteren Extre<strong>mit</strong>äten sowie vorzeitige Cox- und Gonarthrosen. Bei<br />
50 % der Patienten treten Rücken- und Knochenschmerzen auf. An der Wirbelsäule kann<br />
eine Spondylolyse bestehen. Auffällig können auch eine ausgeprägte Karies sowie<br />
Osteomyelitiden (bes. der Mandibula) sein. Die Patienten weißen infolge der Verdrängung<br />
des Markraumes eine Anämie auf. In 20% der Fälle finden sich Schädigungen der<br />
Hirnnerven.<br />
Kompetenz /\ Wissen /\ Netzwerke Seite 3 von 18