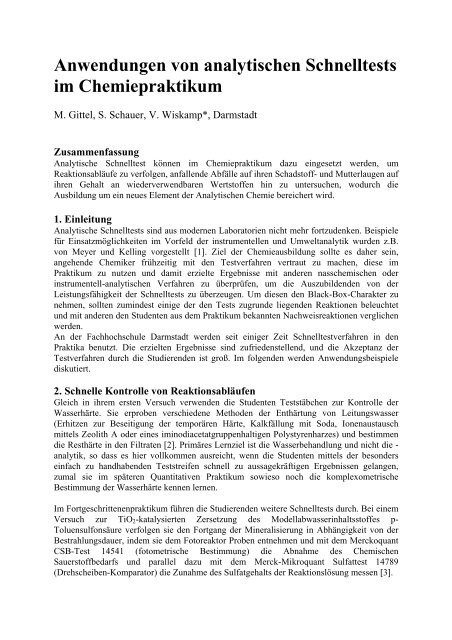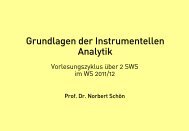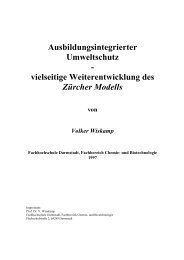Anwendungen von analytischen Schnelltests im Chemiepraktikum
Anwendungen von analytischen Schnelltests im Chemiepraktikum
Anwendungen von analytischen Schnelltests im Chemiepraktikum
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Anwendungen</strong> <strong>von</strong> <strong>analytischen</strong> <strong>Schnelltests</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Chemiepraktikum</strong><br />
M. Gittel, S. Schauer, V. Wiskamp*, Darmstadt<br />
Zusammenfassung<br />
Analytische Schnelltest können <strong>im</strong> <strong>Chemiepraktikum</strong> dazu eingesetzt werden, um<br />
Reaktionsabläufe zu verfolgen, anfallende Abfälle auf ihren Schadstoff- und Mutterlaugen auf<br />
ihren Gehalt an wiederverwendbaren Wertstoffen hin zu untersuchen, wodurch die<br />
Ausbildung um ein neues Element der Analytischen Chemie bereichert wird.<br />
1. Einleitung<br />
Analytische <strong>Schnelltests</strong> sind aus modernen Laboratorien nicht mehr fortzudenken. Beispiele<br />
für Einsatzmöglichkeiten <strong>im</strong> Vorfeld der instrumentellen und Umweltanalytik wurden z.B.<br />
<strong>von</strong> Meyer und Kelling vorgestellt [1]. Ziel der Chemieausbildung sollte es daher sein,<br />
angehende Chemiker frühzeitig mit den Testverfahren vertraut zu machen, diese <strong>im</strong><br />
Praktikum zu nutzen und damit erzielte Ergebnisse mit anderen nasschemischen oder<br />
instrumentell-<strong>analytischen</strong> Verfahren zu überprüfen, um die Auszubildenden <strong>von</strong> der<br />
Leistungsfähigkeit der <strong>Schnelltests</strong> zu überzeugen. Um diesen den Black-Box-Charakter zu<br />
nehmen, sollten zumindest einige der den Tests zugrunde liegenden Reaktionen beleuchtet<br />
und mit anderen den Studenten aus dem Praktikum bekannten Nachweisreaktionen verglichen<br />
werden.<br />
An der Fachhochschule Darmstadt werden seit einiger Zeit Schnelltestverfahren in den<br />
Praktika benutzt. Die erzielten Ergebnisse sind zufriedenstellend, und die Akzeptanz der<br />
Testverfahren durch die Studierenden ist groß. Im folgenden werden Anwendungsbeispiele<br />
diskutiert.<br />
2. Schnelle Kontrolle <strong>von</strong> Reaktionsabläufen<br />
Gleich in ihrem ersten Versuch verwenden die Studenten Teststäbchen zur Kontrolle der<br />
Wasserhärte. Sie erproben verschiedene Methoden der Enthärtung <strong>von</strong> Leitungswasser<br />
(Erhitzen zur Beseitigung der temporären Härte, Kalkfällung mit Soda, Ionenaustausch<br />
mittels Zeolith A oder eines <strong>im</strong>inodiacetatgruppenhaltigen Polystyrenharzes) und best<strong>im</strong>men<br />
die Resthärte in den Filtraten [2]. Pr<strong>im</strong>äres Lernziel ist die Wasserbehandlung und nicht die -<br />
analytik, so dass es hier vollkommen ausreicht, wenn die Studenten mittels der besonders<br />
einfach zu handhabenden Teststreifen schnell zu aussagekräftigen Ergebnissen gelangen,<br />
zumal sie <strong>im</strong> späteren Quantitativen Praktikum sowieso noch die komplexometrische<br />
Best<strong>im</strong>mung der Wasserhärte kennen lernen.<br />
Im Fortgeschrittenenpraktikum führen die Studierenden weitere <strong>Schnelltests</strong> durch. Bei einem<br />
Versuch zur TiO 2 -katalysierten Zersetzung des Modellabwasserinhaltsstoffes p-<br />
Toluensulfonsäure verfolgen sie den Fortgang der Mineralisierung in Abhängigkeit <strong>von</strong> der<br />
Bestrahlungsdauer, indem sie dem Fotoreaktor Proben entnehmen und mit dem Merckoquant<br />
CSB-Test 14541 (fotometrische Best<strong>im</strong>mung) die Abnahme des Chemischen<br />
Sauerstoffbedarfs und parallel dazu mit dem Merck-Mikroquant Sulfattest 14789<br />
(Drehscheiben-Komparator) die Zunahme des Sulfatgehalts der Reaktionslösung messen [3].
2<br />
Die dem Test zugrunde liegenden Reaktionen sind den Studenten grundsätzlich bekannt. Die<br />
<strong>im</strong> CSB-Test verwendete Chromsäure kennen sie schon <strong>von</strong> anderen Oxidationsreaktionen in<br />
der organischen und anorganischen Chemie. Be<strong>im</strong> Sulfattest reagieren die in der Probe<br />
vorliegenden Sulfationen mit Bariumiodat unter Bildung <strong>von</strong> BaSO 4 (klassische<br />
Nachweisreaktion für Sulfat) und einer entsprechenden Menge Iodat. Dieses geht mit der <strong>im</strong><br />
Testsystem außerdem vorhandenen Gerbsäure Tannin einen braunroten Farbkomplex ein. Je<br />
mehr Sulfat vorliegt, desto intensiver ist die Farbe, was für eine quantitative Interpretation<br />
ausgenutzt werden kann.<br />
3. Abwasserkontrolle<br />
Wenn Versuche mit Chlor durchgeführt werden, z.B. bei der Synthese <strong>von</strong> SnCl 4 aus den<br />
Elementen oder <strong>von</strong> Ammoniumhexachloroplumbat aus PbCl 2 , NH 4 Cl und Cl 2 [4], wird<br />
überschüssiges Chlor in Natronlauge aufgefangen, um Emissionen des Giftgases in die Luft<br />
zu vermeiden. Das dabei gebildete Hypochlorit wird mit H 2 O 2 reduktiv zerstört. Bevor das<br />
Abwasser in den Ausguss geschüttet wird, wird vorsichtshalber mit dem Merckoquant<br />
Chlortest 10043 überprüft, ob die Entgiftung wirklich vollständig verlaufen ist. Be<strong>im</strong> Test<br />
darf also kein Hypochlorit mehr angezeigt werden!<br />
Ähnlich vorgegangen wird mit einem formaldehydhaltigen Abwasser, das be<strong>im</strong><br />
Silberrecycling [5] anfällt: Silberionen werden <strong>im</strong> alkalischen Medium mittels Formaldehyd<br />
zu elementarem Silber reduziert, welches ausflockt und abfiltriert wird. Das noch<br />
formaldehydhaltige Filtrat wird mit H 2 O 2 nachbehandelt. Nach Verkochen des<br />
überschüssigen Wasserstoffperoxids wird mit einem Merck Teststäbchen 10036 überprüft, ob<br />
der Aldehyd vollständig oxidiert wurde. Nur wenn der Test auf HCHO negativ verläuft, darf<br />
das Wasser in den Ausguss geschüttet werden!<br />
Da die Studenten aus der OC-Vorlesung wissen, dass Formaldehyd eine besonders<br />
kondensationsfreudige Substanz ist, werden Sie die Funktionsweise des Tests nachvollziehen<br />
können, der auf der Kondensation <strong>von</strong> HCHO mit einem Hydrazin-Derivat (4-Amino-3-<br />
hydraziono-5-mercapto-1,2,3-triazol) beruht und ein Produkt liefert, das durch<br />
Lufteinwirkung zu einem purpurfarbenen Tetrazin abreagiert.<br />
Ein weiteres Abwasser resultiert aus der Synthese <strong>von</strong> CoAl 2 O 4 . Das Blaupigment wird durch<br />
gemeinsames Erhitzen <strong>von</strong> Aluminium- und Cobalt-Verbindungen hergestellt und nach dem<br />
Abkühlen mit verdünnter Salzsäure ausgekocht, um die <strong>im</strong> Überschuss verwendete<br />
Aluminiumverbindung auszuwaschen. Ob dabei auch giftige Cobaltionen ausgewaschen<br />
werden, wird mit Merck Cobalt-Teststäbchen 10002 geprüft. In der Regel wird durch eine<br />
mehr oder weniger tiefe Blaufärbung (Bildung des Komplexes [Co(SCN) 4 ] 2- , der aus einem<br />
anderen Versuch zur Cobaltchemie <strong>im</strong> Praktikum bereits bekannt ist) ein Cobaltgehalt <strong>von</strong><br />
10-50 ppm angezeigt, so dass die Waschsäure nicht einfach weggeschüttet werden darf. Sie<br />
muss vielmehr durch Ausfällen und Abfiltrieren <strong>von</strong> Co(OH) 2 nachbehandelt werden.<br />
Als letztes Beispiel sei die Kontrolle der Entgiftung eines nitrithaltigen Abwassers erwähnt.<br />
Die Studenten messen den Nitritgehalt mit dem Merckoquant Test 10007. Dann setzen sie<br />
dem Wasser H 2 O 2 zu, zerstören anschließend das überschüssige Oxidationsmittel durch<br />
Zugabe <strong>von</strong> etwas Braunstein, filtrieren, prüfen das Filtrat auf Nitritfreiheit und messen<br />
außerdem mit dem Merckoquant Nitrattest 10020, dass die der ursprünglichen Nitritentsprechende<br />
Nitratmenge entstanden ist. Dies belegt, dass das hochgiftige Nitrit in der Tat<br />
quantitativ in das mindergiftige Nitrat übergeführt wurde, so daß das Wasser verworfen<br />
werden darf.<br />
Der Nitrittest basiert auf der Diazoniumsalzbildung zwischen Nitrit und einem aromatischen<br />
Amin und anschließender Azokupplung mit N-[Naphthyl-(1)]-ethylendiamin zu einem<br />
Farbstoff, die den Studenten aus der Qualitativen Analyse in ähnlicher Form als Lunge-Test
3<br />
bekannt ist. Be<strong>im</strong> Nitrattests wird das Nitrat zunächst durch ein <strong>im</strong> Teststreifen enthaltenes<br />
Reduktionsmittel zu Nitrit reduziert, das dann die oben beschriebene Folgereaktion eingeht.<br />
Die vier Beispiele belegen, dass <strong>Schnelltests</strong> wichtige Entscheidungshilfen dafür sein können,<br />
wie mit einem Abwasser verantwortungsbewusst umgegangen werden muß.<br />
4. Ein Schnelltest <strong>im</strong> Vorfeld der Synthesechemie<br />
Im Grundpraktikum wird mit ZnCo 2 O 4 ein weiterer Spinell hergestellt. Die Edukte dafür sind<br />
CoCl 2 und ZnCO 3 . Die letzte Verbindung wird mittels Soda aus Resten <strong>von</strong> Clemmensen-<br />
Reduktionen, die zum Standardprogramm des Organischen Praktikum gehören, ausgefällt.<br />
Durch diese Vorgehensweise werden die dort anfallenden Reste durch Weiterverwendung<br />
sinnvoll entsorgt. Den Studenten, die <strong>im</strong> AC-Praktikum die Grünpigmentsynthese<br />
durchführen sollen, ist der Zinkgehalt der bereitstehenden Lösung aber nicht bekannt. Sie<br />
ermitteln ihn mit dem Merck Microquant Zinktest 14780 und berechnen danach die Menge an<br />
Lösung, die ihnen die nötige Stoffmenge Zink liefert.<br />
Das Analysenergebnis ist recht zuverlässig. Exemplarisch wurde eine Zinkrestlösung einmal<br />
gleichzeitig mit dem Schnelltest und durch komplexometrische Titration mit EDTA-<br />
Maßlösung untersucht. Nach dem Schnelltest betrug der Zinkgehalt der Lösung 7.0 g/l, nach<br />
der Titration 6.1 g/l.<br />
5. <strong>Schnelltests</strong> <strong>im</strong> Vorfeld der Wiedergewinnung <strong>von</strong> Ausgangschemikalien<br />
Zwecks Abfallvermeidung ist es üblich, Versuchsreste auf gängige Ausgangschemikalien<br />
aufzubereiten (vgl. [6]). In der Regel werden die <strong>im</strong> Praktikum anfallenden<br />
Metallsalzlösungen über einen längeren Zeitraum gesammelt und erst bearbeitet, wenn eine<br />
ausreichend große Menge zusammengekommen ist. Der Metallgehalt eines Restes ist nicht<br />
bekannt. Sinnvoll ist es daher, ihn mit einem Schnelltest zumindest halbquantitativ zu<br />
best<strong>im</strong>men, um hochrechnen zu können, wie viel Wertstoff überhaupt isoliert werden kann,<br />
und um die anstehenden Arbeitsschritte in Hinblick auf Zeitbedarf und benötigte Geräte<br />
vernünftig planen zu können.<br />
Mutterlaugen der Kalialaunkristallisation werden mit dem Merckoquant-Test 10015 auf ihren<br />
Aluminiumgehalt hin untersucht. Der Test basiert auf der Bildung eines Farblacks, die den<br />
Studenten in ähnlicher Weise vom Aluminiumnachweis mit Alizarin S aus der Qualitativen<br />
Analyse bekannt ist. Der Test ist zwar nicht sehr genau, da der Aluminiumgehalt nur auf etwa<br />
± 100 ppm abgelesen werden kann, doch reicht die gefundene Größenordnung des<br />
Metallgehalts, die einmal komplexometrisch bestätigt wurde, vollkommen aus, um die Menge<br />
Ammoniak für die Al(OH) 3 -Fällung, das Fassungsvermögen der Nutsche für die folgende<br />
Absaugung und die Menge Schwefelsäure für das Lösen des Hydroxids zum<br />
wiederverwertbaren Sulfat abzuschätzen.<br />
Im Quantitativen Praktikum wird Kupfer fotometrisch als Tetramminkomplex best<strong>im</strong>mt. Die<br />
Reste werden mit Schwefelsäure angesäuert, um Ammoniakausdampfungen zu vermeiden,<br />
und erst aufgearbeitet, wenn mindestens 4 Liter zusammengekommen sind. Durch Zugabe<br />
<strong>von</strong> Eisen wird das Kupfer zementiert und kann an anderer Stelle <strong>im</strong> Praktikum weiterbenutzt<br />
werden. Das kupferfreie Filtrat wird verworfen [7]. Günstig ist es, eine bezogen auf die zu<br />
erwartende Masse Kupfer doppelte Masse Eisen einzuwiegen. Dies kann geschehen, wenn der<br />
Kupfergehalt des aufzuarbeitenden Restes bekannt ist. Seine Best<strong>im</strong>mung erfolgt über den<br />
Merckoquant-Test 10003, wobei das zweiwertige Kupfer durch ein <strong>im</strong> Teststreifen<br />
vorliegendes Reduktionsmittel zunächst zum einwertigen reduziert wird, welches dann mit<br />
2,2’-Bichinolin einen purpurroten Komplex bildet. Die chemischen Grundlagen des Tests<br />
sind für die Studierenden verständlich, da die Komplex- und Redoxchemie des Kupfers<br />
sowieso Lernstoff des Praktikums ist. (Ein Schnelltestergebnis wurde einmal durch<br />
komplexometrische Kupferbest<strong>im</strong>mung überprüft und erwies sich als zuverlässig).
4<br />
Als letztes Beispiel sei erwähnt, dass <strong>im</strong> Darmstädter Praktikum wässrige Chromreste aus<br />
Jones-Oxidationen in wiederverwertbares Kaliumdichromat rückverwandelt werden (Fällen<br />
<strong>von</strong> Cr(OH) 3 , Oxidation <strong>im</strong> alkalischen Medium mit H 2 O 2 zu K 2 CrO 4 , Ansäuern mit H 2 SO 4<br />
und Kristallisation <strong>von</strong> K 2 Cr 2 O 7 ; vgl.[6]). Genau wie bei dem zuvor geschilderten<br />
Recyclingversuch ist es hier für eine sorgfältige Syntheseplanung günstig, vorab den<br />
Chromgehalt der Ausgangslösung zu best<strong>im</strong>men. Dies geschieht mit dem Merckoquant<br />
Chromattest 10012 nach vorheriger Oxidation des vorliegenden dreiwertigen Chroms mittels<br />
Wasserstoffperoxid. (Eine iodometrische Chrombest<strong>im</strong>mung bestätigte die Genauigkeit des<br />
Schnelltestergebnisses). .<br />
Literatur<br />
[1] MEYER, A., KELLING, A.: Chem. Lab. Biotechn., 45, 367-369 und 414-417 (1994)<br />
[2] CREVAR, K., HANSEN, K., WISKAMP, V.: Chem. Schule, 41, 329-330 (1994)<br />
[3] FISCHER, P., HÜTTENHAIN, S., KRAMB, V., WISKAMP, V.: Ch<strong>im</strong>ia, 48, (1994), <strong>im</strong><br />
Druck<br />
[4] WISKAMP, V.: Chem. Lab. Biotechn. (Beilage Memory), 45, 17-20 und 27-30 (1994)<br />
[5] KRAMB, V., NICKEL, A., WISKAMP, V.: Chemkon, <strong>im</strong> Druck<br />
[6] BAUER, R., GITTEL, M., LUKAS, A., SCHNEIDER, D., WENZEL, V., WISKAMP,<br />
V.: Chem. Lab. Biotechn. (Beilage Memory), 44, 73-75 und 90-91 (1993)<br />
[7] KONNO, T., OKAMOTO, K., KRAMB, V., LIMA, P., MOREL, X., WISKAMP, V.:<br />
Chem. Lab. Biotechn. (Beilag Memory), 45, 53-54 (1994)<br />
Firmenschrift<br />
E. Merck: Schnelltest-Handbuch