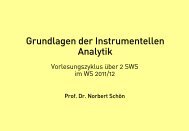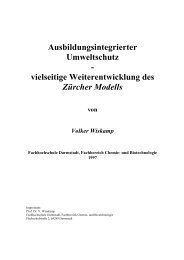Lebensmittelchemie - ein Wahlpflichtkurs in der 9. Klasse
Lebensmittelchemie - ein Wahlpflichtkurs in der 9. Klasse
Lebensmittelchemie - ein Wahlpflichtkurs in der 9. Klasse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Lebensmittelchemie</strong> - <strong>e<strong>in</strong></strong> <strong>Wahlpflichtkurs</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>9.</strong> <strong>Klasse</strong><br />
VOLKER WISKAMP<br />
Impressum: Prof. Dr. V. Wiskamp, FH Darmstadt, Fb. CuB, Hochschulstr. 2, D-64289 Darmstadt<br />
E<strong>in</strong>leitung<br />
Im Rahmen <strong>e<strong>in</strong></strong>es Projektes zur Verbesserung <strong>der</strong> Beziehungen zwischen Fachhochschule und<br />
Schule hatte ich die Gelegenheit, <strong>in</strong> <strong>e<strong>in</strong></strong>er <strong>9.</strong> <strong>Klasse</strong> des Lichtenberg-Gymnasiums <strong>in</strong><br />
Darmstadt <strong>e<strong>in</strong></strong>en <strong>Wahlpflichtkurs</strong> Chemie (2 Stunden pro Woche) zu leiten. Die<br />
teilnehmenden 13 Schüler<strong>in</strong>nen und 3 Schüler verfügten zu Beg<strong>in</strong>n des Kurses, d.h. nach<br />
Abschluss ihres 8. Schuljahres, <strong>in</strong> dem sie <strong>e<strong>in</strong></strong>e Stunde pro Woche Chemieunterricht gehabt<br />
hatten, über Grundkenntnisse des Faches und <strong>der</strong> chemischen Formelsprache und wollten vor<br />
allem selbst experimentieren. Die Themenauswahl war mir überlassen mit <strong>der</strong> <strong>e<strong>in</strong></strong>zigen<br />
Auflage, verb<strong>in</strong>dlichen Lernstoff <strong>der</strong> späteren <strong>Klasse</strong>n möglichst nicht vorwegzunehmen.<br />
Ziele<br />
Für das von mir vorgeschlagene Schwerpunktsthema <strong>Lebensmittelchemie</strong> hatte mich vor<br />
allem die Lektüre neuerer Arbeiten von R. Stübs <strong>in</strong> dieser Zeitschrift /1-3/ motiviert. Hier<br />
waren nicht nur die wichtigsten Experimentieranleitungen zitiert - ich kann deshalb im<br />
folgenden auf Angaben von Quellen verzichten -, son<strong>der</strong>n es wurde vor allem <strong>e<strong>in</strong></strong> Plädoyer<br />
dafür <strong>e<strong>in</strong></strong>gelegt, Lebensmittel wegen ihrer vielseitigen Chemie <strong>in</strong> den Unterricht <strong>der</strong><br />
Sekundarstufe II, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>in</strong> Leistungskurse, zu <strong>in</strong>tegrieren. Da ich außerdem selbst<br />
Erfahrungen hatte, wie sich die Chemie <strong>der</strong> Öle, Fette und Kohlenhydrate als nachwachsende<br />
Rohstoffe für die chemische Industrie <strong>in</strong> <strong>der</strong> praktischen Ausbildung fortgeschrittener<br />
Studenten des Chemi<strong>e<strong>in</strong></strong>genieurwesens <strong>e<strong>in</strong></strong>setzen lässt /4/, reizte es mich beson<strong>der</strong>s zu<br />
erproben, wie das Thema mit jungen Schülern <strong>der</strong> Sekundarstufe I behandelt werden kann.<br />
Beim Umgang mit den alltäglichen Stoffen sollten sich zwanglos grundlegende chemische<br />
Arbeitstechniken, Sicherheit und Umweltschutz im Labor sowie ausgehend von den<br />
Phänomenen Pr<strong>in</strong>zipien des wissenschaftlichen Denkens und Experimentierens vermitteln<br />
lassen, auch ohne dass viele Stoffkenntnisse bei den Schülern vorhanden s<strong>in</strong>d. Außerdem<br />
sollten sich Basisqualifikationen wie mündliches und schriftliches Dokumentieren und<br />
Interpretieren von Laborergebnissen, Transferdenken, Diskussionsfähigkeit und<br />
Gruppenarbeit schulen lassen. Als affektives Lernziel sollten die Kursteilnehmer vor allem<br />
ver<strong>in</strong>nerlichen, wie sehr die Chemie unser tägliches Leben bestimmt. All diese<br />
Gesichtspunkte s<strong>in</strong>d für die naturwissenschaftliche Ausbildung <strong>in</strong>sgesamt wertvoll.<br />
Im folgenden möchte ich <strong>e<strong>in</strong></strong>ige Erfahrungen aus dem Kurs schil<strong>der</strong>n.<br />
Qualitatives Arbeiten<br />
Aufgrund des analogen Verhaltens von Glucose, Fructose, Saccharose und Stärke beim<br />
Erhitzen (Bildung <strong>e<strong>in</strong></strong>es Kondensats, das sich mit Testpapier als Wasser identifizieren ließ,<br />
und <strong>e<strong>in</strong></strong>es schwarzen Rückstandes) und gegenüber konzentrierter Schwefelsäure (Bildung<br />
<strong>e<strong>in</strong></strong>er kohleartigen, aufgeschäumten Masse) war es für die Schüler überzeugend, dass die<br />
weißen Stoffe <strong>e<strong>in</strong></strong>er gem<strong>e<strong>in</strong></strong>samen Verb<strong>in</strong>dungsklasse angehören. Der Name Kohlenhydrate<br />
war <strong>e<strong>in</strong></strong>leuchtend. Zur Unterscheidung <strong>der</strong> Stoffe führten die Schüler weitere Tests (Zugabe
2<br />
von Iodlösung, von alkalischer Kupfer(II)-tartratlösung, E<strong>in</strong>tauchen <strong>e<strong>in</strong></strong>es Glucosetesttreifens)<br />
durch, betrachteten Formelbil<strong>der</strong> und stellten Struktur-Eigenschaft-Korrelationen auf: Nur das<br />
helical aufgebaute Stärkemolekül reagiert mit Iod, nur Glucose und Fructose, die (<strong>in</strong> ihrer<br />
offenkettigen Form) beide über <strong>e<strong>in</strong></strong>e C-O-Doppelb<strong>in</strong>dung verfügen, wandeln die blaue<br />
Kupferverb<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> <strong>e<strong>in</strong></strong>e rote um, nur Glucose verfärbt den Teststreifen.<br />
In <strong>der</strong> <strong>Klasse</strong>narbeit stellte ich folgende Aufgabe: „E<strong>in</strong>e Probe wurde verwechselt. Es kann<br />
sich nur um <strong>e<strong>in</strong></strong>e wässrige Lösung von Glucose, Fructose, Saccharose o<strong>der</strong> Stärke handeln.<br />
Interpretiere bitte die vom Lehrer vorgeführten Nachweisreaktionen und begründe, welche<br />
Probe tatsächlich vorliegt.“ Dann versetzte ich <strong>e<strong>in</strong></strong>zelne Proben (und Wasser als Referenz) mit<br />
Iodlösung (negativ), Fehl<strong>in</strong>g-Reagenz (positiv) und Glucose-Teststreifen (negativ). Fast alle<br />
Schüler kamen zum richtigen Ergebnis (Fructose).<br />
Am Ende <strong>e<strong>in</strong></strong>er Unterrichtsstunde wurde <strong>e<strong>in</strong></strong>e Saccharoselösung mit Bäckerhefe versetzt. In<br />
<strong>der</strong> nächsten Woche wurde die Mischung filtriert und das Filtrat destilliert. Siedepunkt und<br />
Dichte des Destillates wurden bestimmt. In <strong>e<strong>in</strong></strong>em zweiten Experiment wurde Rotw<strong>e<strong>in</strong></strong><br />
destilliert. Die zuerst übergehende Flüssigkeit hatte den gleichen Siedepunkt und die gleiche<br />
Dichte wie das Gärprodukt, worauf die Schüler dieses rasch als Alkohol identifizierten.<br />
Qualitative anorganische Analytik war erfor<strong>der</strong>lich, um Gemüse und Fleisch auf<br />
M<strong>in</strong>eralstoffe zu untersuchen. Dazu musste die organische Materie zunächst durch Veraschen<br />
m<strong>in</strong>eralisiert werden. (Hier unterbrach ich das Thema <strong>Lebensmittelchemie</strong> für zwei Wochen,<br />
um mit den Schülern Experimente mit fasz<strong>in</strong>ierenden M<strong>in</strong>eralien (Bestimmung von<br />
Ritzhärten und Strichfarben /5/) durchzuführen und dadurch den Kurs <strong>in</strong>sgesamt aufzulockern<br />
und um <strong>e<strong>in</strong></strong>en an<strong>der</strong>en Gesichtspunkt zu bereichern.) Beim Calcium- o<strong>der</strong> Chloridnachweis<br />
lernten die Kursteilnehmer dann die Bedeutung von Bl<strong>in</strong>d- und Zusatzproben kennen, um<br />
aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.<br />
Quantitatives Arbeiten<br />
Die Schüler hatten bereits gehört, dass Obst und Gemüse beim längeren Liegen an <strong>der</strong> Luft<br />
<strong>e<strong>in</strong></strong>en Teil s<strong>e<strong>in</strong></strong>es Vitam<strong>in</strong> C-Gehaltes verlieren. Hierzu wurde <strong>e<strong>in</strong></strong> quantitatives<br />
Modellexperiment durchgeführt: 10 mL <strong>e<strong>in</strong></strong>er 1%igen Ascorb<strong>in</strong>säurelösung wurden mit<br />
Wasser verdünnt. Nach Zugabe von etwas Natronlauge (pH ≈ 10) wurde 20 M<strong>in</strong>uten Luft<br />
durch die Lösung geleitet, die dann angesäuert, mit etwas Kaliumiodid und Stärkelösung<br />
versetzt und mit Kaliumiodat-Maßlösung bis zur bleibenden Blaufärbung titriert wurde. E<strong>in</strong>e<br />
Vergleichstitration von 10 mL <strong>der</strong> (nicht mit Luft behandelten) Ascorb<strong>in</strong>säurestammlösung<br />
wurde durchgeführt /6/. Ohne E<strong>in</strong>zelheiten <strong>der</strong> Analysenmethode zu verstehen, konnten die<br />
Schüler die beiden Titrationsergebnisse vergleichen und ausrechnen, wie viel % des Vitam<strong>in</strong>s<br />
oxidativ zerstört wurden.<br />
Die Schüler wussten, dass Sprudelwasser Kohlenstoffdioxid enthält und dass <strong>der</strong> CO 2 -Gehalt<br />
beim Stehenlassen des Getränkes <strong>in</strong> <strong>e<strong>in</strong></strong>em offenen Glas abnimmt. Im Praktikum<br />
quantifizierten sie dieses Phänomen, <strong>in</strong>dem sie 100 mL Selterswasser mit Phenolphthal<strong>e<strong>in</strong></strong><br />
versetzten und mit NaOH-Maßlösung bis zur Rotfärbung titrierten und <strong>in</strong> <strong>e<strong>in</strong></strong>em zweiten<br />
Experiment die gleiche Menge Selterswasser untersuchten, nachdem sie 2 M<strong>in</strong>uten Luft<br />
durchgeleitet hatten. Ähnlich wie bei <strong>der</strong> oben beschriebenen Vitam<strong>in</strong> C-Bestimmung war<br />
auch hier <strong>e<strong>in</strong></strong> detailliertes Verständnis <strong>der</strong> Titration nicht nötig, um den prozentualen<br />
Säureverlust des Sprudels zu ermitteln.
3<br />
Transferdenken<br />
Die Schüler schüttelten <strong>e<strong>in</strong></strong>e Mischung von Wasser und Sojaöl sowie <strong>e<strong>in</strong></strong>e weitere, <strong>der</strong> vorab<br />
<strong>e<strong>in</strong></strong>e Mikrospatelspitze Natriumoleat o<strong>der</strong> -stearat zugesetzt worden war. Danach<br />
beobachteten sie im ersten Fall <strong>e<strong>in</strong></strong>e rasche Phasentrennung, im zweiten Fall <strong>e<strong>in</strong></strong>e langsame<br />
und gleichzeitig <strong>e<strong>in</strong></strong> starkes Schäumen. Die Wirkungsweise von Fettsäuresalzen als Tenside<br />
wurde erläutert.<br />
Im nächsten Versuch schüttelten die Schüler <strong>e<strong>in</strong></strong>e Mischung von Wasser und Sojaöl, <strong>der</strong><br />
etwas Natronlauge zugegeben worden war, unmittelbar nach <strong>der</strong> NaOH-Zugabe und nach<br />
20m<strong>in</strong>ütigem Tempern <strong>der</strong> Mischung <strong>in</strong> <strong>e<strong>in</strong></strong>em fast siedenden Wasserbad. E<strong>in</strong>e<br />
Schaumbildung war erst nach <strong>der</strong> längeren E<strong>in</strong>wirkungszeit <strong>der</strong> Base zu erkennen, woraus die<br />
Schüler schlossen, dass offensichtlich <strong>e<strong>in</strong></strong> Tensid entstanden war.<br />
Als später Margar<strong>in</strong>e und kosmetische Cremes aus wässrigen und öligen Ausgangsstoffen<br />
hergestellt wurden, war es für die Praktikumsteilnehmer leicht <strong>e<strong>in</strong></strong>zusehen, das zusätzlich<br />
Emulgatoren benötigt wurden, um optisch homogene Produkte zu erzielen.<br />
Ökologische Gesichtspunkte<br />
Beim Experimentieren mit Lebensmitteln fallen nur wenige giftige Reste an, die nicht<br />
weggeschüttet werden dürfen, z.B. kupferhaltige aus Fehl<strong>in</strong>gproben, son<strong>der</strong>n <strong>in</strong> <strong>e<strong>in</strong></strong>em<br />
bereitgestellten Gefäß gesammelt wurden. E<strong>in</strong>mal darauf h<strong>in</strong>gewiesen, hielten sich die<br />
Schüler konsequent an die Sammelvorschrift. Es wurde Ihnen mitgeteilt, dass die Reste <strong>in</strong> die<br />
Stoffströme des anorganischen Praktikums an <strong>der</strong> FH Darmstadt <strong>e<strong>in</strong></strong>geschleust und dort auf<br />
wie<strong>der</strong>verwertbares Kupfersulfat aufbereitet werden.<br />
Reste aus den Versuchen zum Nachweis <strong>der</strong> Doppelb<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ölsäure mit Brom wurden<br />
ebenfalls gesammelt. Die fachgerechte Entsorgung führte ich als Demonstrationsversuch vor:<br />
Zu <strong>der</strong> Emulsion <strong>der</strong> bromorganischen Verb<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> Wasser gab ich pulverförmige<br />
Aktivkohle, um den Schadstoff an <strong>der</strong> Kohlenoberfläche zu adsorbieren. Nach Filtration<br />
wurde das giftfreie Filtrat weggeschüttet und die schadstoffbeladene Kohle <strong>der</strong><br />
Son<strong>der</strong>müllverbrennung zugeführt.<br />
An diesen Beispielen lernten die Schüler, dass Umweltschutz zum Experiment dazugehört<br />
und auf chemischen Pr<strong>in</strong>zipien beruht.<br />
E<strong>in</strong>e weitere Möglichkeit, ökologische Probleme anzusprechen, ergab sich <strong>in</strong> Anschluß an<br />
<strong>e<strong>in</strong></strong>en Versuch zur Aufnahme von Wasser<strong>in</strong>haltsstoffen durch Pflanzen: E<strong>in</strong> Bund<br />
Schnittlauch wurde <strong>e<strong>in</strong></strong>en Tag <strong>in</strong> Wasser, <strong>e<strong>in</strong></strong> zweiter <strong>in</strong> LiNO 3 -haltiges Wasser gestellt. Dann<br />
wurden die Spitzen <strong>e<strong>in</strong></strong>iger Pflanzen <strong>in</strong> die Brennerflamme gehalten. E<strong>in</strong>e rote<br />
Flammenfärbung belegte die Aufnahme von Lithiumionen. Da jede Pflanze Nährstoffe<br />
braucht, ist <strong>e<strong>in</strong></strong>e Düngung ihres Nährbodens nötig. Überschüssiger Dünger sowie Schadstoffe<br />
im Boden können allerd<strong>in</strong>gs auch von Menschen durch den Verzehr <strong>der</strong> Pflanze<br />
aufgenommen werden.<br />
Gesundheitserziehung<br />
Die Schüler wussten, dass das Naschen von Süßigkeiten zu Karies führen kann. Darunter<br />
versteht man die Auflösung <strong>der</strong> Zahnsubstanz durch Milchsäure, die beim Abbau von Zucker<br />
durch Mundbakterien entsteht. Als Modellexperiment wurde vorgeführt, wie die Säure <strong>e<strong>in</strong></strong>e<br />
Eierschale unter Freisetzung von Gasblasen (CO 2 ) rasch zersetzt. E<strong>in</strong>e zweite Eierschale<br />
wurde zuerst <strong>e<strong>in</strong></strong>en Tag <strong>in</strong> <strong>e<strong>in</strong></strong>e gesättigte NaF-Lösung gelegt, bevor sie <strong>der</strong> Milchsäure
4<br />
ausgesetzt wurde. Jetzt war nur <strong>e<strong>in</strong></strong>e sehr langsame Gasentwicklung zu sehen. Der Versuch<br />
spiegelt die Kariesprophylaxe durch Putzen <strong>der</strong> Zähne mit fluoridhaltiger Zahnpasta wi<strong>der</strong>,<br />
wobei die Zahnoberfläche <strong>in</strong> <strong>e<strong>in</strong></strong>e säureresistente Fluorappatit-Schicht umgewandelt wird /7/.<br />
Vom Reagenzglas- zum halbtechnischen Ansatz<br />
Zunächst schüttelten die Schüler <strong>e<strong>in</strong></strong>e Mischung von Kokosflocken und Petrolether im<br />
Reagenzglas, filtrierten, gaben das Filtrat auf <strong>e<strong>in</strong></strong> Uhrglas und warteten, bis das Lösemittel<br />
(unter dem Abzug) verdunstet war und <strong>e<strong>in</strong></strong> fettiger Film zurückblieb. Anschließend wurde<br />
ihnen die halbtechnische Gew<strong>in</strong>nung von Kokosfett aus -flocken durch Soxhlett-Extraktion<br />
und anschließendes Abdestillieren des Lösemittels am Rotavapor vorgeführt. Sichtlich<br />
be<strong>e<strong>in</strong></strong>druckt waren die Praktikanten von <strong>der</strong> erhaltenen Fettmenge und <strong>der</strong> Effektivität des<br />
Lösemittelrecycl<strong>in</strong>gs.<br />
Ekelige Chemie<br />
In <strong>e<strong>in</strong></strong>e Stärkelösung zu spucken, um den katalytischen Abbau <strong>der</strong> Moleküls durch die im<br />
Speichel enthaltene Amylase zu beweisen, traute sich nur <strong>e<strong>in</strong></strong> Schüler. Die Mädchen ekelten<br />
sich zu sehr davor.<br />
Den Geruch von Sojaöl bei <strong>der</strong> Siedepunktsbestimmung assoziierte <strong>e<strong>in</strong></strong>e Schüler<strong>in</strong> mit dem<br />
von Fisch, worauf ihr gleich schlecht wurde.<br />
Wissenschaftlich überzeugend, aber alles an<strong>der</strong>e als appetitlich war auch <strong>e<strong>in</strong></strong> Versuch zur<br />
konservierenden Wirkung von Vitam<strong>in</strong> C: E<strong>in</strong>e 3 Tage alte, mit Ascorb<strong>in</strong>säurelösung<br />
getränkte Brotscheibe zeigte noch k<strong>e<strong>in</strong></strong>en Schimmelansatz, während <strong>e<strong>in</strong></strong>e Brotscheibe, die mit<br />
Wasser getränkt war, vor lauter Schimmel kaum noch zu erkennen war.<br />
Schließlich erfreuten sich auch das Homogenisieren - <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schülersprache „Zermatschen“ -<br />
von Bananen und Äpfeln zum anschließenden Glucose-Nachweis o<strong>der</strong> das Zerkochen von<br />
Fleisch mit Salzsäure zwecks Herstellung von Suppenwürze k<strong>e<strong>in</strong></strong>er großen Beliebtheit.<br />
„Gut, dass wir nicht immer wissen, was wir essen“, kommentierte <strong>e<strong>in</strong></strong>e Schüler<strong>in</strong>. H<strong>in</strong>ter<br />
dieser Aussage verbirgt sich die traurige Wahrheit, dass viele Menschen die Produkte <strong>der</strong><br />
chemischen und Lebensmittel<strong>in</strong>dustrie zwar wertschätzen und konsumieren, den<br />
Herstellungsmethoden aber sehr kritisch und häufig sogar ablehnend begegnen. Ob m<strong>e<strong>in</strong></strong><br />
Appell, <strong>der</strong> Chemie <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht zum<strong>in</strong>dest <strong>e<strong>in</strong></strong>e faire Chance zu geben, genützt hat,<br />
weiß ich nicht.<br />
Fazit<br />
Trotz anfänglicher Angst vor dem Umgang mit Säuren, Laugen, Brennern und heißen Geräten<br />
und manchem ekelerregenden Versuch waren die Schüler froh, die Gelegenheit gehabt zu<br />
haben, <strong>e<strong>in</strong></strong> Jahr lang <strong>in</strong>tensiv eigene Versuche durchzuführen und auszuwerten. Auf<br />
Diskussionen und sorgfältige schriftliche Dokumentation <strong>der</strong> Ergebnisse hatte ich beson<strong>der</strong>en<br />
Wert gelegt und die Chemiehefte auch regelmäßig kontrolliert. Und Spaß gemacht hat <strong>der</strong><br />
Kurs auch. Dies sei am Beispiel <strong>e<strong>in</strong></strong>es Versuches zum osmotischen Druck belegt. Ich hatte<br />
jedem Kursteilnehmer <strong>e<strong>in</strong></strong> Gummibärchen mit nach Hause gegeben mit <strong>der</strong> Auffor<strong>der</strong>ung,<br />
dieses <strong>in</strong> <strong>e<strong>in</strong></strong>em Glas mit Wasser zu „ertränken“ und die „Wasserleiche“ an nächsten Tag<br />
genau zu beobachten. E<strong>in</strong> Schüler fand es sehr lustig, dass das Tier riesig aufgequollen war,<br />
und beim Versuch, es aus dem Wasser zu fischen, <strong>e<strong>in</strong></strong> B<strong>e<strong>in</strong></strong> verlor.
5<br />
Am Kursende wurde gefeiert, wobei erworbenes Fachwissen zum Bereiten <strong>der</strong> „Cocktails“ <strong>in</strong><br />
die Praxis umgesetzt wurde. Aus den Lebensmitteladditiven Ascorb<strong>in</strong>säure<br />
(Konservierungsmittel und Vitam<strong>in</strong>), W<strong>e<strong>in</strong></strong>säure (Säuerungsmittel),<br />
Natriumhydrogencarbonat (Treibmittel) und kl<strong>e<strong>in</strong></strong>en Mengen Calciumcarbonat,<br />
Magnesiumoxid und Kaliumchlorid (M<strong>in</strong>eralstoffe) wurde Vitam<strong>in</strong>brausepulver hergestellt.<br />
Nach dessen Auflösen <strong>in</strong> Wasser wurden die Getränke mit Haushaltszucker o<strong>der</strong> Süßstoff -<br />
nach Geschmack - gesüßt. Fasz<strong>in</strong>ierende Farben resultierten bei Zugabe von<br />
Farbstofflösungen, die zuvor durch Überschichten von Smarties mit Wasser und Ablösen <strong>der</strong><br />
Lebensmittelfarbstoffe bereitet wurden.<br />
Literatur<br />
1 Stübs, R.: Das Thema „Lebensmittel“ im Chemieunterricht. - In: Chem. Sch. - 43 (1996) 2. - S. 52 ...<br />
60<br />
2 Stübs, R.: Die „7 Säulen“ <strong>der</strong> Ernährung im Chemieunterricht. - In: Chem. Sch.. - 43 (1996) 7/8. - S.<br />
270 ... 279<br />
3 Stübs, R.: Lebensmittelzusatzstoffe. - In: Chem. Sch.<br />
4 Wiskamp, V.: Nachwachsende Rohstoffe - <strong>e<strong>in</strong></strong>e neue Lehrveranstaltung an <strong>der</strong> Fachhochschule<br />
Darmstadt. - In: chimica didactica. - 22 (1996) 1. - S. 67 ... 80; Kramb, V.: Evaluierung <strong>der</strong><br />
dreiteiligen Lehrveranstaltung „Nachwachsende Rohstoffe“. - In: chimica didactica. - 22 (1996) 1. - S.<br />
81 ...83<br />
5 Schmidkonz, B.: Beobachtungen an Gest<strong>e<strong>in</strong></strong>en und M<strong>in</strong>eralien. - In: Chemkon. - im Druck<br />
6 Proske, W.; Wiskamp, V.; Zenker, S.: Das erprobte Experiment: Quantitative Bestimmung von<br />
Vitam<strong>in</strong> C. - In: Chem. Sch. - 44 (1997) . – im Druck<br />
7 Proske, W.; Wiskamp, V.: Modellversuch zur Bildung und Vermeidung von Karies. - In: NiU-<br />
Chemie, im Druck