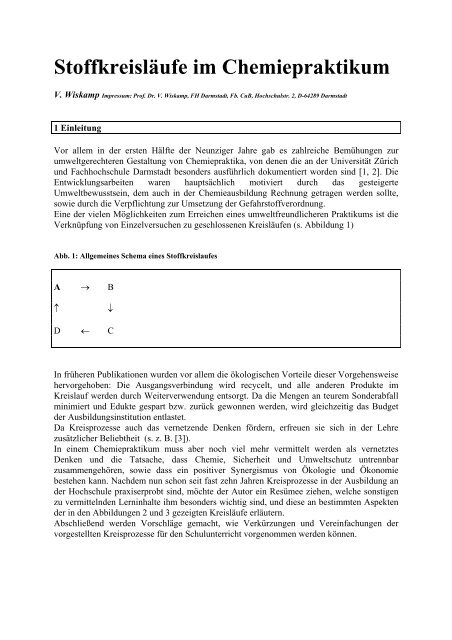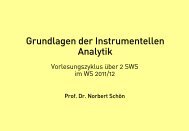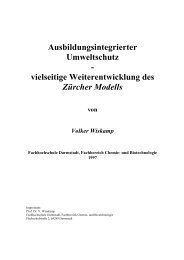Stoffkreisläufe im Chemiepraktikum - Hochschule Darmstadt
Stoffkreisläufe im Chemiepraktikum - Hochschule Darmstadt
Stoffkreisläufe im Chemiepraktikum - Hochschule Darmstadt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Stoffkreisläufe <strong>im</strong> <strong>Chemiepraktikum</strong>V. Wiskamp Impressum: Prof. Dr. V. Wiskamp, FH <strong>Darmstadt</strong>, Fb. CuB, Hochschulstr. 2, D-64289 <strong>Darmstadt</strong>1 EinleitungVor allem in der ersten Hälfte der Neunziger Jahre gab es zahlreiche Bemühungen zurumweltgerechteren Gestaltung von Chemiepraktika, von denen die an der Universität Zürichund Fachhochschule <strong>Darmstadt</strong> besonders ausführlich dokumentiert worden sind [1, 2]. DieEntwicklungsarbeiten waren hauptsächlich motiviert durch das gesteigerteUmweltbewusstsein, dem auch in der Chemieausbildung Rechnung getragen werden sollte,sowie durch die Verpflichtung zur Umsetzung der Gefahrstoffverordnung.Eine der vielen Möglichkeiten zum Erreichen eines umweltfreundlicheren Praktikums ist dieVerknüpfung von Einzelversuchen zu geschlossenen Kreisläufen (s. Abbildung 1)Abb. 1: Allgemeines Schema eines StoffkreislaufesA → B↑↓D ← CIn früheren Publikationen wurden vor allem die ökologischen Vorteile dieser Vorgehensweisehervorgehoben: Die Ausgangsverbindung wird recycelt, und alle anderen Produkte <strong>im</strong>Kreislauf werden durch Weiterverwendung entsorgt. Da die Mengen an teurem Sonderabfallmin<strong>im</strong>iert und Edukte gespart bzw. zurück gewonnen werden, wird gleichzeitig das Budgetder Ausbildungsinstitution entlastet.Da Kreisprozesse auch das vernetzende Denken fördern, erfreuen sie sich in der Lehrezusätzlicher Beliebtheit (s. z. B. [3]).In einem <strong>Chemiepraktikum</strong> muss aber noch viel mehr vermittelt werden als vernetztesDenken und die Tatsache, dass Chemie, Sicherheit und Umweltschutz untrennbarzusammengehören, sowie dass ein positiver Synergismus von Ökologie und Ökonomiebestehen kann. Nachdem nun schon seit fast zehn Jahren Kreisprozesse in der Ausbildung ander <strong>Hochschule</strong> praxiserprobt sind, möchte der Autor ein Resümee ziehen, welche sonstigenzu vermittelnden Lerninhalte ihm besonders wichtig sind, und diese an best<strong>im</strong>mten Aspektender in den Abbildungen 2 und 3 gezeigten Kreisläufe erläutern.Abschließend werden Vorschläge gemacht, wie Verkürzungen und Vereinfachungen dervorgestellten Kreisprozesse für den Schulunterricht vorgenommen werden können.
2Abb. 2: Kupferkreislauf[Cu(H 2 O) 4 ]SO 4⎯NH 3KCO⎯⎯ → [Cu(NH3 ) 4 ]SO 4 ⎯⎯⎯⎯→2 2 4K 2 [Cu(C 2 O 4 ) 2 ]H 2 SO 4 /H 2 O 2 O 2CuClCuCl ←⎯⎯⎯ 2FeCu ←⎯ ⎯ CuCl2 ←HCl ⎯⎯CuOAbb. 3: EisenkreislaufFePyrolyseHSO2 4⎯⎯ ⎯→(NH ) SOFeSO4 ⎯⎯⎯⎯⎯4 2 4→(NH4) 2 Fe(SO 4 ) 2H 2 O 2 /HClFeC 2 O 4 H 3 [FeCl 6 ]UV-BestrahlungMTBEKHC O 2 4KOHK 3 [Fe(C 2 O 4 ) 3 ] ←⎯⎯⎯⎯ Fe(OH) 3 ←⎯⎯⎯[Fe(H2O) 6 ]Cl 3 ←⎯⎯2 ⎯ [Fe(MTBE) 3Cl 3 ]HO2 Vermittlung wichtiger ArbeitstechnikenDie Durchführung der Kreisläufe zur Kupfer- und Eisenchemie n<strong>im</strong>mt etwa vier Arbeitstage,das ist ein Viertel der Gesamtzeit des Einführungspraktikums an der Fachhochschule<strong>Darmstadt</strong>, in Anspruch. Deshalb ist es zunächst einmal erforderlich, dass fundamentaleArbeitstechniken in einem Anorganischen Labor vermittelt werden.Dies ist gewährleistet, denn die Versuchsreihen sind arbeitstechnisch vielseitig.Selbstverständlich werden alle Edukte eingewogen und alle Produkte bis zurGewichtskonstanz getrocknet und dann ausgewogen. Die Gewinnung der Produkte erfolgtdurch Kristallisation (Kaliumoxalatocuprat-(II), Mohrsches Salz, Kaliumoxalatoferrat-(III)),Reaktivfällung (Kupfer, Kupfer(I)-chlorid, Eisen(III)-hydroxid, Eisen(II)-oxalat) oderAussüßen (Tetramminkupfer(II)-sulfat wird aus wässriger Lösung durch Zugabe von Ethanolgefällt) und anschließendes Dekantieren (Mohrsches Salz, Kupfer), Filtrieren (Eisen(II)-sulfat), Absaugen (Tetramminkupfer(II)-sulfat, Eisen(III)-hydroxid) oder Zentrifugieren(Eisen(II)-oxalat). Reaktionen werden <strong>im</strong> Eisbad (Umsetzung von Tetramminkupfer(II)-sulfatmit Kaliumoxalat) oder in der Siedehitze (Umsetzung von Kupfer(II)-chlorid mit Kupfer)durchgeführt; es wird verbrannt (Kaliumoxalatocuprat-(II) zu Kupfer(II)-oxid,Kaliumcarbonat und Kohlenstoff(IV)-oxid) und pyrolysiert (Eisen(II)-oxalat zu Eisen undKohlenstoff(IV)-oxid). Eine Extraktion wird durchgeführt (Hexachloroferrat-(III) mit tert.-Butylmethylether), und be<strong>im</strong> Recyceln des organischen Lösemittels lernen die Studierendenden Rotationsverdampfer kennen. Schließlich wird mit einem Fotoreaktor (Fotoreaktion von
3Oxalatoferrat-(III) zu Eisen(II)-oxalat und Kohlenstoff(IV)-oxid) und unter Schutzgas(Kohlenstoff(IV)-oxid bei der Herstellung von Kupfer(I)-chlorid) gearbeitet.3 Lehrreiche EinzelreaktionenKritiker der hier diskutierten, relativ großen Kreisprozessen werden einwenden, dass <strong>im</strong>Praktikum die Chemie des Kupfer und Eisens überrepräsentiert ist, während hingegen die desNickels oder Chroms beispielsweise fehlt. Dem ist entgegen zu halten, dass es <strong>im</strong>Einführungskurs pr<strong>im</strong>är darauf ankommt, die Auszubildenden mit den für die AnorganischeChemie so typischen Redox-, Säure/Base- und komplexchemischen Reaktionen und damitverbundenen, weitergehenden Fragen vertraut zu machen, und dass es bezüglich derStoffkenntnis und in Anbetracht der doch nicht allzu langen Praktikumdauer vielleichtsinnvoller ist, exemplarisch einige Elemente vertieft zu thematisieren als viele nuroberflächlich. In der Tat lernen die Exper<strong>im</strong>entatoren bei jeder Einzelreaktion etwasInteressantes und Neues.Die Umsetzung von Kupfervitriol zu Tetramminkupfer(II)-sulfat zeigt, dass ein basischeresLigandmolekül (Ammoniak) ein weniger basisches (Wasser) vom Zentralteilchen verdrängenkann.Die Reaktion vom Tetramminkupfer- zum Oxalatocuprat-Komlplex, läuft ab, weil daszweizähnige Oxalat in der Lage ist, zwei einzähnige Amminliganden zu verdrängen(Chelateffekt).Die Umsetzung eines Metalloxids (Kupfer(II)-oxid) mit einer Mineralsäure (Salzsäure) isteine generelle Methode zur Herstellung von Salzen (Kupfer(II)-chlorid).Zur Erklärung der Zementation kann die elektrochemische Spannungsreihe herangezogenwerden: Kupfer(II)-ionen werden vom unedlen Eisen reduziert, gleichzeitig gehen Eisen(II)-ionen in Lösung.Die Reaktion von Kupfer mit Kupfer(II)-chlorid ist eine Synproportionierung, die zu einerVerbindung des einwertigen Kupfers führt. Anders als Kupfer(II)-komplexsalze (d 9 -Systeme)ist Kupfer(I)-chlorid (d 10 -System) farblos.Das unedle Eisen kann von Protonen (der Schwefelsäure) oxidiert werden, allerdings nur biszur zweiwertigen Stufe. Die Weiteroxidation zu Eisen(III)-ionen erfordert stärkereOxidationsmittel, hier Wasserstoffperoxid. Bevor diese Oxidation aber durchgeführt wird,wird <strong>im</strong> Praktikum noch Mohrsches Salz gewonnen, ein repräsentatives Beispiel für einDoppelsalz.In stark salzsaurem Medium liegt dreiwertiges Eisen als Hexachlorokomplex vor. (Eisenionenbilden Oktaederkomplexe, während Kupferionen sich in der Regel mit vier Ligandenbegnügen, und zwar zweiwertiges Kupfer in quadratisch-planarer und einwertiges Kupfer intetraedrischer Anordnung, s. Kupferkreislauf). Drei der anionischen Liganden können durchungeladene Ethermoleküle verdrängt werden, so dass ein Neutralkomplex resultiert, derwegen der Alkylgruppen der Etherliganden hydrophob ist und deshalb in die organischePhase extrahiert werden kann (Reaktivextraktion). Nach Phasentrennung kann das Eisendurch Ausschütteln mit Wasser als kationischer Hexaquokomplex wieder in die wässrigePhase geholt werden. Be<strong>im</strong> Alkalisieren kommt es zur Eisen(III)-hydroxidfällung; mit derSäure Hydrogenoxalat erfolgt die Wiederauflösung des Niederschlages, und zwar unterAusbildung eines grünen Chelatkomplexes. In dessen fotochemisch angeregtem Zustand wirdein Elektron vom Oxalatoliganden zum dreiwertigen Eisen übertragen. Zweiwertiges Eisenbleibt übrig, und der Ligand zerfällt unter Abspaltung von Kohlenstoff(IV)-oxid. Im Seminarwird diese Fotoreaktion mit anderen Prozessen unter Lichteinwirkung verglichen, z. B. beider Schwarz-Weiß-Fotografie oder der Fotosynthese der grünen Pflanzen.
44 Industrie- und PraxisbezugDer Industrie- und Praxisbezug, der gerade in der Ingenieur-Ausbildung an derFachhochschule wichtig ist (in einem Praktikum für Lehramtskandidaten müsste nach derSchulrelevanz gefragt werden), wird in den beschriebenen Kreisprozessen mehrfach deutlich.Kupfersulfat ist die Stammverbindung der Kupferchemie. Technisch wird sie durch saurenAufschluss von Kupfereisenkies gewonnen.Die Zementation ist eine wichtige Methode zur Gewinnung des Halbedelmetalls Kupfer (undanderer Elemente wie Gold oder Silber). Kupfer(I)-chlorid ist ein Katalysator, z. B. beiSandmeyer-Reaktionen.Die Umsetzung von Metalloxiden (CuO) bzw. -hydroxiden (Fe(OH) 3 ) mit Säuren ermöglichtden Zugang zu vielen Salzen (s. o.).Die Oxidation von metallischem und zweiwertigem Eisen begegnet uns beiKorrosionsvorgängen.Eisen(III)-hydroxid ist eine Zentralverbindung der Eisenchemie. Die Fällung des Stoffesspielt z. B. in der Wassertechnik (Flockung) eine Rolle.Die Pyrolyse von Eisen(II)-oxalat spiegelt eine Methode zur Gewinnung sehr feinteiligen unddaher äußerst reaktiven Metalls wider (vgl. die Katalysatorzeugung durch Reduktion vonEisen(III)-oxid mit Wasserstoff <strong>im</strong> Haber-Bosch-Reaktor oder die Zersetzung vonTetracarbonylnickel be<strong>im</strong> Mond-Verfahren).5 Was heißt Recycling?Bedeutet Recycling, dass ein Stoff in seiner ursprünglichen Menge (also quantitativ) undQualität wieder erhalten werden muss, oder ist der Begriff auch noch gerechtfertigt, wenn ein(erheblicher) Ausbeuteverlust, eine verminderte Reinheit oder eine andere Erscheinungsformvorliegt? Diese Frage <strong>im</strong> praktikumbegleitenden Seminar zu thematisieren, ist spannend undlehrreich.Im Darmstädter Praktikum wird Kupfersulfat in etwa 75%iger Ausbeute zurück gewonnen.Dies ist ein gutes Resultat. Dennoch gibt es den Studierenden zu denken, dass ein Viertel dereingesetzten Stoffmenge in diversen Mutterlaugen, Filterpapieren, Nutschen,Präparategläschchen und be<strong>im</strong> Umfüllen und Verschütten verschwunden ist (sog.verfahrensbedingte Verluste).Die Reinheit eines Kupfersulfat-Recyclats beträgt trotz schöner Kristallinität nur etwa 90 %.Dies klingt enttäuschend, ist aber nicht schl<strong>im</strong>m. Denn dadurch, dass das Präparatiodometrisch oder fotometrisch (also mit Methoden aus dem Quantitativen Praktikum) aufseinen Cu-Gehalt hin untersucht wurde, kann es spezifiziert und z. B. versehen mit derAufschrift „CuSO 4 ⋅5H 2 O, 90-%ig, nur verwendbar für die Herstellung vonTetramminkupfer(II)-sulfat <strong>im</strong> Grundpraktikum“ ohne Weiteres zur Benutzung frei gegebenwerden. Ein Einsatz des Recyclats beispielsweise als Referenzsubstanz in der AnalytischenChemie ist hingegen prohibitiv.Die Studierenden kommen zu dem Fazit, dass Recycling besser Downcycling genannt werdensollte, denn das „Recyclat“ hat eine verminderte Qualität und damit nur eine eingeschränkteNutzbarkeit. Man vergleiche den hochmolekularen und hochreinen Kunststoff, der sein Lebenals Käsefolie beginnt, dann aus dem gelben Sack in den Extruder kommt und zu einemFeuerzeuggehäuse umgeschmolzen wird, ein drittes Leben als Parkbank führt und schließlichin der Müllverbrennungsanlage thermisch recycelt wird. Der Begriff Downcycling ist nicht
5abwertend gemeint, denn es ist ökologisch und ökonomisch sehr sinnvoll, einenminderwertigen Stoff für eine weniger anspruchsvolle Funktion, die er aber problemloserfüllen kann, zu nutzen und dadurch Neumaterial zu sparen.Die Eisenkette beginnt mit dem handelsüblichen Metallpulver (ferrum reductum) und endetmit einem durch Pyrolyse von Eisen(II)-oxalat hergestellten extrem feinteiligen Metall. DieAuszubildenden lernen hier, dass aufgrund unterschiedlicher Morphologie Eisen nicht gleichEisen ist. Ihr hochreaktives „Recyclat“ kann nämlich gar nicht als Edukt eines neuenKreislaufes dienen, sondern endet in einem Funkenregen als (umweltfreundlicher) Rost.6 Ganzheitliche Betrachtung der StoffflüsseEs ist trivial, dass Kreisläufe <strong>im</strong>mer dann realisiert sind, sobald aus einem eingesetztenKupfersulfat oder Eisen nach einer Folge von Reaktionen wieder Kupfersulfat bzw. Eisenhervorgeht. Was geschieht aber mit den anderen Reagenzien, Lösungsmitteln undMutterlaugen? Diese Fragen zu beantworten gehört zur ganzheitlichen undverantwortungsvollen Betrachtung von Stoffströmen. Dazu einige Beispiele.Wenn die (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2 -Lösung in den Kühlschrank gestellt wird, kristallisiert ein Teil desSalzes aus, ein Teil bleibt gelöst. Natürlich streben die Praktikanten eine hohe Ausbeute anKristallen an; bezüglich der Folgereaktion (mit Wasserstoffperoxid) ist der Ausbeuteverlustbei der Kristallisation des Mohrschen Salzes allerdings unbedeutend, denn die Kristalle undihre Mutterlauge werden gemeinsam weiter verarbeitet.Das Filtrat der Eisenhydroxidfällung wird in den Ausguss gegeben. Die Studierenden sindsich allerdings der Tatsache bewusst, das der Versuchsrest stark salzhaltig (KCl) undalkalisch (KOH) ist und dass die hauseigene Neutralisationsanlage ihnen einen wichtigenSchritt der Wasseraufbereitung abn<strong>im</strong>mt. Ein anderes Filtrat, das der CuCl-Gewinnung, darfnicht direkt weggeschüttet werden, denn es enthält noch eine geringe, aber doch über dererlaubten Einleitgrenze liegende Menge giftiger Kupferionen, so dass vor der Kanalisationdes Versuchsrestes eine Kupferfällung und Filtration erforderlich ist. Diese nehmen dieAuszubildenden <strong>im</strong> Sinne des Verursacherprinzips selbst vor.Nach beendeter Eisenextraktion wird der Ether mit wenig Aufwand durch Destillation amRotavapor recycelt. Abgesehen von den nicht unerheblichen Verdampfungsverlusten ist damitauch der Lösungsmittelkreislauf geschlossen.7 Vereinfachungen für den SchulunterrichtWenn ein Stoff A unter basischen bzw. reduktiven Bedingungen in einen Stoff B übergeführtwird, so muss die Rückgewinnung von A aus B <strong>im</strong> sauren bzw. oxidativen Milieu stattfinden.Abasisch bzw. reduktivsauer bzw. oxidativBDieser einfache Zusammenhang kann an fünf Teilreaktionen aus den hier beschriebenenKreisprozessen auch <strong>im</strong> Schulunterricht rasch und mit wenig Aufwand verdeutlicht werden.Versuch 1: Eine türkisfarbene Kupfersulfatlösung wird bei Zugabe von überschüssigemAmmoniak tiefblau; die Amminkomplexbildung läuft <strong>im</strong> alkalischen Medium ab. Beianschließender Zugabe von Schwefelsäure werden die NH 3 -Moleküle protoniert, so dass einekomplexartige Bindung an das zweiwertige Kupfer nicht mehr möglich ist, und deranfängliche türkisblaue Aquokomplex wird recycelt.
6[Cu(H 2 O) 4 ]SO 4 (aq) + 4 NH 3 (aq) → [Cu(NH 3 ) 4 ]SO 4 (aq) + 4 H 2 OCu(NH 3 ) 4 ]SO 4 (aq) + 2 H 2 SO 4 (aq) + 4 H 2 O →[Cu(H 2 O) 4 ]SO 4 (aq) + 2 (NH 4 ) 2 SO 4 (aq)Versuch 2: Aus einer Kupfer(II)-chloridlösung fällt bei Zugabe von Natronlaugetürkisfarbenes Kupfer(II)-hydroxid aus, das be<strong>im</strong> Erhitzen zu schwarzem Kupfer(II)-oxidentwässert wird. Beide schwerlöslichen Kupferverbindungen reagieren mit Salzsäure zumursprünglichen Kupfer(II)-chlorid zurück.CuCl 2 (aq) + 2 NaOH (aq) → Cu(OH) 2 (s) + 2 NaCl (aq)Erwä rmenCu(OH) 2 (s) ⎯⎯⎯ ⎯→ CuO (s) + H2OCu(OH) 2 (s) + 2 HCl (aq) → CuCl 2 (aq) + 2 H 2 OCuO (s) + 2 HCl (aq) → CuCl 2 (aq) + H 2 OVersuch 3: Analog bildet sich aus löslichem Eisen(III)-chlorid und Natronlaugeschwerlösliches Eisen(III)-hydroxid, das mit Salzsäure wieder in das Edukt verwandeltwerden kann.FeCl 3 (aq) + 3 NaOH (aq) → Fe(OH) 3 (s) + 3 NaClFe(OH) 3 (s) + 3 HCl (aq) → FeCl 3 (aq) + 3 H 2 OVersuch 4: In stark salzsaurer Lösung liegt dreiwertiges Eisen als Hexachlorokomplex vorund kann daraus mit tert.-Butylmethylether extrahiert werden. Mit reinem Wasser gelingt dieRückführung des Eisens ins wässrige Medium, wo es dann als Hexaquokomplex vorliegt.Be<strong>im</strong> Ansäuern mit konz. Salzsäure erkennt man bereits an der Farbvertiefung die Bildungdes ursprünglichen Chlorokomplexes.H 3 [FeCl 6 ] (aq) + 3 MTBE (l) → [Fe(MTBE) 3 Cl 3 ] (in MTBE) + 3 HCl (aq)[Fe(MTBE) 3 Cl 3 ] (in MTBE) + 6 H 2 O → [Fe(H 2 O) 6 ]Cl 3 (aq) + 3 MTBE (l)[Fe(H 2 O) 6 ]Cl 3 (aq) + 3 HCl (aq) → H 3 [FeCl 6 ] (aq) + 6 H 2 OVersuch 5: Zweiwertiges Kupfer kann mit Eisen zum Element reduziert und diesesanschließend mit Wasserstoffperoxid wieder oxidiert werden.CuSO 4 (aq) + Fe (s) → Cu (s) + FeSO 4 (aq)Cu (s) + H 2 O 2 (aq) + H 2 SO 4 (aq) → CuSO 4 (aq) + 2 H 2 O8 Exper<strong>im</strong>enteller Teil8.1 Benötigte Geräte und ChemikalienReagenzgläser mit Klemme und Ständer, 10-ml-Messzylinder, 50-ml-Schütteltrichter, Brenner, Feuerzeug,Spatel.In Polyethentropfflaschen: Kupfer(II)-sulfat-Lösung (w = 3 %) (Xn, mindergiftig), Ammoniak-Lösung (w = 10%) (C, ätzend), Schwefelsäure (w = 5 %) (C, ätzend), Kupfer(II)-chlorid-Lösung (w = 3 %) (Xn, mindergiftig),Natronlauge (w = 5 %) (C, ätzend), Salzsäure (w = 37 und 5 %) (C, ätzend), Eisen(III)-chlorid-Lösung (w = 3%) (Xi, reizend), tert.-Butylmethylether (Xi, reizend, F, leichtentzündlich), Eisenpulver, Kupferpulver,Wasserstoffperoxid-Lösung (w = 30 %) (C, ätzend), dest. Wasser.
78.2 DurchführungVersuch 1: Zu 3 ml Kupfersulfat-Lösung wird Ammoniak-Lösung getropft, bis ein intermediärer Hydroxid-Niederschlag vollständig in Lösung gegangen ist und eine tiefblaue Lösung vorliegt. Diese wird tropfenweisemit Schwefelsäure versetzt, bis die tiefblaue Farbe verschwunden und die Lösung wieder türkisfarben ist.Versuch 2a: 3 ml Kupferchlorid-Lösung werden mit etwa 5 Tropfen Natronlauge versetzt, wobei eintürkisfarbener Niederschlag entsteht. Dieser wird durch Zutropfen von verdünnter Salzsäure wieder aufgelöst.Versuch 2b: 3 ml Kupferchlorid-Lösung werden mit etwa 5 Tropfen Natronlauge versetzt, wobei eintürkisfarbener Niederschlag entsteht. Es wird erhitzt, bis dieser in schwarzes Kupferoxid übergegangen ist,welches abschließend durch Zutropfen von verdünnter Salzsäure aufgelöst wird.Versuch 3: 3 ml Eisenchlorid-Lösung werden mit etwa 5 Tropfen Natronlauge versetzt, wobei ein braunerNiederschlag entsteht. Dieser wird durch Zutropfen von verdünnter Salzsäure wieder aufgelöst.Versuch 4: 5 ml Eisenchlorid-Lösung werden in einen Schütteltrichter gegeben und mit 5 ml konzentrierterSalzsäure versetzt, worauf sich die Farbe etwas verdunkelt. Dann werden 10 ml MTBE zugegeben, und es wirdgeschüttelt. Nach der Phasentrennung wird die jetzt eisenhaltige organische Phase mit 5 ml Wasser extrahiertund dabei farblos. Nach erneuter Phasentrennung wird die nun eisenhaltige wässrige Phase mit 5 mlkonzentrierter Salzsäure verdünnt. Der Ether wird gesammelt und − wenn eine größere Mengezusammengekommen ist − mit Wasser gewaschen. Dann kann er für eine erneute Eisenextraktion benutztwerden.Versuch 5: 10 ml Kupfersulfat-Lösung werden mit 5 Tropfen Schwefelsäure und einer Spatelspitze Eisenpulverversetzt. Man lässt die Mischung etwa 5 Minuten stehen und schüttelt gelegentlich um. Die über demKupferschlamm stehende, fast farblose Flüssigkeit wird abgeschüttet und das Rohkupfer mehrmals mit 0.5-ml-Portionen Schwefelsäure gewaschen, um überschüssiges Eisen oxidativ zu lösen (Wasserstoff-Entwicklung).(Das Eisen muss weitgehend entfernt sein, denn sonst verhindert das bei der folgenden Oxidation sichunwillkürlich bildende Eisen(III)-sulfat die Erkennung der charakteristischen Farbe des entstehendenKupfer(II)sulfates. Falls die Zeit für die Reinigungsoperation nicht zur Verfügung steht, kann der Versuch mithandelsüblichem Kupferpulver fortgesetzt werden.) Das Kupfer wird mit 3 ml Schwefelsäure und 10 TropfenWasserstoffperoxid-Lösung versetzt. Man beobachtet eine zunehmende (be<strong>im</strong> vorsichtigen Erwärmenschnellere) Türkisfärbung der Lösung.Literatur[1] H. Fischer: Praktikum in Allgemeiner Chemie, Teil 1. 2. Auflage, VHCA und VCH, Basel und Weinhe<strong>im</strong>,1994; H. Fischer: Praktikum in Allgemeiner Chemie, Teil 2. VHCA und VCH, Basel und Weinhe<strong>im</strong>, 1993[2] V. Wiskamp: Umweltfreundlichere Versuche <strong>im</strong> Anorganisch-Analytischen Praktikum. VCH, Weinhe<strong>im</strong>,1995[3] H. Schmidkunz: Kreisprozesse und Unterricht. NiU-Chemie 7 (2), 4 (1996)Anschrift des Verfassers:Prof. Dr. Volker Wiskamp, FH <strong>Darmstadt</strong>, FB. CuB, Hochschulstr. 2, 64289 <strong>Darmstadt</strong>Abstract:Kreisprozesse, hier ausführlich am Beispiel der Kupfer- und Eisenchemie diskutiert, tragennicht nur zur umweltgerechteren Gestaltung von Chemiepraktika bei, weil Edukte wiedergewonnen und Zwischenprodukte durch Weiterverwendung entsorgt werden. Sie fördern auchdas vernetzende Denken und Betrachten von Stoffflüssen <strong>im</strong> Ganzen. Der Begriff Recyclingwird kritisch reflektiert. Klassische Lerninhalte wie das Kennenlernen wichtigerArbeitstechniken und chemischer Prinzipien (Redox-, Säure/Base-, komplexchemischeReaktionen, chemisches Gleichgewicht etc.) kommen bei geschickter Zusammenstellung der
8Einzelversuche keineswegs zu kurz. Vereinfachungen der beschriebenen Kreisläufe für denSchulunterricht werden vorgeschlagen.