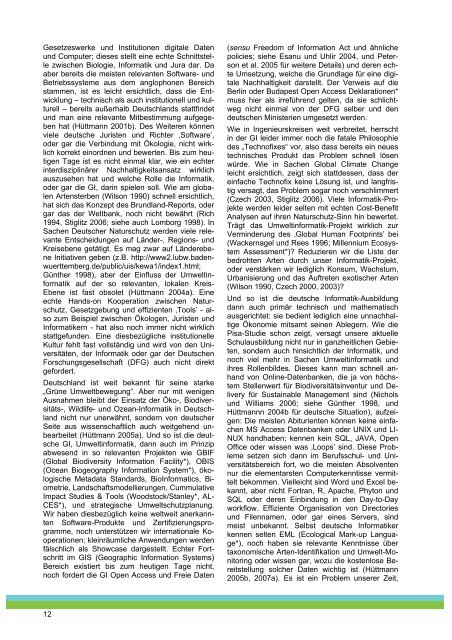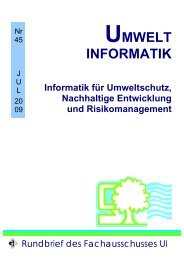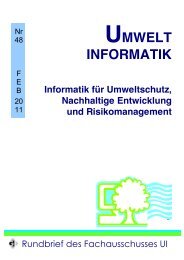UMWELT INFORMATIK
UMWELT INFORMATIK
UMWELT INFORMATIK
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gesetzeswerke und Institutionen digitale Daten<br />
und Computer; dieses stellt eine echte Schnittstelle<br />
zwischen Biologie, Informatik und Jura dar. Da<br />
aber bereits die meisten relevanten Software- und<br />
Betriebssysteme aus dem anglophonen Bereich<br />
stammen, ist es leicht ersichtlich, dass die Entwicklung<br />
– technisch als auch institutionell und kulturell<br />
– bereits außerhalb Deutschlands stattfindet<br />
und man eine relevante Mitbestimmung aufgegeben<br />
hat (Hüttmann 2001b). Des Weiteren können<br />
viele deutsche Juristen und Richter ‚Software’,<br />
oder gar die Verbindung mit Ökologie, nicht wirklich<br />
korrekt einordnen und bewerten. Bis zum heutigen<br />
Tage ist es nicht einmal klar, wie ein echter<br />
interdisziplinärer Nachhaltigkeitsansatz wirklich<br />
auszusehen hat und welche Rolle die Informatik,<br />
oder gar die GI, darin spielen soll. Wie am globalen<br />
Artensterben (Wilson 1990) schnell ersichtlich,<br />
hat sich das Konzept des Brundland-Reports, oder<br />
gar das der Weltbank, noch nicht bewährt (Rich<br />
1994, Stiglitz 2006; siehe auch Lomborg 1998). In<br />
Sachen Deutscher Naturschutz werden viele relevante<br />
Entscheidungen auf Länder-, Regions- und<br />
Kreisebene getätigt. Es mag zwar auf Länderebene<br />
Initiativen geben (z.B. http://www2.lubw.badenwuerttemberg.de/public/uis/kewa1/index1.html;<br />
Günther 1998), aber der Einfluss der Umweltinformatik<br />
auf der so relevanten, lokalen Kreis-<br />
Ebene ist fast obsolet (Hüttmann 2004a). Eine<br />
echte Hands-on Kooperation zwischen Naturschutz,<br />
Gesetzgebung und effizienten ‚Tools’ - also<br />
zum Beispiel zwischen Ökologen, Juristen und<br />
Informatikern - hat also noch immer nicht wirklich<br />
stattgefunden. Eine diesbezügliche institutionelle<br />
Kultur fehlt fast vollständig und wird von den Universitäten,<br />
der Informatik oder gar der Deutschen<br />
Forschungsgesellschaft (DFG) auch nicht direkt<br />
gefordert.<br />
Deutschland ist weit bekannt für seine starke<br />
„Grüne Umweltbewegung“. Aber nur mit wenigen<br />
Ausnahmen bleibt der Einsatz der Öko-, Biodiversitäts-,<br />
Wildlife- und Ozean-Informatik in Deutschland<br />
nicht nur unerwähnt, sondern von deutscher<br />
Seite aus wissenschaftlich auch weitgehend unbearbeitet<br />
(Hüttmann 2005a). Und so ist die deutsche<br />
GI, Umweltinformatik, dann auch im Prinzip<br />
abwesend in so relevanten Projekten wie GBIF<br />
(Global Biodiversity Information Facility*), OBIS<br />
(Ocean Biogeography Information System*), ökologische<br />
Metadata Standards, BioInformatics, Biometrie,<br />
Landschaftsmodellierungen, Cummulative<br />
Impact Studies & Tools (Woodstock/Stanley*, AL-<br />
CES*), und strategische Umweltschutzplanung.<br />
Wir haben diesbezüglich keine weltweit anerkannten<br />
Software-Produkte und Zertifizierungsprogramme,<br />
noch unterstützen wir internationale Kooperationen;<br />
kleinräumliche Anwendungen werden<br />
fälschlich als Showcase dargestellt. Echter Fortschritt<br />
im GIS (Geographic Information Systems)<br />
Bereich existiert bis zum heutigen Tage nicht,<br />
noch fordert die GI Open Access und Freie Daten<br />
(sensu Freedom of Information Act und ähnliche<br />
policies; siehe Esanu und Uhlir 2004, und Peterson<br />
et al. 2005 für weitere Details) und deren echte<br />
Umsetzung, welche die Grundlage für eine digitale<br />
Nachhaltigkeit darstellt. Der Verweis auf die<br />
Berlin oder Budapest Open Access Deklarationen*<br />
muss hier als irreführend gelten, da sie schlichtweg<br />
nicht einmal von der DFG selber und den<br />
deutschen Ministerien umgesetzt werden.<br />
Wie in Ingenieurskreisen weit verbreitet, herrscht<br />
in der GI leider immer noch die fatale Philosophie<br />
des „Technofixes“ vor, also dass bereits ein neues<br />
technisches Produkt das Problem schnell lösen<br />
würde. Wie in Sachen Global Climate Change<br />
leicht ersichtlich, zeigt sich stattdessen, dass der<br />
einfache Technofix keine Lösung ist, und langfristig<br />
versagt, das Problem sogar noch verschlimmert<br />
(Czech 2003, Stiglitz 2006). Viele Informatik-Projekte<br />
werden leider selten mit echten Cost-Benefit<br />
Analysen auf ihren Naturschutz-Sinn hin bewertet.<br />
Trägt das Umweltinformatik-Projekt wirklich zur<br />
Verminderung des ‚Global Human Footprints’ bei<br />
(Wackernagel und Rees 1996; Millennium Ecosystem<br />
Assessment*)? Reduzieren wir die Liste der<br />
bedrohten Arten durch unser Informatik-Projekt,<br />
oder verstärken wir lediglich Konsum, Wachstum,<br />
Urbanisierung und das Auftreten exotischer Arten<br />
(Wilson 1990, Czech 2000, 2003)?<br />
Und so ist die deutsche Informatik-Ausbildung<br />
dann auch primär technisch und mathematisch<br />
ausgerichtet: sie bedient lediglich eine unnachhaltige<br />
Ökonomie mitsamt seinen Ablegern. Wie die<br />
Pisa-Studie schon zeigt, versagt unsere aktuelle<br />
Schulausbildung nicht nur in ganzheitlichen Gebieten,<br />
sondern auch hinsichtlich der Informatik, und<br />
noch viel mehr in Sachen Umweltinformatik und<br />
ihres Rollenbildes. Dieses kann man schnell anhand<br />
von Online-Datenbanken, die ja von höchstem<br />
Stellenwert für Biodiversitätsinventur und Delivery<br />
für Sustainable Management sind (Nichols<br />
und Williams 2006; siehe Günther 1998, und<br />
Hüttmannn 2004b für deutsche Situation), aufzeigen:<br />
Die meisten Abiturienten können keine einfachen<br />
MS Access Datenbanken oder UNIX und LI-<br />
NUX handhaben; kennen kein SQL, JAVA, Open<br />
Office oder wissen was ‚Loops’ sind. Diese Probleme<br />
setzen sich dann im Berufsschul- und Universitätsbereich<br />
fort, wo die meisten Absolventen<br />
nur die elementarsten Computerkenntisse vermittelt<br />
bekommen. Vielleicht sind Word und Excel bekannt,<br />
aber nicht Fortran, R, Apache, Phyton und<br />
SQL oder deren Einbindung in den Day-to-Day<br />
workflow. Effiziente Organisation von Directories<br />
und Filennamen, oder gar eines Servers, sind<br />
meist unbekannt. Selbst deutsche Informatiker<br />
kennen selten EML (Ecological Mark-up Language*),<br />
noch haben sie relevante Kenntnisse über<br />
taxonomische Arten-Identifikation und Umwelt-Monitoring<br />
oder wissen gar, wozu die kostenlose Bereitstellung<br />
solcher Daten wichtig ist (Hüttmann<br />
2005b, 2007a). Es ist ein Problem unserer Zeit,<br />
12