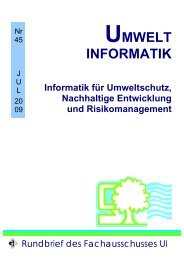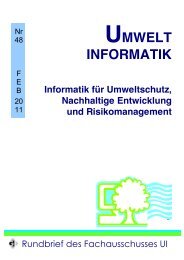UMWELT INFORMATIK
UMWELT INFORMATIK
UMWELT INFORMATIK
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fohrer, Kiel. Zur Kalibrierung komplexer Modelle<br />
sind umfangreiche Datensätze notwendig, um die<br />
Modellergebnisse korrekt interpretieren zu können.<br />
Da diese Datensätze oft nicht zur Verfügung stehen,<br />
wird anhand von SIMPEL, einer Kollektion<br />
von 1D-Modellen zur Simulation der Wasserbilanz,<br />
gezeigt, wie einfache Spreadsheet-Modelle zum<br />
besseren Verständnis der Modellierungsergebnisse<br />
genutzt werden können. Am Beispiel von Modellanalysen<br />
der Bornhöveder Seenkette wurde<br />
die Vorgehensweise vorgestellt und die Effizienz<br />
der Methode demonstriert.<br />
Die Nutzung, Bewirtschaftung und operative Steuerung<br />
von Fließgewässereinzugsgebieten erfolgt<br />
meistens anhand von stationären und instationären<br />
Bilanzmodellen für Wassermenge und Wassergüte.<br />
Unter Einführung von Restriktionen sind<br />
auch Konfliktsituationen darstellbar. Einen anderen<br />
Weg gehen S. Wei und A. Gnauck, Cottbus.<br />
Sie verwenden kooperative und nichtkooperative<br />
spieltheoretische Modelle zur Modellierung und<br />
Simulation von Konflikten zwischen verschiedenen<br />
Gewässernutzern in einem Flussgebiet. Am Beispiel<br />
des Hanjiang-Flussgebietes zeigten sie die<br />
methodischen Ansätze für die Wassermenge und<br />
die Wassergüte, insbesondere Gesamtstickstoff<br />
und Gesamtphosphor, auf und simulierten Gewinne<br />
und Verluste der Spieler bei unterschiedlichen<br />
Strategien.<br />
Der Schwerpunkt „Neuronale Netze“ wurde durch<br />
einen Beitrag von O. Lünsdorf, F. Finke und M.<br />
Sonnenschein, Oldenburg, eingeleitet. Anhand<br />
des individuen-orientierten Simulationsframeworks<br />
SimapD zur Abschätzung von anthropogenen Störungen<br />
auf einen Habitatverbund, lassen sich die<br />
ökologischen Effekte von Entscheidungsmaßnahmen<br />
(z. B. Grünbrücken, Umzäunungen, Tempolimits<br />
usw.) einschätzen. Um einen maximalen<br />
Nutzen aus Entscheidungsmaßnahmen zu erzielen,<br />
müssen meist rechenintensive Simulationen<br />
zur Suche des optimalen Szenarios durchgeführt<br />
werden. Zur Verringerung der Rechenzeit wurden<br />
Approximationsverfahren eingesetzt und mittels<br />
Fehlermetriken bewertet. Zum Vergleich wurden<br />
Mehrschicht-Perzeptren, Radiale-Basis-Funktionsnetze<br />
und Support-Vektor-Maschinen verwendet.<br />
Eine umweltverträgliche Grundwassergewinnung,<br />
als bedeutendste Quelle der Trinkwasserversorgung,<br />
erfordert auch ein nachhaltiges Grundwassermanagement.<br />
Ein wichtiges Instrument zur<br />
Stabilisierung der Grundwasserstände ist die gezielte<br />
künstliche Grundwasseranreicherung durch<br />
Infiltration von Flusswasser. P. Göbel, Darmstadt,<br />
stellte ein KNN-basiertes Konzept zur Bestimmung<br />
der Infiltrationsmengen in der Grundwasserbewirtschaftung<br />
vor, um Aussagen über den zu erwartenden<br />
Grundwasserstand in Abhängigkeit variierender<br />
Infiltrationsmengen geben zu können,<br />
welche die Erreichung von Richtwerten gewährleisten.<br />
Am Beispiel eines Projektgebietes im Hessischen<br />
Ried wurden das Grundwassermonitoring<br />
und erste Simulationsergebnisse vorgestellt. Als<br />
beste Kombination für die Lösung der Problemstellung<br />
wurde ein FNN 5D-90-30-1 Netzwerk mit einem<br />
Zeitfenster von 18 Monaten und einem Training<br />
mit 25.000 Zyklen für die Eingabevariablen<br />
Grundwasserflurabstand, Absickerung und Nettoentnahme<br />
bestimmt.<br />
Bei der Regelung von Müllverbrennungsanlagen<br />
ist ein modellprädiktiver Ansatz bislang nicht oder<br />
nur bedingt möglich, da die hohe Zahl unbekannter<br />
bzw. schwer zu beschreibender Prozesse und<br />
zeitliche Abhängigkeiten zwischen den Stell- und<br />
Regelgrößen die Formulierung eines expliziten<br />
mathematischen Modells erschweren. Einen Ausweg<br />
sahen S. Birkenfeld, M. Reuter und S. Vodegel,<br />
Clausthal-Zellerfeld, im Einsatz neuronaler<br />
Netze. Sie verwenden dazu ein aus einem selbstorganisierenden<br />
Netz und einem Feed-Forward-<br />
Netz bestehendes hybrides Netz, um zukünftige<br />
Betriebszustände vorherzusagen. Die Vorgehensweise<br />
zur Erstellung eines prädiktiven Klassifikators<br />
zur Modellierung und somit zur modellprädiktiven<br />
Regelung wurde eingehend diskutiert.<br />
Der zweite Tag des Workshops begann mit einem<br />
anspruchsvollen theoretisch-ökologischen Beitrag<br />
über einen ontologisch begründeten Denkansatz<br />
zur Analyse, Diagnose und Prognose von Ökosystemen.<br />
F. W. Dahmen und G. Dahmen, Mechernich,<br />
referierten über das Thema „Ähnlichkeit anstelle<br />
von Identität“. Anhand der Metapher „von<br />
den richtigen Schlüsseln zu den richtigen Schlössern“<br />
spannten sie den Bogen aus geobotanischer<br />
Sicht über holistische und reduktionistische Betrachtungsweisen<br />
in der Ökologie, über ganzheitliche<br />
Aspekte der Mustererkennung (ähnlich, aber<br />
nicht gleich, und doch Ordnung), über strukturbildende<br />
Prozesse bis hin zu Erläuterungen von<br />
Begriffen wie direkte und indirekte Umwelt und<br />
dem von ihnen formulierten Relativitätsprinzip der<br />
Ökologie. Praktische Ausprägungen fanden die<br />
theoretischen Überlegungen in der Charakterisierung<br />
landschaftlicher Raumeinheiten und der von<br />
ihnen entwickelten Pflanzendatenbank TERRA<br />
BOTANICA, die sie mit zahlreichen Beispielen dokumentierten.<br />
Der Schwerpunkt Ökosysteme und GIS wurde<br />
durch einen Vortrag von S. Nickel, W. Busch, M.<br />
Kelschebach, V. Staege und P. Vosen, Essen, ü-<br />
ber ein GIS-integriertes fuzzy-regelbasiertes Modell<br />
zur ökologischen Auswirkungsprognose bergbaulicher<br />
Umwelteinwirkungen eingeleitet. Der<br />
untertägige Steinkohleabbau führt über ein komplexes<br />
Wirkungsgefüge zu Auswirkungen auf<br />
Grundwasserleiter, Oberflächengewässer, Bodenrelief,<br />
Biotope, Fauna, Land- und Forstwirtschaft,<br />
Freizeit und Erholung. Ausgangspunkt der Auswirkungsprognose<br />
sind die durch den Steinkohlebergbau<br />
verursachten Senkungen der Erdoberfläche,<br />
die zu Modifizierungen der Grundwasser-<br />
20