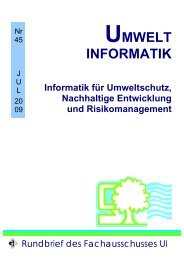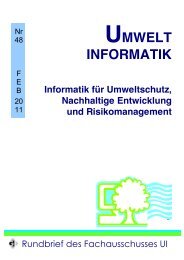UMWELT INFORMATIK
UMWELT INFORMATIK
UMWELT INFORMATIK
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
enzen werden durch Präferenzstrukturen modelliert,<br />
auf denen die Methoden der Entscheidungstheorie<br />
aufsetzen. Die Indifferenz wird anhand von<br />
Schwellenwertmodellen angegeben. Mit Hilfe verschiedener<br />
multikriterieller Verfahren der Entscheidungstheorie<br />
wurden retrospektive Bewertungen<br />
des Belastungszustandes an Probenahmestellen<br />
sowie prospektive Bewertungen der Gewässergüte<br />
am Beispiel des Spree-Havel-Gewässersystems<br />
vorgestellt.<br />
R. Vogel und N. X. Thinh, Dresden, griffen die Ü-<br />
berlegungen des einleitenden Vortrages auf und<br />
diskutierten Indikatoren zur multikriteriellen Bewertung<br />
von Retentionsflächen in der deutschen Elbaue<br />
als vorbeugende Maßnahme zur Minderung<br />
von Schäden an Gebäuden und in der Landwirtschaft.<br />
Zur Identifikation neuer Retentionsflächen<br />
entwickelten sie ein Indikatorset bezüglich Schutzgüter<br />
und Nutzbarkeit. Grundlage für GIS-basierte<br />
Berechnungen der Indikatordatensätze bilden<br />
thematische Geodatensätze der Bundesländer<br />
sowie Daten des ATKIS-DLM und des ATKIS-<br />
DGM. Die Homogenisierung der Daten erfolgte indikatorspezifisch<br />
durch Geoprocessing-Algorithmen.<br />
Die gerasterten Indikatordatensätze dienten<br />
als Input für die multikriteriellen Bewertungen mittels<br />
der Compromise Programming-Methode. Am<br />
Beispiel der Elbaue wurden Anwendungen beschrieben<br />
und Probleme bei der Erstellung länderübergreifender<br />
Indikatordatensätze diskutiert.<br />
Die Vorhersage und Beurteilung der Potentiale<br />
ländlicher Gebiete unter dem Einfluss eines regionalen<br />
Klimawandels wurden durch M. Berg, R.<br />
Wieland, W. Mirschel und K.-O. Wenkel, Müncheberg,<br />
am Beispiel des Entscheidungsunterstützungssystems<br />
LANDCARE diskutiert. Ausgehend<br />
von einer Klimadatenanalyse werden agrarbetriebliche<br />
und regionale Modelle in die Vorhersage einbezogen<br />
und Wahrscheinlichkeitsaussagen formuliert.<br />
Durch Parallelisierung der Teilmodelle ist ein<br />
interaktives Arbeiten im DSS möglich. Schwerpunkte<br />
des DSS liegen auf einer schnellen und intuitiven<br />
Interaktion zwischen Akteuren und DSS<br />
sowie auf einer Entscheidungsunterstützung traditioneller<br />
und moderner agrarwirtschaftlicher Produktionsweisen.<br />
Über den Aufbau eines entscheidungsunterstützenden<br />
Informationssystems für die Wasser- und<br />
Schifffahrtsverwaltung des Bundes zur Berücksichtigung<br />
ökologischer Belange beim Gewässerausbau<br />
und der Gewässerunterhaltung berichteten<br />
H. Albert, G. Belger, M. Haase, T. Hens, J. Kirsch,<br />
K. Lippert, G. Dax, E. Fuchs, H. Giebel, P. Horchler,<br />
V. Hüsing und S. Rosenzweig, Koblenz. Das<br />
Modellsystem INFORM (INtegrated FlOodplain<br />
Response Model) ermöglicht eine integrierte Betrachtung<br />
ökologischer Prozesse in der Flussaue,<br />
wobei vor allem Auswirkungen von Veränderungen<br />
in der Flussaue ermittelt und bewertet werden.<br />
INFORM.DSS (DSS Decision Support System)<br />
setzt darauf auf und dient als Frontend zur Definition<br />
und Analyse der Auswirkungen von Unterhaltungs-<br />
und Flussbaumaßnahmen. INFORM.DSS<br />
ist als verteiltes System konzipiert. Der IN-<br />
FORM.DSS Client basiert auf dem Open Source<br />
Software Framework Kalypso und ist in Java implementiert.<br />
Ein wesentlicher Vorteil bei der Projektarbeit<br />
mit dem INFORM.DSS Clienten ist, dass<br />
die Planungsarbeiten direkt in ihrem räumlichen<br />
Kontext (GIS-Funktionalitäten) erfolgen.<br />
Ergänzend dazu stellten M. Löw, G. Belger, M.<br />
Haase, T. Hens, D. Kuch, K. Lippert, M. Thül, C.<br />
Hübner, M. Ostrowski, A. Winterscheid, E. Fuchs,<br />
P. Horchler, V. Hüsing, S. Rosenzweig, J. Slikker<br />
und P. van Iersel, Wiesbaden/Koblenz/Darmstadt/-<br />
’s-Hertogenbosch/Breda, ein Informations- und<br />
Entscheidungsunterstützungssystem zur Planung<br />
von Hochwasserschutzmaßnahmen im technischökologisch-ökonomischen-raumplanerischen<br />
Kontext<br />
vor. nofdp IDSS (nature-oriented flood damage<br />
prevention) stellt ein mesoskaliges Planungsinstrument<br />
dar, das die Einbeziehung ökologischer<br />
Ziele gestattet. Die Applikation nofdp IDSS besteht<br />
aus den Funktionsgruppen Projektdefinition, Analysewerkzeuge,<br />
interaktive Planungsinstrumente,<br />
Bewertungsfunktionen für Planungsmaßnahmen<br />
und einer Berichtskomponente sowie aus Schnittstellen<br />
zu anderen Systemen. nofdp IDSS ist als<br />
multilinguales System konzipiert und beinhaltet<br />
umfangreiche Geofunktionen. Die integrierte Reportingfunktionalität<br />
erlaubt eine Einbindung von<br />
kartographischen Darstellungen. In Variantenstudien<br />
kann die Wirkung von Maßnahmenkomplexen<br />
mit Hilfe eines integrierten hydraulischen Modells<br />
sowie der nachgeschalteten Module zur Bestimmung<br />
des Vegetationspotenzials und der Eignung<br />
zum Wasserrückhalt analysiert werden. Evaluierungsfunktionen<br />
helfen Planungsszenarien zu bewerten<br />
bzw. zeigen weiteren Planungsbedarf auf.<br />
Am 3. Arbeitstag des Workshops wurde der<br />
Schwerpunkt „Umweltdaten“ behandelt. Zunächst<br />
stellte M. Keszycka, Wroclaw, ihre umfangreichen<br />
experimentellen Ergebnisse zur Untersuchung der<br />
Algengrößenverteilung im Trink- und Abwasser<br />
mittels eines Laser-Granulometers vor, wobei insbesondere<br />
Verteilungsfunktionen und Mittelwerte<br />
zur Einschätzung der verschiedenen Suspensionen<br />
dienten. Zur Klassifikation der Bildanalysen<br />
wurden außerdem clusteranalytische Verfahren<br />
verwendet. Eine Beurteilung der Ergebnisse erfolgte<br />
durch Intensitätsmaße.<br />
Zur exakten mathematischen Beschreibung der<br />
Verteilungsfunktionen entwickelte J. Jarnicka,<br />
Warschau, parametrische und nichtparametrische<br />
statistische Modelle, die optimale Schätzungen der<br />
Parameter erlauben. Mittels einer verallgemeinerten<br />
Schätzfunktion wurden für Klärwerksdaten<br />
vom Umfang n = 10000 sehr genaue Schätzungen<br />
erhalten und multimodale Verteilungen ermittelt.<br />
Die zwischen Zu- und Ablauf einer Kläranlage sta-<br />
22