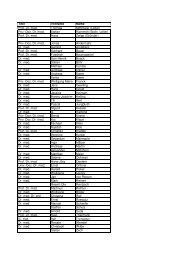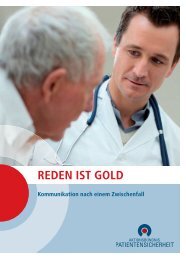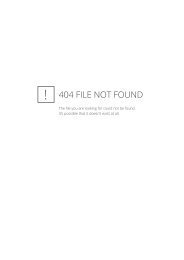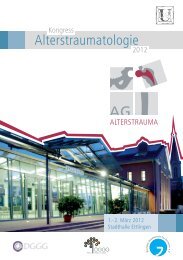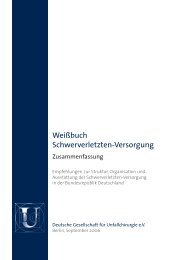Mitteilungen und Nachrichten - Deutsche Gesellschaft für ...
Mitteilungen und Nachrichten - Deutsche Gesellschaft für ...
Mitteilungen und Nachrichten - Deutsche Gesellschaft für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Unfallchirurgie an den Hochschuleinrichtungen<br />
der DDR<br />
E. Markgraf, W. Otto<br />
Situation nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
Die nationalsozialistische Gewaltherrschaft<br />
<strong>und</strong> die Folgen des 2. Weltkrieges<br />
mit den Zerstörungen der Städte durch die<br />
großen Luftangriffe hatten Deutschland<br />
in eine erschütternde Not <strong>und</strong> eine fast<br />
ausweglose Situation gebracht. Mangel an<br />
Unterkünften, Nahrungsmitteln, Kleidung,<br />
Heizmaterialien, Medikamenten, aber auch<br />
räumlichen Kapazitäten für die Kranken<strong>und</strong><br />
Verletztenversorgung bestimmte den<br />
Alltag. Krankheiten (Fleckfieber, Typhus,<br />
Tuberkulose, venerische Erkrankungen) traten<br />
epidemieartig auf. Die anschwellenden<br />
Flüchtlingsströme von Menschen aus den<br />
ehemaligen Ostgebieten verschärften die Situation.<br />
Eine enorme Zahl von Angehörigen<br />
der ehemaligen Wehrmacht war gefallen,<br />
in Kriegsgefangenschaft gekommen oder<br />
galt als vermisst. Die besonders schweren<br />
Bedingungen eines Arztes im 2. Weltkrieg<br />
<strong>und</strong> der nachfolgenden Gefangenschaft hat<br />
der ehemalige Sanitätsoffizier <strong>und</strong> spätere<br />
Ordinarius für Chirurgie in Halle, Karl-Ludwig<br />
Schober (1912–1999), Abb. 1, der die<br />
Schlacht um Stalingrad überlebt hat, anschaulich<br />
geschildert [16].<br />
Zur Behandlung verletzter Menschen standen<br />
in den Jahren nach Beendigung des<br />
2. Weltkriegs nur unzureichende operative<br />
Abb. 1 Porträt von K.-L. Schober (1912–1999)<br />
Aus: Privatbesitz Prof. Dr. Wieland Otto<br />
Möglichkeiten zur Verfügung. Auch die<br />
Reha bilitation der vielen Kriegsversehrten,<br />
die noch über viele Jahre betreuungspflichtig<br />
waren, bereiteten fachliche <strong>und</strong> technische<br />
Probleme. Entsprechende Notsituationen<br />
ergaben sich auch aus den teilweise<br />
erheblichen Kriegseinwirkungen an Krankenhausgebäuden.<br />
Es war, im Westen wie<br />
im Osten, eine erhebliche Aufbauleistung<br />
bei oft desolaten Voraussetzungen nötig. F.<br />
Meißner [10], hat sich in einem Artikel zum<br />
100. Geburtstag des früheren Ordinarius für<br />
Chirurgie in Leipzig, Herbert Uebermuth, folgendermaßen<br />
geäußert: „Lebensgeschichte<br />
ist immer auch Zeitgeschichte. Für die Vita<br />
des von uns heute <strong>und</strong> immer verehrten Herbert<br />
Uebermuth im doppelten Sinn, insofern,<br />
als sein Leben infernalischen äußeren Kräften<br />
ausgesetzt war. Er mußte 2 Weltkriege<br />
durchstehen, <strong>und</strong> er mußte seinen Weg durch<br />
2 Diktaturen finden. Wir sollten uns erinnern,<br />
dass viele Klinikdirektoren <strong>und</strong> erfahrene<br />
Chirurgen aus dem Krieg gekommen waren,<br />
sie vollzogen unter grotesken Bedingungen<br />
den Wiederaufbau ihrer vielfach in ruinenhaftem<br />
Zustand angetroffenen Kliniken in<br />
verblüffender Zeit. Diesen Männern ist viel<br />
zu verdanken, Herbert Uebermuth gehörte<br />
zu ihnen. Sie sicherten, dass es zu keinem Erdrutsch<br />
in der medizinischen Versorgung der<br />
Bevölkerung kam <strong>und</strong> hatten den Anschluß<br />
der deutschen Chirurgie an die rasante Entwicklung<br />
in der westlichen Welt herbeizuführen.“<br />
Eine solche Aufbauleistung aus der Kraft<br />
gestalterischen Willens haben viele Ordinarien<br />
der ostdeutschen Region nach dem<br />
2. Weltkrieg gezeigt.<br />
Über Einflüsse der Kriegsjahre auf die weitere<br />
Profilierung der Unfallheilk<strong>und</strong>e schrieben<br />
Ekkernkamp <strong>und</strong> Probst [2]: „Nach der<br />
Zäsur des 2. Weltkrieges <strong>und</strong> unter dem Einfluss<br />
eines erneuten pragmatischen Wandels<br />
von der morphologisch bestimmten zu einer<br />
zunehmend physiologisch motivierten Chirurgie<br />
veränderte sich auch das Bild der Unfallheilk<strong>und</strong>e:<br />
Die rasche wirtschaftliche Erholung<br />
mit der rasanten Ausweitung des Verkehrs<br />
löste eine traumatische Epidemie aus,<br />
die biologisch-physiologische Auffassung der<br />
Chirurgie <strong>und</strong> Medizin brachte neue Therapieformen<br />
hervor, eine vielseitig innovative<br />
Medizintechnik eröffnete apparativ-instrumentelle<br />
Möglichkeiten, die frühere Chirurgengenerationen<br />
schon vorgedacht, über die<br />
sie aber noch nicht hatten verfügen können.<br />
An erster Stelle ist hier die auf den Schlachtfeldern<br />
des 2. Weltkrieges aus der Not geborene<br />
Schockforschung zu nennen; unzweifelbar<br />
ist z. B. die Bedeutung der Bluttransfusionsforschung<br />
in Deutschland. Eng verzahnt<br />
mit ihr ist der Ausbau des land-, luft- <strong>und</strong><br />
seegestützten Rettungswesens, das ebenfalls<br />
historische Wurzeln hat.“<br />
Unfallchirurgie in der Nachkriegszeit<br />
Die Verletztenversorgung ist die älteste<br />
menschliche <strong>und</strong> ärztliche Hilfeleistung. In<br />
der Mitte des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts war sie zwar<br />
ein wichtiger Teil chirurgischer Obliegenheiten,<br />
aber völlig in die Gesamtchirurgie<br />
integriert. Während in der ersten Jahrh<strong>und</strong>erthälfte<br />
unter dem Einfluss von T. Billroth<br />
<strong>und</strong> seiner Schüler besonders die Entwicklung<br />
der heute als viszeralchirurgisch zugeordneten<br />
Eingriffe dominierte, hatte die<br />
Unfallchirurgie noch kein herausragendes<br />
Profil. Die Ergebnisse der operativen Eingriffe<br />
waren nicht überzeugend.<br />
Die vielfach zur so genannten „Knochenchirurgie“<br />
degradierten Aufgaben waren<br />
mehrheitlich eine ambulante Behandlungsart;<br />
unter den chirurgischen Obliegenheiten<br />
galten sie eher als unwichtig! Auch<br />
die stationär zu versorgenden Verletzten<br />
mussten die oft langzeitigen konservativen<br />
Prozeduren, u. a. mit Streckverbänden oder<br />
aufwendigen Ruhigstellungen der Extremitäten,<br />
des Brustkorbs, Beckens oder der<br />
Wirbelsäule in Gipsverbänden oder Liegeschalen<br />
durchstehen. Es muss aber betont<br />
werden, dass diese Behandlungsformen, die<br />
von Lorenz Böhler [1] zur weltweiten Anerkennung<br />
geführt wurden, viel Geschick,<br />
Kenntnisse <strong>und</strong> ärztliche Zuwendung erforderten.<br />
Sein zitiertes Buch, Erstausgabe<br />
1929, wurde von ihm mehrfach erweitert,<br />
ist in mehreren Auflagen <strong>und</strong> in zahlreichen<br />
Übersetzungen erschienen. F. Povacz [12]<br />
hat die Biographie Böhlers <strong>und</strong> seine Gr<strong>und</strong>sätze<br />
anschaulich dargestellt. An den Medizinischen<br />
Fakultäten gab es keine unfallchirurgische<br />
Repräsentanz.<br />
DGU <strong>Mitteilungen</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachrichten</strong> | Supplement 1/2008 15