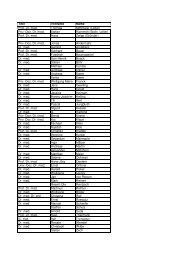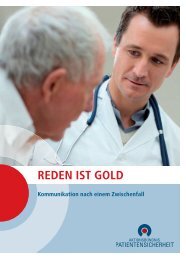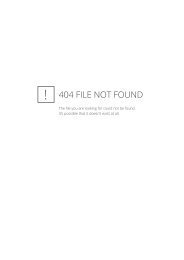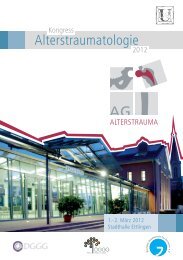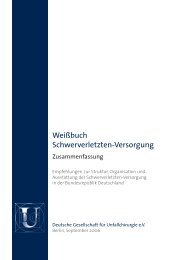Mitteilungen und Nachrichten - Deutsche Gesellschaft für ...
Mitteilungen und Nachrichten - Deutsche Gesellschaft für ...
Mitteilungen und Nachrichten - Deutsche Gesellschaft für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gestaltung des Medizinstudiums<br />
„Zur Neugestaltung des Medizinstudiums<br />
im Jahre 1962 setzte ein komplizierter <strong>und</strong><br />
langwieriger Prozess ein, der erst mit der<br />
Erarbeitung des Studienplanes 1976 einen<br />
vorläufigen, aber noch nicht endgültigen Abschluss<br />
gef<strong>und</strong>en hat. Als Ziel der Neugestaltung<br />
des Medizinstudiums wurde formuliert,<br />
einen ärztlichen Nachwuchs heranzubilden,<br />
der über ein hohes natur- <strong>und</strong> gesellschaftswissenschaftliches<br />
Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Fachwissen<br />
<strong>und</strong> praktische medizinische Erfahrungen<br />
verfügt, auf die Aufgaben des Arztes in der<br />
sozialistischen <strong>Gesellschaft</strong> gut vorbereitet<br />
ist <strong>und</strong> einen festen Klassenstandpunkt sowie<br />
hohe moralisch-ethische Eigenschaften<br />
besitzt“ [15].<br />
Auf dem 2. Nationalen Symposium Lehre<br />
<strong>und</strong> Erziehung an den Hochschulen der<br />
DDR am 21. <strong>und</strong> 22.06.1963 wurden die<br />
„Berliner Erfahrungen“ (eine entsprechende<br />
Vorarbeit) ausgewertet <strong>und</strong> „Gr<strong>und</strong>sätze<br />
zur Neugestaltung des Medizinstudiums“<br />
verabschiedet. Für das klinische Studium<br />
wurden folgende Thesen formuliert (Auszug):<br />
– Berücksichtigung der Einheit von Prophylaxe,<br />
Therapie <strong>und</strong> Metaphylaxe im klinischen<br />
Unterricht eines jeden Faches<br />
– Beherrschung der Gr<strong>und</strong>sätze der ärztlichen<br />
Ersten Hilfe durch jeden Absolventen<br />
– Gr<strong>und</strong>sätzliche Beibehaltung der Übersichtsvorlesungen,<br />
aber stärkere Betonung<br />
der praktischen Ausbildung<br />
1969 wurde von einer Arbeitsgruppe in Berlin<br />
eine völlig neue Konzeption des Medizinstudiums<br />
(„Mecklinger-Plan“) vorgelegt<br />
[15].<br />
Darin war auch eine Neugestaltung des<br />
Chirurgieunterrichts enthalten. Kernstück<br />
bildeten die interdisziplinäre Wissensvermittlung<br />
<strong>und</strong> die Betonung der Pro- <strong>und</strong><br />
Metaphylaxe.<br />
Eine neue Facharztordnung wurde 1974<br />
gemeinsam mit einer Anordnung über die<br />
Subspezialisierung beschlossen.<br />
1976 wurden durch den Wissenschaftlichen<br />
Beirat für Medizin beim Ministerium für das<br />
Hoch- <strong>und</strong> Fachschulwesen neue Studienpläne<br />
erarbeitet, in denen anteilig auch die<br />
Ausbildung in der Traumatologie verankert<br />
war.<br />
Für die Chirurgie wurden dabei u. a. folgende<br />
Lehrveranstaltungen vorgegeben:<br />
– Interdisziplinärer Komplex (IDK) Einführung<br />
in die Notfallmedizin<br />
– Gr<strong>und</strong>lagen der Chirurgie (34 St<strong>und</strong>en)<br />
– Spezielle Chirurgie (einschließlich Unfallchirurgie<br />
– 136 St<strong>und</strong>en im 3. bis 5. Studienjahr)<br />
– Chirurgischer Operationskurs (17 St<strong>und</strong>en)<br />
– IDK Notfallsituationen (11 S<strong>und</strong>en) im 5.<br />
Studienjahr<br />
Am 11.08.1978 wurde das „Klinische Praktikum“<br />
im 6. Studienjahr eingeführt, wobei<br />
die bis zum Ende der DDR gültige Facharztordnung<br />
in Kraft trat.<br />
Medizinische Betreuung<br />
Trotz eingeschränkter materiell-technischer<br />
Voraussetzungen hatten die meisten Ärzte<br />
in der DDR, besonders auch die an Hochschulkliniken<br />
beschäftigten, eine hohe ärztliche<br />
Moral <strong>und</strong> eine ebenso hohe fachliche<br />
Kompetenz.<br />
Zu diesem Anliegen hat Löffler, 1. Vorsitzender<br />
der medizinisch-wissenschaftlichen <strong>Gesellschaft</strong><br />
für Orthopädie der DDR bei ihrer<br />
Gründung am 09.05.1953 im Virchowhaus<br />
des Pathologischen Instituts der Humboldt-<br />
Universität Berlin betont: „Im Mittelpunkt<br />
unserer Arbeit steht der Mensch, das heißt<br />
der Mensch in seiner Gesamtheit, bestehend<br />
aus Leib <strong>und</strong> Seele. Gerade bei den Körperbehinderten,<br />
seien es angeborene, seien es<br />
erworbene Ursachen, sind oft Leib <strong>und</strong> Seele<br />
sehr krank! Daher muss die Behandlung eine<br />
zweifache sein <strong>und</strong> daher muß gerade der<br />
Facharzt für Orthopädie Arzt im wahrsten<br />
Sinne sein, das heißt Mensch <strong>und</strong> Mediziner,<br />
der aus Liebe zu seinen Mitmenschen, um<br />
diesen zu helfen, diesen Beruf erwählt hat“<br />
[8].<br />
Das durchgehende „Dispansaire-System“<br />
brachte Patienten <strong>und</strong> Ärzten deutliche<br />
Vorteile. Das Qualitätsbewusstsein aller<br />
Mitarbeiter für die medizinische Leistung<br />
ist nachträglich schwer zu beurteilen. Ein<br />
besonderer Vorteil, so die Meinung der<br />
Autoren dieses Artikels, war das Fehlen<br />
von Privatpatienten. Es ersparte uns die<br />
Selektion der Patienten <strong>und</strong> erlaubte die<br />
Konzentration der leitenden Ärzte auf die<br />
Schwerpunkte der Arbeit, unabhängig von<br />
profitablen Betätigungen. Es soll in diesem<br />
Supplement nur einmal erläutert werden,<br />
dass die Honorierung ärztlicher Tätigkeit<br />
in der DDR im Vergleich mit der in Westdeutschland<br />
<strong>und</strong> anderen europäischen<br />
Ländern beschämend gering war.<br />
Der Mangel an fortgeschrittener Technik<br />
(Untersuchungsgerätschaft, technische<br />
Ausrüstungen, Instrumente, Implantate)<br />
war eklatant. Aber auch für simple Zubehöre<br />
unserer Tätigkeit, wie z. B. Verbandsmaterial,<br />
Operationshandschuhe, Wäsche<br />
u. a. bestand oft Mangel; über Arbeitsgruppen<br />
bei den Bezirksärzten mussten solche<br />
Artikel angefordert werden.<br />
Die genannten Umstände führten zu beachtlichen<br />
improvisatorischen Leistungen<br />
der Ärzteschaft <strong>und</strong> ihrer Mitarbeiter.<br />
Was die poststationäre Betreuung Unfallverletzter<br />
betraf, war die mögliche Weiterbetreuung<br />
der Patienten durch die primär<br />
behandelnden Ärzte ein großer Vorteil; anspruchsvolle<br />
Rehabilitationseinrichtungen<br />
standen ungenügend zur Verfügung.<br />
Was Spitzensportler betraf, hat der Autor<br />
E. M. einige Erfahrungen.<br />
Der Hochspringer R. B., der aufgr<strong>und</strong> seiner<br />
Leistungen eine Chance auf eine olympische<br />
Medaille hatte, zog sich beim Training eine<br />
Achillessehnenruptur zu. Es war an einem<br />
Sonntag. Die wenigen Einrichtungen der<br />
DDR, die für solche Behandlungen in Frage<br />
kamen, schieden aus, da die entsprechenden<br />
Chefärzte nicht erreichbar waren. Schließlich<br />
wurde ich beauftragt, die notwendige<br />
Operation durchzuführen. Die Operation<br />
erbrachte eine stabile Wiederherstellung<br />
der Sehnenkontinuität. Postoperativ wurde<br />
mir, gegen meinen Protest, die Nachsorge<br />
meines Patienten durch die Sportführung<br />
untersagt. 4 Wochen nach der Operation<br />
wurde er erneut vorgestellt, da die Sehnennaht<br />
ausgerissen <strong>und</strong> wiederum eine Diastase<br />
der Sehnenstümpfe vorlag. Ursache<br />
dieses Ereignisses war das Üben der Dorsalextension<br />
des Fußes der operierten Seite<br />
gegen einen Widerstand von 100 kg. Die<br />
Reoperation wurde mir nicht übertragen;<br />
sie erfolgte in einer für Spitzensportler vorgesehenen<br />
Klinik in Bad Düben.<br />
Forschung<br />
Wissenschaftliche Untersuchungen zu unfallchirurgischen<br />
Fragestellungen erfolgten<br />
bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
hinein vorwiegend im Rahmen<br />
der chirurgischen Forschung.<br />
Diese fanden in drei Bereichen statt [11]:<br />
– zum einen in den Instituten der <strong>Deutsche</strong>n<br />
Akademie der Wissenschaften– später<br />
Akademie der Wissenschaften der DDR in<br />
den so genannten „Bucher Instituten“<br />
– in den chirurgischen Hochschulkliniken<br />
– im Bereich des Ministeriums für Ges<strong>und</strong>heitswesen,<br />
also den nichtuniversitären<br />
Einrichtungen<br />
DGU <strong>Mitteilungen</strong> <strong>und</strong> <strong>Nachrichten</strong> | Supplement 1/2008 21