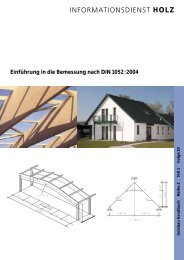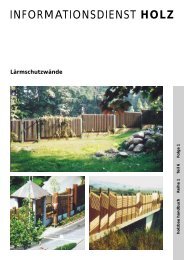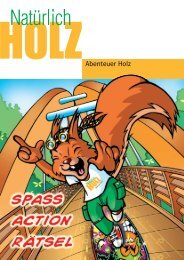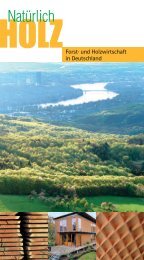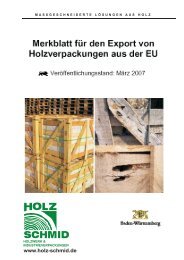HOLZ Dauerhafte Holzbauten bei chemisch-aggressiver ...
HOLZ Dauerhafte Holzbauten bei chemisch-aggressiver ...
HOLZ Dauerhafte Holzbauten bei chemisch-aggressiver ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Dauerhafte</strong> <strong>Holzbauten</strong> <strong>bei</strong> <strong>chemisch</strong>-<strong>aggressiver</strong> Beanspruchung holzbau handbuch Reihe 1, Teil 8, Folge 2<br />
5 Verbindungsmittel<br />
und Anschlussarten<br />
Verbindungen und Anschlüsse an tragenden<br />
Holzbauteilen sind gemäß DIN 1052<br />
rechnerisch nachzuweisen. Im dort enthaltenen<br />
Kapitel „Anforderungen an die Dauerhaftigkeit“<br />
findet sich der Hinweis, dass<br />
ausgehend von der zu erwartenden Beanspruchung<br />
an metallische Bauteilen Maßnahmen<br />
gegen Korrosion zu ergreifen<br />
sind. Zu diesen Maßnahmen zählen u.a.<br />
Metallüberzüge, Beschichtungen, nichtrostende<br />
Stähle, Gussteile oder Kunststoffe.<br />
Überdies sind konstruktive Abdeckungen<br />
oder der primäre Einsatz von Holz-Holzoder<br />
Klebstoff-Verbindungen im Einzelfall<br />
zu prüfen.<br />
Die Erfahrung zeigt, dass an Bauten mit<br />
<strong>chemisch</strong>-<strong>aggressiver</strong> Beanspruchung der<br />
Auswahl der Verbindungsmittel eine übergeordnete<br />
Bedeutung zukommt. Bereits in<br />
der Tragwerksplanung sollte soweit als<br />
möglich auf einen geringen Anteil von<br />
Stahl-Verbindungsmitteln geachtet werden.<br />
Bei deren Auswahl sind die jeweils<br />
gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen als<br />
Ar<strong>bei</strong>tsgrundlage zu verwenden. Die Wirtschaftlichkeit<br />
von Bauwerken in <strong>chemisch</strong><strong>aggressiver</strong><br />
Umgebung wird durch die<br />
Kosten der Neuanschaffung sowie in<br />
besonderer Weise durch Wartungs- und<br />
Instandhaltungsaufwendungen bestimmt.<br />
Die Auswahl eines „billigen“ Verbindungsmittels<br />
kann, bezogen auf die Lebensdauer<br />
eines Bauwerkes, teuer zu stehen kommen.<br />
Auftraggeber und Fachplaner sollten<br />
bereits in der Projektierungs- und Ausschreibungsphase<br />
die Gesamtbilanz aus<br />
Anschaffungs- und Unterhaltskosten <strong>bei</strong><br />
Festlegung der Konstruktion einbeziehen.<br />
Bei der Anordnung von metallischen Verbindungsmitteln,<br />
insbesondere für Stahlblechformteile,<br />
sollten Aspekte der späteren<br />
Wartung und Instandhaltung<br />
berücksichtigt werden. Je nach Art der<br />
Beanspruchung in <strong>chemisch</strong>-aggressiven<br />
Medien können Verbindungsmittel und<br />
Anschlüsse etwa mit einer Holzabdeckung<br />
versehen werden. Auch ist eine gezielt<br />
offene Anordnung für Kontrollzwecke<br />
oder einfachen Austausch denkbar.<br />
Abbildung 5.1 stellt drei Ausführungstypen<br />
eines biegesteifen Längsstoßes von Holzträgern<br />
dar.<br />
In Variante a) ist eine Stoßausbildung mit<br />
Dübeln und einem eingeschlitzten Blech<br />
dargestellt, wie sie im Ingenieurholzbau<br />
häufig Anwendung findet.<br />
Variante b) zeigt einen zweiseitigen Holzanschluss<br />
mit Nägeln oder Dübeln. Die<br />
offenliegenden punktförmigen Metalloberflächen<br />
können in sehr einfacher<br />
Weise mit einer Abdeckung versehen<br />
werden.<br />
Variante c) zeigt seitlich aufgenagelte<br />
Blechlaschen, die sehr gut optisch kontrolliert<br />
werden können. Zugleich ist ein späterer<br />
Austausch der Verbindung ohne<br />
Lageveränderung der Holzteile möglich.<br />
Variante a) Eingeschlitzte Blechlasche mit Dübel<br />
Variante b) Zweiseitige Holzlasche angenagelt<br />
Variante c) Seitlich aufgenagelte Blechlaschen<br />
Abbildung 5.1 Ausführungsvarianten von biegesteifen<br />
Zuganschlüssen<br />
5.1 Unlegierter Stahl<br />
Bei aggressivem Innenklima ist an unlegierten<br />
Stählen ein besonderer Korrosionsschutz<br />
erforderlich. Der Katalog für<br />
zulässige Beschichtungen und Schutzmaßnahmen<br />
ist sehr umfangreich und kann<br />
den jeweils zutreffenden Normen entnommen<br />
werden. Tabelle 5.1 zeigt einen Auszug<br />
aus E DIN 1052, hier sind mögliche<br />
Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit zu<br />
den klimatischen Bedingungen gelistet.<br />
Die Verar<strong>bei</strong>tung feuerverzinkter Verbindungsmittel<br />
wie auch von zusätzlichen<br />
Beschichtungen oder Abdeckungen erfordert<br />
Erfahrung und Sorgfalt <strong>bei</strong> der Ausführung.<br />
Wenn auch <strong>bei</strong> ordnungsgemäßem<br />
Einbau der Verbindungsmittel<br />
und <strong>bei</strong> planmäßiger Nutzung des Bauwerkes<br />
eine Beschädigung der Schutzschichten<br />
nicht ausgeschlossen werden kann, ist<br />
der Einsatz alternativer Verbindungen etwa<br />
aus nichtrostendem Stahl zu überprüfen.<br />
5.2 Nichtrostender Stahl<br />
Nichtrostender Stahl kann <strong>bei</strong> korrosiven<br />
Beanspruchungen Vorteile gegenüber<br />
unlegierten Stählen besitzen, da ein zusätzlicher<br />
Korrosionsschutz in aller Regel<br />
nicht erforderlich ist.<br />
Nichtrostende Stahlsorten bestehen vornehmlich<br />
aus Eisen, Chrom und Nickel. Für<br />
die Korrosionsbeständigkeit ist insbesondere<br />
Chrom von Bedeutung. In Verbindung<br />
mit Chemikalien kann eine Veränderung<br />
der Feinstruktur von Stahl eintreten. In<br />
Abhängigkeit zur Beschaffenheit der Chemikalien<br />
können sich am Stahl durch <strong>chemisch</strong>e<br />
Reaktionen Säuren bilden, welche<br />
den Korrosionsprozess nochmals verstärken.<br />
Deshalb ist auch <strong>bei</strong> der Verwendung<br />
von nichtrostenden Stählen im Einzelfall<br />
die bauaufsichtliche Zulassung zu prüfen.<br />
So darf rostfreier Stahl grundsätzlich nicht<br />
in chlor- oder chlorwasserstoffhaltiger<br />
Atmosphäre eingesetzt werden. Weitere<br />
Einschränkungen können an geschweißten<br />
Stahlteilen oder <strong>bei</strong> Verankerungen in<br />
Beton vorliegen. Bei direktem Kontakt<br />
zwischen nichtrostendem und unlegiertem<br />
Stahl und dem Vorhandensein von Lösungen,<br />
z.B. Wasser, besteht in den Berührungsflächen<br />
Korrosionsgefahr am<br />
unlegierten Stahl. Solche direkte Kontaktflächen<br />
sollten deshalb vermieden werden.<br />
11