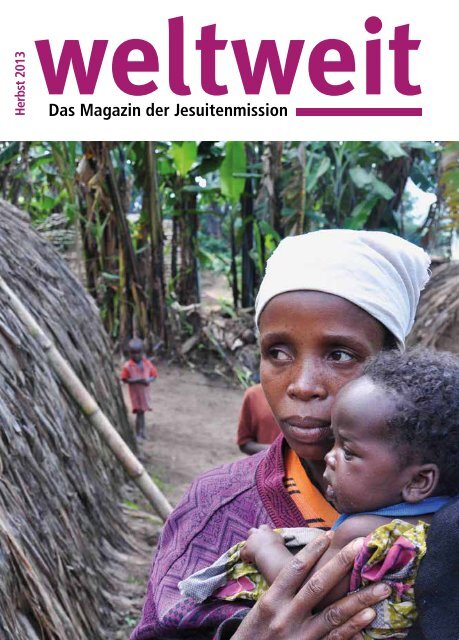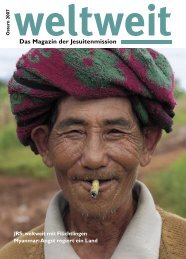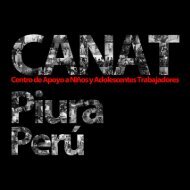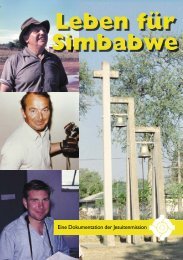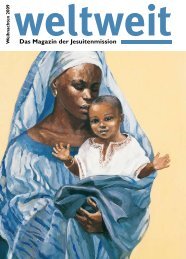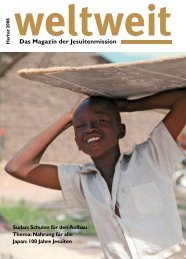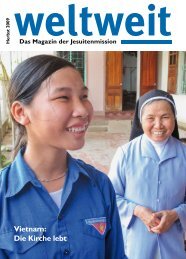Das Magazin der Jesuitenmission
Das Magazin der Jesuitenmission
Das Magazin der Jesuitenmission
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Herbst 2013<br />
weltweit<br />
<strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> <strong>der</strong> <strong>Jesuitenmission</strong>
Editorial<br />
Liebe Freundinnen und Freunde<br />
unserer Missionare und Partner weltweit!<br />
Jedes Jahr im Sommer reist mein Mitbru<strong>der</strong> Peter Balleis in die ostkongolesische<br />
Provinz Nord-Kivu. Und obwohl es eine landschaftlich wun<strong>der</strong>schöne Gegend<br />
ist, die früher als die Schweiz Afrikas galt, ist es für ihn kein Erholungsurlaub.<br />
Seit 1995 ist <strong>der</strong> Flüchtlingsdienst <strong>der</strong> Jesuiten (JRS) in <strong>der</strong> Demokratischen<br />
Republik Kongo präsent und in dieser Zeit haben die JRS-Teams immer wie<strong>der</strong><br />
neue Gewaltausbrüche und Flüchtlingsströme erlebt. Mehr als fünf Millionen<br />
Tote sind die traurige Bilanz des Konfliktes, <strong>der</strong> seit fast zwanzig Jahren andauert.<br />
2,6 Millionen Menschen leben als Flüchtlinge im eigenen Land.<br />
Hier nicht die Hoffnung zu verlieren, grenzt an ein Wun<strong>der</strong>. Und Nord-Kivu<br />
ist nicht <strong>der</strong> einzige Konflikt, um den sich Pater Balleis als internationaler JRS-<br />
Direktor sorgt. Ein zweiter großer Krisenherd ist für den JRS momentan <strong>der</strong><br />
Bürgerkrieg in Syrien. Die beiden Konflikte sind unterschiedlicher Natur. Aber<br />
in beiden Konflikten sind JRS-Teams mittendrin. In Syrien geht es vor allem<br />
um Lebensmittelhilfe für mehr als 100.000 Menschen in Aleppo, Homs und<br />
Damaskus. In Nord-Kivu geht es um Hilfe, Ausbildung und Schulbildung für<br />
die vielen Flüchtlinge in den Lagern um Masisi, Goma und Mweso.<br />
„Die Flüchtlinge, die hier leben und leiden, warten seit Jahrzehnten auf den<br />
Tag, an dem endlich Frieden herrschen möge, so dass wir kein Recht haben,<br />
einfach das Handtuch zu werfen.“ Damit drückt Inés Oleaga, spanische Ordensfrau<br />
und Leiterin <strong>der</strong> JRS-Projekte in Masisi, eine fundamentale Erfahrung<br />
aus: Die Hoffnung <strong>der</strong> Flüchtlinge gibt den Helfern Kraft und Mut. Und<br />
das ist nicht vom Schreibtisch aus erfahrbar, son<strong>der</strong>n nur in <strong>der</strong> Nähe zu den<br />
Flüchtlingen, in <strong>der</strong> persönlichen Begegnung. Dieses Mittendrin-Sein und Begleiten<br />
<strong>der</strong> Flüchtlinge sind Merkmal und Stärke des JRS. Im Verbund mit<br />
an<strong>der</strong>en jesuitischen Hilfswerken in Europa unterstützen wir in einer gemeinsamen<br />
Aktion die Arbeit des JRS in Nord-Kivu. Dafür bitte ich Sie in dieser<br />
Herbstausgabe um Ihre Mithilfe.<br />
Für Ihre Verbundenheit und Ihr Vertrauen danke ich Ihnen von Herzen,<br />
Ihr<br />
Klaus Väthrö<strong>der</strong> SJ<br />
Missionsprokurator<br />
2 weltweit
Hilfe für Ostafrika Inhalt<br />
Endlose Flucht ➜ 4<br />
Seit 17 Jahren warten die Menschen in Nord-Kivu vergeblich auf Frieden<br />
„Die Rebellen werden müde“ ➜ 8<br />
Interview mit Peter Balleis SJ über den Konflikt im Kongo<br />
Unsere Spendenbitte für Nord-Kivu ➜ 9<br />
Helfen Sie den Flüchtlingen in den Lagern von Masisi, Goma und Mweso!<br />
Kin<strong>der</strong> unter Tage ➜ 10<br />
<strong>Das</strong> indische Sozialinstitut NESRC hilft Kin<strong>der</strong>arbeitern in Kohleminen<br />
Titel Kongo:<br />
Flüchtlingslager Kashuga bei<br />
Mweso: Frauen in Nord-Kivu<br />
haben Angst vor Gewalt.<br />
Rücktitel Indien:<br />
Bergarbeiter in einem <strong>der</strong> extrem<br />
niedrigen Schächte <strong>der</strong> Minen<br />
von Meghalaya.<br />
Tief ins Herz gebrannt ➜ 14<br />
Aus einem Freiwilligenjahr entsteht eine Partnerschaft mit Kambodscha<br />
Blume <strong>der</strong> Hoffnung ➜ 18<br />
Eine Meditation von Joe Übelmesser SJ<br />
Hun<strong>der</strong>t Jahre Weisheit ➜ 20<br />
Die Sophia-Universität in Tokio feiert ihr 100-jähriges Bestehen<br />
Bessere Dörfer für eine bessere Welt ➜ 22<br />
Nach Turbulenzen geht es im indischen Dorfbauwerk VRO neu voran<br />
Dank aus Osttimor ➜ 26<br />
Mark Raper SJ freut sich über die Hilfe aus Deutschland<br />
Schüleraustausch im Web 2.0 ➜ 27<br />
Ein virtuelles Begegnungsprojekt zwischen Deutschland und Simbabwe<br />
Was macht unser Patenkind ➜ 30<br />
Seit 45 Jahren hilft <strong>der</strong> Pathardi-Verein indischen Schulkin<strong>der</strong>n<br />
weltweit notiert ➜ 32<br />
Aus <strong>der</strong> <strong>Jesuitenmission</strong>: Nachrichten, Rückblick und weltweite Post<br />
weltweit 3
Kongo<br />
Endlose Flucht<br />
Seit 17 Jahren warten die Menschen in <strong>der</strong> ostkongolesischen Provinz Nord-<br />
Kivu vergeblich auf Frieden, hoffen auf ein Leben ohne Gewalt und haben ihr<br />
Lachen trotz allem nicht verloren.<br />
Nord-Kivu im Osten <strong>der</strong><br />
Demokratischen Republik<br />
Kongo grenzt an<br />
Ruanda und Uganda.<br />
<strong>Das</strong> Foto füllt die Leinwand in<br />
unerbittlicher Größe. Vier<br />
Leichen liegen auf dem Boden<br />
im Gras. Zwei Frauen und zwei<br />
Mädchen, grausam getötet durch<br />
Machetenhiebe. Ein unwillkürliches<br />
Raunen geht durch den Saal. Inés Oleaga<br />
hatte zu Beginn ihres Vortrages gewarnt:<br />
„Es kann sein, dass einige Fotos<br />
Sie schockieren werden. Ich zeige sie<br />
trotzdem. Es geht mir nicht um Sensationsgier,<br />
son<strong>der</strong>n darum, dass Sie<br />
sehen: <strong>Das</strong> ist unser Leben in Nord-<br />
Kivu. <strong>Das</strong> ist die Wirklichkeit, <strong>der</strong> wir<br />
jeden Tag begegnen.“ Die vier jungen<br />
Frauen hatten Pech gehabt, als sie einer<br />
Rebellengruppe über den Weg liefen.<br />
Vielleicht gehörten sie <strong>der</strong> falschen<br />
Ethnie an, vielleicht waren die Rebellen<br />
betrunken, vielleicht hatten sie<br />
einfach Lust auf Gewalt. In <strong>der</strong> ostkongolesischen<br />
Provinz Nord-Kivu gehört<br />
Pech zum Alltag: 920.000 Menschen,<br />
fast eine Million, sind seit April 2012<br />
erneut auf <strong>der</strong> Flucht, leben entwurzelt<br />
als Habenichtse im eigenen Land,<br />
lassen alles zurück, weil sie Angst vor<br />
Gewalt und Tod haben. „Momentan<br />
haben wir in Nord-Kivu elf bewaffnete<br />
Rebellengruppen“, sagt Inés Oleaga.<br />
Die spanische Ordensfrau leitet in<br />
Masisi die Projekte des Jesuitenflüchtlingsdienstes<br />
(JRS). Mit ihren ungebändigten<br />
schwarzgrauen Locken und<br />
ihrer sympathisch direkten Art strahlt<br />
sie Energie und Leidenschaft für ihre Arbeit<br />
aus. Sie nutzt ihren Heimatbesuch,<br />
um gemeinsam mit ihrer kongolesischen<br />
Kollegin Angelique Chayeka über das<br />
Leben in Nord-Kivu zu berichten.<br />
Nie verheilte Wunden<br />
Als Ende vergangenen Jahres die<br />
Rebellengruppe M23 die Provinzhauptstadt<br />
Goma eingenommen<br />
hatte, schaffte <strong>der</strong> Kongokonflikt es<br />
4 weltweit
Kongo<br />
wie<strong>der</strong> einige Tage in die internationalen<br />
Schlagzeilen. Seitdem gab es<br />
einen neuen Friedensvertrag, relative<br />
Ruhe, neue Kämpfe. „Je<strong>der</strong> Stamm<br />
hat seine eigene bewaffnete Miliz“,<br />
erklärt Schwester Inés. „Die Fronten<br />
verlaufen entlang <strong>der</strong> verschiedenen<br />
Ethnien und die Wurzeln des<br />
Konfliktes liegen in Verletzungen<br />
<strong>der</strong> Vergangenheit, die nie verheilt<br />
sind.“ Die Nachbarstaaten Ruanda<br />
und Uganda mischen kräftig mit in<br />
dem Konflikt und nutzen die Schwäche<br />
<strong>der</strong> kongolesischen Regierung.<br />
Krieg macht das Leben zur Hölle<br />
Seit fast zwanzig Jahren macht <strong>der</strong><br />
Krieg, in dem es um Macht, Land und<br />
Mineralien geht, den Menschen das<br />
Leben zur Hölle. Die Demokratische<br />
Republik Kongo ist das Land mit dem<br />
weltweit niedrigsten Index menschlicher<br />
Entwicklung und <strong>der</strong> höchsten<br />
Rate an Vergewaltigungen. Einer Studie<br />
zufolge erleiden jede Stunde 48<br />
Frauen o<strong>der</strong> Mädchen sexuelle Gewalt.<br />
Die meisten Fälle werden we<strong>der</strong><br />
angezeigt noch offiziell erfasst, da die<br />
Frauen aus Angst und Scham schweigen.<br />
An <strong>der</strong> Seite <strong>der</strong> Frauen<br />
In <strong>der</strong> Stimme von Inés Oleaga<br />
schwingt ein bitterer Unterton: „Darüber<br />
wurden schon Tausende Seiten<br />
geschrieben, aber in <strong>der</strong> konkreten<br />
Arbeit, in <strong>der</strong> Unterstützung <strong>der</strong> Opfer<br />
und <strong>der</strong> Vermeidung von Übergriffen,<br />
spiegelt sich nicht viel dieser<br />
Aufmerksamkeit wi<strong>der</strong>.“ In Masisi<br />
ist die Arbeit mit Frauen ein Schwerpunkt<br />
<strong>der</strong> JRS-Projekte. <strong>Das</strong> erfor<strong>der</strong>t<br />
Vertrauen und Nähe. „Als wir<br />
die Frauen zu einem Treffen eingeladen<br />
haben, waren sie sehr klar: Ihre<br />
erste Sorge galt nicht ihnen selbst,<br />
son<strong>der</strong>n ihren Kin<strong>der</strong>n. Sie wollten,<br />
dass wir uns darum kümmern, dass<br />
ihre Kin<strong>der</strong> genug zu essen haben<br />
und in die Schule gehen können.“ In<br />
acht Flüchtlingslagern arbeitet das<br />
JRS-Team in Masisi. Fünf <strong>der</strong> Lager<br />
sind vom UNHCR anerkannt, dem<br />
Flüchtlingswerk <strong>der</strong> Vereinten Nationen.<br />
Drei sind sogenannte „spontane<br />
Flüchtlinge in Masisi<br />
tragen Wasser und<br />
Lebensmittel ins Lager.<br />
Inés Oleaga leitet die<br />
JRS-Projekte, zu denen<br />
auch Schnei<strong>der</strong>kurse<br />
zählen.<br />
weltweit 5
Kongo<br />
Die strahlende Tate<br />
Helène mit Schwester<br />
Regina aus Tansania.<br />
Stolz zeigt ein Junge<br />
sein Zeugnis: Der JRS<br />
macht Schulbildung<br />
möglich.<br />
Lager“, abgelegen und schwer zugänglich,<br />
ohne offizielle Anerkennung und<br />
damit ohne internationale Hilfe. Hier<br />
ist die Not am größten. Aus Bananenblättern<br />
und Plastikplanen haben<br />
sich die Flüchtlinge Hütten gebaut,<br />
es gibt kein Trinkwasser und Lebensmittel<br />
sind knapp. Die Bevölkerung<br />
<strong>der</strong> umliegenden Dörfer ist meistens<br />
nicht glücklich über den ungewollten<br />
Zuzug und Rebellengruppen haben<br />
ungehin<strong>der</strong>ten Zugang zu den „spontanen<br />
Lagern“, pressen den Vertriebenen<br />
illegale Steuern o<strong>der</strong> Zwangsarbeit<br />
ab. Frauen laufen permanent Gefahr,<br />
Opfer sexueller Gewalt zu werden.<br />
Schweigen aus Angst<br />
Die 29-jährige Blandine war wie jeden<br />
Morgen auf <strong>der</strong> Suche nach Feuerholz<br />
und Nahrung unterwegs gewesen.<br />
Als sie schon auf dem Rückweg<br />
ins Flüchtlingslager war, stellten sich<br />
ihr fünf bewaffnete Männer in den<br />
Weg, verspotteten sie, warfen sie zu<br />
Boden und vergewaltigten sie, einer<br />
nach dem an<strong>der</strong>en. „Als sie gingen,<br />
war ich mir nicht sicher, ob ich noch<br />
am Leben o<strong>der</strong> schon tot war“, erzählte<br />
Blandine später dem JRS-Team.<br />
Ihre größte Angst: „<strong>Das</strong>s mein Mann<br />
etwas davon erfahren könnte.“ Angelique<br />
Chayeka leitet die Frauenprojekte<br />
in Masisi, die Ausbildung, Information<br />
und Hilfe anbieten. „Viele Frauen<br />
glauben selbst, dass sie keinen Wert<br />
haben, dass sie nur dazu da sind, Kin<strong>der</strong><br />
auf die Welt zu bringen und für<br />
Nahrung zu sorgen“, sagt die schmale<br />
Kongolesin. „Die Frauen kennen ihre<br />
Rechte nicht und verschweigen die<br />
Vergewaltigung, damit ihr Ehemann<br />
sie nicht verlässt.“<br />
Gesegnet von Tate Helène<br />
Neben <strong>der</strong> Arbeit mit Frauen kümmert<br />
sich das Team von Inés Oleaga<br />
um kranke, alte und behin<strong>der</strong>te Menschen<br />
sowie elternlose Kin<strong>der</strong>. „Die<br />
Jungen schließen sich schnell zu Banden<br />
zusammen und die Mädchen<br />
werden als Arbeitskräfte ausgenutzt.“<br />
Der JRS kooperiert eng mit lokalen<br />
Schulen, hilft beim Wie<strong>der</strong>aufbau<br />
6 weltweit
Kongo<br />
o<strong>der</strong> Neubau <strong>der</strong> Gebäude sowie bei<br />
<strong>der</strong> Ausbildung von Lehrern. Auf diese<br />
Weise sollen die Flüchtlingskin<strong>der</strong><br />
wie<strong>der</strong> in einen möglichst normalen<br />
Schulalltag integriert werden. <strong>Das</strong><br />
Wichtigste in ihrer Arbeit ist für Inés<br />
Oleaga das Gespräch mit den Vertriebenen,<br />
<strong>der</strong> persönliche Kontakt und<br />
die individuelle Hilfe: „Wir sehen das<br />
nicht als Assistenzialismus o<strong>der</strong> Paternalismus,<br />
für uns ist das Begleitung,<br />
und zwar eine sehr persönliche Begleitung.“<br />
Tate Helène wäre ohne diese<br />
Begleitung schon lange tot. „Als wir<br />
sie 2010 in einem <strong>der</strong> Flüchtlingslager<br />
kennenlernten, war sie halbseitig gelähmt,<br />
wog 27 Kilo und hatte mit<br />
dem Leben abgeschlossen.“ Heute<br />
freut sich die strahlende alte Frau über<br />
jeden Besuch von Inés Oleaga o<strong>der</strong> einer<br />
ihrer Kolleginnen. Deren Zuneigung<br />
und Sorge haben geholfen, dass<br />
Tate Helène nicht nur die Krankheit,<br />
son<strong>der</strong>n auch drei weitere Vertreibungen<br />
überlebt hat. „Jedes Mal, wenn<br />
wir gehen, verabschiedet sie uns mit<br />
einem Segen“, erzählt Inés Oleaga.<br />
„Und das ist für mich <strong>der</strong> wahrhaftige<br />
Gott, <strong>der</strong> uns durch Tate Helène segnet.“<br />
Wir sind fröhliche Menschen<br />
Inés Oleaga tippt auf eine Taste ihres<br />
Laptops und ein neues Foto erscheint<br />
auf <strong>der</strong> Leinwand: Eine fröhliche<br />
Menschenmenge tanzt ausgelassen.<br />
„<strong>Das</strong> war nach einer Filmvorführung.<br />
<strong>Das</strong> ist exakt <strong>der</strong>selbe Ort, an dem wir<br />
nur wenige Tag zuvor die vier Leichen<br />
gefunden haben.“ Der Kontrast ist<br />
beabsichtigt und die Botschaft klar:<br />
Freude und Trauer, Leben und Tod,<br />
Schönheit und Zerstörung, Gastfreundschaft<br />
und Grausamkeit liegen<br />
sehr nah beieinan<strong>der</strong> in Nord-Kivu.<br />
„Wir sind fröhliche Menschen“, betont<br />
Angelique Chayeka. „Wir lachen<br />
viel und geben die Hoffnung nicht<br />
auf.“ Im Stillen möchte man hinzufügen:<br />
Trotz allem. Denn auch im Gesicht<br />
von Angelique Chayeka ist beides<br />
zu sehen: Ihr ansteckendes Lachen<br />
und ihre traurigen Augen.<br />
Judith Behnen<br />
Neben <strong>der</strong> Arbeit mit<br />
Mädchen und Frauen<br />
begleitet <strong>der</strong> JRS vor<br />
allem kranke und alte<br />
Flüchtlinge, wie hier<br />
eine Gruppe in Mweso.<br />
weltweit 7
Interview<br />
„Die Rebellen werden müde“<br />
Interview mit P. Peter Balleis SJ, dem internationalen Direktor des Flüchtlingsdienstes <strong>der</strong> Jesuiten<br />
(JRS), während seines Besuches in Nord-Kivu.<br />
Wie steht es mit <strong>der</strong> Hoffnung<br />
in Nord-Kivu<br />
Seit fast 20 Jahren herrscht nun<br />
schon Krieg in Nord-Kivu.<br />
Man kann schon ein wenig die<br />
Hoffnung verlieren. Bischof<br />
Théophile von Goma hat uns<br />
vorhin erzählt, dass er manchmal<br />
gefragt wird, warum er<br />
Schulen und Gebäude immer<br />
wie<strong>der</strong> neu aufbaut, wenn sie<br />
doch nur wie<strong>der</strong> zerstört werden.<br />
Seine Antwort ist, dass wir<br />
dadurch die Hoffnung <strong>der</strong> Leute<br />
wachhalten.<br />
Gibt es etwas, das sich positiv<br />
verän<strong>der</strong>t hat<br />
Jedes Jahr im Sommer besuche<br />
ich die JRS-Teams in Goma,<br />
Masisi und Mweso. Im Vergleich<br />
zum letzten Jahr wird in<br />
Masisi viel gebaut. Viele Leute<br />
bauen sich ein kleines Heim.<br />
Seit dem Vertrag <strong>der</strong> Zusam-<br />
menarbeit zwischen mehreren<br />
Rebellengruppen Anfang dieses<br />
Jahres war es lange ziemlich ruhig<br />
und es gab mehrere Monate<br />
keine Schießereien in Masisi.<br />
Wie ertragen die Menschen<br />
und auch die Mitarbeiter den<br />
ewigen Kreislauf von Hoffnung,<br />
Zerstörung und Flucht<br />
Heute habe ich einen Ort besucht,<br />
wo vor vier Jahren schon<br />
ein Lager war. Die in Stein gebaute<br />
Schule von damals steht<br />
noch und leistet neue Dienste<br />
für Flüchtlingskin<strong>der</strong>. Wie ertragen<br />
wir das Es sind zum Teil<br />
neue JRS-Mitarbeiter im Team,<br />
und sie geben für einige Jahre<br />
ihr Bestes. An<strong>der</strong>e werden folgen<br />
und die Zeichen <strong>der</strong> Hoffnung<br />
weiter setzen. Wie je<strong>der</strong><br />
Krieg wird eines Tages auch dieser<br />
Krieg aufhören. Die Menschen<br />
werden müde vom Krieg.<br />
Ein Lagervorstand in Nzulu<br />
betonte, dass wir Versöhnung<br />
brauchen. Die Kriegsherren<br />
sind noch nicht soweit. Und<br />
doch hat das Friedensabkommen<br />
unter mehreren Rebellengruppen<br />
in Masisi bis jetzt gehalten.<br />
Langsam sind auch die<br />
Rebellen vom Krieg müde.<br />
Warum bricht dann doch immer<br />
wie<strong>der</strong> Gewalt aus<br />
Die Ursachen sind vielfältig<br />
und vielschichtig. Eine Jugendliche<br />
in Masisi sagte mir, dass<br />
einfach zu viele Waffen in den<br />
Händen <strong>der</strong> Leute sind. Keiner<br />
will die Kalaschnikow abgeben,<br />
weil man ja nicht weiß, ob<br />
man sie doch noch gebrauchen<br />
kann. Die an<strong>der</strong>en Gründe<br />
sind Mineralien, ethnische Verschiedenheit,<br />
Streit um Land<br />
als Ressource, das Versagen des<br />
kongolesischen Staates, die regionale<br />
Politik von Uganda und<br />
Rwanda, die aktiv in den Konflikt<br />
verwickelt sind.<br />
Warum sollte uns <strong>der</strong> Konflikt<br />
hier in Deutschland<br />
nicht egal sein<br />
Eigentlich wollen wir doch alle<br />
den Frieden und wir wollen<br />
alle die Mineralien, die es im<br />
Ostkongo gibt, in anständiger<br />
Weise wirtschaftlich erwerben,<br />
ohne dass Menschen sterben,<br />
son<strong>der</strong>n in einer Weise, dass die<br />
Rohstoffe helfen, Nord-Kivu<br />
zu entwickeln. Frieden ist für<br />
alle besser. Als JRS glauben wir<br />
und haben wir die Erfahrung,<br />
dass Bildung den Teufelskreis<br />
von Armut und Gewalt durchbrechen<br />
kann. Deshalb bauen<br />
wir so viele Schulen und bilden<br />
Lehrer aus. Es ist unser Ziel,<br />
unsere Bildungsarbeit noch intensiver<br />
und gezielter für die<br />
Friedenserziehung und Versöhnung<br />
zu nutzen.<br />
Interview: Judith Behnen<br />
8 weltweit
Spendenbitte<br />
Unsere Spendenbitte<br />
für Nord-Kivu<br />
Liebe Leserin, lieber Leser!<br />
Der Flüchtlingsdienst <strong>der</strong><br />
Jesuiten begleitet die Schwächsten<br />
und Verletzlichsten in den<br />
Lagern von Masisi, Mweso und<br />
Goma. Persönliche Zuwendung<br />
und Nähe sind zentral,<br />
aber auch materielle Hilfe ist<br />
unerlässlich:<br />
• Eine Plastikplane als Regenschutz<br />
für eine Hütte kostet<br />
11 Euro.<br />
• Ein Sack Reis und Maismehl<br />
kosten zusammen 29 Euro.<br />
• Ein großer Tank für sauberes<br />
Trinkwasser kostet 117 Euro.<br />
• Der Wie<strong>der</strong>aufbau eines<br />
Klassenzimmers kostet im<br />
Schnitt 1000 Euro.<br />
Auf dem Foto sehen Sie das<br />
Flüchtlingslager Kishondja in<br />
Masisi. Lassen Sie uns gemeinsam<br />
helfen, dass die Menschen<br />
hier nicht vergessen werden.<br />
Danke und Gottes Segen!<br />
Klaus Väthrö<strong>der</strong> SJ,<br />
Missionsprokurator<br />
<strong>Jesuitenmission</strong><br />
Spendenkonto<br />
5 115 582<br />
Liga Bank<br />
BLZ 750 903 00<br />
Stichwort:<br />
X31133 JRS Kongo<br />
weltweit 9
Hilfe Interview für Ostafrika<br />
Kin<strong>der</strong> unter Tage<br />
<strong>Das</strong> von indischen Jesuiten geführte North-Eastern Social Research Centre<br />
(NESRC) ist bekannt dafür, heiße Themen anzupacken. Mit einer deutschen<br />
Stiftung untersucht es Kin<strong>der</strong>arbeit in Kohleminen.<br />
Stell dir vor, du wachst an einem<br />
kalten, regnerischen Morgen<br />
auf und rollst dich müde aus<br />
deinem Bett in einer zugigen Hütte.<br />
Du ziehst ein T-Shirt an, kurze Hosen<br />
und Gummistiefel. Dann machst<br />
du dich auf den Weg zur Arbeit, vorbei<br />
an grauen Kohlehalden. Du erreichst<br />
den Schachteingang, ein fünf<br />
Meter breites Loch, in das du auf<br />
rutschigen Holzstufen hinabsteigst.<br />
Immer tiefer führt es dich ins Dunkle,<br />
bis du 30 Meter unter <strong>der</strong> Erde<br />
wie<strong>der</strong> festen Boden betrittst. Von<br />
hier zweigt ein System so genannter<br />
10 weltweit
Indien<br />
„Rattenlöcher“ ab, tief ins Gestein<br />
getriebene Schächte, die den Kohle-<br />
A<strong>der</strong>n folgen. Du schnappst dir einen<br />
Holzkarren, Spitzhacke und Schaufel<br />
und machst dich an die Arbeit. Den<br />
ganzen Tag wirst du im „Rattenloch“<br />
verbringen, um Kohle zu för<strong>der</strong>n. Du<br />
kannst nicht aufrecht stehen, weil die<br />
Schächte nicht einmal einen Meter<br />
hoch sind. Stell dir vor, so sieht dein<br />
Tag aus, wenn du zwölf Jahre alt bist.<br />
Kohle-Boom in Meghalaya<br />
Der Steinkohle-Boom hat den indischen<br />
Bundesstaat Meghalaya ergriffen.<br />
Nördlich von Bangladesch gelegen,<br />
galt Meghalaya zu Kolonialzeiten<br />
als das „Schottland Indiens“, da es<br />
mit seinen zerklüfteten Bergzügen,<br />
den herrlich bewaldeten Tälern und<br />
seinem Reichtum an Pflanzen und<br />
Tieren an die schottischen Highlands<br />
erinnerte. In den Bergregionen leben<br />
seit Menschengedenken drei Volksstämme,<br />
die Jaintia, Khasi und Garo,<br />
matriarchalisch organisierte Gemeinschaften<br />
mit einem reichen Erbe an<br />
Sprachen, Traditionen und Gebräuchen.<br />
In kleinem Maßstab fand <strong>der</strong><br />
Kohleabbau schon unter britischer<br />
Herrschaft statt, aber seit einigen Jahren<br />
ist die Anzahl <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schächte<br />
explodiert. Auf 550 Millionen Tonnen<br />
werden die Vorkommen geschätzt.<br />
Ziegelvilla statt Bambushütte<br />
Die Minen bringen Geld nach Meghalaya.<br />
Bergarbeiter verdienen zwischen<br />
700 und 1.200 Rupien am Tag, das<br />
sind umgerechnet 10 bis 17 Euro – eine<br />
gute Ausbeute, wenn man bedenkt, dass<br />
an<strong>der</strong>e Arbeiter nur ein Viertel dieser<br />
Summe erhalten. Lokale Landbesitzer<br />
profitieren ebenfalls, wenn auf ihrem<br />
Grund Kohlevorkommen entdeckt<br />
werden: sie tauschen dann schnell die<br />
traditionelle Bambushütte gegen eine<br />
neue Ziegelvilla. Und auch <strong>der</strong> Staat<br />
verdient am Kohle-Boom in Meghalaya:<br />
pro Jahr 500 Millionen Rupien,<br />
umgerechnet 7,1 Millionen Euro. Sehr<br />
viel Geld. Und gleichzeitig sehr wenige<br />
Regeln. <strong>Das</strong> ist die Gleichung für sehr<br />
viele Probleme.<br />
Feldforscher in <strong>der</strong> Grube<br />
Die deutsche Stiftung Childaid Network<br />
hat in Kooperation mit dem Sozialzentrum<br />
NESRC <strong>der</strong> nordindischen<br />
Jesuiten im Jahr 2012 eine Studie zur<br />
Lage <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> in den Kohleminen<br />
begonnen. Obwohl die Feldforscher in<br />
manche feindselig-gefährliche Situation<br />
gerieten, konnten sie umfangreiche<br />
Daten erheben. „Mehr als 3.000 mit<br />
20-25 Tonnen überladene Laster verlassen<br />
die Bergregion täglich“, beziffert<br />
Dr. Martin Kasper, Vorstand von<br />
Spuren des Kohle-<br />
Booms in den Bergen<br />
von Meghalaya:<br />
Hier eine Siedlung <strong>der</strong><br />
Bergarbeiter, die in<br />
provisorischen Hütten<br />
o<strong>der</strong> unter Plastikplanen<br />
leben.<br />
weltweit 11
Indien<br />
Fotos rechts:<br />
1,25 Euro erhalten die<br />
Kin<strong>der</strong>arbeiter für einen<br />
gefüllten Holzkarren.<br />
Die Kohle schlagen sie<br />
mit Spitzhacken aus<br />
dem Gestein. Drei Jungen<br />
vor einem Schachteingang<br />
am Berg.<br />
Childaid Network, das Ausmaß <strong>der</strong><br />
Kohleför<strong>der</strong>ung. „Der große Teil <strong>der</strong><br />
fast 500.000 Bergarbeiter kommt von<br />
außerhalb. Geschätzt von unserem<br />
Forschungs-Team, das in die Grube<br />
ging, sind fast zehn Prozent <strong>der</strong> unter<br />
Tage arbeitenden Belegschaft unter<br />
18, viele sogar unter zehn Jahre alt.“<br />
Krank durch Kohlestaub<br />
So wie die Kohleminen, liegen auch die<br />
ärmlichen Siedlungen <strong>der</strong> Bergarbeiter<br />
außerhalb <strong>der</strong> Dörfer. <strong>Das</strong> Wasser, das<br />
sie zum Trinken und Kochen verwenden,<br />
ist schlammig und verdreckt. Ihre<br />
Ernährung ist einseitig: getrockneter<br />
Fisch mit ein wenig Gemüse. Die meisten<br />
Bergarbeiter sind Analphabeten<br />
und sich <strong>der</strong> Gesundheitsrisiken nicht<br />
bewusst. Viele leiden an Atemwegserkrankungen<br />
aufgrund des Kohlestaubs,<br />
an Durchfall und Malaria.<br />
Kin<strong>der</strong> im Bergwerk<br />
Es scheint, dass die Kin<strong>der</strong>, genau wie<br />
ihre Eltern und Verwandten, von <strong>der</strong><br />
Kohle verzehrt werden. „Ich bin hier,<br />
um meinem Bru<strong>der</strong> zu helfen“, erzählt<br />
ein Junge. „Ich bin fürs Kochen und<br />
Waschen zuständig.“ Ob er vorher zur<br />
Schule gegangen sei, fragen wir ihn.<br />
„Ja, bis zur 5. Klasse. Aber dann habe<br />
ich aufgehört, um zu arbeiten und<br />
Geld zu verdienen.“ Und was denkst<br />
du, wenn du deine Freunde auf dem<br />
Weg zur Schule siehst Er zögert, bevor<br />
er schließlich antwortet: „Ich beneide<br />
sie dann.“<br />
Acht Karren pro Tag<br />
Der 14-jährige Churchill, <strong>der</strong> in einem<br />
<strong>der</strong> „Rattenlöcher“ arbeitet, gehört<br />
zum Stamm <strong>der</strong> Khasi. „Wir waren<br />
13 Brü<strong>der</strong> und Schwestern, aber fünf<br />
sind tot. Als auch mein Vater starb,<br />
habe ich angefangen, in <strong>der</strong> Mine zu<br />
arbeiten. Wenn ich mich anstrenge,<br />
schaffe ich es, so viel Kohle zu schlagen,<br />
dass ich acht Karren füllen kann. Pro<br />
Karren bekomme ich 90 Rupien.“ 90<br />
Rupien sind umgerechnet 1,25 Euro.<br />
Mit seinem mühsam verdienten Lohn<br />
hilft Churchill, dass seine jüngeren Geschwister<br />
weiter zur Schule gehen können:<br />
„Ich ermutige sie, damit sie nicht<br />
auch aufhören, son<strong>der</strong>n weiter lernen.“<br />
Schulferien in <strong>der</strong> Mine<br />
Die Wirklichkeit auf den Kohlefel<strong>der</strong>n<br />
ist komplex und entzieht sich einfachen<br />
Lösungen. Die Verdienstmöglichkeiten<br />
bedeuten Existenzsicherheit<br />
– oft zum ersten Mal im Leben. Ein<br />
Schuldirektor fasst das Dilemma in<br />
Worte: „Auf <strong>der</strong> einen Seite hilft die<br />
Kohle den armen Leuten, auch unseren<br />
Schülern. Während <strong>der</strong> Winterferien<br />
arbeiten sie in den Minen und<br />
können so für den Rest des Jahres die<br />
Schulgebühren zahlen. Aber gleichzeitig<br />
zerstört die Kohle ihr Leben und<br />
ihre Zukunft.“<br />
Bedrohte Natur<br />
Da viele auf den Kohlezug aufspringen,<br />
schwindet die traditionelle Lebensweise<br />
<strong>der</strong> Garos, Khasis und Jaintias.<br />
Ihr Umgang mit <strong>der</strong> Schöpfung<br />
folgte <strong>der</strong> Weisheit <strong>der</strong> Ahnen: Nur<br />
das wird genommen, was zum Leben<br />
wirklich gebraucht wird. Ihre Landwirtschaft<br />
auf Subsistenzbasis erhält<br />
das Gleichgewicht des empfindlichen<br />
Ökosystems <strong>der</strong> Berge – Heimat einer<br />
unschätzbaren biologischen Vielfalt.<br />
Der Kohleabbau dagegen ist rücksichtslos:<br />
Wäl<strong>der</strong> werden gefällt, die<br />
Erde aufgerissen, Flüsse umgeleitet,<br />
12 weltweit
Indien<br />
das Grundwasser sinkt und in den<br />
Halden lagern Schwermetalle.<br />
Überrollt vom Bergbau<br />
Vielleicht geht <strong>der</strong> Schaden für das Sozialsystem<br />
sogar noch tiefer. <strong>Das</strong> Dorfleben<br />
beruhte früher auf dem Grundsatz<br />
<strong>der</strong> Gleichheit. Gemeinsam wurde<br />
auf den Fel<strong>der</strong>n gearbeitet, und alle<br />
hatten ähnlich viel o<strong>der</strong> ähnlich wenig.<br />
Heute gleichen die traditionellen Dörfer<br />
verlorenen Inseln. In Nonghullum,<br />
einem Dorf <strong>der</strong> Khasi, kommen auf<br />
900 Einheimische zum Beispiel 50.000<br />
Bergarbeiter von auswärts. Die sozialen<br />
Probleme überrollen die ländliche Bevölkerung<br />
von Meghalaya: Prostitution<br />
und HIV/Aids, Kriminalität, Profitgier,<br />
Spannungen und sogar Gewalt.<br />
Der Abstand zwischen Gewinnern und<br />
Verlieren des Kohle-Booms wächst.<br />
Wer es sich leisten kann, schickt seine<br />
Kin<strong>der</strong> auf Schulen in die Hauptstadt<br />
Shillong. Die Kin<strong>der</strong> <strong>der</strong> Armen bleiben,<br />
um im Minengeschäft ein Zubrot<br />
zu verdienen. In Bildung und Gesundheitsversorgung<br />
wird nicht investiert.<br />
All das ist Zündstoff für die Zukunft.<br />
Projekte <strong>der</strong> Hoffnung<br />
Die gemeinsame Arbeit von Childaid<br />
Network und NESRC geht weiter.<br />
Gesundheitsmobile und Abendschulen<br />
sind zwei Vorhaben, mit denen<br />
wir beginnen. Eine erste kleine Hoffnung<br />
auf Verbesserung, aber jede<br />
noch so kleine Hoffnung ist wichtig<br />
für die Kin<strong>der</strong> in den Minen.<br />
Michael Kolb SJ / Melville Pereira SJ<br />
North-Eastern Social Research Centre<br />
(NESRC)<br />
Spendencode: X56611 NESRC<br />
weltweit 13
Tief ins Herz gebrannt<br />
Siem Reab<br />
Aus dem Freiwilligeneinsatz von Dr. Thomas Rigl (44) ist eine erfolgreiche<br />
Projektpartnerschaft zwischen seiner Regensburger Heimat und dem kambodschanischen<br />
Dorf Samraong gewachsen.<br />
Angkor Wat – Weltkulturerbe<br />
und Touristenmagnet Kambodschas.<br />
Auch ich wollte dieses<br />
imponierende Bauwerk einmal mit eigenen<br />
Augen sehen und bereiste deshalb<br />
2007 das Land, nichts ahnend, welche<br />
Folgen das haben würde. Zwar zogen<br />
mich die Tempel aus dem alten Königreich<br />
<strong>der</strong> Khmer wie erwartet in ihren<br />
Bann, weit mehr noch aber erschütterte<br />
mich die Armut, <strong>der</strong> ich begegnete.<br />
Noch vor Ort wurde mir klar, dass ich<br />
zurückkehren musste, um etwas gegen<br />
die Not <strong>der</strong> Menschen beizutragen.<br />
Fügung im Sabbatjahr<br />
2010 war es dann soweit. Im Rahmen<br />
eines Sabbatjahres, das mir mein Arbeitgeber,<br />
das Bistum Regensburg,<br />
gewährt hatte, verbrachte ich als Freiwilliger<br />
<strong>der</strong> <strong>Jesuitenmission</strong> rund zehn<br />
Monate in Siem Reap. Nach einer längeren<br />
Durststrecke als Büromitarbeiter<br />
bahnte sich erst gegen Ende meines<br />
Aufenthalts an, was aus meinem<br />
Leben inzwischen nicht mehr wegzudenken<br />
ist. Mit den Mitarbeitern des<br />
Jesuit Service fuhr ich in das etwa 40<br />
Kilometer außerhalb <strong>der</strong> Stadt gelegene<br />
Dorf Samraong, in dem es, wie so<br />
oft in Kambodscha, we<strong>der</strong> Strom und<br />
sauberes Wasser noch medizinische<br />
Versorgung gibt. Zudem war Oktober<br />
und damit Hungerzeit für die Familien,<br />
<strong>der</strong>en Reisernte nicht für ein<br />
ganzes Jahr reicht. Trotz aller Not aber<br />
14 weltweit
Jesuit Volunteers<br />
äußerten die Dorfbewohner beson<strong>der</strong>s<br />
den Wunsch nach einer eigenen<br />
Schule, denn <strong>der</strong> viele Kilometer weite<br />
Fußweg in <strong>der</strong> sengenden Tropenhitze<br />
hin<strong>der</strong>te die meisten ihrer Kin<strong>der</strong> am<br />
Schulbesuch.<br />
Bewegende Einweihung<br />
Der Gedanke, Samraong zu einem<br />
Schulbau zu verhelfen, ließ mich nicht<br />
mehr los. Mit tatkräftiger Unterstützung<br />
einer Regensburger Reisegruppe,<br />
<strong>der</strong> ich in Siem Reap begegnet war,<br />
rührte ich nach meiner Rückkehr in<br />
die Heimat kurz vor Weihnachten<br />
2010 die Spendentrommel. Rundbriefe,<br />
zwei Benefizkonzerte und einzelne<br />
Vorträge brachten so viel Geld<br />
ein, dass <strong>der</strong> Jesuit Service Siem Reap<br />
bereits im April 2011 eine zuverlässige<br />
Baufirma mit <strong>der</strong> Errichtung <strong>der</strong><br />
Grundschule in Samraong beauftragen<br />
konnte. Als diese im Oktober desselben<br />
Jahres ihrer Bestimmung übergeben<br />
wurde, war die Freude im Dorf<br />
unbeschreiblich. Ein großes Fest wurde<br />
gefeiert, bei dem in interreligiöser<br />
Harmonie ein Jesuit das Schulgebäude<br />
segnete und buddhistische Mönche in<br />
einer mehrstündigen Zeremonie die<br />
drei Klassenzimmer einweihten. Es<br />
war sehr bewegend für mich, diesen<br />
wun<strong>der</strong>baren Tag in Samraong hautnah<br />
miterlebt zu haben.<br />
Jahresurlaub für Hilfsprojekte<br />
Mehr und mehr hat Kambodscha seitdem<br />
mein Leben geprägt. Zwei Mal<br />
im Jahr fliege ich für einige Wochen<br />
in das südostasiatische Land und nehme<br />
es gerne in Kauf, meinen gesamten<br />
Jahresurlaub dafür verwenden zu<br />
müssen. Zahlreiche Freundschaften<br />
verbinden mich mit den Khmer, wie<br />
die Bevölkerungsmehrheit sich nennt.<br />
Dank stetig fließen<strong>der</strong> Spenden ließen<br />
sich in enger Abstimmung und Zusammenarbeit<br />
mit dem Jesuit Service<br />
Siem Reap immer neue Projekte in<br />
Samraong und Umgebung verwirklichen.<br />
Mehr als 120 Schülerinnen und<br />
Schüler besuchen die im Dorf Chreav<br />
angebotenen preisgünstigen Englischund<br />
Computerkurse, 25 jährliche Stipendien<br />
ermöglichen Kin<strong>der</strong>n aus den<br />
ärmsten Familien eine gebührenfreie<br />
Teilnahme. In Samraong freuen sich<br />
fünfzig Jugendliche über Fahrrä<strong>der</strong>,<br />
mit denen sie zu weiter entfernten höheren<br />
Schulen fahren können. Zehn<br />
Familien haben solide neue Häuser<br />
als Ersatz für ihre verfallenden Hütten<br />
erhalten, Reislieferungen lin<strong>der</strong>n<br />
den Hunger zum Ende <strong>der</strong> Regenzeit,<br />
Arzt- und Krankenhauskosten können<br />
beglichen und drückende Schulden<br />
zurückgezahlt werden.<br />
Landwirtschaft mit<br />
Hilfe von Ochsen: Die<br />
Reisernten in Samraong<br />
reichen oft nicht ein<br />
ganzes Jahr.<br />
weltweit 15
Jesuit Volunteers<br />
Verän<strong>der</strong>ungen in Samraong<br />
Bei meinem jüngsten Aufenthalt vor<br />
Ort im März dieses Jahres begleitete<br />
mich ein befreundeter Allgemeinarzt,<br />
um ehrenamtlich Dutzende von Patienten<br />
zu behandeln. Die Verän<strong>der</strong>ungen,<br />
die ich in Samraong beobachten<br />
durfte, waren so auffällig wie nie zuvor.<br />
Am Dorfrand sind Bohnenfel<strong>der</strong> entstanden.<br />
Eine Wasserpumpe dient <strong>der</strong><br />
Feldbewässerung, so dass auch in <strong>der</strong><br />
Trockenzeit Bohnen geerntet und auf<br />
dem Markt verkauft werden können.<br />
Immer mehr Familien entwickeln eigene<br />
landwirtschaftliche Initiativen und<br />
bitten um Kleinkredite zur Existenzgründung.<br />
Drei staatliche Lehrkräfte<br />
sorgen dafür, dass die Kin<strong>der</strong> des Dorfes<br />
lesen und schreiben lernen, und drei<br />
Mal die Woche gibt es eine kostenlose<br />
Schulspeisung in Form von Bor-Bor,<br />
<strong>der</strong> kambodschanischen Reissuppe.<br />
Bockbier für Kambodscha<br />
Sprachlos und unendlich dankbar<br />
macht mich die Spendenbereitschaft<br />
<strong>der</strong> Menschen in meiner Regensburger<br />
Heimat und darüber hinaus. Vor<br />
allem Mundpropaganda und halbjährliche<br />
Rundbriefe, die von ihren<br />
Empfängern oft an an<strong>der</strong>e weitergegeben<br />
werden, sorgen dafür, dass <strong>der</strong><br />
Spendentopf nicht leer wird. Einige<br />
Schulen haben den Erlös ihrer Adventsbasare<br />
gestiftet, und eine Regensburger<br />
Brauerei führt seit zwei Jahren<br />
jeden Oktober anlässlich des traditionellen<br />
Bockbieranstichs eine erfolgreiche<br />
Spendenaktion durch, <strong>der</strong>en<br />
Ergebnis sie mit eigenen Mitteln noch<br />
aufstockt. All das führt dazu, dass ich<br />
dem Jesuit Service inzwischen auch<br />
an an<strong>der</strong>en Orten <strong>der</strong> Provinz Siem<br />
Reap unter die Arme greifen kann.<br />
16 weltweit
Jesuit Volunteers<br />
So wird jetzt im Oktober ein neu erbautes<br />
Schulhaus in <strong>der</strong> Gemeinde<br />
Thepdey seine Pforten öffnen und<br />
dem dortigen Schulzentrum als lang<br />
ersehnte High School zur Verfügung<br />
stehen. Deren Einweihung wird vermutlich<br />
nicht min<strong>der</strong> eindrucksvoll<br />
wie die in Samraong.<br />
Entwicklung als Beruf<br />
Kambodscha prägt mein Leben, die<br />
Beschäftigung mit den Themen Armut<br />
und Entwicklung verän<strong>der</strong>t es<br />
zunehmend. Inzwischen habe ich ein<br />
Aufbaustudium im Fach „Nachhaltige<br />
Entwicklungszusammenarbeit“ absolviert.<br />
Im September vergangenen Jahres<br />
eröffnete sich mir die Gelegenheit, im<br />
Bischöflichen Ordinariat Regensburg<br />
auf die Leitung <strong>der</strong> Arbeitsstelle Weltkirche<br />
(Mission-Entwicklung-Frieden) zu<br />
wechseln. Damit konnte ich zu meinem<br />
Beruf machen, was mich seit einigen<br />
Jahren nun privat so sehr beschäftigt.<br />
Auf absehbare Zeit wird Kambodscha<br />
wohl mein persönliches Engagement<br />
bleiben. Die Erfahrungen mit <strong>der</strong> Armut<br />
<strong>der</strong> Menschen und den ungerechten<br />
Strukturen in diesem so gebeutelten<br />
Land aber haben sich tief in mein<br />
Herz eingebrannt. Sie sind mir Triebfe<strong>der</strong><br />
und Motivation für mein neues<br />
berufliches Aufgabenfeld. Und mehr<br />
und mehr werfen sie auch Fragen im<br />
Blick auf den eigenen Lebensstil auf.<br />
Jesuit Service Siem Reap:<br />
Dr. Thomas Rigl<br />
Über Projekterfolge in<br />
Samraong freut sich<br />
Thomas Rigl (oben):<br />
Eines <strong>der</strong> neuen<br />
Familienhäuser, die<br />
Schule als Baustelle<br />
und nach Fertigstellung<br />
(Fotos links).<br />
Der Jesuit Service ist die Organisation, mit <strong>der</strong> die Jesuiten<br />
in Kambodscha Entwicklungshilfe in verschiedenen Provinzen<br />
des Landes leisten, darunter auch in Siem Reap. Die Schwerpunkte<br />
seiner Arbeit liegen in den Bereichen Bildung und Soziales.<br />
Darunter fallen <strong>der</strong> Bau und Unterhalt von Schulen,<br />
die Unterstützung von Lehrkräften, Programme zur Dorfentwicklung<br />
und vielfältige Maßnahmen zur Verbesserung <strong>der</strong><br />
Lebenssituation von Armen und Behin<strong>der</strong>ten. Für die Projekte<br />
von Dr. Thomas Rigl sind bisher mehr als 100.000 Euro gespendet<br />
worden. Auch von uns in <strong>der</strong> <strong>Jesuitenmission</strong> ganz<br />
herzlichen Dank für Ihr Engagement!<br />
Spenden überweisen Sie bitte an die <strong>Jesuitenmission</strong> unter<br />
dem Stichwort: X69120 Rigl<br />
weltweit 17
Blume <strong>der</strong> Hoffnung<br />
Ihr, die ihr voll guten Willens seid<br />
und euch unendlich müht in aller Welt<br />
um jede Not und Ungerechtigkeit<br />
und oft verzweifeln wollt,<br />
weil euer Tun vergeblich scheint:<br />
Seid guten Mutes und bedenkt,<br />
dass selbst das Lächeln eines Kindes<br />
die Hoffnungslosigkeit durchbrechen kann.<br />
Auch ein Stacheldraht hält es nicht auf.<br />
Als wäre dieser schlimme Draht<br />
ein Kin<strong>der</strong>spielzeug nur, weil man<br />
an seine Stacheln Blumen hängen kann,<br />
aus denen Hoffnung blüht, so stark,<br />
als ob sie Berge selbst versetzen könnte.<br />
Und solchen Glauben sollten wir<br />
auch selber immer neu versuchen,<br />
trotz allem Anschein von Vergeblichkeit.<br />
<strong>Das</strong> helle Lächeln eines Kindes<br />
erleuchtet uns dabei den Weg.<br />
Joe Übelmesser SJ<br />
18 weltweit
weltweit 19
Japan<br />
Hun<strong>der</strong>t Jahre Weisheit<br />
Die von Jesuiten gegründete Sophia-Universität in Tokio feiert ihr 100-jähriges Bestehen.<br />
Sie ist nicht die größte Universität<br />
<strong>der</strong> Neun-Millionen-Metropole,<br />
nicht die älteste und auch nicht<br />
die prestigeträchtigste – aber sie<br />
ist die einzige katholische, die<br />
Studenten und Studentinnen<br />
aufnimmt. Heute kann die Sophia-Universität<br />
in Tokio auf eine<br />
100-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.<br />
Jesuiten aus Europa<br />
haben sie 1913 gegründet.<br />
Jährlicher Bewerberansturm<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Japan-Mission,<br />
beauftragt von Papst Pius X.,<br />
bauten die Patres eine Bildungsstätte<br />
auf, in <strong>der</strong> religiöse Praxis<br />
und weltliche Wissensvermittlung<br />
einan<strong>der</strong> sinnvoll ergänzen<br />
sollten. Die ersten Jahrzehnte<br />
waren durch die Gründungsväter<br />
noch stark deutsch geprägt.<br />
Mit jesuitischer Tatkraft aus<br />
aller Welt und mit viel Unterstützung<br />
aus Deutschland, insbeson<strong>der</strong>e<br />
aus dem Erzbistum<br />
Köln, entstand eine mo<strong>der</strong>ne<br />
Hochschullandschaft im Herzen<br />
Tokios. Die Sophia zählt<br />
heute 12.000 Studierende und<br />
bietet in acht Fakultäten ein<br />
breites Fächerspektrum. Sie ist<br />
eine renommierte Privathochschule,<br />
was sich stets an einem<br />
regelrechten Bewerberansturm<br />
auf ihre Plätze zeigt.<br />
110.000 Absolventen<br />
Was alle Studenten an dieser<br />
Hochschule schätzen, ist ihre<br />
Weltoffenheit. <strong>Das</strong> bestätigt<br />
Tokiko Kiyota: „Die Sophia<br />
war immer sehr international<br />
orientiert.“ Die 59-jährige<br />
Tokioterin kennt sich aus mit<br />
weltumspannendem Kulturaustausch.<br />
Sie lebt als Mitarbeiterin<br />
<strong>der</strong> „Japan Foundation“ –<br />
dem japanischen Pendant zum<br />
Goethe-Institut – zum wie<strong>der</strong>holten<br />
Mal in Deutschland.<br />
Seit 2013 leitet sie das Japanische<br />
Kulturinstitut Köln. Und<br />
Tokiko Kiyota zählt zu den<br />
mittlerweile 110.000 Absolventen<br />
<strong>der</strong> Sophia-Universität.<br />
Zufallswahl Germanistik<br />
Von 1973 bis 1979 studierte sie<br />
an <strong>der</strong> Sophia Germanistik. Eigentlich<br />
eine Zufallswahl. „Es<br />
hätte auch eine an<strong>der</strong>e Sprache<br />
werden können. Weil meine Familie<br />
nichts mit dem Ausland zu<br />
tun hatte, habe ich eine Neigung<br />
dazu entwickelt.“ Als Schülerin<br />
eines benachbarten katholischen<br />
Gymnasiums kannte Tokiko<br />
Kiyota die Uni schon vom Vorbeigehen.<br />
Im Rückblick auf ihr<br />
Studium erinnert sie sich an die<br />
beträchtliche Zahl von ausländischen<br />
Studierenden und Dozenten<br />
aus verschiedenen Län<strong>der</strong>n.<br />
Von deutschen Jesuiten<br />
20 weltweit
Japan<br />
lernte sie deutsche Geschichte<br />
und sprachliche Feinheiten. Es<br />
ging streng zu; für die Teilnahme<br />
an den in Japan üblichen<br />
Studenten-Freizeitclubs blieb<br />
keine Zeit. <strong>Das</strong>s die Hochschule<br />
eine kirchliche war, fiel für die<br />
Japanerin, die nicht aktiv religiös<br />
lebt, kaum ins Gewicht.<br />
„Viele Professoren waren Priester,<br />
die Kirche St. Ignatius auf<br />
dem Campus war bekannt, aber<br />
Gottesdienste blieben immer<br />
freiwillig.“<br />
Hort <strong>der</strong> Internationalität<br />
Die Sophia-Universität war das<br />
wichtigste Missionsprojekt <strong>der</strong><br />
Jesuiten in Japan. Der luxemburgische<br />
Erzbischof und Jesuit<br />
Jean-Claude Hollerich, ehemaliger<br />
Professor an <strong>der</strong> Sophia, formuliert<br />
die Verdienste so: „<strong>Das</strong><br />
Christentum ist in <strong>der</strong> akademischen<br />
Welt Japans bekannt und<br />
kein Fremdkörper mehr.“ Auch<br />
Hollerich erlebte die Universität<br />
als Hort <strong>der</strong> Internationalität.<br />
„<strong>Das</strong> hat sich durch die vielen<br />
Jesuiten ergeben, die durch an<strong>der</strong>e<br />
ausländische Kräfte ersetzt<br />
worden sind.“ Aktuell sind noch<br />
29 Jesuiten in <strong>der</strong> Lehre tätig;<br />
rund 60 Patres leben an <strong>der</strong><br />
Hochschule.<br />
Almuni-Club in Düsseldorf<br />
Sophia-Absolventin Kiyota (Foto<br />
rechts) steht noch heute, 30 Jahre<br />
nach ihrem Bachelor-Abschluss,<br />
in guter Verbindung zu damaligen<br />
Kommilitonen. Denn einer<br />
<strong>der</strong> größten Alumni-Clubs sitzt<br />
in Düsseldorf; zweimal jährlich<br />
treffen sich seine rund 50 Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Und wenn Kiyota in<br />
Tokio ist, schließt sie sich gern<br />
den regelmäßigen Klassentreffen<br />
ihres Sophia-Jahrgangs an. Zu<br />
den Jubiläumsfeierlichkeiten <strong>der</strong><br />
Uni im November kann Tokiko<br />
Kiyota aber nicht in ihre Heimat<br />
reisen. Als Direktorin des Japanischen<br />
Kulturinstituts hat sie<br />
2013 selbst ein an<strong>der</strong>es Jubiläum<br />
mitzuorganisieren: Die Städtepartnerschaft<br />
zwischen Köln und<br />
Kyoto feiert 50. Geburtstag.<br />
Isabel Lauer<br />
Jubiläumsmagazin Japan<br />
Die <strong>Jesuitenmission</strong> gibt<br />
gegen Jahresende ein Son<strong>der</strong>heft<br />
zum 100. Jubiläum<br />
<strong>der</strong> Sophia-Universität<br />
Tokio heraus. Darin lassen<br />
Mitarbeiter und ehemalige<br />
Weggefährten die wechselvolle<br />
Historie Revue passieren.<br />
Schon jetzt können<br />
Sie die Festschrift kostenlos<br />
bestellen: per E-Mail an<br />
prokur@jesuitenmission.de<br />
o<strong>der</strong> telefonisch unter<br />
(0911) 2346-160.<br />
weltweit 21
Hilfe für Ostafrika<br />
Bessere Dörfer für eine bessere Welt<br />
Sprechstunde unterm<br />
Baum: Gesundheitsversorgung<br />
in den Dörfern<br />
gehört auch zur Arbeit<br />
<strong>der</strong> VRO.<br />
Mit dem Tod von Pater Windey 2009 geriet das Dorfbauwerk VRO zunächst<br />
in Turbulenzen. Jetzt geht es im alten Geist mit neuem Schwung weiter, wie<br />
Pater Peter Daniel aus Indien berichtet.<br />
Vermutlich ist vielen unter Ihnen<br />
<strong>der</strong> Name Pater Windey<br />
noch ein Begriff. Ich freue<br />
mich, Ihnen nach langer Zeit endlich<br />
wie<strong>der</strong> vom indischen Dorfbauwerk<br />
VRO (Village Reconstruction Organisation)<br />
berichten zu können und die<br />
Brücke zwischen Ihnen in Deutschland<br />
und unserer Arbeit für die Armen<br />
im ländlichen Indien neu aufbauen zu<br />
dürfen. Von 1971 bis zu seinem Tod<br />
im September 2009 sind Tausende<br />
von Wohltäterinnen und Wohltätern<br />
dem Pionier und Grün<strong>der</strong> des Dorfbauwerkes<br />
VRO, P. Michael A. Windey<br />
SJ, mit ihren Spenden zu Hilfe<br />
gekommen. Nicht wenige haben ein<br />
ganzes Haus o<strong>der</strong> gar ein komplettes<br />
Dorf mitfinanziert.<br />
Wie<strong>der</strong> auf Kurs<br />
Seit dem Tod von Pater Windey vor<br />
vier Jahren hat das Dorfbauwerk eine<br />
Krisenzeit durchlebt. Der Grün<strong>der</strong>vater<br />
war schon seit 2008 krank und<br />
konnte die über ganz Indien verstreuten<br />
Einrichtungen nicht mehr richtig<br />
kontrollieren. Auch das finanzielle<br />
22 weltweit
Indien<br />
Management ließ zu wünschen übrig.<br />
Deshalb haben sich damals einige<br />
Wohltäter aus Europa unter Leitung<br />
von P. Joe Übelmesser SJ eingeschaltet<br />
und die Organisation gewissermaßen<br />
auf Sparflamme am Leben erhalten.<br />
Gemeinsam mit indischen Jesuiten<br />
wurde das Werk dann wie<strong>der</strong> auf Kurs<br />
gebracht und seit Oktober 2011 leiten<br />
Pater Santiago und ich die indische<br />
Dorfbauorganisation VRO.<br />
<strong>Das</strong> Vorbild des Vaters<br />
Als ich die Verantwortung als geschäftsführen<strong>der</strong><br />
Direktor übernommen habe,<br />
fragte ich mich: „Besitze ich überhaupt<br />
die notwendigen Eigenschaften, um die<br />
VRO entsprechend <strong>der</strong> Vision von Pater<br />
Windey fortzuführen“ Gerne möchte<br />
ich Ihnen ein bisschen von mir erzählen.<br />
Ich bin ausgebildeter Mathematiklehrer<br />
und habe bis 1990 unterrichtet. Damals<br />
starb mein Vater völlig unerwartet an einem<br />
Schlaganfall. Ich fuhr sofort nach<br />
Hause. Nach <strong>der</strong> Beerdigung erzählten<br />
mir die Dalits in unserem Dorf, also<br />
die so genannten Unberührbaren, von<br />
vielen Situationen, in denen mein Vater<br />
ihnen geholfen hatte. <strong>Das</strong> hat mich<br />
sehr bewegt und ich fragte mich: „Wenn<br />
mein Vater als einfacher Bauer so vielen<br />
Dalit-Familien geholfen hat, was tue ich<br />
dann eigentlich als Jesuit“ Ich begann,<br />
mein bisheriges Leben in Frage zu stellen,<br />
verließ die Schule, schlug mein Zelt<br />
unter den Dalits auf und begann, mit<br />
Pater Windey und <strong>der</strong> VRO zu arbeiten.<br />
Bei ihm habe ich viel für meine spätere<br />
Arbeit gelernt. Nach 18 Monaten habe<br />
ich dann mit <strong>der</strong> Arbeit unter den Dalits<br />
in Darsi, im Distrikt von Pragasam,<br />
begonnen. Dort konnte ich zusammen<br />
mit den Leuten zehn Dörfer für insgesamt<br />
590 Familien aufbauen.<br />
<strong>Das</strong> Feuerdorf Agnipuri<br />
<strong>Das</strong>s diese Arbeit nicht einfach war,<br />
mag die folgende Geschichte illustrieren.<br />
Sie zeigt zugleich eine Grundproblematik<br />
unseres Landes: die fast<br />
unüberwindbaren Unterschiede <strong>der</strong><br />
Kasten. Eines <strong>der</strong> zehn Dörfer im Pragasam<br />
Distrikt hieß Erraobanapali.<br />
Wichtig für jede<br />
Dorfentwicklung ist<br />
die Stärkung <strong>der</strong> Frauen<br />
und Unterricht für<br />
die Kin<strong>der</strong>.<br />
weltweit 23
Indien<br />
Peter Daniel SJ (unten)<br />
hat mit den Dorfbewohnern<br />
neue Häuser für<br />
Agnipuri gebaut (oben).<br />
Es lag zehn Kilometer von <strong>der</strong> Stadt<br />
Darsi entfernt. Von den Familien des<br />
Ortes gehörten 265 den Dalits an und<br />
65 den Landbesitzern. Nun war es<br />
dort seit 100 Jahren üblich, dass immer<br />
nur ein Landbesitzer zum Dorfpräsidenten<br />
gewählt wurde. Als ich in<br />
das Dorf kam, fragte ich die Dalits,<br />
warum sie sich nicht auch selber zur<br />
Wahl stellen wollten, ebenso wie die<br />
an<strong>der</strong>en. <strong>Das</strong> hat die Landbesitzer so<br />
erbost, dass sie alle Hütten <strong>der</strong> Dalits<br />
einfach nie<strong>der</strong>gebrannt haben. In<br />
Furcht und Schrecken verließen die<br />
Dalits den Ort. Ich habe dann die<br />
Leute ermutigt, gegen dieses Unrecht<br />
zu kämpfen. So haben wir also sieben<br />
Tage lang vor dem Büro <strong>der</strong> Regierung<br />
in Darsi demonstriert. Am Ende hat<br />
tatsächlich die Regierung Mittel für<br />
265 neue Häuser freigegeben. Und<br />
mit <strong>der</strong> Unterstützung des Entwicklungshilfe-Klubs<br />
in Wien haben wir<br />
ein ganz neues Dorf, ein wenig abseits<br />
vom alten Platz, erbaut. Wir nannten<br />
es Agnipuri, das heißt: Feuerdorf.<br />
Beim Stamm <strong>der</strong> Koya<br />
Ich zog dann weiter nach Bhadrachalam.<br />
Dort leben Ureinwohner vom<br />
Stamm <strong>der</strong> Koya. Ich begann meine<br />
Mission in einer einfachen Hütte im<br />
Urwald. Es gab keine Elektrizität. Um<br />
zu telefonieren, musste ich 46 Kilometer<br />
weit fahren. Doch bald konnte ich<br />
ein Team von engagierten Laien und<br />
Ordensleuten gewinnen, die mit mir<br />
für die Ureinwohner arbeiten wollten.<br />
Bildung war unsere Priorität. Wir haben<br />
dabei ganz klein begonnen, indem<br />
wir die Kin<strong>der</strong>, die zuvor nie eine Schule<br />
gesehen hatten, zum Unterricht sammelten.<br />
Heute gibt es dort viele Dorfschullehrer,<br />
650 Selbsthilfegruppen in<br />
85 Dörfern und 50 Gesundheitshelferinnen.<br />
Unsere mobilen Klinken haben<br />
seither Tausende von Kin<strong>der</strong>n vor dem<br />
sicheren Tod gerettet.<br />
Zurück zu den Ursprüngen<br />
Ausgerüstet mit den Erfahrungen bei<br />
Pater Windey und meiner Arbeit unter<br />
den Dalits und Ureinwohnern,<br />
habe ich meine neue Aufgabe in <strong>der</strong><br />
Dorfbauorganisation übernommen.<br />
Im Jahre 2012 haben wir in einem<br />
Arbeitskreis mit allen Verantwortlichen<br />
des Werkes die Arbeit <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
begutachtet, ausgewertet<br />
und über die nächsten Schritte beraten.<br />
Als grundsätzliches Ziel unseres<br />
Neubeginns sind wir wie<strong>der</strong> auf die<br />
alte Devise von Pater Windey zurückgekommen:<br />
„Bessere Dörfer für eine<br />
bessere Welt“.<br />
Die sechs großen „E“s<br />
Die Zusammenfassung unserer Ziele<br />
und Absichten lautet: „Als Partner<br />
bei <strong>der</strong> Entwicklung wollen wir die<br />
Menschen zu eigenen Initiativen er-<br />
24 weltweit
Indien<br />
mutigen, und ihnen helfen, ihre Lebensumstände<br />
selber nachhaltig zu<br />
verbessern.“ Um dies zu ermöglichen,<br />
wird sich die Village Reconstruction<br />
Organisation fortan nicht mehr einzelnen<br />
Dörfern und Dorfgemeinschaften<br />
zuwenden, son<strong>der</strong>n immer<br />
gleich einen ganzen Cluster an Dörfern<br />
ins Auge fassen. Auf diese Weise<br />
können sich diese benachbarten<br />
Dorfgemeinschaften gegenseitig ermutigen,<br />
kritisieren und unterstützen.<br />
Es gibt sechs verschiedene Bereiche,<br />
die für eine ganzheitliche und nachhaltige<br />
Entwicklung in den Dörfern<br />
wichtig sind. In englischer Sprache beginnen<br />
alle sechs mit einem „E“:<br />
• Environment o<strong>der</strong> Umwelt: Menschenwürdiges<br />
Wohnen, Gesundheitsvorsorge<br />
und -fürsorge.<br />
• Education o<strong>der</strong> Erziehung: Schulen,<br />
Hausaufgabenhilfe und berufliche<br />
Aus- und Fortbildung.<br />
• Employment: Bezahlte Arbeit o<strong>der</strong><br />
Verdienstmöglichkeiten als selbstständige<br />
Handwerker, Bauarbeiter o<strong>der</strong> in<br />
biologischer Landwirtschaft.<br />
• Enjoyment: Dorfverschönerung, Straßentheater,<br />
Spiele, Gesang.<br />
• Empowerment: Stärkung von Frauen,<br />
die meistens die treibende Kraft bei<br />
<strong>der</strong> Entwicklung sind.<br />
• Entitlement: Rechte und Rechtstitel<br />
einfor<strong>der</strong>n für Grundstücke, politische<br />
Ämter und staatliche Zuschüsse.<br />
Wir wollen also keine neuen Institutionen<br />
bauen, son<strong>der</strong>n die Menschen<br />
in den Dörfern ermutigen, sich diese<br />
sechs großen „E“s selber zu erarbeiten<br />
o<strong>der</strong> zu erkämpfen. Wir wissen, dass<br />
dieser Weg von unserer Seite ein größeres<br />
Engagement und härtere Bemühungen<br />
verlangt, als wenn wir für die<br />
Leute einfach Häuser o<strong>der</strong> Schulen<br />
bauen. Doch wir sind überzeugt, dass<br />
nur das, was die Menschen selber tun,<br />
sich selbst erarbeiten und erstreiten, auf<br />
die Dauer für sie von Wert sein wird.<br />
Dank und Einladung<br />
Froh, dankbar und glücklich sind wir,<br />
dass die VRO nun wie<strong>der</strong> mit voller<br />
Kraft an die eigentliche Arbeit für<br />
die Armen in den indischen Dörfern<br />
gehen kann. An dieser Stelle möchte<br />
ich einen beson<strong>der</strong>en Dank aussprechen<br />
an alle Wohltäter, die uns in den<br />
schwierigen Jahren des Überganges die<br />
Treue gehalten haben. Nun können<br />
wir guten Gewissens wie<strong>der</strong> alte und<br />
neue Freunde einladen, mit uns zu<br />
gehen auf dem alten Weg mit neuem<br />
Schwung und neuer Begeisterung für<br />
die Menschen.<br />
Peter Daniel SJ<br />
Spendencode: X59010 VRO<br />
<strong>Das</strong> Spektrum <strong>der</strong> VRO<br />
umfasst Hausbau,<br />
Gesundheit, Landwirtschaft,<br />
Schulen, Rechtshilfe<br />
und Ausbildung.<br />
weltweit 25
Dank aus Osttimor<br />
Liebe Freundinnen und Freunde <strong>der</strong> <strong>Jesuitenmission</strong>,<br />
von Herzen danke ich Ihnen für die Hoffnung, die Sie mit Ihren<br />
Spenden den Menschen in Osttimor geschenkt haben.<br />
Es ist nahezu unmöglich, sich ein Land vorzustellen, in dem das<br />
Bildungssystem so gründlich ruiniert wurde wie in Osttimor.<br />
Nicht nur verließen viele Lehrer mit dem Abzug <strong>der</strong> Indonesier<br />
das Land, auch viele Schulen wurden während <strong>der</strong> gewalttätigen<br />
Ausschreitungen 1999 zerstört. Die bisherigen Lehrpläne und<br />
Schulbücher wurden belanglos, neben Tetum auch wie<strong>der</strong> Portugiesisch<br />
als zweite Amtssprache eingeführt. Um Lücken zu füllen,<br />
wurden viele Hilfslehrer ohne jegliche Ausbildung eingestellt, so<br />
dass sie noch heute 80 Prozent des Lehrkörpers stellen: Ohne fachliche<br />
Qualifikation, mit großen eigenen Nöten und nur mäßiger<br />
Kenntnis <strong>der</strong> beiden Unterrichtssprachen.<br />
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!<br />
Bis Juli 2013 konnte die<br />
<strong>Jesuitenmission</strong> dank Ihrer Spenden<br />
dieses langfristige Projekt mit<br />
rund 191.000 Euro för<strong>der</strong>n. Weitere<br />
Hilfen sind gerne willkommen.<br />
Spendencode: X31131 Osttimor<br />
Nicht nur die Jesuiten haben Mitbrü<strong>der</strong> verloren (unter den zwei<br />
im September 1999 getöteten war auch <strong>der</strong> deutsche Jesuit Karl<br />
Albrecht). Alle leiden unter dem Trauma dieser Jahre. Selbst die<br />
Kin<strong>der</strong> an unserer Schule, die damals erst zur Welt kamen, oft<br />
in Flüchtlingslagern o<strong>der</strong> leidvollen Familiensituationen, sind von<br />
den seelischen Nöten jener Zeit geprägt.<br />
Aus all diesen Gründen haben sich die Jesuiten verpflichtet, nicht<br />
nur ein paar hun<strong>der</strong>t Kin<strong>der</strong>n in einzelnen Schulen einen guten Unterricht<br />
zu geben, son<strong>der</strong>n mit dem Bau einer Lehrerakademie dem<br />
Bildungssystem insgesamt und damit dem ganzen Land zu dienen.<br />
Im Jahr 2000 wechselte eine Freundin von mir von ihrer gut bezahlten<br />
Stelle in New York zum Regionalbüro <strong>der</strong> Vereinten Nationen<br />
in Osttimor. Sie war begeistert von <strong>der</strong> Chance, am Aufbau eines<br />
neuen Staates mitzuwirken. Diese Mission <strong>der</strong> Vereinten Nationen<br />
ist nicht abgeschlossen. Die tatsächliche Arbeit nehmen nun die Timoresen<br />
selbst in Angriff, auch Dank Ihrer Unterstützung.<br />
<strong>Das</strong> Bildungsprojekt <strong>der</strong> Jesuiten in Osttimor ist langfristig angelegt.<br />
Unsere Bau- und Erweiterungspläne reichen bis in das Jahr<br />
2021. In den nächsten Jahren wird Ihre bleibende Solidarität von<br />
entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung sein, während wir dieses ambitionierte<br />
Bildungsprojekt für die Zukunft Osttimors weiter ausbauen.<br />
P. Mark Raper SJ<br />
Regionaloberer Osttimor<br />
26 weltweit
Schüleraustausch im Web 2.0<br />
Advocacy<br />
Initiiert von Pater Jörg Alt, fand ein virtuelles Begegnungsprojekt zwischen<br />
zwei Jesuitenschulen in Deutschland und Simbabwe statt. Der simbabwische<br />
Koordinator und zwei Schüler berichten.<br />
Dieses Projekt hat mir die Augen<br />
geöffnet für an<strong>der</strong>e Lebensweisen<br />
und neue Kulturen.“<br />
– „Ich konnte es kaum glauben,<br />
dass es so viele Gemeinsamkeiten mit<br />
den Jugendlichen in Deutschland gibt.“<br />
<strong>Das</strong> sind nur zwei <strong>der</strong> Kommentare und<br />
Eindrücke unserer Schüler <strong>der</strong> St. Peters<br />
Kubatana High School in Simbabwe,<br />
die am Web 2.0 Austauschprogramm<br />
mit Schülern des Kollegs St. Blasien in<br />
Deutschland teilgenommen haben. Ziel<br />
des Projektes war es, Jugendliche aus beiden<br />
Län<strong>der</strong>n über die virtuelle Plattform<br />
sozialer Netzwerke in direkten Kontakt<br />
treten zu lassen. Wir teilten die beiden<br />
Gruppen so auf, dass jeweils ein deutscher<br />
und ein simbabwischer Schüler<br />
über die gesamte Projektdauer feste Gesprächspartner<br />
wurden.<br />
<strong>Das</strong> erste Mal im Internet<br />
Die St. Peters Kubatana High School<br />
ist eine Jesuitenschule in <strong>der</strong> simbabwischen<br />
Hauptstadt Harare. Sie liegt<br />
in einer dicht besiedelten Gegend mit<br />
gravierenden Problemen: allgemeine<br />
Armut, fehlende soziale Infrastruktur,<br />
politische Gewalt und Einschüchterung.<br />
Die meisten Jugendlichen im Viertel<br />
fühlen sich macht- und perspektivlos,<br />
sind schnell gefangen in dem Teufelskreis<br />
aus Armut und Gewalt. <strong>Das</strong> Web<br />
2.0 Austauschprogramm war für sie eine<br />
Chance, zu erleben, dass sie Teil einer<br />
größeren globalen Welt sind. Mehr als<br />
die Hälfte von ihnen hatte vorher noch<br />
nie Internet benutzt und wir mussten<br />
ihnen erst beibringen, wie man einen<br />
Computer bedient und sich bei Skype<br />
und Facebook anmeldet.<br />
Kontakt per Facebook:<br />
Zwei Schülerinnen in<br />
Harare chatten mit Gleichaltrigen<br />
in St. Blasien.<br />
weltweit 27
Advocacy<br />
Teilnehmer auf <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en Seite des Globus:<br />
Yannick Müller und zwei<br />
Mitschülerinnen im Kolleg<br />
St. Blasien.<br />
<strong>Das</strong> Potenzial <strong>der</strong> Jugend<br />
Was eine wirklich wun<strong>der</strong>volle Erfahrung<br />
war: Trotz <strong>der</strong> großen Entfernung,<br />
<strong>der</strong> sehr unterschiedlichen<br />
kulturellen Gegebenheiten und des<br />
tiefen wirtschaftlichen Grabens, <strong>der</strong><br />
Deutschland und Simbabwe voneinan<strong>der</strong><br />
trennt, machten sich die<br />
Jugendlichen bei<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> sehr<br />
ähnliche Gedanken und Sorgen über<br />
die Zukunft <strong>der</strong> Welt. In ihren Gesprächen<br />
diskutierten sie Themen wie<br />
Menschenrechte, politische Führung,<br />
Klimawandel, Bildung, Armut und<br />
Konflikte in beiden Län<strong>der</strong>n. <strong>Das</strong><br />
Projekt gab den Schülern die Gelegenheit,<br />
globale Fragen zu erörtern und<br />
das Potenzial zu entdecken, das die<br />
Jugend hat, um eine gerechtere Welt<br />
zu schaffen.<br />
Ngonidzashe Edward SJ<br />
Jugendseelsorger in Simbabwe<br />
Bericht aus St. Blasien<br />
Als Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Amnesty International<br />
AG des Kollegs St. Blasien<br />
hat es uns sehr interessiert, mit den<br />
Schülern aus Simbabwe in Kontakt zu<br />
treten. Da dort in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen<br />
stattfinden sollen<br />
und bei uns im Herbst die Bundestagswahlen<br />
anstehen, bot sich dies als<br />
thematische Grundlage an. Bei den<br />
zunehmend vertieften Gesprächen<br />
wurden neben einem ausgeprägten gegenseitigen<br />
Interesse dann auch große<br />
gesellschaftliche Unterschiede deutlich.<br />
So waren schnell zehn Fragen<br />
zum politischen und sozialen Leben<br />
für die öffentliche Skype-Konferenz<br />
gefunden, die im Rahmen des jährlichen<br />
„Tag für Eine Welt“ im Kolleg<br />
St. Blasien stattfand und als Höhepunkt<br />
unseres interkulturellen Austauschs<br />
allen Beteiligten ein aktives<br />
Teilhaben am Geschehen ermöglichte.<br />
Fragen über die Unterschiede zwischen<br />
armen und reichen Menschen<br />
in Deutschland, das Verhältnis von<br />
Bildung und Politik zueinan<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Schutz <strong>der</strong> Umwelt in einer so erfolgreichen<br />
Industrienation führten zu<br />
einem sorgfältigen reflexiven Denken<br />
unsererseits. Auch nach <strong>der</strong> Gleichstellung<br />
homosexueller Paare o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Rolle <strong>der</strong> Frau in <strong>der</strong> Arbeitswelt<br />
wurden wir befragt und hatten somit<br />
die Möglichkeit, unsere gewohnte<br />
Umgebung einmal von außen zu betrachten.<br />
Die Beantwortung unserer<br />
Fragen von Seiten <strong>der</strong> simbabwischen<br />
Schüler verhalf uns zu einer besseren<br />
Vorstellung <strong>der</strong> dortigen Verhältnisse.<br />
Lei<strong>der</strong> wurden etwas heiklere Fragen<br />
wie zum Beispiel nach <strong>der</strong> Meinungsund<br />
Pressefreiheit o<strong>der</strong> <strong>der</strong> teilweise<br />
28 weltweit
Advocacy<br />
korrupten und autoritären Regierung<br />
Mugabes nur verhältnismäßig knapp<br />
beantwortet. Wir gewannen den Eindruck,<br />
unsere Gesprächspartner könnten<br />
befürchten, sich mit zu kritischen<br />
Äußerungen selbst in Gefahr zu bringen.<br />
Es war gewissermaßen eigenartig,<br />
von jenen Schülern zu hören, wie angespannt<br />
die Stimmung in <strong>der</strong> Hauptstadt<br />
Simbabwes ist und gewaltsame<br />
Auseinan<strong>der</strong>setzungen beinahe zum<br />
Alltag gehören – und das bereits lange<br />
vor den eigentlichen Wahlen. Bil<strong>der</strong>,<br />
wie man sie sonst oft im Fernsehen zu<br />
sehen bekommt, wurden plötzlich viel<br />
realer und greifbarer.<br />
Yannick Müller<br />
Schüler des Kollegs St. Blasien<br />
Bericht aus Harare<br />
Als ich von dem geplanten Austausch<br />
mit einer Schule von einem an<strong>der</strong>en<br />
Kontinent hörte, habe ich mich enorm<br />
angestrengt, um die Chance zu bekommen,<br />
an diesem einmaligen Projekt<br />
teilzunehmen. Und ich hatte Glück<br />
und durfte mitmachen! Ich wollte<br />
einfach mehr über Europa, und noch<br />
genauer über Deutschland erfahren.<br />
Außerdem wollte ich wissen, wie und<br />
warum unsere Kulturen so verschieden<br />
sind. Ich wollte Informationen, Ideen<br />
und Gefühle mit Menschen von <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en Seite des Globus austauschen.<br />
Die Teilnahme an diesem Projekt war<br />
für mich wie ein großer Schritt in die<br />
globale Weltgemeinschaft. Mein Gesprächspartner<br />
während des Projektes<br />
war Yannick Müller. Zu Beginn haben<br />
wir uns recht oberflächlich unterhalten,<br />
aber mit jedem weiteren Chat<br />
haben wir an Boden und Vertrauen<br />
gewonnen, so dass wir von sozialen<br />
zu politischen Themen und von allgemeinen<br />
Informationen auch zu mehr<br />
persönlichen Fragen gelangten. Wir<br />
haben die Situation in Simbabwe mit<br />
<strong>der</strong> in Deutschland verglichen und haben<br />
viele Unterschiede in <strong>der</strong> Art und<br />
Weise entdeckt, wie unsere Län<strong>der</strong><br />
politisch geführt werden. Wir haben<br />
uns auch darüber unterhalten, was die<br />
Menschen in Deutschland über Simbabwe<br />
denken und fühlen, und wie wir<br />
in Simbabwe Europa sehen. Und trotz<br />
mancher technischer Verbindungsprobleme<br />
denke ich, dass ein starkes Band<br />
zwischen St. Peters und St. Blasien gewachsen<br />
ist. Durch solche Austauschprojekte<br />
zeigen wir Jugendlichen <strong>der</strong><br />
Welt, dass wir in <strong>der</strong> Lage sind, einan<strong>der</strong><br />
die Hände zu reichen, uns gegenseitig<br />
zu helfen und füreinan<strong>der</strong> einzustehen<br />
– egal woher wir kommen, wer<br />
wir sind und wo wir leben.<br />
Prince Munyaradzi Gaura<br />
St. Peters Kubatana High School<br />
Prince Munyaradzi Gaura<br />
wollte unbedingt mitmachen,<br />
um mehr über<br />
Europa und Deutschland<br />
zu erfahren.<br />
weltweit 29
Spen<strong>der</strong>aktion<br />
Was macht unser Patenkind<br />
Vor 45 Jahren startete die Pfarrgemeinde St. Ansgar in Hamburg Niendorf eine Initiative, um Kin<strong>der</strong>n<br />
in Indien den Schulbesuch zu ermöglichen. Ulrike Henn hat ehemalige Patenkin<strong>der</strong> getroffen.<br />
Was ist wohl aus den Kin<strong>der</strong>n<br />
geworden, die durch Patenschaften<br />
des 1968 in Hamburg<br />
gegründeten Pathardi-Vereins<br />
unterstützt wurden Über die<br />
<strong>Jesuitenmission</strong> entstand damals<br />
<strong>der</strong> Kontakt zur Missionsstation<br />
Pathardi im indischen<br />
Bundesstaat Maharashtra. Der<br />
Beitrag von 65 Cent pro Tag<br />
geht direkt an die Schulen und<br />
Internate, die von Jesuitenpatres<br />
o<strong>der</strong> Ordensschwestern geleitet<br />
werden. Von ihnen kommen die<br />
Informationen über die Patenkin<strong>der</strong><br />
und nur über sie läuft <strong>der</strong><br />
Kontakt zu den Kin<strong>der</strong>n. Zurzeit<br />
unterstützt <strong>der</strong> Verein rund<br />
200 Kin<strong>der</strong>, davon 130 über direkte<br />
Patenschaften.<br />
Lebensfreude im Orden<br />
Im Vorfeld bitte ich die zuständigen<br />
Ordensschwestern<br />
und Jesuiten um ein Treffen<br />
mit ehemaligen Schülerinnen<br />
und Schülern. Die Resonanz<br />
ist groß: rund 20 ehemaligen<br />
Patenkin<strong>der</strong>n begegne ich auf<br />
meiner Reise. „Mir war sofort<br />
klar, dass ich kommen würde.<br />
Ich verdanke meinem Paten so<br />
viel“, erzählt Schwester Rita<br />
D’Souza, heute Lehrerin an einer<br />
Ordensschule. Wie sie sind<br />
eine ganze Reihe unserer ehemaligen<br />
Patenmädchen in den<br />
Orden eingetreten. Die jungen<br />
Frauen erzählen, dass ihnen<br />
während ihrer Schulzeit <strong>der</strong><br />
starke Glaube, das herzliche<br />
Zusammenleben und die soziale<br />
Verantwortung <strong>der</strong> Schwestern<br />
imponiert haben. <strong>Das</strong>s<br />
auch die Lebensfreude nicht<br />
zu kurz kommt, zeigt sich an<br />
diesem Abend. Es wird gesungen,<br />
erzählt und herzlich über<br />
lustige Vorkommnisse aus <strong>der</strong><br />
Schulzeit gelacht.<br />
Kin<strong>der</strong> von Wan<strong>der</strong>arbeitern<br />
Auf dem Weg nach Ajra zur<br />
Jesuitenschule fahren wir über<br />
enge Bergstraßen, durch kleine<br />
Dörfer, vorbei an provisorisch<br />
errichteten Zelten <strong>der</strong> Wan<strong>der</strong>arbeiter.<br />
Viele Eltern unserer<br />
Patenkin<strong>der</strong> arbeiten als Saisonarbeiter<br />
auf den Zuckerrohrfel<strong>der</strong>n.<br />
Ohne die Hilfe von Paten,<br />
die Schulgebühren und Internatskosten<br />
übernehmen, hätten<br />
ihre Kin<strong>der</strong> nie die Möglichkeit,<br />
eine Schule zu besuchen.<br />
Sieben junge Frauen in Ajra voller Lebensfreude, Zukunftspläne und Dankbarkeit.<br />
Grüße nach Deutschland<br />
In Ajra treffe ich sieben ehemalige<br />
Patenmädchen. Sie sprühen<br />
vor Lebensfreude und erzählen<br />
begeistert von ihren Zukunftsplänen.<br />
Zwei <strong>der</strong> jungen Frauen<br />
machen eine Ausbildung<br />
zur Krankenschwester. Avelyn<br />
D’Souza arbeitet bereits in einem<br />
Krankenhaus in Mumbai.<br />
Drei ihrer Freundinnen haben<br />
Lehramtsstudiengänge in<br />
30 weltweit
Spen<strong>der</strong>aktion<br />
Computertechnik, Psychologie<br />
o<strong>der</strong> Kunst belegt. Supriya Julius<br />
D`Souza studiert Chemie<br />
und hat sehr gute Chancen, ein<br />
Stipendium für die USA zu bekommen.<br />
Alle sprechen perfekt<br />
Englisch, beste Voraussetzung,<br />
um in jedem indischen Bundesstaat<br />
arbeiten zu können. Die<br />
jungen Frauen bekunden, dass<br />
sie großes Glück hatten. Sie<br />
stammen aus Dorffamilien, die<br />
ihren Töchtern einen Schulbesuch<br />
finanziell nicht hätten ermöglichen<br />
können. Fast alle erinnern<br />
sich an die Namen ihrer<br />
Patenfamilien in Deutschland<br />
und tragen mir Grüße auf. „Wir<br />
sind uns sehr bewusst, dass wir<br />
eine für indische Mädchen unserer<br />
Schicht privilegierte Ausgangsposition<br />
haben“, erklärt<br />
Winifred. Es scheint, als fühlten<br />
sich die fröhlichen, selbstbewussten<br />
jungen Frauen aus<br />
diesem Grund beson<strong>der</strong>s angespornt,<br />
ihren Weg erfolgreich<br />
zu meistern.<br />
Medaille im Gewichtheben<br />
Die Freude ist groß, als ich in<br />
<strong>der</strong> Missionsstation Pathardi<br />
ankomme. Mit Pater Denis Borges<br />
treffe ich sechs ehemalige<br />
Schüler. Herr Pagare ist heute<br />
Englischlehrer. Sachin Balid<br />
gewann die Silbermedaille des<br />
Bundesstaates Maharashtra im<br />
Gewichtheben und verdient sich<br />
als Nachtportier Geld, um aufs<br />
College zu gehen. Er will Polizist<br />
werden. Beson<strong>der</strong>s berührt hat<br />
mich <strong>der</strong> Besuch bei Bhagwan<br />
Malhari Randhave, <strong>der</strong> nach<br />
<strong>Das</strong> ehemalige Patenkind Sachin Balid aus Pathardi ist stolz auf sportliche Erfolge.<br />
seiner Schulzeit im Technical<br />
College <strong>der</strong> Jesuiten in Pune<br />
zum Automechaniker ausgebildet<br />
wurde. Heute repariert er<br />
Regierungsautos und lebt mit<br />
seiner Familie und seiner Mutter<br />
im kleinen Dorf Agaskhand.<br />
Er erzählt so begeistert und anschaulich<br />
von seinen Erlebnissen<br />
im Internat, dass man meint, er<br />
hätte das alles erst gestern erlebt.<br />
Aus Dankbarkeit hat er einen<br />
gusseisernen Kreuzweg für die<br />
Kapelle in Pathardi geschmiedet.<br />
Anils Zukunftstraum<br />
Weiter geht es nach Belgaum<br />
zur St. Paul’s High School<br />
<strong>der</strong> Jesuiten. Ich erfahre, dass<br />
viele unserer ehemaligen Patenkin<strong>der</strong><br />
in den indischen<br />
Wirtschaftszentren arbeiten<br />
und zwei in die USA und nach<br />
Australien ausgewan<strong>der</strong>t sind.<br />
Hier im Internat treffe ich auch<br />
mein Patenkind Anil. Seit elf<br />
Jahren begleitet meine Familie<br />
den Jungen. Anil erzählt, dass er<br />
aus einem kleinen Dorf stammt<br />
und seine Eltern Blumen an<br />
<strong>der</strong> Straße verkaufen. Ich sehe<br />
Anil an, wie sehr er seine Eltern<br />
liebt und ihnen dankbar ist. Er<br />
durfte ins Internat gehen und<br />
musste nicht wie viele an<strong>der</strong>e<br />
Kin<strong>der</strong> arbeiten, um die große<br />
Familie zu unterstützen. Welchen<br />
beruflichen Weg will er<br />
nach seinem Abschluss nächstes<br />
Jahr einschlagen Noch ist er<br />
sich nicht sicher, aber er freut<br />
sich auf die Besinnungswoche<br />
mit seiner Klasse, bei <strong>der</strong> es<br />
auch um Zukunftsträume geht.<br />
„Vielleicht werde ich Jesuit“,<br />
sagt Anil leise.<br />
Ulrike C. Henn<br />
2. Vorsitzende Pathardi e.V.<br />
Mehr Informationen:<br />
www.patenkin<strong>der</strong>-pathardi.de<br />
weltweit 31
Nachrichten<br />
Filmtipp: Soegija<br />
Eine Kino-Produktion indonesischer Jesuiten<br />
Nein. Ein Blockbuster ist es nicht – zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Zu<br />
wenig Dramatik, zu viele verschiedene Sprachen: indonesisch, japanisch, englisch,<br />
holländisch und lateinisch. Um die Handlung zu verstehen, muss man die<br />
Geschichte Indonesiens in den Jahren vor <strong>der</strong> Unabhängigkeit kennen.<br />
Die DVD mit englischen<br />
Untertiteln schicken wir<br />
Interessierten gerne zu:<br />
prokur@jesuitenmission.de<br />
o<strong>der</strong> (0911) 2346-160.<br />
In Indonesien sind die Menschen trotzdem in die Kinos geströmt, um diesen Film<br />
zu sehen, <strong>der</strong> vom Studio Audio Visual Puskat <strong>der</strong> indonesischen Jesuiten produziert<br />
wurde. Er handelt von dem indonesischen Jesuiten und ersten einheimischen<br />
Bischof Albertus Magnus Soegijaparanata SJ („Soegija“). Drei Tage nach seinem<br />
Tod im Jahre 1963 wurde er zum „Nationalen Held“ Indonesiens erklärt.<br />
Der Film handelt von <strong>der</strong> Besetzung Indonesiens durch japanische Truppen<br />
und <strong>der</strong>en Vertreibung, vom holländischen Kolonialismus bis hin zur Unabhängigkeit.<br />
Einzelne Schicksale und Charaktere werden dem Zuschauer in ästhetischen<br />
Bil<strong>der</strong>n nahegebracht. Nationalismus, Humanismus und Glaube sind<br />
die Themen, die durch die Figur Soegijas im Mittelpunkt stehen. Der Film<br />
propagiert Toleranz und Frieden im multikulturellen Indonesien, ein Thema,<br />
das auch heute brennend aktuell ist.<br />
Im Heimatdorf Bowallno<br />
Gedenkfeier zum 35. Todestag von Br. Bernhard Lisson SJ<br />
Ein 35. Jahrestag ist gewöhnlich kein großes Ereignis. An<strong>der</strong>s jedoch im polnischen<br />
Ort Bowallno, <strong>der</strong> jetzt erstmals seines hier am 21. August 1909 geborenen<br />
großen Sohnes Bernhard Lisson gedachte. Er und P. Gregor Richert SJ<br />
starben in ihrem Einsatz für die Mission durch die Kugeln eines Todesschützen<br />
am 27. Juni 1978 in Makonde, Simbabwe.<br />
Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes unter Leitung von Bischof Andreas<br />
Czaja von Opole wurde ihm zu Ehren eine Gedenktafel vor <strong>der</strong> Kirche enthüllt.<br />
In seiner Predigt wies <strong>der</strong> Bischof auf die sinnlose Gewalt hin, die Menschen guten<br />
Willens dahinrafft. Überraschend war seine Empfehlung, nicht nur für Bru<strong>der</strong><br />
Lisson zu beten, son<strong>der</strong>n auch ihn selbst im Gebet um Unterstützung für<br />
eigene Anliegen zu bitten. Beson<strong>der</strong>e Gnadenerweise sollten dem Ortspfarrer<br />
mitgeteilt werden. Diese Feier hat ohne Zweifel dem Leben in <strong>der</strong> Pfarrei neue<br />
Impulse gegeben. Bru<strong>der</strong> Lissons Leitsatz: „Weil ich nichts habe, um es Jesus zu<br />
geben, habe ich ihm mich selbst gegeben“ hat die Gläubigen tief berührt.<br />
P. Wolfgang Thamm SJ<br />
32 weltweit
Rückblick<br />
Vor 40 Jahren in Indien<br />
Pater Prabhudar aus Goa erinnert sich an seine Schulzeit<br />
Als ich drei Jahre alt war, zog <strong>der</strong> erste Missionar zu uns auf das Land. Er eröffnete<br />
auch bei uns im Dorf eine Schule. Zunächst steckte mich mein Vater in die öffentliche<br />
Marathi-Schule, die er selbst besucht hatte. Nach einer Schlägerei kam ich einmal<br />
blutüberströmt nach Hause. Kurzerhand packte mich mein Vater und brachte<br />
mich zur Missionsschule. Ich war in <strong>der</strong> dritten Klasse. Es war April, die Zeit zum<br />
Reis säen. Wir hatten keine Zeit, um in die Schule zu gehen, denn wir mussten<br />
die Kühe hüten. Eines Abends, als ich die Rin<strong>der</strong> festmachte, stieß mir eine Kuh<br />
das linke Auge aus. In <strong>der</strong> vierten Klasse waren wir ganze fünf Schüler. Vier davon<br />
blieben am Ende sitzen. Ich hatte zwar die Klasse bestanden, aber wer sollte schon<br />
eines einzigen Schülers wegen eine neue 5. Klasse einrichten Also musste auch ich<br />
wie<strong>der</strong>holen. Als dann meine vier Volksschulkameraden ebenfalls den Abschluss geschafft<br />
hatten, gingen wir gemeinsam auf die höhere Schule in Belgaum.<br />
Aus drei <strong>Magazin</strong>en ist<br />
weltweit entstanden:<br />
missio, Herbst 1977<br />
Vor 30 Jahren in Simbabwe<br />
Pater Weichsel erzählt von einem Ausflug am freien Montag<br />
Also, was macht man am freien Montag in Marymount Vielleicht eine Wan<strong>der</strong>ung<br />
an den Mazowe-Fluss Dort sind einige Frauen bei <strong>der</strong> Arbeit. Sie<br />
kommen uns zu begrüßen, zusammen mit einer Menge kleiner Kin<strong>der</strong>. Dies<br />
sind die Goldwäscherinnen vom Mazowe. Im Flusssand sind bis ein Meter<br />
tiefe Löcher, wo <strong>der</strong> Sand zum Waschen herausgegraben wird. In klobigen hölzernen<br />
Schüsseln wird dann <strong>der</strong> Sand in <strong>der</strong> Strömung hin- und hergeschüttelt,<br />
bis – wenn man Glück hat – nur noch winzige glitzernde Plättchen übrigbleiben:<br />
das Gold. Der Verdienst ist mager. Nein, leben könne man davon nicht.<br />
Sambesi, Nr. 45, 1987<br />
Vor 50 Jahren in Japan<br />
Pater Cieslik berichtet über den wan<strong>der</strong>nden Pater Schurhammer<br />
P. Schurhammer (75 Jahre) ist nicht zufrieden mit blasser Bücherweisheit. Er<br />
studierte die alten Landkarten und Reisebeschreibungen Europas, und mit dem<br />
Rucksack auf dem Rücken durchwan<strong>der</strong>te er alle Straßen und Wege, die einst<br />
<strong>der</strong> hl. Franz Xaver gegangen war. Ein gleiches tat er unter <strong>der</strong> glühenden Sonne<br />
Indiens. Im Januar 1957 weilte er in Japan. Auch hier wollte er zu Fuß alle Wege<br />
durchwan<strong>der</strong>n, und ich (43 Jahre) sollte ihm in Kyushu Führer und Dolmetscher<br />
sein. Ich sagte ihm klar, dass dieser Plan in einer Woche nicht durchzuführen sei.<br />
Er sah mich etwas misstrauisch an und gab schließlich nach: „Ja, wenn Sie sich<br />
dazu zu schwach fühlen, werden wir eben mit <strong>der</strong> Bahn fahren.“.<br />
Aus dem Lande <strong>der</strong> aufgehenden<br />
Sonne, Nr. 70, 1967<br />
weltweit 33
Weltweite Post<br />
Ein wahrer Gottsucher<br />
Selten hat mich ein Beitrag so sehr bewegt, wie <strong>der</strong> von Fouad Nakhla in weltweit<br />
Ostern 2013. Unverkennbar begegnet mir da in Fouad ein wahrer Gottsucher –<br />
ohne fertige Antworten auf die mör<strong>der</strong>ische Wirklichkeit, die ihn umgibt, mitten<br />
im tödlichen Syrien. Und dennoch – er begegnet Gott mitten in aller Unwahrscheinlichkeit.<br />
Wahre ignatianische Theologie, Spiritualität. Wie kann ich mich<br />
von Fouad im satten, befriedeten Deutschland anstecken lassen Jedenfalls, Dank<br />
an Fouad – wahnsinnig!<br />
Klaus Beurle, Würzburg<br />
Wie<strong>der</strong> in die Heimat aufgebrochen<br />
Ein lehrreiches, frustrierendes, herausfor<strong>der</strong>ndes, schweißtreibendes, buntes,<br />
karges, trauriges, schönes, abenteuerliches und starkes Jahr neigt sich dem Ende<br />
zu. Ich bin wie<strong>der</strong> in die Heimat aufgebrochen. Ich habe Freunde und Familie<br />
in Simbabwe gefunden und diese zurückgelassen. Ich spüre große Freude und<br />
Dankbarkeit in mir über so viele kostbare Erfahrungen und Begegnungen, über<br />
gemeinsames Lachen und ergreifende Gespräche. Und es ist auch wie<strong>der</strong> schön,<br />
heimkommen zu können und eine Passbesitzerin zu sein, die zu ihrer Familie und<br />
zu ihren Freunden gehen kann.<br />
Magdalena, Jesuit Volunteer in Makumbi/Simbabwe<br />
Winter in Argentinien<br />
Tagsüber haben wir unseren Heizofen für den Aufenthaltsraum ausgepackt. Man<br />
kann es sich in etwa so vorstellen, als ob man bei uns in einem Rohbau sitzt. Die<br />
Wände sind nicht isoliert, die Wellbleche dienen als Dächer, wobei man durch<br />
einige Lücken des Zements gucken kann. Über Tag hockt man sich einfach zusammen<br />
in den Raum des Hauses, <strong>der</strong> am wärmsten ist, o<strong>der</strong> kuschelt sich in das<br />
Bett, denn Sofas gibt es keine, und genießt einen deftigen „locro“, einen hausgemachten<br />
Eintopf. Die Menschen, die in den Holzhäusern und auf Lehmboden<br />
leben, haben es weitaus unkomfortabler. Sie heizen oft mit Kohle, die sie einfach<br />
auf dem Boden ausbreiten und nicht selten ist einer an den Dämpfen in <strong>der</strong> Nacht<br />
gestorben o<strong>der</strong> das Haus hat sich entzündet.<br />
Sheila, Jesuit Volunteer in Orán/Argentinien<br />
Schön, dass es Euch gibt!<br />
Vielen Dank für das ausgezeichnet gestaltete Sommer-<strong>Magazin</strong> 2013. Mein Alter<br />
erlaubt mir kein beson<strong>der</strong>s intensives Lesen mehr, über dieses Heft habe ich mich<br />
aber sehr gefreut; eigentlich über die Arbeit <strong>der</strong> Jesuiten und all ihrer Helferinnen<br />
und Helfer in <strong>der</strong> ganzen Welt. Schön, dass es Euch gibt, das ist Kirche auf ganz<br />
erfreuliche Weise.<br />
Gilbert Niggl (Pfr. i.R.), München<br />
34 weltweit
Impressum<br />
Herausgeber: Klaus Väthrö<strong>der</strong> SJ<br />
Redaktion: Judith Behnen<br />
Gestaltung: Katja Pelzner, dialog<br />
Druck auf zertifiziertem Papier aus nachhaltiger<br />
Forstwirtschaft: EOS St. Ottilien<br />
ISSN 1860-1057, erscheint vierteljährlich<br />
Ausgabe: 3/2013 – Herbst<br />
weltweit – die <strong>Jesuitenmission</strong><br />
Überall auf <strong>der</strong> Welt leben Jesuiten mit den Armen,<br />
teilen ihre Not, setzen sich für Gerechtigkeit und<br />
Glaube ein. Über dieses weltweite Netzwerk för<strong>der</strong>t<br />
die <strong>Jesuitenmission</strong> dank Ihrer Spenden rund 600<br />
Projekte in mehr als 50 Län<strong>der</strong>n. Sie leistet Unterstützung<br />
in den Bereichen Armutsbekämpfung,<br />
Flüchtlingshilfe, Bildung, Gesundheit, Ökologie,<br />
Menschenrechte und Pastoralarbeit.<br />
weltweit – das <strong>Magazin</strong><br />
gibt viermal im Jahr einen Einblick in das Leben und<br />
die Arbeit unserer Missionare, Partner und Freiwilligen.<br />
✂<br />
Ja, schicken Sie mir weltweit – das <strong>Magazin</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Jesuitenmission</strong> ab <strong>der</strong> nächsten Ausgabe<br />
bitte kostenlos zu. (Für neue Abonnenten)<br />
Bildnachweise:<br />
Balleis SJ/JRS (Titel,S.4-9), Noack (S.2), Childaid Network<br />
(S.10), NESRC (S.10-13,Rücktitel), Rigl (S.14-17),<br />
En<strong>der</strong> (S.18-19: Mädchen im Lager in Canaa bei Port<br />
au Prince/Haiti, S.27-29), Sophia-Universität (S.20-21),<br />
Kiyota (S.21), Daniel SJ (S.22-25), Oliver SJ (S.26),<br />
Henn (S.30-31), Archiv (S.32), JRS Middle East (S.34),<br />
Lauer (S.35)<br />
Karten: Fischer Weltalmanach (S.4,S.14)<br />
Leserbriefe bitte an:<br />
Redaktion weltweit<br />
Königstraße 64, 90402 Nürnberg<br />
Tel. (0911) 23 46-160, Fax -161<br />
weltweit@jesuitenmission.de<br />
www.jesuitenmission.de<br />
Spendenkonto: 5 115 582<br />
Liga Bank, BLZ 750 903 00<br />
IBAN: DE61 7509 0300 0005 1155 82<br />
SWIFT: GENO DEF1 M05<br />
Name, Vorname<br />
Straße, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
E-Mail (falls vorhanden)<br />
Antwort<br />
An die<br />
<strong>Jesuitenmission</strong><br />
Redaktion weltweit<br />
Königstraße 64<br />
90402 Nürnberg<br />
Geburtsdatum (freiwillige Angabe)<br />
weltweit 35
Danke für Ihre Unterstützung!<br />
jesuitenmission.de<br />
Königstr. 64 • 90402 Nürnberg<br />
Telefon: (0911) 2346-160<br />
E-Mail: prokur@jesuitenmission.de<br />
Spendenkonto 5 115 582<br />
Liga Bank • BLZ 750 903 00