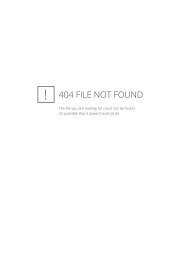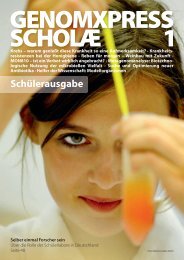NL 3_05.qxd - GenomXPress
NL 3_05.qxd - GenomXPress
NL 3_05.qxd - GenomXPress
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12 Forschung<br />
epigenetische Mechanismen erklärbar. Fötale Entwicklung und<br />
Wachstum lassen sich als ein gewebespezifisches, koordiniertes<br />
An- und Abschalten relevanter Gene verstehen. Eine fötale Entwicklungsstörung<br />
ist demnach die Folge eines unzeitgemäßen<br />
An- oder Abschaltens bestimmter für die Bildung entsprechender<br />
Gewebestrukturen oder physiologischer Systeme notwendiger<br />
Gene. Die Steuerung der Genexpression durch epigenetische<br />
Mechanismen beinhaltet die chemische Modifikation des Erbguts<br />
ohne jedoch seine festgelegte Nukleotidsequenz, die Kodierung,<br />
zu ändern. Dies kann geschehen durch Modifizierung von Zellkernproteinen<br />
(Histonen) oder durch DNA-Methylierung/Demethylierung<br />
in Promotorregionen. Letztere sorgen durch Bindung<br />
geeigneter Transkriptionsfaktoren für die gewebespezifische<br />
Expression eines Gens.<br />
Unmethylierte DNA kann von DNA-Polymerasen direkt in RNA<br />
abgeschrieben werden, was zur Expression des Gens führt. Ist DNA<br />
methyliert, ist das Abschreiben in RNA erschwert oder nicht möglich,<br />
was zu verminderter Expression oder zum Abschalten eines<br />
Gens führt. Durch z.B. verringerte Verfügbarkeit von Methylgruppen<br />
(z.B. bei Proteinmangel) kommt es zur Hypomethylierung der<br />
DNA, die sich im Laufe weiterer Zellteilungen verstärkt und manifestiert.<br />
Dies führt z.B. in den Leberzellen zum unzeitgemäßen<br />
Anschalten des Glucocorticoid-Rezeptors und in dessen Folge zur<br />
Stimulation der Gluconeogenese und einer erhöhten basalen Glucosekonzentration<br />
im Blut. Da das Muster der DNA-Methylierung<br />
und Histonmodifikation an neue Generationen von Zellen weitergegeben<br />
wird, können solche fötal initiierten, epigenetischen<br />
Veränderungen auch nach der Geburt weiter bestehen bleiben<br />
und so zu Veränderungen von physiologischen Funktionen oder<br />
Strukturen führen, lange Zeit nach dem Einwirken des ursprünglichen<br />
Stimulus oder Störfaktors.<br />
Abb. 2: Relative Expressionsstärke (rot =<br />
herab-, blau = herauf reguliert) von regulierten<br />
Genen (Zeilen) bei den untersuchten<br />
Nachkommen (Spalten) von Sauen<br />
(neugeborene Ferkel) die Futterrationen<br />
mit 12% (Kontrolle), 30% (Hochprotein),<br />
oder 6% (Niedrigprotein) erhielten.<br />
Zielsetzung von FEPROeXPRESS<br />
In der Modellstudie FEPROeXPRESS untersuchen Arbeitsgruppen<br />
aus dem Forschungsinstitut für die Biologie Landwirtschaftlicher<br />
Nutztiere (FBN) in Dummerstorf und der Rheinischen Friedrich-<br />
Wilhelms-Universität in Bonn welche molekularen und epigenetischen<br />
Adaptationsmechanismen der während des fötalen Lebens<br />
ernährungsabhängig initiierten, postnatalen Merkmalsausprägung<br />
beim Schwein zugrunde liegen.<br />
In dem Vorhaben wird bei graviden Jungsauen die Wirkung<br />
von drei Futterrationen mit Proteingehalten von 6, 12, oder 30 %<br />
auf Produktivitätsmerkmale der Nachkommen untersucht. Dazu<br />
Abb. 3: Proteine in der Leber (100-10 kDa; pH 3-10) von neugeborenen Ferkeln mit<br />
geringem (1 kg; grün markiert) oder hohem Geburtsgewicht (1.6 kg; rot markiert).<br />
Gelb markierte Proteine sind in beiden Geburtsgewichtsgruppen gleich stark exprimiert.<br />
Die Tiere sind Nachkommen einer Sau, die Kontrolldiät erhielt. (Foto: Dr. B.<br />
Kuhla, FBN Dummerstorf)<br />
GENOMXPRESS 1.09