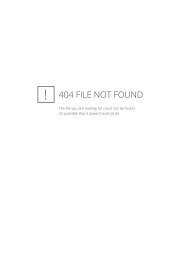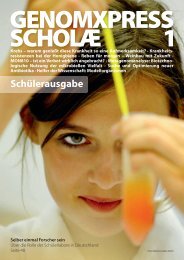NL 3_05.qxd - GenomXPress
NL 3_05.qxd - GenomXPress
NL 3_05.qxd - GenomXPress
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
46 Wissenschaft kompakt<br />
Wissenschaft kompakt<br />
Auf dem Weg zum<br />
Proteindesign<br />
Proteine besitzen eine komplexe dreidimensionale Struktur, die<br />
von ihrer Sequenz, das heißt der Aneinanderreihung einer<br />
bestimmten Abfolge von Aminosäuren, bestimmt wird. Die Proteinoberfläche<br />
bestimmt wesentlich die Wechselwirkungen von<br />
Proteinen untereinander – essentiell für die Funktion der Zelle,<br />
aber auch für die Entwicklung von Krankheiten. Für das Design<br />
von Proteinen und Wirkstoffen ist es wichtig zu wissen, wie stark<br />
die einzelnen Aminosäuren die Bindungsstärke innerhalb eines<br />
Komplexes aus verschiedenen Proteinen beeinflussen. Diese<br />
Kenntnisse können in begrenztem Umfang aus teuren Experimenten<br />
gewonnen werden, indem einzelne Aminosäuren ausgetauscht<br />
werden und die Änderung der Bindungsstärke durch diese<br />
Mutation gemessen wird. Auch verlässliche theoretische Vorhersagen<br />
waren bisher sehr zeitintensiv und damit in vielen Fällen<br />
kaum anwendbar. Ein internationales Team von Wissenschaftlern<br />
hat nun eine neue Computer-gestützte Methode entwickelt,<br />
welche die Vorhersage bei vergleichbarer Qualität etwa<br />
um den Faktor einhundert beschleunigt und daher ausgedehnte<br />
Untersuchungen erlaubt. Ihre Stärke: Bei den Berechnungen<br />
wird die innere Flexibilität der Proteinstrukturen effizient berücksichtigt<br />
und mit einer speziellen Funktion kombiniert, welche die<br />
physikalischen Kräfte zwischen den Atomen der Proteine beinhaltet.<br />
Mit ihrer Hilfe kann die Stabilität von Proteinen und Proteinkomplexen<br />
sehr schnell und präzise bestimmt werden. In<br />
einer ersten Machbarkeitsstudie wurde die Oberfläche des Hormons<br />
Insulin analysiert auf der Suche nach Mutationen, welche<br />
die Bindungskräfte innerhalb des Protein-Komplexes abschwächen.<br />
Der Grund: Insulin kann nur als isoliertes Protein den Blutzuckerspiegel<br />
senken. Bei hohen Insulinkonzentrationen, wie sie<br />
bei der Behandlung von Diabetes mellitus-Patienten verwendet<br />
werden, bilden die Insulin-Moleküle aber Komplexe, die den<br />
Wirkmechanismus des Hormons verzögern. Einige in der Praxis<br />
verwendete Insulin-Mutanten verhindern die Komplexbildung<br />
und können somit sehr schnell den Blutzuckerspiegel senken.<br />
Diese so genannten schnellen Insulin-Analoga konnten korrekt<br />
mit der neu entwickelten Methode reproduziert werden, neue<br />
eventuell verbesserte Insulin-Mutanten wurden entwickelt.<br />
Originalpublikation: Benedix, A et al. (2009) Predicting Free<br />
Energy Changes Using Structural Ensembles. Nature Methods 6,<br />
3-4. doi:10.1038/nmeth0109-3<br />
Insektenbekämpfung<br />
mit Genschalter<br />
Gängige Programme zur Schädlingsbekämpfung ohne Pestizideinsatz<br />
basieren auf der Sterilen-Insekten-Technik (SIT). Dabei<br />
werden große Mengen von sterilisierten Insekten freigesetzt, die<br />
aufgrund unfruchtbarer Paarungen die Schädlingspopulation<br />
der nächsten Generation reduziert. Diese reproduktive Sterilität<br />
wird durch Bestrahlung erzeugt, die jedoch die "Fitness" der SIT-<br />
Insekten vermindert. Ein internationales Forscherteam ist nun<br />
einen anderen Weg gegangen. Sie arbeiteten an der Mittelmeerfruchtfliege<br />
Ceratitis capitata, einem bedeutenden Agrarschädling<br />
des Obst- und Gemüseanbaus in wärmeren Regionen. Den<br />
Wissenschaftlern gelang es, in das Insekt ein Gen mit letaler Wirkung<br />
einzuschleusen. Es führt dazu, dass die nächste Insektengeneration<br />
noch während der Embryonalentwicklung abstirbt und<br />
damit gar nicht erst das gefräßige und fruchtzerfressende Larvenstadium<br />
erreicht. Das von ihnen eingeschleuste Letalitätsgen<br />
wird durch einen Genschalter reguliert. Während der Zucht<br />
bleibt das "tödliche" Gen mithilfe eines Nahrungszusatzes abgeschaltet;<br />
nach dem Freisetzen der männlichen Insekten wird es<br />
aktiviert und führt zu einem frühen Absterben der unmittelbaren<br />
Nachkommen. Die Wissenschaftler haben den Schädling zudem<br />
mit Markierungsgenen ausgestattet, um bei einer Kontrolle der<br />
freigesetzten Individuen auf eine Markierung mit floureszierenden<br />
Stäuben verzichten zu können. Zwar werden transgene<br />
Insekten bislang lediglich in Versuchsansätzen für die Schädlingsbekämpfung<br />
getestet, langfristig biete das Verfahren jedoch<br />
die Möglichkeit, Umweltbelastungen herkömmlicher Kontrollprogramme<br />
zu verringern, so die Forscher. Dass die biotechnologisch<br />
veränderten Schadinsekten außerhalb der Zucht nicht<br />
überleben könnten, stelle dabei ein besonderes Sicherheitsmerkmal<br />
dar. Um jedoch erste Feldstudien durchführen zu können,<br />
müssten genaue Regularien und Rahmenbedingungen definiert<br />
werden.<br />
Originalpublikation: Schetelig, MF et al. (2009) Conditional<br />
embryonic lethality to improve the sterile insect technique in<br />
Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae), BMC Biology 7:4<br />
doi:10.1186/1741-7007-7-4<br />
Neue Gendefekte bei<br />
Schuppenflechte entdeckt<br />
In Deutschland sind etwa 1,6 Mio Menschen von Schuppenflechte<br />
(Psoriasis) betroffen. Schuppenflechte ist zu einem großen<br />
Anteil erblich bedingt, kann aber durch verschiedene Umweltfaktoren<br />
ausgelöst werden, wie beispielsweise Infektionen, psychischen<br />
Stress oder Medikamente. In den meisten Fällen (70 bis<br />
80 Prozent) ist nur die Haut befallen, die Krankheit kann sich aber<br />
auch auf die Gelenke und Nägel ausbreiten. Klassisch wird in<br />
schwächeren Fällen mit Licht oder Salben therapiert. In schweren<br />
Fällen der Psoriasis helfen nur Medikamente, die oft das Immunsystem<br />
zu weiten Teilen stilllegen, wie beispielsweise Cortison.<br />
Erst die genaue Kenntnis der Krankheitsvorgänge macht die Entwicklung<br />
von Medikamenten möglich, die das Immunsystem<br />
weniger schwächen und damit weniger Nebenwirkungen entfalten.<br />
Doch die Entzündungsregulierung im menschlichen Körper<br />
GENOMXPRESS 1.09