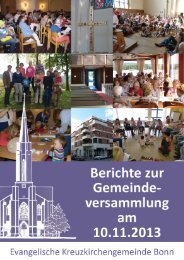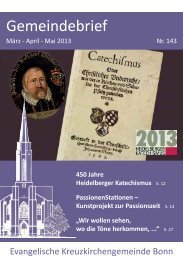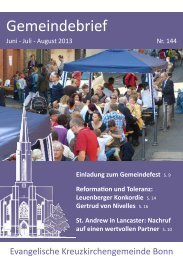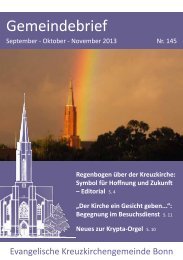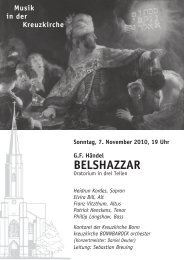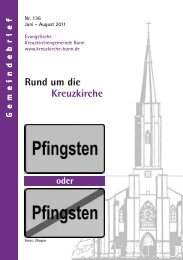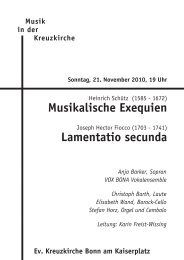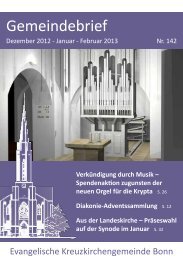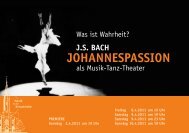Denkmaltag 2013_Broschuere.indd - Baukultur Bonn
Denkmaltag 2013_Broschuere.indd - Baukultur Bonn
Denkmaltag 2013_Broschuere.indd - Baukultur Bonn
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ermekeilkaserne<br />
geöffnet von 11 bis 17 Uhr<br />
Anatomisches Institut<br />
um 10, 11, 12 und 13 Uhr<br />
Privathaus in<br />
der Weststadt<br />
von 14 bis 17 Uhr<br />
Kaufmannstraße 65<br />
53115 <strong>Bonn</strong>-Weststadt<br />
Führungen:<br />
Um 14 und um 16 Uhr durch<br />
die Besitzer<br />
Das Wohnhaus aus dem Jahr<br />
1903 bietet eine außergewöhnliche<br />
Begegnung von Historismus<br />
und moderner Architektur. Alle<br />
historischen Elemente wie Marmor-Entree,<br />
Stuckdecken, Parkett-<br />
und Dielenböden, verzierte<br />
Holztüren und Eichenholz-Treppenhaus<br />
wurden behutsam saniert.<br />
Farbige Wand- und Bodenflächen,<br />
eigens angefertigte<br />
Möbel und Einbauten, eine innovative<br />
Lichtgestaltung, moderne<br />
Bäder, hochwertige Materialien<br />
sowie eine klare und konsequente<br />
Formensprache bringen die<br />
Ansprüche moderner Architektur<br />
in das denkmalgeschützte<br />
Gebäude.<br />
Die Ermekeilkaserne wurde 1880 bis 1883 errichtet. Die historistische<br />
Architektur zeigt sich, entsprechend ihrer Nutzung, sowohl repräsentativ<br />
als auch wehrhaft. Nach 1955 wurde sie Dienstsitz des ersten Verteidigungsministers<br />
der Bundesrepublik. Seit 1986 steht die Anlage unter<br />
Denkmalschutz. Der gesamte, etwa 24.000 qm große Gebäude- und<br />
Geländekomplex liegt an den Grenzen der seit der Gründerzeit mit der<br />
<strong>Bonn</strong>er Südstadt zusammengewachsenen Gemeinden Poppelsdorf und<br />
Kessenich. Im Rahmen der Bundeswehrreform wird das Gelände der Ermekeilkaserne<br />
ab <strong>2013</strong> einer zivilen Nutzung zugeführt und umgenutzt.<br />
Schumann-Haus<br />
um 12 Uhr<br />
Das Gebäude, in dem 1856 der<br />
Komponist Robert Schumann<br />
verstarb, hat eine wechselvolle,<br />
faszinierende (Bau-)Geschichte<br />
hinter sich. Der ursprüngliche<br />
Landsitz wurde zu dieser Zeit als<br />
psychiatrische Privatklinik genutzt.<br />
Später wurde das Gebäude<br />
Altenheim und schließlich Gedenkstätte,<br />
städtische Musikbibliothek<br />
und Konzertstätte, in der<br />
Klavier- und Kammermusik des<br />
Schumann-Kreises lebendig werden.<br />
1956 ist das Haus nur knapp<br />
dem Abriss entgangen.<br />
Führung:<br />
Um 12 Uhr durch<br />
Katrin Reinhold,<br />
Leiterin der Musikbibliothek<br />
im Schumannhaus<br />
Führungen:<br />
Um 11 und 14 Uhr durch<br />
Vetreter der Ermekeil Initiative<br />
Treffpunkt:<br />
Vorhof des Hauses 1<br />
Ermekeilstraße 32<br />
53115 <strong>Bonn</strong>-Südstadt<br />
www.ermekeilkaserne-zivil.de<br />
Sebastianstraße 12<br />
53115 <strong>Bonn</strong>-Endenich<br />
Nussallee 10<br />
53115 <strong>Bonn</strong>-Poppelsdorf<br />
Führungen:<br />
10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr (Dauer ca.<br />
45 Minuten), durch Architekt Dipl.-Ing. Andreas<br />
Flügge (S+G Architekten) und den Geschäftsführenden<br />
Direktor des Instituts Prof. Dr. Karl<br />
Schilling (zeitweise)<br />
Jüdischer Friedhof<br />
um 10.30 Uhr<br />
Heute von der städtischen Bebauung eingegrenzt,<br />
ist dieser Friedhof das letzte Zeugnis eines rheinischen<br />
Landjuden-Friedhofs des 19. Jahrhunderts<br />
in <strong>Bonn</strong>. Die Begräbnisstätte der Gemeinde, die<br />
Poppelsdorf, Endenich, Witterschlick etc. umfasste,<br />
erzählt die Geschichte von Viehhändlern, Metzgern,<br />
aber auch immer wieder von Auseinandersetzungen<br />
mit der Nachbarstadt <strong>Bonn</strong>.<br />
Hainstraße 76-78<br />
53121 <strong>Bonn</strong>-Endenich<br />
Führungen:<br />
Um 10.30 Uhr durch Leah Rauhut-Brungs, Verein<br />
für die Geschichte der Juden der Rheinlande e. V.<br />
HINWEIS: Herren werden gebeten, eine Kopfbedeckung<br />
zu tragen.<br />
Das Gebäude des Anatomischen Institutes, ein<br />
vierflügeliger Backsteinbau im Stil der Neurenaissance,<br />
wurde von 1869 bis 1872 nach Plänen des<br />
Universitätsarchitekten August Dieckhoff errichtet.<br />
Sein Nachfolger Jakob Neumann war für die<br />
Bauausführung und Bauleitung zuständig. Um<br />
1900 wurden stilistisch angepasste seitliche Anbauten<br />
hinzugefügt, von denen einer während des<br />
Zweiten Weltkrieges zerstört wurde. Von 1998 bis<br />
2001 fand eine umfangreiche Sanierung des Gebäudes<br />
statt. Ziel dieser Sanierung war es, das Gebäude<br />
in seinem ursprünglichen Erscheinungsbild<br />
zu erhalten und zeitgemäßes Arbeiten für die im<br />
Gebäude ansässigen Anatomischen Abteilungen<br />
der Universität zu ermöglichen. Im Treppenhaus<br />
sowie den angrenzenden Fluren wurde der Ursprungszustand<br />
wiederhergestellt. Auch die Fassade<br />
und der historische Hörsaal wurden einer umfassenden<br />
Sanierung unterzogen. Im Kontrast zur<br />
bestehenden historischen Substanz entstand eine<br />
neue Bibliothek in heutiger Architektursprache.<br />
Ausstellung historischer Präparate im Historischen<br />
Hörsaal im 1. Obergeschoss (zu Führungen).<br />
18 19