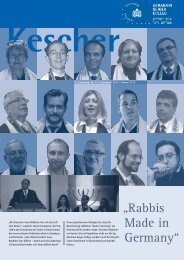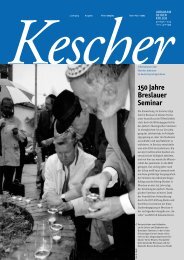Schana Tova - Abraham Geiger Kolleg
Schana Tova - Abraham Geiger Kolleg
Schana Tova - Abraham Geiger Kolleg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
wir davon aus, dass es sich mehr oder weniger<br />
so zugetragen hat. Wie reagierte der Mann? Er<br />
machte sich hierüber keine Sorgen und wollte<br />
nichts davon wissen. Da dieser Versuch der<br />
Frau erfolglos war, würde man ihr raten, ehe<br />
sie ihre Klage öffentlich bekannt machte, zu R.<br />
Me’ir zu gehen und ihm den Fall vorzutragen.<br />
Das Argument scheint überzeugend und<br />
angenommen sie geht diesen Weg und erzählt<br />
R. Me’ir ihre traurige Geschichte. Um ihr aber<br />
zu helfen, wozu er ja offenbar bereit ist, muss<br />
er den Namen des Mannes erfahren. Erst dann<br />
kann er ihm ins Gewissen reden und ihn zur<br />
Heirat oder zur Scheidung bewegen. Sie gibt<br />
den Namen des Mannes jedoch nicht preis. Sie<br />
will ihn nicht bloßstellen. Das ist wohl erwiesen,<br />
denn wäre dem nicht so, hätte sie seinen<br />
Namen auch im Lehrhaus bekannt gegeben.<br />
Der neuzeitliche Talmudkommentator Steinsalz<br />
meint, dass die Frau den Namen des Mannes gar<br />
nicht kannte. Er legt die Worte der Frau „Einer<br />
aus eurer Mitte hat mich durch Beiwohnung<br />
geehelicht“ folgendermaßen aus: „Das bedeutet:<br />
einer schlief mit mir und sagte mir, dass er<br />
dies zum Zwecke der Eheschließung tut, und<br />
ich weiß nicht, wer es war, und sie will dass er<br />
sie entweder heiratet oder sich scheiden lässt.“<br />
Diese Auslegung ist etwas weit hergeholt. Man<br />
wird bei einer üblichen Beweisführung kaum<br />
jemanden davon überzeugen können, dass<br />
eine Frau, die mit einem Mann geschlafen hat,<br />
nachdem er sie von seinen ehrlichen Absichten<br />
überzeugt hatte und sie in den Bund mittels<br />
eines Beischlafs einwilligte, nicht wissen soll,<br />
wer der Mann ist; darüber hinaus weiß sie, wo<br />
er zu finden ist, nämlich im Lehrhaus des R.<br />
Me’ir. Man kann also davon ausgehen, dass die<br />
Frau sehr wohl über die Identität des Mannes<br />
Bescheid wusste, sie diese aber weder R. Me’ir<br />
(sofern es ein privates Vorgespräch mit ihm gab)<br />
noch den Anwesenden im Lehrhaus gegenüber<br />
preiszugeben bereit war. Warum wohl?<br />
Die naheliegende Erklärung, um nicht zu sagen<br />
die sichere, da man bei der Auslegung solcher<br />
Sachverhalte immer nur nach der Wahrscheinlichkeit<br />
verfahren kann, ist die folgende: Die<br />
Frau hat sich dem Mann in ehrlicher Absicht<br />
hingegeben, um von ihm geehelicht zu werden.<br />
Sie ist bereit und willig, mit ihm eine Ehe zu<br />
führen, aber wenn er nicht dazu bereit ist, so<br />
will sie von ihm geschieden werden. Sie ist<br />
jedoch nicht bereit, seinen Namen bekannt<br />
zu geben. Sie respektiert trotz allem seine<br />
Privatsphäre, will ihm keine Schande bereiten<br />
und ihn nicht in der Öffentlichkeit unmöglich<br />
Vorschau auf Veranstaltungen des Orpheus Trust<br />
27. Oktober, 19.00 Uhr<br />
Festsaal der Österreichischen Nationalbank,<br />
Otto Wagner-Platz 3, 1090 Wien: Festakt 40<br />
Jahre Österreichisch-IsraelischeGesellschaft.<br />
Musikpro-gramm: Orpheus Trust in Kooperation<br />
mit dem Herbert von Karajan-Centrum<br />
machen. Offensichtlich hegt sie keinen<br />
Groll gegen ihn und hasst ihn auch nicht für<br />
das, was er ihr angetan hat, jedenfalls nicht<br />
dermaßen, dass sie ihn bloßstellen will. Wir<br />
haben es wahrscheinlich mit einer feinfühligen<br />
und altruistischen Frau zu tun, die großherzig<br />
genug ist, feindselige Gefühle (die eigentlich in<br />
diesem Zusammenhang zu erwarten wären) zu<br />
unterdrückten und einfach menschlich zu sein.<br />
Die Berichterstatter oder Autoren der Gemara<br />
gehen selbstverständlich davon aus, dass<br />
diese Geschichte ein nachahmenswertes altruistisches<br />
Verhalten des R. Me’ir dokumentiert<br />
und ordnen sie in eine Reihe von anderen Ereignissen<br />
ein, in denen es darum geht, seinen<br />
Nächsten vor der Beschämung, Beleidigung,<br />
Peinlichkeit und Erniedrigung zu bewahren, ihn<br />
möglichst vor solchen Situationen zu schützen.<br />
In der Tat ist dies eine Tugend, die in der<br />
Gemara an mehreren Stellen hervorgehoben<br />
wird. In diesem besonderen Fall scheint es<br />
doch eher so zu sein, dass die betrogene Frau<br />
diejenige war, die beispielhaft gehandelt hat.<br />
Von R. Me’ir kann man allenfalls sagen, dass er<br />
nicht anders handeln konnte. Mit dem Erscheinen<br />
der Frau im Lehrhaus und ihrer Aussage<br />
zufolge musste R. Me’ir klar geworden sein,<br />
dass die Frau den Namen des betreffenden<br />
Mannes nicht preisgeben würde (sonst hätte<br />
sie ihn gleich genannt). Also handelte R. Me’ir<br />
sehr klug und erreichte für die Frau, worauf sie<br />
Anspruch hatte. Als ein besonderes Verdienst<br />
kann sein Handeln nicht gelten. Oder aber<br />
– und diese Frage ist die entscheidende für die<br />
Einstellung der Gelehrten zur Frau – übersieht<br />
die Gemara absichtlich die Verdienste der<br />
Frauen und übergeht ihrer Belobigung? Auch<br />
wenn diese krasse Formulierung etwas zu<br />
weit zu gehen scheint und die Verteidiger der<br />
Gelehrten mit Leichtigkeit viele Zitate vorlegen<br />
könnten, in denen die Rolle der Frau und ihre<br />
Tugenden herausgestrichen werden, so lässt<br />
sich doch mindestens das eine feststellen:<br />
Die Gemara wurde von Männern geschrieben,<br />
und es war nicht ihre Sache, sich in die Frauen<br />
hineinzudenken und nach ihren Motiven zu forschen.<br />
Und wenn dadurch die Frau an Ansehen<br />
verliert und der Mann stattdessen an Ansehen<br />
gewinnt, so hätten sich die Männer deshalb<br />
auch keine grauen Haare wachsen lassen.<br />
Dr. Gabriel Miller ist als Notar in Frankfurt<br />
und Tel Aviv tätig. Er lehrt Jüdisches Recht<br />
an der Frankfurter Johann Wolfgang-Goethe-<br />
Universität. Mehr Talmudisches:<br />
www.juedisches-recht.de<br />
21.–22. November<br />
VHS Hietzing, Hofwiesengasse 48, 1140<br />
Wien: ‚Adorno hören - Symposion zum 100.<br />
Geburtstag‘, Koordination: Robert Streibel,<br />
Markus Vorzellner. Referenten: Konrad Paul<br />
Liessmann, Wendelin Schmid-Dengler, Gerhard<br />
Scheit, Hermann Schlösser, Michael Ley,<br />
Richard Steurer u.a.<br />
15<br />
9. Jahrgang | Ausgabe 1<br />
Ein Abend mit Edith Kraus<br />
Die Pianistin erzählt aus ihrem Leben<br />
Moderation: Evelyn Adunka<br />
Freitag, 24.Oktober 2003,<br />
nach dem Erew Schabbat-<br />
Gottesdienst (ca. 20.15<br />
Uhr), Haidgasse 1, 1020<br />
Wien. Eine Veranstaltung<br />
von Or Chadasch in<br />
Kooperation mit dem<br />
Orpheus Trust.<br />
Edith Kraus wurde 1913 in Wien geboren und<br />
übersiedelte 1919 nach Karlsbad. Sie war ein<br />
„Wunderkind“ und absolvierte mit elf Jahren<br />
ihr Konzertdebüt mit Mozarts c-moll-Konzert.<br />
Auf Empfehlung Alma Mahler-Werfels begann<br />
sie mit dreizehn Jahren das Studium an der<br />
Berliner Hochschule für Musik, ein Jahr später<br />
war sie jüngste Studentin in Arthur Schnabels<br />
Meisterklasse. Nach dem Studium übersiedelte<br />
sie nach Prag, wo sie eine rege Konzert- und<br />
Rundfunktätigkeit entfaltete . 1933 heiratete<br />
sie Karl Steiner.<br />
1942 wurde sie mit ihren Mann nach Theresienstadt<br />
deportiert. Dort arbeitete sie im Rahmen<br />
der jüdischen Selbstverwaltung als Pianistin<br />
eng mit dem Komponisten Viktor Ullmann zusammen.<br />
Ihre Familie überlebte nicht. Nach der<br />
Befreiung kehrte sie nach Prag zurück, 1946<br />
heiratete sie Arpad Bloedy (siehe dazu Torberg:<br />
Tante Jolesch).<br />
1949 emigrierte sie nach Israel. Sie unterrichtete<br />
an der Rubin Music Academy in Tel Aviv und<br />
beschäftigte sich intensiv mit den Werken der<br />
Theresienstädter Komponisten. Edith Kraus lebt<br />
heute in Jerusalem. Gefragt, ob die Künstlerin<br />
sich selbst als eine der letzten Vertreterinnen<br />
der sogenannten deutschen Schule des Klavierspiels<br />
einschätzt, widerspricht sie vehement.<br />
Denn sie glaubt, Vertreter dieser Schule seien<br />
Pianisten gewesen, die mehr Wert auf echte<br />
Musikalität und Werktreue und weniger auf<br />
Virtuosität legten: „Ich glaube nicht, dass das<br />
ausstirbt. Denken Sie an den Briten Solomon oder<br />
an Murry Perahia.“ Nach einem Schlaganfall<br />
musste Kraus 1994 mit dem aktiven Klavierspiel<br />
aufhören, unterrichtet aber weiterhin.<br />
Edith Kraus kehrt auf Einladung des Orpheus<br />
Trust zum ersten Mal in ihre Geburtsstadt<br />
Wien zurück und wird im Rahmen der Ullmann-<br />
Masterclass an der Universität für Musik und<br />
Darstellende Kunst die Klaviersonaten von<br />
Victor Ullmann mit Studenten erarbeiten.<br />
Der von Primavera Gruber geleitete Verein<br />
Orpheus Trust wurde im Mai 1996 gegründet<br />
und ist die einzige Institution Österreichs, die<br />
sich zum Ziel setzt, durch Veranstaltungen,<br />
durch Erforschung und Dokumentation sowie<br />
durch Beratung und Informationsvermittlung<br />
an die aus Österreich vertriebenen oder im<br />
KZ ermordeten Musiker, Komponisten, Musikverleger,<br />
-wissenschaftler und -publizisten<br />
zu erinnern. Sie hat dabei seit Beginn ihrer<br />
Tätigkeit mit schweren finanziellen Problemen<br />
zu kämpfen.