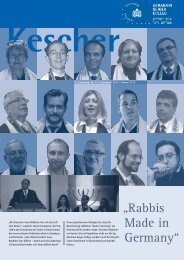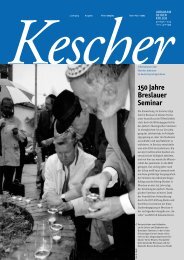Schana Tova - Abraham Geiger Kolleg
Schana Tova - Abraham Geiger Kolleg
Schana Tova - Abraham Geiger Kolleg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Essay<br />
Wir sind alle Reformer<br />
Im Judentum hat Erneuerung Tradition<br />
von Primar Dr. Theodor Much<br />
Der Bruderzwist unter Juden um die Notwendigkeit<br />
von religiösen Reformen im Judentum,<br />
erhitzt die Gemüter seit jeher. Besonders<br />
intensiv wird diese Frage seit rund 200 Jahren<br />
(als Folge des Aufkommens der Reformbewegung<br />
in Deutschland) diskutiert und je nach<br />
Standpunkt der Diskutierenden äußerst unterschiedlich,<br />
ja teilweise konträr bewertet.<br />
Während (ultra)orthodoxe Juden (und in ihrem<br />
Sog auch viele in religiösen Fragen indifferente,<br />
säkulare Juden), die Notwendigkeit von<br />
religiösen Reformen völlig negieren, sie als<br />
„unnötig, schädlich und gefährlich” ansehen<br />
und sich dabei auf das Dogma von der „Torah<br />
min haschamaim” berufen („Moses erhielt alle<br />
Gebote – selbst die mündliche Überlieferung<br />
– direkt von Gott am Sinai”: „für Änderungen<br />
ist daher kein Platz”), sind religiöse Juden,<br />
die sich nicht als orthodox verstehen (sondern<br />
als konservativ oder progressiv), naturgemäß<br />
anderer Meinung.<br />
Für Gegner jeder Reform existiert im Allgemeinen<br />
nur „ein einziges authentisches<br />
Judentum”, ein Judentum, das „von <strong>Abraham</strong><br />
über Moses bis zum heutigen Tag unverfälscht,<br />
von Generation zu Generation weitergereicht<br />
wurde”: nämlich die „Orthodoxie.”<br />
Wer so denkt, argumentiert, „dass religiöse<br />
Reformen im Judentum überflüssig und gefährlich<br />
seien, weil nach Entfernung einzelner<br />
Bausteine, das Gesamtgebäude früher oder<br />
später zum Einsturz gebracht wird und die Assimilation<br />
dann nicht mehr zu verhindern sei.”<br />
In den Augen nichtorthodox-religiöser Juden ist<br />
diese Argumentationslinie falsch, auch weil sie<br />
geschichtliche Entwicklungen und Realitäten<br />
der jüdischen Welt nicht zu Kenntnis nimmt.<br />
Denn keiner, der sich mit der Geschichte des<br />
Judentums ernsthaft auseinandersetzt, wird<br />
bestreiten, dass das gesamte heutige Judentum<br />
in all seinen Aspekten sich sehr wesentlich<br />
vom Judentum des Mittelalters unterscheidet,<br />
und letzteres wiederum ist ein völlig anders<br />
Judentum als das weiter zurückliegender<br />
Epochen.<br />
Gäbe es so etwas wie Zeitreisen, dann würde<br />
ein Zeitgenosse von Moses, der eine solche<br />
Reise antritt, sich weder im mittelalterlichen,<br />
geschweige denn im heutigen Judentum,<br />
zurechtfinden. Unser Zeitreisender würde alle<br />
heutigen Juden als „Reformer und Dissidenten”<br />
sehen und (wahrscheinlich) verdammen. Das<br />
Wort „Reform” bedeutet laut allgemeiner<br />
Übereinkunft eine Umgestaltung bestehender<br />
Verhältnisse, eine Verbesserung ohne Gewalteinwirkung<br />
(im Gegensatz zur Revolution). Reformen<br />
im Sinne dieser Definition gab es – wie<br />
im Folgenden gezeigt werden soll – zu allen<br />
Zeiten im Judentum, auch wenn eine jüdische<br />
Reformbewegung im engeren Sinne erst seit<br />
rund 200 Jahren existiert.<br />
Beispiele für solche Neuerungen und Verbesserungen<br />
im Judentum gibt es viele, und es<br />
erstaunt mich immer wieder, wie vielen Menschen<br />
diese einfache Tatsache nicht bewußt<br />
ist.<br />
Schon im 5. Buch Moses kann der Bericht von<br />
den Töchtern des Zelofchads gelesen werden.<br />
Dort wird erzählt, dass Frauen, deren Vater<br />
ohne männliche Erben verstorben war, von Moses<br />
das Recht auf Erbschaft forderten. Moses,<br />
der keine sofortige Antwort auf das Problem<br />
wusste, zog sich zurück um mit Gott darüber zu<br />
beraten, um erst danach die Entscheidung zu<br />
treffen, dass auch Frauen erben dürfen. Diese<br />
Episode zeigt deutlich, daß Moses nicht alle<br />
Gesetze am Sinai von Gott erhielt und selbst er,<br />
um bestehende Ungerechtigkeiten auszumerzen,<br />
es für legal hielt, Reformen einzuführen.<br />
Doch auch viele andere biblisch fixierte Gesetze<br />
wurden von unseren Vorfahren im Sinne<br />
von Tikkun Olam, Verbesserung der Welt,<br />
außer Kraft gesetzt. Denken wir an die biblischen<br />
Kapitalstrafen für bestimmte Vergehen,<br />
Verbot der Bitterwasserprobe bei Verdacht<br />
auf Ehebruch, den Schuldenerlaß im 7. Jahr<br />
(durch Hillel), die Schwagerehe, Gesetze im<br />
Zusammenhang mit Sklaverei, die Abschaffung<br />
der Polygamie, dem Aussetzen der Opfergesetze<br />
und Reinheitsgebote und sehr vieles<br />
mehr. Selbst die Frommsten der Frommen im<br />
Judentum (Selbstbezeichnung: „Thoratreue”)<br />
sind daher heute nicht mehr in der Lage diesen<br />
Gesetzen zu folgen! Auch die Gebetsliturgie<br />
wurde immer wieder weiter entwickelt und<br />
teilweise erneuert.<br />
So wurden unter anderem Piutim (die synagogale<br />
Poesie) eingeführt, und es entstanden<br />
auch – stets gegen den Widerstand der Traditionalisten<br />
– manche neuen Gebete (wie das Kol<br />
Nidre und selbst von manchen orthodoxen Synagogen<br />
wurde ein Brauch der Reformer – die<br />
Predigt des Rabbiners – übernommen. Auch<br />
die Bat Mizwa-Feier und der Talmud-Tora-Unterricht<br />
für Mädchen in einzelnen orthodoxen<br />
Synagogen, sind Neuerungen im Sinne der<br />
Reformbewegung. Vielen Menschen ist auch<br />
nicht bewußt, dass alte, heute selbstverständliche<br />
Sitten wie das Tragen der Kippa und die<br />
Tradition der materilinearen Abstammungslinie<br />
im Judentum in biblischer Zeit noch unbekannt<br />
waren, also ebenfalls Neuerungen sind.<br />
Reformen im Judentum sind daher nicht eine<br />
„Erfindung” der Reformjuden, sondern notwendige<br />
Selbstverständlichkeiten, die aber<br />
heute von manchen jüdischen Gruppierungen<br />
hartnäckig geleugnet und abgelehnt werden.<br />
Man darf daher mit Gewissheit behaupten,<br />
dass ein Judentum ohne Neuerungen nicht bis<br />
heute überlebt hätte, dass also Reformen für<br />
17<br />
9. Jahrgang | Ausgabe 1<br />
das Weiterbestehen des Judentums eine Notwendigkeit<br />
waren und immer noch sind. Und<br />
wer sich heute Gedanken über das Wunder des<br />
Überlebens des Judentums macht, sollte die<br />
Flexibilität unserer Vorfahren, die Bereitschaft<br />
zu Neuerungen im Sinne von Tikkun Olam als<br />
ein wesentliches Element der Überlebensstrategie<br />
des Judentums nicht geringschätzen.<br />
Solche Reformen dürfen aber nie nach Lust und<br />
Laune (oder aus Bequemlichkeit) durchgeführt<br />
werden, sondern nur von hochqualifizierten<br />
Gelehrten – und soweit wie möglich im Rahmen<br />
der Halacha – ausdiskutiert und eingeleitet<br />
werden. Ein solches Institut, das sich auf<br />
allerhöchstem Niveau mit all diesen Fragen<br />
beschäftigt und Responsen zu allen relevanten<br />
Themen veröffentlicht, ist das Freehof-Institut<br />
für progressive Halacha (Direktor: Rabbiner<br />
Moshe Zemer) in Tel Aviv. Eine logische Folge<br />
all dieser beschriebenen Entwicklungen im<br />
Judentum ist daher die, daß sämtliche heute<br />
lebenden Juden ein Judentum der Reformen<br />
leben, selbst wenn diese Tatsache nicht<br />
allen gefällt. Eine Stagnation durch völlige<br />
Reformverweigerung führt daher das Judentum<br />
unweigerlich in eine gefährliche Sackgasse,<br />
wo die Kluft zwischen der modernen jüdischen<br />
Realität und einem Wunschdenken fundamentalistischer<br />
Gruppierungen immer größer wird<br />
und sich in heftigen Bruderkämpfen entlädt.<br />
Progressive und konservative Juden in aller<br />
Welt sehen daher die Auseinandersetzung mit<br />
dieser gefährlichen Stagnation als eine ihrer<br />
Hauptaufgaben an, um ein Judentum leben<br />
zu können, das bei aller Liebe zur Tradition<br />
auch gesellschaftliche Entwicklungen wie die<br />
Gleichstellung der Frauen berücksichtigt und<br />
das Ungerechtigkeiten (besonders im traditionellen<br />
Ehe- und Scheidungsgesetz) beseitigt<br />
beziehungsweise imstande ist, auf brennende<br />
innerjüdischer Probleme (dazu zählen auch die<br />
Konversion zum Judentum und die vielen interreligiösen<br />
Ehen) vernünftige und praktikable<br />
Antworten zu geben vermag.<br />
Pavel Feinstein: „Sukkot“, 1997 Öl auf Leinwand