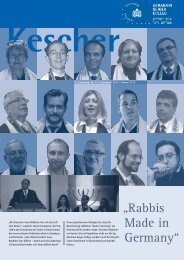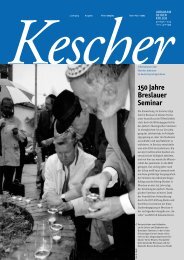Schana Tova - Abraham Geiger Kolleg
Schana Tova - Abraham Geiger Kolleg
Schana Tova - Abraham Geiger Kolleg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bücher<br />
Ein Blick zurück – Neuerscheinungen zur deutsch-jüdischen Geschichte<br />
Meike Berg: Jüdische Schulen in Niedersachsen.<br />
Tradition-Emanzipation-Assimilation. Böhlau<br />
Verlag, Wien-Köln-Weimar 2003, 287 S.<br />
Aufklärerische Schulreform meint in der<br />
Erziehungs- wie in der Geschichtswissenschaft<br />
vor allem die schulischen Reformen, die in den<br />
deutschen Kleinstaaten seit den 1760er und<br />
1770er Jahren von christlichen Pädagogen,<br />
Beamten und Kirchenmännern durchgeführt<br />
wurden. Kaum bekannt ist dagegen, dass es<br />
in der deutsch-jüdischen Bildungsgeschichte<br />
vergleichbare Ansätze zur Erziehungsreform<br />
gegeben hat, die parallel zur christlichen<br />
Entwicklung verliefen und von der jüdischen<br />
Aufklärung, der Haskala, ausgingen. Meike<br />
Berg verfolgt in ihrer Studie die Geschichte der<br />
Jacobson-Schule in Seesen (1801-1922) und der<br />
Samsonschule in Wolfenbüttel (1807-19289<br />
– zwei Freischulen, in der jüdische Kinder aus<br />
armen Verhältnissen unentgeltlich aufgenommen<br />
wurden. Die Jacobson-Schule wurde Vorbild<br />
für soziale und religiöse Neuerungen in der<br />
jüdischen Lebenswelt weit über Niedersachsen<br />
hinaus und war die erste Simultanschule, die<br />
auch christliche Schüler aufnahm. (H. B.)<br />
<strong>Schana</strong> <strong>Tova</strong>!<br />
Dipl. Pol. Matthias Cohn<br />
Human Resources Management<br />
Personal- und<br />
Organisationsentwicklung<br />
Beratung – Training – Coaching<br />
www.cohnsulting.de<br />
info@cohnsulting.de<br />
Andreas Brämer: Judentum und religiöse Reform.<br />
Der Hamburger Israelitische Tempel 1817–1938,<br />
Dölling und Gallitz Verlag. Hamburg 2000, 304 S.<br />
„Die ersten Erneuerer des Judentums hatten<br />
nicht die Absicht, eine eigene „reformierte“<br />
jüdische Glaubensgemeinschaft zu gründen“,<br />
sagte Michael A. Meyer bei seinem Berliner<br />
Festvorrag im Juli. „Sie glaubten an die Möglichkeit<br />
der Entstehung eines einzigen modernen<br />
Judentums, das potentiell alle im Westen<br />
lebenden Juden einschlösse. Sehr bald jedoch<br />
wurde deutlich, dass selbst unter Juden, die<br />
der europäischen und deutschen Gesellschaft<br />
und Kultur angehören wollten, tiefgreifende<br />
Meinungsverschiedenheiten über Wesen und<br />
Umfang der verbleibenden jüdischen Sphäre<br />
bestanden. Der Hamburger Tempelverein, der<br />
im Jahre 1817 gegründet worden war, zog mit<br />
seinem reformierten Gottesdienst nur einen<br />
vergleichsweise kleinen Teil der Juden der<br />
Stadt an, während die traditionsverhaftete Gemeinde<br />
ihre eigenen, wenn auch eingeschränkten<br />
Anpassungen an die Moderne vollzog..<br />
So haben wir in Hamburg zum ersten Mal auf<br />
Dauer eine Spaltung in zwei Richtungen, deren<br />
jede von der Moderne beeinflußt ist: die von<br />
Issak Bernays geleitete Synagogengemeinde<br />
auf der einen Seite und den Tempelverein auf<br />
der anderen.“ Das Beispiel des Hamburger<br />
Tempels, der sich als Verein getrennt von der<br />
übrigen Gemeinde konstituierte, machte, so<br />
Meyer, aber keine Schule; der Tempelverein<br />
trat schließlich wieder mit der übrigen jüdischen<br />
Gemeinschaft in Verbindung, indem er<br />
unter dem Dach der Deutsch-Israelitischen Gemeinde<br />
die Stellung eines anerkannten Kultusverbandes<br />
errang. Andreas Brämer, Mitarbeiter<br />
des Hamburger Instituts für die Geschichte<br />
der deutschen Juden, dokumentiert in seiner<br />
Studie die Geschichte des Hamburger Tempels<br />
von den Ursprüngen bis zu seinem Untergang<br />
anhand einer Vielzahl schwer zugänglicher gedruckter<br />
oder unveröffentlichter Quellen nach.<br />
Heutzutage erinnert in Hamburg nur noch der<br />
Sendesaal des Norddeutschen Rundfunks in<br />
der Oberstraße an den Tempel: das Gebäude,<br />
das als der bedeutendste erhaltene jüdische<br />
Saalbau der Moderne in Deutschland gilt,<br />
wurde 1930/31 nach Plänen von Felix Ascher<br />
und Robert Friedmann für den Israelitischen<br />
Tempelverband errichtet. (H. B.)<br />
7<br />
9. Jahrgang | Ausgabe 1<br />
Ludwig Feuchtwanger: Gesammelte<br />
Aufsätze zur jüdischen Geschichte.<br />
Herausgegeben von Rolf Rieß. Duncker<br />
& Humblot Verlag, Berlin 2003, 249 S.<br />
Ludwig Feuchtwanger, der jüngere Bruder des<br />
Schriftstellers Lion Feuchtwanger, war in München<br />
vor der Shoah ein jüdischer Historiker und<br />
Publizist von Rang. Er stammte, wie Michael<br />
Brenner im Vorwort schreibt, „aus einer der<br />
angesehensten Münchner jüdischen Familien,<br />
einer Familie, in der bayerische Traditionen und<br />
orthodoxes Judentum sich nie widersprochen<br />
haben.“ – einer Familie, von der nach Verfolgung<br />
und Emigration nur sechs Mitglieder nach<br />
München zurückkehrten, darunter der Bankier<br />
Walter Feuchtwanger s.A., Mitglied der liberalen<br />
Münchner Gemeinde Beth Shalom.<br />
Ludwig Feuchtwanger arbeitete von 1914 bis<br />
1933 als Verlagsleiter bei Duncker & Humblot<br />
und von 1930 bis 1938 als Herausgeber der<br />
Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung.<br />
Es ist das Verdienst des vorliegenden Bandes,<br />
seine Aufsätze zur jüdischen Geschichte in<br />
Erinnerung zu rufen und eine repräsentative,<br />
sorgfältig annotierte Auswahl daraus sowie<br />
eine 376 Positionen umfassende Bibliographie<br />
aller Arbeiten Feuchtwangers und der<br />
Sekundärliteratur zu veröffentlichen. Die<br />
Themen der publizierten Aufsätze umfassen<br />
Moses Mendelsohn, jüdische Geschichte und<br />
Rechtsgeschichte in Bayern und in Österreich<br />
im Mittelalter und in der Neuzeit sowie die Situation<br />
des deutschen Judentums in der Zeit des<br />
Nationalsozialismus. Gerade weil die Ernsthaftigkeit<br />
und das Pathos von Feuchtwangers<br />
Sprache uns eher fremd geworden sind, sind<br />
seine Arbeiten auch heute noch lesenswert.<br />
Das Nachwort des Herausgebers ist in vielen<br />
Punkten sehr informativ. Er beschreibt Feuchtwangers<br />
Arbeiten für Duncker & Humblot, in<br />
dem er unter anderen Carl Schmitt zu betreuen<br />
hatte, und schildert die Tragik des Exils in Großbritannien,<br />
wo Feuchtwanger nie wieder eine<br />
adäquate Stellung erhielt und unter großen<br />
Entbehrungen zu leiden hatte. Sehr interessant<br />
sind auch seine Briefe, die er als Berater und<br />
Übersetzer der amerikanischen Beatzung<br />
1945 aus Deutschland schrieb. Leider erfährt<br />
der Leser jedoch nichts über Feuchtwangers<br />
Lehrtätigkeit im Münchner Jüdischen Lehrhaus.<br />
Auch sind einige Formulierungen von Rieß eher<br />
ungenau, etwa wenn er pro-nationalsozialistische<br />
Äußerungen von Elie Munk erwähnt, ohne<br />
diese zu erklären. Darüber hinaus erläutert er<br />
an keiner Stelle die Kriterien für seine Auswahl.<br />
Bei dem im Zusammenhang mit dem Raub<br />
von Feuchtwangers Bibliothek durch die SS-<br />
Stiftung Ahnenerbe und deren anschließenden<br />
Transport erwähnten „Professor Dr. Viktor“<br />
handelte es sich übrigens um den Wiener Orientalisten<br />
Viktor Christian. Genauer nachzulesen<br />
ist diese Geschichte in dem Buch der Verfasserin:<br />
„Der Raub der Bücher“, Wien 2002, S.157ff.<br />
Evelyn Adunka