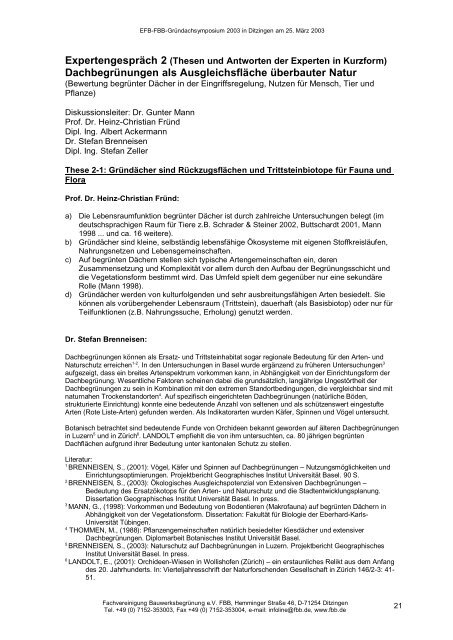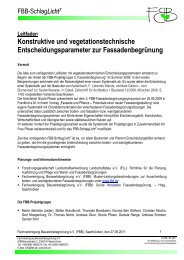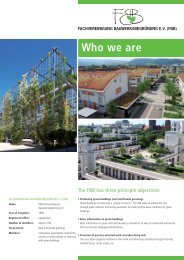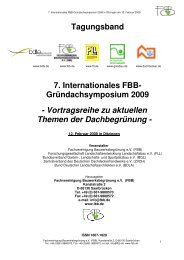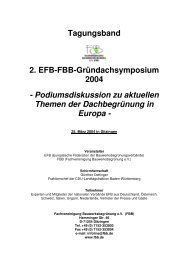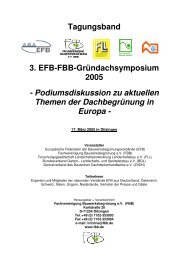Tagungsband EFB-FBB-Symposium 2003 - Fachvereinigung ...
Tagungsband EFB-FBB-Symposium 2003 - Fachvereinigung ...
Tagungsband EFB-FBB-Symposium 2003 - Fachvereinigung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>EFB</strong>-<strong>FBB</strong>-Gründachsymposium <strong>2003</strong> in Ditzingen am 25. März <strong>2003</strong><br />
Expertengespräch 2 (Thesen und Antworten der Experten in Kurzform)<br />
Dachbegrünungen als Ausgleichsfläche überbauter Natur<br />
(Bewertung begrünter Dächer in der Eingriffsregelung, Nutzen für Mensch, Tier und<br />
Pflanze)<br />
Diskussionsleiter: Dr. Gunter Mann<br />
Prof. Dr. Heinz-Christian Fründ<br />
Dipl. Ing. Albert Ackermann<br />
Dr. Stefan Brenneisen<br />
Dipl. Ing. Stefan Zeller<br />
These 2-1: Gründächer sind Rückzugsflächen und Trittsteinbiotope für Fauna und<br />
Flora<br />
Prof. Dr. Heinz-Christian Fründ:<br />
a) Die Lebensraumfunktion begrünter Dächer ist durch zahlreiche Untersuchungen belegt (im<br />
deutschsprachigen Raum für Tiere z.B. Schrader & Steiner 2002, Buttschardt 2001, Mann<br />
1998 ... und ca. 16 weitere).<br />
b) Gründächer sind kleine, selbständig lebensfähige Ökosysteme mit eigenen Stoffkreisläufen,<br />
Nahrungsnetzen und Lebensgemeinschaften.<br />
c) Auf begrünten Dächern stellen sich typische Artengemeinschaften ein, deren<br />
Zusammensetzung und Komplexität vor allem durch den Aufbau der Begrünungsschicht und<br />
die Vegetationsform bestimmt wird. Das Umfeld spielt dem gegenüber nur eine sekundäre<br />
Rolle (Mann 1998).<br />
d) Gründächer werden von kulturfolgenden und sehr ausbreitungsfähigen Arten besiedelt. Sie<br />
können als vorübergehender Lebensraum (Trittstein), dauerhaft (als Basisbiotop) oder nur für<br />
Teilfunktionen (z.B. Nahrungssuche, Erholung) genutzt werden.<br />
Dr. Stefan Brenneisen:<br />
Dachbegrünungen können als Ersatz- und Trittsteinhabitat sogar regionale Bedeutung für den Arten- und<br />
Naturschutz erreichen 1-2 . In den Untersuchungen in Basel wurde ergänzend zu früheren Untersuchungen 3<br />
aufgezeigt, dass ein breites Artenspektrum vorkommen kann, in Abhängigkeit von der Einrichtungsform der<br />
Dachbegrünung. Wesentliche Faktoren scheinen dabei die grundsätzlich, langjährige Ungestörtheit der<br />
Dachbegrünungen zu sein in Kombination mit den extremen Standortbedingungen, die vergleichbar sind mit<br />
naturnahen Trockenstandorten 4 . Auf spezifisch eingerichteten Dachbegrünungen (natürliche Böden,<br />
strukturierte Einrichtung) konnte eine bedeutende Anzahl von seltenen und als schützenswert eingestufte<br />
Arten (Rote Liste-Arten) gefunden werden. Als Indikatorarten wurden Käfer, Spinnen und Vögel untersucht.<br />
Botanisch betrachtet sind bedeutende Funde von Orchideen bekannt geworden auf älteren Dachbegrünungen<br />
in Luzern 5 und in Zürich 6 . LANDOLT empfiehlt die von ihm untersuchten, ca. 80 jährigen begrünten<br />
Dachflächen aufgrund ihrer Bedeutung unter kantonalen Schutz zu stellen.<br />
Literatur:<br />
1 BRENNEISEN, S., (2001): Vögel, Käfer und Spinnen auf Dachbegrünungen – Nutzungsmöglichkeiten und<br />
Einrichtungsoptimierungen. Projektbericht Geographisches Institut Universität Basel. 90 S.<br />
2 BRENNEISEN, S., (<strong>2003</strong>): Ökologisches Ausgleichspotenzial von Extensiven Dachbegrünungen –<br />
Bedeutung des Ersatzökotops für den Arten- und Naturschutz und die Stadtentwicklungsplanung.<br />
Dissertation Geographisches Institut Universität Basel. In press.<br />
3 MANN, G., (1998): Vorkommen und Bedeutung von Bodentieren (Makrofauna) auf begrünten Dächern in<br />
Abhängigkeit von der Vegetationsform. Dissertation: Fakultät für Biologie der Eberhard-Karls-<br />
Universität Tübingen.<br />
4 THOMMEN, M., (1988): Pflanzengemeinschaften natürlich besiedelter Kiesdächer und extensiver<br />
Dachbegrünungen. Diplomarbeit Botanisches Institut Universität Basel.<br />
5 BRENNEISEN, S., (<strong>2003</strong>): Naturschutz auf Dachbegrünungen in Luzern. Projektbericht Geographisches<br />
Institut Universität Basel. In press.<br />
6 LANDOLT, E., (2001): Orchideen-Wiesen in Wollishofen (Zürich) – ein erstaunliches Relikt aus dem Anfang<br />
des 20. Jahrhunderts. In: Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 146/2-3: 41-<br />
51.<br />
<strong>Fachvereinigung</strong> Bauwerksbegrünung e.V. <strong>FBB</strong>, Hemminger Straße 46, D-71254 Ditzingen<br />
Tel. +49 (0) 7152-353003, Fax +49 (0) 7152-353004, e-mail: infoline@fbb.de, www.fbb.de<br />
21