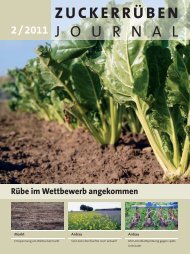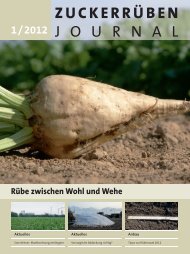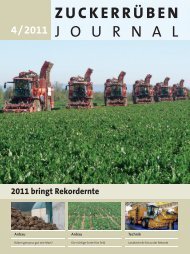zuckerrüben journal - Guter Ertragszuwachs und hohe Zuckergehalte
zuckerrüben journal - Guter Ertragszuwachs und hohe Zuckergehalte
zuckerrüben journal - Guter Ertragszuwachs und hohe Zuckergehalte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1/2010<br />
Rekordernte im Rheinland<br />
Aktuelles<br />
EU: Extra-Zuckerexporte <strong>und</strong> keine<br />
finale Quotenkürzung<br />
Z U C K E R R Ü B E N<br />
J O U R N A L<br />
Anbau<br />
Maschinenvorführung<br />
im Maifeld<br />
Anbau<br />
Tipps zum Herbizideinsatz
I N H A L T A K T U E L L E S P O L I T I K M A R K T B E T R I E B S W I R T S C H A F T A N B A U T E C H N I K Z U C K E R<br />
Der Niederländer<br />
Jos van Campen<br />
ist Präsident der<br />
europäischen<br />
Rübenanbauer.<br />
Das Zuckerrüben<strong>journal</strong><br />
sprach mit<br />
ihm über den<br />
Zuckersektor <strong>und</strong><br />
seine Zukunft. Lesen<br />
Sie ab Seite 3.<br />
Mehr Ertrag –<br />
mehr Stickstoff?<br />
Brauchen steigende<br />
Rübenerträge<br />
mehr Nährstoffe,<br />
vor allem Stickstoff?<br />
Wie Sie<br />
richtig kalkulieren,<br />
lesen Sie ab Seite<br />
19.<br />
Titelbild:<br />
Hochbetrieb in den<br />
Zuckerfabriken:<br />
Mit 71,8 t/ha Rübenertrag<br />
<strong>und</strong> 18,11 %<br />
Zuckergehalt gab es<br />
im Rheinland eine<br />
Rekordernte.<br />
Foto: agrar-press<br />
Mitteilungen des Rheinischen<br />
Rübenbauer-Verbandes e.V. <strong>und</strong> der<br />
Bezirksgruppe Nordrhein des Vereins<br />
der Zuckerindustrie e.V.<br />
Redaktion:<br />
Natascha Kreuzer (verantwortlich)<br />
Rochusstraße 18, 53123 Bonn<br />
Telefon: (02 28) 96499717<br />
Fax: (02 28) 96499718<br />
E-Mail: ZRJournal@aol.com<br />
Faule Rüben können<br />
viele Ursachen<br />
haben, das hat sich<br />
auch in der Ernte<br />
2009 wieder gezeigt.<br />
Lesen Sie ab<br />
Seite 14, welche<br />
neuen <strong>und</strong> alten<br />
Ursachen es gibt.<br />
Aktuelles<br />
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.<br />
Telefon: (02 28) 652534<br />
Bezirksgruppe Nordrhein des<br />
Vereins der Zuckerindustrie e. V.<br />
Telefon: (02 21) 4980332<br />
Redaktionsbeirat:<br />
Heinrich Brockerhoff, Johannes Brünker,<br />
Dr. Helmut Esser, Dr. Bernd Kämmerling,<br />
Dr. Peter Kasten, Dr. Willi Kremer-Schillings<br />
Interview mit Jos van Campen<br />
Zuckermarkt braucht keine drastischen Reformen 3<br />
Ein Modell der ökologischen Nachhaltigkeit 4<br />
Umsetzung der EU-Zuckerexporte im Rheinland 4<br />
EU: Extra-Zuckerexporte <strong>und</strong> keine finale Quotenkürzung 5<br />
Mitgliederversammlung des Rheinischen<br />
Rübenbauer-Verbandes<br />
Zuckerrüben bleibt die Nummer eins 6<br />
Zuckerwirtschaft auf der Grünen Woche 6<br />
Ernte 2009: Motivation <strong>und</strong> Verpflichtung 8<br />
Verlag:<br />
Rheinischer Landwirtschafts-Verlag GmbH<br />
Rochusstraße 18, 53123 Bonn<br />
Telefon: (02 28) 52006-35<br />
Fax: (02 28) 52006-60<br />
Satz:<br />
Print PrePress GmbH & Co. KG<br />
53340 Meckenheim<br />
Druck:<br />
L.N. Schaffrath Druck Medien, 47594 Geldern<br />
2 | Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L LZ 8 · 2010<br />
Markt<br />
Rüben zwischen Im- <strong>und</strong> Export 9<br />
Betriebswirtschaft<br />
Wie rechnete sich die Ernte 2009? 11<br />
Anbau<br />
Humus im Fokus des Ackerbaus 13<br />
Maschinenvorführung im Maifeld 13<br />
Rekordernte, aber auch kranke Rüben 14<br />
Tipps zum Herbizideinsatz 2010 16<br />
Mehr Ertrag – mehr Stickstoff? 19<br />
Quoten verleihen ist ganz einfach 20
Z U C K E R T E C H N I K A N B A U B E T R I E B S W I R T S C H A F T M A R K T P O L I T I K A K T U E L L E S<br />
Zuckermarkt braucht keine<br />
drastischen Reformen<br />
Drei gute Zuckerrübenernten in Folge haben die Stimmung im<br />
Zuckerrübenanbau wieder steigen lassen, nachdem die Reform<br />
der Zuckermarktordnung herbe Einschnitte gefordert hatte.<br />
Die Marktordnung läuft bis Ende 2015 <strong>und</strong> es stellt sich die<br />
Frage, wie es danach weitergeht. Ein Gespräch mit dem Niederländer<br />
Jos van Campen, Präsident der Internationalen Vereinigung<br />
Europäischer Zuckerrübenanbauer (CIBE).<br />
Jos van Campen<br />
Interview mit Jos van Campen<br />
Journal: Als die Reform der Zuckermarktordnung<br />
beschlossen wurde, sahen viele<br />
schlechte Zeiten auf die Rübenanbauer in<br />
Europa zukommen. Aber so schlimm wie<br />
befürchtet, ist es nicht gekommen. Wie<br />
beurteilen Sie die Situation?<br />
Van Campen: Die Veränderungen des Sektors<br />
infolge der geänderten Zuckermarktordnung<br />
waren sehr schmerzlich: 80 Zuckerfabriken<br />
in Europa haben ihre Tore<br />
geschlossen, r<strong>und</strong> 140 000 Landwirte<br />
haben den Rübenanbau eingestellt. Aber<br />
die Landwirte <strong>und</strong> die Fabriken haben<br />
ihre Produktivität gesteigert <strong>und</strong> die Kosten<br />
gesenkt, die steigenden Rübenerträge<br />
haben dazu beigetragen <strong>und</strong> liegen heute<br />
auf dem Niveau von Zuckerrohr. Die Rübenanbauer<br />
in Europa brauchen keine<br />
Angst vor der Zukunft zu haben.<br />
Journal: Wie sieht denn die Zukunft des<br />
Zuckersektors nach dem Ende der Zuckermarktordnung<br />
2015 Ihrer Meinung nach<br />
aus?<br />
Van Campen: Da die Beratungen für die<br />
Gemeinsame Agrarpolitik der EU bald beginnen,<br />
ist es auch Zeit für uns, über unsere<br />
Zukunft nachzudenken. Wir haben<br />
im Oktober <strong>und</strong> November intensive Gespräche<br />
mit unseren Mitgliedern in den<br />
verschiedenen europäischen Ländern geführt.<br />
Die Debatte war sehr lehrreich <strong>und</strong><br />
hat gezeigt, dass keine drastischen Reformen<br />
am bestehenden System nötig sind.<br />
Das Vertragsmodell bei der Zuckerrübe ist<br />
beispielhaft, es bietet über langfristige<br />
Verträge eine sichere Mengenkontrolle<br />
<strong>und</strong> garantiert einen stabilen Markt.<br />
Journal: In Europa gibt es immer wieder<br />
Stimmen, die eine Liberalisierung der<br />
Landwirtschaft fordern, könnte dies auch<br />
für den Zuckermarkt in Frage kommen?<br />
Van Campen: Die Ziele der Reform der Zuckermarktordnung<br />
waren, die Marktordnung<br />
WTO-konform zu machen, die Wettbewerbsfähigkeit<br />
zu steigern, die Importe<br />
im Rahmen der Alles-außer-Waffen-Initiative<br />
(EBA) zu ermöglichen <strong>und</strong> den Zuckerpreis<br />
in Europa zu senken. Alle diese<br />
Ziele sind erreicht worden. Wenn man<br />
nun einseitig über Quotenabschaffungen<br />
in das System eingreift, fällt das ganze<br />
System wie ein Kartenhaus zusammen.<br />
Außerdem darf man nicht vergessen,<br />
dass man den ärmsten Ländern der Welt<br />
(LDC) einen Zugang nach Europa versprochen<br />
hat, das lässt sich nicht so einfach<br />
rückgängig machen. Ich denke, das sind<br />
alles gute Argumente für eine Beibehaltung<br />
der Quotenregelung.<br />
Journal: Die Importe in die EU aus den<br />
ärmsten Ländern der Welt, den LCD-Staaten,<br />
<strong>und</strong> den Ländern aus Afrika, der Karibik<br />
<strong>und</strong> dem Pazifik, den AKP-Staaten,<br />
sind vielen ein Dorn im Auge, weil sie dazu<br />
geführt haben, dass die Produktion in<br />
Europa reduziert wurde. Wie beurteilen<br />
Sie diese Importe?<br />
Van Campen: Wichtig ist, dass die Importe<br />
nicht über die vereinbarten Grenzwerte<br />
hinausgehen <strong>und</strong> dies auch kontrolliert<br />
wird. Aber wir dürfen auch nicht vergessen,<br />
dass diese Länder die gleichen Interessen<br />
haben wie wir: Ein ausgeglichener<br />
Markt in Europa ist genauso im<br />
Interesse der importierenden Staaten,<br />
denn nur so kann das Marktgleichgewicht<br />
gehalten werden <strong>und</strong> Marktschwankungen,<br />
die zerstörerisch sind,<br />
können verhindert werden. Zurzeit sind<br />
wir durch einen <strong>hohe</strong>n Weltmarktpreis<br />
geschützt, aber wenn der Weltmarktpreis<br />
sinkt, ist es wieder attraktiver, nach<br />
Europa zu liefern. Im Moment ist der<br />
Zur Person:<br />
Jos van Campen<br />
Jos van Campen, seit 2007 Präsident<br />
der Internationalen Vereinigung der<br />
Europäischen Zuckerrübenanbauer<br />
(CIBE), ist Landwirt aus Ens, einem Dorf<br />
im Noordoostpolder, mitten in den<br />
Niederlanden. Er bewirtschaftet den<br />
Betrieb zusammen mit seiner Frau <strong>und</strong><br />
einem seiner drei Söhne. Der Bauernhof<br />
liegt auf einem der neuen niederländischen<br />
Polder. Der Lehmboden ist<br />
für viele Feldfrüchte geeignet, angebaut<br />
werden Pflanzkartoffeln,<br />
Zuckerrüben, Weizen, Möhren <strong>und</strong><br />
Zwiebeln. Seit 2003 ist Jos van Campen,<br />
Jahrgang 1950, Vorsitzender der<br />
Koninklijke Coöperatie Cosun U. A.<br />
(Royal Cosun), einer Genossenschaft<br />
mit 10 000 Zuckerrübenanbauern,<br />
<strong>und</strong> seit 1992 Mitglied in deren Vorstand.<br />
Davor war er seit 1979 Mitglied<br />
<strong>und</strong> Vorsitzender eines regionalen<br />
Ausschusses der Cosun.<br />
Cosun wurde 1899 gegründet <strong>und</strong> ist<br />
als Zuiker Unie Eigentümer der beiden<br />
niederländischen Zuckerfabriken.<br />
Außerdem gehört der Kartoffelverarbeiter<br />
Aviko zu Cosun, ebenso wie<br />
Royal Nedalco: Die Firma stellt Ethanol<br />
aus Zuckerrübenmelasse, Zuckerrohrmelasse<br />
<strong>und</strong> Getreide her. Weitere<br />
Firmen sind der Tiefkühlgemüse<strong>und</strong><br />
Obstverarbeiter SVZ, der Inulin-<br />
Produzent Sensus <strong>und</strong> die Unifine<br />
Food & Bake Ingredients GmbH, die<br />
Lebensmittelzusätze erzeugt. Cosun<br />
hat r<strong>und</strong> 4 000 Mitarbeiter <strong>und</strong> einen<br />
Jahresumsatz von 1,7 Mrd. €.<br />
Früher war Jos van Campen auch aktiv<br />
als Mitglied im Vorstand des<br />
Pflanzkartoffelunternehmens ZPC,<br />
jetzt HZPC, der Genossenschaftsbank<br />
Rabobank <strong>und</strong> dem Weltzuchtverband<br />
für Sportpferde World Breeding<br />
Federation for Sport Horses (WBSH).<br />
LZ 8 · 2010 Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L | 3<br />
Foto: Natascha Kreuzer
A K T U E L L E S P O L I T I K M A R K T B E T R I E B S W I R T S C H A F T A N B A U T E C H N I K Z U C K E R<br />
Ein Modell der ökologischen Nachhaltigkeit<br />
Eine gemeinsame Veröffentlichung der Internationalen<br />
Vereinigung Europäischer Rübenanbauer<br />
(CIBE) <strong>und</strong> des Verbandes der Europäischen Zuckerindustrie<br />
(CEFS) informiert über das Engagement<br />
der EU-Zuckerwirtschaft in den Bereichen<br />
Bewahrung der Biodiversität, Bodenschutz, Wassermanagement<br />
<strong>und</strong> Kampf gegen den Klimawandel.<br />
Der Flyer mit dem Titel „Der europäische Zuckersektor<br />
– Ein Modell der ökologischen Nachhal-<br />
Der europäische Zuckersektor:<br />
Markt in einer Übergangsphase, die vollen<br />
Effekte der Importe werden wir wohl<br />
im Laufe dieses Jahres spüren.<br />
Journal: Es kommt zwar viel Zucker nach<br />
Europa, aber leider verlässt nicht mehr<br />
viel Zucker die EU, weil es nach WTO verboten<br />
ist. Wie verkraftet das der Zuckermarkt,<br />
wenn es wie jetzt die dritte Rekordernte<br />
in Folge gibt?<br />
Van Campen: Die Möglichkeit, Zucker zu<br />
exportieren, muss unbedingt erhalten<br />
bleiben. Die Abschaffung der Exportmöglichkeiten<br />
ist nicht akzeptabel. Wenn der<br />
Weltmarkt unseren Zucker will <strong>und</strong> auch<br />
bezahlt, ist es nicht zu verstehen, warum<br />
wir nicht exportieren dürfen.<br />
Journal: Wie steht die CIBE zur Beibehaltung<br />
der Produktionsabgabe?<br />
Van Campen: Wir sind gegen die Beibehaltung<br />
der Produktionsabgabe. Wir haben<br />
uns immer für den Gr<strong>und</strong>satz der<br />
Haushaltsneutralität ausgesprochen. Es<br />
geht hier um 160 Mio. € im Jahr <strong>und</strong> denen<br />
stehen keine zuckerspezifischen Ausgaben<br />
gegenüber. Die bisher gezahlte<br />
Produktionsabgabe muss unbedingt<br />
komplett erstattet werden. Was die „alten“<br />
Produktionsabgaben in der vorherigen<br />
Zuckermarktordnung betrifft: Dass<br />
die EU sich dem Urteil des EU-Gerichts-<br />
EIN MODELL DER ÖKOLOGISCHEN NACHHALTIGKEIT<br />
Gemeinsame Verpflichtungen<br />
der Rübenanbauer <strong>und</strong> der<br />
Zuckerindustrie:<br />
■ Bewahrung der Biodiversität<br />
■ Bodenschutz<br />
■ Wassermanagement<br />
■ Kampf gegen den<br />
Klimawandel<br />
Diese Broschüre fasst das gemeinsame Engagement von CIBE<br />
<strong>und</strong> CEFS zur Stärkung der ökologischen Nachhaltigkeit in der<br />
EU-Zuckerwirtschaft zusammen <strong>und</strong> informiert über die erreichten<br />
Ergebnisse. Ein umfangreicher Bericht mit weiteren Details <strong>und</strong><br />
Fallbeispielen wird auf den Internet-Seiten von CIBE <strong>und</strong> CEFS<br />
zur Verfügung gestellt. Diese Broschüre kann heruntergeladen<br />
werden unter:<br />
www.cibe-europe.eu<br />
www.cefs.org<br />
www.zuckerverbaende.de<br />
tigkeit“ kann bei der<br />
Wirtschaftlichen Vereinigung<br />
Zucker (WVZ) im Internet<br />
unter www.zuckerverbaende.deheruntergeladen<br />
oder per Telefon<br />
unter 02 28/22 85-126 bezogen<br />
werden.<br />
WVZ<br />
hofes widersetzt <strong>und</strong> nur einen Bruchteil<br />
dieser Abgabe erstatten will, ist für mich<br />
absolut unverständlich.<br />
Journal: Ein anderer Geldtopf, um den<br />
zurzeit gerungen wird, ist der Restrukturierungsfonds,<br />
der Zuckerunternehmen<br />
<strong>und</strong> Anbauern den Ausstieg aus der<br />
Rüben- beziehungsweise Zuckerproduktion<br />
erleichtern sollte. Wie ist Ihre Position<br />
dazu?<br />
Van Campen: Wir gehen davon aus, dass<br />
in dem Restrukturierungsfonds r<strong>und</strong> 640<br />
Mio. € enthalten sind. Das ist Geld, das<br />
der Zuckersektor erbracht hat <strong>und</strong> deshalb<br />
steht dieses Geld auch der Zuckerbranche<br />
zu. Aber die Auseinandersetzung<br />
darüber wird sicher noch dauern, denn<br />
die Kommission sieht dies anders.<br />
Journal: Kommen wir noch mal zur Zukunft<br />
der Rübe in Europa. Welche Perspektiven<br />
sehen Sie?<br />
Van Campen: Ich denke, dass auch die<br />
Themen Bioethanol <strong>und</strong> Biogas der Rübe<br />
eine Zukunft bieten. Die Bioethanolherstellung<br />
hat zum Beispiel in Deutschland,<br />
aber auch in Frankreich <strong>und</strong> Belgien, den<br />
Anbaurückgang aufgefangen. Bei Biogas<br />
ist das Rheinland ein Vorreiter <strong>und</strong> wenn<br />
die Preise gut sind, ist dies sicher eine<br />
Perspektive für die Rübe.<br />
Umsetzung der EU-Zuckerexporte im Rheinland<br />
Die EU-Kommission hat am 28. Januar beschlossen,<br />
die Ausfuhrmenge für Nichtquotenzucker<br />
im Zuckerwirtschaftsjahr 2009/2010 um<br />
500 000 t zu erhöhen. Damit werden zusätzliche<br />
Exporte auch aus dem Rheinland möglich<br />
sein, die dann eine Reduzierung der Übertragungsverpflichtung<br />
zur Folge haben. Der Rheinische<br />
Rübenbauer-Verband <strong>und</strong> Pfeifer & Lan-<br />
gen sind übereingekommen, dass nun denjenigen<br />
Betrieben, die freiwillig vorgetragen haben,<br />
eine Reduzierung ihres freiwilligen Vortrags angeboten<br />
wird. In welcher Größenordnung diese<br />
Reduzierung liegt, kann zum jetzigen Zeitpunkt<br />
noch nicht gesagt werden, da die Größenordnung<br />
des zusätzlichen Exportvolumens für Pfeifer<br />
& Langen <strong>und</strong> damit auch für das rheinische<br />
Journal: Für die Rübe sprechen viele Argumente,<br />
wie die Nachhaltigkeit des Anbaus<br />
im Vergleich zu den Produktionsmethoden<br />
in vielen anderen Ländern der<br />
Welt. Müsste man diese Vorteile nicht<br />
mehr in die Waagschale werfen?<br />
Van Campen: Die Zuckerrübe ist Teil einer<br />
umweltfre<strong>und</strong>lichen Produktion <strong>und</strong> das<br />
müssen wir bei der EU stärker deutlich<br />
machen. Die CIBE hat gemeinsam mit<br />
dem europäischen Verband der Zuckerverarbeiter<br />
CEFS eine Broschüre zur Nachhaltigkeit<br />
der Zuckerrübe herausgegeben,<br />
um die guten Argumente für die Rübe im<br />
Bereich Umwelt <strong>und</strong> in Klimafragen deutlich<br />
zu machen (siehe Kasten). Auch die<br />
regionale Produktion <strong>und</strong> Verarbeitung<br />
des Rohstoffs Zucker mit geringen Transportwegen<br />
muss noch deutlicher gemacht<br />
werden. Dies gilt auch für die<br />
Energieerzeugung aus Rüben.<br />
Journal: Was kann denn der einzelne<br />
Landwirt tun, um für die Zukunft gerüstet<br />
zu sein?<br />
Van Campen: Jeder Anbauer muss seine<br />
Kosten im Blick haben, um wirtschaftlich<br />
Rüben anbauen zu können. Da gibt es<br />
viele Herausforderungen, denn längere<br />
Kampagnen <strong>und</strong> zum Beispiel eine 24-<br />
St<strong>und</strong>en-Anfuhr erfordern eine ausgefeilte<br />
Logistik. Außerdem gilt es, die guten<br />
Argumente für die Rübe weiterzugeben.<br />
Die CIBE wird dies auf der politischen<br />
Bühne tun, jeder Landwirt kann dies in<br />
seinem Umfeld vorantreiben. Aber auch<br />
die EU ist gefordert, die Anstrengungen<br />
des Sektors zu würdigen <strong>und</strong> nicht durch<br />
weiteren Druck oder eine Verschärfung<br />
der Produktionsbedingungen neue Hürden<br />
aufzubauen.<br />
Natascha Kreuzer<br />
Anbaugebiet noch nicht feststeht. Auch die<br />
Übertragungsverpflichtung für die übrigen Betriebe,<br />
die nicht am freiwilligen Vortrag teilgenommen<br />
haben, kann somit noch nicht berechnet<br />
werden. Alle Anbauer werden jedoch so<br />
bald wie möglich darüber informiert.<br />
Rheinischer Rübenbauer-Verband e.V.<br />
Pfeifer & Langen KG<br />
4 | Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L LZ 8 · 2010
Foto: Natascha Kreuzer<br />
Z U C K E R T E C H N I K A N B A U B E T R I E B S W I R T S C H A F T M A R K T P O L I T I K A K T U E L L E S<br />
EU: Extra-Zuckerexporte <strong>und</strong> keine finale Quotenkürzung<br />
Lohnender Einsatz<br />
Die Europäische Kommission will die Voraussetzungen<br />
für zusätzliche Exporte in<br />
Höhe von 500 000 t im laufenden Wirtschaftsjahr<br />
schaffen <strong>und</strong> verzichtet im<br />
Rahmen der Zuckermarktreform gleichzeitig<br />
auf eine abschließende Kürzung<br />
der Produktionsquoten. Lob für den Vorstoß<br />
kam von der Arbeitsgemeinschaft<br />
Deutscher Rübenbauerverbände (ADR),<br />
dem Deutschen Bauernverband (DBV)<br />
<strong>und</strong> der Wirtschaftlichen Vereinigung<br />
Zucker (WVZ).<br />
Mit der Aufstockung der Ausfuhrmöglichkeiten<br />
überschreitet die EU das bereits<br />
ausgeschöpfte Limit von 1,37 Mio. t,<br />
das ihr von der Welthandelsorganisation<br />
(WTO) gesetzt wurde. Als vorübergehende<br />
Maßnahme hält die Kommission den<br />
Schritt angesichts der angespannten<br />
Weltmarktlage jedoch für gerechtfertigt.<br />
Im Gegenzug plant die Behörde für<br />
2010/2011 die Einrichtung eines zollfreien<br />
Importkontingents für die Verarbeitung<br />
durch die chemische Industrie in<br />
Höhe von 400 000 t, um die langfristige<br />
„Die Entscheidung der EU-Kommission, nun doch<br />
weitere Zuckerexporte aus der EU in Höhe von<br />
500 000 t Weißzucker zuzulassen, ist uneingeschränkt<br />
zu begrüßen. Sie trägt zum einen dazu<br />
bei, das Zuckerdefizit auf dem Weltmarkt etwas zu<br />
reduzieren <strong>und</strong> die Möglichkeiten der Zuckerversorgung<br />
gerade für ärmere Staaten zu verbessern,<br />
die sich am Weltmarkt bedienen müssen. Zum anderen<br />
haben wir Europäer nun die Möglichkeit, einen<br />
wesentlichen Teil des bei uns auf Gr<strong>und</strong> sehr<br />
günstiger Witterungsbedingungen gewachsenen<br />
Zuckerertrags auf dem Weltmarkt sinnvoll abzusetzen.<br />
Der Export ist auch – oder gerade – vor<br />
dem Hintergr<strong>und</strong> sehr <strong>hohe</strong>r Weltmarktpreise<br />
mehr als gerechtfertigt, denn niemand kann unter<br />
dieser Preissituation der EU mehr vorwerfen, sie<br />
würde gegen die Subventionsvorschriften der<br />
Welthandelsorganisation (WTO) verstoßen.<br />
Die Exportmöglichkeit wird den Druck, erhebliche<br />
Mengen auf das kommende Zuckerwirtschaftsjahr<br />
Versorgungssicherheit dieser Branche<br />
sicherzustellen. Laut Kommission ist es<br />
vor diesem Hintergr<strong>und</strong> ferner nicht nötig,<br />
die Produktionsquoten in einem finalen<br />
Schritt zu kürzen, um am Ende der<br />
EU-Zuckermarktreform ein strukturelles<br />
Gleichgewicht zu erreichen. Das ursprüngliche<br />
Ziel, die EU-Erzeugung um<br />
6 Mio. t zu senken, wurde danach zu<br />
mehr als 96 % erreicht.<br />
Beispiellose Situation<br />
Mit Blick auf die Erhöhung der Zuckerexportquote<br />
bezeichnete EU-Agrarkommissarin<br />
Mariann Fischer Boel die derzeitige<br />
Situation als außergewöhnlich. Die<br />
Weltmarktpreise seien auf beispiellose<br />
Höhen geklettert, zum Nachteil von Verbrauchern<br />
in ärmeren Ländern. Das Preisniveau<br />
sowohl innerhalb der EU als auch<br />
am Weltmarkt machten die zusätzliche<br />
Ausfuhr von<br />
europäischem<br />
vortragen zu müssen, erheblich<br />
reduzieren. Ein<br />
gravierender Vortrag hätte unsere gesamte Zuckerwirtschaft,<br />
das heißt Rübenanbauer <strong>und</strong><br />
Zuckerindustrie, in der kommenden Kampagne<br />
viel Substanz gekostet. So sind wir guter Hoffnung,<br />
in ein annähernd „normales“ Rübenjahr zu<br />
gehen. Der Weg bis zur Kommissionsentscheidung<br />
war lang <strong>und</strong> erforderte viel Überzeugungskraft.<br />
Alle Verbände der Zuckerwirtschaft, insbesondere<br />
die beiden europäischen Dachverbände CIBE für die<br />
Rübenanbauer <strong>und</strong> CEFS für die Zuckererzeuger, haben<br />
hier viel Arbeit leisten müssen, um die politischen<br />
Entscheidungsträger mit guten Argumenten<br />
zu überzeugen. Das Ergebnis zeigt jedoch, dass sich<br />
der große Einsatz gelohnt hat. Die jetzige Entscheidung<br />
ist für alle Beteiligten ein Gewinn.“<br />
Bernhard Conzen<br />
Rheinischer Rübenbauer-Verband e.V.<br />
Zucker vertretbar, ohne dass die Verpflichtungen<br />
gegenüber der WTO verletzt würden.<br />
Die WTO-Schwelle von 1,37 Mio. t für<br />
EU-Exporte gilt auch für Nichtquotenzucker,<br />
der zwar ohne Zuschüsse gehandelt<br />
wird, aber in den Augen der internationalen<br />
Handelspartner als Nebenprodukt des<br />
Quotenzuckers trotzdem als subventioniert<br />
gilt. Ursprünglich waren seitens der<br />
Brüsseler Behörde für das laufende Wirtschaftsjahr<br />
Ausfuhren von lediglich<br />
650 000 t vorgesehen; im Zuge der Preisentwicklung<br />
wurden im Oktober zusätzliche<br />
Mengen freigegeben. Jetzt wurde von<br />
der Kommission argumentiert, die Produktionskosten<br />
in der Gemeinschaft lägen<br />
derzeit unterhalb des Weltmarktpreises.<br />
Dadurch sehen sich Fischer Boels<br />
Rechtsexperten auf der sicheren Seite,<br />
nicht gegen das WTO-Verbot zu verstoßen.<br />
Der Sprecher der Dänin stellte klar,<br />
dass es sich um eine außergewöhnliche,<br />
einmalige Maßnahme handle.<br />
Zuckerwirtschaft begrüßt<br />
Anhebung<br />
Die Rübenbauern <strong>und</strong> der DBV zeigten<br />
sich erfreut über die Ankündigung. Die<br />
Kommission reagiere endlich auf die außergewöhnliche<br />
Situation auf den internationalen<br />
Zuckermärkten. Optimale Witterungsbedingungen<br />
hätten in Europa zu<br />
deutlich höheren Ernten als geplant geführt,<br />
während sich auf dem Weltmarkt<br />
durch den Ausfall wichtiger Erzeugerländer<br />
ein stattliches Versorgungsdefizit aufgebaut<br />
habe. Angesichts der Weltmarktentwicklung<br />
könnten die deutschen <strong>und</strong><br />
europäischen Erzeuger jetzt zu einer Entlastung<br />
auf dem Zuckermarkt beitragen.<br />
Der WVZ-Vorsitzende Dr. Hans-Jörg Gebhard<br />
betonte, die Anhebung der Exportmenge<br />
komme spät, aber gerade noch<br />
rechtzeitig.<br />
LZ 8 · 2010 Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L | 5<br />
AgE
A K T U E L L E S P O L I T I K M A R K T B E T R I E B S W I R T S C H A F T A N B A U T E C H N I K Z U C K E R<br />
Zuckerrübe bleibt Nummer eins<br />
Mitgliederversammlung des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes e.V. in Düren-Birkesdorf<br />
„Die Rübe gehört ins Rheinland. Trotz aller politischen <strong>und</strong><br />
wirtschaftlichen Hürden, die uns im Zuge der Zuckermarktreform<br />
in den Weg gestellt wurden, hat der heimische Rübenanbau<br />
heute einen Stellenwert, den viele vor zwei Jahren, als<br />
die Preise für Alternativfrüchte hoch waren, kaum erwartet<br />
haben“, mit dieser erfreulichen Zusammenfassung begrüßte<br />
Bernhard Conzen, Vorsitzender des Rheinischen Rübenbauer-<br />
Verbandes die Mitglieder zur diesjährigen Verbandsversammlung<br />
Mitte Januar in Düren.<br />
„Wir haben auf die Herausforderungen<br />
richtig reagiert <strong>und</strong> an der Wirtschaftlichkeit<br />
der Erzeugung gearbeitet. Die neue<br />
Stärke der Rübe mag zwar auch mit den<br />
schlechten Preisen für Getreide, Raps <strong>und</strong><br />
Milch zusammenhängen. Sie ist aber<br />
auch die Folge einer gewaltigen Ertragssteigerung.“<br />
Auch wenn die Witterung ihren Anteil<br />
an dem Rekordergebnis hatte, so hätten<br />
Zuckerwirtschaft auf der<br />
Grünen Woche<br />
Seit mehr als zehn Jahren zeigt der ErlebnisBauernhof auf der Grünen<br />
Woche Landwirtschaft zum Anfassen. Unter dem diesjährigen<br />
Motto „Werte schaffen – Versorgung sichern: Das ist unsere Landwirtschaft“<br />
wurde anschaulich gezeigt, welche Bedeutung die<br />
Landwirtschaft für Verbraucher, Umwelt <strong>und</strong> Wirtschaft hat. Am<br />
Zuckerstand konnten sich die Besucher über die Herstellung des<br />
Zuckers aus der Zuckerrübe informieren <strong>und</strong> frische Waffeln mit<br />
Puderzucker <strong>und</strong> selbst gemachte Konfitüre verkosten. Das Informationsangebot<br />
der WVZ r<strong>und</strong> um Rübenanbau <strong>und</strong> Zuckererzeugung<br />
wurde von den Besuchern hervorragend angenommen. Mit<br />
Verbrauchern aller Altersgruppen sowie Lehrern <strong>und</strong> Schülern wurden<br />
die unterschiedlichsten Fragen zum Thema Zucker erörtert;<br />
das Spektrum reichte vom Rohstoff Rübe über die Warenk<strong>und</strong>e bis<br />
hin zu Ernährungsthemen. Groß <strong>und</strong> Klein konnten ihr Wissen<br />
beim beliebten Zuckermemospiel testen. Hier galt es, die einzelnen<br />
Zuckersorten ihrer Verwendung zuzuordnen. Foto: WVZ<br />
„Der Selbstversorgungsgrad bei Zucker darf in<br />
Europa nicht noch weiter sinken, wir dürfen<br />
nicht noch mehr von Importen abhängig werden“,<br />
erklärte Bernhard Conzen.<br />
die Anbauer die Produktionstechnik immer<br />
weiter verbessert, die neuen Sorten<br />
hätten ihren Anteil am guten Ergebnis.<br />
Auch wenn die <strong>hohe</strong>n Erträge nötig seien,<br />
um erfolgreich zu wirtschaften, so dürfe<br />
man nicht vergessen, dass der gewachsene<br />
Zucker auch vermarktet werden müsse.<br />
Conzen erinnerte an die schwierige<br />
Umstrukturierung im Rahmen der Reform<br />
der Zuckermarktordnung. Es seien<br />
gravierende Gegenmaßnahmen vonnöten<br />
gewesen, um die heimische Erzeugung<br />
auf stabilem Niveau zu erhalten,<br />
begleitet von sachgerechten Preisabschlüssen<br />
<strong>und</strong> Lieferbedingungen.<br />
„Es wäre unverantwortlich, den Selbstversorgungsgrad<br />
angesichts der zunehmend<br />
knappen Versorgung der Weltbevölkerung<br />
mit Nahrungsmitteln bei<br />
Zucker auf unter 80 % sinken zu lassen.<br />
Keinesfalls darf sich Europa hier noch<br />
weiter von außereuropäischen Versorgern<br />
abhängig machen“, betonte Conzen.<br />
Dies müsse auch bei den Überlegungen<br />
zur Gestaltung des Zuckermarktes nach<br />
2015 berücksichtigt werden.<br />
In der politischen Diskussion erhielten<br />
auch die Umweltverträglichkeit <strong>und</strong> die<br />
Klimarelevanz eine immer größere Rolle.<br />
„Dass ein Hektar Zuckerrüben mehr CO2<br />
bindet als ein Hektar Wald, ist seit Längerem<br />
bekannt. Wir Rheinländer sollten<br />
aber nicht nachlassen, auf einen gewaltigen<br />
Vorteil unserer Produktion hinzuweisen,<br />
<strong>und</strong> das sind die geringen ,food miles’.“<br />
Diese lägen im Rheinland unter<br />
100 km vom Feld über die Fabrik zum Verbraucher<br />
im Gegensatz zum Zuckerrohr,<br />
wo es 3 000 bis 4 000 km seien.<br />
Kampagne gut gemeistert<br />
„Rekorde mit Herausforderungen, so würde<br />
ich die vergangene Rübenkampagne<br />
beschreiben“, erklärte Dr. Botho von<br />
Schwarzkopf, Pfeifer & Langen, in seinem<br />
Grußwort. Er bedankte sich bei allen, die<br />
zu einem guten Gelingen der Kampagne<br />
beigetragen hätten. „Die Ernteprognosen<br />
stiegen wöchentlich höher als erwartet,<br />
dies war eine logistische Meisterleistung<br />
für alle. Vor zwei Jahren haben wir noch<br />
über die Formel 15-15-15 diskutiert, jetzt<br />
haben schon viele Betriebe Erträge über<br />
15 t pro ha realisiert.“<br />
Zum Thema Rüben entblättern erklärte<br />
Dr. von Schwarzkopf, es sei systematisch<br />
zu prüfen, ob sich das System wirtschaftlich<br />
rechne.<br />
In der Rekordernte 2009 habe sich gezeigt,<br />
dass es sich lohne, Kapazitäten vorzuhalten.<br />
„Im Rheinland haben wir im<br />
Prinzip eine Fabrik zu viel, dies hat sich in<br />
dieser Kampagne als Vorteil erwiesen.“<br />
Schwierig sei es nun, die große Zuckermenge<br />
im Markt unterzubringen. Zunächst<br />
würden Lager für den Zucker gesucht.<br />
Darüber hinaus suche man Absatzwege<br />
für Industriezucker in der chemischen<br />
Industrie. Dies sei aber nicht so einfach,<br />
da hier auch die Wirtschaftskrise<br />
greife <strong>und</strong> die Rübe Konkurrenz aus Mais<br />
<strong>und</strong> Weizen bekäme.<br />
Der Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel<br />
sei härter geworden. Dr. von<br />
Schwarzkopf erläuterte dies an einem<br />
Beispiel: Der Preis für 1 kg Zucker liege im<br />
Schnitt bei 85 Cent. Der Discounter Lidl<br />
habe den Preis auf 72 Cent gesenkt <strong>und</strong><br />
Aldi habe binnen 24 St<strong>und</strong>en diesen Preis<br />
auf 69 Cent gesenkt. Dies zeige, wie<br />
schwierig die Situation im Lebensmittelmarkt<br />
sei.<br />
Moderate Anbauplanung<br />
Für die kommende Kampagne empfahl<br />
Dr. von Schwarzkopf, bei der Anbauplanung<br />
nicht nur von dem letzten sehr<br />
guten Erntejahr auszugehen, sondern<br />
eine sichere Quotenerfüllung zu planen,<br />
6 | Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L LZ 8 · 2010
Z U C K E R T E C H N I K A N B A U B E T R I E B S W I R T S C H A F T M A R K T P O L I T I K A K T U E L L E S<br />
Die gewaltigen Rübenmengen bescherten den Abfuhrorganisationen viel Arbeit.<br />
Foto: Peter Hensch<br />
darüber hinaus sei aber nur ein geringer<br />
Überschuss zu kalkulieren.<br />
Auch Dr. Peter Kasten, Geschäftsführer<br />
des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes,<br />
appellierte an die Rübenanbauer, bei der<br />
Anbauplanung 2010 Maß zu halten. Er<br />
blickte in seinem Jahresbericht auf zwei<br />
spannende Jahre zurück. „Hatten wir im<br />
Jahr 2007/2008 nach der Reform der Zuckermarktordnung<br />
noch gedacht, es kehre<br />
Ruhe ein, so stimmte dies nicht. Mit einer<br />
Marktrücknahme von 13,5 % in<br />
2007/2008 <strong>und</strong> der nachfolgenden Restrukturierung<br />
2008/2009 war auch dies<br />
eine Herausforderung für die Rübe“, erklärte<br />
Dr. Kasten. „Im Rahmen der freiwilligen<br />
Quotenrückgabe haben 479 Anbauer<br />
den Rübenanbau vollständig aufgegeben.<br />
Seit dem Jahr 2000 hat der Verband<br />
damit 30 % weniger Mitglieder, die<br />
durchschnittliche Anbaufläche je Anbau<br />
ist auf 11,4 ha Rüben angestiegen.“<br />
Für die Rübenanbauer habe es einige<br />
neue Vereinbarungen gegeben. So seien<br />
die Kosten für den Rübenvortrag auf 3 €<br />
pro t gesenkt worden. Der Überrübenpreis<br />
betrage mindestens 21,60 € pro t<br />
Rübe. Ab 2009 wurden die ersten 5 %<br />
Überrüben zum Quotenrübenpreis bezahlt<br />
<strong>und</strong> der Frachttarif für die Fuhrvergütung<br />
wurde um 2,5 % erhöht. Neu sei<br />
auch, dass die Saatgutbestellung nur<br />
noch im Frühjahr mit einem Rabatt von<br />
10 % erfolge. Für Industrierüben gebe es<br />
nur noch das flexible Preismodell, das<br />
sich an den Börsenpreisen für Winterweizen<br />
<strong>und</strong> Zucker orientiere.<br />
Frostfonds ein Erfolg<br />
Zufrieden blickte Dr. Kasten auf die Einführung<br />
des Frostfonds, der, sofern die<br />
Zuckerrüben mit Vlies abgedeckt werden,<br />
eine Versicherung bei Frostschäden dar-<br />
stelle. „Die Kampagnen haben gezeigt,<br />
dass der Frostfonds eine gute Lösung ist.<br />
Das Vlies als Abdeckmaterial wird komplett<br />
von dem Frostfonds erstattet, die<br />
Technik zu 75 % bezuschusst. Der Vorteil<br />
ist, dass die Verantwortung beim Landwirt<br />
bleibt <strong>und</strong> die Rübenabdeckung freiwillig<br />
ist“, erklärte Dr. Kasten. Inzwischen<br />
gebe es 1 Mio. m 2 Vlies, was für 400 000<br />
bis 450 000 t Rüben ausreiche.<br />
Das Versuchswesen im Rahmen der<br />
Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau<br />
aus Rübenbauer-Verband, Landwirtschaftlichem<br />
Informationsdienst Zuckerrübe<br />
<strong>und</strong> Landwirtschaftskammer NRW<br />
ist mit 75 bis 80 Versuchen im Jahr ein<br />
gewaltiges Arbeitspensum. „Hinter diesen<br />
Versuchen verbergen sich r<strong>und</strong> 3 500<br />
Einzelparzellen, auf denen neue Sorten,<br />
aber auch Versuche zum Pflanzenschutz,<br />
zu Ditylenchus, zu Blattkrankheiten oder<br />
zu Mikronährstoffen angelegt werden.“<br />
Diese Themen würden die Versuchsarbeit<br />
der Zukunft weiterhin beschäftigen, ein<br />
ganz neues Thema sei das Thema Rüben<br />
entblatten.<br />
Hochkarätigen Besuch bekam der Rübenbauer-Verband<br />
mit Jos van Campen,<br />
Präsident der Internationalen Vereinigung<br />
europäischer Zuckerrübenanbauer<br />
(CIBE). Er hielt einen interessanten Vortrag<br />
zum Thema „Wie sichern wir Europas<br />
Zuckerrübenanbau?“ (siehe hierzu auch<br />
das Interview auf Seite 3).<br />
Bei den anschließenden Beiratswahlen<br />
wurden zwei Beiratsbezirke neu besetzt.<br />
Für Heinz Stammen aus Geldern-Hartefeld<br />
ist nun Hubert Boßmann aus Emmerich<br />
neu im Beirat, für den RRV-Ehrenvorsitzenden<br />
Jan Kirsch aus Köln ist Degenhard<br />
Neisse aus Konradsheim neu im Beirat<br />
für Erftstadt-Kerpen (siehe Kasten).<br />
Natascha Kreuzer<br />
Beiratsmitglieder des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes e.V.<br />
2010<br />
1. Kreis Wesel<br />
Heinrich van de Sand<br />
Hürdemannshof<br />
46509 Xanten, Telefon:<br />
02801/4860, Fax: 9695<br />
2. Kreis Kleve<br />
Hubert Boßmann<br />
Blouswardt 21<br />
46446 Emmerich, Telefon:<br />
02822/80126, Fax: 8249<br />
3. Kreise Borken, Coesfeld,<br />
Recklinghausen<br />
Johannes Körner<br />
Am Bokern 11<br />
46499 Hamminkeln-Dingden<br />
Telefon: 02852/3084<br />
Fax: 72101<br />
4. Kreis Mettmann,<br />
Rheinisch-Bergischer-Kreis<br />
Wolfgang Bergermann<br />
Gut Cones, 40882 Ratingen<br />
Telefon: 02102/841878<br />
Fax: 83808<br />
5. Kreis Viersen, Schwalmtal,<br />
Niederkrüchten<br />
Michael Dohrenbusch<br />
Reckenhöfe 10<br />
47918 Tönisvorst<br />
Telefon: 02152/516191<br />
Fax: 510428<br />
6. Neuss, Kaarst, Korchenbroich,<br />
Mönchengladbach,<br />
Erkelenz<br />
Paul Heusgen<br />
Büttgen-Buscherhöfe 9<br />
41564 Kaarst, Telefon:<br />
02131/514260, Fax: 958611<br />
7. Jüchen, Grevenbroich,<br />
Rommerskirchen<br />
Hubertus Velder<br />
Berghütte 22<br />
41569 Rommerskirchen<br />
Telefon: 02183/81155<br />
Fax: 414342<br />
9. Kreis Heinsberg, Wegberg,<br />
Geilenkirchen<br />
Bernhard Conzen<br />
Claeßenhof, Sittarder Straße 4<br />
52538 Gangelt<br />
Telefon: 02454/2366<br />
Fax: 937902<br />
11. Titz, Jülich, Linnich<br />
Martin Ditges<br />
Gut Betgenhausen, 52445 Titz<br />
Telefon: 02463/7463<br />
Fax: 999866<br />
12. Bedburg, Elsdorf, Bergheim<br />
Konrad Peters<br />
Abtshof, Embestraße 20<br />
50189 Elsdorf, Telefon:<br />
02274/905386, Fax: 81484<br />
13. Köln, Hürth, Frechen,<br />
Pulheim<br />
Friedhelm Decker<br />
Zum neuen Kreuz 55, 50859<br />
Köln, Telefon: 0221/9502970<br />
Fax: 9502971<br />
14. Kerpen, Erftstadt<br />
Degenhard Neisse<br />
Burg Konradsheim<br />
Frenzenstraße 201<br />
50374 Konradsheim<br />
Telefon: 02235/690180<br />
Fax: 953702<br />
15. Niederzier, Düren,<br />
Merzenich, Nörvenich<br />
Franz Josef Kügelgen<br />
Ellbachstraße 4<br />
52388 Nörvenich-Rommelsheim,<br />
Telefon: 02421/73508<br />
Fax: 72659<br />
16. Kreis Aachen, Baesweiler,<br />
Übach-Palenberg<br />
Yvonne Hogen<br />
Katzenpolzweg 6<br />
52072 Aachen<br />
Telefon: 02407/572844<br />
Fax: 3375<br />
17. Vettweiß, Zülpich, Kreuzau,<br />
Nideggen, Heimbach<br />
Gerd-Volker Berning<br />
Burg Lüssem, 53909 Zülpich<br />
Telefon: 02252/833510<br />
Fax: 833516<br />
18. Weilerswist, Euskirchen,<br />
Mechernich, Kall,<br />
Bad Münstereifel<br />
Dr. Karl-Otto Ditges<br />
Gut Friedrichsruh<br />
53881 Euskirchen<br />
Telefon: 02251/2061<br />
Fax: 54910<br />
19. Rhein-Sieg-Kreis linksrheinisch,<br />
Bonn, Brühl,<br />
Wesseling<br />
Johannes Brünker<br />
Hohn 22, 53913 Swisttal<br />
Telefon: 02226/2617<br />
Fax: 909532<br />
20. Rhein-Sieg-Kreis,<br />
rechtsrheinisch<br />
Herbert Werres<br />
Weilerhof, 53859 Niederkassel<br />
Telefon: 02208/5117<br />
Fax: 759473<br />
21. Maifeld<br />
Toni Maur<br />
Kirchstraße 48<br />
56753 Mertloch<br />
Telefon: 02654/7838<br />
Fax: 7087<br />
Ohne Bezirk: Johannes Frizen<br />
Präsident der Landwirtschaftskammer<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Siebengebirgsstraße 200<br />
53229 Bonn<br />
Telefon: 0228/703-1275<br />
Fax: 703-8226<br />
LZ 8 · 2010 Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L | 7
A K T U E L L E S P O L I T I K M A R K T B E T R I E B S W I R T S C H A F T A N B A U T E C H N I K Z U C K E R<br />
Ernte 2009: Motivation<br />
<strong>und</strong> Verpflichtung<br />
„Wer uns vor zehn Jahren prophezeit hätte, dass wir in der<br />
Kampagne 2009/2010 13 t Zucker je Hektar ernten, den hätten<br />
wir wohl nicht ganz ernst genommen.“ Dieses Zitat von<br />
Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Frizen bei der Begrüßung<br />
zur Beratertagung in Düren umschreibt die Gefühlslage<br />
zur abgelaufenen Ernte.<br />
Foto: Peter Hensch<br />
Nach anfänglicher Skepsis gegenüber den<br />
Prognosen der Proberodungen realisierten<br />
spätestens ab Mitte Oktober alle Anbauer,<br />
dass das Ergebnis der Kampagne<br />
2009/2010 das beste sein würde, welches<br />
im Rheinland jemals erzielt wurde. Sowohl<br />
mit einem Durchschnittsertrag von<br />
71,8 t/ha als auch einem Zuckergehalt<br />
von 18,11 % wurden Ergebnisse erzielt,<br />
die bislang noch nicht erreicht wurden.<br />
Betrachtet man die Ertragsentwicklung<br />
der vergangenen zehn Jahre, ist festzustellen,<br />
dass die rheinischen Anbauer<br />
einen durchschnittlichen <strong>Ertragszuwachs</strong><br />
von 1,2 t Rüben/ha <strong>und</strong> Jahr realisierten –<br />
ein erstaunlicher Wert. Mitte der neunziger<br />
Jahre wurden noch Erträge von knapp<br />
über 50 t/ha erzielt. Das heutige Niveau<br />
liegt knapp 40 % höher. Ohne Zweifel<br />
haben günstige Witterungsbedingungen<br />
in den vergangenen Jahren<br />
wesentlich zur positiven Ertragsentwicklung<br />
beigetragen.<br />
Ähnliches stellten wir bereits<br />
im vergangenen Jahr fest. Die<br />
Anbauer sind in der Lage, günstige<br />
Bedingungen in Verbindung<br />
mit hochwertigem Saatgut<br />
in <strong>hohe</strong> Erträge umzusetzen.<br />
Dies ist allerdings auch eine unverzichtbare<br />
Voraussetzung, um unter<br />
den ökonomischen Bedingungen<br />
nach der Zuckermarktreform noch erfolgreich<br />
Zuckerrüben anbauen zu können.<br />
Die Beratungsorganisationen in der<br />
Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau,<br />
die Landwirtschaftskammer NRW, Pfeifer<br />
& Langen beziehungsweise der Landwirtschaftliche<br />
Informationsdienst Zuckerrübe<br />
(LIZ) <strong>und</strong> der Rheinische Rübenbauer-<br />
Verband e.V. (RRV) tun ihr Möglichstes,<br />
um die Betriebe zu unterstützen.<br />
Die positive Ertragsentwicklung führte<br />
dazu, dass die Deckungsbeiträge im Zuckerrübenanbau<br />
2009/2010 trotz des Erreichens<br />
der letzten Preissenkungsstufe<br />
<strong>und</strong> der deutlich gesunkenen Erlöse aus<br />
dem Futtermittelverkauf, verb<strong>und</strong>en mit<br />
einer stark gesunkenen Schnitzelvergütung,<br />
sogar knapp über denen des vergangenen<br />
Jahres lagen. Die Rübe bestätigt<br />
also einmal mehr ihre Rolle als stabilisierendes<br />
<strong>und</strong> damit unverzichtbares<br />
Element im Betriebseinkommen.<br />
Zuwachs bis Ende November<br />
Das Jahr 2009 startete bereits günstig<br />
mit einem optimalen Saattermin Ende<br />
März bis Anfang April. Die wüchsige Folgewitterung<br />
<strong>und</strong> ein durchgehend geringer<br />
Befallsdruck mit Blattkrankheiten taten<br />
ihr Übriges. Das Wachstum der Zuckerrüben<br />
hielt bis Ende November an.<br />
Dieser Monat war ungewöhnlich warm.<br />
Bei gegebener Bodenfeuchte <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>em<br />
Blattwerk setzten die Rüben das<br />
wüchsige Wetter direkt in Ertrag um. Spätestens<br />
nach der ersten Oktoberdekade<br />
passten auch die Rodebedingungen überall.<br />
Im September noch war die Ernte lokal<br />
auf Standorten mit unzureichendem<br />
Niederschlag schwierig, verb<strong>und</strong>en mit<br />
Ernteverlusten. Der Gesamtabzug für den<br />
Kopf, Erdanhang <strong>und</strong> organischen Rest<br />
lag bei 7,5 % <strong>und</strong> damit um 1 % unter<br />
dem des Vorjahres.<br />
Unsere westlichen Nachbarn, die Niederlande<br />
<strong>und</strong> Belgien, konnten sogar<br />
noch höhere Erträge erzielen. Deren Ergebnisse<br />
zeigen den rheinischen Anbau-<br />
Grafik: Gewachsene Zuckererträge im Rheinland seit 1950<br />
14 t/ha<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Der Gesamtabzug für den Kopf, Erdanhang <strong>und</strong> organischen<br />
<strong>und</strong> damit r<strong>und</strong> 1 % unter dem Vorjahr.<br />
ern, dass bei der Zuckerrübe im Rheinland<br />
trotz des erreichten Niveaus offensichtlich<br />
noch Ertragsreserven vorhanden sind.<br />
Und diese sollte man nutzen. Wer Erträge<br />
vergleicht, muss allerdings stets die Rahmenbedingungen<br />
in die Betrachtung mit<br />
einbeziehen, unter denen das Ertragsergebnis<br />
zustande kam. Wesentlichstes Kriterium<br />
ist hierbei der Kampagnebeginn.<br />
Gerade im September haben Rüben noch<br />
erhebliche Zuwächse.<br />
Ein weiteres, wenn auch nachgelagertes<br />
Kriterium ist beispielsweise die Erntetechnik.<br />
Der Aspekt der Vermeidung von<br />
Rodeverlusten liegt allein bei der Landwirtschaft.<br />
Die Frage der vereinbarten<br />
Rübenbeschaffenheit fällt zumindest teilweise<br />
in den Regelungsbedarf der Branchenvereinbarung.<br />
Derzeit laufen vielerorts<br />
Untersuchungen zum Ernteverfahren<br />
der Rübenentblattung. Den rheinischen<br />
Anbauern wurde das Verfahren un-<br />
Zuckerertrag: + 1 dt/ha <strong>und</strong> Jahr<br />
1950<br />
1952<br />
1954<br />
1956<br />
1958<br />
1960<br />
1962<br />
1964<br />
1966<br />
1968<br />
1970<br />
1972<br />
1974<br />
1976<br />
1978<br />
1980<br />
1982<br />
1984<br />
1986<br />
1988<br />
1990<br />
1992<br />
1994<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
2002<br />
2004<br />
2006<br />
2008<br />
8 | Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L LZ 8 · 2010
Z U C K E R T E C H N I K A N B A U B E T R I E B S W I R T S C H A F T M A R K T P O L I T I K A K T U E L L E S<br />
Rest lag in diesem Jahr bei 7,5 %<br />
Foto: agrar-press<br />
ter anderem beim Feldtag in Nörvenich<br />
vorgestellt. Ob die Rübenentblattung für<br />
alle Beteiligten ein Ernteverfahren mit<br />
Zukunft ist, muss umfassend, mehrjährig<br />
<strong>und</strong> unter Betrachtung aller Kostenaspekte<br />
geprüft werden. Dies tun wir. Bis zu einem<br />
Ergebnis gilt die bestehende Regelung,<br />
dass geköpfte Rüben in die Zuckerfabriken<br />
zu liefern sind.<br />
Realistische Anbauplanung wichtig<br />
So sehr alle Beteiligten die gute Ernte, die<br />
zufriedenstellenden Erlöse <strong>und</strong> auch die<br />
gute Auslastung der rheinischen Zuckerfabriken<br />
erfreute, so sehr zeigte das Thema<br />
Nichtquotenzucker auf, wie wichtig es<br />
ist, auch in Zukunft auf ein vernünftiges<br />
Mengenmanagement zu setzen. Dieses<br />
beginnt bei der Anbauplanung <strong>und</strong> natürlich<br />
auch bei der Anbauempfehlung. Der<br />
Rheinische Rübenbauer-Verband <strong>und</strong> Pfeifer<br />
& Langen empfehlen für das Anbau-<br />
„Mit einer guten Lage im Herzen Europas,<br />
aber auch mit hervorragenden Böden<br />
<strong>und</strong> großer Nähe zum Verbraucher bot<br />
sich das Rheinland schon immer als<br />
Ackerbaustandort an. Die Tatsache, dass<br />
der Rübenanbau im Rheinland auch nach<br />
der Reform der Zuckermarktordnung mit<br />
ihren dramatischen Preissenkungen von<br />
r<strong>und</strong> 40 % auf <strong>hohe</strong>m Niveau erhalten<br />
blieb, bestätigt diese Einschätzung“, erklärte<br />
Johannes Frizen, Präsident der<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-<br />
Westfalen, in seiner Begrüßung.<br />
Wohin geht der Weltmarktpreis?<br />
Zunächst warf Stefan Uhlenbrock aus<br />
dem Marktforschungshaus F.O. Licht in<br />
Ratzeburg einen Blick auf den Zuckerweltmarkt.<br />
„Der Zuckerpreis ist seit dem<br />
1. Januar 2009 um 123 % gestiegen <strong>und</strong><br />
liegt damit auf einem sehr <strong>hohe</strong>n Niveau,<br />
jahr 2010 die sichere Erfüllung aller vertraglichen<br />
Liefermengen. Die Erzeugung<br />
von Überrüben sollte aber auf das zur Absicherung<br />
der Vertragsmengenerzeugung<br />
notwendige Maß begrenzt werden.<br />
Gr<strong>und</strong>lage der Planung ist zum einen die<br />
Berücksichtigung eines eventuellen Vortrags,<br />
der nach der Brüsseler Entscheidung<br />
zu weiteren Exporten von Nichtquotenzucker<br />
wesentlich geringer ausfallen wird,<br />
als anfänglich befürchtet. Wesentlich ist<br />
aber auch eine realistische Ertragsplanung.<br />
Diese sollte auf dem Durchschnittsertrag<br />
der vergangenen fünf Jahre <strong>und</strong><br />
dem durchschnittlichen Zuckergehalt in<br />
diesem Zeitraum beruhen.<br />
Ein wesentlicher Aspekt in den Verhandlungen<br />
mit der Zuckerindustrie ist<br />
für den Rheinischen Rübenbauer-Verband<br />
immer die Planungssicherheit für seine<br />
Mitglieder. Zur Planungssicherheit gehören<br />
sowohl die Mengensteuerung als<br />
das bisher nur von den Preisen in der ersten<br />
<strong>und</strong> zweiten Ölkrise übertroffen wurde“,<br />
erklärte Uhlenbrock. In den vergangenen<br />
Jahrzehnten sei die Zuckererzeugung<br />
weltweit immer gestiegen. Aber im Zuckerwirtschaftsjahr<br />
2008/2009 sei es zu<br />
einem Erzeugungsrückgang von 18,9 Mio.<br />
t gekommen. Dazu beigetragen hätten<br />
alle Zuckererzeuger, allen voran Indien<br />
mit einem Rückgang um 45 %, nur Brasilien<br />
habe seine Produktionsmenge gehalten.<br />
„In 2009/2010 wird es wohl wieder<br />
zu einem Anstieg kommen, den wir auf<br />
7 Mio. t schätzen. Damit läge die Produktion<br />
bei r<strong>und</strong> 157 Mio. t. Da der Zuckerverbrauch<br />
besonders in den Entwicklungsländern,<br />
die 70 % des Verbrauchs<br />
ausmachen, weiter steigt, ist die Bilanz<br />
nicht ausgeglichen, es gibt zu wenig<br />
Zucker.“<br />
Auf dem Weltmarkt wird nur ein Drittel<br />
der Weltzuckerproduktion gehandelt.<br />
Hauptakteur auf diesem Markt ist Brasilien<br />
mit 60 %, dazu kommen Australien<br />
<strong>und</strong> Thailand: Diese drei Länder stellen<br />
mit ihren Exporten auf dem Weltmarkt<br />
drei Viertel der Rohzuckermenge weltweit.<br />
auch die Ökonomie. Daher sind bereits<br />
jetzt wesentliche Eckpfeiler der Rübenbezahlung<br />
für 2010 vereinbart worden. Bis<br />
zu einer Vertragsmengenerfüllung von<br />
105 % werden alle Rüben wie Quotenrüben<br />
bezahlt. Für weitere 10 % Überrüben<br />
gilt ein Mindestpreis von 21,60 €/t Rüben.<br />
Der Preis für Industrierüben bemisst<br />
sich anhand des vereinbarten flexiblen<br />
Preismodells. Der aktuelle Preis ist im Internet<br />
unter www.agrarmarkt-nrw.de<br />
<strong>und</strong> unter www.rrvbonn.de nachzulesen.<br />
Bis zu 115 % der kontraktierten Industrierübenmenge<br />
werden mit diesem Preis<br />
bezahlt. Gewissenhafte Anbauplanung<br />
<strong>und</strong> kalkulierbare Preise sollten dazu beitragen<br />
können, dass auch 2010 ein erfolgreiches<br />
Jahr für die rheinischen<br />
Rübenanbauer wird, in dem sich die<br />
Wettbewerbsfähigkeit des Rübenanbaus<br />
weiter festigt.<br />
Dr. Peter Kasten<br />
Rheinischer Rübenbauer-Verband e.V.<br />
Rüben zwischen Im- <strong>und</strong> Exporten<br />
Beratertagung der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau<br />
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Rüben- <strong>und</strong> Zuckererzeugung<br />
waren ein Schwerpunktthema bei der Beratertagung<br />
der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrüben Ende Januar in<br />
Düren.<br />
„Die EU ist kein relevanter Exporteur<br />
mehr. Den größten Einfluss auf dem<br />
Weltmarkt haben Brasilien <strong>und</strong> Indien.<br />
Letzteres macht abwechselnd mit Exporten<br />
<strong>und</strong> dann wieder mit Importen auf<br />
sich aufmerksam“, erklärte Uhlenbrock.<br />
Um die r<strong>und</strong> 50 Mio. Rohranbauer in Indien<br />
zu fördern, werde der Preis von der<br />
Regierung gestützt <strong>und</strong> die Mengen über<br />
Exporte reguliert. „Indien wird als Marktpartner<br />
unsicher bleiben, solange die Regierung<br />
so arbeitet. Das Zuckerrohr wird<br />
geerntet, doch sobald sich die Preise für<br />
andere Kulturen ändern, steigen die Bauern<br />
um. Dann werden die Lagerbestände<br />
abgebaut, was zu stärkeren Importen<br />
führt. Dieser indische Zyklus mit schwankenden<br />
Produktionsmengen ist typisch.“<br />
In Brasilien stiegen die Erntemengen<br />
seit dem Jahr 2000 <strong>und</strong> hätten einen regelrechten<br />
Boom erfahren. Die aktuelle<br />
Ernte sei jedoch auf Gr<strong>und</strong> von massiven<br />
Regenfällen behindert worden, r<strong>und</strong> 50<br />
Mio. t Rohr seien nicht geerntet worden,<br />
damit stünden dem Markt erhebliche<br />
Mengen nicht zur Verfügung.<br />
In Brasilien werden r<strong>und</strong> 60 % des Zuckerrohrs<br />
zu Ethanol verarbeitet <strong>und</strong> dem<br />
LZ 8 · 2010 Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L | 9
A K T U E L L E S P O L I T I K M A R K T B E T R I E B S W I R T S C H A F T A N B A U T E C H N I K Z U C K E R<br />
Gaben den Beratern einen Überblick über den Zuckermarkt:<br />
Stefan Uhlenbrock von F.O. Licht, Annie Martin, Wirtschaftliche<br />
Vereinigung Zucker, Dr. Botho von Schwarzkopf, Pfeifer & Langen, <strong>und</strong><br />
Dr. Harald Lopotz, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen<br />
(v. l. n. r.). Foto: Natascha Kreuzer<br />
Foto: Peter Hensch<br />
Benzin zu mindestens 25 % beigemischt.<br />
„Bei steigenden Zuckerpreisen wird mehr<br />
Zucker hergestellt, bei niedrigen Preisen<br />
werden die Ethanolraffinerien bedient.“<br />
Erzeugung <strong>und</strong> Export würden in Brasilien<br />
weiter steigen, allerdings lägen infolge<br />
der Wirtschaftskrise viele Neubauten<br />
besonders für Ethanolraffinerien auf Eis.<br />
Woher kommen Importe in Europa?<br />
Einen Überblick über die Zuckerimporte<br />
in die EU gab Annie Martin von der Wirtschaftlichen<br />
Vereinigung Zucker (WVZ).<br />
Im Rahmen der EU-Außenpolitik sei es<br />
schon in den 70er-Jahren zu Importen<br />
aus den AKP-Staaten aus Afrika, der Karibik<br />
<strong>und</strong> dem Pazifik gekommen. Größere<br />
Mengen seien aber vor allem in den letzten<br />
zehn Jahren hinzugekommen, zum<br />
Beispiel durch das Balkanabkommen oder<br />
durch Vereinbarungen mit den 50 ärmsten<br />
Ländern der Welt, den LDC.<br />
Seit 1. Oktober 2009 hätten die 50<br />
LDC- <strong>und</strong> die 77 AKP-Staaten unter bestimmten<br />
Voraussetzungen zoll- <strong>und</strong><br />
quotenfreien Zugang für Weiß- <strong>und</strong> Rohzucker<br />
in die EU. Die LDC- <strong>und</strong> AKP-Staaten<br />
könnten zu einem Mindestankaufspreis<br />
von 90 % des EU-Referenzpreises<br />
importieren, dieser läge bei Weißzucker<br />
bei 264 €/t. „Außerdem dürfen Australien,<br />
Brasilien, Indien <strong>und</strong> Kuba r<strong>und</strong><br />
680 000 t Rohzucker importieren, hier besteht<br />
ein Zollsatz von 98 €/t“, erklärte Annie<br />
Martin. „Dazu kommen noch Importe<br />
aus dem Balkan in Höhe von 380 000 t<br />
Weiß- oder Rohzucker sowie Isoglucose,<br />
für die aber kein Mindestpreis besteht.“<br />
Zusätzlich bestehe eine Schutzklausel,<br />
die die Importe der 36 AKP-Staaten begrenzen<br />
könne, die keine LDC sind. Diese<br />
Klausel bestehe noch bis 2015. Für die 50<br />
LDC-Staaten könne eine Schutzklausel<br />
wirksam werden, wenn die Importe aus einem<br />
Land in einem Jahr um mehr als 25 %<br />
steigen, so eine Kommissionserklärung.<br />
Die EU habe sich vom zweitgrößten Exporteur<br />
auf den Weltmarkt zum Nettoimporteur<br />
entwickelt. Damit würden 20 %<br />
des europäischen Verzehrs aus Importen<br />
gedeckt, von denen r<strong>und</strong> zwei Drittel aus<br />
den AKP- <strong>und</strong> LDC-Staaten kommen, r<strong>und</strong><br />
20 % kommen aus Australien, Kuba <strong>und</strong><br />
Brasilien <strong>und</strong> 13 % vom Balkan. Für die Zukunft<br />
seien noch weitere Handelsabkommen<br />
geplant, derzeit verhandele die EU<br />
zum Beispiel mit Zentralamerika, den<br />
Mercosur-Staaten in Südamerika, der<br />
Ukraine, Indien, den südost-asiatischen<br />
ASEAN-Staaten oder Kanada. „Die EU<br />
muss in den bestehenden Verhandlungen<br />
die Schutzklauseln konsequent anwenden<br />
<strong>und</strong> darf in neuen Abkommen keine weiteren<br />
Öffnungen für Zucker oder zuckerhaltige<br />
Produkte zusagen. Die Ursprungsregeln<br />
müssen verschärft werden, um den<br />
Umgehungshandel zu unterbinden, das<br />
ist die Position der WVZ.“<br />
Aus Sicht der Zuckerunternehmen<br />
Welche Konsequenzen die Zuckerimporte<br />
für ein Zuckerunternehmen haben, erläuterte<br />
Dr. Botho von Schwarzkopf, Mitglied<br />
der Geschäftsführung der Pfeifer & Langen<br />
KG. „Wir haben unsere Produktion<br />
immer auf die Rübe als Rohstoff ausgerichtet<br />
<strong>und</strong> versucht, mit einer guten<br />
Marktorientierung <strong>und</strong> Innovationen unsere<br />
Position zu stärken“, erklärte er mit<br />
Blick auf die 140-jährige Firmengeschichte.<br />
Pfeifer & Langen (P & L) habe sich mit<br />
Werken in Deutschland, Polen oder Rumänien<br />
in Europa gut aufgestellt, dazu<br />
kämen Vertriebsstandorte zum Beispiel in<br />
Tschechien, Ungarn, auf dem Balkan, in<br />
Griechenland <strong>und</strong> Italien. Die Zuckerquote<br />
betrage r<strong>und</strong> 1,03 Mio. t <strong>und</strong> sei im<br />
Rahmen der Restrukturierung um 21,9 %<br />
zurückgegangen.<br />
Der Markt in Europa sei vereinfacht<br />
gesagt von einem Überschuss in Nordwest-Europa<br />
<strong>und</strong> einer Unterversorgung<br />
in Südost-Europa gekennzeichnet. „Die<br />
Defizite müssen ausgeglichen werden,<br />
dies geht am einfachsten über Rohzuckerimporte,<br />
um die vorhandenen Werkskapazitäten<br />
besser auszunutzen <strong>und</strong> die<br />
Stückkosten zu senken“, erklärte Dr. von<br />
Schwarzkopf. Dabei seien die Schwerpunkte<br />
in den einzelnen Ländern unterschiedlich.<br />
In Rumänien beispielsweise<br />
gehe es darum, die Gr<strong>und</strong>versorgung zu<br />
sichern. In Deutschland dagegen gebe es<br />
nur regionale <strong>und</strong> saisonale Defizite, die<br />
durch die Rohzuckerimporte, wie beispielsweise<br />
neuerdings in Euskirchen, gedeckt<br />
würden.<br />
Mit Blick auf die Importe aus den AKP-<br />
Staaten erklärte Dr. von Schwarzkopf,<br />
dass die Zuckermengen für den Export<br />
knapp seien <strong>und</strong> es nicht so einfach sei,<br />
größere Zuckermengen ohne feste Kontrakte<br />
zu kaufen. „Hier wird es meiner<br />
Meinung nach keine rasanten Entwicklungen<br />
geben, denn es werden nur die<br />
Mengen verkauft, die nicht für den eigenen<br />
Bedarf gebraucht werden. Der Zucker<br />
bleibt oft in der Region, weil die Transportkosten<br />
niedriger sind, vor allem bei<br />
<strong>hohe</strong>m Weltmarktpreis.“ P & L versuche,<br />
eine Position in Ostafrika aufzubauen,<br />
um dort über feste Handelsbeziehungen<br />
Rohzucker zu beziehen.<br />
Wo stehen die Ackerbaubetriebe?<br />
Welche Entwicklungsmöglichkeiten hat<br />
ein nordrhein-westfälischer Ackerbaubetrieb?<br />
Dieser Frage ging Dr. Harald Lopotz,<br />
Landwirtschaftskammer NRW, nach. Die<br />
Landwirtschaft sei eine Zukunftsbranche,<br />
stehe aber stark unter gesellschaftlicher<br />
Kontrolle. Außerdem seien die Märkte viel<br />
wechselhafter als früher. Auch wenn über<br />
die staatliche Förderung gewisse Preisuntergrenzen<br />
bestünden, seien diese Preise<br />
nicht kostendeckend. Die Unternehmer<br />
müssten immer flexibler sein, noch mehr<br />
die Märkte beobachten <strong>und</strong> alle Wachstumsoptionen<br />
nutzen. „Da die Fläche aber<br />
zurückgeht <strong>und</strong> die Veredlungs- <strong>und</strong> die<br />
Biogasbetriebe den Pachtmarkt für sich<br />
beeinflussen, wird die Situation für die<br />
Ackerbauern schwieriger“, erklärte Dr.<br />
Lopotz. „Viele Ackerbaubetriebe können<br />
beim Bieten um Pachtflächen nicht mehr<br />
mithalten <strong>und</strong> befinden sich in einer<br />
Warteposition.“ Der einzige Ausweg sei<br />
eine Erhöhung der Wertschöpfung pro<br />
Hektar durch <strong>hohe</strong> Erträge, angepasste<br />
Direktkosten <strong>und</strong> niedrige Arbeitserledigungskosten.<br />
Dazu gehörten auch ein geringer<br />
Maschinenbesatz <strong>und</strong> eine optimale<br />
Vermarktung. Nur wer seine Produktionskosten<br />
<strong>und</strong> die Liquiditätsschwelle<br />
kenne, könne dies als Entscheidungshilfe<br />
nutzen. Die Beratung der Kammer könne<br />
bei der Frage „Durchstarten, abwarten<br />
oder ausscheiden“ helfen.<br />
Natascha Kreuzer<br />
10 | Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L LZ 8 · 2010
Z U C K E R T E C H N I K A N B A U B E T R I E B S W I R T S C H A F T M A R K T P O L I T I K A K T U E L L E S<br />
Wie rechnete sich die Ernte 2009?<br />
Auswertung der Schlagkartei für Zuckerrüben<br />
Die Mitglieder des Arbeitskreises für Betriebsführung Köln-<br />
Aachener Bucht waren wie fast alle rheinischen Zuckerrübenbauern<br />
mit ihrer Ernte 2009 mehr als zufrieden. Das dritte Jahr<br />
in Folge lag die Erntemenge im Durchschnitt über 70 t/ha <strong>und</strong><br />
2009 mit 75,3 t/ha noch einmal um 2 t höher als in den vergangenen<br />
Jahren. Die relativ ausgeglichenen Temperaturen<br />
<strong>und</strong> vor allem die gleichmäßigen Niederschläge bescherten<br />
den Landwirten diese sehr guten Ergebnisse.<br />
Herausragender noch als die Erntemenge<br />
zeigte sich der Zuckergehalt, der in allen<br />
Betrieben überdurchschnittlich ausfiel<br />
<strong>und</strong> im Mittel 18,5 % betrug. Nur einmal,<br />
1987, wurden mehr als 18 % Zucker geerntet,<br />
damals allerdings bei nur 50 t Rüben.<br />
So erreichte der Zuckerertrag 2009 die<br />
noch nie erzielte Menge von 13,92 t/ha.<br />
Vor zwei Jahren wurde das Ziel formuliert,<br />
im Jahr 2015 zu 15 €/t Stückkosten 15<br />
t/ha Zucker zu ernten. Schon jetzt haben<br />
vier Betriebe des Arbeitskreises zumindest<br />
das Mengenziel von 15 t Zucker erreicht,<br />
Tabelle 1: Auswertung der Schlagkartei für Zuckerrüben AK I<br />
<strong>und</strong> beschränkt man sich bei dem Kostenziel<br />
auf die variablen Stückkosten, so erreichen<br />
das in diesem Jahr auch die Besten.<br />
Bis auf die genaue Schnitzelvergütung<br />
sind die zu erwartenden Preise bereits be-<br />
Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Fläche, ha 1 271 1 195 1 299 1150 1 103 1 342<br />
Schläge, Anzahl 139 113 135 130 106 137<br />
Ackerzahl, Durchschnitt 76 75 78 72 74 76<br />
Rübenertrag, t/ha 68 65,8 63,1 72,8 73,4 75,3<br />
Zuckergehalt, % 16,9 17,7 16,4 16,6 17,2 18,5<br />
Zuckerertrag, t/ha 11,5 11,7 10,3 12,1 12,6 13,9<br />
Preis inklusive Schnitzel (Brutto), €/dt 47,60 47,80 39,40 35,30 36,20 35,50<br />
Lieferprämie, Entschädigung, €/ha 25 19 23 29 66 83<br />
Marktleistung1) , €/ha 3 247 3 164 2 507 2 599 2 723 2756<br />
Saatgut, €/ha 241 248 253 246 250 238<br />
Düngung3) , €/ha 175 183 208 207 415 391<br />
N-Düngung, kg/ha 170 162 185 150 140 141<br />
Pflanzenschutz, €/ha 213 217 228 260 244 264<br />
" Herbizide, €/ha 175 183 193 208 198 206<br />
" Insektizide, €/ha 2 3 1 1 1 2<br />
" Fungizide, €/ha 36 31 33 48 40 50<br />
" Sonstige, €/ha 0 0 1 3 5 6<br />
Direktkosten, €/ha 629 648 689 713 909 893<br />
Direktkostenfreie Leistung, €/ha<br />
Sonstige variable Kosten<br />
2 618 2 516 1 818 1 886 1 814 1 863<br />
(Saison-AK, Hagelversicherung, Vlies), €/ha 52 58 43 48 43 53<br />
Variable Maschinenkosten3) , €/ha 203 224 255 275 280 270<br />
Überfahrten Pflege4) , Anzahl 7,7 7,4 7,0 7,5 7,2 7,8<br />
Variable Spezialkosten, €/ha 883 929 987 1 036 1 232 1 216<br />
Deckungsbeitrag5) , €/ha 2 364 2 235 1 520 1 563 1 491 1 540<br />
1) Ohne Bonus Malus, ohne Qualitätsprämie, 2) Gr<strong>und</strong>düngung nach Entzug, 3) Eigenerledigung aller Arbeiten, 4) Pflanzenschutz<br />
<strong>und</strong> mineralische Stickstoffdüngung, 5) Bei jeweiligem Zuckergehalt <strong>und</strong> Produktionsquoten – sowie eventueller<br />
Industrierübenanteil <strong>und</strong> ohne Prämie<br />
Die Erlöse aus dem Zuckerrübenanbau waren 2009 wegen der guten Ernte ausreichend, werden<br />
aber voraussichtlich 2010 auch wegen des Rübenvortrags zurückgehen. Dabei spielt für den Gesamtbetrieb<br />
auch eine Rolle, wo die Preise der anderen Kulturen liegen werden. Foto: Peter Hensch<br />
kannt. 2009 trat die letzte Stufe der Preissenkungen<br />
nach der Änderung der Zuckermarktordnung<br />
in Kraft <strong>und</strong> die Mindestpreise<br />
für die Vertragsmenge – bezogen<br />
auf 16 % – liegen jetzt bis 2013 bei<br />
25,44 €/t.<br />
Die bei der Auswertung zugr<strong>und</strong>e gelegten<br />
Preise basieren auf dem Durchschnitt<br />
der Preise für die Vertragsmenge,<br />
dem Anteil an Industrierüben (Festpreismodell<br />
zu 25 €/t netto) <strong>und</strong> dem Anteil<br />
der Überrüben (zu 21,60 €/t). Dabei wurde<br />
berücksichtigt, dass ab 2009 5 % Überrüben<br />
zum Vertragspreis abgerechnet<br />
werden, ebenso wird mit 15 % Überlieferung<br />
bei den Industrierüben verfahren.<br />
Trotzdem hatten die meisten Betriebe<br />
noch Überrüben abzurechnen, bis maximal<br />
30 % zum Überrübenpreis sind angefallen.<br />
Unberücksichtigt blieben bei der<br />
Preisberechnung der mögliche Vortrag<br />
auf 2010 <strong>und</strong> die Qualitätszuschläge.<br />
Der Durchschnittspreis über alle Betriebe<br />
liegt mit 35,50 €/t vor allem durch<br />
die <strong>hohe</strong>n <strong>Zuckergehalte</strong> nur geringfügig<br />
unter dem Preis 2008 <strong>und</strong> sogar etwas<br />
über dem Preis von 2007.<br />
In Tabelle 1 sind die Ergebnisse dargestellt,<br />
die Marktleistung einschließlich<br />
Lieferprämien liegt 2009 mit 2 756 €/ha<br />
ungefähr auf gleicher Höhe wie 2008 <strong>und</strong><br />
sogar noch etwas höher als 2007 <strong>und</strong><br />
2006.<br />
Bei den variablen Spezialkosten hat<br />
sich im Vergleich zum vergangenen Jahr<br />
nicht viel verändert. Die Saatgut- <strong>und</strong><br />
Düngerkosten sind etwas gesunken <strong>und</strong><br />
die Ausgaben für den Pflanzenschutz um<br />
LZ 8 · 2010 Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L | 11
A K T U E L L E S P O L I T I K M A R K T B E T R I E B S W I R T S C H A F T A N B A U T E C H N I K Z U C K E R<br />
Grafik: Entwicklung der Deckungsbeiträge von Zuckerrüben<br />
<strong>und</strong> Winterweizen<br />
3 000<br />
2 500<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
0<br />
€/ha<br />
Zuckerrüben<br />
guter Standort<br />
Winterweizen<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
20 €/ha gestiegen. Auch 2009 zahlte es<br />
sich aus, dass viele Betriebe organischen<br />
Dünger eingesetzt haben. Manche konnten<br />
auf diese Weise bis zu 200 €/ha einsparen.<br />
Eine neue Kostenposition ist 2009<br />
bei den „sonstigen variablen Kosten“ hinzugekommen,<br />
nämlich die Kosten für die<br />
Mietenabdeckung gegen Frost, hier kurz<br />
mit Vlies bezeichnet. Verteilt auf alle Parzellen<br />
schlagen diese Kosten zwar noch<br />
nicht sehr stark zu Buche, aber bei den<br />
Schlägen, deren Ernte abgedeckt werden<br />
musste, sind bei Fremdabdeckung ungefähr<br />
50 bis 70 €/ha zu bezahlen. Die Betriebsleiter<br />
äußern sich aber sehr zufrie-<br />
den über den Frostfonds.<br />
Tabelle 1 zeigt auch,<br />
dass mit 1 540 €/ha der<br />
Deckungsbeitrag etwas höher<br />
liegt als im Vorjahr, die Deckungsbeiträge<br />
seit 2006 ungefähr auf<br />
gleicher Höhe sind, weil die ertragreichen<br />
Jahre 2007 bis 2009 die Preissenkungen<br />
aus der Zuckermarktordnung fast<br />
ausgleichen konnten.<br />
Zuckerrübenerzeugung<br />
kostendeckend?<br />
Tabelle 2: Stückkostenvergleich der Fruchtarten bei zwei verschiedenen Standorten<br />
2008<br />
2009<br />
Die erfreulichen Ernteergebnisse der Zuckerrübenbauern<br />
<strong>und</strong> auch die Bezahlung<br />
aller Rüben durch die Fabriken führten<br />
2009 dazu, dass in den meisten Fällen die<br />
Zuckerrübenerzeugung kostendeckend<br />
war <strong>und</strong> auch die eingesetzten Faktoren<br />
Boden, Arbeit <strong>und</strong> Kapital entlohnt wer-<br />
den konnten. Die Unternehmergewinne<br />
liegen zwar<br />
deutlich unter denen vor<br />
der Reform der Zuckermarktordnung,<br />
aber<br />
die Ergebnisse liegen<br />
„im grünen Bereich“.<br />
Zu den Spezialkosten<br />
von r<strong>und</strong> 1 200 €/ha kommen noch<br />
1 100 €/ha feste Kosten. Dividiert durch<br />
den jeweiligen Ertrag ergeben sich Stückkosten<br />
von 31 bis 36 €/t, siehe Tabelle 2.<br />
Die Zuckerrübe braucht den<br />
Wettbewerb nicht zu scheuen<br />
In Tabelle 2 sind auch die Kostenpositionen<br />
zweier alternativer Früchte, Winterweizen<br />
<strong>und</strong> Raps, dargestellt. Bei diesen<br />
beiden Früchten wird unter den aktuellen<br />
Bedingungen noch nicht einmal die Gewinnschwelle<br />
erreicht, also können die<br />
Betriebe daraus kein Einkommen erwirtschaften.<br />
Standort 1 Standort 2<br />
Fruchtart Weizen Raps Zuckerrüben Weizen Raps Zuckerrüben<br />
Ertrag in t/ha 9,5 4,7 75,0 8,6 4,2 63,0<br />
Kostenpositionen: €/ha €/t €/ha €/t €/ha €/t €/ha €/t €/ha €/t €/ha €/t<br />
Saatgut 77 73 240 77 73 250<br />
Dünger 250 260 310 230 240 290<br />
Pflanzenschutz 163 175 265 155 165 250<br />
Sonstige 15 15 50 15 15 25<br />
Summe Direktkosten 505 53 523 111 865 12 477 56 493 117 815 13<br />
Variable Maschinenkosten 85 83 110 85 83 110<br />
Variable Arbeitskosten 0 0 0 0 0 0<br />
Erntekosten inklusive Transport 122 111 240 122 111 240<br />
Variable Spezialkosten 712 717 1 215 684 687 1 165<br />
Produktionsschwelle 1 712 75 717 153 1 215 16 684 80 687 164 1 165 18<br />
Pacht (50 %) 250 250 250 250 250 250<br />
Lohnkosten 120 120 180 120 120 180<br />
Allgemeine Kosten/Gebäude Unterhaltung 160 160 160 160 160 160<br />
./. Flächenprämie – 300 – 300 – 300 – 300 – 300 – 300<br />
Produktionsschwelle 2 942 99 947 201 1 505 20 914 107 917 218 1 455 23<br />
Flächenprämie (wieder plus) 300 300 300 300 300 300<br />
Abschreibung (Maschinen/Gebäude) 110 110 180 110 110 180<br />
Gewinnschwelle (ohne Prämie) 1 352 142 1 357 289 1 985 26 1 324 155 1 327 316 1 935 31<br />
Lohnansatz 150 150 150 150 150 150<br />
Pachtansatz 100 100 100 100 100 100<br />
Zinsansatz 110 95 110 110 95 110<br />
Unternehmergewinnschwelle 1 712 180 1 702 362 2 345 31 1 684 197 1 672 398 2 295 36<br />
12 | Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L LZ 8 · 2010
Z U C K E R T E C H N I K A N B A U B E T R I E B S W I R T S C H A F T M A R K T P O L I T I K A K T U E L L E S<br />
2010 Erlöseinbußen zu erwarten<br />
Es ist allerdings jetzt schon abzusehen,<br />
dass sich die guten Erlöse in 2010 nicht<br />
wiederholen können. Trotz der <strong>hohe</strong>n<br />
Weltmarktpreise für Zucker kann Pfeifer<br />
& Langen nach den derzeitigen EU-Regelungen<br />
<strong>und</strong> WTO-Abmachungen nicht<br />
ausreichend Zucker exportieren, sondern<br />
muss ihn ins nächste Jahr vortragen. Dieser<br />
Vortrag muss an die Erzeuger weitergegeben<br />
werden. Durch die zusätzlichen<br />
Lagerkosten in Höhe von 3 €/t liegen die<br />
Preise für Vortragsrüben nur geringfügig<br />
über denen von Überrüben. Wirtschaftlich<br />
gehört der Vortrag zu 2009, auch<br />
wenn erst 2010 bezahlt wird.<br />
Aber nicht nur die notwendige Einschränkung<br />
des Zuckerrübenanbaus<br />
durch den Vortrag wird zu Erlöseinbußen<br />
2010 führen, auch die aller Voraussicht<br />
nach niedrigeren Durchschnittspreise bei<br />
wieder normalen <strong>Zuckergehalte</strong>n <strong>und</strong> die<br />
Tatsache, dass 2010 zwar auch 5 % Überrüben<br />
zum Quotenpreis bezahlt werden,<br />
darüber hinaus 10 % der Überrüben eine<br />
Mindestpreiszusage haben, werden die<br />
Erlöse sinken lassen. Insgesamt muss mit<br />
einem Mindererlös aus Zuckerrüben in<br />
2010 gerechnet werden, der nur teilweise<br />
durch den Anbau von Alternativfrüchten<br />
ausgeglichen werden kann, sodass bei<br />
den aktuellen Getreidepreisen auch der<br />
Gesamtdeckungsbeitrag sinken wird.<br />
Es sind schwierige Zeiten für die rheinischen<br />
Ackerbaubetriebe, denn seit der<br />
Änderung der Zuckermarktordnung können<br />
die Zuckerrüben das Einkommen<br />
nicht mehr sichern <strong>und</strong> die Alternativfrüchte<br />
schaffen keinen Ausgleich, auch<br />
wenn es zwischenzeitlich so aussah.<br />
Zwischen 2005 <strong>und</strong> 2006 sind die Gewinne<br />
aus Zuckerrüben drastisch gesunken.<br />
Trotzdem ist der tatsächliche Gesamtgewinn<br />
zum Vorjahr nicht gesunken, weil<br />
die Getreidepreise angestiegen sind. Weil<br />
von 2008 auf 2009 die Preise von Getreide<br />
<strong>und</strong> Raps aber weiter zurückgingen,<br />
sanken auch die Gewinne, <strong>und</strong> durch die<br />
zu erwartenden Erlöseinbußen bei den<br />
Zuckerrüben wird der Gewinn 2010 noch<br />
einmal weniger, sollten die Anteile aus<br />
den übrigen Früchten auf bestehendem<br />
Niveau bleiben.<br />
Die Ackerbauern sollten also trotz der<br />
so erfreulichen Ernteergebnisse 2009<br />
nicht müde werden, alle ackerbaulichen<br />
Maßnahmen zur weiteren Ertragssicherung<br />
<strong>und</strong> Kostensenkung zu ergreifen.<br />
Dazu gehören auch natürlich alle unternehmerischen<br />
Überlegungen zur Sicherung<br />
der Liquidität, zur optimalen Vermarktung<br />
ihrer Produkte <strong>und</strong> zur Weiterentwicklung<br />
ihres Unternehmens.<br />
Inge Schneider<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen<br />
Maschinenvorführung im Maifeld<br />
Humus im Focus des<br />
Ackerbaus<br />
Bernhard Conzen, Vorsitzender des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes,<br />
schilderte bei der Beratertagung am Beispiel<br />
seines Ackerbaubetriebes in Gangelt, wie eine Strategie<br />
zum Humus-Erhalt <strong>und</strong> -Aufbau aussehen kann. „Eine <strong>hohe</strong><br />
Bodenfruchtbarkeit ist die Basis guter Erträge <strong>und</strong> ich versuche,<br />
den Gedanken der Nachhaltigkeit zu verfolgen.“ Mit<br />
Blick auf die Politik erklärte er: „Die Devise muss lauten:<br />
Selbstverpflichtung anstelle von Zwangsbewirtschaftung<br />
<strong>und</strong> Auflagenflut, dies gilt auch für die Humuswirtschaft.“<br />
Wie man für eine Fruchtfolge die Humusbilanz berechnen,<br />
erläuterte Clemens Eßer vom Landwirtschaftlichen Informationsdienst<br />
Zuckerrübe (LIZ) anhand des Programms LIZ-<br />
Humusbilanz. Werden zum Beispiel bei einer Fruchtfolge<br />
mit Rüben, Weizen <strong>und</strong> Stoppelweizen die Cross-Compliance-Anforderung<br />
mit dem Anbau von mindestens drei Kulturen<br />
<strong>und</strong> mindestens je 15 % der Ackerfläche nicht erfüllt,<br />
kann alternativ eine jährliche Humusbilanz durchgeführt<br />
werden. Da im berechneten Beispiel allerdings nur das<br />
Rübenblatt als Humuslieferant genutzt wird, liegt dessen<br />
Durchschnittssaldo über drei Jahre wiederum unterhalb<br />
des Cross-Compliance-Mindestwertes von –75 kg C je ha.<br />
Verschiedene Berechnungen zur Humusbilanzierung konnten<br />
zeigen, dass ein zusätzlicher Zwischenfruchtanbau<br />
trotz vieler anderer Vorteile für die C-Bilanz keine großen<br />
Effekte bringt. Erst wenn der Betrieb in der Fruchtfolge mit<br />
Rüben-Weizen-Weizen die Hälfte des Weizenstrohs auf<br />
dem Acker lasse oder Kompost dünge, sei die C-Bilanz im<br />
Rahmen der CC-Vorgaben ausgeglichen.<br />
Bilanzierungshilfen, wie das vorgestellte Programm LIZ-<br />
Humusbilanz, gibt es im Internet unter www.liz-online.de.<br />
Mit gleicher Datengr<strong>und</strong>lage arbeitet die Kalkulation der<br />
Landwirtschaftskammer NRW innerhalb des Nährstoffvergleichs<br />
NRW.<br />
Über 60 Rübenanbauer besuchten die Maschinenvorführung zum maschinellen Mietenabdecken mit dem Vliesgerät<br />
Anfang Dezember auf Flächen von Werner Schnorpfeil in Münstermaifeld-Metternich. Bei frischen Temperaturen führte<br />
das Lohnunternehmen Mörtter aus Hennef im Auftrag des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes <strong>und</strong> der Zuckerfabrik<br />
Euskirchen die maschinelle Abdeckung der Rübenmiete vor. Aktuelle Informationen zur Vermarktungssituation <strong>und</strong><br />
zum Rübenvortrag sowie zur praktischen Durchführung der maschinellen Mietenabdeckung ergänzten die Maschinenvorführung.<br />
Fotos: Eduard Eich<br />
LZ 8 · 2010 Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L | 13
A K T U E L L E S P O L I T I K M A R K T B E T R I E B S W I R T S C H A F T A N B A U T E C H N I K Z U C K E R<br />
Rekordernte, aber auch kranke Rüben<br />
Faule Rüben können viele Ursachen haben<br />
Für die Spitzenerträge in der Zuckerrübenernte 2009 sind auf<br />
fast allen Standorten die sehr günstigen Witterungsbedingungen<br />
verantwortlich zu machen. Dennoch tauchten in der Kampagne<br />
2009 Lieferungen mit kranken <strong>und</strong> faulenden Zuckerrüben<br />
auf. Dabei waren die vielen Schadbilder ohne eine differenzierte<br />
Laboruntersuchung teilweise kaum zu unterscheiden.<br />
Rhizoctonia solani<br />
In den Lieferungen mit faulen Rüben wurde<br />
mehrfach das Schadbild der späten<br />
Rübenfäule Rhizoctonia solani festgestellt.<br />
Diese Fäulnis beginnt immer am<br />
Rübenkörper kurz unterhalb der Bodenoberfläche<br />
<strong>und</strong> ist zu Beginn eine trockene<br />
braune bis schwarze Fäulnis, die wenige<br />
Zentimeter in den Rübenkörper eindringt.<br />
Die Leitbündel im Rübenkörper sowie<br />
Rübenkopf <strong>und</strong> das Blattwerk sehen<br />
lange Zeit ges<strong>und</strong> aus, sodass die Krankheit<br />
oft erst bei der Ernte festgestellt<br />
wird.<br />
Erst wenn sek<strong>und</strong>äre pilzliche Erreger,<br />
wie Fusarium, Penicillium, Aspergillus<br />
<strong>und</strong> Botrytis sowie zahlreiche Bakterien,<br />
zur weiteren Zersetzung des Rübenkörpers<br />
beitragen, tritt der Schaden deutlich<br />
hervor. Typisch sind dabei die abgestorbenen<br />
Blätter, die sternförmig um den mumifizierten<br />
Rübenkörper liegen. Im Rübenschlag<br />
beginnt der Befall meist nesterweise.<br />
Unter günstigen Bedingungen<br />
kann der Pilz von dort aus ein ganzes Feld<br />
besiedeln <strong>und</strong> die Fläche auf Dauer belasten.<br />
Der für die Krankheit ursächliche Biotyp<br />
des Pilzes Rhizoctonia solani AG 2-2II-<br />
IB reichert sich bei enger Fruchtfolge<br />
<strong>und</strong> anderen Wirtspflanzen, wie zum<br />
Beispiel Mais, in den Böden an. Die<br />
Dauerkörper sind jahrelang lebensfähig.<br />
Eine schnelle Bodenerwärmung<br />
im Frühjahr, eine<br />
schlechte Bodenstruktur mit<br />
<strong>hohe</strong>n CO2- <strong>und</strong> geringen Sauerstoffmengen<br />
im Boden fördern<br />
den Pilz ebenso wie mangelnde,<br />
unausgeglichene Ernährung <strong>und</strong><br />
eine unsachgemäße Bewässerung.<br />
Inzwischen steht mit dem Anbau<br />
von resistenten Sorten, zum Beispiel<br />
Nauta, Premiere oder Syncro, ein geeignetes<br />
Mittel zur Wahl, um den Pilz ein-<br />
Bormangel: Hohlraum im Rübenkopf, Eindringen von Sek<strong>und</strong>ärerregern, Besatz des Rübenkörpers<br />
mit Schimmelpilzen Fotos: Dr. Monika Heupel<br />
zudämmen. Dennoch dürfen ackerbauliche<br />
Maßnahmen wie Fruchtfolgeerweiterung<br />
oder Zwischenfruchtanbau nicht<br />
vergessen werden.<br />
Noch andere Rhizoctonia-Arten<br />
Neben dem Pilz Rhizoctonia solani konnten<br />
in der Kampagne auch die Schadsymptome<br />
durch den Erreger Rhizoctonia<br />
violacea beobachtet werden. Dieser Pilz<br />
überzieht den Rübenkörper mit einem rot<br />
bis dunkelviolett gefärbten Pilzmyzel. Der<br />
Befall setzt dabei häufig im unteren Teil<br />
des Rübenkörpers an <strong>und</strong> dringt nur wenig<br />
in das Rübenfleisch ein. Wenn die flache<br />
Fäulnis in eine tiefere Fäulnis der Zuckerrüben<br />
übergeht, sind in der Regel sek<strong>und</strong>äre<br />
Erreger aus den Pilzgattungen<br />
Fusarium <strong>und</strong> Penicillium sowie Bakterien<br />
beteiligt. Der flächige Überzug der<br />
Rüben mit Pilzfäden verursachte vielfach<br />
einen sehr starken Erdanhang nach der<br />
Ernte.<br />
Rhizoctonia violacea trat im Jahr 2009<br />
auf außergewöhnlich vielen Flächen auf.<br />
Der Pilz wurde durch die Wärme gefördert,<br />
das außergewöhnliche Dickenwachstum<br />
hat Eintrittspforten in den Rübenkörper<br />
geschaffen. Befallene Rüben<br />
sind sehr anfällig für sek<strong>und</strong>äre Erreger.<br />
Vor allem in den Rübenmieten besteht<br />
die Gefahr, dass die trockene flache Fäulnis<br />
durch sek<strong>und</strong>äre Pilze <strong>und</strong> Bakterien<br />
in eine vollständige Zersetzung der Rübenkörper<br />
übergeht.<br />
Im Feld ist die Symptomatik ähnlich<br />
wie bei Rhizoctonia solani zunächst nesterweise<br />
zu beobachten. Der Pilz überlebt<br />
mit seinen Sklerotien jahrelang im Boden.<br />
Symptome werden nur in sehr warmen<br />
Jahren beobachtet. Ein regelmäßiges Auftreten<br />
wird in Frankreich <strong>und</strong> Spanien<br />
gemeldet. Befallsfördernd sind nach<br />
heutigem Kenntnisstand in jedem Fall<br />
eine schlechte Bodenstruktur <strong>und</strong> der<br />
häufige Anbau von Wirtspflanzen, zu<br />
denen insbesondere Möhren, Sellerie,<br />
Spargel <strong>und</strong> Schwarzwurzeln gehören.<br />
Gegenüber Rhizoctonia solani resistente<br />
Sorten sind nicht zwangsläu-<br />
Rotfäule: Violetter Pilzüberzug auf der Oberfläche<br />
der Rübenkörper, sek<strong>und</strong>ärer Befall mit<br />
Schimmelpilzen <strong>und</strong> weiteren Pilzen, starker<br />
Erdanhang, zunächst trockene Fäulnis, die nur<br />
geringfügig in das Rübenfleisch eindringt.<br />
14 | Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L LZ 8 · 2010
Z U C K E R T E C H N I K A N B A U B E T R I E B S W I R T S C H A F T M A R K T P O L I T I K A K T U E L L E S<br />
fig gegenüber Rhizoctonia violacea resistent.<br />
Nematoden eine Ursache?<br />
Besonders schwierig war in der Kampagne<br />
die Differenzierung zwischen Rhizoctonia-<br />
<strong>und</strong> Ditylenchus-Fäulnis. Fäulnis<br />
durch Ditylenchus wird durch das Rübenkopfälchen<br />
Ditylenchus dipsaci hervorgerufen.<br />
Der Nematode hat sich in den<br />
letzten Jahren in einigen rheinischen Anbaugebieten,<br />
aber auch in Bayern <strong>und</strong> Baden-Württemberg<br />
verbreitet. Setzt der<br />
Befall früh, schon kurz nach dem Auflaufen<br />
der Rübe ein, kommt es zu starken<br />
Blattverdrehungen – wie sie auch bei Herbizidschäden<br />
auftreten – bis hin zum Absterben<br />
der Pflanzen. Junge Rüben, die<br />
diese Phase überstanden haben, wachsen<br />
dann zunächst unauffällig weiter. Im weiteren<br />
Vegetationsverlauf <strong>und</strong> der sprunghaften<br />
Vermehrung der Nematoden<br />
durch immer neue Generationen bildet<br />
sich kurz unter dem Blattansatz im Kopfbereich<br />
der Rübe weißes, lockeres, blasiges<br />
Luftgewebe. In diesem Gewebe finden<br />
sich bei Untersuchungen je Gramm<br />
Rübe nicht selten über 5 000 junge Infektionslarven<br />
des Nematoden.<br />
Ditylenchus dipsaci zerstört durch seine<br />
Saugtätigkeit die Zellen des Rübenkörpers.<br />
Er ist sehr beweglich <strong>und</strong> breitet<br />
sich deshalb schnell auf einer Fläche aus.<br />
Der weitere, nun sichtbare Befall, der<br />
immer von oben am Rübenkopf beginnt,<br />
ist an schorfartigem, rissigem<br />
Rübenfleisch, das sich bis tief in den<br />
Rübenkörper grauschwarz verfärbt <strong>und</strong><br />
durch sek<strong>und</strong>ären Bakterienbefall<br />
wässrig wird, zu erkennen. Saprophytische<br />
Pilze können schnell eindringen<br />
<strong>und</strong> zur Zersetzung des Rübenfleisches<br />
beitragen. Betroffene Rübenparzellen<br />
zeigen eine starke Schädigung bis hin<br />
zur vollständigen Zerstörung. Der extrem<br />
große Wirtspflanzenkreis von Ditylenchus<br />
dipsaci mit über 500 Pflanzenarten<br />
<strong>und</strong> die sehr niedrige Schadschwelle<br />
von nur einem Nematoden pro Hektar<br />
ermöglichen dem Anbauer kaum Handlungsspielraum.<br />
Eine sofortige Anlieferung belasteter<br />
Rübenpartien trägt zur Schadensbegren-<br />
zung bei. Da Unkräuter ebenfalls zu den<br />
Wirtspflanzen gehören, sollten diese gezielt<br />
bekämpft werden.<br />
Chemische Maßnahmen zur Eindämmung<br />
stehen nicht zur Verfügung. Auch<br />
resistente Sorten sind derzeit nicht verfügbar.<br />
Jedoch zeigten in einem durch<br />
die Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau<br />
durchgeführten umfangreichen<br />
Sortenscreening einige Sorten bei einem<br />
Nematodenbefall deutlich weniger Fäulnis.<br />
Zu nennen wären hier vor allem die<br />
Sorte Beretta <strong>und</strong> Syncro.<br />
Bormangel macht auch faule Rüben<br />
Als weitere primäre Ursache faulender<br />
Rüben wurde in der Kampagne 2009 Bormangel,<br />
die sogenannte Herz- <strong>und</strong> Trockenfäule,<br />
beobachtet. Der Befall beginnt<br />
im Bereich der Herzblätter, die sich<br />
schwarz verfärben <strong>und</strong> absterben. Die<br />
Fäulnis unter den Herzblättern geht über<br />
in den Rübenkopf, der nachfolgend einen<br />
Hohlraum aufweist. Ein weiteres Erkennungsmerkmal<br />
sind dunkel verfärbte Gefäßbündelringe.<br />
Vor allem in den Mieten<br />
werden Bormangelrüben durch sek<strong>und</strong>är<br />
eindringende Pilze wie Fusarium <strong>und</strong> Penicillium<br />
sowie andere Pilze zersetzt.<br />
Die Zuckerrübe ist eine sehr borbedürftige<br />
Pflanze. Der Nährstoff wird für<br />
die Stabilisierung der Zellwände benötigt<br />
<strong>und</strong> ist<br />
wesentlich<br />
am Aufbau der<br />
Leitungsbahnen<br />
beteiligt.<br />
Da vor allem die<br />
Wasser- <strong>und</strong> Nähr-<br />
stoffaufnahme stark beeinträchtigt werden,<br />
sterben zunächst die Herzblätter ab.<br />
Auch bei ausreichender Borverfügbarkeit<br />
im Boden kann bei besonders <strong>hohe</strong>m pH-<br />
Wert die Bindung des Nährstoffs an die<br />
Bodenpartikel eine Freisetzung verhindern<br />
<strong>und</strong> auf diese Weise Mangel auslösen.<br />
Extreme Trockenheit oder starke Auswaschung<br />
durch Feuchtigkeit können<br />
deshalb auch bei ausreichendem Nährstoffangebot<br />
im Boden Schadsymptome<br />
hervorrufen. Vorbeugend können auf Verdachtsstandorten<br />
regelmäßige Kontrollen<br />
<strong>und</strong> Blattdüngungen vorgenommen<br />
werden. Bor kann in der Pflanze nicht verlagert<br />
werden, einmal geschädigte Pflanzen<br />
<strong>und</strong> Pflanzenteile können deshalb<br />
nicht mehr geheilt werden. Daher ist frühes<br />
Handeln das oberste Gebot.<br />
Eine eindeutige Zuordnung der Fäulnissymptome<br />
an den Zuckerrüben zu einer<br />
primären Schadursache war auch<br />
nach einer Laboruntersuchung nicht in<br />
allen Fällen möglich. Insbesondere sek<strong>und</strong>äre<br />
Pilze aus der Gattung Fusarium<br />
tragen sehr schnell zur Zersetzung<br />
der Rüben bei<br />
<strong>und</strong> verstärken die<br />
Schäden, sodass die<br />
Primärerreger nicht<br />
mehr isoliert werden<br />
konnten.<br />
Wenn bei der Ernte<br />
faule Rüben<br />
festgestellt werden,<br />
ist in jedem<br />
Fall eine Schadensbegrenzung<br />
durch vorgezogene<br />
Verarbeitung<br />
möglich. Auf diese Weise wird zumindest<br />
die weitere Zersetzung der Rüben in der<br />
Miete verhindert.<br />
Dr. Monika Heupel<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen<br />
Pflanzenschutzdienst<br />
Diese Rübe ist mit<br />
Rotfäule infiziert, als<br />
sek<strong>und</strong>ärer Befall<br />
kommt Penicillium<br />
dazu.<br />
Fusariumpilze<br />
können primär oder<br />
als Sek<strong>und</strong>ärerreger<br />
erhebliche Schäden<br />
durch Zersetzung des<br />
Rübenkörpers hervorrufen,<br />
deutliches<br />
Erkennungszeichen<br />
ist ein rosafarbenes<br />
Pilzmyzel.<br />
LZ 8 · 2010 Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L | 15
A K T U E L L E S P O L I T I K M A R K T B E T R I E B S W I R T S C H A F T A N B A U T E C H N I K Z U C K E R<br />
Tipps zum Herbizideinsatz 2010<br />
Welche Lehren kann man aus 2009 ziehen?<br />
Das Anbaujahr 2009 brachte bei der Unkrautbekämpfung<br />
einige besondere Herausforderungen. Welche Konsequenzen<br />
ergeben sich daraus für 2010?<br />
Die Rübenaussaat 2009 erfolgte relativ<br />
früh. Erste Rüben wurden in der letzten<br />
Märzwoche gesät. Schon zehn Tage später<br />
war die Zuckerrübenaussaat im Rheinland<br />
beendet. Rekordwerte bei den Temperaturen<br />
<strong>und</strong> ausreichend Feuchtigkeit<br />
führten zu einem sehr schnellen Auflauf<br />
von Rüben <strong>und</strong> Unkräutern. Äußerst ungewöhnlich<br />
war der extrem frühe <strong>und</strong><br />
sehr massive Auflauf von typischen Spätunkräutern,<br />
wie Bingelkraut, Nachtschatten<br />
oder Hirse.<br />
Erste Herbizidmaßnahmen standen<br />
Mitte April an. Zu diesem Zeitpunkt waren<br />
die Böden feucht <strong>und</strong> die Rüben <strong>und</strong><br />
Unkräuter sehr wüchsig. Dies versprach<br />
<strong>hohe</strong> Wirkungsgrade über Blatt <strong>und</strong> Boden,<br />
aber auch Verträglichkeitsprobleme<br />
bei Mischungen mit entsprechend ausgeprägter<br />
Blattaktivität. Unterschiedlich<br />
mutig gingen Landwirte <strong>und</strong> Berater bei<br />
der Zusammenstellung der Mischungen<br />
vor. Erwartungsgemäß konnten die vorhandenen<br />
Unkrautprobleme nicht auf allen<br />
Flächen durch die 1. NAK vollständig<br />
gelöst werden. Bei Mischungen mit <strong>hohe</strong>r<br />
Blattaktivität kam es auch zu ersten Rübenschädigungen.<br />
Die 2. NAK erfolgte acht bis 14 Tage<br />
später Ende April bis Anfang Mai. Regional<br />
sehr unterschiedliche Niederschläge<br />
führten zu unterschiedlichen Bedingungen.<br />
In einigen Fällen mussten aggressivere<br />
Mischungen gegen die nach der<br />
1. NAK verbliebene Restverunkrautung<br />
eingesetzt werden. Vor allem Raps, Bingelkraut<br />
<strong>und</strong> Knöteriche bereiteten auf<br />
einigen Flächen immer noch Probleme.<br />
Die Wirkung der 2. NAK war sehr gut, hinterließ<br />
aber deutlich sichtbare Spuren an<br />
den Rüben, die besonders stark in Überlappungsbereichen<br />
am Vorgewende oder<br />
in der Schick zu sehen waren. Ursache<br />
hierfür waren neben der Herbizidmi-<br />
schung <strong>und</strong> der <strong>hohe</strong>n Bodenfeuchte<br />
auch zusätzliche Stressfaktoren durch<br />
große Temperaturschwankungen zwischen<br />
Tag <strong>und</strong> Nacht.<br />
Die 3. NAK erfolgte dann Mitte Mai bei<br />
zumeist optimalen Bedingungen. Die ersten<br />
beiden NAK waren nicht immer verträglich,<br />
aber in der Summe sehr gut<br />
wirksam gewesen. Die Versiegelung erfolgte<br />
daher auf unkrautfreien <strong>und</strong> mittlerweile<br />
wieder wüchsigen Beständen.<br />
Erfreulich früh kam es Ende Mai bis<br />
Mitte Juni zum Reihenschluss. Während<br />
der Sommermonate gab es in einigen Regionen<br />
Trockenschäden <strong>und</strong> Reduzierungen<br />
des Blattapparates. Auf Problemstandorten<br />
mit Bingelkraut entwickelte<br />
sich leider eine stärkere Spätverunkrautung.<br />
Was kann man aus 2009 lernen?<br />
In 2009 verlangten der massive <strong>und</strong> frühe<br />
Auflauf der Unkräuter, sehr sensible Rüben,<br />
zumeist feuchte Böden <strong>und</strong> teilweise<br />
extreme Tag- <strong>und</strong> Nachtschwankungen<br />
bei den Temperaturen Fingerspitzengefühl<br />
bei der Zusammenstellung der<br />
Herbizidkombination, wenn man unnötigen<br />
Stress für die Zuckerrübe vermeiden<br />
wollte. Oftmals wäre es besser gewesen,<br />
bei empfindlichen Rüben <strong>und</strong> prognostizierter<br />
Wetterbesserung eine Behandlung<br />
noch ein bis zwei Tage zu verschieben<br />
oder höhere Aufwandmengen sicherheitshalber<br />
zu splitten.<br />
Hilfsmittel wie das Programm LIZ-Herbizid<br />
bieten immer – besonders aber in<br />
Extremjahren wie 2007 oder 2009 – eine<br />
sehr gute Hilfestellung bei der Zusammenstellung<br />
einer wirkungsvollen <strong>und</strong><br />
zugleich verträglichen Mischung, da<br />
wichtige wechselnden Rahmenbedingungen<br />
gezielt abgefragt <strong>und</strong> zu einer angepassten<br />
<strong>und</strong> optimalen Empfehlung verarbeitet<br />
werden.<br />
Ungewöhnlich waren 2009 aber auch<br />
Herbizidschäden, die in dieser Form im<br />
Rübenanbau bislang eher unbekannt waren.<br />
Nach der 1. NAK <strong>und</strong> besonders nach<br />
der 3. NAK kam es auf einigen wenigen<br />
Betrieben nach dem Einsatz bestimmter<br />
Mittel zu teilweise massiven Rübenschädigungen.<br />
Die betroffenen Flächen zeigten<br />
Chlorosen <strong>und</strong> erhebliche Pflanzenausfälle<br />
nach der 1. NAK oder eine deutliche<br />
Rübenschädigung von drei bis vier<br />
Wochen, wenn die Schädigung bei der<br />
3. NAK verursacht wurde. Die Ursache ist<br />
letztendlich nicht vollständig geklärt. Vermutet<br />
werden Verunreinigungen in einigen<br />
Kanistern von Metamitron-Generika.<br />
Einige der geschädigten Landwirte berichten<br />
im Nachhinein von Auffälligkeiten<br />
bei Farbe (rosa statt weiß) <strong>und</strong> Absetzverhalten<br />
in den entsprechenden Kanistern.<br />
Landwirten kann man hier nur den Tipp<br />
geben, alle Pflanzenschutzmittel beim<br />
Bezug <strong>und</strong> beim Befüllen sorgfältig zu<br />
kontrollieren <strong>und</strong> bei allen Auffälligkeiten<br />
in Farbe, Absetzverhalten im Kanister<br />
oder anderen Eigenschaften die Ware<br />
umgehend zu reklamieren.<br />
Herbizidnachwirkungen bedenken<br />
Weiter zugenommen haben 2009 Schäden,<br />
die durch Fremdherbizide verursacht<br />
wurden. Das sind Herbizidreste, die aus anderen<br />
Behandlungen stammen <strong>und</strong> in Zuckerrüben<br />
zu Schäden führen. Die Schadenspalette<br />
reicht von leichten Wuchsdepressionen<br />
bis zum Totalschaden.<br />
Direkte Schäden durch Brühe- oder<br />
Wirkstoffreste in der Feldspritze können<br />
<strong>und</strong> müssen durch eine sachgemäße <strong>und</strong><br />
gründliche Reinigung aller Spritzenbauteile<br />
vermieden werden. Abdriftschäden<br />
von Nachbarflächen sind besonders bei<br />
ungünstigen Windverhältnissen zu erwarten.<br />
Auch hier gilt es, Schäden durch<br />
optimale Spritztermine <strong>und</strong> angepasste<br />
Düsentechnik zu vermeiden.<br />
Verschiedene Ursachen hat die Zunahme<br />
der Schäden durch Herbizidnachwirkungen<br />
aus Behandlungen der Vorkultur.<br />
16 | Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L LZ 8 · 2010
Z U C K E R T E C H N I K A N B A U B E T R I E B S W I R T S C H A F T M A R K T P O L I T I K A K T U E L L E S<br />
Sie sind im Wesentlichen abhängig von<br />
Mittel, Aufwandmenge, Einsatztermin,<br />
Witterung <strong>und</strong> Bodenbearbeitung. Es<br />
lohnt sich, sich jetzt vor der Rübenaussaat<br />
intensiv mit dem Herbizideinsatz im<br />
Vorjahr zu beschäftigen. Nach der Rübenaussaat<br />
ist es zur Schadensverhinderung<br />
zu spät. Unter www.liz-online.de finden<br />
Sie entsprechende Informationen zur<br />
Herbizid-Nachbauproblematik.<br />
Fast nichts Neues bei den Mitteln<br />
Bei den im Rübenanbau zugelassenen<br />
Mitteln gibt es kaum Veränderungen. Leider<br />
gibt es auch für 2010 keine neuen<br />
Wirkstoffe. Der deutsche Landwirt muss<br />
nach wie vor gegen Unkräuter mit neun<br />
Wirkstoffen auskommen.<br />
Die Zulassung von Goltix 700 SC (Feinchemie)<br />
ist Ende Dezember 2009 ausgelaufen.<br />
Das Produkt darf nicht mehr gehandelt<br />
werden. Vorhandene Restbestände<br />
dürfen bis Ende 2011 aufgebraucht<br />
werden. Tornado (Feinchemie) soll trotz<br />
noch vorhandener Zulassung 2010 nicht<br />
mehr vertrieben werden. Die Firma Feinchemie<br />
ersetzt die beiden Produkte durch<br />
Goltix Gold. Die neue Formulierung verspricht<br />
nach Herstellerangaben eine geringfügig<br />
verbesserte Blattaktivität <strong>und</strong><br />
einen etwas langsameren Wirkstoffabbau<br />
bei <strong>hohe</strong>r Strahlungsintensität. In<br />
den Versuchen der Arbeitsgemeinschaft<br />
bestätigte sich die etwas bessere Blattaktivität<br />
im Vergleich zu den Vorgängern.<br />
Spectrum (BASF) wird 2010 nur noch<br />
im Pack zusammen mit Rebell als Spectrum<br />
R-Pack oder mit Focus Ultra als<br />
Spectrum F-Pack vertrieben.<br />
Worauf muss man achten?<br />
Kein Einzelwirkstoff kann alle Unkrautprobleme<br />
in Zuckerrüben lösen. Entscheidend<br />
für den Erfolg der Herbizidmaßnahme(n)<br />
sind daher die Auswahl<br />
der richtigen Wirkstoffe <strong>und</strong> die richtige<br />
Dosierung in der Einzelmaßnahme <strong>und</strong><br />
der Gesamtspritzfolge. Ob dazu Fertigmischungen<br />
oder eine Mischung von<br />
Einzelwirkstoffen eingesetzt wird, ist<br />
normalerweise für den Erfolg unbedeutend.<br />
Die Mischung von Einzelwirkstoffen<br />
ist in aller Regel die kostengünstigere<br />
Lösung. Hier muss wie in jedem Jahr<br />
im März/April nach Vorliegen der Preislisten<br />
neu entschieden werden.<br />
Der Anteil von Mulchsaaten nach Zwischenfrucht<br />
<strong>und</strong> Strohmulchflächen hat<br />
in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.<br />
Verb<strong>und</strong>en ist dieser Verfahrenswechsel<br />
häufig auch mit Altverunkrautung<br />
in Form von Unkräutern, Ungräsern<br />
<strong>und</strong> Ausfallgetreide. In den kommenden<br />
Wochen sollten Sie daher alle<br />
Rübenflächen auf Altverunkrautung kontrollieren<br />
<strong>und</strong> bei Bedarf vor der Saat mit<br />
einem Glyphosatmittel behandeln. Findet<br />
die Behandlung mindestens drei bis vier<br />
Tage vor der Bodenbearbeitung statt, gibt<br />
es zwischen Billig- <strong>und</strong> Premiumglyphosaten<br />
keine Wirkungsunterschiede. Hier<br />
kann der Hektarpreis entscheiden. Bei<br />
sehr wenig Zeit bis zur ersten Bearbeitung<br />
oder sehr kühler Witterung sollte<br />
auf Ro<strong>und</strong>up Ultra Max oder Glyphos Supreme<br />
zurückgegriffen werden. Glyphosate<br />
sollten in keinem Fall in AHL pur ausgebracht<br />
werden.<br />
Der klassische Vorauflauftermin mit<br />
Metamitron, Chloridazon oder Rebell ist<br />
in der Praxis nahezu unbedeutend. Sinn<br />
macht der Termin eigentlich nur noch bei<br />
H<strong>und</strong>spetersilie oder Wilder Möhre,<br />
wenn bei feuchten Böden mit 2,5 bis 3 l/<br />
ha Rebell eine sichere Gr<strong>und</strong>versicherung<br />
garantiert ist. Ausfallraps als Unkraut in<br />
Zuckerrüben nimmt im Rheinland weiter<br />
zu. Raps läuft in aller Regel noch vor den<br />
Rüben auf. Bei feuchten Böden kann dann<br />
mit frühen Metamitronmengen (1 000<br />
bis 1 500 g/ha Wirkstoff) ebenfalls eine<br />
wirkungsvolle Maßnahme gefahren werden.<br />
Das heißt hier aber nicht zwangsläu-<br />
Tabelle: Rübenherbizide<br />
Phenmedipham „Betanal“<br />
Handelsname Wirkstoffgehalt<br />
Betosip SC 160 g/l<br />
Berghoff PMP 160 SC 160<br />
Betasana SC 160<br />
Kontakt 320 320<br />
Asket 470 470<br />
Ethofumesat „Tramat“<br />
Ethosat 500 500 g/l<br />
Tramat 500 500<br />
Metamitron „Goltix“<br />
Goltix 700 SC 700 g/l<br />
Beetix SC 700<br />
Metafol 700 SC 700<br />
Tornado 700<br />
Goltix Gold 700<br />
Triflusulfuron „Debut“<br />
Debut 486 g/kg<br />
Safari 486<br />
Dimethanamid-P „Spectrum“<br />
Spectrum 720 g/l<br />
Clopyralid „Lontrel“<br />
Lontrel 100 100 g/l<br />
Cliophar 100 100<br />
Chloridazone „Pyramin“<br />
Pyramin WG 650 g/kg<br />
Terlin DF 650<br />
Terlin WG 650<br />
Betoxon 65 WDG 650<br />
Chloridazon + Quinmerac „Rebell“<br />
Rebell 400 + 50 g/l<br />
Ethofumesat + Metamitron „Goltix Super“<br />
Goltix Super 150 + 350 g/l<br />
Phenmedipham + Ethofumesat „Tandem“<br />
Powertwin Plus 200 + 200 g/l<br />
Phenmedipham + Desmedipham + Ethofumesat „Expert“<br />
Betanal Expert 75 + 25 + 151 g/l<br />
Phenmedipham + Desmedipham + Ethofumesat + Metamitron „Quattro“<br />
Betanal Quattro 60 + 20 + 100 + 200 g/l<br />
fig im klassischen Vorauflauf zur Saat,<br />
sondern gezielt, wenn feuchte Böden bei<br />
zu erwartendem Ausfallraps gute Wirkungsgrade<br />
versprechen.<br />
LZ 8 · 2010 Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L | 17<br />
Foto: Peter Hensch
A K T U E L L E S P O L I T I K M A R K T B E T R I E B S W I R T S C H A F T A N B A U T E C H N I K Z U C K E R<br />
Chloridazon nicht in<br />
Wasserschutzgebieten<br />
Abbauprodukte (Metaboliten) des Wirkstoffes Chloridazon<br />
sind in den vergangenen Jahren in erhöhten Konzentrationen<br />
im Gr<strong>und</strong>wasser gef<strong>und</strong>en worden. Das nordrheinwestfälische<br />
Umwelt- <strong>und</strong> Landwirtschaftsministerium, die<br />
Firma BASF, die Zuckerfabriken, der Rheinische Rübenbauer-<br />
Verband <strong>und</strong> die Pflanzenschutzberatung der Landwirtschaftskammer<br />
NRW haben daher schon 2007 eine freiwillige<br />
Vereinbarung zu vorbeugenden Minderungsmaßnahmen<br />
beim Einsatz von Rübenherbiziden mit dem Wirkstoff<br />
Chloridazon vereinbart. Die Vereinbarung auf freiwilliger<br />
Basis hat Modellcharakter. Funktioniert sie, wird man bei<br />
Chloridazon – aber auch zukünftig bei ähnlichen Problemen<br />
mit anderen Wirkstoffen – ein gr<strong>und</strong>sätzliches Anwendungsverbot<br />
verhindern können. In Wasserschutzgebieten<br />
<strong>und</strong> Gebieten zur Trinkwassergewinnung werden<br />
die entsprechenden Mittel (siehe Tabelle) daher nicht mehr<br />
empfohlen. Betroffen von dieser Verzichtsvereinbarung ist<br />
vor allem das Mittel Rebell, das normalerweise fester Bestandteil<br />
von Mischungen ist.<br />
Feste Regeln im Nachauflauf<br />
Die wichtigste Herbizidmaßnahme in Zuckerrüben<br />
ist die 1. NAK-Spritzung. „Der<br />
erste Schuss muss sitzen“, heißt dabei die<br />
Devise. Das heißt auf jeden Fall früh genug,<br />
damit hartnäckige Unkräuter wie<br />
Bingelkraut, Vogelknöterich oder Raps<br />
nicht schon zu groß sind. Es heißt aber<br />
nicht unbedingt, dass jedes Jahr mit der<br />
gleichen Ladung geschossen werden<br />
muss. Die äußeren Rahmenbedingungen<br />
bestimmen die genaue Zusammensetzung<br />
der Maßnahme <strong>und</strong> den eventuell<br />
erforderlichen Anteil von Wirkungsverstärkern<br />
(Additiven).<br />
Üblich bei der 1. NAK ist unter rheinischen<br />
Verhältnissen eigentlich eine Mischung,<br />
die landläufig mit dem Begriff<br />
GBR abgekürzt wird. Für G = Goltix gelten<br />
700 bis 1 000 g/ha Metamitron, für B =<br />
Betanal Tandem 120 bis 200 g/ha Ethofumesat<br />
<strong>und</strong> 120 bis 200 g/ha Phenmedipham<br />
<strong>und</strong> für R = Rebell Aufwandmengen<br />
zwischen 0,6 <strong>und</strong> 1,0 l/ha. Für Flächen<br />
außerhalb von Wasserschutzgebieten<br />
ändert sich hieran für 2010 nichts.<br />
Die blattaktive Komponente (der<br />
B-Anteil) muss in Abhängigkeit der äußeren<br />
Umstände nach unten oder oben angepasst<br />
werden. Wenn Trockenheiten<br />
eine <strong>hohe</strong> Blattaktivität fordert, hat Betanal<br />
Expert Vorteile, die bei Alternativen<br />
durch den Zusatz von Additiven aus Öl<br />
ausgeglichen werden müssen. Auch bei<br />
Rebell sollte auf Gr<strong>und</strong> der Verträglichkeit<br />
keine starre Aufwandmenge gesetzt sein.<br />
In den letzten Jahren hat die Bedeutung<br />
von Debut in der 1. NAK deutlich zugenommen.<br />
Eine 1. NAK mit Debut bietet<br />
mehr Wirkungssicherheit gegen größere<br />
Kamille, Bingelkraut, Knötericharten,<br />
H<strong>und</strong>spetersilie <strong>und</strong> Ausfallraps. Erkauft<br />
wird dies allerdings mit höheren Verträglichkeitsrisiken.<br />
Hier muss man abwägen<br />
<strong>und</strong> dann situationsbedingt entscheiden.<br />
In Wasserschutzgebieten werden zukünftig<br />
bei schwächerer Verunkrautung GB-<br />
Mischungen oder bei kritischeren Standorten<br />
GB plus Debut zum Standard. Bei<br />
Debut müssen die Mengen je nach Situation<br />
angepasst werden. Die Zugabe von<br />
Lontrel oder Spectrum zur 1. NAK sollte<br />
aus Verträglichkeitsrisiken nicht standardmäßig<br />
erfolgen.<br />
Die 2. NAK kann in Ruhe angegangen<br />
werden, wenn die 1. NAK geglückt ist. Kritischer<br />
wird es, wenn nach der 1. NAK<br />
eine Restverunkrautung verblieben ist.<br />
Die Zusammensetzung der Mischung<br />
muss nach Witterung, Unkrautart <strong>und</strong><br />
Unkrautgröße angepasst werden. Die<br />
Jahre 2007 (Spritzung bei absoluter Trockenheit)<br />
<strong>und</strong> 2009 (feuchte Böden <strong>und</strong><br />
empfindliche Rüben) zeigen, dass starre<br />
Empfehlungen keinen Sinn machen. Auf<br />
Bingelkraut- oder Rapsstandorten wird<br />
aus GBR zwangsläufig GBR plus Debut<br />
oder GB plus Debut. In Wasserschutzgebieten<br />
werden Mischungen GB plus Debut<br />
oder GB plus Teilmengen Spectrum<br />
Standard sein.<br />
Gräserherbizide können der NAK zugemischt<br />
werden, wenn Witterung <strong>und</strong> Rübenzustand<br />
es zulassen. Beachten Sie<br />
aber, dass die Verträglichkeit der NAK<br />
beim Zusatz von Gräsermitteln abnehmen<br />
kann. Sind bei kritischer Witterung<br />
bereits weitere Risikokandidaten, wie<br />
Spectrum, Rebell oder Debut, in der NAK<br />
enthalten, sollten Sie auf den Zusatz verzichten<br />
<strong>und</strong> Gräsermittel solo einsetzen.<br />
Das Gräserherbizid kann in verträglichen<br />
Witterungsphasen auch hervorragend<br />
mit 0,6 bis 0,9 l/ha Spectrum zur Hirsebehandlung<br />
kombiniert werden.<br />
Auf vielen Standorten reicht eine<br />
3. NAK, um die Flächen zu versiegeln. Ziel<br />
der abschließenden NAK ist die Bekämpfung<br />
der Restverunkrautung, mehr aber<br />
noch der Aufbau eines Wirkstoffdepots<br />
gegen Spätverunkrautung. Gegen Melde<strong>und</strong><br />
Gänsefußarten sowie Nachtschatten<br />
ist der Wirkstoff Metamitron entschei-<br />
dend. Bei zusätzlichem Bingelkraut, Amarant,<br />
H<strong>und</strong>spetersilie oder Hirse ergänzt<br />
Spectrum die Lücke bei Metamitron.<br />
Bei starken Bingelkrautproblemen<br />
sind häufig insgesamt vier NAK angesagt.<br />
Bei der zweiten <strong>und</strong> dritten Spritzung gehört<br />
Debut fest mit ins Programm. Bei<br />
der 4. NAK sollte es auch um den Aufbau<br />
eines Depots über Bodenherbizide wie<br />
Ethofumesat <strong>und</strong> Spectrum gehen.<br />
Erfahrungen aus Spezialversuchen<br />
Seit mehreren Jahren gibt es im Rheinland<br />
Sonderversuche zu Bingelkraut. Hieraus<br />
lassen sich mehrere Empfehlungen<br />
ableiten. Eine möglichst gute Beschattung<br />
des Bodens durch Rübenblätter ist<br />
der beste Schutz vor Spätverunkrautung.<br />
Jahre mit Trockenstress wie 2003 oder<br />
2009 sind besonders kritische Jahre.<br />
Blattreiche, nematoden- <strong>und</strong> trockentolerante<br />
Sorten bieten momentan die besten<br />
Voraussetzungen für eine optimale<br />
Unkrautunterdrückung.<br />
Während der normalen Herbizidsaison<br />
muss es anschließend um eine konsequente<br />
<strong>und</strong> möglichst gute Bekämpfung<br />
gehen. Dazu sind mindestens drei bis vier<br />
NAK-Spritzungen notwendig, in denen<br />
Blattaktivität (Debut) zur Bekämpfung<br />
der Unkräuter <strong>und</strong> Versiegelung (Ethofumesat,<br />
Chloridazon, Spectrum) zum<br />
Schutz vor neu auflaufenden Unkräutern<br />
gefordert sind. Höhere Mengen an Bodenherbiziden<br />
verbessern die Dauerwirkung,<br />
bringen aber keinen verlässlichen<br />
Dauerschutz. Den verbessert man nur<br />
mit noch späteren Maßnahmen in Form<br />
der Unterblattspritzung. Im Einzugsbereich<br />
der Zuckerfabrik Euskirchen steht<br />
ein entsprechendes Gerät für Rübenanbauer<br />
zur Verfügung.<br />
Weitere Probleme bereiten in Einzelfällen<br />
Amarant, Ausfall-Leguminosen,<br />
Phacelia, Ölrettich, Stechapfel, Malvenarten,<br />
Kreuzkraut <strong>und</strong> andere Unkräuter.<br />
Jedes Unkraut erfordert einen angepassten<br />
Lösungsansatz.<br />
Zu allen angesprochenen Fragen <strong>und</strong><br />
Problemen stehen Ihnen die Berater <strong>und</strong><br />
Beraterinnen von Pfeifer & Langen/LIZ,<br />
des Rübenbauernverbandes <strong>und</strong> der<br />
Landwirtschaftskammer gerne als Ratgeber<br />
zur Verfügung. Umfangreiche Informationen<br />
im Internet finden Sie unter<br />
www.liz-online.de.<br />
Heinrich Brockerhoff<br />
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen<br />
18 | Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L LZ 8 · 2010
Z U C K E R T E C H N I K A N B A U B E T R I E B S W I R T S C H A F T M A R K T P O L I T I K A K T U E L L E S<br />
Mehr Ertrag – mehr Stickstoff?<br />
Exakte Ermittlung des N-Bedarfs zu Zuckerrüben durch Bilanzierung mit LIZ-Npro<br />
In den letzten Jahren <strong>und</strong> speziell 2009 wurden Rüben- <strong>und</strong><br />
Zuckererträge in bis dahin nicht für möglich gehaltener Höhe<br />
erreicht. 100 t Rüben <strong>und</strong> 17 t Zucker je ha liegen durchaus<br />
auch in Zukunft im Bereich des Möglichen. In diesem Zusammenhang<br />
stellt sich die Frage: Benötigen höhere Rübenerträge<br />
mehr Nährstoffe <strong>und</strong> speziell mehr Stickstoff (N)?<br />
Steigende Werte ➔<br />
300<br />
280<br />
260<br />
240<br />
220<br />
Die Frage kann man auf den ersten Blick<br />
mit „nein“ beantworten, denn die unerwartet<br />
<strong>hohe</strong>n Erträge wurden in den<br />
meisten Fällen mit der betriebsüblichen<br />
Düngung erzielt. Die wenigsten werden<br />
in Erwartung steigender Erträge vorsorglich<br />
mehr gedüngt haben. Das <strong>hohe</strong> Ertragsniveau<br />
2009 ist zu einem <strong>hohe</strong>n Anteil<br />
der Witterung zu verdanken. Wachstumswetter<br />
ist auch Mobilisierungswetter.<br />
Hohe Temperaturen <strong>und</strong> eine gute<br />
Grafik 1: Rübe-Blatt-Verhältnis <strong>und</strong> N-Aufnahme bei<br />
steigendem Rübenertrag<br />
kg N/ha<br />
Rübe-Blatt-Verhältnis<br />
Rübe-Blatt-Verhältnis<br />
N-Aufnahme<br />
50 60 70 80 90 100<br />
Rübenertrag t/ha<br />
Grafik 2: Abhängigkeit verschiedener Parameter<br />
Bereinigter Zuckerertrag<br />
Rübenertrag vom<br />
N-Angebot<br />
Steigende Werte ➔<br />
Bereinigter Zuckerertrag<br />
Steigendes N-Angebot ➔<br />
Steigendes N-Angebot ➔<br />
Zuckergehalt<br />
Rübenertrag<br />
Zuckergehalt<br />
0,8<br />
0,7<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
Wasserversorgung lassen die Rübe wachsen<br />
<strong>und</strong> mobilisieren gleichzeitig mehr<br />
Stickstoff: Wird N gebraucht, wird N geliefert.<br />
Hohe Erträge <strong>und</strong> <strong>hohe</strong> N-Mineralisation<br />
haben offensichtlich gut gepasst.<br />
Wie viel zusätzlicher Stickstoff bei<br />
steigenden Erträgen?<br />
Dennoch muss man sich der Frage stellen,<br />
inwieweit dauerhaft höhere Erträge<br />
einen höheren Stickstoffbedarf haben,<br />
der nicht immer aus einer zusätzlichen<br />
Mineralisation gedeckt wird.<br />
Mit zunehmenden Rübenerträgen<br />
nimmt der Blattertrag relativ ab. Das Rübe-Blatt-Verhältnis<br />
verringert sich auf<br />
1:0,4. Ab einem Rübenertrag von 70 t/ha<br />
wird für weitere Ertragssteigerungen<br />
quasi kein zusätzliches Blatt produziert.<br />
Deswegen <strong>und</strong> weil im Rübenkörper relativ<br />
wenig Stickstoff enthalten ist, ist der<br />
zusätzliche N-Bedarf bei steigenden Erträgen<br />
sehr gering. Entsprechend flacht<br />
die Kurve der N-Aufnahme (Grafik 1) ab.<br />
Zusammenfassend kann festgestellt werden,<br />
dass höhere Rübenerträge mehr<br />
Stickstoff benötigen, aber nur sehr wenig.<br />
Interessant ist, dass mehr Stickstoff<br />
sogar zu Mindererträgen führen kann.<br />
Dies hängt mit einer übermäßigen <strong>und</strong><br />
unproduktiven Blattbildung zusammen.<br />
Steigt der Blattflächenindex (m² Blattfläche<br />
je m² Bodenfläche) auf über 4,5, so<br />
kommt es zu Ertragsdepressionen. Da<br />
sich die Blätter zunehmend beschatten,<br />
ist ihre assimilatorische Mehrleistung gering.<br />
Andererseits wird für das starke<br />
Blatt viel Energie benötigt, die dem Rübenkörper<br />
verloren geht.<br />
Mit der Stickstoffdüngung muss jedoch<br />
nicht nur der Rübenertrag, sondern<br />
es müssen auch die Inhaltsstoffe optimiert<br />
werden. Mit steigender N-Versorgung<br />
nimmt der Zuckergehalt deutlich ab<br />
<strong>und</strong> zwar bereits in einem Bereich, in<br />
dem der Rübenertrag noch zunimmt. Hier<br />
entsteht ein Konflikt: Ertrag oder Zuckergehalt?<br />
Verschärft wird dieser noch durch<br />
die Tatsache, dass auch der Amino-N in<br />
der Rübe <strong>und</strong> in der Folge der Standardmelasseverlust<br />
(SMV) negativ durch ein<br />
erhöhtes N-Angebot beeinflusst werden.<br />
In der Konsequenz liegt deshalb das Stick-<br />
Die Stickstoffdüngung sollte genau am Ertrag,<br />
am Standort <strong>und</strong> an der Bewirtschaftung ausgerichtet<br />
sein. Foto: Agrarfoto.com<br />
stoffoptimum des bereinigten Zuckerertrages<br />
(BZE) immer unter dem des<br />
Rübenertrages (siehe Grafik 2).<br />
Dies ist allerdings nur die biologische<br />
Betrachtung, die noch um die wirtschaftlichen<br />
Aspekte zu ergänzen ist. Auf Gr<strong>und</strong><br />
des Bezahlungssystems wird derselbe Zuckerertrag<br />
umso besser bezahlt, je höher<br />
der Zuckergehalt ist. Zu berücksichtigen<br />
sind auch noch Qualitätsprämien (in Abhängigkeit<br />
von Inhaltsstoffen: SMV, Amino-N)<br />
<strong>und</strong> die Kosten des Düngers. Diese<br />
Faktoren senken das ökonomische Stickstoffoptimum<br />
zusätzlich.<br />
Fasst man alles zusammen, so lautet<br />
die Erkenntnis: Höhere Rübenerträge benötigen<br />
mehr Stickstoff, aber unter wirtschaftlichen<br />
Gesichtspunkten noch weniger<br />
als bei rein biologischer Betrachtung.<br />
N-Düngung ist nicht nur Frage des<br />
N-Bedarfs<br />
Die Betrachtung des notwendigen Stickstoffbedarfs<br />
in Abhängigkeit vom Ertrag<br />
ist eine Sache, die angepasste Stickstoffdüngung<br />
eine völlig andere. Dies hängt<br />
damit zusammen, dass der N-Bedarf aus<br />
verschiedenen Quellen gedeckt wird: Bodenvorräte,<br />
Mineralisierung aus Boden<br />
<strong>und</strong> organischen Düngern sowie der mi-<br />
LZ 8 · 2010 Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L | 19
A K T U E L L E S P O L I T I K M A R K T B E T R I E B S W I R T S C H A F T A N B A U T E C H N I K Z U C K E R<br />
Grafik 3: Beispiel N-Bedarf bei 70 t/ha Rübenertrag<br />
Grafik 4: Beispiel N-Bedarf bei 100 t/ha Rübenertrag<br />
neralischen Düngung. Letztere ist quasi<br />
das Zünglein an der Waage <strong>und</strong> muss<br />
unter Berücksichtigung aller anderen<br />
N-Quellen optimiert werden.<br />
Hierbei ist eine Vielzahl von Standortbedingungen<br />
zu berücksichtigen. Die<br />
Auswirkungen sind gr<strong>und</strong>sätzlich bekannt,<br />
jedoch schwer zu quantifizieren.<br />
Deshalb ist es das Einfachste, man lässt<br />
sich helfen, durch N-Bilanierung, Nmin-<br />
Proben oder zum Beispiel mit dem Online-Programm<br />
LIZ-Npro.<br />
Es genügen wenige Angaben zum<br />
Standort, zur Bewirtschaftung <strong>und</strong> zum<br />
Ertragspotenzial <strong>und</strong> das Programm<br />
empfiehlt die optimale mineralische<br />
N-Düngung unter Berücksichtigung aller<br />
oben diskutierten Aspekte. Dies ist mög-<br />
Quote verleihen ist ganz einfach<br />
Seit einigen Jahren ist es auch im Rheinland<br />
möglich, Rübenliefermengen zeitweise <strong>und</strong> flächenlos<br />
zu verleihen. Hierzu genügt es, wenn<br />
sich der Verleiher oder der Leiher unter der Angabe<br />
der zu verleihenden Rübenliefermenge, in der<br />
Regel die Gesamtmenge, <strong>und</strong> der Verleihdauer,<br />
zum Beispiel für ein Jahr oder bis auf Widerruf,<br />
bei dem zuständigen Stammwerk des Verleihers<br />
meldet. Hier wird dann die sogenannte „Vereinbarung<br />
zur leihweisen Überlassung von Rübenliefermengen“<br />
vorbereitet <strong>und</strong> den Beteiligten<br />
zur Unterschrift zugeschickt.<br />
Gr<strong>und</strong>lage für die flächenlose Verleihung ist die<br />
derzeit bestehende Branchenvereinbarung zur<br />
Verteilung von Rübenliefermengen vom<br />
lich, weil eine Vielzahl von Daten, wie<br />
Witterung oder Gehaltszahlen, <strong>und</strong> alle<br />
wichtigen Beziehungen in Form von Funktionen<br />
hinterlegt sind. Sofern vorhanden,<br />
können hinterlegte Daten durch betriebsindividuelle<br />
ersetzt werden <strong>und</strong> die Empfehlung<br />
verbessern.<br />
Mit Blick auf den N-Bedarf bei <strong>hohe</strong>m<br />
Ertragsniveau (70 t/ha) empfiehlt das<br />
Programm LIZ-Npro unter bestimmten<br />
Standortbedingungen für 30 t Mehrertrag<br />
nur noch 9 kg zusätzlichen Stickstoff<br />
je ha (Grafik 3 <strong>und</strong> 4).<br />
Wer die N-Empfehlung nachvollziehen<br />
will, findet in der „Bilanz“ alle wichtigen<br />
Aspekte der Stickstoffbilanz. Sollte die<br />
N-Empfehlung von der bisherigen Praxis<br />
abweichen oder unerwartet ausfallen, so<br />
bietet sie darüber hinaus eine hervorragende<br />
Basis, um nach den Ursachen der<br />
Abweichung zu suchen <strong>und</strong> dabei möglicherweise<br />
zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.<br />
Fazit<br />
Höhere Rübenerträge führen zu einer erhöhten<br />
N-Aufnahme, die mit zunehmendem<br />
Ertragsniveau allerdings immer kleiner<br />
wird. Ursache ist das differenzierte<br />
Blattwachstum. Inhaltsstoffe <strong>und</strong> bezahlungsrelevante<br />
Aspekte begrenzen zusätzlich<br />
den geringen N-Mehrbedarf.<br />
26. Januar 2007. Durch diese Übertragung wird<br />
der derzeit gültige Flächenbezug der verliehenen<br />
Rübenliefermenge nicht aufgehoben. Sollten<br />
Flächen aus der Bewirtschaftung des Verleihers<br />
gehen, wird nach fristgerechter Antragsstellung<br />
des Nachbewirtschafters die verliehene<br />
Menge entsprechend angepasst. Der Verleiher<br />
sichert darüber hinaus zu, dass ihm zum<br />
Termin der Unterzeichnung mögliche Flächenabgänge<br />
nicht bekannt sind.<br />
Folgendes sollte unbedingt beachtet werden:<br />
■ Zur Absicherung des Flächenbezuges der verliehenen<br />
Rübenliefermenge ist es nötig, dass<br />
der abgebende Betrieb das Flächenverzeichnis<br />
2005 (Übergangsjahr von Einzelflächen zu Feld-<br />
Bildet die Rübe auf Gr<strong>und</strong> einer sehr <strong>hohe</strong>n<br />
Stickstoffversorgung sehr viele Blätter, kann<br />
das sogar den Ertrag senken, da sich die Blätter<br />
gegenseitig beschatten. Foto: Peter Hensch<br />
Pauschale Stickstoffzuschläge für ein<br />
erhöhtes Ertragsniveau werden nicht<br />
zum Erfolg führen, sondern nur eine an<br />
den Ertrag, den Standort <strong>und</strong> die Bewirtschaftung<br />
angepasste N-Düngung.<br />
Wegen der vielen dabei zu berücksichtigenden<br />
Aspekte liefert das Programm<br />
LIZ-Npro wertvolle Hilfe, es ist zu finden<br />
unter www.liz-online.de unter der Rubrik<br />
Entscheidungshilfen.<br />
Dr. Heinz Josef Kochs<br />
Martin van Look<br />
Christina Rothkranz<br />
Landwirtschaftlicher Informationsdienst<br />
Zuckerrübe<br />
blöcken) sowie das jeweils aktuelle Flächenverzeichnis<br />
der unterschriebenen Vereinbarung<br />
beifügt.<br />
■ Die Kündigung von bestehenden Vereinbarungen<br />
mit einer Laufzeit bis auf Widerruf müssen<br />
dem zuständigen Werk bis zum 30. Juni des<br />
Vorjahres mitgeteilt werden.<br />
■ Neue Vereinbarungen bitte bis spätestens<br />
31. Januar anmelden.<br />
Sobald die unterschriebene Vereinbarung sowie<br />
die Flächenverzeichnisse an das Werk zurückgeschickt<br />
wurden, erfolgt eine schriftliche<br />
Bestätigung, mit der die Vereinbarung dann in<br />
Kraft tritt.<br />
Burkhard Schopen, Pfeifer & Langen<br />
20 | Z U C K E R R Ü B E N J O U R N A L LZ 8 · 2010