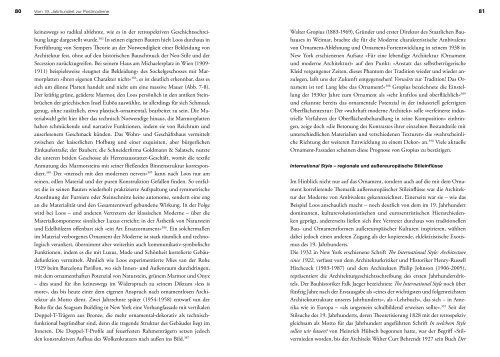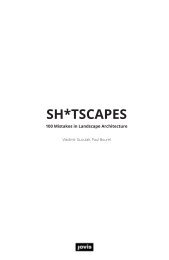Ornamente der Fassade
ISBN 978-3-86859-233-7
ISBN 978-3-86859-233-7
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
80 Vom 19. Jahrhun<strong>der</strong>t zur Postmo<strong>der</strong>ne 81<br />
keineswegs so radikal ablehnte, wie es in <strong>der</strong> retrospektiven Geschichtsschreibung<br />
lange dargestellt wurde. 382 In seinen eigenen Bauten hielt Loos durchaus in<br />
Fortführung von Sempers Theorie an <strong>der</strong> Notwendigkeit einer Bekleidung von<br />
Architektur fest, ohne auf den historischen Bauschmuck <strong>der</strong> Neo-Stile und <strong>der</strong><br />
Secession zurückzugreifen. Bei seinem Haus am Michaelerplatz in Wien (1909-<br />
1911) beispielsweise »leugnet die Bekleidung« des Sockelgeschosses mit Marmorplatten<br />
»ihren eigenen Charakter nicht« 383 ; es ist deutlich erkennbar, dass es<br />
sich um dünne Platten handelt und nicht um eine massive Mauer (Abb. 7-8).<br />
Der kräftig grüne, geä<strong>der</strong>te Marmor, den Loos persönlich in den antiken Steinbrüchen<br />
<strong>der</strong> griechischen Insel Euböa auswählte, ist allerdings für sich Schmuck<br />
genug, ohne zusätzlich, etwa plastisch-ornamental, bearbeitet zu sein. Die Materialwahl<br />
geht hier über das technisch Notwendige hinaus, die Marmorplatten<br />
haben schmückende und narrative Funktionen, indem sie von Reichtum und<br />
auserlesenem Geschmack künden. Das Wohn- und Geschäftshaus vermittelt<br />
zwischen <strong>der</strong> kaiserlichen Hofburg und einer exquisiten, aber bürgerlichen<br />
Einkaufsstraße; <strong>der</strong> Bauherr, die Schnei<strong>der</strong>firma Goldmann & Salatsch, nutzte<br />
die unteren beiden Geschosse als Herrenausstatter-Geschäft, womit die textile<br />
Anmutung des Marmorsteins mit seiner fließenden Binnenstruktur korrespondiert.<br />
384 Der »mensch mit den mo<strong>der</strong>nen nerven« 385 kann nach Loos nur am<br />
reinen, edlen Material und <strong>der</strong> puren Konstruktion Gefallen finden. So entfaltet<br />
die in seinen Bauten wie<strong>der</strong>holt praktizierte Aufspaltung und symmetrische<br />
Anordnung <strong>der</strong> Furniere o<strong>der</strong> Steinschnitte keine autonome, son<strong>der</strong>n eine eng<br />
an die Materialität und den Gesamtentwurf gebundene Wirkung. In <strong>der</strong> Folge<br />
wird bei Loos – und an<strong>der</strong>en Vertretern <strong>der</strong> klassischen Mo<strong>der</strong>ne – über die<br />
Materialkomponente sinnlicher Luxus erreicht; in <strong>der</strong> Ästhetik von Naturstein<br />
und Edelhölzern offenbart sich »ein Art Ersatzornament« 386 . Ein solchermaßen<br />
im Material verborgenes Ornament <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne ist stark räumlich und technologisch<br />
verankert, übernimmt aber weiterhin auch kommunikativ-symbolische<br />
Funktionen, indem es die mit Luxus, Mode und Schönheit korrelierte Gebäudefunktion<br />
vermittelt. Ähnlich wie Loos experimentierte Mies van <strong>der</strong> Rohe<br />
1929 beim Barcelona Pavillon, wo sich Innen- und Außenraum durchdringen,<br />
mit dem ornamenthaften Potenzial von Naturstein, grünem Marmor und Onyx<br />
– dies stand für ihn keineswegs im Wi<strong>der</strong>spruch zu seinem Diktum »less is<br />
more«, das bis heute einer dem eigenen Anspruch nach ornamentlosen Architektur<br />
als Motto dient. Zwei Jahrzehnte später (1954-1958) entwarf van <strong>der</strong><br />
Rohe für das Seagram Building in New York eine Vorhangfassade mit vertikalen<br />
Doppel-T-Trägern aus Bronze, die mehr ornamental-dekorativ als technischfunktional<br />
begründbar sind, denn die tragende Struktur des Gebäudes liegt im<br />
Inneren. Die Doppel-T-Profile auf feuerfesten Rahmenträgern setzen jedoch<br />
den konstruktiven Aufbau des Wolkenkratzers nach außen ins Bild. 387<br />
Walter Gropius (1883-1969), Grün<strong>der</strong> und erster Direktor des Staatlichen Bauhauses<br />
in Weimar, brachte die für die Mo<strong>der</strong>ne charakteristische Ambivalenz<br />
von Ornament-Ablehnung und Ornament-Fortentwicklung in seinem 1938 in<br />
New York erschienenen Aufsatz »Für eine lebendige Architektur (Ornament<br />
und mo<strong>der</strong>ne Architektur)« auf den Punkt: »Anstatt das selbstbetrügerische<br />
Kleid vergangener Zeiten, dieses Phantom <strong>der</strong> Tradition wie<strong>der</strong> und wie<strong>der</strong> anzulegen,<br />
laßt uns <strong>der</strong> Zukunft entgegensehen! Vorwärts zur Tradition! Das Ornament<br />
ist tot! Lang lebe das Ornament!« 388 Gropius bezeichnete die Einstellung<br />
<strong>der</strong> 1930er Jahre zum Ornament als »sehr kraftlos und oberflächlich« 389<br />
und erkannte bereits das ornamentale Potenzial in <strong>der</strong> industriell gefertigten<br />
Oberflächentextur: Der »wahrhaft mo<strong>der</strong>ne Architekt« solle »verfeinerte industrielle<br />
Verfahren <strong>der</strong> Oberflächenbehandlung in seine Komposition« einbringen,<br />
zeige doch »die Betonung des Kontrastes ihrer einzelnen Bestandteile mit<br />
unterschiedlichen Materialien und verschiedenen Texturen« die »wahrscheinliche<br />
Richtung <strong>der</strong> weiteren Entwicklung zu einem Dekor« an. 390 Viele aktuelle<br />
Ornament-<strong>Fassade</strong>n scheinen diese Prognose von Gropius zu bestätigen.<br />
International Style – regionale und außereuropäische Stileinflüsse<br />
Im Hinblick nicht nur auf das Ornament, son<strong>der</strong>n auch auf die mit dem Ornament<br />
korrelierende Thematik außereuropäischer Stileinflüsse war die Architektur<br />
<strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne von Ambivalenz gekennzeichnet. Einerseits war sie – wie das<br />
Beispiel Loos anschaulich macht – noch deutlich von dem im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
dominanten, kulturevolutionistischen und eurozentristischen Hierarchiedenken<br />
geprägt, an<strong>der</strong>erseits ließen sich ihre Vertreter durchaus von traditionellen<br />
Bau- und Ornamentformen außereuropäischer Kulturen inspirieren, wählten<br />
dabei jedoch einen an<strong>der</strong>en Zugang als <strong>der</strong> kopierende, eklektizistische Exotismus<br />
des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts.<br />
Die 1932 in New York erschienene Schrift The International Style: Architecture<br />
since 1922, verfasst von dem Architekturkritiker und Historiker Henry-Russell<br />
Hitchcock (1903-1987) und dem Architekten Philip Johnson (1906-2005),<br />
repräsentiert die Architekturgeschichtsschreibung des ersten Jahrhun<strong>der</strong>tdrittels.<br />
Der Bauhistoriker Falk Jaeger bezeichnete The International Style noch über<br />
fünfzig Jahre nach <strong>der</strong> Erstausgabe als »eines <strong>der</strong> wichtigsten und folgenreichsten<br />
Architekturtraktate unseres Jahrhun<strong>der</strong>ts«, als »Lehrbuch«, das sich – in Amerika<br />
wie in Europa – »als ungemein schulbildend erweisen sollte«. 391 Seit <strong>der</strong><br />
Stilsuche des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts, <strong>der</strong>en Theoretisierung 1828 mit <strong>der</strong> retrospektiv<br />
gleichsam als Motto für das Jahrhun<strong>der</strong>t angeführten Schrift In welchem Style<br />
sollen wir bauen? von Heinrich Hübsch begonnen hatte, war <strong>der</strong> Begriff »Stil«<br />
vermieden worden, bis <strong>der</strong> Architekt Walter Curt Behrendt 1927 sein Buch Der