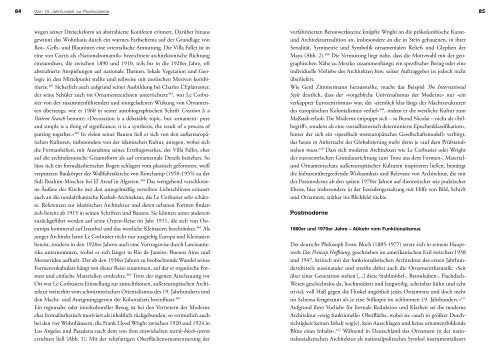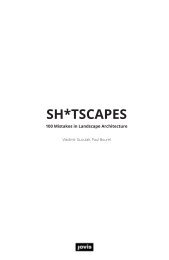Ornamente der Fassade
ISBN 978-3-86859-233-7
ISBN 978-3-86859-233-7
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
84 Vom 19. Jahrhun<strong>der</strong>t zur Postmo<strong>der</strong>ne 85<br />
wegen seiner Dreiecksform an abstrahierte Koniferen erinnert. Darüber hinaus<br />
gewinnt das Wohnhaus durch ein warmes Farbschema auf <strong>der</strong> Grundlage von<br />
Rot-, Gelb- und Blautönen eine orientalische Anmutung. Die Villa Fallet ist in<br />
eine von Curtis als »Nationalromantik« bezeichnete architektonische Richtung<br />
einzuordnen, die zwischen 1890 und 1910, teils bis in die 1920er Jahre, oft<br />
abstrahierte Anspielungen auf nationale Themen, lokale Vegetation und Geologie<br />
in den Mittelpunkt stellte und teilweise mit exotischen Motiven kombinierte.<br />
401 Sicherlich auch aufgrund seiner Ausbildung bei Charles L’Eplattenier,<br />
<strong>der</strong> seine Schüler auch im Ornamentzeichnen unterrichtete 402 , war Le Corbusier<br />
von <strong>der</strong> zusammenführenden und sinngeladenen Wirkung von <strong>Ornamente</strong>n<br />
überzeugt, wie er 1960 in seiner autobiographischen Schrift Creation Is a<br />
Patient Search betonte: »Decoration is a debatable topic, but ›ornament‹ pure<br />
and simple is a thing of significance; it is a synthesis, the result of a process of<br />
putting together.« 403 In vielen seiner Bauten ließ er sich von den außereuropäischen<br />
Kulturen, insbeson<strong>der</strong>e von <strong>der</strong> islamischen Kultur, anregen, wobei sich<br />
die Formanleihen, mit Ausnahme seines Erstlingswerkes, <strong>der</strong> Villa Fallet, eher<br />
auf die architektonische Gesamtform als auf ornamentale Details beziehen. So<br />
lässt sich ein formalästhetischer Bogen schlagen vom plastisch geformten, weiß<br />
verputzten Baukörper <strong>der</strong> Wallfahrtskirche von Ronchamp (1950-1955) zu <strong>der</strong><br />
Sidi Ibrahim-Moschee bei El Ateuf in Algerien. 404 Das weitgehend verschlossene<br />
Äußere <strong>der</strong> Kirche mit den unregelmäßig verteilten Lichtschlitzen erinnert<br />
auch an die nordafrikanische Kasbah-Architektur, die Le Corbusier sehr schätzte.<br />
Referenzen zur islamischen Architektur und <strong>der</strong>en urbanen Formen finden<br />
sich bereits ab 1915 in seinen Schriften und Bauten. Sie können unter an<strong>der</strong>em<br />
zurückgeführt werden auf seine Orient-Reise im Jahr 1911, die sich von Osteuropa<br />
kommend auf Istanbul und das westliche Kleinasien beschränkte. 405 Als<br />
junger Architekt hatte Le Corbusier nicht nur ausgiebig Europa und Kleinasien<br />
bereist, son<strong>der</strong>n in den 1920er Jahren auch eine Vortragsreise durch Lateinamerika<br />
unternommen, wobei er sich länger in Rio de Janeiro, Buenos Aires und<br />
Montevideo aufhielt. Der ab den 1930er Jahren zu beobachtende Wandel seines<br />
Formenvokabulars hängt mit dieser Reise zusammen, auf <strong>der</strong> er organische Formen<br />
und einfache Materialien entdeckte. 406 Trotz <strong>der</strong> eigenen Anschauung vor<br />
Ort war Le Corbusiers Einstellung zur autochthonen, außereuropäischen Architektur<br />
weiterhin vom schwärmerischen Orientalismus des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts und<br />
den Macht- und Aneignungsgesten <strong>der</strong> Kolonialzeit beeinflusst. 407<br />
Ein regionaler o<strong>der</strong> interkultureller Bezug ist bei den Vertretern <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne<br />
eher formalästhetisch motiviert als inhaltlich rückgebunden, so vermutlich auch<br />
bei den vier Wohnhäusern, die Frank Llyod Wright zwischen 1920 und 1924 in<br />
Los Angeles und Pasadena nach dem von ihm entwickelten textile-block-system<br />
errichten ließ (Abb. 1). Mit <strong>der</strong> reliefartigen Oberflächenornamentierung <strong>der</strong><br />
vorfabrizierten Betonwerksteine knüpfte Wright an die präkolumbische Kunstund<br />
Architekturtradition an, insbeson<strong>der</strong>e an die in Stein gehauenen, in ihrer<br />
Serialität, Symmetrie und Symbolik ornamentalen Reliefs und Glyphen <strong>der</strong><br />
Maya (Abb. 2). 408 Die Vermutung liegt nahe, dass die Motivwahl mit <strong>der</strong> geographischen<br />
Nähe zu Mexiko zusammenhängt; ein spezifischer Bezug o<strong>der</strong> eine<br />
individuelle Vorliebe des Architekten bzw. seiner Auftraggeber ist jedoch nicht<br />
überliefert.<br />
Wie Gerd Zimmermann herausstellte, macht das Beispiel The International<br />
Style deutlich, dass <strong>der</strong> »vorgebliche Universalismus <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne« nur »ein<br />
verkappter Eurozentrismus« war, <strong>der</strong> »ziemlich klar längs <strong>der</strong> Machtstrukturen<br />
des europäischen Kolonialismus verlief« 409 , indem er die westliche Kultur zum<br />
Maßstab erhob. Die Mo<strong>der</strong>ne entpuppt sich – so Bernd Nicolai – nicht als »Stilbegriff«,<br />
son<strong>der</strong>n als eine »sozialhistorisch determinierte Epochenklassifikation«,<br />
hinter <strong>der</strong> sich ein »spezifisch westeuropäisches Gesellschaftsmodell« verbirgt,<br />
das heute in Anbetracht <strong>der</strong> Globalisierung mehr denn je »auf dem Prüfstand«<br />
stehen muss. 410 Dass sich mo<strong>der</strong>ne Architekten wie Le Corbusier o<strong>der</strong> Wright<br />
<strong>der</strong> eurozentrischen Grundausrichtung zum Trotz aus dem Formen-, Materialund<br />
Ornamentschatz außereuropäischer Kulturen inspirieren ließen, bestätigt<br />
die kulturenübergreifende Wirksamkeit und Relevanz von Architektur, die mit<br />
<strong>der</strong> Postmo<strong>der</strong>ne ab den späten 1970er Jahren auf theoretischer wie praktischer<br />
Ebene, hier insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> <strong>Fassade</strong>ngestaltung mit Hilfe von Bild, Schrift<br />
und Ornament, stärker ins Blickfeld rückte.<br />
Postmo<strong>der</strong>ne<br />
1960er und 1970er Jahre – Abkehr vom Funktionalismus<br />
Der deutsche Philosoph Ernst Bloch (1885-1977) setzte sich in seinem Hauptwerk<br />
Das Prinzip Hoffnung, geschrieben im amerikanischen Exil zwischen 1938<br />
und 1947, kritisch mit <strong>der</strong> funktionalistischen Architektur des ersten Jahrhun<strong>der</strong>tdrittels<br />
auseinan<strong>der</strong> und streifte dabei auch die Ornamentthematik: »Seit<br />
über einer Generation stehen [...] diese Stahlmöbel-, Betonkuben-, Flachdach-<br />
Wesen geschichtslos da, hochmo<strong>der</strong>n und langweilig, scheinbar kühn und echt<br />
trivial, voll Haß gegen die Floskel angeblich jedes Ornaments und doch mehr<br />
im Schema festgerannt als je eine Stilkopie im schlimmen 19. Jahrhun<strong>der</strong>t.« 411<br />
Aufgrund ihrer Vorliebe für formale Reduktion und Klarheit sei die mo<strong>der</strong>ne<br />
Architektur »ewig funktionelle« Oberfläche, wobei sie »auch in größter Durchsichtigkeit<br />
keinen Inhalt zeig[e], kein Ausschlagen und keine ornamentbildende<br />
Blüte eines Inhalts«. 412 Während in Deutschland das Ornament in <strong>der</strong> nationalsozialistischen<br />
Architektur als nationalpolitisches Symbol instrumentalisiert