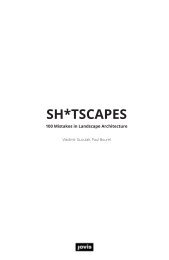Ornamente der Fassade
ISBN 978-3-86859-233-7
ISBN 978-3-86859-233-7
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
114 Zeitgenössische <strong>Ornamente</strong> 115<br />
Branding-Zweck hinausweisende Relevanz von <strong>Ornamente</strong>n <strong>der</strong> Konsumbranche<br />
zeigte sich an <strong>der</strong> Diskussion um die <strong>Fassade</strong>ngestaltung eines Kaufhaus-<br />
Neubaus, <strong>der</strong> 2007-2009 an Stelle des abgerissenen Centrum Warenhauses in<br />
Dresden errichtet wurde (Abb. 29-30). Das Centrum Warenhaus in <strong>der</strong> Prager<br />
Straße, 1973-1978 von den ungarischen Architekten Ferenc Simon und Ivan<br />
Fokvari entworfen, galt mit seiner Vorhang-<strong>Fassade</strong> aus rhomboiden, eloxierten<br />
Aluminiumelementen als Vorzeigebau <strong>der</strong> Kaufhaus-Architektur in <strong>der</strong> DDR.<br />
Peter Kulka gewann im Wettbewerb für die Neu- und Umgestaltung den ersten<br />
Preis, weil er die Wie<strong>der</strong>verwendung <strong>der</strong> <strong>Fassade</strong>nwaben des Altbaus zu 80 Prozent<br />
vorsah und, so die Begründung des Preisgerichtes, mit dem »Einsatz <strong>der</strong><br />
identifikationsstiftenden <strong>Fassade</strong>nelemente auf das historische Bewusstsein <strong>der</strong><br />
Dresdner« 587 reagiere.<br />
Regionale Bezüge<br />
29<br />
Begriffsverwendung – lokal, global, »glokal«<br />
29, 30 Peter Kulka: Centrum Warenhaus (Neu- und Umgestaltung)<br />
in Dresden (D), 2007-2009<br />
wi<strong>der</strong>zuspiegeln. Architektur müsse, so Gautrand, »manchmal selbst ein Signal<br />
werden: Sie hat die Macht und die Eigenschaft, eine Marke zu repräsentieren,<br />
und diese Art von Signaletik ist viel bedeuten<strong>der</strong> als irgendetwas, das lediglich<br />
auf das Gebäude appliziert wird.« 586 Emotion, Spektakel und Kommerz bilden<br />
im Hinblick auf Konsumarchitektur oftmals eine Wirkungseinheit; Konsum<br />
wird durch spektakuläre Architektur zu einem mehrdimensionalen, sinnlichästhetischen<br />
Ereignis.<br />
Das Ornament in seiner ganzen Bandbreite eignet sich für wirtschaftliche Strategien<br />
des branding, indem es dem Gebäude o<strong>der</strong> <strong>der</strong> darin ansässigen Firma<br />
o<strong>der</strong> Institution zu größerer Bekanntheit, einer Profilschärfung o<strong>der</strong> Prestige-<br />
Verbesserung verhelfen kann. An<strong>der</strong>erseits kommt es dem heutigen Bedürfnis<br />
nach Atmosphäre, Ereignis, emotionaler Involviertheit und individuellem Erleben<br />
entgegen. So wie die Zeichenhaftigkeit <strong>der</strong> Architektur ganz allgemein<br />
zu einer Verbindung zwischen Wirtschaft und menschlicher Psyche führt,<br />
so kann das einzelne Ornament-Zeichen als Bindeglied zwischen wirtschaftlichem<br />
Kalkül und emotionalen Belangen dienen. Die kulturprägende, über den<br />
30<br />
Auf <strong>der</strong> Suche nach neuen architektonischen Erscheinungsformen nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg bemühten sich einzelne Architekten um eine Ortsbindung<br />
und Kontextualisierung ihrer Bauten, indem sie auf vormo<strong>der</strong>ne, lokal verankerte<br />
Bauweisen, Gestaltungselemente und Motive zurückgriffen. In Abgrenzung<br />
zum »Universalismus <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne« wurde die Rückbesinnung auf die<br />
»nationalen und regionalen Beson<strong>der</strong>heiten des Bauens« mit <strong>der</strong> Postmo<strong>der</strong>ne<br />
wie<strong>der</strong> zu einem zentralen Anliegen. 588 In den letzten zwei Jahrzehnten führte<br />
dann die zunehmende Einbindung in globale künstlerische Austauschprozesse<br />
zu <strong>der</strong> Herausbildung einer hybriden, global wie lokal orientierten Baukultur.<br />
Dabei kommt <strong>Ornamente</strong>n eine entscheidende Rolle zu, denn sie können aufgrund<br />
ihrer kulturellen Bedeutung und kommunikativen Funktion die entstandene<br />
»Dichotomie zwischen Tabula rasa und Kontextualisierung« überbrücken<br />
und eine »Artikulation zwischen dem Lokalen und dem Globalen« beför<strong>der</strong>n. 589<br />
Der Neologismus »glokal«, eine Zusammenziehung von global und lokal, wurde<br />
Anfang <strong>der</strong> 1990er Jahre in Kalifornien im soziopolitischen Zusammenhang<br />
kreiert, um die Debatte zwischen Globalisierungsbefürwortern und Globalisierungsgegnern<br />
zu beschreiben. Robert Robertson, auf den <strong>der</strong> Terminus<br />
glocalisation zurückgeführt wird, vertritt die Position, dass »Globalisierung die<br />
Wie<strong>der</strong>herstellung, in bestimmter Hinsicht sogar die Produktion von ›Heimat‹,<br />
›Gemeinschaft‹ und ›Lokalität‹ mit sich gebracht« 590 habe. Aus diesem Grund<br />
ist das Lokale »nicht als Gegenspieler des Globalen«, son<strong>der</strong>n vielmehr als »ein<br />
Aspekt von Globalisierung« 591 , als »konstitutiver Bestandteil des Globalen« 592 zu<br />
verstehen. Im Unterschied zur postmo<strong>der</strong>nen Architektur, die größtenteils Wert