Au sg ab e 0 1 /1 1 - Fachwissen Palliative Care - B. Braun ...
Au sg ab e 0 1 /1 1 - Fachwissen Palliative Care - B. Braun ...
Au sg ab e 0 1 /1 1 - Fachwissen Palliative Care - B. Braun ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
16<br />
Der Wille des Patienten ist maßgebend<br />
Von Prof. Dr. Gunnar Duttge, Martje Oldewurtel<br />
Die aktuelle Grundsatzentscheidung des Bunde<strong>sg</strong>erichtshofes zum aktiv herbeigeführten Behandlungs<strong>ab</strong>bruch<br />
(BGH v. 25. Juni 2010 – 2 StR 454/09) ist eindeutig: Wünscht der Patient keine Therapieverlängerung,<br />
so ist dies für alle am Behandlung<strong>sg</strong>eschehen Beteiligten zu respektieren. Weiterhin verboten bleibt „das<br />
zielgerichtete Beibringen“ eines todbringenden Mittels.<br />
<strong>Au</strong>f dem Gebiet der Therapiebegrenzung besteht noch immer<br />
große Rechtsunsicherheit bei allen Beteiligten, besonders bei<br />
pflegendem und betreuendem Personal, was erlaubt und welche<br />
Handlungen mit Strafe bedroht sind. Dass dies bisher nicht <strong>ab</strong>schließend<br />
geklärt war, zeigt sich auch daran, dass im entscheidung<strong>sg</strong>egenständlichen<br />
Verfahren ein Fachanwalt für Medizinrecht<br />
angeklagt wurde. Der Bunde<strong>sg</strong>erichtshof in Strafsachen<br />
hatte in seiner Grundsatzentscheidung die rechtlich wie emotional<br />
schwierige Frage zu entscheiden, inwieweit zur Durchsetzung<br />
des (mutmaßlichen) Patientenwillens eine laufende Therapie (hier:<br />
künstliche Ernährung) aktiv beendet werden darf, selbst wenn dies<br />
(jedenfalls mittelfristig) zum Tode des Patienten führen kann.<br />
I. Zum Sachverhalt<br />
Im vorliegenden Fall lag die Patientin (Frau K.) seit 2002 im sogenannten<br />
„Wachkoma“ (apallisches Syndrom) und wurde in einem<br />
Seniorenheim gepflegt. Sie war nicht ansprechbar und wurde<br />
durch eine Magensonde (PEG) künstlich ernährt. Wenige Wochen,<br />
bevor sie ins Wachkoma fiel, hatte sich Frau K. ihrer Tochter gegenüber<br />
dahingehend geäußert, dass sie „künstliche Beatmung<br />
und Ernährung“ ausdrücklich <strong>ab</strong>lehne, wenn die Lage aussichtslos<br />
sei. Der behandelnde Hausarzt bestätigte nach Ablauf von mehr<br />
als drei Jahren, dass sich der Zustand von Frau K. nicht mehr bessern<br />
werde, woraufhin die mittlerweile zur Betreuerin bestellte<br />
Tochter die Einstellung der künstlichen Ernährung forderte. Die<br />
Heimleitung lehnte dieses Ansinnen <strong>ab</strong> und erteilte der Tochter<br />
nach monatelangen <strong>Au</strong>seinandersetzungen Hausverbot. Diese<br />
suchte Rat bei dem angeklagten Anwalt; dieser riet ihr unter dem<br />
Eindruck der eskalierten Situation, den Schlauch der PEG-Sonde<br />
mit einer Schere zu durchtrennen.<br />
Die zuständige Staatsanwaltschaft klagte beide, Tochter und Anwalt,<br />
vor dem Landgericht Fulda wegen versuchten Totschlags<br />
an. Ein vollendetes Tötungsdelikt schied von vornherein aus, weil<br />
Frau K. eines natürlichen Todes verstarb, nachdem ihr eine neue<br />
PEG-Sonde eingesetzt wurde. Die Tochter wurde wegen unvermeidbaren<br />
Verbotsirrtums freigesprochen (§ 17 StGB). Ein solcher<br />
liegt vor, wenn der Täter alles in seiner Macht stehende getan hat,<br />
um die Rechtslage richtig zu deuten und somit keine Möglichkeit<br />
hatte zu erkennen, dass er Unrecht begeht. Der Anwalt wurde hin-<br />
01/11<br />
Recht<br />
gegen zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung<br />
verurteilt. Dadurch, dass er als rechtskundige Person der Tochter<br />
versicherte, dass sie rechtmäßig handle, h<strong>ab</strong>e er deren Verbotsirrtum<br />
hervorgerufen und somit das Geschehen „gesteuert“; das<br />
Tatgeschehen müsse ihm deshalb als eigenes zugerechnet werden<br />
(mittelbare Täterschaft, § 25 Abs. 1 Hs. 2 StGB).<br />
II. Problemstellung<br />
<strong>Au</strong><strong>sg</strong>angspunkt für sämtliche Fallgestaltungen zur Therapiebegrenzung<br />
ist, dass jeder Mensch das Recht hat, ein ärztliches<br />
Therapieangebot <strong>ab</strong>zulehnen, selbst wenn dies für ihn <strong>ab</strong>sehbar<br />
oder sicher tödliche Folgen hat. Das Selbstbestimmungsrecht über<br />
den eigenen Körper verschafft dem Patienten daher die Befugnis,<br />
auf diese Weise mittelbar auch über sein Leben zu verfügen. Allerdings<br />
darf er sich von einem anderen nicht zielgerichtet töten<br />
lassen; § 216 StGB verbietet die aktiv-direkte Tötung selbst dann,<br />
wenn der Patient dies ausdrücklich und ernstlich verlangt hat. Hier<br />
findet also der Wille des Patienten seine Grenze, u. a. deshalb, um<br />
Missbrauch zu verhindern: Denn niemand kann im Anschluss den<br />
Getöteten noch befragen, ob er seinen Tod wirklich gewollt hat.<br />
Die bisherige Rechtsprechung des höchsten Strafgerichts (insbes.<br />
BGHSt 40, S. 257 ff.) ging davon aus, dass ein Beenden lebenserhaltender<br />
Therapien dann straffrei ist, wenn die Erkrankung unaufhaltsam<br />
einen tödlichen Verlauf genommen hat und das Unterlassen<br />
weiterer lebenserhaltender Maßnahmen vom tatsächlich<br />
geäußerten oder mutmaßlichen Willen des Patienten gedeckt ist<br />
(sog. „passive Sterbehilfe“). Zur damit bedeutsamen Abgrenzungsfrage<br />
zwischen „straffreiem Unterlassen“ und strafbewehrtem<br />
„aktiven Tun“ wurde in der Vergangenheit in der klinischen Praxis<br />
(<strong>ab</strong>er auch von manchen Vormundschaftsrichtern) das Abstellen<br />
einer Lungenmaschine häufig wegen der „Aktivität“, die es zum<br />
Umlegen des Schalters braucht, als „aktives Tun“ und damit als<br />
strafbar qualifiziert. Betrachtet man <strong>ab</strong>er genauer, was eine Lungenmaschine<br />
„tut“, so stellt man fest, dass sie lediglich dem Arzt<br />
das Beatmen von Hand <strong>ab</strong>nimmt. Würde er einfach mit der manuellen<br />
Beatmung aufhören, so ließe sich dies eindeutig als Unterlassen<br />
qualifizieren. Der sog. „Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit“<br />
liegt hier also nicht beim Umlegen des Schalters, sondern beim<br />
Unterlassen der weiteren Beatmung.




![PDF [6.54 MB] - Fachwissen Palliative Care - B. Braun Melsungen AG](https://img.yumpu.com/25122911/1/184x260/pdf-654-mb-fachwissen-palliative-care-b-braun-melsungen-ag.jpg?quality=85)
![PDF [0.22 MB] - Fachwissen Palliative Care - B. Braun Melsungen AG](https://img.yumpu.com/25122907/1/190x135/pdf-022-mb-fachwissen-palliative-care-b-braun-melsungen-ag.jpg?quality=85)
![PDF [3.81 MB] - Fachwissen Palliative Care - B. Braun Melsungen AG](https://img.yumpu.com/25122908/1/184x260/pdf-381-mb-fachwissen-palliative-care-b-braun-melsungen-ag.jpg?quality=85)

![PDF [0.65 MB] - Fachwissen Palliative Care - B. Braun Melsungen AG](https://img.yumpu.com/25122900/1/190x135/pdf-065-mb-fachwissen-palliative-care-b-braun-melsungen-ag.jpg?quality=85)
![PDF [3.34 MB] - Fachwissen Palliative Care - B. Braun Melsungen AG](https://img.yumpu.com/25122892/1/184x260/pdf-334-mb-fachwissen-palliative-care-b-braun-melsungen-ag.jpg?quality=85)
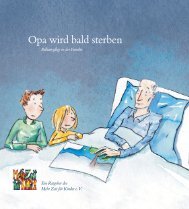

![PDF [8.89 MB] - Fachwissen Palliative Care - B. Braun Melsungen AG](https://img.yumpu.com/25122889/1/184x260/pdf-889-mb-fachwissen-palliative-care-b-braun-melsungen-ag.jpg?quality=85)
![PDF [3.82 MB] - Fachwissen Palliative Care - B. Braun Melsungen AG](https://img.yumpu.com/25122886/1/184x260/pdf-382-mb-fachwissen-palliative-care-b-braun-melsungen-ag.jpg?quality=85)

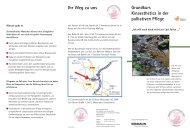

![PDF [2.20 MB] - Fachwissen Palliative Care - B. Braun Melsungen AG](https://img.yumpu.com/25122881/1/190x133/pdf-220-mb-fachwissen-palliative-care-b-braun-melsungen-ag.jpg?quality=85)