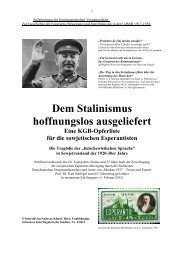OE 4 2007 van Dijk - Plansprachen.ch
OE 4 2007 van Dijk - Plansprachen.ch
OE 4 2007 van Dijk - Plansprachen.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
148 Ziko <strong>van</strong> <strong>Dijk</strong><br />
Der erste Eindruck ist der einer romanis<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>e, Wörter wie seminario sind<br />
sofort wiedererkennbar. Das -o am Ende eines Wortes signalisiert im Esperanto, daß<br />
es si<strong>ch</strong> um ein Substantiv handelt, -j ist das Anhängsel für den Plural. Das letzte Wort,<br />
seminariejo, enthält das Suffix -ej, das einen Ort bezei<strong>ch</strong>net, also: Seminarort.<br />
Es fällt der „Da<strong>ch</strong>bu<strong>ch</strong>stabe“ ĉ auf, der wie ts<strong>ch</strong> ausgespro<strong>ch</strong>en wird. Zamenhof hat<br />
einige diakritis<strong>ch</strong>e Zei<strong>ch</strong>en eingeführt, damit bestimmte Laute ni<strong>ch</strong>t mit mehreren<br />
Bu<strong>ch</strong>staben ausgedrückt werden müssen, Vorbild waren vor allem die slawis<strong>ch</strong>en<br />
Spra<strong>ch</strong>en mit Lateinalphabet.<br />
Vergli<strong>ch</strong>en mit den meisten anderen <strong>Planspra<strong>ch</strong>en</strong> ist für das Esperanto außergewöhnli<strong>ch</strong>,<br />
daß es au<strong>ch</strong> germanis<strong>ch</strong>e und slawis<strong>ch</strong>e Elemente verwendet. Das Wort partoprenanto<br />
im Beispielssatz heißt ganz wörtli<strong>ch</strong> „Teil-nehmer“, Zamenhof verwendete<br />
also wie im Deuts<strong>ch</strong>en eine Zusammensetzung von gängigeren Wörtern, um Neologismen<br />
wie etwa participanto einzusparen. Ferner gibt es au<strong>ch</strong> Lexeme, die aus germanis<strong>ch</strong>en<br />
und slawis<strong>ch</strong>en Spra<strong>ch</strong>en entnommen wurden, beispielsweise jaro (Jahr)<br />
und nur (nur) aus dem Deuts<strong>ch</strong>en, suno (Sonne) aus dem Englis<strong>ch</strong>en, kolbaso (Wurst)<br />
aus dem Polnis<strong>ch</strong>en und vosto (S<strong>ch</strong>wanz) aus dem Russis<strong>ch</strong>en. Au<strong>ch</strong> aus dem Litauis<strong>ch</strong>en<br />
gibt es ein Esperanto-Wort – das Wört<strong>ch</strong>en tuj aus dem obigen Beispielsatz.<br />
Strittig ist ein jiddis<strong>ch</strong>er Einfluß. 18 Je na<strong>ch</strong> Korpus und Zählweise wird der Anteil sol<strong>ch</strong>er<br />
ni<strong>ch</strong>tromanis<strong>ch</strong>er Wörter am Esperanto auf bis zu ein Viertel ges<strong>ch</strong>ätzt. 19<br />
Die erste Wörterliste Zamenhofs von 1887 enthielt ungefähr neunhundert Lexeme,<br />
au<strong>ch</strong> sol<strong>ch</strong>e, die man ni<strong>ch</strong>t unbedingt im Grundworts<strong>ch</strong>atz einer Weltspra<strong>ch</strong>e vermuten<br />
würde. Sie geben einen Hinweis auf Zamenhofs Umwelt, wie cimo (Zecke) und<br />
pliko, der berü<strong>ch</strong>tigte Wei<strong>ch</strong>selzopf (plica polonica), eine Hautkrankheit, die angebli<strong>ch</strong><br />
besonders unter den armen Juden Polens vorkam. Bald na<strong>ch</strong> Ers<strong>ch</strong>einen der Spra<strong>ch</strong>e<br />
setzte jedo<strong>ch</strong> eine eigenständige Entwicklung ein, in der alte Wörter ausges<strong>ch</strong>ieden<br />
und neue aufgenommen wurden, wie dies au<strong>ch</strong> bei anderen Spra<strong>ch</strong>en der Fall ist.<br />
Maßgebli<strong>ch</strong> ist der Spra<strong>ch</strong>gebrau<strong>ch</strong>, der von den Esperanto-Wörterbü<strong>ch</strong>ern na<strong>ch</strong>vollzogen<br />
wird.<br />
Eine neue Spra<strong>ch</strong>gemeins<strong>ch</strong>aft<br />
Na<strong>ch</strong> zwei früheren Projekten veröffentli<strong>ch</strong>te Zamenhof 1887 die „Internationale<br />
Spra<strong>ch</strong>e“, die später den Namen Esperanto erhielt. Da er um seinen Ruf als junger<br />
Augenarzt für<strong>ch</strong>tete, verwendete er für si<strong>ch</strong> das Pseudonym „Esperanto“, was in dieser<br />
Spra<strong>ch</strong>e „ein Hoffender“ bedeutet. Bald bürgerte si<strong>ch</strong> das Wort, über „Spra<strong>ch</strong>e des<br />
Dr. Esperanto“ und „Esperanto-Spra<strong>ch</strong>e“, als Name für die Spra<strong>ch</strong>e selbst ein.<br />
Der fris<strong>ch</strong> verheiratete Augenarzt hatte vom wohlhabenden S<strong>ch</strong>wiegervater eine<br />
großzügige Mitgift erhalten, so daß er si<strong>ch</strong> ganz der Verbreitung des Esperanto widmen<br />
konnte. Do<strong>ch</strong> das Geld war na<strong>ch</strong> bereits zwei Jahren aufgebrau<strong>ch</strong>t, und zwei<br />
Kinder mußten ernährt werden. Zamenhof ma<strong>ch</strong>te wie alle anderen <strong>Planspra<strong>ch</strong>en</strong>autoren<br />
die Erfahrung, wie mühselig es ist, eine neue Spra<strong>ch</strong>e an den Mann zu bringen.<br />
——————<br />
18 Christer Kiselman: Kial ni hejtas la hejmon sed ŝajnas fajfi pri la fajlado? In: Literatura<br />
Foiro, 138/1992, S. 213–216. – Ebbe Vilborg: Etimologia Vortaro de Esperanto, 4 Bde.<br />
Malmö 1989–2001, siehe unter den Lemmata hejm/o, hejt/i und edz/o.<br />
19 Detlev Blanke: Internationale <strong>Planspra<strong>ch</strong>en</strong>. Eine Einführung. Berlin 1985, hier S. 252–253.