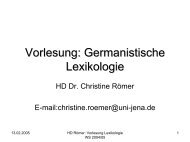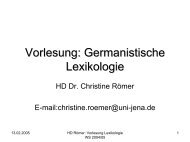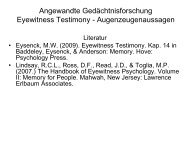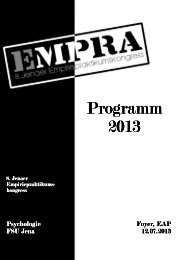Grundvorlesung Allgemeine Mikrobiologie
Grundvorlesung Allgemeine Mikrobiologie
Grundvorlesung Allgemeine Mikrobiologie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Grundvorlesung</strong> <strong>Allgemeine</strong> <strong>Mikrobiologie</strong><br />
möglichst effizient aufzunehmen. Es kam zur Evolution gezielter Transportmechanismen. Vorteihaft war es<br />
auch, wenn man sich zusätzliche Nahrungsquellen erschließen konnte. Es kam zur Evolution von<br />
Freßmechanismen. Noch vorteilhafter war es, wenn man sich von vorgeformter, organischer Nahrung<br />
weitgehend unabhängig machen konnte. Ausgehend von der zunächst vollständig heterotrophen<br />
Lebensweise kam es zur autotrophen Daseinsform. Kohlenstoff konnte in Form der einfachen, gasförmigen<br />
Kohlenstoffverbindung CO2 aufgenommen und in zelleigenes Material umgewandelt werden. Die ersten<br />
einfachen und für lange Zeit einzelligen Pflanzen wurden erfunden.<br />
Bisher haben wir stillschweigend vorausgesetzt zu wissen, was Leben ist. Wir sollten vielleicht nicht<br />
unbedingt eine strikte Definition suchen, sollten uns aber wenigstens über die Kriterien des Lebens einig sein.<br />
Die Pyrit−Theorie als Alternative zur Ursuppen−Vorstellung<br />
Seit etlichen Jahren wird als Alternative oder Ergänzung zur 'Ursuppentheorie' eine andere Theorie zur<br />
Entstehung des Lebens auf der Erde diskutiert. Sie stammt von dem Münchner Chemiker und Patentanwalt<br />
Günter Wächtershäuser. Während nach der Ursuppentheorie die ersten Lebensformen heterotroph waren,<br />
schlägt Wächtershäuser ein Modell vor, das primär autotrophes Leben entstehen läßt. Natürlich können die<br />
ersten Lebewesen keine Photosynthese in Art der grünen Pflanzen oder auch nur der etwas einfacher<br />
aufgebauten photosynthetisch aktiven Cyanobakterien durchgeführt haben. Dazu sind schon in einer<br />
Minimalausstattung sehr komplizierte Strukturen erforderlich. Somit scheidet Licht als Energiequelle aus. Es<br />
gibt aber Alternativen. Sie werden noch lernen, daß es auch heute noch Bakterien auf der Erde gibt, die sich<br />
energieliefernde anorganisch−chemische Prozesse zunutze machen und auf dieser Basis autotroph sind. Wir<br />
nennen solche Organismen chemolithoautotroph. Manche Bakterien − und die sind nicht einmal selten −<br />
können sich sogar extrem exotherme Reaktionen wie die Knallgasreaktion zunutze machen. Natürlich ist auch<br />
das keine Alternative für die einfache Form der Autotrophie wie wir sie aus der Frühzeit der Geschichte des<br />
Lebens erwarten können. Es erfordert lange, sorgfältig kontrollierte Reaktionskaskaden, um diese Reaktion in<br />
kleine, nutzbare Teilreaktionen aufzulösen.<br />
Wächtershäuser suchte also nach einer viel sanfteren Reaktion, deren Energie in biochemische Prozesse<br />
einfließen kann. Sein Vorschlag war die Bildung von Pyrit aus Eisen(II)sulfid und Schwefelwasserstoff:<br />
FeS + H2S −−−−−> FeS2 + 2 H + + 2 e −<br />
Mit Hilfe der durch die Reaktion bereitgestellten Elektronen und der freiwerdenden Energie könnte<br />
Kohlendioxid reduziert und zu Makromolekülen umgewandelt werden. Tatsächlich findet man in extremen<br />
Biotopen, die von Archaebakterien besiedelt sind, oft auch Pyrit. Solche Organismen sind bei über 100°C in<br />
heißen Quellen unter Druck lebensfähig. Das sind genau die Bedingungen, unter denen das Leben auf der<br />
Basis der Pyritbildung entstanden sein soll. Im Experiment konnte man zeigen, daß auch einige heute lebende<br />
Archaebakterien Eisensulfid mit Hilfe von Schwefelwasserstoff in Pyrit umwandeln können. Der postulierte<br />
frühe Lebensprozeß im einzelnen:<br />
Die Ausgangsstoffe des frühen Stoffwechsels − Wasser, Kohlendioxid, Stickstoff, Ammoniak − werden von<br />
heißen, vulkanischen Quellen zur Verfügung gestellt (1). Aus Schwefel und Schwefelwasserstoff entsteht<br />
Pyrit, der eine positiv geladene Oberfläche hat. Die freigesetzte Energie dient zur Reduktion von CO2 und zur<br />
Synthese hochmolekularer Verbindungen. Negativ geladene organische Verbindungen bleiben an die<br />
Pyritoberfläche gebunden (2). Katalytisch aktive Verbindungen sorgen für einen Stoffwechsel zwischen<br />
Kristalloberfläche und Umgebung (doch Ursuppe?). Fett−ähnliche Reaktionsprodukte lösen sich von der<br />
Oberfläche ab und umgeben den Pyritkristall (3). Weiteres Wachstum war nur möglich, indem sich der<br />
Pyritkristall vergrößertre. Es entstand der Himbeer−Pyrit, den es am Boden der Meere auch tatsächlich gibt<br />
(4). Mit dem Abheben der Membran entwickelt sich ein Reaktionsraum, der auch unabhängig von der<br />
Katalyse an der Pyrit−Oberfläche einen Stoffwechsel entwickeln kann. Die folgenden, komplizierten Schritte<br />
bis zur Bildung richtiger Zellen lassen sich wie auch bei der Ursuppentheorie dann nicht mehr so einfach<br />
Die Pyrit−Theorie als Alternative zur Ursuppen−Vorstellung 11