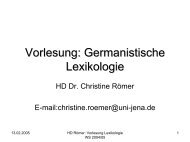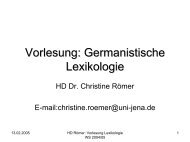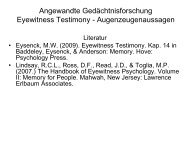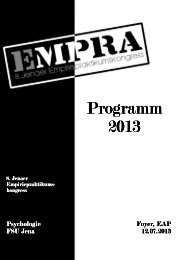Grundvorlesung Allgemeine Mikrobiologie
Grundvorlesung Allgemeine Mikrobiologie
Grundvorlesung Allgemeine Mikrobiologie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Maße von den Wachstumsbedingungen der Bakterien ab. Man kann die Kapseln im Mikroskop sehr einfach<br />
sichtbar machen, indem man einen Farbstoff zusetzt, der nicht in die Kapsel eindringt. Am einfachsten kann<br />
man dazu schwarze Tusche verwenden. Vor dem Hintergrund der Rußpartikel hebt sich die Zelle mit ihrer<br />
Hülle ab. Diese Färbetechnik heißt Negativ−Kontrastierung.<br />
Die chemische Zusammensetzung der Schleime kann sehr verschieden sein. Am verbreitesten sind Schleime<br />
aus Polysacchariden. Die genaue Zusammensetzung der Polysaccharide kann auch innerhalb der Art stark<br />
variieren. Damit wird nochmals klar, welche Bedeutung die Polysaccharide für Pathogene haben können.<br />
Obwohl im Innern prinzipiell dasselbe Bakterium steckt, kann die Immunabwehr sehr unterschiedlich<br />
reagieren, da die Bakterien von außen anders aussehen.<br />
Besonders bei Arten der Gattung Bacillus gibt es auch Kapseln, die aus Aminosäuren aufgebaut sind. Der<br />
Erreger des Milzbrandes, Bacillus anthracis baut seine Kapsel aus einem Polymer der Glutaminsäure auf.<br />
Geißeln und Beweglichkeit<br />
Bei Bakterien sind zwei Möglichkeiten zur Fortbewegung verwirklicht:<br />
• durch flexible Bewegungen der gesamten Zelle, die zu einem Gleiten führen. Das ist die typische<br />
Fortbewegungsart der Myxobakterien, die auf feuchten Oberflächen leben. Unter geeigneten<br />
Bedingungen können das durchaus auch andere Bakterien − sogar Escherichia coli.<br />
• durch das Schlagen von Geißeln. Diese Fortbewegungsart funktioniert natürlich nur in flüssigem<br />
Medium.<br />
Bakterielle Flagellen oder Geißeln sind entweder an einem Ende der Zelle inseriert (monotrich) oder an<br />
beiden Enden (amphitrich) oder aber sind um die gesamte Zelle herum verteilt (peritrich). Es gibt dann noch<br />
die polare Begeißelung in Schopf−artiger Form (lophotrich). Flagellen sind mit 20 nm so dünn, daß man sie<br />
im Lichtmikroskop nicht sehen kann. Sie sehen aber die Auswirkungen des Geißelschlags: Bakterien können<br />
im Lebendpräparat enorm schnell sein.<br />
Die Geißeln der Gram−negativen Bakterien durchdringen ausgehend von ihrer Einbettung in die<br />
Cytoplasmamembran die gesamte Zellwand. Sie sind aufgebaut aus dem Basalkörper, der Hakenregion und<br />
dem Filament. Der Basalkörper besteht aus zwei Paaren von Ringen, die das hohle Filament der Geißel<br />
umgeben. Diese Struktur ist dann in die Zellwand eingelassen, so daß der untere oder M−Ring in der<br />
Cytoplasmamembran sitzt. Der äußere Ring sitzt in Höhe der äußeren Membran. Dieser komplizierte<br />
Basalkörper ist aus 10−13 verschiedenen Proteinen aufgebaut. Moleküle von einem bestimmten dieser<br />
Proteine aggregieren spontan zu der Hakenregion. Das Filament ist ein langes, dünnes Rohr, das in der Regel<br />
aus nur einem einzigen Protein, dem Flagellin aufgebaut ist. Es wird vermutet, daß sich das Filament<br />
außerhalb der Zelle Proteinmolekülen zusammensetzt, die durch den ebenfalls hohlen Basalkörper nach außen<br />
transportiert werden, sich am distal gelegenen Ende in die Flagellenstruktur einordnen und sie somit<br />
verlängern. Die Struktur der Flagellen in gram−positiven Organismen ist ganz ähnlich, nur daß der<br />
Basalkörper aus nur zwei Ringen aufgebaut ist. Der innere sitzt in der Cytoplasmamembran und verankert die<br />
Geißel, der äußere sitzt in der Peptidoglycan−Schicht der Zellwand. Die Funktion der Ringe können SIe sich<br />
etwa wie die eines Gleitlagers in der Technik vorstellen.<br />
Die Flagellen setzen die bakterielle Zelle in Bewegung, indem der Basalkörper rotiert; die Drehrichtung kann<br />
sich umkehren. Die Energie für die Geißelbewegung dazu wird von ATP−liefernden Stoffwechselvorgängen<br />
am M−Ring erzeugt.<br />
Chemo− und Phototaxis<br />
<strong>Grundvorlesung</strong> <strong>Allgemeine</strong> <strong>Mikrobiologie</strong><br />
Bakterien können auf chemische und physikalische Stimuli antworten, d.h., sie können sich auf eine<br />
Reizquelle zu− oder sich von ihr wegbewegen. Chemotaxis nennen wir die Reaktion auf chemische Reize.<br />
Geißeln und Beweglichkeit 19