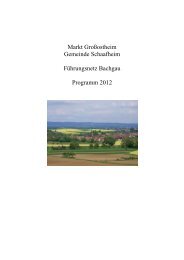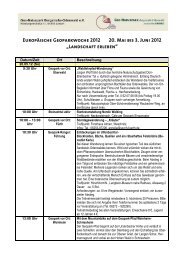Download PDF - Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
Download PDF - Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
Download PDF - Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Online-Publikationen des <strong>Geo</strong>-<strong>Naturpark</strong>s Bergstraße-<strong>Odenwald</strong> - www.geo-naturpark.net<br />
Spuren antiker Steingewinnung bei Heppenheim? -<br />
Experimentelle Ansätze zum Aufbau einer Typologie der Keiltaschen<br />
Jochen Babist 1,3 , Alexander Vögler 2 , Markus Gnirß 1<br />
( 1 AG Altbergbau <strong>Odenwald</strong> / 2 TU Darmstadt / 3 <strong>Geo</strong>-<strong>Naturpark</strong> Bergstraße-<strong>Odenwald</strong> e. V.)<br />
1. Technik der Hartgesteinsgewinnung im Wandel der Zeit<br />
Die Gesteine des Bergsträßer <strong>Odenwald</strong>es entstanden vor rund 400 bis 320 Millionen Jahren während<br />
des Variskischen Gebirgsbildungszyklus’, bei dem sich durch Kollision verschiedener Kontinente und<br />
Kontinent-Bruchstücke der Großkontinent „Pangäa“ bildete. An der Stelle des heutigen Bergsträßer<br />
<strong>Odenwald</strong>es befand sich ein aktiver Kontinentalrand, unter den ozeanische Kruste eines nördlich<br />
gelegenen Ozeans subduziert wurde 1 . Diese Situation ist in etwa vergleichbar mit den heutigen Anden<br />
an der Westküste Südamerikas.<br />
Im Unterbau des Variskischen Gebirges kristallisierten aus großen Mengen unterschiedlich<br />
zusammengesetzter Gesteinsschmelzen die Gesteinsarten Gabbro, Diorit, Granodiorit und Granit in<br />
Tiefen von 4 bis über 10 km Tiefe unter der damaligen Landoberfläche 2 .<br />
Typisches Kennzeichen dieser Plutonite (Tiefengesteine) ist das grobkörnige, ineinander verzahnte<br />
und meist richtungslose Gefüge, das sich durch ein langsames und Wachstum seiner Minerale<br />
ausbildete. Im Unterschied zu geschichteten Sedimenten (Ablagerungsgesteinen) und geschieferten<br />
Metamorphiten (Umwandlungsgesteinen) zeigen die Plutonite des Bergsträßer <strong>Odenwald</strong>es daher<br />
primär wenig ausgeprägte Spaltbarkeiten. Auch eine mit dem bloßen Auge kaum sichtbare<br />
magmatische Foliation konnte nur dann entstehen, wenn die Kristallisation während tektonischer<br />
Einspannung ablief – dann regelten sich bereits kristallisierte Mineralkörner mit ihrer Längsrichtung<br />
parallel zur Fließrichtung der Restschmelze in der Magmakammer ein 3 .<br />
Störungen und Klüfte, die heute sichtbar die Gesteine kennzeichnen, entwickelten sich während ihrer<br />
weiteren Abkühlung und unter später anliegenden tektonischen Spannungsfeldern. So sind Gabbro,<br />
Diorit, Granodiorit und Granit einerseits sehr kompakte, hochwertige Hartgesteine, aber andererseits -<br />
beispielsweise verglichen mit dem jüngeren Buntsandstein - deutlich schwieriger zu gewinnen und zu<br />
bearbeiten.<br />
Ähnliches gilt für die Ganggesteine, die als Schmelzen in Spalten in das Nebengestein eindrangen und<br />
dort kristallisierten 4 . Vor allem die meist feinkörnigen Lamprophyre des vorderen <strong>Odenwald</strong>es<br />
eigneten sich zur Herstellung von Pflastersteinen und wurden in linear angelegten Steinbrüchen, die<br />
den aderförmigen Vorkommen folgten, abgebaut (z. B. an der „Steinmauer“ bei Heppenheim-<br />
Erbach 5 ).<br />
Wesentlich jünger als die Ära der Variskischen Gebirgsbildung sind die hydrothermalen<br />
Gangfüllungen aus Baryt (Schwerspat) und Quarz. Sie stammen vermutlich aus der Jura-Zeit 6 und<br />
1 FRANKE, W. (1989).<br />
2 Zur Zusammenschau neuerer Interpretationen und Druck- und Temperaturdaten für das Bergsträßer Kristallin<br />
vergleiche z. B. STEIN, E. (2001).<br />
3 Zur Ausbildung magmatischer Foliationen im Detail siehe STEIN, E. (2000).<br />
4 Zur Petrographie und Genese der Odenwälder Ganggesteine siehe z. B. MEISL, S. (1975) und NICKEL, E. &<br />
FETTEL, M. (1985).<br />
5 Eine Exkursionsbeschreibung zum Kersantitgang der „Steinmauer“ findet sich bei NICKEL, E. & FETTEL, M.<br />
(1985), S. 121-123.<br />
6 Eine direkte Datierung der Odenwälder Barytquarzgänge liegt noch nicht vor. Allerdings gibt es zwei Gänge<br />
bei Hammelbach und am Leonhardshof bei Beerfelden, die Buntsandstein durchsetzen, also jünger als 251<br />
Millionen Jahre alt sein müssen. Tonmineraldatierungen aus hydrothermalen Gängen bei Schriesheim ergaben<br />
jurassische (Misch-)Alter, LIPPOLT, H. J & LEYK, H.-J. (2004). Ein indirekter Beleg ergibt sich auch durch die<br />
2