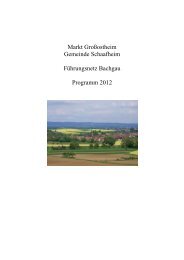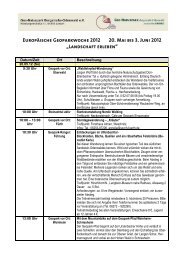Download PDF - Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
Download PDF - Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
Download PDF - Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Online-Publikationen des <strong>Geo</strong>-<strong>Naturpark</strong>s Bergstraße-<strong>Odenwald</strong> - www.geo-naturpark.net<br />
Erst im 19. Jahrhundert blühte die Hartgesteinindustrie des vorderen <strong>Odenwald</strong>es erneut auf 20 , und<br />
neben zahlreichen neu erschlossenen Steinbrüchen entstanden viele einzelne Werkplätze an<br />
natürlichen Felsgruppen oder im Bereich von Blockansammlungen. Zwar hatte sich mittlerweile die<br />
Sprengtechnik entwickelt (zunächst unter Einsatz von Schwarzpulver, im Bergbau des <strong>Odenwald</strong>es<br />
spätestens ab den 1740er Jahren nachweisbar), doch konnte die neue Technik noch nicht das Lösen<br />
und Zerteilen des Gesteins mit der Keilspaltungstechnik ersetzen: Zu stark wurde bei den radial<br />
wirkenden Sprengungen das interne Gefüge des Gesteins gestört, sodass es kaum noch für die<br />
Herstellung größerer Werkstücke brauchbar war. Mit dem Aufkommen des maschinellen<br />
Pressluftbohrens wurden schließlich zur Spaltung Patent- oder Federkeile (Keile mit Einlegescheiben<br />
aus Stahl) in die zylindrischen Bohrlöcher eingesetzt, um eine günstigere Kraftverteilung zu erreichen.<br />
Somit wurde die in vier Varianten praktizierte Keilspaltungstechnik (1. Keilspaltung ohne Keilnut,<br />
2. Keilspaltung mit Keilnut, 3. Keilrillenspaltung und 4. Federkeilspaltung) im Wesentlichen über<br />
1900 Jahre unverändert angewendet (Abb. 4). Alle händisch hergestellten Keiltaschenformen ohne<br />
Keilnut sind grundsätzlich in ihren Geländebefunden als verwechslungsgefährdet anzusprechen. Zwar<br />
gibt es – betrachtet man die Befunde vom Felsberg bei Reichenbach – Hinweise auf eine Überprägung<br />
von Variante 1 zu Variante 2 21 , doch bleibt zu diskutieren, inwieweit die Keilspaltung mit Nut<br />
tatsächlich die ursprünglichere Form der Keilspaltung mit Einzeltaschen zeitlich fassbar ablöste.<br />
Alternativ wäre durchaus denkbar, dass abhängig von Blockgröße und Gesteinseigenschaften beide<br />
Methoden auch gleichzeitig Anwendung fanden.<br />
2. Der Geländebefund vom Steinberg bei Heppenheim<br />
und die resultierende Fragestellung<br />
Anlässlich einer Begehung neuzeitlicher Werkplätze zwischen Heppenheim und der Juhöhe<br />
entdeckten die Verfasser einen Werkplatz, der schon durch seine Lage am steilen Westhang des<br />
Steinbergs (Gauss-Krüger Koordinaten R 3475300 / H 5499250) zwischen Heppenheim und<br />
Laudenbach ungewöhnlich erschien (vergleiche Karte Abb. 10, Lokalität „Steinberg“ südsüdöstlich<br />
von Heppenheim).<br />
Unmittelbar nördlich eines kleinen Steinbruches befindet sich eine größere Felsgruppe<br />
(Abb. 5) aus Granodiorit, die zwei misslungene und eine gelungene Stoßspaltung (vertikal) aufweist.<br />
Die Keiltaschen wurden ohne Keilnut in das Gestein eingetieft und weisen eine obere Breite von bis<br />
zu 14 cm auf. Die obere Spaltung wurde durchgeführt und zerriss den Block seitlich ausbrechend in<br />
zwei Teile (Abb. 6). Die untere Spaltung blieb erfolglos oder wurde gar nicht erst angesetzt (Abb. 7),<br />
da eine entsprechende Rissbildung entlang der vorgesehenen Spaltlinie nicht zu beobachten ist.<br />
Am nordwestlichen Fuß des Hauptfelsens findet sich ein scheibenförmiges Werkstück, dessen<br />
Rundung durch Keilspaltung (reliktisch erkennbare Keiltaschen mit einer Breite von 6,5 cm) und<br />
durch grobes Bossieren und Abspitzen hergestellt wurde. Der angelegte Kreisbogen besitzt einen<br />
Radius von rund 43 cm, das Werkstück besitzt eine (ungleichmäßige) Dicke von rund 30 cm (Abb. 8).<br />
Lediglich der unmittelbar nördlich davon liegende Block weist noch Reste einer Keilspaltung auf, alle<br />
anderen Blöcke im Umfeld scheinen unbearbeitet geblieben zu sein (vgl. Abb. 5). Sie zeigen die<br />
typische natürliche, rundliche Verwitterungsform granitischer Gesteine, gelegentlich durch scharf<br />
definierte Klüfte durchsetzt.<br />
Die Ränder der Keiltaschen aller drei Spaltungen erscheinen durch Verwitterung auffällig gerundet<br />
und legen den Schluss nahe, dass es sich nicht um neuzeitliche Abbauspuren handelt. Am unteren Teil<br />
des Felsens finden sich insgesamt drei Bohrpfeifen (Bohrlöcher) mit einem Durchmesser von 2,7 bis<br />
3,0 cm. Sie erscheinen jedoch willkürlich angeordnet und besitzen keinen Bezug zu der beabsichtigten<br />
Spaltlinie entlang der eingeschlagenen Keiltaschen (Abb. 6).<br />
20 Vergleiche z. B. CHELIUS, C. (1905), S. 61-74.<br />
21 Überprägungsbeziehungen wurden am Felsberg für Block 156 zwischen „Pyramide“ und den großen Felsen in<br />
der Nähe der Schutzhütte beschrieben von LOEWE, G. (1985), S. 98.<br />
6