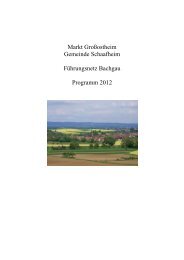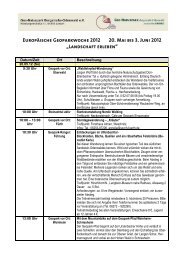Download PDF - Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
Download PDF - Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
Download PDF - Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Online-Publikationen des <strong>Geo</strong>-<strong>Naturpark</strong>s Bergstraße-<strong>Odenwald</strong> - www.geo-naturpark.net<br />
Mit Ausnahme der Sägespuren am „Altarstein“ (Block 87) und an einem weiteren Block oberhalb der<br />
Riesensäule zeigen alle bearbeiteten Quarzdiorit-Blöcke am Felsberg Spuren von reiner Keilspaltung.<br />
Diese Technik wurde spätestens seit der Herrschaft der Ptolemäer (323 bis 31 v. Chr.) in Ägypten<br />
angewendet 10 . Alle Formen der Keilspaltungen haben gemeinsam, dass das Gestein entlang einer<br />
durch zuvor eingehauene Vertiefungen definierten Linie beim Einschlagen von Keilen gezielt und<br />
schonend auseinander gesprengt wird. Als Keile dienten Eisenkeile (Methode 1 in Abb. 1) oder Eisen-<br />
und Holzkeile in Kombination mit paarweise an den Keiltaschenwangen anliegenden Eisenlamellen<br />
(Methode 2 in Abb. 1) 11 . Aus der Mühlsteinherstellung im Mayener Grubenfeld in der Osteifel ist auch<br />
die Verwendung von hölzernen Lamellen in situ in Keiltaschen dokumentiert worden 12 . Die sehr<br />
spärlichen Funde, die 1958 am Werkplatz des „Schiffs“ gemacht werden konnten, belegen in jedem<br />
Fall für den Felsberg die Verwendung 0,8 bis 1 cm dicker Eisenlamellen 13 .<br />
Abb. 2 (links):große Keiltasche der nach Röder vermutlich älteren Phase am Felsberg bei Reichenbach.<br />
Abb. 3 (rechts): Keilspaltung mit Keilnut und kleineren Keiltaschen der zweiten Phase am Felsberg.<br />
RÖDER entwickelte aufgrund seiner Beobachtungen an den Werkplätzen des Felsberges eine grobe<br />
Typologie nach der Größe der Keiltaschen (Vertiefungen, in die die Keile eingelassen wurden) und<br />
kam so zu einer zeitlichen Abfolge: Während einzelne, sehr breite und tiefe Keiltaschen mit einer<br />
oberen Keiltaschenlänge von bis zu 20 cm (siehe Abb. 2, zur Definition der Maßbegriffe vergleiche<br />
Abb. 14) aus der Frühphase des Abbaus im 2. Jahrhundert n. Chr. stammen sollen, werden die<br />
wesentlich häufigeren, mit 8 bis 10 cm Länge kürzeren Keiltaschen am Grund durchlaufend<br />
eingeschrämter „Keilnuten“ aufgrund von Analogieschlüssen dem 4. Jahrhundert n. Chr. zugeordnet 14 .<br />
Das Einschrämen einer Keilnut (Abb. 3) brachte gegenüber den einzeln stehenden Keiltaschen den<br />
Vorteil, dass die Längsachsen der einzelnen Keiltaschen besser in Linie ausgerichtet werden konnten<br />
10 RÖDER, J. (1965), S.527.<br />
11 GÖLDNER, H. & WEYRAUCH, W. (1989).<br />
12 MANGARTZ, F. (2008), S. 61.<br />
13 PLÖßER, H. (1993), S. 22.<br />
14 RÖDER, J. (1985).<br />
4