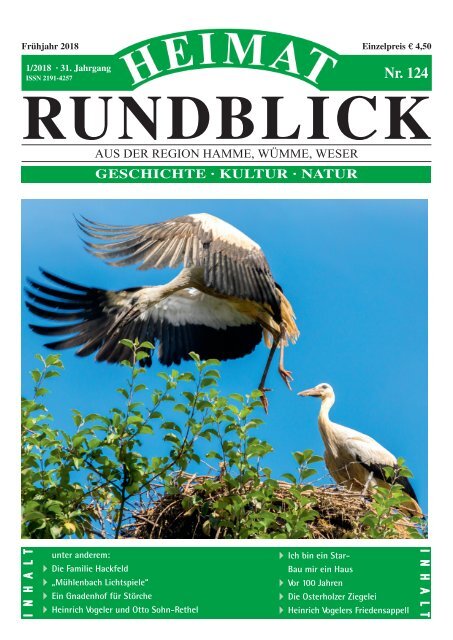Heimat-Rundblick Frühjahr 2018
Magazin für Kultur, Geschichte und Natur
Magazin für Kultur, Geschichte und Natur
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
Einzelpreis € 4,50<br />
1/<strong>2018</strong> Û·31. Jahrgang<br />
ISSN 2191-4257 Nr. 124<br />
RUNDBLICK<br />
AUS DER REGION HAMME, WÜMME, WESER<br />
GESCHICHTE Û KULTUR Û·NATUR<br />
I N H A L T<br />
unter anderem:<br />
4Die Familie Hackfeld<br />
4„Mühlenbach Lichtspiele“<br />
4Ein Gnadenhof für Störche<br />
4Heinrich Vogeler und Otto Sohn-Rethel<br />
4Ich bin ein Star-<br />
Bau mir ein Haus<br />
4Vor 100 Jahren<br />
4Die Osterholzer Ziegelei<br />
4Heinrich Vogelers Friedensappell<br />
I N H A L T
Anzeige<br />
Bestellcoupon<br />
q Ja, ich möchte den HEIMAT-RUNDBLICK abonnieren.<br />
Zum Jahresvorzugspreis von € 18,– einschl. Versand.<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Name / Vorname<br />
Siebdruck<br />
Digitaldruck<br />
Außenwerbung<br />
Wilbri GmbH<br />
Gutenbergstraße 11<br />
28 865 Lilienthal<br />
Tel. 04298-2706 0<br />
www.wilbri.de<br />
Straße / Hausnummer<br />
PLZ / Ort<br />
Bezahlung:<br />
q Überweisung auf Kreissparkasse Lilienthal<br />
IBAN: DE27 2915 2300 1410 0075 28 · BIC: BRLADE21OHZ<br />
q Abbuchung von meinem Konto Nr.<br />
Bank:<br />
IBAN:<br />
Redaktionssitzung<br />
Dr. Pourshirazi<br />
Fotos: Maren Arndt<br />
Am 27, Januar <strong>2018</strong> fand die aktuelle Redaktionssitzung<br />
unserer Zeitschrift statt – im stilvollen<br />
Overbeck-Museum in Vegesack. Frau Dr.<br />
Pourshirazi führte die Redakteure in lebendiger<br />
und gefühlvoller Weise in das Werk und das<br />
Leben von Fritz Overbeck ein – wir bedanken<br />
uns herzlichst!<br />
Anschließend besuchten wir zwecks Stärkung<br />
das Café gleich in der Nachbarschaft,<br />
eigentlich auch gedacht als Tagungsort, was<br />
allerdings aufgrund von Enge und Lautstärke zu<br />
Kopfzerbrechen über die weitere Gestaltung<br />
führte. Hocherfreut nahmen wir das Angebot<br />
von Frau Dr. Pourshirazi an, uns in die oberen<br />
Räume des Museums zurückziehen zu dürfen.<br />
Schnell ein paar Stühle organisiert – und schon<br />
konnte es losgehen.<br />
Verleger Jürgen Langenbruch berichtete von<br />
dem Renteneintritt unserer eigentlich unersetzlichen<br />
Almuth Roselius – wir wünschen Ihr<br />
alles Gute. (Gottseidank bleibt sie uns für einige<br />
Stunden in der Woche erhalten...). Erfreulicherweise<br />
arbeitet sich zur Zeit die Grafik-Designerin<br />
Christina Meyer, die in dem Haus des ehemaligen<br />
Daumlingsdorfs in Lüninghausen lebt,<br />
in die Materie ein. Ebenso erfreulich ist, dass<br />
Nächste Redaktionssitzung<br />
wir einige neue Autoren begrüßen dürfen – wir<br />
freuen uns!<br />
Eine gute Nachricht kommt vom Museum in<br />
OHZ – einige Aktivisten kümmern sich um eine<br />
mögliche Weiterführung – viel Erfolg!<br />
Nach Rückblick folgte die traditionelle Aufnahme<br />
neuer Themen – von denen so viele<br />
gemeldet wurden, dass auch für die neue Ausgabe<br />
kein Mangel herrschen wird. Nach Schlusswort<br />
und vielen Plaudereien ging auch diese<br />
Sitzung zu Ende –<br />
vielen Dank an Alle! Jürgen Langenbruch<br />
Die nächste Redaktionssitzung findet am 28. April <strong>2018</strong>, 15 Uhr, in der Kunstschau Lilienthal statt. Wir besuchen<br />
die neue Ausstellung „Karl Vinnen und Carl Krummacher“ und tagen gleich dort im Café.<br />
Ich lade herzlich dazu ein – Jürgen Langenbruch.<br />
2<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
Aus dem Inhalt<br />
Aktuelles<br />
Jürgen Langenbruch<br />
Redaktionssitzung Seite 2<br />
BRAS e. V.<br />
Köksch un Qualm Seite 22<br />
Axel Miesner<br />
Worphüser Heimotfrünn Seite 28<br />
Daniela Platz<br />
800 Jahre Worpswede Seite 34 – 38<br />
<strong>Heimat</strong>geschichte<br />
Harald Steinmann<br />
was lange währt... Seite 20-22<br />
Wilhelm Berger<br />
Die Osterholzer Ziegelei Seite 23 – 25<br />
Helmut Strümpler<br />
Jugendherbergen in den<br />
Dreißigerjahren Seite 29<br />
Daniela Platz<br />
Heinrich Vogelers Friedensappell<br />
von 1918 - aktuell bis heute Seite 32 – 33<br />
Kultur<br />
Rudolf Matzner<br />
Erinnerung an die ehemaligen Burglesumer<br />
„Mühlenbach Lichtspiele“ Seite 13<br />
Siegfried Bresler<br />
Heinrich Vogeler und<br />
Otto Sohn-Rether Seite 16 – 17<br />
Hans-Jörg Baake<br />
„Im Nebel der Vergangenheit“<br />
Die Enstehung „Neuenkirchen“ Seite 26-27<br />
Jens Uwe Böttcher<br />
Lilienthaler Wintertheater Seite 30-31<br />
Jürgen Langenbruch<br />
Ausstellung „Schwebschrauben<br />
und Scheinblüten“ Seite 39<br />
Natur<br />
Maren Arndt<br />
Ein Gnadenhof für Störche Seite 12-13<br />
Susanne Eilers<br />
Ich bin ein Star -<br />
bau mir ein Haus Seite 18-19<br />
Serie<br />
Peter Richter<br />
‘n beten wat op Platt Seite 9<br />
Vor 100 Jahren Seite 14 – 15<br />
Humor im Jahre 1918 Seite 19<br />
Bauernregeln Seite 25<br />
Fast vergessen Seite 33<br />
Redaktionsschluss für die nächste<br />
Ausgabe: 15. Mai <strong>2018</strong><br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
Liebe Leserinnen<br />
und Leser,<br />
Sie ahnen es vielleicht - unser Heft ist etwas<br />
ganz Besonderes. Jedenfalls ist mir nichts<br />
Gleichartiges bekannt: ein, fast hätte ich<br />
gesagt "Kollektiv", also eine Gruppe Gleichgesinnter,<br />
weiblich und männlich, erarbeitet seit<br />
vielen Jahren in jedem Vierteljahr mit viel Zeitaufwand<br />
und Recherche eine Reihe von in der<br />
Regel qualitativ hochwertigen Artikeln, die sich<br />
mit allen möglichen Ereignissen aus Vergangenheit<br />
und Gegenwart, aber auch mit die<br />
Zukunft tangierenden Entwicklungen beschäftigen.<br />
Dafür gebührt allen Beteiligten Dank<br />
und Anerkennung - vielleicht fällt dabei auch<br />
etwas für den Verleger ab, der bei der Kostenkalkulation<br />
gerne seine Brille mit den rosarot<br />
gefärbten Gläsern aufsetzt. Nun, sei es wie es<br />
ist: der Frühling ist eingetroffen und mit ihm<br />
die Störche, die deshalb auch unsere Titelseite<br />
schmücken.<br />
Ihnen ist sicher das Konsul-Hackfeld-Haus<br />
in der Birkenstraße bekannt, das Haus des<br />
CVJM, in dem zudem viele Veranstaltungen<br />
aller Art stattfinden. Wer dieser Konsul Hackfeld<br />
war, erfahren Sie in einem ausführlichen<br />
Artikel unseres Autors Rudolf Matzner; und<br />
dazu gibt es auch noch einen Nachtrag über<br />
den Zuckerfabrikanten Paul Isenberg.<br />
Wann waren Sie zum letzten Mal im Kino?<br />
Wenn Sie nicht mehr ganz jung an Jahren sind<br />
und Burglesum kennen, erinnern Sie sich vielleicht<br />
an die dortigen „Mühlenbach Lichtspiele“?<br />
In Berne gibt es eine Auffangstation für<br />
verletzte Störche, Maren Arndt berichtet uns<br />
von dieser verdienstvollen Unternehmung.<br />
Viele Vögel werden durch unsere ach so wunderbaren<br />
Windkraftwerke, für die es ja „keine<br />
Alternative“ gibt, verletzt oder getötet. Falls<br />
Ihre Uhr in letzter Zeit mal etwa nachging, es<br />
lag an der Vielzahl stromtechnischer Einspeisungen<br />
in das Netz, die je nach aktueller Lage<br />
(Wind – kein Wind, Sonnenlicht – kein Sonnenlicht)<br />
zu Schwierigkeiten bei der Synchronisation<br />
(50 Hz) führen. Und wenn der Strom<br />
einmal da ist und nicht gespeichert oder verbraucht<br />
werden kann, wird es schwierig.<br />
Vor 100 Jahren gab es das noch nicht, aber<br />
es gab andere Probleme – auch mit dem Strom,<br />
wie Peter Richter in dieser beliebten Rubrik<br />
erläutert.<br />
Siegfried Bresler berichtet von der Künstlerfreundschaft<br />
zwischen Heinrich Vogeler und<br />
Otto Sohn-Rethel, eine wichtige Episode aus<br />
dem spannungsreichen Leben Vogelers. Vogel<br />
des Jahres ist der Star – Susanne Eilers zitiert<br />
aus Veröffentlichungen der NABU.<br />
Nicht unumstritten ist die Geschichte des<br />
Klosters Lilienthal, Harald Steinmann konfrontiert<br />
uns mit neuen Erkenntnissen zu diesem<br />
Thema.<br />
Die Osterholzer Ziegelei wird ausführlich<br />
von Wilhelm Berger vorgestellt, in bewährter<br />
Qualität mit Wort und Bild.<br />
Hans-Jörg Baaake und Herbert A. Peschel<br />
rätseln zusammen über die Entstehung von<br />
Neuenkirchen – lesen Sie selbst.<br />
Im Lilienhof fand die diesjährige JHV der<br />
rührigen „Worphüser <strong>Heimat</strong>frünn“ statt – der<br />
neue Vorsitzende Axel Miesner berichtet.<br />
Jeder von uns hat sicher schon einmal in<br />
einer Jugendherberge übernachtet und erinnert<br />
sich gerne daran. Helmut Strümpler erinnert<br />
an die Jugendherberge Worpswede und<br />
den Missbrauch im „3. Reich“. Jens-Uwe Böttcher<br />
erzählt von einer Zusammenarbeit der<br />
Lilienthaler Freilichtbühne mit der Bremer<br />
Heimstiftung im Ellener Hof. Und noch einmal<br />
Heinrich Vogeler – der Friedensappel an den<br />
Kaiser von 1918; eine Rezension der Buchs von<br />
Bernd Stenzig: „Das Märchen vom lieben Gott“.<br />
Zwischendurch erfreut uns Peter Richter mit<br />
dem Gedicht „Sommerabend“ von Richard<br />
Dehmel; mögen uns auch solche Erbnisse<br />
beschieden werden...<br />
„Worpswede“ - das Dorf gab es auch schon<br />
ohne Künstler, Daniela Platz berichtet von 800<br />
Jahren Worpswede. Sie merken es: es gibt viel<br />
zu Lesen – ich wünsche Ihnen viel Spaß und<br />
hoffe, dass die so verschiedenen Themen auch<br />
Ihre Aufmerksamkeit verdient haben.<br />
Ihr Jürgen Langenbruch<br />
Impressum<br />
Herausgeber und Verlag: Druckerpresse-Verlag UG<br />
(haftungsbeschränkt), Scheeren 12, 28865 Lilienthal,<br />
Tel. 04298/46 99 09, Fax 04298/3 04 67, E-Mail<br />
info@heimat-rundblick.de, Geschäftsführer: Jürgen<br />
Langenbruch M.A., HRB Amtsgericht Walsrode 202140.<br />
Redaktionsteam: Wilko Jäger (Schwanewede),<br />
Rupprecht Knoop (Lilienthal), Dr. Christian Lenz (Teufelsmoor),<br />
Peter Richter (Lilienthal), Manfred Simmering<br />
(Lilienthal), Dr. Helmut Stelljes (Worps wede).<br />
Für unverlangt zugesandte Manuskripte und Bilder wird<br />
keine Haftung übernommen. Kürzungen vorbehalten. Die<br />
veröffentlichten Beiträge werden von den Autoren selbst<br />
verantwortet und geben nicht unbedingt die Meinung der<br />
Redaktion wieder. Wir behalten uns das Recht vor,<br />
Beiträge und auch Anzeigen nicht zu veröffentlichen.<br />
Leserservice: Telefon 04298/46 99 09, Telefax 04298/3 04 67.<br />
Korrektur: Helmut Strümpler.<br />
Erscheinungsweise: vierteljährlich.<br />
Bezugspreis: Einzelheft 4,50 ¤ , Abonnement 18,– ¤<br />
jährlich frei Haus. Bestellungen nimmt der Verlag<br />
entgegen; bitte Abbuchungsermächtigung beifügen.<br />
Kündigung drei Monate vor Ablauf des Jahresabonnements.<br />
Bankverbindungen: Für Abonnements: Kreissparkasse<br />
Lilienthal IBAN: DE27 2915 2300 1410 0075 28,<br />
BIC: BRLADE21OHZ.<br />
Für Spenden und Fördervereins-Beiträge: Volksbank<br />
Osterholz eG, IBAN: DE66 2916 2394 0732 7374 00, BIC:<br />
GENODEF1OHZ.<br />
Druck: Langenbruch, Lilienthal.<br />
Erfüllungsort: Lilienthal, Gerichtsstand Osterholz-Scharmbeck.<br />
Der HEIMAT-RUNDBLICK ist erhältlich:<br />
Bremen: Böttcherstraße/Ecke Andenkenladen<br />
Worpswede: Buchhandlung Netzel, Aktiv-Markt, Barkenhoff.<br />
Titelbild:<br />
Storchenstation „Mutter bringt Futter“<br />
Foto: Maren Arndt<br />
3
Die Familie Hackfeld<br />
Aufstieg und Niedergang des ehemals größten Unternehmens im Südseeraum<br />
Vorbemerkung:<br />
Das Haus des Bremer CVJM in der Birkenstraße<br />
Verwaltungsgebäude des Hackfeld-Konzern auf Hawaii<br />
Mit diesem Aufsatz soll versucht werden, das<br />
Lebenswerk des Heinrich Hackfeld und dessen<br />
Neffen und Nachfolgers Johann Friedrich Hackfeld<br />
ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken.<br />
Beide Familien haben ihre Spuren sowohl in<br />
Bremens Innenstadt als auch in St. Magnus hinterlassen.<br />
Während meines Vortrages über Persönlichkeiten<br />
unserer Stadt am 3. April 2003 in<br />
der ehemaligen Hackfeldschen Sommervilla in<br />
St. Magnus war ich versucht zu sagen, dass Bremens<br />
Geschichte um einiges ärmer wäre, wenn<br />
es Bremen-Nord nicht gäbe. Das können wir<br />
allerdings aus heutiger Sicht nur so sagen, denn<br />
zu der Zeit, als sich Bremer Reeder, Kapitäne,<br />
Künstler, Senatoren und Kaufleute ihre Sommerhäuser<br />
hier an der Lesum und an der Weser<br />
errichten ließen, gehörte dieser Landstrich -<br />
mit Ausnahme von Vegesack - bis 1939 zu<br />
Preußen und zuvor zum Königreich Hannover.<br />
Absichtlich habe ich die Kaufleute zuletzt<br />
angeführt, um darauf hinzuweisen, dass es in<br />
Bremen unüblich war, von einem Großkaufmann<br />
zu reden. Trotz eines verdienten Wohlstandes<br />
gab man sich bescheiden und so sprach<br />
man in Bremen zum Beispiel vom Weinkaufmann,<br />
Getreidekaufmann, Kaffee- oder Holzkaufmann.<br />
Die Hackfelds waren Überseekaufleute,<br />
und zwar die größten mit Firmensitz in<br />
Honolulu.<br />
Die auswärtige Konkurrenz bezeichnete die<br />
Bremer Kaufleute als „Pfeffersäcke" und zum<br />
anderen sagte man: „Die Bremer Kaufleute sind<br />
so steif wie ihr Grog".<br />
Zu Bremen-Nord wäre noch zu sagen, dass<br />
sich die zuvor erwähnten Kaufleute und dergleichen<br />
seit Beginn der zweiten Hälfte des vorletzten<br />
Jahrhunderts und auch überwiegend im<br />
zweiten Abschnitt ihres Lebens hier angesiedelt<br />
haben, so auch die Hackfelds. Es galt der<br />
Spruch: „Landluft macht frei".<br />
Biografien und Beschreibungen über<br />
Geschäftsentwicklungen sind auch immer<br />
Dokumente der Zeitgeschichte die - je länger<br />
die Zeit darüber vergeht - oft in Vergessenheit<br />
geraten. Das ist mir besonders bei meinen<br />
Recherchen über Baron Ludwig Knoop, dem<br />
Besitzer von Schloss Mühlenthal in St. Magnus,<br />
und dem Gutsbesitzer Johannes Pellens aufgefallen,<br />
der für seine Frau die Villa Marßel bauen<br />
ließ.<br />
Erfreulicherweise trägt das CVJM-Haus in der<br />
Bremer Birkenstraße in großen Lettern die<br />
Foto: R. Matzner<br />
Foto aus Privatbesitz<br />
Bezeichnung „Konsul-Hackfeld-Haus", ein Zeichen,<br />
dass dieser christlich orientierte Verein<br />
dem Konsul Hackfeld sich zu Dank verpflichtet<br />
fühlt. In ähnlich anerkennender Weise schrieb<br />
die Delmenhorster Zeitung 1992 unter der<br />
Überschrift: „Das Märchen von Heinrich Hackfeld"<br />
und „Es war einmal ein armer Junge"'.<br />
Dabei wurde berichtet, dass der Hackfeldsche<br />
Marienfonds wieder zur Verfügung steht. Diese<br />
beiden Hinweise mögen schon mal den großzügigen<br />
Charakter beleuchten, der mit dem<br />
Namen Hackfeld verbunden ist.<br />
Lebenslauf des Firmengründers<br />
Heinrich Hackfeld<br />
Es begann mit Heinrich Hackfeld, der am 24.<br />
August 1816 in Almsloh bei Ganderkesee als<br />
Sohn armer Eltern geboren wurde. Sein Vater<br />
war von Beruf Tagelöhner und verstarb am 7.<br />
Februar 1824, als Heinrich siebeneinhalb Jahre<br />
alt war. Die Mutter hatte danach drei Töchter<br />
und vier Söhne zu versorgen. Tätigkeiten als<br />
Hütejunge beim Bauern, mäßiger Schulbesuch<br />
und ärmliche Lebensverhältnisse bestimmten<br />
Heinrichs Kindheit. Nach der Konfirmation, also<br />
im Alter von etwa dreizehn oder vierzehn Jahren,<br />
verließ Heinrich Hackfeld seinen <strong>Heimat</strong>ort<br />
im Oldenburgischen in Richtung Amsterdam,<br />
um Seemann zu werden. Amsterdam war<br />
damals der Treffpunkt aller Fahrensleute aus<br />
der Gemeinde Ganderkesee und Umgebung.<br />
Zahlreiche junge Männer zog es dort hin, weil<br />
sie in ihrer <strong>Heimat</strong> keine Zukunft sahen. Nach<br />
mehreren Fahrten besuchte Heinrich mit finanzieller<br />
Unterstützung eines Freundes die Steuermannsschule<br />
in Bremen. Mit achtundzwanzig<br />
Jahren segelte er als Kapitän und Mitbesitzer<br />
des Schiffes „Expreß" zunächst nach Honolulu.<br />
Sein Schiff strandete 1845 bei der Insel Batan.<br />
4 RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
Mannschaft und Silberladung wurden geborgen;<br />
jedoch in der Zeit lernte Heinrich Hackfeld<br />
die Schauplätze seines späteren Erfolges kennen.<br />
So richtete er im Januar 1847 als dreißigjähriger<br />
Kapitän ein Schreiben an die heute<br />
noch existierende Reedereifirma W. A. Fritze in<br />
Bremen, in welchem er auf die große Bedeutung<br />
der Hawaii-Inseln für den Handel in der<br />
Südsee mit Amerika und China aufmerksam<br />
machte. Seine Absicht war es, Vertreter des<br />
bekannten Bremer Unternehmens zu werden.<br />
Es war sein Glück, dass die Geschäftsleitung der<br />
Firma Fritze auf sein Angebot nicht eingegangen<br />
war. Kurzentschlossen kaufte er die Brigg<br />
„Wilhelmine", fuhr von Hongkong nach Bremen<br />
und kaufte hier Ware ein für ein in Honolulu zu<br />
gründendes Geschäft. In Bremen heiratete er<br />
Das Elternhaus von Marie Gesine Hackfeld, geborene Pflüger, an der Schlachte - zweites Haus von<br />
links - Fassade heute an der Sparkasse am Bremer Marktplatz<br />
Foto aus Privatbesitz<br />
Heinrich Hackfeld<br />
noch die Tochter des Schiffsmaklers Georg-Friederich<br />
Pflüger Marie Gesine. Mit ihr und ihren<br />
beiden Brüdern trat er die Reise nach Honolulu<br />
an. Johann Carl Diederich Pflüger (1833-1883),<br />
sein Schwager, wurde aufgrund seines Fleißes<br />
als Geschäftspartner und Teilhaber aufgenommen.<br />
Das 1849 gegründete Geschäft befasste sich<br />
zunächst mit der Ausstattung von Walfangschiffen<br />
und deren Besatzung. Der Erwerb von<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
Foto aus Privatbesitz<br />
Marie Gesine Hackfeld, geb. Pflüger<br />
Foto aus Privatbesitz<br />
zwei Zuckerplantagen stabilisierte das Unternehmen<br />
und die Entwicklung des Holzimportes.<br />
Die Einführung von Ananaspflanzungen von<br />
Mexiko nach Hawaii brachte der Firma Hackfeld<br />
einen ungeahnten Aufschwung. Im Jahre 1850<br />
wurde ein Ladengeschäft für Kleiderstoffe -<br />
auch Seidenhaus Haie Kalika genannt - eingerichtet.<br />
Die Leitung übernahm Hackfelds Neffe<br />
Bernd-Carl Ehlers, dem bald 70 Angestellte<br />
unterstanden.<br />
Heinrich Hackfeld kehrte 1862 mit seiner<br />
Frau Marie Gesine nach Bremen zurück. Zuvor<br />
aber wurde noch eine Reedereigesellschaft<br />
gegründet, deren Register 1871 achtzehn<br />
Schiffe zählte. Hackfelds Reedereiflagge auf<br />
den Schiffen war das rote Hanseatenkreuz auf<br />
weißem Feld. Eine interessante Nachbildung<br />
dieser ehemaligen Verdienstmedaille für Bremer<br />
Freiheitskämpfer der Jahre 1810-1813 finden<br />
wir auf dem Pflaster des Bremer Marktplatzes.<br />
Heinrich Hackfeld war Konsul von Schweden<br />
und Russland. Sein Nachfolger Johann Friedrich<br />
Hackfeld bzw. die Direktoren der Hackfeld-<br />
Gruppe vertraten Jahrzehnte die verschiedensten<br />
Staaten, wie Österreich, Ungarn, Schweden,<br />
Norwegen, Belgien und das deutsche Kaiserreich.<br />
Am 20. Oktober 1887 starb Heinrich Hackfeld<br />
im Alter von 71 Jahren in Bremen, von wo<br />
er die Geschäfte seines Unternehmens noch<br />
betreut hatte. Der Firmengründer Heinrich<br />
Hackfeld wurde in Delmenhorst bestattet, später<br />
auf den 1897 fertiggestellten Friedhof an<br />
der Wildeshauser Straße umgebettet. Marie<br />
Gesine Hackfeld hat ihren Ehemann dreißig<br />
Jahre überlebt. Sie starb am 4. Februar1917 und<br />
wurde nach der Einäscherung im Elterngrab auf<br />
dem Riensberger Friedhof in Bremen beigesetzt.<br />
Zunächst wurde die Leitung des umfangreichen<br />
Unternehmens auf Hawaii von dem<br />
Schwager Johann Carl Diederich Pflüger wahrgenommen.<br />
Als hochqualifizierter Mitarbeiter<br />
in der Firmenspitze fungierte Paul Isenberg, ein<br />
aus Dransfeld stammender Landwirt, dem der<br />
Konzern seine starke Stellung in der Hawaiischen<br />
Zuckerwirtschaft verdankte. Bleibt noch<br />
anzumerken, dass freie Pflanzer mit großzügigen<br />
Krediten unterstützt wurden, allerdings mit<br />
der Auflage, ihre Erzeugnisse über das Hackfeldsche<br />
Unternehmen abzurechnen.<br />
Aus der Ehe des Firmengründers sind keine<br />
Kinder hervorgegangen, sodass Heinrich Hackfeld<br />
seinen Neffen Johann Friedrich Hackfeld<br />
im Jahre 1878 nach Hawaii schickte. Sein Vater,<br />
der am 10. Februar 1821 geborene Hermann<br />
Wilhelm Hackfeld, war der Bruder von Heinrich<br />
Fassade des ehemals Pflügerschen Hauses an<br />
der Sparkassenfiliale am Marktplatz<br />
Foto: R. Matzner<br />
Hackfeld. Er war Tagelöhner aber auch Schneidermeister.<br />
Aus der übernommenen Reihenfolge<br />
der Berufsbezeichnungen ist zu vermuten,<br />
dass er im Winter seinen Lebensunterhalt als<br />
Schneider bestritten hat. Wie erwähnt, befand<br />
sich das Ehepaar Marie Gesine und Heinrich seit<br />
5
Das Landgut Hackfeld. Im Dreikaiserjahr 1888 kaufte die Witwe des Konsuls Heinrich Hackfeld,<br />
Marie Gesine Hackfeld, ein Grundstück mit dem dazugehörenden Landhaus an der heutigen Lesmonastraße<br />
mit Blick auf die Lesum. Das i. J.1870 erbaute Gebäude wurde 1933 abgebrochen und<br />
ein Jahr später wurde für die Familie Drettmann eine ansehnliche Villa erbaut.<br />
Foto aus Privatbesitz<br />
1862 bereits in Bremen.<br />
Im Jahre 1892 kehrte Johann Carl Diederich<br />
Pflüger nach Bremen zurück, wo er 5O-jährig<br />
verstarb. Auf die Todesnachricht hin schlossen<br />
in Honolulu sämtliche Regierungs- und<br />
Geschäftsbüros; die Handelskammer trat zu<br />
einer Trauersitzung zusammen und die Flaggen<br />
wehten auf halbmast.<br />
Johann Friedrich Hackfeld,<br />
der Neffe und Nachfolger auf<br />
Hawaii (genannt John)<br />
Am 26. Dezember 1856 in Gruppenbühren<br />
nordwestlich von Delmenhorst geboren, hatte<br />
Johann Friedrich Hackfeld nach seiner Lehrzeit<br />
bei der Firma Papendiek in Bremen seine<br />
Militärzeit absolviert und war dann 2O-jährig in<br />
das Unternehmen seines Onkels in Honolulu<br />
eingetreten. Als Mitarbeiter der Konzernleitung<br />
hatte er sich außerordentlich bewährt, sodass<br />
er 1903 nach dem Tode von Paul Isenberg allein<br />
verantwortlich die Unternehmensführung auf<br />
Hawaii übernahm. Doch schon zuvor, 1888, heiratete<br />
er eine Nichte von Paul Isenberg, Julita<br />
Berkenbusch aus Pueblo in Mexiko. Aus dieser<br />
Ehe sind die Töchter Julia und Marie-Dorothee<br />
hervorgegangen. Aus den Überlieferungen ist<br />
zu entnehmen, dass es außergewöhnlich hübsche<br />
Damen gewesen waren.<br />
Wie schon Heinrich Hackfeld, so pflegten<br />
auch sein Schwager Johann Pflüger und Neffe<br />
Johann Friedrich Hackfeld enge persönliche<br />
Kontakte zu dem hawaiischen König Kamehameda.<br />
So war es nicht ungewöhnlich, dass der<br />
König mit seinem Gefolge schon morgens um<br />
5.00 Uhr im Hause Hackfeld erschien, um einzukaufen<br />
und sich beim Kaffeetrinken bedienen<br />
zu lassen. Johann Friedrich Hackfeld war<br />
zum Berater des Königs aufgestiegen und er<br />
galt insgeheim als ..König von Honolulu". Selbst<br />
Banknoten von Hawaii trugen den Namen<br />
Hackfeld.<br />
Auf dem Sterbebett liegend war es dem<br />
König Kamehameda ein wichtiges Anliegen,<br />
Heinrich Hackfelds Schwager Johann Pflüger zu<br />
versichern, dass die vom Hause Hackfeld geliehene<br />
Schuldsumme umgehend zurückgezahlt<br />
werden würde. Johann Pflüger war inzwischen<br />
zum Minister und bevollmächtigten Gesandter<br />
des Königshauses von Hawaii aufgestiegen.<br />
Bleibt noch zu erwähnen, dass die königliche<br />
hawaiische Armee vom Hause Hackfeld eingekleidet<br />
wurde, wobei die Uniformen in der<br />
Schneiderei Hering in Bremen - früher gegenüber<br />
der Wallmühle - angefertigt wurden.<br />
Fortan durfte sich die Uniformschneiderei<br />
Hering mit dem Titel „Königlich Hawaiische<br />
Hofschneiderei" schmücken. Übrigens, die<br />
hawaiische Armee wurde von einem deutschen<br />
Offizier ausgebildet. Ebenso wurde die Militär-<br />
Musikkapelle von der Firma Hackfeld unterstützt,<br />
denn auch die Musik spielte eine verbindende<br />
Rolle zwischen den beiden doch so<br />
unterschiedlichen Volksgruppen. So hat der<br />
Potsdamer Kapellmeister Heinrich Berger von<br />
1872 bis 1915 als Leiter der Royal Hawaiian<br />
Band sich als Komponist engagiert, sodass ihn<br />
die Königin Lili Uokalowi als ,.Vater der hawaiischen<br />
Musik" bezeichnete, denn von ihm<br />
stammt auch die Nationalhymne -Aloha He-.<br />
Bis 1914 war die Firma Hackfeld das größte<br />
Unternehmen im Südseeraum und noch heute<br />
leben etwa 25000 Menschen rein deutscher<br />
Abstammung auf Hawaii. Die Hackfeldsche<br />
Firma hat in diesen Jahrzehnten vor Ausbruch<br />
des l. Weltkrieges ihre größte Blüte erlebt.<br />
Johann Friedrich Hackfeld war nicht nur im<br />
geschäftlichen Leben, sondern auch in der<br />
öffentlichen Begegnung in Honolulu eine<br />
angesehene Persönlichkeit. Mit dem hawaiischen<br />
Ehrenbürgerrecht ausgezeichnet, leistete<br />
er durch seinen Einfluss für die Übernahme<br />
der Inseln durch die Vereinigten Staaten wertvollste<br />
Dienste. Im Sternbanner der USA nimmt<br />
Hawaii den 50sten Platz ein.<br />
Der Wert der von Johann Friedrich Hackfeld<br />
geführten Firma wurde auf rund 18 Millionen<br />
Dollar geschätzt.<br />
Als Korrespondenzreederei der Firma Hackfeld<br />
in Honolulu verschiffte die Firma Pflüger in<br />
Bremen europäische, vorwiegend deutsche<br />
Waren nach Hawaii. Die eigene Schiffstonnage<br />
reichte nicht mehr aus, sodass fremde Segler<br />
und Dampfer gechartert werden mussten. Von<br />
der Stecknadel bis zur Lokomotive, Stoffe,<br />
Bekleidung, Bier, Seife, Zement usw. gab es ja<br />
kaum etwas, was nicht in den Schiffen der Firmen<br />
Hackfeld und Pflüger verfrachtet worden<br />
wäre. Darüber hinaus besaß man eigene Sägewerke<br />
und Maschinen zur Bearbeitung von<br />
Rohkaffee.<br />
Der Nordbremer Schriftsteller Ulf Fiedler<br />
schreibt in seinem Buch:<br />
„Die Firma Hackfeld und Co. gründete Niederlassungen<br />
in Kamschatka und Alaska, in der<br />
Südsee und an vielen Plätzen der Welt. Der<br />
Blumenthaler Kapitän Dallmann, selbst Ehrenbürger<br />
von Hawaii, landete im Auftrag Hackfelds<br />
als erster auf der Wrangelinsel an der sibirischen<br />
Eismeerküste. Hackfeld selbst war Konsul<br />
von Honolulu und hisste an Feiertagen in<br />
Lesum die Flagge von Honolulu.“ Soweit Ulf<br />
Fiedler.<br />
Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass neben<br />
der persönlichen Tüchtigkeit dieses Mannes<br />
und die verwandtschaftlichen Verbindungen in<br />
der Konzernspitze zahlreiche Menschen aus<br />
Bremen und anderen deutschen Landen zum<br />
Aufstieg und Erfolg des Hackfeldschen Unternehmens<br />
beigetragen haben. Sowohl deutsche<br />
Kaufleute, Handwerker und Landwirte haben<br />
ihren beruflichen Weg hier gemacht. Pfarrer<br />
und Lehrer aus Deutschland wurden gerufen,<br />
um in dem von Hackfeld und Isenberg gestifteten<br />
Gotteshauses zu predigen und in der Schule<br />
zu lernen.<br />
Johann Friedrich Hackfeld wurde auf Hawaiisch<br />
„Hakapila“ und Johann Diederich Pflüger<br />
wurde „Feluga“ genannt. Die Übersetzung von<br />
Paul Isenberg ist mir nicht bekannt.<br />
Und nun zur<br />
entscheidenden Enteignung<br />
Nach dem 1917 erfolgten Kriegseintritt der<br />
Vereinigten Staaten von Amerika fand die<br />
gesamte Geschäftsentwicklung ein jähes Ende.<br />
Durch Beschlagnahme der in deutschen Händen<br />
befindlichen Firmenanteile wurde der Verkauf<br />
an ein amerikanisches Wettbewerbsuntenehmen<br />
ermöglicht und gegen Ende des Krieges<br />
durchgesetzt. Johann Friedrich Hackfeld<br />
hat den Wandel nur aus der Ferne miterlebt,<br />
denn er befand sich bei Kriegsausbruch in<br />
Deutschland. Seine Frau Julita hielt sich mit den<br />
beiden Töchtern bereits seit dem Jahre 1900<br />
aus klimatischen und gesundheitlichen Gründen<br />
in Bremen auf. Wäre Johann Friedrich<br />
Hackfeld beim Umbruch in Honolulu gewesen,<br />
hätte er an dem Ergebnis gewiss nichts ändern<br />
können. Danach hat er Hawaii nie wieder betreten.<br />
Der Prozess um die Eigentumserklärung hat<br />
bis zum Beginn des 2. Weltkrieges gedauert,<br />
verlief für die früheren Eigentümer jedoch<br />
6 RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
erfolglos. Der geringste Betrag an die späteren<br />
Erben soll immerhin noch 150.000 DM betragen<br />
haben. Johann Friedrich Hackfeld lebte als Privatmann<br />
in Bremen.<br />
Am 27. August 1932 verstarb er in Glotterbad<br />
im Schwarzwald während einer Kur im Alter<br />
von 75 Jahren. Er wurde im Familiengrab auf<br />
dem Riensberger Friedhof beigesetzt.<br />
In den überlieferten Schriftstücken wird er<br />
als ein ruhiger und sachlicher Mann beschrieben,<br />
dessen Charakter mit den Worten „vornehm<br />
und ausgeglichen" beschrieben wird. Er<br />
war sich seiner besonderen Stellung bewusst<br />
und so heißt es „ohne dass er die eine Hand wissen<br />
ließ, was die andere tat".<br />
Sein Familienleben wird als vorbildlich beurteilt,<br />
persönlich still, bescheiden und<br />
anspruchslos. Nicht als Eigentümer, sondern als<br />
Verwalter seines Vermögens fühlte er sich, so ist<br />
zu lesen in seiner Biografie.<br />
Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass er<br />
seinen Reichtum teilte, sowohl die kirchlichen,<br />
aber auch die bürgerlichen Einrichtungen<br />
haben davon profitiert.<br />
Johann Friedrich Hackfeld besaß kein Auto,<br />
auch keine Kutsche, wie es früher üblich war.<br />
Ein Glas Rotwein und eine Zigarre genoss er nur<br />
bei besonderen Anlässen. Er war ein Freund<br />
guter Musik und er schätzte besonders Männerchöre.<br />
Dr. Prüser schreibt über Johann Friedrich<br />
Hackfeld: „So steht ein Bild vor uns, das eines<br />
untadeligen Menschen und eines wahren Christen<br />
von echter Nächstenliebe"<br />
Nun hatte ich berichtet, dass sich Johann<br />
Friedrich Hackfeld bei Ausbruch des 1. Weltkrieges<br />
bereits in Deutschland befand. Hier in<br />
Bremen lebte die Familie in ihrem Haus in der<br />
Parkallee, in Sommermonaten jedoch - von Mai<br />
bis September - wohnte man in dem Sommerhaus<br />
in St. Magnus. Dieses große, massive Haus<br />
hinter der heutigen Kirche in St. Magnus, hatte<br />
der Neffe des Unternehmensgründers um 1900<br />
erbauen lassen. Nach einem Gespräch mit<br />
Pastor Berger erfuhr ich, dass das bis zur Bahnlinie<br />
reichende Grundstück eine Fläche von 42<br />
Morgen einnahm und dort, wo sich jetzt die<br />
Sommerhaus der Familie Johann Hackfeld hinter<br />
der ev. Kirche in Bremen-St. Magnus. Das<br />
Haus dient heute als Begegnungsstätte für<br />
Senioren und die obere Etage wird als Jugendtreff<br />
genutzt. Foto aus Privatbesitz<br />
Sparkassenfiliale befindet, standen große<br />
Gewächshäuser. Vor seinem Sommersitz in St.<br />
Magnus hatte Konsul Hackfeld einen Fahnenmast<br />
setzen lassen, der von Hawaii stammte und<br />
so lang war, dass er hinter dem Schiff hergezogen<br />
werden musste. An den Festtagen wurde<br />
dann die Flagge von Hawaii gehisst.<br />
Ein Blitzschlag hat dem Fahnenmast ein<br />
jähes Ende bereitet. Dieser Sommersitz hatte<br />
damals die Bezeichnung „Tannenhof“ in<br />
Neuschönebeck.<br />
Heinrich Hackfeld, nun wieder zurück zum<br />
Gründer des Unternehmens, hat trotz seiner<br />
Erfolge und seines märchenhaften Reichtums<br />
nie seine <strong>Heimat</strong> und seine ärmliche Kindheit<br />
vergessen. So wurde seinem Wunsche entsprechend<br />
von seinem Vermögen - ein Jahr nach seinem<br />
Tode - 1888 in Ganderkesee der „Hackfeldsche<br />
Marienfonds" gegründet. Bis heute waren<br />
aus den Zinserträgen Stipendien für besonders<br />
begabte Jugendliche evangelisch-lutherischer<br />
Konfession gewährt, um ihnen eine über den<br />
Hauptschulabschluss hinausgehende Ausbildung<br />
zu bieten. Die Witwe des verstorbenen<br />
Heinrich Hackfeld und der Neffe haben das<br />
Stiftungskapital von 75.000 Mark dem Kuratorium<br />
unter der Oberaufsicht der ,,Großherzoglichen<br />
Commission für Verwaltung" übergeben.<br />
Allerdings stellte das Kuratorium in einer Sitzung<br />
am 16. Januar 1956 fest, dass nicht mehr<br />
viel zu verwalten war. An dieser Sitzung nahmen<br />
der Ganderkeseer Bürgermeister, der evangelische<br />
Ortspfarrer und der Rektor der Volksschule<br />
teil. Der stolze Betrag von 75.000 Mark<br />
war auf 3.200 DM zusammengeschmolzen.<br />
Inzwischen ist der „Hackfeldsche Marienfonds"<br />
wieder aufgefüllt worden auf etwa 35.000 Euro,<br />
obwohl der Ganderkeseer Gemeinderat 1956<br />
vor der Frage stand, die Stiftung aufzulösen.<br />
Interessant noch zu erwähnen, dass der Stiftungszweck<br />
sich insbesondere an Knaben richtete,<br />
um ihnen eine weiterführende Ausbildung<br />
als Lehrer, Pfarrer, Arzt, Tierarzt oder ähnliches<br />
zu ermöglichen.<br />
In Erinnerung an die Leistungen und Verdienste<br />
der Familie Hackfeld sowie an Paul Isenberg<br />
und an Johann Carl Diederich Pflüger hat die<br />
Die heutige Ansicht des ehemaligen Sommerhauses<br />
der Familie Johann Friedrich Hackfeld in<br />
Bremen-St.Magnus<br />
Foto aus Privatbesitz<br />
Stadt Bremen mit den folgenden Straßenbenennungen<br />
den hier beschriebenen Persönlichkeiten<br />
ein bleibendes Denkmal gesetzt. In St.<br />
Magnus ,,An Hackfelds Park" (Lt. Senatsbeschluss<br />
vom 26.11.1979) und in Schwachhausen<br />
„Hackfeldstraße", „Isenbergweg" und „Pflügerweg".<br />
An der Contrescarpe 101 eröffnete der Bremer<br />
CVJM im Jahre 1928 sein eigenes Vereinshaus.<br />
Dieses villenartige Gebäude wurde allerdings<br />
im 2. Weltkrieg zerstört. Schon die<br />
Namensgebung des 1955 errichteten Konsul -<br />
Hackfeldhauses in der Birkenstraße macht<br />
deutlich, dass sich der Bremer Jugendverein der<br />
Familie Hackfeld noch nach langen Jahren verpflichtet<br />
fühlt.<br />
Johann Friedrich Hackfeld hat dem Bremer<br />
CVJM für den Kauf des ersten Vereinshauses die<br />
beachtliche Summe von 30.000 Mark zur Verfügung<br />
gestellt. Später sind dem Bremer CVJM<br />
weitere 25.000 Mark zugeflossen. Gewiss hatte<br />
auch Marie Gesine Hackfeld ihre wohltätige<br />
Hand dabei und dieses jugendfördernde Projekt<br />
zustimmend begleitet.<br />
Das „Haus an der Weser" der Bremer Heimstiftung<br />
ist der Nachfolgebau des im Jahre 1890<br />
von Johann Friedrich Hackfeld auf den Rönnebecker<br />
Weserklippen. Zuvor gehörte das Anwesen<br />
einem Zöllner. Während der Sommermonate<br />
wurden in dem erheblich vergrößerten<br />
Haus Bremer Kinder im Wechsel von 6 bis 8<br />
Wochen zur Erholung hier aufgenommen.<br />
Bezugnehmend auf die Inselgruppe im Pazifik,<br />
zu der auch Hawaii gehörte, und auf der das<br />
Hackfeld-Unternehmen große Plantagen<br />
besaß, übertrug der Mäzen Hackfeld den<br />
Namen der Sandwichinseln auf dieses Haus als<br />
„Sandwichheim". Übrigens: J.F. Hackfeld war<br />
daran interessiert, die Sandwichinseln als deutsches<br />
Kolonialgebiet zu gewinnen, doch die<br />
Amerikaner waren dagegen und Bismarck ließ<br />
das entsprechende Schreiben unbeachtet in<br />
seinem Schreibtisch liegen. So wurde nichts<br />
daraus.<br />
Marie Gesine Hackfeld<br />
hat durch großzügige<br />
Schenkungen in Bremen<br />
Spuren hinterlassen<br />
Gehen wir nochmal zurück zu Heinrich<br />
Hackfeld, dem 1887 verstorbenen Gründer des<br />
Unternehmens und seiner dreißig Jahre später<br />
verstorbenen Ehefrau Marie Gesine. In den Jahren<br />
1888 bis 1909 wurde der Bremer Dom<br />
umfangreich restauriert. In dieser Zeit wurden<br />
auch die beiden großen metallenen Domtüren<br />
an der Westfront angefertigt und mit biblischen<br />
Szenen des Alten und Neuen Testaments versehen.<br />
In Erinnerung an ihren verstorbenen Mann<br />
hat Marie Gesine Hackfeld die Finanzierung der<br />
Türen übernommen, wobei der Bronzeguss der<br />
linken Seite der rechten Tür das Bildnis einer<br />
knienden Frau vor dem segnenden Christus<br />
zeigt. Im oberen Feld sieht man einen Landmann<br />
mit einem Pflug. Beide Motive zeugen<br />
von einer Verbindung zu der Familie Hackfeld.<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
7
Auf dem Lesumer Friedhof an der Bördestraße<br />
befindet sich links vom Ehrenmal ein<br />
schlichtes kurzes Holzkreuz zur Erinnerung an<br />
die im 1. Weltkrieg vermissten Soldaten.<br />
Und im Turmzimmer der evangelischen St.<br />
Martini Kirche zu Lesum hängt ein großes Christusbild,<br />
das vor etlichen Jahren als Altarbild im<br />
großen Kirchenraum seinen ursprünglich vorgesehenen<br />
Platz hatte. Es ist die Arbeit der<br />
Burgdammer Malerin Elisabeth Rapp, die auch<br />
ihrer vielen Katzen wegen als Katzenmutter<br />
bekannt war. Sie wurde unterstützt von Marie<br />
Gesine Hackfeld, die das Bild in Auftrag gegeben<br />
hatte. Das zuvor beschriebene Vermisstenkreuz<br />
auf dem Lesumer Friedhof geht ebenfalls<br />
auf die Initiative der Frau Hackfeld zurück.<br />
Die Witwe Marie Gesine Hackfeld erwarb<br />
1888 einen Sommersitz in Lesum am heutigen<br />
„Admiral-Brommy-Weg". Die 1870 erbaute Villa<br />
war ihres Aussehens wegen im Volksmund als<br />
„Kaffeemühle" bekannt. Die Familie Drettmann<br />
als späterer Besitzer hat das Haus 1933<br />
abreißen und durch einen Neubau ersetzen lassen,<br />
der danach von der Familie des Barons<br />
Uslar von Gleichen als Wohnsitz diente.<br />
Nun sind an vorheriger Stelle die von Marie<br />
Gesine Hackfeld gestifteten Domtüren erwähnt<br />
worden. Dabei bietet es sich an, die schöne<br />
Rokokofassade des so genannten Pflügerschen<br />
Hauses am Bremer Marktplatz in die Betrachtung<br />
mit einzubeziehen. Heute hat die Sparkasse<br />
wohl ihre schönste Filiale dort eingerichtet.<br />
Der Schwiegervater von Heinrich Hackfeld<br />
kaufte im Jahre 1836 das für den Ratsherrn und<br />
Weinhändler Georg Hoffschläger 1755 erbaute<br />
Haus, welches sich an der Schlachte befand und<br />
die Hausnummer 31 B trug. Anfang der 20er-<br />
Jahre des letzten Jahrhunderts wurde das<br />
Gebäude unter Verwendung der Rokokofassade<br />
von dem Architekten Albert Dunkel neu gestaltet.<br />
Das Haus brannte 1944 nach einem Luftangriff<br />
aus, doch die schöne Fassade wurde geborgen<br />
und 1958 für den Neubau der Sparkassenfiliale<br />
Ecke Langenstraße-Marktplatz wieder<br />
verwendet. Friedrich Pflüger war nicht nur<br />
Schiffsmakler, sondern er soll auch eine Gaststätte<br />
in dem Gebäude betrieben haben und<br />
auf der Weser hatte er ein kleines Fährboot liegen.<br />
Nach meinem Hackfeld-Vortrag beim Seniorenkreis<br />
der evangelischen Kirchengemeinde<br />
in St. Magnus in dem ehemaligen Hackfeldschen<br />
Sommerhaus bekam ich von August<br />
Rohlfs eine Bassumer Jubiläumsschrift. Darin<br />
wurde berichtet, dass der Bruder der Marie<br />
Gesine Hackfeld - Georg Pflüger - 20 Jahre von<br />
der Bassumerin Fräulein Schlu in ihrem Hause<br />
aufopferungsvoll gepflegt worden ist. Er verstarb<br />
am 8. März 1900 siebzigjährig. Die Bremer<br />
Konsulswitwe und Schwester des Verstorbenen<br />
wollte sich im Nachhinein erkenntlich zeigen,<br />
doch die Pflegerin Agnes Schlu hatte nur einen,<br />
aber großen Wunsch, Geld für ein in Bassum zu<br />
errichtendes Krankenhaus. Marie Gesine wollte<br />
30.000 Goldmark zur Verfügung stellen, aber<br />
nur unter der Bedingung, dass das Krankenhaus<br />
bis zum 1. Mai 1903 in Betrieb genommen werden<br />
würde und zweitens, dass es groß genug<br />
wäre für ein Einzugsgebiet von 1.000 Menschen.<br />
In einer Bremer Zeitung war am 15. Dezember<br />
2003 zu lesen: „Das Bassumer Krankenhaus<br />
ist heute hundert Jahre alt. Am Wochenende<br />
wurde das Jubiläum im kleinen Kreis gefeiert.<br />
Die Stadt Bassum benannte eine Straße nach<br />
Marie Hackfeld, die mit 30.000 Goldmark<br />
damals den finanziellen Grundstock für dieses<br />
Haus gelegt hatte. Bürgermeister Wilhelm Baker<br />
enthüllte das Namensschild der spendablen<br />
Bürgerin." Während einer Halbtagesfeier des<br />
Lesumer <strong>Heimat</strong>vereins am 26. Mai 2003 zur<br />
Besichtigung des Damenstifts in Bassum führte<br />
mich anschließend mein Weg zum nahe gelegenen<br />
Krankenhaus. Das 1903 erbaute Haus musste<br />
im Jahre 1983 einem Neubau weichen. Von<br />
dem ehemals mit 20 Betten ausgestatteten<br />
Krankenhaus konnten mir von dem Verwaltungsleiter<br />
Herrn Feldmann lediglich zwei<br />
Ansichtskarten ausgehändigt werden. Die dienen<br />
nun als Bereicherung meiner Dia-Serie und<br />
die kopierten schriftlichen Unterlagen runden<br />
das Bild über die Familie Hackfeld ab.<br />
Bleibt noch zu erwähnen, dass das Delmenhorster<br />
Kreisblatt im Mai 1998 berichtet hat,<br />
dass sich im Bremer Bürgerpark eine Marie<br />
Hackfeld-Brücke befindet. So schön es auch<br />
wäre, doch diese Meldung stimmt nicht!<br />
Die Enkeltöchter der Eheleute Johann Friedrich<br />
und Julita Hackfeld, Gisela Grabenhorst<br />
aus Schwachhausen und Ruth Nagel aus Schönebeck,<br />
waren vor Jahren Gäste in meinem<br />
Freundeskreis beim Bremer CVJM. Ihnen danke<br />
ich für einen Teil der Informationen, ebenso<br />
dem Ehepaar Gisela und Heinz Hackfeld aus<br />
Bremen-Aumund. Gisela Grabenhorst sagte:<br />
„Unser Großvater hat darauf hingewiesen, dass<br />
der Wohlstand nicht selbstverständlich sei, und<br />
sie könne sich nicht daran erinnern, dass er viel<br />
Autorität besaß."<br />
Der Bremer Professor Leuthold sagte abschließend<br />
in einem Zeitungsbericht, dass sich Bremens<br />
historischer Ruf und Unternehmenskultur<br />
auf Persönlichkeiten wie Hackfeld und Pflüger<br />
stützen und heute gebe es auf Hawaii noch<br />
Spuren des ehemaligen Weltunternehmens<br />
Hackfeld.<br />
Abschließend äußere ich meine Hoffnung,<br />
dass das Bremer CVJM-Gebäude aus gutem<br />
Grund noch lange die Bezeichnung „Konsul -<br />
Hackfeld-Haus" tragen möge. Mein Dank gilt<br />
Gisela Grabenhorst, Ruth Nagel, Pastor Berger<br />
und August Rohlfs für die nützlichen Informationen.<br />
Rudolf Matzner<br />
Das ehemalige Isenbergheim in der Bremer Kornstraße<br />
8<br />
Foto: R. Matzner<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
Paul Isenberg, 15. April 1837-16. Januar 1903<br />
Foto: R. Matzner<br />
Nachtrag: Der Zuckerfabrikant<br />
Paul Isenberg<br />
Wenngleich Paul Isenberg nicht unmittelbar<br />
zur Hackfeldfamilie zuzurechnen ist — wie etwa<br />
Carl Diederich Pflüger - so hat er doch in der<br />
Hackfeldschen Konzernspitze eine führende<br />
Position eingenommen. Heinrich Hackfeld<br />
hatte das große Glück, in seiner Personalpolitik<br />
verantwortungsbewusste und fleißige Fachleute<br />
um sich zu scharen, die den Erfolg des<br />
Unternehmens maßgeblich beeinflusst haben.<br />
Nun ist Paul Isenberg in diesem Aufsatz zwar<br />
erwähnt worden, doch die späteren Stiftungen<br />
dieses Mannes und seiner Frau Beta, geborene<br />
Glade, sind der Anlass, den Weg und die Verdienste<br />
der Isenbergs etwas ausführlicher in<br />
diesem Nachtrag zu beschreiben:<br />
Das große Bremer Lexikon von Professor Dr.<br />
Herbert Schwarzwälder gibt zu diesem Thema<br />
folgende Auskunft:<br />
„Isenberg, Paul: Zuckerfabrikant, geboren am<br />
15. April 1837 in Dransfeld, gestorben am 16.<br />
Januar 1903 in Bremen.<br />
Isenberg, Beta: geboren am 12. Mai 1846 in<br />
Bremen, gestorben am 10. März 1933 in Bremen.<br />
Paul Isenbergs Vater war Pastor zu Dransfeld,<br />
später Superintendent in Wunstorf; der Sohn<br />
besuchte das Realgymnasium in Braunschweig<br />
und ging 1858 zur Ausbildung als Landwirt<br />
nach Hawaii, wo er zunächst Verwalter auf einer<br />
Vieh-Ranch, dann auf einer Zuckerplantage<br />
wurde. 1861 heiratete er die Tochter des<br />
Eigentümers der Plantage und übernahm nach<br />
einigen Jahren deren Verwaltung. 1867 starb die<br />
Frau von Paul Isenberg. In dieser Zeit knüpfte er<br />
Beziehungen zu Heinrich Hackfeld an, der auch<br />
im Zuckergeschäfl tätig war. 1869 schloss Paul<br />
Isenberg eine zweite Ehe mit Beta Glade, Tochter<br />
eines Bremer Kramers. 1878 zog das Paar<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
Beta Isenberg, 12. Mai 1846-10. März 1933<br />
Foto: R. Matzner<br />
nach Braunschweig, 1879 nach Bremen und<br />
bezog das Haus Contrescarpe Nr. 3, das 1912<br />
dem Bau des Schauspielhauses weichen musste.<br />
1881 wurde Paul Isenberg Teilhaber, 1889 Leiter<br />
der Zuckerfabrik Heinrich Hackfeld & Co. Nach<br />
dem Tode von Paul Isenberg (1903) blieb die<br />
Firma in der Hand der Familie. Die Witwe, Beta<br />
Isenberg, zog 1912 in das große Haus Contrescarpe<br />
Nr. 19. Sie setzte die Großherzigkeit ihres<br />
Mannes fort. Er hatte vor allem dem Ellener Hof,<br />
einer Erziehungsanstalt für Knaben, mehrfach<br />
Spenden überwiesen. In seinem Todesjahr gingen<br />
100.000 Mark an die Paul-Isenberg-Stiftung,<br />
deren Zinsen dem Ellener Hof zur Verfügung<br />
standen. Beta Isenberg war zudem Vorsitzende<br />
des „Vereins für eine Zufluchtstätte für<br />
Frauen und Mädchen". Nach zwei Provisorien<br />
wurde 1914/15 nach den Plänen der Architekten<br />
Abbehusen und Blendermann ein Haus an<br />
der Kornstraße 209-211 gebaut, für das Beta<br />
Isenberg 100.000 Mark stiftete. In ihm wurde<br />
ein Kinderheim eingerichtet, das den Namen<br />
„Isenberg-Heim" erhielt.<br />
Im 1. Weltkrieg ging das Isenberg-Vermögen<br />
auf Hawaii verloren, nach dem Kriege schmolz<br />
das Geldvermögen durch die Inflation zusammen.<br />
Die Isenberg-Stiftung (Ellener Hof) wurde<br />
1966 aufgelöst. Das Haus an der Contrescarpe<br />
Nr. 19 dient heute dem Institut Francais.<br />
Das Isenbergheim an der Kornstraße wurde<br />
1915 fertiggestellt und nahm nach Kriegsbeginn<br />
Kriegswaisen auf, auch wurden<br />
Angehörige von Gefallenen betreut. Seit 1933<br />
nur Kinderheim. Im 2. Weltkrieg war das Haus<br />
überfüllt mit Töchtern von Soldaten und<br />
Rüstungsarbeiterinnen. Oft mussten Hausbewohner<br />
in Dörfer der Bremer Umgebung<br />
umquartiert werden. Nach 1945 nur Mädchenheim.<br />
1950 wurde das Gartenhaus für 22 weibliche<br />
Lehrlinge ausgebaut. Das Heim ging 1960<br />
an die Innere Mission, wurde 1978 als<br />
Mädchenheim aufgegeben und in einen<br />
„beschützenden Wohnraum für ältere Männer<br />
mit besonderen sozialen Problemen" umgewandelt.<br />
Aus ärmlichen Verhältnissen aufgestiegen,<br />
wurde Paul Isenberg auf Hawaii als „Zuckerkönig"<br />
angesehen. Der Bau einer großen Raffinerie<br />
- so hoffte er - würde ihn zum „Kaiser" der<br />
Hawaiischen Zuckerindustrie machen. Der Lauf<br />
des Schicksals nahm jedoch seine Wendung.<br />
1881 entwindet Johann Carl Pflüger mit<br />
Unterstützung von Paul Isenberg dem Zuckerkönig<br />
Claus Spreckels die Herrschaft über die<br />
hawaiischen Zuckerrohrpflanzer, die sich nun<br />
dem Hackfeld-Unternehmen anschließen.<br />
Und damit enden meine Aufzeichnungen<br />
über den märchenhaften Aufstieg der Familien;<br />
man könnte auch sagen, Geschichten, die das<br />
Leben schrieb. - Dabei habe ich auch berichtet<br />
von einer Inselgruppe in der Südsee, die etwa<br />
16.000 km und rund dreißig Flugstunden von<br />
Bremen entfernt ist, und dennoch gab es durch<br />
Bremer Kaufleute enge Verbindungen zu unserer<br />
alten Hansestadt Bremen.<br />
Es ist wahrlich:<br />
eine Insel aus Träumen geborgen!<br />
Rudolf Matzner<br />
Weitere benutzte Quellen:<br />
Aufzeichnungen von Prof. Dr. Alexander Pflüger,<br />
Bonn 1932<br />
Aufsatz von Dr. Prüser, Bremen<br />
Buch „Bremische Landgüter" Dr. Stein, Bremen<br />
Sonderdruckbuch „Bremische Biografie 1912-<br />
1962"<br />
Archiv des Bremer CVJM<br />
Lesumer <strong>Heimat</strong>buch, G. Schmolze<br />
Eigenes Zeitungsarchiv<br />
Hauszeitung der Bremer Heimstiftung<br />
‘n beten<br />
wat op Platt<br />
Redensarten unserer<br />
engeren <strong>Heimat</strong><br />
Wenn de Bottern all is, hett dat Smären `n<br />
Enne.<br />
Achtern Barg ward ok Botterkoken backt.<br />
De ruugsten Fohlen weerd de besten Peer.<br />
Gegen `n Foor Mest kann`n nich anstinken.<br />
Wenn de Göös` Water seht, denn wüllt se<br />
supen.<br />
Keen dat Letzte ut`n Kroog nimmt, den<br />
fallt de Deckel op`r Näs.<br />
De Fulen drägt sick doot, de Fliedigen loopt<br />
sick doot.<br />
(Aus „Plattdüütsche Lüde – gistern un<br />
hüde“, 1962)<br />
Peter Richter<br />
9
Erinnerung an die ehemaligen Burglesumer<br />
"Mühlenbach Lichtspiele"<br />
Schaut man heute ins aktuelle Bremer Branchen-Telefonbuch,<br />
dann findet man Eintragungen<br />
von nur noch sieben Kinos. Das ist eine<br />
unvorstellbar geringe Anzahl im Vergleich zu<br />
den Lichtspielhäusern in der Zeit der 60er- und<br />
7Oer-Jahre des letzten Jahrhunderts. Man<br />
konnte früher davon ausgehen, dass jeder<br />
Stadtteil zumindest über ein Kino-Theater verfügte.<br />
Das Fernsehen hat als Heimkino zahlreiche<br />
Kinos verdrängt und die wenigen noch<br />
erhaltenen, und insbesondere die neu hinzugekommenen<br />
Spielstätten, sind an Ausstattung<br />
und Technik enorm verbessert und modernisiert<br />
worden. Dazu passend sind dann auch die<br />
zunächst ungewohnten Namen zu lesen, wie<br />
Cinemaxx, CineStar, Kristal-Palast, wobei die<br />
Schauburg noch an alte Zeiten erinnert.<br />
Das bekannteste Vergnügungslokal dieser Art<br />
in Burglesum befand sich an der Kreuzung Hindenburgstraße/Bremer<br />
Heerstraße, dort wo später<br />
das Jugendheim entstand. Lange Jahre als<br />
"Mühlenbach Lichtspiele" bekannt und hier<br />
gegenüber steht auch heute noch das Gasthaus<br />
"Stadt London". Nach mehrmaligem Pächterwechsel<br />
ist nun ein asiatisches Speiselokal dort<br />
eingezogen.<br />
Eigenartigerweise wurde in einem Zeitungsbericht<br />
von 1979 auch dieses Kino als "Stadt<br />
London" bezeichnet. Es ist wirklich unverständlich,<br />
wie der Schreiber vor 35 Jahren auf diese<br />
irrtümliche Bezeichnung hereingefallen ist. Der<br />
Name "Mühlenbach Lichtspiele" ist zurückzuführen<br />
auf die ehemals hier gestandene Blendermannsche<br />
Mühle. Im Volksmund wurde sie<br />
auch die Untermühle genannt.<br />
In meinem Aufsatz vom September 2O14<br />
über "Hillmanns Hotel und die familiäre Verbindung<br />
nach Burgdamm" hatte ich aus der Familienchronik<br />
berichtet, dass der Bruder des Bremer<br />
Hoteliers Johann Heinrich Hillmann, der i.J.<br />
1796 geborene Johann Carl Hillmann, 1831<br />
nach Lesum gezogen ist. In der Sterbeurkunde<br />
wurde er als Halbhöfner und Posthalter<br />
bezeichnet. Es ist nicht überliefert, ob Johann<br />
Carl Hillmann auch der Bauherr war und es ist<br />
auch nicht bekannt, wann dieses günstig gelegene<br />
Haus erbaut worden ist. Zumindest weiß<br />
man, dass in diesem Haus von 1862 bis 1911 sich<br />
die Königlich Hannoversche Posthalterei<br />
befand, die von Johann Carl Hillmann verwaltet<br />
wurde.<br />
Interessanterweise war am Ostgiebel des<br />
Gebäudes ein steinerner Reichsadler zu sehen,<br />
der beim Abbruch des Hauses 1979 in drei Teile<br />
zerbrach. Die Vegesacker Post war sehr darauf<br />
bedacht, das vermeintliche Postwappen zu bergen<br />
und im Keller des Verwaltungsgebäudes zu<br />
lagern. Nachforschungen haben ergeben, dass<br />
es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den<br />
Reichsadler des neuen deutschen Reiches handelt.<br />
Wie auch immer; die Post betrachtete das<br />
Wappen als ihr Eigentum und so sehen wir die<br />
steinerne Erinnerung an die ehemalige Burgdammer<br />
Post heute unter einer Glaswand links<br />
vom Eingang zum Postgebäude an der Schafgegend.<br />
Sollte es als historisches Andenken<br />
gedacht sein, dann wirkt das über ein Meter<br />
hohe Wappen doch recht verloren an dieser<br />
kaum beachteten Wand.<br />
Doch zurück zu den früheren "Mühlenbach<br />
Lichtspielen" In den unteren Räumen des Hauses<br />
befand sich eine Gaststätte mit Namen<br />
"Zum Tunnel". Eigentlich waren es ausgebaute<br />
Kellerräume, die wegen ihrer Gemütlichkeit<br />
nicht nur von den Einheimischen sehr geschätzt<br />
wurden. Es ist berichtet worden, dass sich im<br />
Haus auch ein Saal für Tanzvergnügen und Ausstellungen<br />
anbot und selbst der Radfahrverein<br />
zeigte hier seine akrobatischen Kunststücke.<br />
Darüber hinaus gab es an der seitlichen Außenfront<br />
des Hauses einen schönen Freiluftbereich,<br />
der als "Thielbars Sommergarten" bekannt war.<br />
Es war nicht zu ermitteln, wann die<br />
"Mühlenbach Lichtspiele" ihren Betrieb aufnahm,<br />
wohl aber, dass es ein gut florierendes<br />
Unternehmen gewesen sein muss. Der Inhaber<br />
Gauert habe als Filmbegleiter die Besucher mit<br />
Ansichtskarte von 1909. Rechts das Schild Postamt.<br />
Foto: Archiv R. Matzner<br />
10 RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
seiner Geige unterhalten. Kurz nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg waren in diesem Kino die schönsten<br />
Filme mit Marika Rökk zu sehen. Eine<br />
besondere Anziehungskraft hatte der Film<br />
"Moulin Rouge" Es ist doch erstaunlich wenn<br />
man erfährt, dass die verschiedenen Veranstaltungen<br />
mit der jeweilig passenden Dekoration<br />
schon im Vorraum eingeleitet wurden. So wurden<br />
z.B. bei der Aufführung des Filmes "Grün<br />
ist die Heide", die Zuschauer schon im Theatervorraum<br />
zur Einstimmung mit Birkengrün und<br />
Heidekraut als Wandschmuck begrüßt.<br />
Die Kinoveranstaltungen hatten dann im<br />
Laufe der Zeit an Attraktivität verloren.<br />
Zunächst versuchte man durch Kinderfilme den<br />
Betrieb aufrechtzuerhalten und als letzte<br />
Anstrengung wurde den männlichen Besuchern<br />
die ersten gewagten Pornofilme angeboten.<br />
Heute würden wir darüber laut lachen, doch<br />
Sitte und Anstand wurden beachtet und jeder<br />
Zuschauer wurde angehalten, sich namentlich<br />
in ein großes Anwesenheitsbuch am Saaleingang<br />
einzutragen. Die Kinobesucher trugen<br />
sich mit den unmöglichsten Namen ein, von<br />
Schauspielern, Wissenschaftlern und sogar mit<br />
Namen ehemaliger Naziführer und dergleichen.<br />
Etwa 1976 wurde der gesamte Gebäudekomplex<br />
von der Stadtgemeinde aufgekauft, um die<br />
Straßenführung dem Verkehr anzupassen und<br />
letztlich um Platz zu gewinnen für das Jugendfreizeitheim.<br />
Eine Abbruchfirma aus Farge hatte dafür<br />
gesorgt, dass nur noch die Erinnerung bleibt.<br />
Quellenangabe:<br />
U. Ramlow. Burglesum 1860-1945<br />
A. und G. Schmölze. An der Lesum<br />
Eigenes Zeitungsarchiv<br />
Gespräche mit Zeitzeugen<br />
Rudolf Matzner, Januar 2O16<br />
Ein Haus voller Geschichten wurde um 1979<br />
abgerissen. Früher befanden sich in dem<br />
Gebäude das Kino „Mühlenbach Lichtspiele“,<br />
die Posthalterei, ein Friseurgeschäft, eine Gaststätte<br />
mit Saal und ein Sommergarten.<br />
Foto: Archiv R. Matzner<br />
Sommergarten, Burgdamm am Mühlenbach.<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
Foto: Archiv R. Matzner<br />
11
Ein Gnadenhof für Störche<br />
Die Storchenstation in Berne, Ortsteil Glüsing<br />
Störche Collage<br />
Foto: Maren Arndt<br />
In Berne in der Wesermarsch, Ortsteil Glüsing,<br />
gibt es eine Auffangstation für verletzte<br />
Störche. Udo Hilfert gründete diese Station<br />
1992 auf seinem Grundstück in Privatinitiative.<br />
Seitdem kümmert sich die ganze Familie Hilfers<br />
um Störche. Es hat sich herumgesprochen, aus<br />
der gesamten Region werden verletzte Störche<br />
nach Berne gebracht. Die Station ist eine vom<br />
Land Niedersachsen anerkannte Storchenpflegestation,<br />
dauerverletzte Störche findet dort<br />
eine Bleibe auf Lebenszeit.<br />
2017 hatte Familie Hilfers mehrere Gründe<br />
zum Feiern. Die Storchenstation hatte 25-jähriges<br />
Jubiläum, der gemeinnützige Verein bestand<br />
seit 10 Jahren und feierte sein 1000. Mitglied.<br />
Zudem war 2017 in der Wesermarsch ein wirklich<br />
erfolgreiches Storchenjahr, trotz des nassen<br />
Sommers. Laut Udo Hilfers brüteten 128 Storchenpaare<br />
und zogen 312 Junge groß.<br />
Die weitläufige Wiesenlandschaft mit einem<br />
großen Nahrungsangebot ist wohl mit ein<br />
Grund dafür, dass sich in der Wesermarsch eine<br />
regelrechte Storchenkolonie gegründet hat.<br />
Ausgewilderte, gesunde Störche kehrten im<br />
Frühling aus dem Süden zurück und bauten<br />
neue Nester. Allein die dauerhaft in der Pflegestation<br />
lebenden Störche zogen im vergangenen<br />
Sommer 45 Küken groß, die beringt wurden<br />
und ausflogen. Viele davon werden zurückkehren<br />
nach Berne. Das wäre ohne menschliche<br />
Hilfe und Unterstützung nicht möglich gewesen.<br />
Die Wesermarsch ist ein Schwerpunktgebiet<br />
für Weißstörche in ganz Niedersachsen.<br />
Leider richtete Orkan Xavier großes Chaos in<br />
der Storchenstation an. Bäume mit den zentnerschweren<br />
Storchennestern knickten um. Die<br />
Orkanböen wirbelten zentnerschwere Nester<br />
durch die Luft, dicke Äste, auf denen Nester<br />
gebaut waren, brachen ab. Insgesamt 16 Nester<br />
gingen verloren. Im Laufe der Jahre trugen die<br />
Störche unglaubliche Mengen an Nistmaterial<br />
zusammen, all das lag nach dem Orkan zerstört<br />
auf der Erde. Viel Arbeit für die Betreiber der<br />
Station und es muss schnell gehandelt werden,<br />
denn im Januar schon kehren die ersten Störche<br />
zurück. Störche sind standorttreu und<br />
Familie Hilfers ist nun mit Freunden, Vereinsmitgliedern<br />
und Unterstützern dabei, neue<br />
Nistmöglichkeiten zu schaffen.<br />
Besucher sind auf der Storchenstation gern<br />
gesehen. Es stehen Bänke bereit, man kann sich<br />
Zeit nehmen für die Beobachtung der Störche.<br />
Blumen und Gartenfreude finden ein buntes<br />
Ambiete vor, im Sommer blüht es in allen Farben<br />
im Garten der Hilperts. Ein Besuch dort ist<br />
gratis, Spenden sind willkommen, ganz besonders<br />
jetzt, da der Orkan soviel zerstört hat. Anke<br />
und Udo Hilfers bieten für Besuchergruppen<br />
Führungen an, die etwa eine Stunde dauern<br />
und nach vorheriger Anmeldung stattfinden.<br />
Der Besucher lernt dabei viel Wissenswertes<br />
über Störche und die Arbeit in der Station. So<br />
erfährt der Besucher u.a., dass Hilfers die Nester<br />
vor jeder Brutsaison reinigt. Störche bauen<br />
auch allerlei Müll und Plastik in ihre Nester ein.<br />
So verhindert Plastik zusätzlich zu der verbauten<br />
Lehmsilage in den Nestern, dass das Regenwasser<br />
ablaufen kann. Der Nestboden wird wasserundurchlässig<br />
und hart wie Beton. In kalten<br />
und nassen Sommern ist das verheerend für<br />
den Storchennachwuchs. Das Gelege kühlt aus,<br />
die Eier sterben ab und Jungstörche erfrieren.<br />
Sehr wichtig ist also auch die jährliche Reinigung<br />
und Instandsetzung der vorhandenen<br />
Nester. Auch Kunststoffnetze und Taue können<br />
Altvögeln und größeren Küken gefährlich wer-<br />
12 RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
den, sie verheddern sich und strangulieren sich<br />
damit. Das passiert ebenso in der berühmten<br />
Basstölpelkolonie auf Helgoland, wo sich regenmäßig<br />
Tölpel in zerfetzten Fischernetzen strangulieren.<br />
Gefahren drohen aber nicht nur im Nest. Kollisionen<br />
mit Windkrafträdern zum Beispiel können<br />
zu schwersten Verletzungen führen. In<br />
Osterholz Scharmbeck wurde eine Störchin aus<br />
dem Nest im Ortsteil Buschhausen durch ein<br />
nahes Windkraftrad so schwer verletzt, dass<br />
auch Udo Hilfers dem Vogel nicht mehr helfen<br />
konnte, die Störchin musste eingeschläfert werden.<br />
Gerettete Tiere werden im Freigehege der<br />
Auffangstation gesund gepflegt und möglichst<br />
wieder ausgewildert. Diejenigen ohne Chance<br />
auf ein Überleben in der freien Wildbahn bleiben<br />
für immer und bekommen aber auch dort<br />
die Chance, gesunden Nachwuchs aufzuziehen.<br />
Störchen ist ihr Zugverhalten angeboren, Jungstörche<br />
sammeln sich und ziehen im großen<br />
Verbund schon einige Wochen vor ihren Eltern<br />
gen Süden. So ist es möglich, dass auch die in<br />
Gefangenschaft geborenen Jungvögel erfolgreich<br />
ausgewildert werden. Manche Störche<br />
leben allerdings schon 20 Jahre mit ihrer jeweiligen<br />
Behinderung in der Station.<br />
Auch im Landkreis Osterholz ist die Anzahl<br />
der brütenden Störche in den letzten Jahren<br />
gestiegen. Allein im Tiergarten Ludwigslust sind<br />
jährlich mindestens 2 Storchennester besetzt,.<br />
Wildstörche, von denen vielleicht der eine oder<br />
der andere Vogel das Licht der Welt in Berne<br />
erblickt hat. Ein Junges aus Ludwigslust fiel im<br />
vergangenen Jahr aus dem Nest und kam verletzt<br />
und auf einem Auge blind nach Berne, wo<br />
er gesund gepflegt wurde. Wegen seiner Sehbehinderung<br />
wird er dort auch bleiben auf dem<br />
Gnadenhof für Störche.<br />
Maren Arndt Udo Hilfers Foto: Maren Arndt<br />
Hunger Foto: Maren Arndt Mutter bringt Futter Foto: Maren Arndt Storchenstation Foto: Maren Arndt<br />
Storchenstation Foto: Maren Arndt Im Apfelbaum Foto: Maren Arndt<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
13
Vor 100<br />
Jahren…<br />
<strong>Heimat</strong>-Rückblick:<br />
Wie sich der Erste Weltkrieg in der<br />
hiesigen Presse widerspiegelt<br />
„Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!<br />
Es lebe der Massenstreik!“ Mit diesen<br />
Parolen ruft der Spartakusbund in Berlin im<br />
<strong>Frühjahr</strong> 1918 zum Streik auf und fordert ein<br />
Ende des Krieges. Rund 200 000 Arbeiter folgen<br />
diesem Aufruf. Im gesamten Reichsgebiet und<br />
auch in Österreich beginnen Massenstreiks.<br />
Doch das Militär greift ein, die Streiks brechen<br />
zusammen, der sehnlichste Wunsch der Menschen<br />
nach Frieden erfüllt sich nicht. Aber auch<br />
an der Front nimmt die Ernüchterung zu: Die<br />
Begeisterung ist geschwunden, die Moral sinkt<br />
auf den Nullpunkt.<br />
Divisionskommandeure werfen der Heeresführung<br />
vor, dass die Truppe trotz der Verluste<br />
keinen einsatzfähigen Nachschub mehr erhält.<br />
Mittlerweile werden sogar Munitionsarbeiter<br />
nach einer Kurzausbildung an der Front eingesetzt.<br />
Auch die Hochseeflotte in Wilhelmshaven<br />
und Kiel meutert. Die Marinesoldaten weigern<br />
sich, weiter zu aussichtslosen Seegefechten<br />
auszulaufen und sich ohne Aussicht auf Erfolg<br />
zu opfern. Aber noch ist kein Ende des Krieges<br />
in Sicht…<br />
Arbeitskräfte für die Landwirtschaft<br />
– Verschickung<br />
von Kindern<br />
Nach dem Ende eines wieder einmal strengen<br />
Winters soll die Vorbereitung der Äcker für die<br />
<strong>Frühjahr</strong>sbestellung beginnen, um die notwendige<br />
Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.<br />
Dies erweist sich jedoch als problematisch,<br />
fehlen vor allem dafür die Männer, die an der<br />
Front Kriegsdienst leisten müssen. Schon im<br />
Januar hatte die Reichsregierung deshalb Vorsorge<br />
getragen. In einer entsprechenden<br />
Bekanntmachung der Kreisverwaltung Osterholz<br />
teilt Landrat Dr. Becker mit:<br />
„Bei dem bekannten, in diesem <strong>Frühjahr</strong><br />
infolge vermehrter Einziehung noch verschärften<br />
Arbeitermangel hat das Kriegswirtschaftsamt<br />
schon jetzt mit dem deutschen<br />
Industriebüro in Brüssel persönlich Fühlung<br />
aufgenommen und erreicht, daß ihm eine<br />
größere Anzahl tüchtiger Arbeitkräfte, die<br />
landwirtschaftliche Erfahrungen besitzen,<br />
garantiert sind, wenn die festen Bestellungen<br />
bis Anfang Februar vorliegen. Es handelt sich<br />
zunächst um 2 000 Mädchen und 500 Männer,<br />
die zu folgenden Bedingungen abgegeben werden<br />
sollen.“ Darauf folgt eine detaillierte<br />
Beschreibung des Verfahrens, wie eine solche<br />
„Bestellung“ zu formulieren ist.<br />
Unter dem fortdauernden Mangel an ausreichender<br />
Ernährung leiden die Kinder besonders.<br />
Vor allem die in den Städten wohnenden Kleinen<br />
sollen nun durch einen Aufenthalt „auf<br />
dem Lande“ wieder zu Kräften kommen. Im<br />
April wendet sich deshalb die Kreisverwaltung<br />
an die Bevölkerung mit einer nachdrücklichen<br />
Bitte: „Die in den Großstädten und Industriebezirken<br />
unvermindert fortbestehenden<br />
Ernährungsschwierigkeiten zwingen dazu, auch<br />
in diesem Jahre eine umfangreiche Verschickung<br />
von Kindern auf das Land in Aussicht<br />
zu nehmen. Dank der Opferfreudigkeit der<br />
Landbevölkerung konnten im vergangenen<br />
Sommer mehr als eine halbe Million Kinder die<br />
Wohltat eines Landaufenthaltes genießen und<br />
im Herbst an Leib und Seele gestärkt in ihre<br />
<strong>Heimat</strong> zurückkehren.<br />
In diesem Jahr soll die Aufnahme schon vom<br />
Monat Mai ab bis auf weiteres, möglichst aber<br />
auf die Dauer von 3 bis 4 Monaten erfolgen,<br />
damit eine, für die Kinder so dringend notwendige,<br />
nachhaltige Erholung erreicht werden<br />
kann.“ Landrat Dr. Becker hofft auf große Resonanz<br />
und Bereitwilligkeit der ländlichen Bevölkerung<br />
und ergänzt: „Es handelt sich bei der<br />
Aufnahme der Kinder um ein vaterländisches<br />
Werk der Nächstenliebe, das nicht etwa nur den<br />
Städtern zugute kommt, sondern Deutschlands<br />
heranwachsender Jugend in ihrer Gesamtheit.“<br />
Probleme Flüchtlingsfürsorge<br />
und Überführung gefallener<br />
Soldaten<br />
Auch die Aufnahme von Flüchtlingen muss<br />
geregelt werden. Seit der Besetzung östlicher<br />
Gebiete diesseits und jenseits der Reichsgrenze<br />
durch russische Soldaten hatte vor allem dort<br />
eine große Fluchtbewegung Richtung Westen<br />
eingesetzt.<br />
Dazu schreibt die Presse Folgendes: „Die aus<br />
dem feindlichen Auslande zurückkehrenden<br />
Deutschen werden von der militärischen<br />
Grenzübernahmestelle einem Wohnorte zuge-<br />
14 RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
wiesen, der nach Möglichkeit ihren Wünschen<br />
entspricht. Zunächst kommt dabei ein Ort in<br />
Frage, wo sich Verwandte oder Bekannte befinden,<br />
die zur Aufnahme oder Unterstützung<br />
bereit sind oder lohnbringende Beschäftigung<br />
vermitteln können. (…) Die Zurückkehrenden<br />
erhalten an der Grenze die für die Lebensmittelversorgung<br />
erforderlichen Karten ausgehändigt.<br />
Die Reise erfolgt für Mittellose kostenfrei.<br />
Weiteres wird in unserer Provinz durch die<br />
Flüchtlingsfürsorgestelle des Roten Kreuzes<br />
wahrgenommen. Personen, die deren Hilfe in<br />
Anspruch nehmen wollen, müssen sich an den<br />
Magistrat oder Gemeindevorstand ihres Aufenthaltsortes<br />
wenden.“<br />
Ein nahezu unlösbares Problem bedeutete<br />
für die Militärs die Überführung der unzähligen<br />
Toten in die <strong>Heimat</strong>. Wenn auch die Angehörigen<br />
hofften, die sterblichen Überreste in der<br />
<strong>Heimat</strong>erde bestatten zu können, so erlaubten<br />
Kampfhandlungen und riesige Nachschubbewegungen<br />
dies kaum. Betroffene Angehörige<br />
konnten dazu in der Zeitung erfahren: „Mit<br />
Rücksicht auf die militärische Lage sind schon<br />
seit geraumer Zeit alle Überführungen von<br />
Kriegerleichen aus dem gesamten Grenzgebiet<br />
des Westens ausnahmslos gesperrt. Da mit dem<br />
1. Mai des Jahres die Sommersperre eintritt, die<br />
bis zum 1. Oktober dauert, können Gesuche an<br />
das stellvertretende Generalkommando um<br />
Genehmigung zur Rückführung von Leichen<br />
Gefallener erst wieder im September mit Aussicht<br />
auf Erfolg eingereicht werden. (…) Auch<br />
auf die deutsche Ostfront wird die Sperre schon<br />
jetzt vor dem 1. Mai ausgedehnt, zumal hier<br />
nach dem abgeschlossenen Frieden neue<br />
Bestimmungen in Rückführungsangelegenheiten<br />
vereinbart werden müssen.“<br />
Kleidung aus Torffasern<br />
Ein aus heutiger Sicht besonderes Kuriosum<br />
verbirgt sich in einem Beitrag unter dem Titel<br />
„Milliarden im Moor“. Dass in der damaligen<br />
Kriegszeit der Erfindungsgeist besonders einfallsreicher<br />
Menschen gefragt war, wurde in den<br />
letzten Ausgaben unseres Magazins bereits<br />
mehrfach dargestellt. Hier nun ein weiteres<br />
erstaunliches Beispiel:<br />
„Vor einem Jahr staunte man in Berlin in der<br />
Versammlung des ‚Vereins zur Förderung der-<br />
Moorkultur im Deutschen Reich‘ einen Mantel<br />
an, der aus Torffasern hergestellt war. Inzwischen<br />
hat die Torffaser immer weitere Verwendung<br />
als Ersatz für unsere sonst gebräuchlichen<br />
Spinnstoffe gefunden. Welche Bedeutung die<br />
faserhaltigen Torfmoore haben, zeigte Professor<br />
Dr. W. Magnus während der in diesem Jahr wieder<br />
in Berlin abgehaltenen Versammlung des<br />
Vereins. Könnte man alle Fasern, die in unseren<br />
Mooren vorhanden sind, gewinnen, so würde<br />
man zu ungeheuren Werten kommen.<br />
Ein rechnungsfroher Regierungsbeamter hat<br />
den Wert der in den norddeutschen Mooren liegenden<br />
Fasern mit 9 Milliarden Mark angegeben.<br />
Aber die Gewinnung ist nicht so einfach.<br />
Fast nirgends kommt die Faser, die vertorften<br />
Blattscheiden des Wollgrases, in so großem Prozentgehalt<br />
in den Mooren vor, daß es sich<br />
lohnte, das Moor ausschließlich für die Gewinnung<br />
umzugraben. Im allgemeinen ist ihre<br />
Gewinnung auf das Absammeln aus den zu<br />
anderen Zwecken bewegten Torfmassen<br />
beschränkt. Im letzten Sommer erhielt man<br />
ungefähr 700 Waggons Rohfasern; fast nur<br />
Frauen und Kinder hatten in Nebenarbeit diese<br />
Menge gesammelt. Für dieses Jahr ist die<br />
Zuweisung von Kriegsgefangenen in Aussicht<br />
gestellt.“<br />
Das auch noch…<br />
- „Wie wir hören, tragen sich die verantwortlichen<br />
Stellen in Berlin mit Erwägungen, eine<br />
weitere Beschlagnahme aller entbehrlichen<br />
Kleidunsstücke für männliche Personen vorzunehmen.<br />
So dürfte jeder Mann nur zwei vollständige<br />
Anzüge behalten. Wer beruflich<br />
gezwungen ist, einen Frack zu benutzen, wird<br />
ihn neben den beiden Anzügen behalten dürfen.<br />
Die Beschlagnahme soll erfolgen, nachdem<br />
auf Formularen der Bestand als eidesstattliche<br />
Versicherung angegeben worden ist.“<br />
- „Zur Verbesserung des Geschmackes der<br />
alten Kartoffeln: Da zurzeit die alten Kartoffeln<br />
im Keimen begriffen sind, haben die Knollen<br />
einen starken Solanumgehalt. Dieser beeinträchtigt<br />
den Geschmack und wirkt nachteilig<br />
auf die Verdauung. Es empfiehlt sich deshalb,<br />
den Kartoffeln oder Kartoffelspeisen beim<br />
Beginn des Kochens einige Kümmelkörner<br />
zuzusetzen.“<br />
- „Borgfeld. Am letzten Sonntag fand hier in<br />
glücklicher Fügung der Umstände bei der Einführung<br />
des neuen Gesangbuches zugleich die<br />
Weihe unserer neuen Orgel statt. Das kleine,<br />
aber feine Werk, welches im wesentlichen<br />
einem Legat des Frl. Marie von Lingen zu verdanken<br />
ist, macht der Orgelbaufirma Furtwängler<br />
& Hammer in Hannover alle Ehre. Nach<br />
dem Gutachten des Herrn Organisten Hoyermann<br />
von St. Ansgari in Bremen ist es in Material<br />
und Stimmung vorzüglich. Beim Festgottesdienst<br />
in der gefüllten Kirche hat Herr Hoyermann<br />
auch selber kunstvoll die neue Orgel der<br />
andächtig lauschenden Gemeinde vorgeführt.<br />
So verlief die schöne Doppelstunde ganz im<br />
Sinne des Predigttextes: Singet und spielet dem<br />
Herrn in euren Herzen!“<br />
Peter Richter<br />
Anmerkung: In den Originaltexten wurde die<br />
damals gültige Rechtschreibung beibehalten.<br />
Quelle: Zeitungsarchiv des <strong>Heimat</strong>vereins Lilienthal<br />
e.V.<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
15
Heinrich Vogeler und Otto Sohn-Rethel<br />
Eine Künstlerfreundschaft<br />
Als der siebzehnjährige Heinrich Vogeler im<br />
September 1890 an die Düsseldorfer Akademie<br />
kam, lernte er dort den einige Jahre jüngeren<br />
Otto Sohn-Rethel kennen. Aus dieser Begegnung<br />
entwickelte sich eine langjährige Künstlerfreundschaft.<br />
Sohn-Rethel besuchte schon als Dreizehnjähriger<br />
die Kunstakademie. Wie Vogeler verbesserte<br />
er als Kunstschüler sein Zeichentalent in<br />
Vorkursen, um später mit einer repräsentativen<br />
Kunstmappe vor der Aufnahmekommission der<br />
Akademie bestehen zu können und als Kunsteleve<br />
in die Akademie aufgenommen zu werden.<br />
Die zeichnerische Begabung war Sohn-Rethel<br />
mit in die Wiege gelegt, entstammte er doch<br />
Gnädig wurden die Akademieflüchtlinge<br />
wieder in den Kunstbetrieb aufgenommen und<br />
konnten ihr Studium in Düsseldorf im Wintersemester<br />
1894/1895 beenden. Heinrich Vogeler<br />
hatte schon während des Studiums durch den<br />
Kontakt zu Fritz Overbeck Verbindung zur<br />
Künstlergruppe in Worpswede aufgenommen<br />
und auch Otto Sohn-Rethel kam zeitweise ins<br />
Künstlerdorf. Als er 1895 mit Zustimmung von<br />
Fritz Mackensen beabsichtigte, sich der Gruppe<br />
anzuschließen, schrieb ihm Vogeler eine Ablehnung:<br />
„Lieber Otto Sohn! Dass ich dir diesen<br />
Brief schreiben muss, ist mir sehr unangenehm;<br />
aber Otto Modersohn und Overbeck stehen<br />
jedem Neuen so misstrauisch gegenüber, dass es<br />
Michels. Sein älterer Bruder Alfred hatte die<br />
Tochter des Hauses, Julie Michels, geheiratet.<br />
Von Hannover kam er immer mal wieder ins<br />
norddeutsche Künstlerdorf. Auch Vogeler<br />
besuchte ihn in der Leinestadt und ließ später<br />
von Eduard Michels einen Teppichentwurf fertigen.<br />
(3)<br />
Das Verhältnis zwischen Heinrich Vogeler und<br />
Otto Sohn-Rethel war herzlich und vertrauensvoll.<br />
Vogeler nannte seinen jüngeren Kollegen<br />
liebevoll „Söhnlein“ und bat ihn, als er sich längere<br />
in Berlin aufhielt, ein Bild von ihm zu verpacken<br />
und zu einer Ausstellung des Hannoveraner<br />
Kunstvereins zu bringen: „Carissimo! Du<br />
könntest mir einen hohen Dienst erweisen:<br />
Atelier-Strohl-Fern Foto: S. Bresler Sint anna 3 Foto: S. Bresler<br />
einer bekannten Düsseldorfer Künstlerfamilie.<br />
Sein Großvater war der berühmte Historienmaler<br />
Alfred Rethel und sein Vater der Maler Karl-<br />
Rudolf Sohn. Otto Sohn-Rethel malte und<br />
zeichnete schon als Kind und übte sich schon<br />
mit zehn Jahren in Aquarellieren und Zeichnung<br />
mit Tierstudien und Porträts von Familienmitgliedern.<br />
An der Akademie war er zwar einer der jüngsten<br />
Schüler, doch seine Lehrer konnten ihm<br />
wenig Neues bieten. Ähnlich wie Heinrich Vogeler<br />
langweilte er sich in den Kursen des akademischen<br />
Zeichnens nach Gipsmodellen.<br />
Gemeinsam mit dem Studienfreund Robert<br />
Weise beschlossen sie daher im Herbst 1892,<br />
nachdem sie als Eleve die Weihen der Kunsthochschule<br />
erhalten hatten, dem öden Akademiebetrieb<br />
den Rücken zu kehren.<br />
Anders als Vogeler in seiner Autobiografie<br />
WERDEN schreibt, besuchten sie aber nicht<br />
Sohn-Rethel im südholländischen Sluis, sondern<br />
sie entdeckten gemeinsam diesen idyllischen<br />
Ort, in dem Otto sich Jahre später für<br />
kurze Zeit niederließ. Zu dritt erkundeten sie<br />
von dort aus die Kunst eines Hans Memling oder<br />
Jan van Eyck im nahe gelegenen Brügge. Vor der<br />
ausbrechenden Cholera flüchten sie nach<br />
Genua und Rapallo.<br />
für den Frieden besser ist, wenn du nicht<br />
kommst. Ich schreibe dir dies mit brutaler<br />
Offenheit da ich dich kenne und du mich verstehen<br />
wirst. […]“(1) Anscheinend nagte die<br />
schroffe Abweisung an Vogelers Gewissen und<br />
er schrieb gleich einen neuen Brief: „Lieber<br />
Otto Sohn, Söhnchen! Vor allem erst einmal die<br />
Hauptsache: Ich erwarte dich sobald wie möglich<br />
hier auf dem Weyerberg. Am liebsten wäre<br />
es mir, wenn du in 8 Tagen kämest. Leider ist die<br />
Roggenernte schon vorüber, das wäre was für<br />
dich gewesen. Ich rate dir, wenn du kommen<br />
willst komme sobald wie möglich. - Du musst<br />
meinen Freunden nun nur nicht ihr Misstrauen<br />
verübeln. Es war nicht die Furcht vor dem<br />
Künstler viel mehr vor dem neuen Menschen. –<br />
Also hiermit lade ich dich ein, wenn du dich<br />
etwas behelfen willst, kannst du bei mir wohnen.<br />
[…]“ (2)<br />
Der zweite Brief scheint die Freundschaft<br />
gerettet zu haben. Zwar lässt sich Sohn-Rethel<br />
nicht dauerhaft in Worpswede nieder, doch<br />
besuchte er Vogeler dort häufiger. Beide standen<br />
in engem Kontakt, tauschten Rezepte für<br />
Malfarben und ihre gesundheitlichen Befindlichkeiten<br />
aus.<br />
Bis 1899 wohnte Sohn-Rethel wiederholt in<br />
Hannover bei dem Teppichfabrikanten Eduard<br />
Gehe hin zum Barkenhoff nimm dir 2 (zwei)<br />
starke Männer (worunter ein Tischler) und gieb<br />
ihnen Anordnung mein Bild zu verpacken. Die<br />
Kiste steht fertig. Hinten gut festschrauben.<br />
[…]“ (4)<br />
Als sich Sohn-Rethel ab <strong>Frühjahr</strong> 1899 längere<br />
Zeit in Paris aufhielt, stand Vogeler mit ihm<br />
brieflich in Verbindung und hielt ihn über<br />
eigene Aktivitäten und die Veränderungen in<br />
Worpswede auf dem Laufenden. Nach dem Parisaufenthalt<br />
begab Otto Sohn-Rethel sich nach<br />
Holland, wo er in der Nähe von Sluis, das er ja<br />
aus Studententagen kannte, in Sant Anna ter<br />
Muiden ein kleines Häuschen anmietete und<br />
dort bis 1902 lebte und arbeitete.<br />
Als Heinrich Vogeler im <strong>Frühjahr</strong> 1901<br />
Martha Schröder heiratete, führte sie ihre<br />
Hochzeitsreise nach Holland zu Otto Sohn-<br />
Rethel.<br />
„ […] 20 Minuten von unserem Städtchen<br />
liegt ein wunderbar malerisch kleines Nest St<br />
Anna Ter Muiden und dort wohnt das kleine<br />
Söhnlein. Das hättest du sehen müssen als wir<br />
beide da plötzlich eines schönen Nachmittags<br />
bei ihm antraten. In einem ganz kleinen Häuschen<br />
mit niedrigem Ziegeldach und grünen<br />
Fensterläden wohnt der Mensch wie ein alter<br />
Sonderling umgeben von den wertvollsten alten<br />
16 RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
Sohn-Rethel jung<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
Foto: S. Bresler<br />
Sachen, ein riesiges malerisches Heim vollgestopft<br />
von feinen Stoffen, wunderbaren Copien,<br />
die Gebhardt (5) nach alten Meistern gemacht<br />
hat, schönen Gläsern, Silbersachen, Porzellanen,<br />
vielleicht sieht es etwas zu sehr nach<br />
einem Althändler aus, aber wenn die Sonne<br />
durch eines der kleinen Fenster kommt und<br />
über die Truhen, Schränke, Spitzen und Brokatstoffe<br />
scheint , dann ist doch eine ganz besondere<br />
märchenhafte Stimmung in dem Häuschen.<br />
– […].“ (6)<br />
Das freie, ungezwungene Leben seines jungen<br />
Studienfreundes schien Vogeler fasziniert<br />
zu haben. Auch als Otto Sohn-Rethel im folgenden<br />
Jahr nach Rom ging und bei dem Kunstmäzen<br />
Alfred Strohl-Fern eine Atelierwohnung<br />
bezog, folgte Vogeler ihm im November 1902<br />
nach. Gemeinsam mit Martha begab er sich<br />
nach Rom und wohnte auf der Piazza Barberini<br />
nicht weit von dem Villengelände Strohl-Ferns<br />
entfernt. Als Martha Mitte Dezember Rom verlässt<br />
und nach Worpswede zurückkehrte, zog<br />
Heinrich Vogeler bei Otto Sohn-Rethel in die<br />
Atelierwohnung. Zusammen mit anderen<br />
Künstlern feierten sie Weihnachten und Vogeler<br />
reiste auf Anraten von Sohn-Rethel nach Neapel<br />
und Pompeij.<br />
In Neapel besuchte er gleich zweimal die<br />
Bibliothek der Zoologischen Station, die mit<br />
Wandbildern Hans von Marées ausgeschmückt<br />
sind. Diese Begegnung hatte Vogeler, wie zuvor<br />
auch schon seinen Freund Otto, in seiner künstlerischen<br />
Entwicklung stark beeinflusst. „Wieder<br />
in Neapel, trieb es mich noch einmal in das<br />
Aquarium am Meeresstrand, um Abschied von<br />
den Fresken zu nehmen, mit denen Hans von<br />
Marées die Wände dieses Studienortes für italienische<br />
und ausländische Studenten geziert<br />
hatte. Wenn man diese frischen, realistischen<br />
monumentalen Wandbilder aus dem Leben der<br />
Fischer mit den Naturforschern gesehen hat,<br />
dann forscht man immerwährend nach der<br />
Fortsetzung dieses einzigartigen Weges zur<br />
monumentalen Kunst, der hier beschritten<br />
wurde.“ (7)<br />
Um den 20. Januar 1903 kehrte Vogeler<br />
zurück nach Rom und verbrachte dann noch bis<br />
Ende Februar 1903 eine künstlerisch stimulierende<br />
Zeit mit Otto Sohn-Rethel in dessen Atelierwohnung<br />
auf dem Gelände der Villa Strohl-<br />
Fern. In dieser Zeit wurde Vogelers Gemälde<br />
„Erster Sommer“ in einer Ausstellung der Berliner<br />
Sezession ausgestellt. In dem von Paul Cassirer<br />
herausgegebenen Katalog ist er mit „Vogeler<br />
Heinrich, Maler, Worpswede bei Bremen. Z.Z.<br />
Rom Villa Strohl-Fern“ (8) verzeichnet. Im März<br />
1903 kehrte Vogeler nach Worpswede zurück<br />
und der Kontakt zu Otto Sohn-Rethel scheint<br />
einzuschlafen.<br />
Dann verkaufte Vogeler im Jahre 1912 eine<br />
Zeichnung der Villa Strohl Fern, die während<br />
seines Aufenthaltes in Rom entstanden war, für<br />
450 M an die Hamburger Galerie Commeter.<br />
Diese Aktion mag noch einmal die gemeinsame<br />
Zeit mit Sohn-Rethel in Erinnerung gebracht zu<br />
haben. Sein Künstlerfreund wohnte nun schon<br />
einige Zeit auf der Insel Capri. In dem Ort Anacapri<br />
hatte er sich in der Villa Lina eine repräsentative<br />
Bleibe einrichten können. Dort empfing<br />
er Künstler, Literaten und Musiker aus ganz<br />
Europa und widmete sich neben der Malerei<br />
auch seiner frühen Passion, den Schmetterlingen.<br />
Diese Leidenschaft brachte ihm auf der<br />
Insel den Namen Farfallaro von Anacapri ein<br />
(von ital. farfalla für Schmetterling). Wahrscheinlich<br />
hat Vogeler im September 1913 seinen<br />
Studienfreund noch einmal besucht. Eine<br />
Visitenkarte Vogelers im Archiv der Bibliothek<br />
der Zoologischen Station in Neapel vom<br />
04.09.1913 legt diese Vermutung nahe. Danach<br />
Von der Raupe zum Falter, Otto Sohn-Rethel ca. 1910<br />
scheinen sich ihre Kontakte jedoch zu verlieren.<br />
Heinrich Vogeler zog bald in den Krieg,<br />
schwörte dem Jugendstil ab und wandte sich<br />
dem Kommunismus zu. Otto Sohn-Rethel blieb<br />
meist auf Capri und hielt von dort aus weiter<br />
Kontakt zu Künstlern in Deutschland. Er verstarb<br />
am 09. Juni 1949 auf Capri und ist auf<br />
dem Friedhof in Anacapri begraben.<br />
Siegfried Bresler - Bielefeld<br />
(1) Brief Heinrich Vogelers an Otto Sohn-<br />
Rethel vom Juli 1895.<br />
(2) Brief Heinrich Vogelers an Otto Sohn-<br />
Rethel, vom 29. Juli 1895.<br />
(3) Hinweis von Frau Lambert Düsseldorf. Sie<br />
ist eine Nachfahrin der Familie<br />
Sohn-Rethel.<br />
(4) Postkarte Heinrich Vogelers aus Berlin an<br />
Otto Sohn-Rethel, vom 18.02.1897<br />
(5) Das ist Eduard von Gebhardt, bei dem<br />
Vogeler und Sohn-Rethel Malerei<br />
studierten<br />
(6) Brief Heinrich Vogelers an Otto Modersohn,<br />
vom 24. März 1901.<br />
(7) Heinrich Vogeler. Werden. Erinnerungen.<br />
Fischerhude 1989. S. 89.<br />
(8) Paul Cassirer (Hrsg.): Katalog der siebten<br />
Kunstausstellung der Berliner Secession,<br />
Berlin 1903, S. 47.<br />
Foto: S. Bresler<br />
17
Ich bin ein Star - bau mir ein Haus!<br />
Das sollten Sie über den Vogel des Jahres <strong>2018</strong> wissen<br />
Der Star ist uns ein vertrauter Nachbar. Er ist<br />
uns vertraut aus den Parks und Gärten, wenn er<br />
auf Nahrungssuche über den Rasen flitzt oder<br />
sich am Kirschbaum gütlich tut. Schwarz auf<br />
den ersten Blick, aber erst bei genauerem Hinsehen<br />
ist er eine wahre Attraktion: sein glänzender<br />
Frack und ihr Pünktchenkleid sind ein<br />
echter Hingucker insbesondere zur Brutzeit.<br />
Zwar ist der Starenmann nicht so stimmgewaltig<br />
wie manch anderer Singvogel, dafür gibt es<br />
keinen vielseitigeren Imitator unter den heimischen<br />
Vögeln als ihn. Zwischen seine schnalzenden<br />
und pfeifenden Töne mischt er auch<br />
mal ein Froschquaken oder eine Alarmanlage.<br />
Seine bevorzugten Lebensräume wie Weiden,<br />
Wiesen und Felder mit Alleen und Waldrändern<br />
werden immer intensiver genutzt. Er benötigt<br />
Baumhöhlen zum Brüten und Nahrungsflächen<br />
mit kurzer Vegetation, wo er Würmer und Insekten<br />
findet. Doch Hecken und Feldgehölze<br />
„stören“ eher beim intensiven Anbau von<br />
Getreide und Energiepflanzen in Monokulturen.<br />
Auch die zunehmende Haltung von Nutztieren<br />
in abgeriegelten Riesenställen setzt dem Star<br />
zu. Grasen Tiere nicht auf der Weide und hinterlassen<br />
dort ihren Mist, bleibt mit den<br />
angelockten Insekten ein wichtiges Nahrungsmittel<br />
aus.<br />
Heute stellen Parks und Friedhöfe mit ihren<br />
zum Teil alten und höhlenreichen Bäumen<br />
sowie den kurzrasigen Wiesen wichtige Ersatzlebensräume<br />
dar. Auch an Gebäuden nutzt<br />
unser Jahresvogel Hohlräume zum Brüten.<br />
Jeder Garten- oder Hausbesitzer kann der Wohnungsnot<br />
des Stars mit einem Nistkasten<br />
www.lbv.de<br />
begegnen. Gärtnern ohne Pflanzenschutzmittel<br />
und Insektizide sowie Beeren tragende Gehölze<br />
verhelfen dem Star zu ausreichend Nahrung.<br />
Eine strukturbereichernde und ökologische<br />
Landwirtschaft mit artgerechter Tierhaltung<br />
hilft dem Star und vielen anderen Vögeln.<br />
Die Nahrung für seine Jungen findet der Star<br />
auf insektenreichen Wiesen und Weiden, von<br />
denen es in der industriellen Landwirtschaft<br />
aber immer weniger gibt. Auch Streuobstwiesen<br />
und beerenreiche Hecken verschwinden aus<br />
unserer Landschaft und lassen dem Star keine<br />
andere Wahl, als seinen Hunger auf Früchte in<br />
Wein- und Obstplantagen zu stillen. In der grünen<br />
Stadt geht es ihm da schon ein wenig besser,<br />
doch herrscht vielerorts Wohnungsmangel,<br />
wenn Höhlenbäume gefällt oder Fassadenlöcher<br />
geschlossen werden.<br />
Richtig imposant wird es, wenn mehrere tausend<br />
Stare dichte Schwärme bilden. In filigranen<br />
Wogen tanzen sie am Himmel und zeigen<br />
ein einzigartiges Naturschauspiel, das seinesgleichen<br />
sucht. Doch die Schwärme werden<br />
kleiner. In vielen Ländern Europas und auch in<br />
Deutschland gehen die Starenbestände zurück.<br />
Am besten zu beobachten sind die imposanten<br />
www.rbb-online.de<br />
Foto: Dieter Goebel-Berggold, fotocommunity.de, fc-foto 5470525 *<br />
18 RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
www.rbb-online.de<br />
Schwarmwolken im September und Oktober,<br />
etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang. Doch<br />
schon im Frühsommer oder noch Ende November<br />
können Sie mit etwas Glück Starenschwärme<br />
am Himmel sehen, bevor sie schlagartig<br />
nach unten sinken. Starenschwärme reichen<br />
von kleinen Nahrungstrupps bis zu einer<br />
Million Tiere an Hauptsammelplätzen. Vor allem<br />
an Gewässern mit großen, ausgedehnten Schilfzonen<br />
und in Baumgruppen sammeln sich<br />
Schwärme besonders gern und suchen dort<br />
Schutz für die Nacht. Große Trupps finden Sie<br />
aber auch im Grünland auf Weiden oder auf<br />
Stromleitungen. Da natürliche Höhlen in alten<br />
Bäumen immer weniger zur Verfügung stehen,<br />
helfen Sie dem Vogel des Jahres mit einem Nistkasten.<br />
Sowohl im Privatgarten als auch in<br />
öffentlichen Grünbereichen und in ländlichen<br />
Gebieten findet der Star so einen Platz, um<br />
seine Jungen aufzuziehen. Der Starenkasten<br />
bietet auch Wendehals oder Kleiber Unterschlupf<br />
– ein Argument mehr, um zu Hammer<br />
und Säge zu greifen.<br />
Zusammengestellt von Susanne Eilers anhand<br />
von NABU Veröffentlichungen<br />
Foto: Kleinbucher.blogspot.de<br />
Obwohl Krieg herrscht:<br />
Humor im Jahre 1918<br />
Oh, diese Fremdwörter!<br />
In einer Volksschule waren die Augen<br />
sämtlicher Schüler einer Untersuchung<br />
durch den Augenarzt unterzogen worden.<br />
Den Eltern derjenigen Kinder, bei denen<br />
nicht alles in Ordnung war, wurde eineentsprechende<br />
Mitteilung gemacht.<br />
Infolgedessen erhielt der Vater Reinhold<br />
Müllers einen Brief des Rektors, in dem<br />
dieser ihm schrieb: „Sehr geehrter Herr!<br />
Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß sich bei<br />
Ihrem Sohn Reinhold Anzeichen von<br />
Astigmatismus bemerkbar machen,<br />
wogegen sofort Schritte getan werden<br />
müssen. Hochachtungsvoll, pp.“<br />
Am nächsten Morgen brachte Reinhold<br />
folgenden Brief seines Vaters: „Sehr geehrter<br />
Herr Rektor! Es ist mir zwar nicht klar,<br />
was der Junge diesmal wieder angestellt hat,<br />
aber auf jeden Fall habe ich ihn tüchtig verwichst,<br />
und ich wäre Ihnen dankbar, wenn<br />
Sie ihm auch noch eine ordentliche Tracht<br />
Prügel zukommen lasssen wollen. Hochachtungsvoll,<br />
pp.“<br />
Sparsamkeit...<br />
Drei Reisende saßen im Raucherabteil<br />
eines Schnellzuges und unterhielten sich.<br />
„Ja,“ sagte der eine, „es gibt Leute, die so<br />
sparsam sind, daß es an Geiz grenzt. Ein<br />
früherer Chef von mir verlangte von seinen<br />
Angestellten, daß sie eine ganz kleine Handschrift<br />
schrieben, um Tinte zu sparen.“ -<br />
„Ach,“ sagte der zweite, „mein Onkel ist<br />
noch viel sparsamer! Der stellt, wenn er zu<br />
Bett geht, sämtliche Uhren in der Wohnung<br />
still, damit die Werke während der Nacht<br />
nicht abgenutzt werden.“ - „Da weiß ich<br />
noch etwas Besseres,“ erklärte der dritte,<br />
„ich kenne einen alten Geizkragen, der keine<br />
Zeitung liest, weil er findet, daß das seine<br />
Brille angreift.“<br />
Peter Richter<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
19
Was lange währt …<br />
Neues zur Geschichte des Klosters Lilienthal<br />
Seit mehreren Jahren gibt es das Rätselraten<br />
darüber, ob der kleine Ort Wollah in der Nähe<br />
von Lesum bei Bremen ein Standort des Klosters<br />
Lilienthal war. Da veröffentlicht am 16. April<br />
2017 der WESER-KURIER unter dem Titel „Klosterlandschaft<br />
wird virtuell sichtbar“ einen Artikel<br />
über eine gerade erschienene „Niedersächsische<br />
Klosterkarte“. In seiner E-Mail vom 20.<br />
November 2017 antwortet Dr. Niels Petersen<br />
vom Institut für Historische Landesforschung<br />
an der Georg-August-Universität in Göttingen,<br />
dass die Anfrage, ob das Kloster Lilienthal sich<br />
in Wollah befunden hat, ihren Weg über zwei<br />
Schreibtische nahm. Das Ergebnis: In Wollah bei<br />
Lesum hat es nie ein Kloster gegeben, es handelt<br />
sich um eine Verwechslung bei der Zuordnung<br />
des Ortsnamens!...<br />
Erste Zweifel<br />
„…, als ob in Wolda (Wollah) von Hartwich<br />
wirklich ein Kloster errichtet sein, so scheint<br />
mir das ein Irrthum zu sein, denn man findet<br />
auch nicht eine Spur davon.“ (Archiv des Vereins<br />
für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer<br />
Bremen und Verden und des Landes<br />
Hadeln zu Stade, Stader Geschichts- und <strong>Heimat</strong>verein,<br />
1863)<br />
Der Irrtum<br />
„Das Kloster auf St. Stephani wurde abgebrochen<br />
und der Erzbischof von Bremen kaufte<br />
den Ort Wolda „by der Leßem mit allen thobehoringe<br />
von dem Junker Wilken van Marsale<br />
(Marssel) har man dor bouwen scholde ein<br />
Jungfrouwenkloster von St. Bernhardsorden in<br />
der ehre unser Leuen freuwen.“ Und jetzt folgt<br />
die Passage, die Christoph Tornée nicht besser<br />
wissen konnte: „Daß der Erzbischof Hartwig II.<br />
[1187] ein Stück Land in Wolda (Wolla) gekauft<br />
hat, steht fest; …“. Er übersetzt dabei Wolda mit<br />
Wollah [bei Lesum] und fügt hinzu: „aber für<br />
die Herstellung unter seiner Aegide [Leitung]<br />
fehlen alle Beweise.“!<br />
Die älteste Bremer Chronik<br />
Im Jahr 1968 gibt der Verlag Carl Schünemann<br />
in Bremen eine Chronik heraus, die<br />
eigentlich schon vor dem Zweiten Weltkrieg<br />
erscheinen sollte, jedoch nicht fertig gestellt<br />
wurde, weil der damit Beauftragte, Hermann<br />
Meinert, Staatsarchivrat beim Preußischen<br />
Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem, 1940<br />
zur kämpfenden Truppe einberufen wurde. Er<br />
„übersetzte“ aus der Urkundenschrift, was Gert<br />
Rinesberch [um 1315-1406], Herbord Schene<br />
[um 1358-1413] und Johann Hemeling [um<br />
1358-1428], Abkömmlinge aus Bremer Familien,<br />
über das Werden der Freien und Hansestadt<br />
Bremen geschrieben hatten. Hier findet man<br />
Hist. Karte Altenwalde 2<br />
auch den Text im Original, den Christoph Tornee<br />
in seiner Chronik zitiert: „ock kofte he [Erzbischof<br />
Hartwig II.] ene stede, geheten Wolda,<br />
mit alle siner tobehoringe vor hundert unde<br />
sostich mark, dat men dar makede ein junckfrouwen<br />
closter van sunte Bernhardus orden in<br />
de ere unser leven vrouwen, dat nu to deme<br />
Liliendale hetet, unde wart van dar to der Trupe<br />
gebuwet, dar id nu steit.“ Datiert auf den 1. Mai<br />
1187. - Ein Blick in das Register: Wolda s. Altenwalde<br />
! - (Im „Urkundenbuch des Klosters Neuenwalde“<br />
findet man die Schreibweise „Wolda“<br />
für Altenwalde bei mehreren Urkunden.) - Herbord<br />
Schene, einer der Autoren dieser Bremer<br />
Chronik, war Bruder von vier Klosterschwestern<br />
im Kloster Lilienthal, darunter die Äbtissin Gertrudis,<br />
deren von ihm im Jahr 1400 gestiftete<br />
Grabplatte als Denkmal bezeichnet wird. So<br />
wird auch die mündliche Überlieferung eine<br />
Rolle gespielt haben. – Irritierend die Titel dieser<br />
Chronik: Die Chroniken der deutschen<br />
Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert Siebenunddreißigster<br />
Band Untertitel: Die Chroniken<br />
der niedersächsischen Städte. Dann erst Bremen.<br />
Altenwalde<br />
Allein das Auffinden dieser Stelle zum Vergleich<br />
zwischen den beiden Chroniken reicht<br />
aus, um den Irrtum von Johann Renner (und<br />
anderen) aufzuklären. Doch eine große Anzahl<br />
Historischer Plan Altenwalde;<br />
Karte Amt Ritzebüttel (Schröter,1594);<br />
weiterer Fakten untermauert diese Feststellung.<br />
Die historische und christliche Vergangenheit<br />
von Altenwalde ist ein nächster Anhaltspunkt<br />
dafür, dass sich der vorübergehende Standort<br />
des Klosters Lilienthal dort befunden hat und<br />
nicht in Wollah.<br />
Im September 1971 erschien die „Chronik<br />
von Altenwalde“ (Winfried Siefert), doch auch<br />
in diesem Werk wurde die älteste Bremer Chronik<br />
nicht berücksichtigt. Der von Erzbischof<br />
Hartwig II. im Jahr 1187 getätigte Kauf der<br />
„stede Wolda“ (= Altenwalde) wird mit keiner<br />
Silbe erwähnt! Auch für Altenwalde ist diese<br />
neue Erkenntnis daher eine weitere bemerkenswerte<br />
Etappe auf dem ohnehin geschichtsträchtigen<br />
Weg dieses Ortes in die heutige Zeit.<br />
Das Kloster<br />
In der Altenwalder Chronik beginnt die<br />
Geschichte ihres Klosters mit der Gründung im<br />
Jahr 1219 eines Kanonissenstiftes in Midlum,<br />
etwa 10 km südlich von Altenwalde gelegen. Die<br />
Edelherren von Diepholz errichteten kein Klostergebäude,<br />
statteten es jedoch mit Diepholzer<br />
Gütern der Umgebung aus. Erzbischof Giselbert<br />
verlegt 1282 dieses Kloster nach Altenwalde, zu<br />
einem Zeitpunkt, als das Kloster Lilienthal<br />
schon 50 Jahre in Trupe sesshaft war. Auch hier<br />
kein Wort über die „Zwischenstation“, den<br />
bereits ca. 100 Jahre vorher getätigten Kauf der<br />
„stede Wolda“ mit dem Namen „Liliendale“ für<br />
ein dort geplantes Kloster.<br />
Der Wallfahrtsort<br />
Altenwalde war ein stark besuchter Wallfahrtsort<br />
im Erzbistum Bremen mit einer Reliquie,<br />
einem Splitter vom Kreuz Jesu Christi, in<br />
der dortigen „capella sanctae crucis sanctissimique<br />
patris Willehadi“ (Kapelle des heiligen<br />
Kreuzes und des heiligen Vaters Willehad) auf<br />
der Altenwalder Höhe. Die Trümmerstätte auf<br />
der Altenwalder Höhe war noch 1905 (Heinrich<br />
Rüther) übersät mit gebrannten Steinen und<br />
Dachziegeln, kleineren Stücken von Tuffsteinen,<br />
20 RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
Bereiches um Altenwalde und die Aussage, dass<br />
hier bereits zur Römerzeit intensiver Handel<br />
betrieben wurde.<br />
Das Kloster Lilienthal hat mit dem Kauf der<br />
„stede Wolda“ nicht nur dort seinen Namen<br />
erhalten und mit nach Trupe genommen, es hat<br />
sich am Wallfahrtsort Altenwalde auch einen<br />
Namen gegenüber dem Bremer Erzbistum<br />
gemacht. Hätte sonst die Äbtissin Grethen ihren<br />
Platz als Konsolfigur unter der Skulptur des<br />
Markgrafen von Brandenburg an der Schauseite<br />
des Bremer Rathauses für eine Ewigkeit durch<br />
eine Spende erwerben dürfen?...<br />
Vergleich Klostergebäude<br />
Lilienthal / Neuenwalde<br />
Romanische Feldsteinkirche St. Cosmas und Damian in Altenwalde<br />
dem älteren Baumaterial aus Kalk mit Muschelteilen<br />
und Sand, das auch in den alten Kirchen<br />
von Wremen und Blexen zu finden ist. Gleichzeitig<br />
war der Ort nördlicher Endpunkt eines<br />
tief aus dem Süden kommenden Handelsweges,<br />
der daher ebenfalls Reisestation für Händler,<br />
Seefahrer und Besucher war. Es muss eine viel<br />
größere Anzahl von Reisenden gewesen sein, die<br />
hier um Unterkunft baten, als bisher gedacht.<br />
Eine der Begründungen für den Umzug des Klosters<br />
nach Neuenwalde, die Unruhe durch die<br />
große Anzahl von Reisenden wäre einer der<br />
Punkte gewesen, das Kloster nach Neuenwalde<br />
zu verlegen, ist gut nachzuvollziehen.<br />
„ … Allerdings mußte man tatsächlich das<br />
Wasser stets den Berg hochschleppen, da ein<br />
Brunnen nicht ergiebig war.“ Mit dieser Aussage<br />
findet ein anderer Punkt aus der bisherigen Lilienthaler<br />
Klostergeschichte eine neue<br />
Erklärung: Nicht das Hochwasser der Wümme /<br />
Wörpe hat den Klosterinsassen am Standort<br />
Trupe große Schwierigkeiten bereitet, diese<br />
Aussage war viele Jahre vorher in Altenwalde<br />
von großer Bedeutung. Und einer der Hauptgründe,<br />
das Kloster 1334 von Alten- nach Neuenwalde<br />
zu verlegen.<br />
„Sämtliche Einwohner der Orte Altenwalde,<br />
Gudendorf, Oxstedt, Arensch, Berensch und<br />
Holte wurden Klostermeier und damit zehntpflichtig.“<br />
- Auch hier ist die Bedeutung und der<br />
Einfluss des Erzbischofs auf den Ort abzulesen,<br />
der damals schon mit den umliegenden Dörfern<br />
fast als Kleinstadt zu bezeichnen war.<br />
Die Altenwalder Mühle, eine Bockmühle, war<br />
auf der Altenwalder Höhe (38 m), die über den<br />
Geestrücken Hohe Lieth noch hinausragt, auch<br />
als Schifffahrtszeichen sowohl für die Wesermündung<br />
als auch die Zufahrt über einen Kanal<br />
nach Altenwalde, deutlich sichtbar. Im historischen<br />
Plan von Altenwalde sind nah beieinander<br />
drei Kreuze eingezeichnet: Das Kloster, die<br />
Kapelle sowie die Mühle.<br />
Archäologische Funde im Bereich Altenwalde,<br />
Lagerplätze aus der Hamburger Stufe<br />
(um 12.000 v. Chr.), Steingräber (1700 bis 700<br />
v. Chr.), die Altenwalder Silberschale (spätrömisch)<br />
und ein römischer Bronzeeimer vom<br />
Hemmoorer Typ bestätigen das hohe Alter des<br />
Ein Gemälde vom ehemaligen Amtshaus Lilienthal<br />
könnte als Erinnerung an das Klostergebäude<br />
dienen. Ein Klostergebäude wie in Hude<br />
vorzufinden … Dieser Gedanke ist auszuschließen.<br />
- Der Anblick des von Alten- nach Neuenwalde<br />
verlegten Klosters lässt eher einen Vergleich<br />
zu.<br />
Bodenuntersuchung<br />
Vor einigen Jahren führte Professor Thilo von<br />
Dobeneck (Uni Bremen) im Lilienthaler Amtsgarten<br />
eine geophysikalische Bodenuntersuchung<br />
durch, um mithilfe der Ergebnisse sagen<br />
zu können, ob dort noch Fundamente von<br />
Gebäuden oder Kreuzgängen nachzuweisen<br />
wären. Der Befund: Es konnten keine Fundamentreste<br />
gefunden werden! Die Vorstellung, in<br />
Trupe habe ein Klostergebäude gestanden, das<br />
mit der verbliebenen Ruine des Klosters Hude<br />
vergleichbar wäre, ist damit Vergangenheit. Hier<br />
gab es, vergleichbar mit dem Kloster Neuenwalde,<br />
ein Wohngebäude, wohl ähnlich dem auf<br />
dem Gemälde im <strong>Heimat</strong>verein Lilien-thal<br />
gezeigten Amtshaus mit dem noch vorhandenen<br />
Klosterkeller.<br />
Pilgerzeichen Neuenwalde<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
21
Das Mutterkloster<br />
In einem Buch über das Kloster Walberberg<br />
(nahe Köln) findet man unter dem Titel „Das<br />
Walberberger Tochterkloster Lilienthal“ auch<br />
folgende Aussage: Der damalige Bremer Erzbischof<br />
Gerhard II. (1219-1258) ließ demnach<br />
durch Boten und Briefe vier Nonnen aus Walberberg<br />
holen, um ein Kloster zu gründen. Diese<br />
Darstellung fällt in das Jahr 1230, zwei Jahre<br />
vor der bisher angenommenen Klostergründung<br />
...<br />
Straßennamen in Wollah<br />
Eine weitere interessante Fage bleibt: Wann<br />
wurden Straßen in Wollah in Anlehnung an das<br />
Kloster benannt? Nach 1969? ... Dann war der<br />
veröffentlichte Fehler aus der Chronik von<br />
Johann Renner der Anlass. Eine nachgewiesene<br />
Fundstelle für ein Klostergebäude dort ist nicht<br />
bekannt. - Abschließend darf man feststellen,<br />
dass das Auffinden dieser Stelle in der ältesten<br />
Bremer Chronik das Kloster Lilienthal in einem<br />
völlig neuen, ganz anderen Licht erscheinen<br />
lässt.<br />
Harald Steinmann<br />
Weitere Quellen:<br />
Chronica der Stadt Bremen, Johann Renner,<br />
1583; Urkundenbuch des Klosters Neuenwalde,<br />
Heinrich Rüther, 1905; Chronik von Altenwalde,<br />
Winfried Siefert, 1971; Cuxpedia: Altenwalde,<br />
<strong>2018</strong>; Pilgerzeichen: Focke Museum Bremen<br />
Straßenschild Mönchstr. / Klosterstr. in Wollah<br />
Köksch un Qualm – mehr als ein Museum<br />
Donnerstagsprogramm bietet für jeden etwas in der Stader Landstraße 46<br />
DO 05.04.18, 14.00 Uhr Anmeldung erbeten!<br />
Découpage – Verschönerung für Ihr Zuhause<br />
Découpage-Technik ist eine einfache und vielseitige<br />
Methode, um Wohnaccessoires z. B. Bilderrahmen,<br />
Blumentöpfe etc. zu dekorieren.<br />
Rita Wichmann führt Sie in die Technik ein.<br />
Bringen Sie kleine Gegenstände aus Holz,<br />
Pappe, Kunststoff, Glas oder Porzellan mit.<br />
(Kosten für weiteres Material je nach Aufwand.<br />
DO 12.04.18, 15.30 Uhr Anmeldung erbeten!<br />
Naturkosmetik aus dem Küchenschrank<br />
Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie Natron und<br />
andere kleine Helfer im Haushalt in die tägliche<br />
Körperpflege integrieren können. Pflegen Sie<br />
Ihr Gesicht, Körper, Zähne und Haar ohne<br />
künstliche Zusätze! Wir präsentieren Ihnen die<br />
Produkte und geben Hinweise für die Zubereitung<br />
und Anwendung.<br />
DO 19.04.18, 15.30 Uhr Anmeldung erbeten!<br />
Frühlingsküche mit würzigem Bärlauch<br />
Bärlauch ist ein weit verbreitetes und beliebtes<br />
Wildgemüse. Wir geben Ihnen ein paar Anregungen,<br />
wie Sie mit der Gewürz- und Heilpflanze<br />
Gerichte verfeinern können. Eine kleine<br />
Verköstigung der Anwendungsbeispiele rundet<br />
den Nachmittag ab.<br />
DO 26.04.18, 15.00 Uhr<br />
Mode aus dem Katalog – Textile Einblicke<br />
1903/04<br />
Das Kaufhaus Wertheim in Berlin war um 1900<br />
eines der größten Kaufhäuser in Europa und<br />
verkaufte seine Waren ergänzend durch Katalog-Werbung.<br />
Die Besucher sind an diesem Tag<br />
herzlich eingeladen, als Laien-Modell am neuen<br />
Katalog mitzuarbeiten. Bereits vorab vielen<br />
Dank dafür!<br />
DO 03.05.18, 15.30 Uhr Anmeldung erbeten!<br />
Streitbare Frauen!<br />
Betty Gleim – Schriftstellerin und Schulgründerin<br />
Ilsabetha Gleim (1781-1827), genannt<br />
Betty, widmete sich früh der Literatur und<br />
Pädagogik. Als pädagogische Autodidaktin<br />
eröffnete sie in Bremen eine Lehranstalt für<br />
Mädchen. Diese spannende Persönlichkeit und<br />
ihr fortschrittliches Denken möchten wir Ihnen<br />
heute näher bringen.<br />
DO 17.05.18, 15.30 Uhr Anmeldung erbeten!<br />
Gastgeber Sprache Festival <strong>2018</strong> -<br />
Kennen Sie Marga Berck?<br />
Richtig, sie ist die Verfasserin der Mädchenbriefe<br />
“Sommer in Lesmona”. Es gibt jedoch viel<br />
mehr in ihrem literarischen Schaffen zu entdecken!<br />
Christine Bongartz kommt als “Gesine<br />
von Katenkampp” und liest aus “Die goldene<br />
Wolke” sowie “Aus meiner Kinderzeit” und<br />
bringt Ihnen damit die Autorin ein bisschen<br />
näher.<br />
DO 24.05.18, 14.00 Uhr Anmeldung erbeten!<br />
Kartoffel- und Blütendruck<br />
Rita Wichmann stellt Ihnen die kreative Gestaltung<br />
von Papier und Stoff mit zwei simplen<br />
Drucktechniken vor. Erzielen Sie schöne Effekte<br />
dank des Einsatzes von Naturmaterialien, wie<br />
Kartoffeln, Blüten, Moos und Blättern. Bringen<br />
Sie kleine Gegenstände (Briefpapier, Packpapier,<br />
Kopfkissen, Geschirrhandtücher etc. ) mit.<br />
(Kosten für weiteres Material je nach Aufwand.)<br />
DO 31.05.18, 14 -17 Uhr Anmeldung erbeten!<br />
Köksch un Qualm – Zu Besuch im 19. Jahrhundert<br />
Weißnäherin Elsa, Waschfrau Emma und Meta<br />
die Köksch, erklären die mühevolle Hausarbeit<br />
um 1900. Herr Richtering, der Zigarrenfabrikant,<br />
präsentiert Ihnen das Zigarrenkabinett<br />
und im Salon werden selbst gebackene Waffeln<br />
mit heißen Kirschen und frischer Sahne serviert.<br />
DO 07.06.18, 15.00 Uhr<br />
Das Päckchen aus Amerika<br />
Was ist das nur für ein Stoff, den der Neffe der<br />
Familie Richtering 1907 aus Amerika schickte?<br />
Eine Stoffseite ist dunkelblau, die andere Seite<br />
fast weiß. Und hart ist dieser Stoff! Wie kann<br />
dieser ein hauswirtschaftliches Problem seiner<br />
Tante lösen? Und was haben die Richteringschen<br />
Zigarren damit zu tun? Fragen über Fragen,<br />
die an diesem Tag geklärt werden.<br />
DO 14.06.18, 15.30 Uhr Anmeldung erbeten!<br />
Lesumer Kulturtage <strong>2018</strong> –Das Glück liegt in<br />
der Ferne!<br />
Christine Bongartz liest als Gesine von Katenkampp<br />
aus Robinson Crusoe. Über ihn gibt es so<br />
viel mehr zu erfahren, als dass er jahrelang mit<br />
seinem treuen Begleiter Freitag auf einer einsamen<br />
Insel gelebt hat.<br />
DO 21.06.18, 14.00 Uhr Anmeldung erbeten!<br />
Spitzendeckchen kreativ einsetzen!<br />
Im Laufe des 19. Jahrhunderts haben sich<br />
diverse edle Stoffarten entwickelt. Darunter<br />
finden sich Häkel-, Tüll-, Klöppel- oder Applikationsspitzen.<br />
Heute erhalten Sie nicht nur<br />
historische Informationen über diese edlen Textilien,<br />
sondern lernen, wie sie mit den feinen<br />
Mustern aus durchbrochenem Stoff und Ton<br />
kleine Alltagsgegenstände wie Seifenablagen,<br />
Brettchen, Schälchen etc. dekorativ gestalten.<br />
(Kosten für Material je nach Aufwand.)<br />
DO 28.06.18, 14 – 17 Uhr<br />
Zu Besuch im 19. Jahrhundert – Ferienspezial<br />
Erwachsene und Kinder können unseren fleißigen<br />
Waschfrauen zur Hand gehen und ausprobieren<br />
wie früher gewaschen wurde: Wäschestampfen,<br />
mit dem Waschbrett schrubben und<br />
die große Wringe kurbeln. Zur Belohnung gibt<br />
es selbst hergestellte Seife.<br />
Anmeldung unter:<br />
Telefon 0421 636958-66 oder<br />
E-Mail zigarrenfabrik@brasbremen.de<br />
www.koeksch-un-qualm.de<br />
22 RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
Die Osterholzer Ziegelei<br />
Wie der Betrieb funktioniert haben könnte (I)<br />
Ausschnitt aus der Karte „Plan von…Osterholtz…1756“; NLA Stade,<br />
Karten Neu Nr. 12929<br />
Nachdem Ende 1730 erste Vorschläge zur<br />
Errichtung einer Ziegelei nahe dem damaligen<br />
Flecken Osterholz durch den Drost von Schwanewede<br />
gemeinsam mit dem Amtschreiber<br />
Anton Friedrich Meiners der Kammer in Hannover<br />
unterbreitet worden waren, wurden im<br />
Laufe des Jahres 1731 diverse Fragen aufgeworfen<br />
und beantwortet, sodass am Ende dieses<br />
Jahres Zustimmung aus Hannover signalisiert<br />
wurde und die Inbetriebnahme als Herrschaftliche<br />
Ziegelei wohl bereits im Jahre 1732 erfolgen<br />
konnte.<br />
Eine erste kartografische Bestandsaufnahme<br />
ist erfolgt, indem durch F. v. Haerlem 1749 das<br />
Gelände kartiert wurde. 1) Jürgen Christian Findorff<br />
hat dann 1756 ganz Osterholz kartiert,<br />
inklusive der damals schon über 20 Jahre bestehenden<br />
und damit am Ende der vereinbarten<br />
Pachtdauer befindlichen Ziegelei. 2)<br />
Inwieweit sich dabei gegenüber der Ausgangssituation<br />
in den verflossenen Jahren Veränderungen<br />
ergeben haben, soll anhand der<br />
Quellentexte erörtert werden. Diese legen nahe,<br />
dass die ersten Anlagen etwas bescheidenere<br />
Dimensionen hatten, aber mit wirtschaftlichem<br />
Erfolg dann zu dem weitläufigen Ensemble<br />
angewachsen sind, wie es sich zu Findorffs Zeiten<br />
präsentierte und das sich mit Sicherheit von<br />
sonst in Gebrauch befindlichen Betrieben zur<br />
Ziegelherstellung deutlich abhob.<br />
Eine erste Beschreibung liegt vor aus dem<br />
Jahre 1733 und wurde am 4. März aus Osterholz<br />
„unterthänigst“ an die Herrschaft gesandt. 3)<br />
Die zeichnerische Darstellung ist nicht mehr<br />
vorhanden, nur noch die Legende zum „Grundriss<br />
der zu Osterholtz angelegten Ziegelbrennerey“<br />
liegt dem Schreiben bei. Darin werden drei<br />
Gebäudekomplexe genannt: „1. die pfannen<br />
Hütte, 2. Hütten zum Stein streichen, 3. der<br />
Brennofen vor Mauer Steine“.<br />
Daraus lässt sich folgern, dass nach anfänglicher<br />
Beschränkung auf die Produktion von<br />
Mauersteinen sehr bald auch mit der Pfannenherstellung<br />
begonnen wurde. Unterpunkte lassen<br />
Schlussfolgerungen auf den Produktionsprozess<br />
zu.<br />
Um die Steine herzustellen, wurde Ton in<br />
einen Behälter, eine Kumpe, gefahren und dort<br />
– unter Zugabe von Wasser – von Pferden getreten.<br />
Daraus wurden dann Steine geformt und<br />
vorgetrocknet (aus Nr. 2). Im Umfeld des Ofens<br />
befanden sich ein Raum zur Lagerung der Rohlinge<br />
sowie ein weiterer für den erforderlichen<br />
Torf. Auch die Arbeitskräfte waren hier untergebracht;<br />
je „eine Cammer vor die Ziegel Knechte“<br />
und „vor den Brandmeister“ sind vermerkt. Ferner<br />
wurden die benötigten Gerätschaften in<br />
„zwey Cammern“ hier verwahrt (aus Nr. 3).<br />
Vieles in der Pfannenhütte (Nr. 1) war ähnlich;<br />
eine Besonderheit bildete eine „Kleymühle“,<br />
in der mit Hilfe eines Pferdes das<br />
Rohmaterial (der Kley) gemahlen und in eine<br />
gleichmäßige Konsistenz gebracht werden<br />
sollte. Hierzu findet sich eine Beschreibung im<br />
Umfang von 10 Punkten, die zur Erläuterung<br />
der Konstruktion dienen sollte. Dazu wurde –<br />
wie es im Brief heißt – ein „Modell von der<br />
Kleymühle“ im Maßstab 1 : 12 mit übersandt.<br />
Die detaillierte Erläuterung lässt den Schluss zu,<br />
dass es sich bei der Mühle um eine ganz spezielle,<br />
vielleicht besonders fortschrittliche Anlage<br />
gehandelt hat.<br />
Special-Plan der Herrschafftl. Ziegelei zu Osterholtz; NLA Stade,<br />
Karten Neu Nr. 13061, Tab. VI<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
Standort der Betriebsstätte<br />
Für die Ziegelei hatte man einen Standort<br />
ausgewählt, der im Übergangsbereich von der<br />
dort niedrigen Geest zur Hammeniederung eine<br />
weitgehend ebene Fläche bot. Diese lag südlich<br />
23
ewilligt wurde. Der Abbau muss also über viele<br />
Jahrzehnte und mindestens bis in die 1780er-<br />
Jahre hinein stattgefunden haben; die Örtlichkeit<br />
ist jedoch unbekannt. Auch in der kürzlich<br />
erschienenen Chronik von Lintel findet sich kein<br />
Hinweis hierauf.<br />
Die Gebäude und<br />
ihre Funktion<br />
Trete-Diehle; aus: NLA Stade, Karten Neu Nr. 13061, Tab VII. Nr. G<br />
des Fleckens Osterholz und war bis dahin unbewohnt.<br />
Wege nach Osterholz, Scharmbeck, Bremen<br />
und in Richtung Hamme kreuzten sich dort; so<br />
war eine Verbindung auf dem Landweg gegeben.<br />
Ein bei Findorff bereits vorhandener Kanal<br />
zur Hamme stellte einen Wasserweg dar, der im<br />
Zusammenhang mit der Gründung der Ziegelei<br />
geschaffen bzw. ausgebaut worden war. Durch<br />
die Schiffgräben waren große Flächen erschlossen;<br />
dadurch war die Belieferung mit Brenntorf<br />
per Schiff sichergestellt.<br />
Nicht weit entfernt befanden sich im Klosterholz<br />
gut erreichbare Ton- und Lehmvorkommen,<br />
die für den Betrieb leicht verfügbar, weil<br />
in herrschaftlichem Besitz, waren. 4)<br />
Aus den Erörterungen hinsichtlich der<br />
Errichtung der Ziegelei war jedoch zu entnehmen,<br />
dass die Tonvorkommen im Klosterholz<br />
zwar gut geeignet erschienen für die Herstellung<br />
von Mauersteinen, für Dachpfannen<br />
jedoch zu sehr von gröberem Material, also<br />
24<br />
kleineren und größeren Steinen, durchsetzt<br />
seien. Hier musste eine anderweitige Quelle<br />
gefunden und erschlossen werden. Erstmals<br />
erfahren wir hierüber durch eine Urkunde des<br />
„Commissario“ Conrad Friedrich Meiners,<br />
unterzeichnet am 29. April 1746 in Lilienthal. 5)<br />
Diese verweist darauf, dass bereits in „vorigen<br />
Zeiten“ aus der „Gemeinheit zwischen Scharmbeck<br />
und Lintel“ der für die „Osterholtzische<br />
Ziegeley erforderliche Pfannen leim“ gegraben<br />
wurde, wobei dieser Kontrakt für das laufende<br />
Jahr verlängert werden sollte mit der Zusage,<br />
dass alle durch den Abbau entstehenden Kuhlen<br />
beseitigt und das Gelände nachträglich wieder<br />
eingeebnet werden solle. Als (Mit-)Erbe der<br />
Ziegelei wolle Obiger sich gütlich mit den Eingesessenen<br />
vergleichen.<br />
Der Akte kann man weiterhin entnehmen,<br />
dass sich jedoch Ende der 1770er-Jahre Widerstand<br />
seitens der Linteler Bauern regte, jedoch<br />
durch Entscheid Hannovers jegliche Ansprüche<br />
abgewiesen und das Lehmgraben weiterhin<br />
Der Ziegelknechte Wohnung in der sog. Jungfern Bude; in: NLA Stade, Karten Neu Nr. 13061,<br />
Tab. VII. Nr. A<br />
Die ambitionierte Planung zielte von Anfang<br />
an darauf, sowohl Ziegelsteine als auch Dachpfannen<br />
herzustellen. Das hatte Auswirkungen<br />
auf die zu errichtenden Gebäude. Da die Produktionsverfahren<br />
voneinander verschieden<br />
sind, mussten die Produktionsstätten entsprechend<br />
den Anforderungen konzipiert werden.<br />
Der o. g. Gebäudebestand deckt sich noch<br />
nicht mit den Aussagen der Karten. Innerhalb<br />
der Akte 6) befindet sich jedoch noch eine ausführliche<br />
Erläuterung auf 15 handgeschriebenen<br />
Seiten mit dem Titel „Umbständliche<br />
beschreibung der zu Osterholtz angelegten Ziegelbrennerey“.<br />
Leider ist dieser Text ohne Verfasserangabe<br />
und ohne Datum hinterlegt, sodass<br />
eine Zuordnung nicht eindeutig möglich ist.<br />
Zeitlich dürfte die Beschreibung näher an die<br />
Karten heranrücken. Auch hierin wird auf Risse<br />
verwiesen, die aber ebenfalls nicht vorliegen.<br />
Dass Veränderungen vorgenommen worden<br />
sind, ist auch der Karte von v. Haerlem zu entnehmen.<br />
Ganz am Rande ist ein alter eingefallener<br />
Brennofen (G) verzeichnet; dieser ist<br />
durch neue ersetzt (J und K).<br />
Im o. g. Text wird einleitend auf die Kapazitäten<br />
hingewiesen: pro Jahr können 300 000<br />
große Mauersteine und 200 000 Dachpfannen<br />
geformt und gebrannt werden; die fertigen<br />
Steine haben ein Sollmaß von 1 Fuß x 5 ⅞ Zoll<br />
x 3 ¼ Zoll (ca. 28,7 x 14 x 7,8 cm), die Pfannen<br />
von 1 ½ Fuß Länge und 1 Fuß Breite.<br />
Eine Hütte dient zum Vorbereiten von 24 000<br />
Steinen. Man erfährt, dass diese zunächst<br />
gestrichen und dann 8 Tage „gestrecket liegen,<br />
bevor sie auffgeringelt und zu fernern trocken<br />
in hagen auffgesetzet werden können“. Erst<br />
dann können sie gebrannt werden, wozu ein<br />
Ofen dient, der im Lichten 16 Fuß breit, 21 Fuß<br />
lang und 17 Fuß hoch ist und dabei 4 Fuß dicke<br />
Mauern hat. 30 000 Steine können hierin auf<br />
einmal gebrannt werden, wozu Torf dient, der<br />
direkt vor den Öfen in separaten Hütten trocken<br />
lagert.<br />
Für die Pfannenherstellung gibt es entsprechende<br />
Gebäude; der Ofen hat jedoch eine<br />
andere Form und kann 10 000 Pfannen aufnehmen.<br />
Unterschiedlich sind auch die benötigten<br />
Gerätschaften, wobei beim Pfannenwerk wieder<br />
der Einsatz der Kleymühle besonders hervorgehoben<br />
und diese bis ins Detail im Aufbau<br />
und in ihrer Funktion beschrieben wird. Und<br />
wieder findet sich ein Hinweis auf ein mitgeliefertes<br />
Modell.<br />
Wirft man einen Blick auf die vom Conducteur<br />
Findorff kartierte Anlage (s. S. 23) , so fällt<br />
die Vielzahl der Gebäude auf. 7) Im Zentrum stehen<br />
zwei Öfen, ein größerer und ein kleinerer<br />
(als Anbauten zu E), in denen Mauersteine<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
Profil durch den großen Ofen (c), Grundrisse des<br />
großen (a) und kleinen (b) Brandt-Ofens; aus:<br />
NLA Stade, Karten Neu Nr. 13061, Tab. VII. Nr. B<br />
gebrannt werden konnten, die in benachbarten<br />
Gebäuden geformt und vorbereitet wurden. Der<br />
benötigte Brenntorf konnte mit wenig Aufwand<br />
aus dem „Torff-Schauer“ (F) herangeschafft<br />
werden.<br />
Vorbereitet wurde der Ton in der Trete Deehle<br />
(K); auf überdachter Fläche wurde er hier ggf.<br />
angefeuchtet und dann von Pferden getreten,<br />
um eine gleichmäßige, geschmeidige Masse zu<br />
erhalten, die sich gut formen lassen sollte. Zwei<br />
Flächen gab es mit je einem Pferd. Das<br />
benötigte Wasser konnte aus dem nahen Bach<br />
entnommen und hierher geleitet werden.<br />
Diesem am nächsten erstreckt sich auf 260<br />
Fuß Länge und 28 Fuß Breite die Bek Hütte<br />
(auch Bach Hütte genannt). Da diese auch am<br />
nächsten zum Tonvorkommen gelegen ist, lässt<br />
sich hier dessen Anlieferung vermuten. Dann<br />
käme die Jungfern Bude (B) für die Formung<br />
und erste Trocknung der Ziegel in Frage, bevor<br />
sie zur weiteren Trocknung in die Pferde-Hütte<br />
(E) verbracht werden. Diese Funktion wird auch<br />
durch die Bezeichnung „Trocken Stein Hütte“<br />
nahe gelegt. Von dort ist es nur noch ein kurzer<br />
Weg in den großen oder kleinen Brandt-Ofen (c<br />
bzw. d).<br />
In einem Anbau an die Jungfern Bude (B) ist<br />
eine Wohnung für die Ziegelknechte untergebracht,<br />
die also direkt auf dem Betriebsgelände<br />
gewohnt haben. Was man aus der Zeichnung<br />
allerdings herauslesen kann, deutet doch auf<br />
eine Gruppenunterkunft mit sehr spartanischer<br />
Ausstattung hin.<br />
Herstellung der Rohziegel<br />
Ein separater Punkt in der „Umbständlichen<br />
beschreibung“ befasst sich speziell mit den<br />
Arbeiten im „Steinwerck“, da diese sich gegenüber<br />
anderen Ziegeleien unterschieden. Fasst<br />
man diese Beschreibung mit den Kartenbefunden<br />
und anderen Hinweisen 8) zusammen, so<br />
lässt sich folgender Arbeitsablauf für die Herstellung<br />
der Rohlinge konstruieren. Dabei waren<br />
einige Arbeitsgänge erforderlich, die arbeitsteilig<br />
zu absolvieren waren.<br />
1) Die Lehmgrube befand sich im Klosterholz.<br />
Hier wurde ggf. bereits im Vorjahr der Lehm<br />
vorbereitet und im Winter der Witterung<br />
ausgesetzt, um dessen Struktur zu verbessern.<br />
2) Die ersten drei Tage einer Woche dienten<br />
dazu, Lehm für 12 000 Steine zuzubereiten.<br />
Dazu mussten zwei Lehmmacher täglich 40<br />
Karren Ton graben. Sie bereiteten vor Ort den<br />
Rohstoff zu, damit er weich, gut formbar und<br />
von gleichmäßiger Qualität war. Zu „fetter“<br />
Lehm wurde mit Sand versetzt.<br />
3) Zwei Aufkarrer „fahren solchen an in die<br />
nahe bey der Hütten befindliche Kumpe“, wo<br />
er ggf. mit Wasser aus dem Bach angefeuchtet<br />
wurde.<br />
4) Zur Durchmischung bediente man sich auf<br />
einer speziellen Diele der Hilfe von zwei Pferden,<br />
die den Ton so lange treten mussten, bis<br />
dieser so fein und zäh geworden ist, dass<br />
Mauersteine daraus gestrichen werden<br />
konnten.<br />
5) Danach wurde „die zubereitete Erde aus dem<br />
Kumpen wieder in die Karren geschlagen“<br />
und in die Streichhütte gefahren.<br />
6) In Form gebracht wurde der Lehm dann in<br />
den drei restlichen Tagen der Arbeitswoche<br />
durch den Ziegelstreicher. Nachdem der Einschlager<br />
die Masse in vorbereitete Rahmen<br />
aus Holz geschlagen hatte, konnte der Streicher<br />
oder Former diese dann mit einem<br />
Streichbrett glätten. Bei dieser im Akkord<br />
verrichteten Tätigkeit erhielt der Lehm dann<br />
die gewünschte Form; in der Regel war es der<br />
Quader, aber auch andere Formen waren<br />
möglich.<br />
7) Im nächsten Arbeitsschritt war es dann der<br />
Abträger, der die gefüllten Formen zu einem<br />
Trockenplatz trug. Dort konnten die Formen<br />
dann abgezogen und zum Ziegelstreicher<br />
zurückgebracht werden.<br />
8) Nach einigen Tagen der Trocknung trat dann<br />
der Ziegler (Hagensetzer) in Aktion und stapelte<br />
die vorgetrockneten Rohlinge so, dass<br />
sie dann für 2 – 3 Wochen weiter trocknen<br />
konnten. Dabei verloren diese außer an<br />
Masse auch an Volumen, was im Vorfeld bei<br />
der Bemessung der Formen zu berücksichtigen<br />
war.<br />
Anmerkungen<br />
Wilhelm Berger<br />
1) Siehe HRB Nr. 122, S. 6.<br />
2) Zur Errichtung der Ziegelei und zu vertraglichen<br />
Regelungen s. HRB Nr. 123, S. 10 – 12.<br />
3) NLA Stade, Rep. 74 Osterholz Nr. 799<br />
4) Hans Siewert, Der Wandel von einer Tongrube<br />
zum Osterholzer Waldstadion; in: HRB Nr.<br />
3/2009, S. 21<br />
5) NLA Stade, Rep. 74 Osterholz Nr. 800. C. F.<br />
Meiners war Sohn von A. F. Meiners und seit<br />
1744 Amtschreiber und Kommissarius in Lilienthal.<br />
1744 war sein Vater gestorben, dessen<br />
Erbe er antrat. Dazu gehörte auch die<br />
Osterholzer Ziegelei. Drost in Osterholz war<br />
damals B. C. von Gruben. (Angaben von H.-C.<br />
Sarnighausen: Amtsjuristen…; in: Genealogie<br />
1/2015, S. 373 – 376)<br />
6) NLA Stade, Rep. 74 Osterholz Nr. 799<br />
7) NLA Stade, Karten Neu Nr. 13061, Tab. VI und<br />
VII. Die Gebäudestruktur deckt sich mit der<br />
im HRB Nr. 123, S. 10, veröffentlichten Darstellung.<br />
8) Die Ausführungen basieren u. a. auf:<br />
http//wiki-de.genealogy.net/Ziegler_(Beruf)<br />
April<br />
Der April kann rasen,<br />
nur der Mai halt Maßen.<br />
Ist die Krähe nicht mehr weit,<br />
wird‘s zum Säen höchste Zeit.<br />
Bauernregeln<br />
April – Mai – Juni<br />
Mai<br />
Donnert‘s im Mai viel,<br />
haben die Bauern leichtes Spiel.<br />
Der Mai, zum Wonnemonat erkoren,<br />
hat den Reif noch hinter den Ohren.<br />
Juni<br />
Was im September soll geraten,<br />
das muss bereits im Juni braten.<br />
Wenn im Juni wechseln Regen und Sonnenschein,<br />
wird die Ernte reichlich sein.<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
25
„Im Nebel der Vergangenheit“<br />
Das Rätsel um die Entstehung der dörflichen Ansiedlung „Neuenkirchen“ am östlichen Geestrand der Weser<br />
Das Kirchdorf Neuenkirchen liegt am Ostufer<br />
der Unterweser (Niederweser), etwa auf halber<br />
Strecke zwischen Bremen-Mitte und Bremerhaven.<br />
Heute ist es verwaltungsmäßig ein Ortsteil<br />
von Schwanewede, Kreis Osterholz, Land<br />
Niedersachsen, und schließt unmittelbar am<br />
nördlichen Rand des Landes Bremen an,<br />
genauer an dessen Ortsteil Farge-Rekum.<br />
Das Kirchspiel und das Gericht Neuenkirchen<br />
entstanden nach den historischen Überlieferungen<br />
„als Erzbischof Liemar im Jahre 1071<br />
seinen treuen Vasallen des Adelsgeschlechtes<br />
„von Stelle“ das Kirchspiel mit Ländereien<br />
und Landgütern beschenkte und später 1080<br />
auch die Gerichtsbarkeit für dieses Kirchspiel<br />
übertrug“, so berichtet zumindest die Historie<br />
des heutigen Ortes.<br />
Doch können diese überlieferten Daten auch<br />
das Gründungsdatum des Ortes sein, wie kann<br />
man einem Gefolgsmann die Herrschaft über<br />
ein Gebiet schenken, welches noch nicht existiert?<br />
Dann könnte es ja nur unbewohntes<br />
Ödland gewesen sein. Also muss das Dorf, vielleicht<br />
auch ein kirchlicher Andachtsraum,<br />
früher entstanden sein!<br />
Das Adelsgeschlecht derer „von Stelle“ residierte<br />
auf einem schlossähnlichen Gutshof am<br />
Ortsausgang Neuenkirchen nach Rade. Im Jahr<br />
1791 brannte der Gutshof ab und wurde nie<br />
wieder aufgebaut, nur das Vorwerk „Steller<br />
Bruch“, welches als Meierhof zum Steller Gut<br />
gehörte, erinnert heute noch daran.<br />
Peschel 1974, Hochwasserwarnanlage<br />
Gehen wir einmal in der Geschichte zurück,<br />
Anno 780 weist „Karl der Große“ dem angelsächsischen<br />
Priester Willehad den Gau Wigmodien<br />
als Missionsgebiet zu und er begann alsbald<br />
darauf die Sachsen als Bewohner zu christianisieren.<br />
Nach der Überlieferung wirkte Erzbischof<br />
Liemar sehr viel später, vom Jahre 1072<br />
bis 1101, vor ihm wirkten an seiner Stelle bereits<br />
von 1035 – 1043 Adalbrand (auch: Bezelin,<br />
Alebrand) und danach von 1043 – 1072 Adalbert<br />
I., Pfalzgraf von Sachsen, als Erzbischöfe des<br />
Erzbistums Hamburg-Bremen. Noch vor der<br />
Schenkung Anno 1071 vermuten wir die Gründung<br />
und Entstehung des Dorfes Neuenkirchen,<br />
als Erzbischof Liemar hiernach noch gar nicht<br />
im Amte war.<br />
Die alten Stedinger Lande - Copyright v. Wersebe 1815<br />
Der „Bremisch Verdische Rittersahl“, von Luneberg<br />
Mushard, berichtet 1720 (p508), dass den<br />
„von Stelle zum Stellerbroke“ im Jahre Christi<br />
1080 das Gericht zu Neuenkirchen an der<br />
Weser gegeben wurde. Das Wirken der adligen<br />
Herren von Stelle wurde ausgiebig in der Chronik<br />
der St. Michaels-Kirche zu Neuenkirchen<br />
von Karl Heinz Berendt beschrieben. Aber es<br />
gab noch einen Adligen, der als Stadtvogt von<br />
Bremen sicherlich einen Einfluss auf die<br />
Geschehnisse um Neuenkirchen hätte haben<br />
können, nämlich „Adolf von Neuenkirchen“!<br />
Doch konnte er der Begründer und Namensgeber<br />
sein? Nein, er trat sehr viel später mit Heinrich<br />
dem Löwen in Erscheinung.<br />
Adolf von Neuenkirchen entstammte dem<br />
Hause der Grafen von Ricklingen (Hannover). Da<br />
er an den Gütern der Grafenfamilie nicht erbberechtigt<br />
war, wird angenommen, ein Halbbruder<br />
oder Stiefkind gewesen zu sein und war<br />
als Gefolgsmann des „Heinrich der Löwe“ im<br />
Raum Goslar ansässig. 1153 wurde Adolf von<br />
Neuenkirchen mit der Vogtei zu Bremen von<br />
Welfenherzog „Heinrich dem Löwen“ betraut<br />
(Urkunde Heinr.d.Löwe 21). Nach dieser<br />
Urkunde hat sich Adolf von Neuenkirchen nach<br />
Neuenkirchen in Osterstade genannt, was<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
Jade Weser - Wikimedia Commons<br />
jedoch äußerst angezweifelt werden darf. In der<br />
Bürgerweideurkunde v. 1159 wird a. v. Neuenkirchen<br />
„advocatus civitatis“, also Stadtvogt<br />
genannt. Landvergabe in Stedingen, Besitz in<br />
Hiddigwarden, Wersabe und Buren (Hasenbüren)<br />
(Hofmeister / Röpcke 1987, 24f, 65, 232).<br />
Im Buch „Über die Niederländischen Colonien<br />
welche im nördlichen Teutschlande…“<br />
schreibt August von Wersebe, königlich Großbritannisch-Hannoverschem<br />
Landrosten und<br />
Randrathe, Assessor des Bremen und Verdenschen<br />
Hofgerichts, Erb- und Gerichtsherrn zum<br />
Meienburg, im Jahre 1815 über Adolf von Neuenkirchen<br />
und seiner Beziehung zum Erzbischof:<br />
„Bey der hieraus anscheinenden Connexion<br />
dieses Adolf von Neuenkirchen mit dem Vorgänger<br />
des Erzbischofs lässt es sich um so eher erklären,<br />
dass demselben hier die Qualität eines „advocati<br />
civitatis Bremensis“ beygelegt wird, wiewohl dieser<br />
Umstand sonst beym ersten Anblicke befremdet<br />
scheint, da es ausserdem kein Beyspiel davon<br />
gibt, dass dieser Adolf eine Advocatie in Bremen<br />
bekleidet hätte“….<br />
Verlassen wir hier den Adel und wenden uns<br />
anderen Quellen und Möglichkeiten für die<br />
Datierung einer Ortsgründung zu. Der „Blanke<br />
Hans“, wie die verheerenden Sturmfluten seit<br />
alters schon von den heidnischen Bewohnern<br />
dieses Landstriches genannt werden, wird nach<br />
meiner Vermutung seine Hände im Spiel um die<br />
Orts-Gründung gehabt haben. Ich denke dabei<br />
an eine Sturmflut, die vor 1071 stattgefunden<br />
haben muss, denn die Julianenflut fand erst viel<br />
später am 17. Februar 1164 statt. Da war aber<br />
Neuenkirchen längst gegründet. Damals, vor<br />
1071, werden die von der Flut vertriebenen Bauern<br />
an den rettenden Geestrand geflüchtet sein<br />
und hier auf sicherem Boden ihre „Neue Kirche“<br />
errichtet haben. Daraus wurde dann mundartlich<br />
Nienkarken und später auf Hochdeutsch<br />
„Neuenkirchen“.<br />
Vor tausend Jahren war noch der gesamte<br />
heutige Jadebusen von einem großen Moorgebiet<br />
bedeckt, das sich im Westen bis an den<br />
Geestrand erstreckte und im Osten bis an den<br />
hohen Marschrücken des Stadlandes reichte.<br />
Zwei Ströme waren Nebenarme der Weser,<br />
nördlich die „Dornebbe“ und südlich die<br />
„Wester Weser oder Line“ genannt, durchzogen<br />
das moorige Land von der „Friesischen Balje“<br />
zur Weser hin und führten nahe Brake und Elsfleth<br />
von dort in westlicher Richtung zur See“.<br />
Den Nachweis dazu liefern Reste der alten Wurten<br />
und deichähnliche Aufschüttungen die entlang<br />
dieses Urstromtales von den Deichverbänden<br />
gefunden und untersucht wurden.<br />
Die frühere Gründung Neunkirchens scheint<br />
auch durch die Tatsache eines eichenen Holzfundes<br />
recht gut belegt zu sein, der von Hans-<br />
Jörg Baake im Gemäuer des Kirchturmes der<br />
Michaeliskirche in etwa 8 Meter Höhe gefunden<br />
wurde. Von den „<strong>Heimat</strong>freunden Neuenkirchen<br />
e.V.“, durch Herrn Baake, wurde eine<br />
Holzprobe 2013 zur Altersdatierung (Probe KIA<br />
48074) an die Christian-Albrecht-Universität in<br />
Kiel, an das Leibniz-Labor für Altersbestimmung<br />
gegeben, die das Radiokarbonalter auf<br />
915 ± 20 Jahre datierte, woraus sich das Jahr der<br />
Fällung zum Bauholz auf 1078-1098-1118<br />
ableiten lässt. Der untere Teil des heutigen<br />
Kirchturms war auf Grund seiner Bauart gewiss<br />
ein viel älterer mächtiger Aussichts- und Wehrturm<br />
gegen die in jener Zeit immer wieder einfallenden<br />
Wikinger. Die bisherige Vermutung<br />
war, dass das gefundene Holzstück ein vergessenes<br />
Teil einer Pfette eines Daches und bei der<br />
Erhöhung für einen Kapellenraum im Mauerwerk<br />
übersehen wurde. Das gefundene Eichenholzstück<br />
ist aber nach dem Ergebnis eher kein<br />
vergessenes Teil eines alten Daches, sondern<br />
gehörte als Stück Bauholz, dessen Zweck unbekannt<br />
bleibt, in die Zeit der Aufstockung. Der<br />
erste sichere Versammlungsraum für kirchliche<br />
Zwecke ist damit auf die Jahre zwischen 1078-<br />
1118 anzunehmen und liegt damit nahe am Jahr<br />
1080, der Zeit, in der Neuenkirchen bereits zum<br />
Gerichtsort – nicht aber in die Zeit, als Neuenkirchen<br />
zum Kirchdorf erhoben wurde, wie im<br />
„Bremisch Verdische Rittersahl“ genannt wird.<br />
Das Ereignis, an dem Erzbischof Liemar das<br />
Gebiet um Neuenkirchen an die adeligen Ritter<br />
„von Stelle“ verschenkt haben soll, fand schon<br />
vorher statt, bevor Liemar Erzbischof wurde.<br />
Der erste kirchliche Raum im Turm dürfte den<br />
Beginn des Kirchdorfes und Kirchspiels kennzeichnen,<br />
Neuenkirchen oder Nienkarken war<br />
geboren.<br />
Hans-Jörg Baake, Neuenkirchen<br />
& Herbert A. Peschel, Aumund-Fähr<br />
Verwendete Quellen:<br />
<strong>2018</strong>, Ergebnisse eigener Recherchen in diversen<br />
Quelle durch H.-J. Baake und Herbert A.<br />
Peschel.<br />
1997, „Beiträge zur Geschichte der Ev.-ref. Kirchengemeinde<br />
Neuenkirchen“ herausgegeben<br />
vom Kirchenrat der Ev.-ref. Kirchengemeinde<br />
Neuenkirchen.<br />
1720, „Bremisch Verdische Rittersahl“ von Luneberg<br />
Mushard (p508).<br />
1815, „Ueber die Niederländischen Colonien,<br />
welche im nördlichen Teutschlande im zwöften<br />
Jahrhunderte gestiftet worden, und weitere<br />
Nachforschungen“ von August von Wersebe,<br />
königlich Großbritannisch-Hannoverschem<br />
Landrosten und Randrathe, Assessor des Bremen<br />
und Verdenschen Hofgerichts, Erb- und<br />
Gerichtsherrn zum Meienburg.<br />
2013, „Datierungsbericht KIA 48074“ zur<br />
Altersbestimmung des Leibnitz Labor für<br />
Altersbestimmung und Isotopenforschung der<br />
Christian Albrecht Universität Kiel.<br />
2015, „Ritter und Knappen zwischen Weser und<br />
Elbe“. Die Ministerialität des Erzstifts Bremen,<br />
von Hans G. Trüper.<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
27
Worphüser Heimotfrünn<br />
Bericht von der Jahreshauptversammlung am 16. Februar <strong>2018</strong><br />
Hinrich Tietjen zum Ehrenvorsitzenden<br />
und Helmut Meyer<br />
zum Ehrenkassenwart ernannt<br />
- Wahlen zum<br />
Vorstand<br />
Ehrenmitglieder<br />
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der<br />
Worphüser Heimotfrünn war geprägt von einem<br />
würdigen Abschied der langjährigen Vorstandsmitglieder<br />
Helmut Meyer und Hinrich Tietjen.<br />
Beide gehörten seit Gründung des Vereins am 8.<br />
Mai 1977 ununterbrochen dem Vorstand an.<br />
Wie der neue Vorsitzende Axel Miesner im Rückblick<br />
feststellte, startete Hinrich Tietjen<br />
zunächst als Schriftführer und übernahm am 8.<br />
September 1987 nach Einweihung des Bauernhauses<br />
und damit offizieller Eröffnung des Lilienhofes<br />
von Gustav Geffken den Vorsitz bei den<br />
Heimotfrünn. Als Dank und Anerkennung für<br />
seine bereits damals langjährige Vorstandsarbeit<br />
wurde Hinrich Tietjen 2006 das Niedersächsische<br />
Verdienstkreuz ausgehändigt. Helmut<br />
Meyer und Hinrich Tietjen wurde 2007 für<br />
ihre damals 30-jährige Arbeit im Vorstand der<br />
Worphüser Heimotfrünn durch die Gemeinde<br />
die Ehrennadel verliehen. Beide haben sich um<br />
den Verein auf dem Lilienhof mehr als verdient<br />
gemacht. Mit ihnen wurde der Lilienhof, was er<br />
heute ist. Ein Filetstück in Worphausen und ein<br />
Schmuckstück in der Gemeinde Lilienthal. Der<br />
Verein ist zu mehr als Dank verpflichtet, so Axel<br />
Miesner. Ein Dank gilt in diesem Zusammenhang<br />
auch den Ehefrauen, die ihre Männer<br />
unterstützt haben. Als Dank und Anerkennung<br />
für die 40-jährige Tätigkeit wurde Hinrich Tietjen<br />
zum Ehrenvorsitzenden und Helmut Meyer<br />
zum Ehrenkassenwart ernannt. Beide gehören<br />
weiter unserem Vorstand an, können ihre Erfahrungen<br />
einbringen und stehen dem neuen Vorstand<br />
weiter mit Rat und Tat zur Seite.<br />
Bürgermeister Kristian Tangermann bedankte<br />
sich bei allen Aktiven im Verein für ihre<br />
ehrenamtliche Tätigkeit auf dem Lilienhof.<br />
Allen Mitgliedern und Gästen würden immer<br />
sehr schöne Veranstaltungen geboten. Gegenüber<br />
Helmut Meyer und Hinrich Tietjen brachte<br />
der Bürgermeister zum Ausdruck, dass es in der<br />
heutigen Zeit schon fast einmalig sei, dass sich<br />
Bürger vierzig Jahre aktiv in die Vorstandsarbeit<br />
einbringen. Auch er bedankte sich bei den beiden<br />
Ehrenvorstandsmitgliedern für die enorme<br />
Arbeit, die sie geleistet haben.<br />
Zum neuen Vorsitzenden der Worphüser Heimotfrünn<br />
wurde der bisherige stellvertretende<br />
Vorsitzende Axel Miesner gewählt. Stellvertretender<br />
Vorsitzender ist zukünftig Peter Brünjes,<br />
Schriftführerin bleibt Birgit Reiß, ihre Stellvertreterin<br />
wurde Heike Brüning. Neue Kassenwartin<br />
wurde die bisherige stellvertretende Kassenwartin<br />
Sonja Brüggemann und ihre Stellvertreterin<br />
wurde Elke Geffken-Dreier.<br />
Als Delegierte für den Ortsjugendring Lilienthal<br />
wurde Andrea Schwarz gewählt. Miriam<br />
Holz wurde für 2 Jahre zur Kassenprüferin<br />
gewählt, die dieses Amt mit Hendrik Grotheer<br />
ausübt. Anschließend wurden langjährige Mitglieder<br />
für ihre 40- jährige bzw. 25-jährige Vereinszugehörigkeit<br />
geehrt. Darauf folgten<br />
Berichte aus den Gruppen und die Termine für<br />
Der Vorstand<br />
das Jahr <strong>2018</strong> wurden besprochen, u. a. die<br />
Tagesfahrt nach Emden. Im Anschluss an die<br />
Versammlung wurden noch selbst geschmierte<br />
Brote gereicht, sodass der Abend gemütlich<br />
ausklang.<br />
Axel Miesner, Vorsitzender<br />
28<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
Jugendherbergen in den Dreißigerjahren<br />
Zur Geschichte der Jugendherberg Worpswede<br />
„Die Jugend wandert – Jugendherbergen in<br />
Bremens Umgebung“, mit dieser Überschrift<br />
beginnt ein Artikel in der Zeitschrift „Bremer<br />
Hausfrau“ vom 08.09.1932 . Im Weiteren wird<br />
über norddeutsche Jugendherbergen berichtet,<br />
die Anfang der Dreißigerjahre gebaut bzw. eingeweiht<br />
wurden, u.a. von der Grundsteinlegung<br />
des Westturms auf Wangerooge, die der bremische<br />
Senator Kleemann in seiner Festrede mit<br />
folgenden Worten einführte:<br />
„Denn auf unserer Jugend beruht die<br />
Zukunft des Volkes . Deshalb müssen wir auch in<br />
schwersten Zeiten Möglichkeiten schaffen,<br />
unsere Jugend gesund zu erhalten. Das ist kein<br />
Luxus, sondern eiserne Notwendigkeit im Dienste<br />
an unserem Volke! Jugend und <strong>Heimat</strong>, das<br />
sind die beiden gewaltigen Klänge, die in solchen<br />
Stunden durch unsere Seelen rauschen<br />
und uns zu Opfern und zum Verständnis für<br />
diese Bewegung bereit finden lassen.“ Die Sprache<br />
ist uns heute fremd. Da ist die Rede von<br />
„Gottes herrlicher Natur, von der Liebe zum<br />
Vaterland, von Jugend und <strong>Heimat</strong>...“<br />
JH Worpswede Anfang der 30ger-Jahre<br />
Erinnert wird u.a. an die Jugendherberge in<br />
Worpswede, „die herrlich am westlichen<br />
Abhang des Weyerberges liegt und ihren Gästen<br />
nicht nur die Möglichkeit erschließt, den eigenartigen<br />
Zauber von Moor- und Heidefahrten zu<br />
erleben, sondern ihnen auch Gelegenheit gibt,<br />
die hier bodenständige Kunst an Ort und Stelle<br />
durch Besuch der Künstlerwerkstätten und<br />
Ausstellungen zu studieren.“ Und in diesem<br />
Haus gebe es „herrliche Wasch-, Dusch- und<br />
Badegelegenheit, so daß die bestaubten Wanderer<br />
sich schnell erfrischen können.“ Auch die<br />
in jenen Tagen fertig gewordene Jugendherberge<br />
„Zum Utkiek“ in Bremen-Vegesack wird<br />
erwähnt, ein Haus , das „in sehr bevorzugter<br />
Lage direkt an der alten Hafenmauer liegt und<br />
in opferwilliger Aufbauarbeit durch Arbeitslose<br />
aufgebaut worden ist.“<br />
Immer wieder wird in dem Artikel auf die<br />
erzieherische Bedeutung hingewiesen, die Aufenthalte<br />
in Jugendherbergen für die Jugend<br />
haben. Wer Gelegenheit habe, die Jugend in den<br />
Herbergen zu beobachten, der würde merken,<br />
dass es „nirgends geordneter und gesitterter<br />
hergehen kann, als dort.“ Dafür sorge einmal die<br />
straffe Hausordnung, für die der Herbergsvater<br />
verantwortlich zeichne, „und vor allen Dingen<br />
die Selbsterziehung und Kameradschaftlichkeit<br />
unter der Jugend selbst.“ Und es besteht die<br />
Hoffnung, dass „die jungen Menschen durch<br />
die Hausordnung in den Herbergen dazu erzogen<br />
werden, Ordnung um sich herum zu halten.“<br />
Für die Selbstversorger heißt es: selbst<br />
kochen, die gebrauchten Gegenstände selbst<br />
aufwaschen und Eßtische und Schlafsäle in<br />
gesitterter Ordnung zu hinterlassen.“ Der Beitrag,<br />
durchzogen von Volkstümelei, endet mit<br />
einem Ausspruch von Turnvater Jahn: „Wer auf<br />
Wanderschaft gehen will, muß in der <strong>Heimat</strong><br />
Foto: „Die Hausfrau“<br />
flügge geworden sein. Die Wanderfahrt ist die<br />
Bienenfahrt nach dem Honigtau des Erdenlebens.“<br />
„Niederdeutsche Jugendherbergen“, so ist<br />
ein weiterer Beitrag in der Zeitschrift „Bremer<br />
Hausfrau“ vom 07. Dezember1933 überschrieben.<br />
Die Übernachtungszahlen haben sich verändert:<br />
Gab es 1911 siebzehn Jugendherbergen<br />
mit 3000 Übernachtungen, so haben 1932<br />
bereits in 2124 Häusern 4 200 000 Menschen<br />
übernachtet.<br />
Aber auch die Diktion hat sich verändert, sie<br />
ist völkisch-national geworden, ein Beispiel:<br />
„Für die Jugend das Richtige zu schaffen, darauf<br />
kommt es an. Und das Richtige? Was kann<br />
es anderes sein als Erziehung zu wahrer Volksgemeinschaft,<br />
zur Vaterlandsliebe, zur Kame-<br />
Jugendherberge Worpswede heute mit dem<br />
neuen Anbau<br />
Quelle: Dt. Jugendherbergswerk<br />
radschaftlichkeit und zur Ordnung und Sauberkeit<br />
des inneren und äußeren Menschen.“<br />
Die Nationalsozialisten sind inzwischen an<br />
der Macht. Der Reichsjugendführer der NSDAP,<br />
Baldur von Schirach, hat die Schirmherrschaft<br />
für das Jugendherbergswesen übernommen. Es<br />
steht nun „unter dem machtvollen Schutz des<br />
ganzen Reiches, da werden nun wohl auch für<br />
die immer noch abseits stehenden Eltern die<br />
Jugendherbergen für ihre Kinder gesellschaftsfähig<br />
geworden sein.“<br />
Die Eltern werden aufgefordert, vor allen<br />
Dingen die „zuständigen“ Mütter, „sich mehr<br />
mit diesem Erziehungswerk zu beschäftigen<br />
und bei Ausflügen und anderen Gelegenheiten<br />
selbst einmal in die Jugendherbergen hineinzuschauen,<br />
um sich davon zu überzeugen, daß<br />
ihre Kinder in Freizeiten und auf Fahrten gut<br />
untergebracht sind...“<br />
Die Jugendorganisationen HJ (Hitlerjugend)<br />
und BDM (Bund deutscher Mädel) werden hier<br />
vorbereitet. Verräterisch sind Sätze wie diese:<br />
“Denn wie kann ein Mensch sein Vaterland lieben,<br />
wenn er die Schönheiten desselben nicht<br />
kennt? Wie kann er seinen Volksgenossen verstehen<br />
lernen, wenn er nicht in kameradschaftlichem<br />
Zusammensein mit demselben andere<br />
Wesensart kennenlernt?“<br />
Rechtspopulistische Gruppierungen in vielen<br />
Ländern Europas, verstärkt auch seit einigen<br />
Jahren in Deutschland, bedienen sich heute der<br />
Sprache der Nationalsozialisten; historische<br />
Parallelen zur Blut- und Boden-Ideologie sind<br />
unverkennbar. Ein Menetekel?<br />
Helmut Strümpler<br />
Jugendherberge Worpswede<br />
Quelle: Dt. Jugendherbergswerk<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
29
Wie das Lilienthaler Wintertheater<br />
die Bremer Stadtmusikanten hinter sich ließ<br />
Passt der Schuh?<br />
Wer hätte damit gerechnet - im Jahre 1993,<br />
als Dieter Klau-Emken der Freilichtbühne Lilienthal<br />
seine Idee einer angegliederten Schauspielschule<br />
vorstellte - dass daraus ein so starkes<br />
Ensemble vorwiegend jugendlicher Schauspielenthusiasten<br />
erwachsen könne, die in der<br />
abgelaufenen Saison auf mehr als 20 Vorführungen<br />
kommen und sogar auf Tournee<br />
gehen würde?! Diesen langen Satz wollen wir<br />
inhaltlich mal etwas näher durchleuchten:<br />
Dieter Klau-Emken, in Grevenbroich im<br />
Rheinland aufgewachsen, hatte es in jungen<br />
Jahren als begabter Turner zu einigem Erfolg<br />
auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen<br />
gebracht. Während seines Studiums an der<br />
Sporthochschule in Köln wechselte der Schwerpunkt<br />
seines Interesses aber von Turnen zu Tanz.<br />
Und von dort war es kein weiter Schritt mehr<br />
zum Theater. Auf Umwegen führte ihn sein Weg<br />
irgendwann in den Norden und schließlich über<br />
Bremen und Worpswede nach Lilienthal, wo er<br />
seit der Jahrtausendwende zu Hause ist. In dieser<br />
Zeit hatte er mehrere Jahre lang einen Lehrauftrag<br />
für Tanz an der Hochschule für Gestaltende<br />
Kunst und Musik wahrgenommen, dem<br />
direkten Vorläufer der heutigen Hochschule für<br />
Künste. Und er gehört als Schauspieler und<br />
Choreograph zu den frühen Mitgliedern der<br />
Freilichtbühne, die bekanntlich 1984 aus der<br />
Taufe gehoben wurde.<br />
Nachdem er also 1993 die Verantwortlichen<br />
vom Nutzen einer Schauspielschule für die Freilichtbühne<br />
und für Lilienthal überzeugt hatte,<br />
galt es, das Projekt organisatorisch anzubinden<br />
und seine Finanzierung zu sichern. In Anlehnung<br />
an die Organisation größerer Sportvereine<br />
wurde die Theaterschule als eigenständige<br />
Abteilung der Freilichtbühne gegründet. In den<br />
ersten Jahren legte Klau-Emken besonderen<br />
30<br />
Wert auf Sprech- und (dies vor allem!) Bewegungstraining.<br />
Im Vordergrund stand das<br />
Improvisationstheater, mit dem die Truppe in<br />
der Umgebung mit wachsendem Zuspruch auftrat.<br />
Zeitweise teilten sich bis zu 50 Schülerinnen<br />
und Schüler auf bis zu vier Gruppen auf.<br />
Irgendwann wurden die Empfehlungen zahlreicher<br />
und lauter, es wäre doch schön, mit solchen<br />
Begabungen auch mal ein richtiges Stück<br />
aufzuführen.<br />
Gesagt, getan. Mit der Premiere von "Sterntaler"<br />
im Winter 2000/2001 wurde das Wintertheater<br />
ins Leben gerufen, so genannt als<br />
Pendant zum Sommerbetrieb der Freilichtbühne.<br />
Ständige Spielstätte wurde schnell der<br />
dafür umgebaute Martinssaal der Diakonischen<br />
Behindertenhilfe Lilienthal, für die Klau-Emken<br />
nur wenige Jahre zuvor bereits das "Theater<br />
Mobile" (die aus der Kulturszene Lilienthals<br />
ebenfalls nicht mehr wegzudenken ist) gegründet<br />
hatte. Bedingt auch durch den demographischen<br />
Wandel, der zu einem schleichenden<br />
Rückgang der Schauspieleleven führte, ging die<br />
Schauspielschule allmählich in das Wintertheater<br />
über. Mittlerweile hat sich die Teilnehmerzahl<br />
bei rund 30 begeisterungsfähigen Nachwuchsschauspielerinnen<br />
und -spielern stabilisiert.<br />
Das erlaubt es dem Regisseur Klau-<br />
Emken, dem es wichtig ist, möglichst allen<br />
Interessierten eine, zumindest bescheidene<br />
Mitwirkung zu ermöglichen, seine Rollen doppelt<br />
zu besetzen. Was für die Beteiligten, die<br />
zumeist die Schulbank drücken oder den Hörsaal<br />
frequentieren, bei der hohen Anzahl von<br />
Aufführungen je Spielzeit, teilweise sogar an<br />
Vormittagen (für Schulklassen oder KiTas) eine<br />
spürbare Terminentlastung bedeutet.<br />
Auf die Spielzeit zu Hause folgt für das<br />
Ensemble seit einigen Jahren ein Wochenende<br />
mit mehreren Auftritten in Göttingen.<br />
Am 10. Juni 1846 gründeten engagierte Bremer<br />
Bürger den Verein Ellener Hof zum Betrieb<br />
eines "Rettungshaus für sittlich verwahrloste<br />
Kinder". Vorbild dazu war das vom 'Reformpastor'<br />
Johann Hinrich Wichern 1833 in Hamburg<br />
gegründete "Rauhe Haus". Das damals rasant<br />
an Fahrt aufnehmende Industriezeitalter hatte<br />
eine ebenso rasant wachsende Zahl verwahrloster<br />
Kinder und Jugendlicher zur Folge, die für<br />
ihre Verfehlungen bis dahin durchweg ins<br />
Gefängnis - oder gar ins Zuchthaus - geworfen<br />
wurden. Wie viele Geistliche seiner Zeit war<br />
Wichern von der Überzeugung getrieben, dass<br />
eine solche Erziehungsanstalt jungen Menschen,<br />
die wegen fehlender Lebensperspektive<br />
auf die schiefe Bahn geraten waren, viel bessere<br />
Resozialisierungsmöglichkeiten biete als eine<br />
Haftanstalt, die zu der Zeit noch um einiges<br />
trostloser (und auch inhumaner!) war als heute.<br />
Diesem Reformansatz schloss sich der 'Grün-<br />
Dieter Klau-Emken: Der Kopf vom Ganzen<br />
dungsvater' der bald "Ellener Hof" genannten,<br />
autark arbeitenden Einrichtung vor der Stadt,<br />
Pastor Georg Gottfried Treviranus an.<br />
Nach einer langen, höchst wechselvollen<br />
Geschichte, auf die in einer zukünftigen Ausgabe<br />
des <strong>Heimat</strong>-<strong>Rundblick</strong>s ausführlicher eingegangen<br />
werden soll, wurde der Betrieb dieser<br />
Einrichtung, im frühen 20. Jahrhundert auch<br />
als "Rettungs-Anstalt für verwahrloste Knaben"<br />
bezeichnet, im Juni 1989 eingestellt An einer<br />
Ecke des Geländes wurde ein größeres Altenheim<br />
für betreutes Wohnen errichtet, die vorhandenen<br />
Altbauten verfielen allmählich. Dem<br />
Verein Ellener Hof fehlte jedoch die Kraft zu<br />
einem dynamischen Neuanfang. Im Jahr 2015<br />
schenkte er das gesamte Gelände der Bremer<br />
Heimstiftung, dem größten Altenpflegebetrei-<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
er am Ort. Gemeinsam mit dem Senat und<br />
einem niederländischen Stadtplanungsbüro<br />
wird das Areal, das nun 'Stiftungsdorf Ellener<br />
Hof' heißt, neu gestaltet. Mehr als 500 Wohneinheiten<br />
sind vorgesehen, ebenso wie ein Studentenwohnheim,<br />
ein Hindutempel, zwei Kitas,<br />
diverse Therapiepraxen, Einkaufsmöglichkeiten<br />
und eine Außenstelle der Volkshochschule, um<br />
nur einige der neuen Siedler zu nennen. fast<br />
alles in nachhaltig ökologischer Holzbauweise.<br />
Auch hierüber wird demnächst an dieser Stelle<br />
im Detail zu berichten sein.<br />
Nur wenige der alten Gebäude werden auf<br />
dem Gelände stehen bleiben können. Dazu<br />
gehört ein Haus, in dessen Keller sich die zentrale<br />
Heizungsanlage für einen Großteil des<br />
Areals befindet. In dessen Erdgeschoss liegt der<br />
ehemalige Speisesaal, der zugleich als Aula<br />
genutzt werden konnte.<br />
Noch in der ersten Planungsphase, gleich<br />
Kultur-Aula, Stiftungsdorf Ellener Hof<br />
nach Übernahme des Ellener Hofs, wurde den<br />
Verantwortlichen bei der Bremer Heimstiftung<br />
schnell klar, dass es nicht nur auf dem Gelände<br />
selbst, sondern in der gesamten Umgebung an<br />
geeigneten Räumlichkeiten für niederschwellige<br />
kulturelle Veranstaltungen für die dort<br />
lebende und arbeitende Bevölkerung fehlte -<br />
Veranstaltungen, die zuvörderst auf die Bedürfnisse<br />
der Menschen in Blockdiek auf der einen<br />
Seite des Geländes und dem Ellener Feld auf der<br />
anderen zugeschnitten waren - Veranstaltungen<br />
vor allem, ob Konzerte, Theater, Tanz, Ausstellungen<br />
oder anderes, die von den Ansässigen<br />
selbst organisiert oder gar einstudiert und aufgeführt<br />
würden. Die ursprüngliche Idee, dort<br />
einen reinen Theaterbetrieb aufzubauen, wurde<br />
rasch verworfen. An einem Standort im Außenbezirk<br />
und ohne lange, pulsierende Theatertradition<br />
regelmäßig mindestens einhundert<br />
Plätze je Aufführung verkaufen zu müssen,<br />
erschien allen Planungsbeteiligten dann doch<br />
als ein allzu ambitioniertes Vorhaben. Außerdem<br />
hatten informelle Umfragen und Erkundungen<br />
gezeigt, dass ein Mehrzweckveranstaltungsraum<br />
doch eher den Bedürfnissen der<br />
Menschen vor Ort gerecht würde.<br />
Nachdem die grundsätzliche Ausrichtung<br />
Junger Prinz versteht Erwachsene nicht...<br />
des Projekts geklärt war, musste geplant, entrümpelt,<br />
umgebaut und eingerichtet werden -<br />
nachdem die Finanzierung des ja nicht ganz billigen<br />
Vorhabens geklärt war. Zu Letzterem war<br />
die Bremer Heimstiftung nur zu einem geringen<br />
Teil in der Lage. Satzungsgemäß ist sie ja eine<br />
gemeinnützige Betreiberin von Altenpflegeeinrichtungen,<br />
nicht von Kulturstätten. Doch mit<br />
Unterstützung insbesondere des Ortsbeirats<br />
und des Ortsamts Osterholz sowie von Förderstiftungen<br />
und der Sparkasse Bremen konnte<br />
die "Kultur-Aula", wie sie zwischenzeitlich<br />
getauft worden war, in knapp zweijähriger<br />
Arbeit als ein von vielen Besuchern bewunderter<br />
Phoenix aus der Asche "alter Speisesaal"<br />
entsteigen. Auf ihrem Einweihungskonzert, bei<br />
dem unter anderem die bewährte Bremer<br />
Oldie-Coverband "Larry & the Handjive" für<br />
Stimmung sorgte, übergab die Bremer Heimstiftung<br />
den Betrieb des Hauses an den dafür<br />
gegründeten "Ellener Hof Verein".<br />
Blieb nur noch das eine Thema: Was soll dort<br />
aufgeführt werden? Neue Ensembles, welcher<br />
künstlerischer Ausrichtung auch immer,<br />
schießen auch in Bremen-Osterholz nicht über<br />
Nacht aus dem Boden. Also erst einmal ein Veranstaltungsjahr<br />
gleichsam zur Probe, mit diversen<br />
Vor- und Aufführungen aus ganz unterschiedlichen<br />
Richtungen. Da kam es dem für<br />
die Programmgestaltung verantwortlichen Vereinsvorsitzenden<br />
sehr gelegen, dass er sich<br />
zumindest in seinem heimischen Lilienthal<br />
etwas auskannte. Vor allem kannte er das Wintertheater<br />
- und ihren Gründungsleiter.<br />
Warum, so sagte er sich, sollen die, so gut, wie<br />
sie sind, nicht mal in Bremen ihr Glück versuchen?<br />
Ein Anruf, ein Treffen - und die Idee ging in<br />
die Umsetzung. Zwei Vorstellungen sollten es<br />
werden, und zwar nach der Dernière in Lilienthal<br />
Ende Januar und vor dem Gastspiel in Göttingen<br />
am letzten Februarwochenende. Am 8.<br />
Februar, einem Donnerstag, wurden Kleider und<br />
Kulissen aus Lilienthal abgeholt und Letztere<br />
noch am selben Tag in der Kultur-Aula aufgebaut.<br />
Tags darauf gab es schon die erste von<br />
zwei vereinbarten Vorstellungen. Wie die Profis<br />
gingen die Akteure zu Werk. Für vollwertige<br />
Proben, etwa um sich mit der neuen Bühne vertraut<br />
zu machen, vor allem mit ihrer Akustik<br />
und ihren Auf- und Abgängen, reichte die Zeit<br />
nicht. Ein paar kurze Anweisungen des Prinzipals<br />
und Regisseurs und ebensolche Abstimmungen<br />
untereinander mussten ausreichen.<br />
Kaum eine Stunde später öffnete sich der Vorhang.<br />
Obwohl das Haus noch lange nicht ausverkauft<br />
war, waren die Zuschauer vom grandiosen<br />
Spiel der Truppe begeistert. Auch bei der zweiten<br />
Aufführung, einer besser besuchten Nachmittagsvorstellung<br />
am Sonntag, den 11. Februar,<br />
sprang der Funke von der Bühne aufs Publikum<br />
über. Und zwar so deutlich, dass das Ensemble<br />
entschied: Nächstes Jahr kommen wir wieder.<br />
Dann allerdings mit einem ausgesprochen<br />
anspruchsvollen Stück: "Momo", nach dem<br />
Roman von Michael Ende.<br />
Zum Schluss erfuhr der Chronist ganz<br />
nebenbei, dass dies doch nicht der erste Auftritt<br />
der Truppe in Bremen war. Im Jahr 2003 hatte<br />
das Wintertheater mit "König Drosselbart" an<br />
einem Tag der offenen Tür des Bremer Theaters<br />
teilgenommen - und sogar den Publikumspreis<br />
gewonnen! Damals also schon weiter gekommen<br />
als die Bremer Stadtmusikanten, die<br />
bekanntlich nie in Bremen angekommen sind.<br />
Jens Uwe Böttcher<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
31
Heinrich Vogelers Friedensappell von 1918<br />
- aktuell bis heute<br />
H. Vogeler; Schützengraben<br />
32<br />
In unseren heute so friedlichen Zeiten in<br />
Europa scheinen die Gräuel der beiden Weltkriege,<br />
die von Deutschland angezettelt wurden,<br />
langsam in Vergessenheit zu geraten. Mit<br />
großer Distanz können wir die Kriege dieser<br />
Welt von sicherem Territorium aus betrachten.<br />
Kaum vorstellbar ist das Risiko, das vor einhundert<br />
Jahren Heinrich Vogeler auf sich nahm, als<br />
er seinen Friedensappell an den deutschen Kaiser<br />
schrieb. Dieser Protestbrief hat, dank der<br />
vielen weltweiten Kriegsschauplätze, heute<br />
nichts von seiner Aktualität eingebüßt, und so<br />
veröffentlichte zum Jahresanfang der Kenner<br />
der Worpsweder Kunstgeschichte Bernd Stenzig<br />
ein akribisch recherchiertes Buch über „Das<br />
Märchen vom lieben Gott“, wie Vogeler selbst<br />
sein Schreiben an den Deutschen Kaiser betitelte.<br />
Der Autor, der Privatdozent und Hochschullehrer<br />
am Institut für Germanistik der Universität<br />
Hamburg ist, schrieb schon zahlreiche<br />
Publikationen über Heinrich Vogeler. Durch<br />
seine profunden Kenntnisse von Originalquellen<br />
entsteht eine spannende Chronologie der<br />
Ereignisse – ausgehend vom Originaltext des<br />
Friedensappells, der in einem Worpsweder<br />
Museum als handschriftliche Abschrift von<br />
Heinrich Vogeler vorliegt. Vogelers militärische<br />
Karriere vom kriegsfreiwilligen Oldenburger<br />
Dragoner bis zum zeichnenden Kundschafter<br />
und Gestalter von Drucksachen ist nicht durch<br />
Heldentaten und Nationalpatriotismus<br />
geprägt, sondern zunächst von einem naiven<br />
Glauben an den Kaiser. Immer wieder pendelt<br />
der sensible Künstler zwischen Generalstab und<br />
Front hin und her und ist zunehmend erschüttert<br />
vom Elend und der Sinnlosigkeit des Krieges.<br />
Anfang Januar 1918 kehrt Vogeler, für die<br />
Familie überraschend, aus dem Krieg zurück. Er<br />
ist empört über das deutsche Verhalten<br />
während der in Brest-Litowsk stattfindenden<br />
Verhandlungen über einen Separatfrieden mit<br />
der Sowjetunion, das einen baldigen Frieden<br />
verhindert. Interessant und neu ist, dass sich<br />
Vogeler zu dieser Zeit noch als einen treuen<br />
Anhänger der Monarchie bezeichnet. Sein am<br />
20. Januar 1918 formulierter Brief an den Kaiser<br />
und auch ein weiterer Brief drei Tage später<br />
an seinen vorgesetzten Major sollen den Kaiser<br />
sowie die Oberste Heeresleitung Hindenburg<br />
und Ludendorff zu einem baldigen Friedensschluss<br />
bewegen.<br />
Im ersten Brief verwendet Vogeler dafür eine<br />
Erzählform, die an die zeitgenössische expressionistische<br />
Literatur erinnert, wie Bernd Stenzig<br />
schlüssig erläutert. Hierin kommt der „liebe“<br />
Gott als alter, trauriger Mann am 24. Dezember<br />
auf den Potsdamer Platz in Berlin und verteilt<br />
ein Flugblatt, auf dem steht: „Friede auf Erden<br />
und den Menschen ein Wohlgefallen“. Nachdem<br />
er durch die Staatsmacht standrechtlich<br />
erschossen wurde, erscheint er ein paar Tage<br />
später wieder und verweist auf die zehn Gebote.<br />
Er findet aber keine Aufmerksamkeit. Zum<br />
Abschluss fordert Vogeler Kaiser Wilhelm II. auf:<br />
„Sei Friedensfürst […] In die Knie vor der Liebe<br />
Gottes, sei Erlöser, habe die Kraft des Dienens.“<br />
Stenzig hält Heinrich Vogelers Bekenntnis zum<br />
Christentum für eine durchaus „gläubige“ Haltung,<br />
die sich auch ab 1917 in mehreren Briefen<br />
an seine Frau Martha und an Harry Graf<br />
Kessler belegen lassen. Heinrich Vogeler und der<br />
kunstaffine Ordonnanzoffizier Graf Kessler hatten<br />
sich 1915 bei einer gemeinsamen Frontinspektion<br />
kennengelernt.<br />
Aus Sorge der erste Brief würde vielleicht den<br />
Kaiser nicht erreichen, sendet Vogeler am 23.<br />
Januar 1918 einen weiteren Brief mit einer<br />
Abschrift des ersten auf dem ordentlichen<br />
Dienstweg über seinen Major mit der Bitte um<br />
Weiterleitung an Ludendorff. In diesem doppelt<br />
so langen Begleitbrief ist zu spüren, dass Vogeler<br />
über die Auswirkungen des Krieges außer<br />
sich ist. „Unser Volk ist am Ende, die Revolution<br />
lebt wie eine fressende Flamme. Kein Brot, keine<br />
Sättigung kann sie ausschalten! Wahrheit!<br />
Wahrheit, gebt den Menschen Wahrheit!“<br />
Diese Briefe setzt Bernd Stenzig in den historischen<br />
Kontext und bescheinigt Vogeler eine<br />
politische Weitsicht. Wenige Tage später treten<br />
über anderthalb Millionen Arbeiter, angeführt<br />
durch das linke politische Spektrum, in den<br />
Streik – und Heinrich Vogeler findet sich<br />
„unversehens auf Seiten derLinken wieder. Im<br />
Bürgertum ist er damit ein Sonderfall, er tritt<br />
ein erstes Mal heraus aus seiner Klasse“, so<br />
Stenzig. Beide Briefe könnte man todesmutig<br />
nennen, vielleicht sind sie aber auch in einer<br />
tiefen Depression geschrieben worden. Es ist<br />
nicht überliefert, ob der Kaiser die Briefe gelesen<br />
hat. Im Hauptquartier beim Ersten Generalquartiermeister<br />
Erich Ludendorff sorgte der<br />
Brief für Empörung. Der Befehl, Heinrich Vogeler<br />
standrechtlich zu erschießen, ist dann aber<br />
doch zu einer Einweisung in die Bremer Irrenanstalt<br />
abgewandelt worden. Am 27. Februar<br />
wird Vogeler wieder entlassen.<br />
Im Verlauf der nächsten Jahre entwickelt<br />
Vogeler eine eigene politische Weltanschauung,<br />
in der er auf unorthodoxe Weise Religion und<br />
Rätekommunismus verknüpft, findet dafür aber<br />
weder bei den örtlichen noch bei den Bremer<br />
Kommunisten Verständnis. Seine Kommune<br />
Barkenhoff, eine Insel im kapitalistischen Staat,<br />
bleibt ein Solitär und scheitert nach wenigen<br />
Jahren.<br />
Im letzten Kapitel geht Bernd Stenzig ausführlich<br />
auf die Bedeutung des Kaiserbriefs in<br />
Vogelers letzten Lebensphase von 1931 bis 1942<br />
in der Sowjetunion ein. Heinrich Vogeler bezog<br />
sich später immer wieder auf diesen Brief, um<br />
seinen frühen Einsatz für den Kommunismus<br />
deutlich zu machen. Er geht dabei so weit, seine<br />
eigenen Intentionen und politischen Einstellungen<br />
nachträglich umzudeuten, um sich als<br />
treuen Parteigänger darzustellen. Warum er<br />
dies tat, stellt Stenzig umfassend dar – sein<br />
Ausschluss 1929 aus der KPD in Deutschland,<br />
die Umsiedlung nach Moskau 1931, seine<br />
beruflichen und persönlichen Schwierigkeiten<br />
bis hin zu seiner Zwangsevakuierung 1941, die<br />
1942 zu seinem einsamen Tod in der kasachischen<br />
Steppe führt. Insbesondere das Studium<br />
der Komintern-Kaderakte im Russischen Zentrum<br />
für die Aufbewahrung und Erforschung<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
der Dokumente der neuesten Zeit (RCCHIDNI) in<br />
Moskau, die dank Reinhard Müller 1995 erstmals<br />
eingesehen und publiziert wurde, ist dafür<br />
eine bedeutende Quelle.<br />
Bernd Stenzig gelingt es mit seiner Analyse,<br />
die Geburtsstunde des politischen Engagements<br />
Heinrich Vogelers verständlich zu<br />
machen. Mit seinem Buch veröffentlicht er ein<br />
Standardwerk zu einem entscheidenden<br />
Lebensabschnitt Heinrich Vogelers. Dazu trägt<br />
auch das Personenregister am Ende des Buches<br />
bei, das eine schnelle Suche nach bestimmten<br />
Personen ermöglicht.<br />
Durchweg ist Stenzigs starke Empathie für<br />
Vogelers todesmutigen Einsatz für den Frieden<br />
zu spüren und er schließt mit den Worten der<br />
deutschen UNESCO-Kommission. Es sei die<br />
mutige Tat eines großen Menschen, „dessen<br />
Friedensbrief an Kaiser Wilhelm II. im Januar<br />
1918 als kühnes Friedensvorhaben in die<br />
Geschichte einging – und dessen Verhalten<br />
auch heute Generationen beeindruckt.“<br />
Daniela Platz<br />
Bernd Stenzig, Das Märchen vom lieben Gott<br />
– Heinrich Vogelers Friedensappell an den Kaiser<br />
im Januar 1918. Hardcover, 119 Seiten, div.<br />
teils farbige Abb. von Dokumenten, Zeichnungen<br />
und Gemälden, erschienen im Donat Verlag,<br />
Bremen <strong>2018</strong>. ISBN 978-3-943425-59-8<br />
Bildnachweis: Buchtitel, Donat Verlag Bremen<br />
Postkarte nach Federzeichnung, 1915, Privatbesitz<br />
Fast<br />
vergessen …<br />
Stimmungsbilder aus Moor und<br />
Heide im Spiegel der Dichtkunst<br />
Heute nahezu unbekannt ist der Dichter<br />
Richard Dehmel, obwohl er in den ersten beiden<br />
Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts als<br />
herausragender Lyriker galt. Hier und dort findet<br />
man noch in Anthologien und Lesebüchern<br />
einzelne Gedichte von ihm. Doch im<br />
Gegensatz zu denen seiner Zeitgenossen wurden<br />
seine Werke nicht neu aufgelegt. Richard<br />
Dehmel wurde am 18. November 1863 als<br />
Sohn eines Försters in Hermsdorf, Provinz<br />
Brandenburg, geboren. Nach dem Abitur in<br />
Danzig studierte er in Berlin Naturwissenschaften,<br />
Nationalökonomie und Philosophie.<br />
Er beendete sein Studium in Leipzig mit der<br />
Promotion im Jahre 1887 und arbeitete daran<br />
anschließend als Sekretär im Versicherungswesen<br />
in Berlin. Während dieser Zeit verkehrte<br />
er im Umkreis des Berliner Naturalismus und<br />
widmete sich der Dichtkunst. Nach der Scheidung<br />
von seiner ersten Frau Paula Oppenhei-<br />
mer, mit der er auch Kinderbücher verfasst<br />
hatte, heiratete Dehmel ein zweites Mal. Weite<br />
Reisen durch Europa folgten. 1912 bezog das<br />
Paar ein in Hamburg-Blankenese neu gebautes<br />
Haus. Trotz seines schon fortgeschrittenen<br />
Alters meldete sich Richard Dehmel beim Ausbruch<br />
des Ersten Weltkrieges 1914 freiwillig<br />
zum Kriegsdienst. Am 8. Februar 1920 starb er<br />
an einer Venenentzündung, die er sich im Krieg<br />
zugezogen hatte.<br />
Peter Richter<br />
Sommerabend<br />
Klar ruhn die Lüfte auf der weiten Flur;<br />
fern dampft der See, das hohe Röhricht flimmert,<br />
im Schilf verglüht die letzte Sonnenspur,<br />
ein blasses Wölkchen rötet sich und schimmert.<br />
Vom Wiesengrunde kommt ein Glockenton,<br />
der Hirte sammelt seine satte Herde;<br />
im stillen Walde steht die Dämmrung schon,<br />
ein Duft von Tau entweicht der warmen Erde.<br />
Im jungen Roggen rührt sich nicht ein Halm,<br />
die Glocke schweigt wie aus der Welt geschieden;<br />
nur noch die Grillen geigen ihren Psalm.<br />
So sei doch froh, mein Herz, in all dem Frie-<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
33
800 Jahre Worpswede<br />
Von der Ansiedlung zum Künstlerdorf<br />
Das kleine Bauerndorf Worpswede wurde<br />
1218 erstmals in einer Urkunde erwähnt – ein<br />
guter Grund der Einheimischen, mit Gästen von<br />
Nah und Fern ein großes Fest zu feiern. Seit vier<br />
Jahren bereitet sich das Dorf auf sein Jubiläum<br />
vor. Das Ergebnis der Planungen ist eine<br />
Mischung aus speziell kreierten Veranstaltungen,<br />
die auf verschiedene Epochen der Ortsentwicklung<br />
oder direkt auf die mittelalterliche<br />
Zeit vor 800 Jahren Bezug nehmen, und Traditionsfeste,<br />
die in diesem Jahr mit besonderen<br />
Attraktionen aufwarten. Das gesamte Jahr steht<br />
unter dem Motto „800 Jahre Worpswede – mit<br />
Brief und Siegel“.<br />
Mittelalter<br />
Es war Sonnabend, der 21. Juli 1218, als der<br />
Erzbischof Gerhard I. von Hamburg-Bremen<br />
dem Benediktiner Nonnenkloster St. Marien zu<br />
Osterholz eine Hälfte des Zehnten von vier<br />
Hufen in „Worpensweerde“, das heißt von vier<br />
Vollhöfnern, übertrug. Der Name eines Worpsweder<br />
Einwohners wird in dieser Urkunde<br />
genannt: „mit samt den Töchtern des Swether“.<br />
1<br />
Er ist damit der älteste bekannte Worpsweder<br />
Familienname – der allerdings später im Ort<br />
nicht mehr zu finden ist. Die drei Töchter heirateten<br />
vielleicht in die Familien Oldenbüttel,<br />
Schmonsees, Behrens, Bötjer oder Segelken, die<br />
aus den Hofakten überliefert sind.<br />
1223 folgt eine Schenkung des Welfen Heinrich<br />
V., Herzog von Sachsen und Pfalzgraf bei<br />
Rhein, Sohn des Welfen Heinrich der Löwe, der<br />
dem Kloster Osterholz „vier Hufen Landes zu<br />
Worpswede mit dem Obereigentumsrecht“<br />
überschreibt. Etwa um 1224 schenkt auch die<br />
Altes Bauernhaus nach 1932, Verlag H. Ch. Büsing, Bremen<br />
34<br />
Markgräfin Mathilde von Brandenburg, Witwe<br />
des Askanier Albrecht II., die zweite Hälfte der<br />
Worpsweder Insel, „medietatem insule“ mit vier<br />
Hufen. Hier mutiert der Name zu „Worpeneswede“.<br />
In einer Urkunde des Papstes Gregor IX.<br />
vom 5. Februar 1229 wird dem Kloster Osterholz<br />
der Besitz des Ortes Worpswedes, nun „Worpensethe“<br />
genannt, bestätigt. 2 1244 verfügt dann<br />
der Erzbischof von Bremen Gerhard II. die letzte<br />
Hälfte des Zehnten der Worpsweder Höfe an das<br />
Kloster. 3<br />
Im Mittelalter wurde, unabhängig vom Zehnten,<br />
der an die Kirche gezahlt wurde, auch eine<br />
Abgabe an die adeligen Gerichts- und Grundherren<br />
entrichtet. So hat es für eine lange Zeit<br />
die Situation gegeben, dass die Worpsweder<br />
Bauern ihre Grundsteuer an unterschiedliche,<br />
sogar verfeindete Adelsfamilien zahlen mussten<br />
und den Zehnten zusätzlich an die Landeskirche.<br />
Mit der Zusammenführung der Eigentumsverhältnisse<br />
und der verschiedenen Abgaben<br />
kam eine Jahrzehnte dauernde Erbstreitigkeit,<br />
in die Heinrich der Löwe und einige andere Protagonisten<br />
der Zeit verwickelt waren, zu einem<br />
friedlichen Ende. Der Streit um die Herrschaftsrechte<br />
an der unteren Elbe und der Weser hatte<br />
eine bis 1236 dauernde Konfrontation zwischen<br />
dem Welfen und den Staufern entfacht.<br />
In Folge der Streitigkeiten war das kleine, aber<br />
auf einer strategisch interessanten Landmarke<br />
im Teufelsmoor gelegene Fleckchen Worpswede,<br />
1106 auf zwei verfeindete Erbparteien aufgeteilt<br />
worden. 4 Gerrit Aust sind diese Erkenntnisse<br />
zu verdanken, der recherchierte, dass die<br />
Teilung des Dorfes einen strategischen Grund<br />
hatte.<br />
Im Kriegsfalle konnte sich die Truppe auf diesen<br />
Hügel zurückziehen und von dort aus die<br />
Bauernhof Hof 6 nach 1932<br />
Verlag H. Ch. Büsing; Bremen<br />
Bewegungen der feindlichen Heere zwischen<br />
Bremen und Stade am Osterholzer Geestrand<br />
beobachten.<br />
Der Weyerberg war allerdings nur schwer zu<br />
erreichen, denn er war vollständig eingeschlossen<br />
von Nieder- und Hochmooren, die jegliche<br />
Querung zu einem waghalsigen Abenteuer<br />
machten. Die Moore begannen vor etwa 11.000<br />
Jahren den Weyerberg von der Außenwelt abzuschneiden.<br />
Es gab nur wenige Knüppelwege,<br />
später zu Sandwegen ausgebaut, die im Winterhalbjahr<br />
wegen der häufigen hohen Wasserstände<br />
durch Sturmfluten und ergiebige<br />
Regenfälle unpassierbar waren. Das Hauptverkehrsmittel<br />
war dann ein Kahn mit geringem<br />
Tiefgang, mit dem man das Moorflüsschen<br />
Hamme befuhr. Allerdings mussten die Bewohner<br />
dafür zunächst zweieinhalb Kilometer zu<br />
Fuß an den Fluss laufen. Noch im siebzehnten<br />
Jahrhundert war Worpswede nur durch einen<br />
Sommerweg Richtung Tarmstedt mit der<br />
Außenwelt verbunden. 5<br />
In den Urkunden werden insgesamt acht<br />
Worpsweder Hufe erwähnt. Eine Hufe war ein<br />
landwirtschaftliches Gut, das mit einem Pflug<br />
bestellt werden kann und damit der Arbeitskraft<br />
einer Familie entspricht. Die Worpsweder<br />
Bauern bewirtschafteten den sandigen Boden<br />
des Weyerbergs in einer Heideplaggwirtschaft.<br />
Vermutlich wurden in den benachbarten Moorflächen<br />
und auf dem Berg der obere, durchwurzelte<br />
Bodenbereich abgetragen und als<br />
Stalleinstreu benutzt. Mit dem Stallmist angereichert,<br />
wurde dies Material als Dünger auf die<br />
dorfnahen Ackerflächen, die sogenannten<br />
Eschen, aufgebracht. Allerdings brauchten die<br />
Bauern mindestens das fünffache an Plaggfläche,<br />
um ihre Äcker gut bewirtschaften zu<br />
können. Von hier kommt vermutlich der Begriff<br />
„sich abplagen“. Durch das Abplaggen entstand<br />
eine Auszehrung des Bodens, auf dem dann nur<br />
noch Heide und wenige Büsche und Birken<br />
wuchsen. Der Standort auf dem Weyerberg<br />
ermöglichte immerhin eine einträgliche<br />
Bewirtschaftung mit Ackerbau und Viehzucht -<br />
und als weiteres Zubrot den Fischfang in der<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
Hamme und seinen Ausläufern. An den Sonntagen,<br />
zu Beerdigungen und Hochzeiten fuhren<br />
die Worpsweder Familien mit dem Kahn nach<br />
Scharmbeck. Im elften Jahrhundert wurde der<br />
Ort allerdings noch „Scirnbeci“, etwas später<br />
dann „Sandbeck“ genannt. Die Gründung der<br />
ersten Holzkirche „St. Willehardi“ soll auf den<br />
Missionar Ansgar aus Bremen zurückgehen und<br />
ist somit die älteste Kirche in der Region. 6 1182<br />
wird am Geest-rand das Benediktinerkloster St.<br />
Marien zu Osterholz gegründet. Obwohl die<br />
Bauern ihre Zehnten ab dem dreizehnten Jahrhundert<br />
hier abliefern, gehören sie weiterhin<br />
der Kirche von Scharmbeck an, bis sie ihre<br />
eigene Kirche auf dem Weyerberg erhalten.<br />
Aber bis dahin erleben die Worpsweder noch so<br />
manche unruhigen Zeiten.<br />
Die Reformationszeit<br />
Im sechzehnten Jahrhundert breitet sich die<br />
Reformation im norddeutschen Raum rasant<br />
aus. Vor allem an Orten mit großen Märkten<br />
Gehöft Weyermoor 3, mit Blick auf den Moorexpress, 1934<br />
Schnaars (Worpswede 6), Gevert Behrens<br />
(Worpswede 7), Hinrich Segelken (Worpswede<br />
8), Gevert Schmonsees, Vorfahre der Monsees<br />
(Worpswede 9), Dierk Bötjer (Worpswede 12),<br />
die sich alle im Südosten des Weyerberges angesiedelt<br />
haben. Dann folgen die Familien Reiners,<br />
Mahnken, Wellbrock, Semken und Kück. Beim<br />
Studium der Stammbäume fällt auf, dass es<br />
zahlreiche familiäre Verbindungen zwischen<br />
den Familien gibt.<br />
Das Teufelsmoor wird<br />
schwedisch<br />
Im Westfälischen Frieden von 1648 werden<br />
Königin Christine von Schweden unter anderem<br />
die Bistümer Bremen und Verden zugesprochen.<br />
Allerdings nimmt sie dieses Gebiet als deutsche<br />
Reichsfürstin in Besitz, sodass das Territorium<br />
als Provinz Mitglied im schwedischen Landesgebiet<br />
wird und alle seine Rechte und Privilegien<br />
des Heiligen Römischen Reiches weiter Bestand<br />
haben.<br />
Foto: Martha Vogeler<br />
Königin Christine schenkt ihrer Kusine Eleonora<br />
Catharina von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg,<br />
die mit ihr gemeinsam in Stockholm aufgewachsen<br />
war, zur Hochzeit mit dem Landgrafen<br />
Friedrich von Hessen-Eschwege (der „tolle<br />
Fritz“) das Rittergut Beverstedtermühlen. Von<br />
der Mitgift kaufen sich die beiden darüber hinaus<br />
noch das Gut Stotel. Für seine Verdienste im<br />
Kriege erhält der Landgraf die Klöster Osterholz<br />
und Lilienthal. Zunächst regieren sie von<br />
Eschwege aus die Region. Auf einer Reise durch<br />
das Gebiet entdecken der Landgraf und seine<br />
Frau die Schönheit des Weyerberges und<br />
beschließen 1654, ein sogenanntes Lust- oder<br />
Jagdschloss zu bauen. Die Schloss-Scheune, der<br />
Fischteich und der Entenfang im Straßentor<br />
waren schon fertiggestellt und der Thiergarten<br />
mit einigen Baumpflanzungen angelegt, als<br />
Friedrich 1655 während des schwedisch-polnischen<br />
Krieges stirbt. Seine Witwe Eleonora Catharina<br />
ist 29 Jahre alt und bleibt mit ihren Kindern<br />
allein in Eschwege zurück. Karl X. Gustav,<br />
Eleonora Catharinas Bruder, war ein Jahr zuvor<br />
der nächste schwedische König geworden. Er<br />
bestätigt sie als Erbin und Landgräfin mit ihren<br />
Besitztümern in Osterholz, Lilienthal und Stotel<br />
und sie erhält eine Pension von 3.000 Reichstalern,<br />
was für eine Frau in der damaligen Zeit<br />
nicht selbstverständlich war.<br />
Um 1656 verlegt sie ihren Wohnsitz nach<br />
Norddeutschland und bewohnt die alten<br />
Gebäude des Klosters in Osterholz. Ihr Schwiegersohn<br />
Baron von Lilienburg übernimmt die<br />
Verwaltung des Guts Stotel. Die Sommermonate<br />
residiert sie in Lilienthal, im Winter wohnt sie in<br />
Osterholz. Von hier aus leitet sie die Amtsgeschäfte,<br />
sitzt selbst dem Gericht vor und siedelt<br />
weitere Bauern in Osterholz an. Das Armenund<br />
Pflegehaus wird finanziell von ihr unterstützt,<br />
ein Arzt von ihr eingesetzt und eine Apotheke<br />
gegründet. Und es werden die Gilden für<br />
Tuchmacher und Schuster als Amt eingerichtet,<br />
die die Ausübung der Berufe regulieren sollen. 8<br />
Das Schlossbauprojekt betreibt sie nicht weiter.<br />
verbreitet sich die neue Lehre schnell. 1522 predigt<br />
der Augustinermönch Heinrich von Zütphen<br />
erstmals in Bremen. Das Osterholzer Kloster<br />
erhält in dieser Zeit von 120 Ortschaften<br />
den Zehnten und war dadurch finanziell sehr<br />
gut gestellt. In Lilienthal gab es seit 1230 das<br />
Zisterzienser Nonnenkloster St. Maria im Tal der<br />
Lilien. Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis<br />
1648 fordert auch hier in der Region seine<br />
Opfer. Immer wieder streifen kämpfende Truppen<br />
durch die Region. Es ist nicht überliefert, ob<br />
sie auch bis an den Weyerberg kamen. Das Moor<br />
mag in dieser Zeit ein guter Schutz gegen<br />
unliebsame Besucher gewesen sein. Allerdings<br />
haben die Bauern ihre kostbaren Eichen als<br />
Kriegsmaterial abliefern müssen, sodass der<br />
Baumbestand vermutlich fast ganz verschwunden<br />
war. In dieser Zeit begannen die Bauern ihr<br />
Brennmaterial, aus Mangel an Holz, durch Torf<br />
zu ersetzten.<br />
Über die Familien dieser Region gibt es aus<br />
dem sechzehnten Jahrhundert nur wenige Aufzeichnungen.<br />
7 In Worpswede sind es die Namen<br />
Gevert Oldenbüttel (Worpswede 5), Johann<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
Totenweg 1934<br />
Foto: Martha Vogeler<br />
35
Alter Ortskern Worpswede mit Slottschün<br />
Heute gibt es nur noch wenige Zeugnisse aus<br />
dieser Zeit. Ein Wanderweg am Rand des Weyerbergs<br />
heißt immer noch Thiergarten. Eine Trauben-Eiche,<br />
den Einheimischen als die „Mackensen-Eiche“<br />
bekannt, stammt noch aus der Aufforstung<br />
des Weyerbergs und zeichnete sich<br />
Jahrhunderte besonders vor dem Berghang ab.<br />
Sie wurde als Naturdenkmal unter Schutz<br />
gestellt. Im letzten Jahr zerbarst der Baum bei<br />
einem Sturm und bleibt nun als Fragment weiterhin<br />
Zeugnis dieser Zeit. Die Schloss-Scheune<br />
(Slottschün) erfährt eine zweite Renaissance,<br />
als die Worpsweder Künstlervereinigung<br />
1933/1934 das Fachwerkgebäude als Versammlungsraum,<br />
in dem sie unzensiert ihre Ausstellungen<br />
durchführen kann, einrichtet. Vier Jahre<br />
später wird das Gebäude abgerissen. Begründet<br />
wird es von der Verwaltung mit dem Bau der<br />
Straße nach Osterholz, Insider vermuteten<br />
damals aber politische Gründe – die Künstlerschaft<br />
galt tendenziell als Links orientiert.<br />
Am 3.3.1692 stirbt Eleonora Catharina. 9 Zu<br />
ihrer Trauerfeier am 18.3. kommen hochrangige<br />
weltliche und geistliche Würdenträger. Die<br />
Glocken läuten in Lilienthal, St. Jürgen, Hambergen,<br />
Lesum, Trupe, Scharmbeck und Osterholz.<br />
Ihr Leichnam wurde aus Geldmangel in<br />
einem einfachen Holzsarg in die Fürstengruft<br />
nach Eschwege überführt. 10<br />
Neu Helgoland, Torfkahn, Fotograf unbekannt<br />
36<br />
Vollkommen zu Unrecht ist diese bedeutende<br />
Person unserer Region in Vergessenheit geraten.<br />
Siebenunddreißig Jahre hat sie über die<br />
Geschicke der Bewohner und Bewohnerinnen<br />
bestimmt. Mit ihrer gerechten, aber auch milden<br />
und fürsorglichen Art war sie eine Ausnahmeerscheinung<br />
in der sonst männerdominierten<br />
Herrscherwelt. Ab 1672 taucht der Name<br />
Catharina als Mädchenname in Worpswede auf<br />
- vielleicht als Wertschätzung ihrer Landesherrin.<br />
Moorkolonisierung<br />
Fotograf unbekannt<br />
Ab 1742 beschäftigt sich die Hannoversche<br />
Regierung unter Georg II., Kurfürst von Hannover<br />
und englischer König, mit der Besiedlung<br />
der Moore. 1751 wird Jürgen Christian Findorff<br />
mit der Umsetzung der Moorkolonisation<br />
beauftragt. Die Randbereiche der Moore waren<br />
schon besiedelt, aber im unwegsamen<br />
Hochmoor in der Mitte des Teufelsmoores werden<br />
nun neue Kolonien geplant und vermessen.<br />
Auch aus Worpswede lassen sich einige Bewohner,<br />
Häuslinge, Knechte, Mägde und Bauernsöhne<br />
und -töchter als Moorsiedler gewinnen.<br />
Auf dem Weyerberg wird eine neue Kirche<br />
errichtet, die für viele Jahre die Hauptanlaufstelle<br />
aller neuen Moorbewohner und -bewohnerinnen<br />
wird. Die Kirchengemeinde bestand<br />
anfangs aus 153 Feuerstellen, das sind bei<br />
durchschnittlich sieben Familienmitgliedern<br />
insgesamt über 1.000 Personen. Etwa fünfzig<br />
Jahre später zählt die Kirchengemeinde schon<br />
400 Feuerstellen mit 2.886 „Seelen“. 11 Der Ausflug<br />
der Moorsiedler nach Worpswede, ob zu<br />
Fuß oder mit Kutsche, ist einerseits eine willkommene<br />
Abwechslung im harten und einsamen<br />
Alltag. Andererseits ist der Kirchgang für<br />
mindestens ein Familienmitglied Pflicht, denn<br />
die Kirche ist auch der Ort der amtlichen<br />
Bekanntmachungen. Jeder Siedler unterschrieb<br />
mit der Übernahme seines Landes, dass er sonn-<br />
tags zur Kirche kommt.<br />
Entlang der Hauptstraße in Worpswede siedeln<br />
sich bald Gastwirtschaften, Geschäfte,<br />
Handwerker und eine Apotheke an. Jeden<br />
Sonntag strömen hunderte Menschen die<br />
Kirchstraße hinauf und erledigen ihre Einkäufe<br />
nach dem Gottesdienst. Plötzlich wird aus dem<br />
weltabgeschiedenen Dorf, das sich Jahrhunderte<br />
nicht veränderte, ein Ort mit einem regen<br />
Kommen und Gehen. Worpswede erhält einen<br />
enormen Entwicklungsschub. Die letzte neue<br />
Moorkolonie „Neu Mooringen“ wird 1808 nach<br />
Jürgen Christian Findorffs Plänen gegründet.<br />
Der „Vater aller Moorbauern“ erlebt dies nicht<br />
mehr, er war 1792 gestorben.<br />
Künstlerdorf<br />
Mit dem Einzug der Künstler und Künstlerinnen<br />
in das Dorf kommt es erneut zu einer<br />
wesentlichen Erweiterung der Dorfgemeinschaft.<br />
Fritz Mackensen besucht seit 1884 das<br />
Dorf im Teufelsmoor regelmäßig. Heute ist die<br />
Gründung der Künstlerkolonie 1889 durch ihn<br />
und seine Malerfreunde Otto Modersohn und<br />
Hans am Ende legendär. Es ist vermutlich der<br />
freundlichen Aufnahme durch die einheimische<br />
Bauernschaft zu verdanken, dass sie blieben<br />
und auch weitere Künstler und Künstlerinnen<br />
in den Ort zogen. 1895 sind es sechs Künstler,<br />
um 1900 sind es mehr als fünfzehn Kollegen<br />
und Kolleginnen mit stetig wachsender Tendenz.<br />
Ihre Häuser und Villen tragen zur Veränderung<br />
des Ortsbildes bei. Den größten Einfluss<br />
hat Heinrich Vogeler, der 1903 mit dem Bauern<br />
Johann Bötjer den Verschönerungsverein<br />
Worpswede e.V. initiiert und dann Vorsitzender<br />
des Vereins und Mitglied der Baukommission<br />
wird. Er berät nicht nur die Bauwilligen des<br />
Ortes, sondern bekommt auch diverse Planungsaufträge<br />
für neue Gebäude. Haus Garmann,<br />
heute Vogeler-Villa genannt, ist der erste<br />
Auftrag für einen Eisenwarenhändler. Vogeler<br />
wird sogar zwei Künstler, die Brüder Walter und<br />
Alfred Schulze, zur Unterstützung einstellen.<br />
Wenn man alle Gebäude der drei talentierten<br />
Zeichner zusammenrechnet, haben sie bis 1914<br />
fünfzehn Häuser entworfen. 12 Das bekannteste<br />
Gebäude ist der Worpsweder Bahnhof, der 1910<br />
fertiggestellt wird und heute unter Denkmalschutz<br />
steht, weil es eines der sehr seltenen<br />
vollständig erhaltenen Jugendstilgebäude<br />
Deutschlands ist.<br />
Als die Künstler ihren ersten großen Ausstellungserfolg<br />
in München 1895 feiern können,<br />
wird Worpswede ein touristisch interessantes<br />
Ausflugsziel. Schon vorher kamen die Bremer<br />
als Tagesbesucher in das Bauerndorf. Ab 1906<br />
entstehen Ausstellungshäuser, Cafés, Kunstgewerbewerkstätten<br />
und weitere Künstlerateliers,<br />
die um die Aufmerksamkeit der Besucher werben.<br />
In einem Interview, das Radio Bremen 1953<br />
mit dem Hoferben Nicolaus Bötjer aus der Bauernreihe<br />
führte, berichtet er davon, dass Künstler,<br />
Kaufleute und Bauern zu Beginn miteinander<br />
befreundet waren und viele Feste miteinander<br />
feierten. 13<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
An der Hamme nach 1932 Verlag H. Ch. Büsing; Bremen<br />
Nationalsozialismus<br />
Zwischen den beiden Weltkriegen wird<br />
Worpswede zu einem Schauplatz weltanschaulicher<br />
und politischer Auseinandersetzungen.<br />
Nicht nur die Künstlerschaft, auch die anderen<br />
Einwohner Worpswedes teilen sich in ein konservatives<br />
und ein linkes Lager. Heinrich Vogeler<br />
gründet auf dem Barkenhoff eine kommunistische<br />
Kommune und verkündet in öffentlichen<br />
Reden seine neuesten politischen Erkenntnisse.<br />
Fritz Mackensen entwickelt sich zu einem erbitterten<br />
Feind in dieser Zeit. Mit der Ernennung<br />
Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar<br />
1933 verändert sich das Leben im Ort schlagartig.<br />
Bei der im März durchgeführten Reichstagswahl<br />
stimmen von 859 Wahlberechtigten<br />
Worpswede 1939, Maryan Žurek<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
472 für die NSDAP, 98 für die Kampffront<br />
Schwarz-Weiß-rot (deutschnational), 94 für die<br />
SPD, 47 für die KPD, der Rest wählt Splitterparteien.<br />
Vermutlich wird kurze Zeit später die<br />
Kirchstraße in Adolf-Hitler-Straße (heute Findorffstraße)<br />
und die Bergstraße hieß Hindenburgallee.<br />
Am ersten April 1933 wird in Deutschland<br />
zum „Judenboykott“ aufgerufen. Kurze Zeit<br />
später wird am Tennisplatz des jüdischen Kaufmanns<br />
Walter Steinberg aus Bremen ein judenfeindliches<br />
Schild angebracht. 14 Der Platz<br />
befand sich in der Bergstraße auf dem Gelände<br />
der Nr. 12. Auch die Familie des jüdischen<br />
Schlachters Abraham im Udo-Peters-Weg<br />
(heute Schlachter Schopfer) bekommt die<br />
feindliche Atmosphäre zu spüren. Henny Abraham<br />
und ihr Sohn Fred können zu ihren Ver-<br />
wandten nach New York City flüchten. Mutter<br />
Rosa Abraham bleibt in Worpswede, weil sie sich<br />
immer noch sicher fühlt und stirbt 1942 im Vernichtungslager<br />
Treblinka. In den Schulen wird<br />
inzwischen Rassenkunde und Vererbungslehre<br />
eingeführt. Christel Meiners-DeTroy berichtet<br />
in ihrem Buch über die bedrohliche Stimmung<br />
andersdenkenden Menschen gegenüber. 15 Eine<br />
weitere wichtige Quelle ist das Buch von Anning<br />
Lehmensiek über die Juden in Worpswede. 16<br />
Künstler und Künstlerinnen hatten auf<br />
unterschiedliche Weise unter dem nationalsozialistischen<br />
Regime zu leiden. Der 1931 in die<br />
Sowjetunion ausgereiste Heinrich Vogeler wird<br />
drei Jahre später ausgebürgert und kann nicht<br />
mehr in seine <strong>Heimat</strong> zurückkehren. Karl Jakob<br />
Hirsch flüchtet zunächst in die Schweiz und<br />
dann in die USA. Bernhard Hoetger, selbst<br />
Anhänger Adolf Hitlers, wird als entarteter<br />
Künstler mit Ausstellungsverbot belegt. Die<br />
Werke Paula Modersohn-Beckers werden aus<br />
öffentlichen Museen und Sammlungen<br />
beschlagnahmt. Mehrere expressionistische<br />
Künstler erhalten Ausstellungsverbot. Andere<br />
passen sich an den staatlich empfohlenen<br />
nationalsozialistischen Realismus an.<br />
Auf Anordnung der Partei entstehen Arbeitslager,<br />
in denen junge Frauen und Männer für<br />
verschiedenste Arbeiten auf dem Lande eingesetzt<br />
werden. Auf der Dohnhorst entsteht das<br />
sogenannte Maidenlager. Als der Krieg beginnt,<br />
werden die meisten jungen Männer zum Kriegsdienst<br />
eingezogen. Alte, Frauen und Kinder bleiben<br />
zurück und tragen die ganze Arbeitslast<br />
allein - bis Ende September 1939 in Sandborstel<br />
das riesige Kriegsgefangenenlager Stalag<br />
XB entsteht. Während des gesamten Krieges<br />
werden überall im Deutschen Reich Kriegsgefangene<br />
als Zwangsarbeiter eingesetzt. Rund<br />
um Worpswede entstehen in Gasthöfen, Schuppen<br />
und Baracken örtliche Arbeitslager für Soldaten<br />
aus der ganzen Welt, die als Erntehelfer,<br />
Bäcker, Molkereiarbeiter und an vielen anderen<br />
Stellen arbeiten müssen.<br />
1938 wird eine neue Straße von Osterholz<br />
über Waakhausen nach Worpswede gebaut. Mit<br />
erheblichen Mengen Sand aus Lintel und<br />
Worpswede wird ein Damm aufgeschüttet,<br />
sodass die Straße auch bei winterlichen hohen<br />
Wasserständen passierbar bleibt. Durch den<br />
Sandabbau entsteht mitten in Worpswede vor<br />
der Zionskirche ein großer Geländeeinschnitt,<br />
den der Lehrer aus Wörpedahl in seiner<br />
Schulchronik als eine Art „Culebra cut“<br />
bezeichnet. Er vergleicht dieBaumaßnahme mit<br />
dem Bau des Panamakanals. Seine Bemerkung<br />
dazu: „So etwas kann auch nur in Worpswede<br />
passieren“.<br />
Ab 1940 kreisen regelmäßig feindliche Flugzeuge<br />
über dem Teufelsmoor. Einzelne Flieger<br />
werden abgeschossen und stürzen in die Moore<br />
rings um Worpswede. In den letzten Kriegsjahren<br />
muss die Worpsweder Feuerwehr zahlreiche<br />
Einsätze in den Großstädten Bremen, Hamburg,<br />
Wesermünde und anderswo übernehmen. 17 Zu<br />
Beginn des Krieges hatte Worpswede 2.706 Einwohner,<br />
1945 vergrößert sich die Zahl auf 5.591<br />
Personen durch die Flüchtlinge aus den Ostgebieten.<br />
Die Wohnungsnot ist sehr groß. Kriegs-<br />
37
Zionskirche vor 1899<br />
rückkehrer finden manchmal in ihrem eigenen<br />
Haus kein Bett zum Schlafen. Die ehemaligen<br />
Zwangsarbeiterlager werden zu Notunterkünften,<br />
selbst der Niedersachsenstein von Bernhard<br />
Hoetger beherbergt Flüchtlinge. Es dauert bis in<br />
die 1950er-Jahre, bis durch neue Baugebiete<br />
alle Neubürger menschenwürdige Unterkünfte<br />
beziehen können.<br />
Worpswede heute<br />
Seit 1974 ist Worpswede mit den Dörfern<br />
Hüttenbusch, Mevenstedt, Neu Sankt Jürgen,<br />
Ostersode, Schlußdorf, Waakhausen und Überhamm<br />
zu einer Einheitsgemeinde verschmolzen<br />
und hat heute ca. 9.500 Einwohner. Der Ort<br />
Worpswede auf dem Weyerberg zählt ca. 5.500<br />
Einwohner. Worpswede versteht sich immer<br />
noch als ein Dorf, das aber auf Grund der heterogenen<br />
Bevölkerungsstruktur sehr unterschiedliche<br />
Fassetten hat. Der Tourismus<br />
ermöglicht eine Vielfalt an gastronomischen<br />
und musealen Angeboten, die auch den Einheimischen<br />
zugutekommen.<br />
800 Jahre feiern<br />
38<br />
Die Hauptveranstaltung des Jubiläums findet<br />
am Wochenende 21. und 22. Juli direkt im historischen<br />
Ortskern in der Bauernreihe und dem<br />
Straßentor statt. Auf dem Gelände des Rathauses,<br />
einem der ältesten Bauernhäuser des Dorfes,<br />
können die Besucher einen Living History<br />
Markt erleben, auf dem professionelle Darsteller<br />
in historischen Kostümen das Leben der<br />
Worpsweder vor 800 Jahren authentisch darstellen.<br />
Im weiteren Umfeld präsentieren sich<br />
verschiedene Vereine und Initiativen der<br />
Gemeinde, die den Bogen von der Vergangenheit<br />
in die Gegenwart schlagen. In einer Freiluftausstellung<br />
werden einige Meilensteine der<br />
Ortsgeschichte und das Leben der Torfbauern<br />
im Teufelsmoor präsentiert. Einige Autoren des<br />
Worpsweder Lesebuchs, das erstmals zum<br />
Jubiläum vom <strong>Heimat</strong>verein Worpswede e.V.<br />
herausgegeben wird, berichten von ihren ortsgeschichtlichen<br />
Forschungsergebnissen.<br />
Seit Jahresbeginn bieten die Worpsweder<br />
Gästeführer besondere Touren, Ortsspaziergänge<br />
mit Museumsbesuch und begleitete<br />
Rundfahrten per Rad, an. Die öffentlichen<br />
Rundgänge „800 Jahre Worpswede“ starten ab<br />
der Tourist-Information in der Bergstraße. Dort<br />
beginnen auch die geführten Radtouren, die<br />
zwischen Mai und September angeboten werden,<br />
die zwar Worpsweder Geschichte im Fokus<br />
haben, aber auch die landschaftlich spannende<br />
Umgebung erleben lassen.<br />
Der erst vor rund zwei Jahren gegründete<br />
<strong>Heimat</strong>verein Worpswede e.V. versteht sich als<br />
Koordinationsstelle und Veranstalter. Über ihn<br />
ist auch eine vollständige Liste der Veranstaltungen<br />
des gesamten Jahres erhältlich. Kontakt<br />
über: <strong>Heimat</strong>verein Worpswede e.V., Hans-Hermann<br />
Hubert, Bergstr. 1, 27726 Worpswede,<br />
<strong>Heimat</strong>verein@Worpswede.de<br />
Daniela Platz<br />
1<br />
Übernommen aus dem Urkundenbuch des<br />
Klosters Osterholz, Hans-Heinrich Jark 1982.<br />
Abschrift: Hodenberg 15. Druck: Pratje, Herzogtümer<br />
IV Nr. 4(S. 16); Hamb. UB 1, Nr. 418;<br />
Brem. UB 1 Nr. 113 (S. 134; Auszug) – Regest:<br />
May 1 Nr. 754.<br />
2<br />
Zitat aus „Urkundenbuch des Klosters<br />
Osterholz“ in der Bearbeitung von Hans-<br />
Heinrich Jarck, 1982.<br />
Fotograf unbekannt<br />
3<br />
Gerrit Aust, Das zweigeteilte Dorf, aus:<br />
Worpswede – Das Bauerndorf wird Künstlerdorf,<br />
2. Auflage 1992.<br />
4<br />
Ebd.<br />
5<br />
Karte de Wit in: Friedrich Netzel Stiftung<br />
2017<br />
6<br />
www.willehadi.de abgerufen am 12.3.<strong>2018</strong><br />
7<br />
Datenbank genealogy, Ortsfamilienbücher,<br />
Teufelsmoor in: www.online-ofb.de/, abgerufen<br />
am 13.3.<strong>2018</strong><br />
8<br />
Wilhelm Berger, <strong>Heimat</strong> <strong>Rundblick</strong> 27. Jahrgang,<br />
4/2014 Nr. 111, und Wilhelm Berger,<br />
<strong>Heimat</strong> <strong>Rundblick</strong> 27. Jahrgang, 1/2015 Nr.<br />
112<br />
9<br />
Wikipedia:<br />
https://de.wikipedia.org/wiki/Eleonore_Kat-<br />
harine_von_Pfalz-Zweibr%C3%BCcken-<br />
Kleeburg, abgerufen am 8.1.<strong>2018</strong><br />
10<br />
Erika Thies, Die Landgräfin mit den zwei<br />
Klöstern, in: Weser Kurier, 9.6.2007.<br />
11<br />
www.worpswede-moordoerfer.de, abgerufen<br />
2.2.<strong>2018</strong><br />
12<br />
Heike Albrecht, Worpswede, Künstler verändern<br />
ein Dorf. Untersuchung zur baulichen<br />
Entwicklung Worpswedes zwischen<br />
1889 und 1929. Diplomarbeit Universität<br />
Hannover 1988<br />
13<br />
Radio Bremen, Worpswede gestern und<br />
heute. 1953. Kopie der Sendung in meinem<br />
Archiv.<br />
14<br />
Mündlicher Bericht von Thomas Schiestl<br />
und Christel Meiners-DeTroy 2017<br />
15<br />
Christa Meiners-DeTroy, Das schweigsame<br />
Dorf am Weyerberg, Fischerhude 2016<br />
16<br />
Anning Lehmensiek, Juden in Worpswede.<br />
Bremen 2014<br />
17<br />
Internetseite Freiwillige Feuerwehr<br />
Worpswede<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong>
Ausstellung „Schwebschrauben und Scheinblüten"<br />
Werke von Constantin Jaxy im Hafenmuseum Speicher XI in der Bremer Überseestadt.<br />
Der seit vielen Jahren in Oyten lebende und<br />
schaffende Künstler Constantin Jaxy wurde<br />
1957 in Bremen-Walle geboren, studierte an<br />
der Hochschule für Bildende Künstler in Braunschweig<br />
(Meisterschüler bei dem 2017 verstorbenen<br />
Prof. Malte Sartorius) und an der Königlichen<br />
Akademie für Bildende Künstler in Den<br />
Haag - um nur zwei Punkte aus seinem<br />
umfangreichen Lebenslauf zu nennen. Eine<br />
Vielzahl von nationalen und internationalen<br />
Preise lassen sich aufzählen, ebenso Einzel- und<br />
Ausstellungsbeteiligungen weltweit.<br />
Jaxy arbeitet in Schwarz-Weiß - was nicht<br />
schwarz wird, bleibt weiß, Yin und Yang, dunkel<br />
und hell, Stillstand und Bewegung, Technik und<br />
Zeit. Im Hafenmuseum zeigt er kleine und großformatige<br />
Werke, gemalt und gezeichnet mit<br />
Holz, Kohle, Kreide und Grafit auf Papier und<br />
Karton, dazu bewegliche Konstruktionen und<br />
Mobiles. Seine häufigen Reisen, insbesondere in<br />
asiatlische Länder, vermitteln ihm neuartige<br />
Perspektiven, die sich unmittelbar in seinem<br />
künstlerischen Schaffen niederschlagen.<br />
Seine künstlerisches Fühlen und Denken<br />
generiert sich aus der Beschäftigung mit Technik<br />
und Architektur, aus Bewegung und Energie.<br />
Unterwegs fotografiert er viel, um die aktuellen<br />
Eindrucke für spätere Gestaltungen zu konservieren<br />
- so kommen unzählige Fotos zusammen.<br />
Die Ausstellung ist bis zum 8. April <strong>2018</strong> zu<br />
sehen.<br />
Weitere Informationen findet man im Internet<br />
unter www.constantinjaxy.homepage.tonline.de.<br />
Text und Fotos: Jürgen Langenbruch<br />
RUNDBLICK <strong>Frühjahr</strong> <strong>2018</strong><br />
39