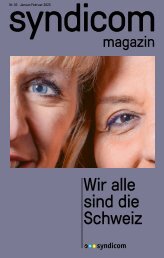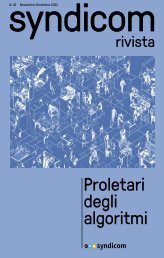syndicom magazin Nr. 5 - Recht auf Bildung. Für alle
Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.
Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>syndicom</strong><br />
<strong>Nr</strong>. 5 Mai–Juni 2018<br />
<strong>magazin</strong><br />
<strong>Recht</strong> <strong>auf</strong><br />
<strong>Bildung</strong>.<br />
<strong>Für</strong> <strong>alle</strong>.
Anzeige<br />
Jetzt die Konzernverantwortungsinitiative unterstützen!<br />
Kinderarbeit <strong>auf</strong> Kakaoplantagen, unmenschliche Arbeitsbedingungen in Textilfabriken,<br />
durch Goldminen verschmutzte Flüsse: Immer wieder verletzen Konzerne mit Sitz<br />
in der Schweiz die Menschenrechte und ignorieren minimale Umweltstandards. Die<br />
Initiative will solchen Geschäftspraktiken einen Riegel schieben.<br />
Fahne bestellen<br />
konzern-initiative.ch/<br />
fahne<br />
Spenden<br />
IBAN: CH50 0900 0000<br />
6188 9552 4<br />
Mitmachen<br />
konzern-initiative.ch/<br />
mitmachen
Inhalt<br />
4 Teamporträt<br />
5 Kurz und bündig<br />
6 Die andere Seite<br />
7 Gastautor<br />
8 Dossier: Weiterbildung<br />
16 Arbeitswelt<br />
19 Grafische Industrie<br />
22 Weiterbildung digital<br />
25 <strong>Recht</strong> so!<br />
26 Freizeit<br />
27 1000 Worte<br />
28 Bisch im Bild<br />
30 Aus dem Leben von ...<br />
31 Kreuzworträtsel<br />
32 Inter-aktiv<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
Die Arbeitswelt steht vor der digitalen Revolution.<br />
Um nicht ins Abseits zu geraten, muss die<br />
Weiterbildung erneuert werden. Die berufliche<br />
Weiterentwicklung liegt heute noch in der<br />
Verantwortung der Einzelnen. Allenfalls gewährt<br />
das Unternehmen Unterstützung. Diese Politik<br />
hält noch immer zu viele Personen von der<br />
beruflichen Weiterbildung fern. Vor <strong>alle</strong>m jene,<br />
die sie am meisten benötigen würden.<br />
Es ist nicht hinnehmbar, dass die Schweiz bei<br />
der ungleichen Teilnahme von gut und schlecht<br />
Ausgebildeten an den Weiterbildungskursen<br />
nach wie vor an erster Stelle liegt. Genauso<br />
wie es nicht angeht, dass Teilzeit arbeitende<br />
Frauen, die älteren Arbeitnehmerinnen und<br />
Arbeitnehmer, Migrantinnen und Migranten<br />
und Nichterwerbstätige vergessen werden.<br />
Angesichts der Digitalisierung der Arbeitswelt<br />
schlägt <strong>syndicom</strong> verschiedene Lösungen vor:<br />
In den GAV soll ein echtes <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> <strong>Bildung</strong><br />
eingeführt werden. Die Leistungen der Arbeitslosenversicherung<br />
sollen die Weiterbildung jener<br />
finanzieren, die ihre Stelle verloren haben.<br />
Der Staat muss handeln und Beiträge an eine<br />
kontinuierliche Aus- und Weiterbildung für <strong>alle</strong><br />
leisten, während welcher der Arbeitsplatz gesichert<br />
bleibt. Dabei müssen Anschlusslösungen<br />
vorgesehen werden, wie es in den Verhandlungen<br />
für den GAV MEM gefordert wird.<br />
Den Worten müssen nun Taten folgen.<br />
4<br />
8<br />
19<br />
Sylvie Fischer, Chefredaktorin
4<br />
Teamporträt<br />
An vorderster Front<br />
Sebastian Gänger (30)<br />
Der Inlandredaktor bei der SDA stammt<br />
aus Gampel (VS). Seit fünf Jahren<br />
gehört er der Redaktionskommission<br />
an. Er ist kürzlich <strong>syndicom</strong> beigetreten,<br />
und seit drei Jahren ist er<br />
ebenfalls Mitglied von impressum.<br />
Antoinette Prince (55)<br />
Antoinette Prince kommt aus St-Aubin<br />
(FR) und arbeitete während 15 Jahren<br />
als Heilpädagogin, bevor sie mit 42 in<br />
den Journalismus wechselte. Seit neun<br />
Jahren im Auslandressort der SDA. Sie<br />
ist Mitglied der Redaktionskommission<br />
und der Gewerkschaft impressum.<br />
Tina Tuor (26)<br />
Sie stammt aus Sumvitg (GR) und<br />
arbeitet seit vier Jahren im Wirtschaftsressort<br />
der SDA. Sie wird zum<br />
Tochterunternehmen AWP wechseln.<br />
Seit Januar ist sie Mitglied von<br />
<strong>syndicom</strong>, und seit dem Streik gehört<br />
sie der Redaktionskommis sion an.<br />
Text: Sylvie Fischer<br />
Bild: Alexander Egger<br />
«Alle Journalisten<br />
haben ihre Solidarität<br />
bekundet»<br />
«Mit dem Streik vom 29. Januar bis<br />
zum 2. Februar bei der Schweizerischen<br />
Depeschenagentur haben wir<br />
die Solidarität der gesamten Journalismusbranche<br />
erlebt. In der Bevölkerung<br />
haben wir an Bekanntheit<br />
gewonnen. Die Politik hat die Bedeutung<br />
einer nationalen Presseagentur<br />
erkannt. Diese öffentliche Debatte<br />
wird zwar unmittelbar keine Stellen<br />
retten. Es ist aber zu hoffen, dass die<br />
Agentur im Rahmen des neuen<br />
Mediengesetzes eine andere Struktur<br />
als heute, in der die SDA-Aktionäre<br />
ihre Kunden sind, und eine neue Art<br />
der Finanzierung erhalten wird. Wir<br />
haben ein Dutzend sehr gut besuchte<br />
Personalversammlungen (80 bis<br />
110 Personen) durchgeführt: Die<br />
gesamte Redaktion hat immer am<br />
selben Strick gezogen.<br />
Wir haben eine E-Mail-Adresse<br />
eingerichtet, an die <strong>alle</strong> Mitarbeitenden<br />
ihre Forderungen einschicken<br />
können. Die Redaktion nimmt<br />
Fragen entgegen und leitet Anliegen<br />
an die Chefredaktion weiter. In vier<br />
Runden wurde mit dem Verwaltungsrat<br />
verhandelt (dieser bot an, den von<br />
Kündigungen oder Änderungskündigungen<br />
Be troffenen zusätzlich einen<br />
Monatslohn zu bezahlen). Danach<br />
hat das Schlichtungsverfahren beim<br />
SECO begonnen. Die ersten Gespräche<br />
finden im Mai statt, die Verhandlungen<br />
werden bis im Juli dauern.<br />
Wir erwarten noch eine Verbesserung<br />
des Sozialplans für die über<br />
60-Jährigen, da man vier Jahre vor<br />
der Pensionierung keine Leute<br />
entlassen kann, deren Rente so <strong>auf</strong><br />
Lebenszeit gekürzt würde. Wir<br />
möchten vor <strong>alle</strong>m, dass sich die<br />
Direktion bewusst wird, dass es so<br />
nicht weiter gehen kann, ohne dass<br />
die Qualität der Arbeit darunter<br />
leidet. Zusätzlich zu den 36 gestrichenen<br />
Stellen bis 2019, haben 17<br />
Personen die Kündigung eingereicht.<br />
Das ist fast ein Drittel der Redaktion.<br />
Wir fordern, dass keine weiteren<br />
Stellen abgebaut werden und die<br />
Personen, die ihre Stelle kündigen,<br />
prioritär durch die gekündigten<br />
Personen ersetzt werden. Die Direktion<br />
muss sich bewusst werden, dass<br />
ein Stellenabbau kein Zukunftsmodell<br />
ist und ernsthaft über das<br />
Modell der Online-Kommunikation<br />
nach gedacht werden muss, das wir<br />
in Zukunft benötigen werden.»
Kurz und<br />
bündig<br />
«il caffè»: Richter für die Pressefreiheit \ Ziviler Widerstand<br />
gegen die Postchefs \ PöstlerAlarm im Rat \ Entlassungen<br />
beim Drucker Atar \ Neoliberale Angriffswelle \ Die ILO wird 100<br />
5<br />
Tessiner Richterspruch für<br />
die Pressefreiheit<br />
Die Entlassungen bei Atar<br />
Roto Presse einfrieren!<br />
Agenda<br />
Zensur wagt in der Schweiz kein CEO<br />
und reaktionärer Politiker zu fordern.<br />
Helvetische Maulkörbe sind aus perfiderem<br />
Stoff. Seit einigen Jahren können<br />
kritische Berichte mit dem Totschlagargument<br />
«unlauterer Wettbewerb»<br />
verhindert und freche Medien mit Millionenklagen<br />
gekillt werden. Dem bot ein<br />
Tessiner Strafrichter jetzt Paroli: Er<br />
sprach vier Journalisten des Blattes<br />
«il caffè» frei. Sie hatten den Fall einer<br />
Privatklinik recherchiert, wo ein Arzt<br />
einer gesunden Patienten die Brüste<br />
amputiert hatte. Der Richter zitierte ein<br />
Urteil des Europäischen Gerichtshofes<br />
für Menschenrechte, das die Medien als<br />
«Wachhunde der Demokratie» pries.<br />
Das Tessiner Urteil macht Jurisprudenz.<br />
Er schützt investigativen Journalismus.<br />
Besonders wichtig in einer Zeit, da eine<br />
Handvoll schwerreicher Männer die<br />
meisten Schweizer Medien kontrolliert.<br />
Wie dieser Tage gerade der Deal zwischen<br />
Christoph Blocher und Tamedia<br />
um die Basler Zeitung erneut belegt.<br />
Ziviler Widerstand gegen<br />
das Poststellenmassaker<br />
Seit das Bundesverwaltungsgericht<br />
entschieden hat, dass Gemeinden bei<br />
Poststellenschliessungen nicht mitzureden<br />
haben, gibt es nur noch einen<br />
Weg, das Massaker zu bremsen: Die<br />
Gemeinden müssen die für den Postkonzern<br />
obligatorische Alibikonsultation<br />
verweigern. So blockieren sie den Prozess.<br />
Dieser zivile Widerstand ist umso<br />
nötiger, als die Post diverse Beschlüsse<br />
der eidgenössischen Räte missachtet.<br />
Das Postgesetz muss dringend überarbeitet<br />
werden. Postchefin Ruoff hatte<br />
im Dezember 2017 versprochen, bis zur<br />
Revision keine Poststellenschliessungen<br />
gegen den Willen der Gemeinden zu<br />
vollziehen. Jetzt vergeht kaum ein Tag<br />
ohne Schliessung.<br />
PöstlerAlarm im Ständerat<br />
Stimmt der Ständerat einer CVPMotion<br />
zu, muss die Post bis um 12.30 Uhr verteilt<br />
sein. Ist doch gut? Nein. Es würde<br />
rund 1500 Pöstler zu 50 %Jobbern machen.<br />
Von einem halben Lohn lässt sich<br />
nicht leben. Jetzt formiert sich politischer<br />
Widerstand. Gegen die Motion.<br />
Und gegen die Post.<br />
1999 waren sie noch 170, jetzt sind sie<br />
rund 60 und bald sollen es noch 49 Angestellte<br />
beim grössten Genfer Drucker,<br />
Atar Roto Presse in Vernier sein.<br />
Atar druckt unter anderem den<br />
«Courrier». Am 1. Mai forderte die<br />
Genfer Sektion von <strong>syndicom</strong> einen<br />
Entlassungstopp und ermunterte die<br />
Kollegen, geeint zu handeln. Nun soll<br />
mit der Geschäftsleitung über einen<br />
Sozialplan verhandelt werden.<br />
Die nächste neoliberale<br />
Angriffswelle läuft<br />
Die neoliberalen Zerstörer von SVP und<br />
FDP haben zur nächsten Grossattacke<br />
geblasen. Wir sind gefordert:<br />
– Referendum gegen die Unternehmenssteuerreform<br />
III, die Bundesrat<br />
Maurer gegen den Willen des Volkes<br />
neu <strong>auf</strong>legt – als «Steuervorlage 17».<br />
– Referendum gegen Sozialspitzel.<br />
– Kampf gegen Jobabbau für höheren<br />
Profit bei Swisscom.<br />
– Ja zur Konzernverantwortung.<br />
– <strong>Für</strong> die 99%Initiative der Juso.<br />
Arbeit ist keine Ware –<br />
das SGBDossier zur ILO<br />
Immer mal wieder bekommt der Bundesrat<br />
Post aus Genf, von der Internationalen<br />
Arbeitsorganisation. Meist<br />
muss die ILO Grundsätzliches anmahnen.<br />
So entspricht etwa das<br />
Kündigungsrecht nicht der ILONorm.<br />
Gewerkschaftlich oder betrieblich engagierte<br />
Arbeitende etwa sind kaum<br />
geschützt. 2019 wird die ILO hundert<br />
Jahre alt. Ihr Ringen um international<br />
verbindliche Arbeitsnormen ist wichtig<br />
– gerade für uns Gewerkschaften.<br />
SGBDossier 126: Die Bedeutung der<br />
ILO. Download unter sgb.ch<br />
Juni<br />
2.<br />
Brauereibesichtigung<br />
Die IG Jugend von <strong>syndicom</strong> lädt zur<br />
Mikrobrauerei Wabräu in Wabern ein.<br />
Dort trifft man sich jeweils freitagabends.<br />
Interessierte melden sich über<br />
ihren my.<strong>syndicom</strong>Account an.<br />
9.<br />
A.o. Kongress <strong>syndicom</strong><br />
Bern, Kursaal, ab 8 Uhr, Eröffnung um<br />
9.15 Uhr<br />
14.<br />
Weltweiter Frauenstreiktag<br />
Lohngleichheit. Jetzt. Sofort. Und<br />
endlich mehr Chancengleichheit.<br />
Aktionen in der ganzen Schweiz.<br />
29.<br />
Internationales<br />
Literaturfestival Leukerbad<br />
(bis 1.7.)<br />
Drei Dutzend hochkarätige Autoren im<br />
Bergdorf. Lesen. Hören. Reden.<br />
Wandern in der DalaSchlucht. Gelage.<br />
Literaturfestival.ch<br />
Juli<br />
1.<br />
Branchenkonferenz Buch und<br />
Medienhandel<br />
Volkshaus Zürich, 13.15 bis 16.15 Uhr<br />
Nicht öffentlich, Anmeldung über<br />
my.<strong>syndicom</strong>.<br />
Übrigens ...<br />
10.6.<br />
Abstimmung VollgeldInitiative:<br />
Der SGB sagt Nein.<br />
Abstimmung Spielbankengesetz:<br />
Der SGB sagt Ja.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/agenda
6 Die andere<br />
Mania Hodler<br />
Seite<br />
hat Betriebswirtschaft mit Marketing studiert und arbeitet<br />
seit 2007 bei Swisscom. Seit 2015 ist sie Head of Talent and<br />
Skills Management, also verantwortlich für <strong>alle</strong> Themen rund<br />
um die berufliche Entwicklung der Mitarbeitenden.<br />
1<br />
In Ihrem GAV haben die Mitarbeitenden<br />
Anspruch <strong>auf</strong> fünf Tage<br />
Weiterbildung pro Jahr. Warum?<br />
Wir haben den GAV gemeinsam<br />
weiterentwickelt und an die Marktgegebenheiten<br />
angepasst. Und zwar<br />
mit Blick <strong>auf</strong> die Arbeitswelt der<br />
Zukunft, die massgeblich durch die<br />
Digitalisierung getrieben ist. Mit<br />
diesen Weiterbildungstagen stellen<br />
wir Lebenslanges Lernen, kontinuierliche<br />
Weiterentwicklung und damit<br />
auch die Arbeitsmarktfähigkeit von<br />
uns <strong>alle</strong>n ins Zentrum.<br />
2<br />
Welche Überlegungen stecken<br />
dahinter?<br />
Wir sind überzeugt, dass es bei der<br />
«Digital Fitness» künftig nicht nur um<br />
die aktuell gefragten Fähigkeiten<br />
geht, sondern eben um den Erhalt<br />
der eigenen Arbeitsmarkt fähigkeit.<br />
Mit dem Weiterbildungs artikel im<br />
GAV werden wir unserer Rolle als<br />
soziale Arbeitgeberin nebst der<br />
Vielzahl an Weiterentwicklungsangeboten<br />
nun auch im Sinne eines<br />
zeitlichen Rahmens gerecht.<br />
3<br />
Wie wichtig sind weitergebildete<br />
Mitarbeitende?<br />
Sehr wichtig! Es sind die Menschen,<br />
die Swisscom heute und in Zukunft<br />
erfolgreich machen. Nur mit motivierten,<br />
leistungsbereiten und gut<br />
ausgebildeten Mitarbeitenden<br />
werden wir unsere Vision realisieren<br />
können. Wir sehen die berufliche<br />
Weiterentwicklung als geteilte<br />
Verantwortung von Mitarbeitenden,<br />
Führungsverantwortlichen und<br />
Swisscom. Wichtig ist aber, dass<br />
letztlich jeder seine Entwicklung<br />
eigenverantwortlich anpackt.<br />
4<br />
Wann wird die Weiterbildung durch<br />
den Arbeitgeber bezahlt: In jedem<br />
Fall oder nur wenn es im engeren<br />
Sinn mit dem Beruf zu tun hat?<br />
Die Beteiligung haben wir im Rahmen<br />
eines Leitfadens geregelt. Je<br />
nach Ausgangssituation und Entwicklungsziel<br />
haben externe Aus und<br />
Weiterbildungen einen unterschiedlich<br />
hohen Nutzen und eine unterschiedlich<br />
hohe Wirkung für Swisscom<br />
und die Mitarbeitenden selber.<br />
Die Führungsverantwortlichen<br />
orientieren sich für die Festlegung<br />
der Beteiligung an einer Checkliste.<br />
5<br />
Kann das Weiterbildungsguthaben<br />
auch für eine berufliche Neuorientierung<br />
genutzt werden?<br />
Ja, dazu verfügen wir über ein<br />
umfassendes Angebot, das Berufsorientierungskurse,<br />
Standortbestimmung,<br />
individuelles Coaching,<br />
L<strong>auf</strong>bahnberatung, Aus und Weiterbildung<br />
sowie die Erarbeitung einer<br />
persönlichen Bewerbungsstrategie<br />
umfasst.<br />
6<br />
Weshalb tritt das <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> die<br />
<strong>Bildung</strong>stage erst 2019 in Kraft?<br />
Die Grundlage für den Bezug der fünf<br />
Weiterbildungstage bildet ein<br />
«Development Checkpoint»,der neu<br />
für <strong>alle</strong> obligatorisch ist. Wir bieten<br />
auch einen Fragebogen zur eigenen<br />
Arbeitsmarktfähigkeit an. Diese<br />
Massnahmen werden wir im Sommer<br />
einführen. Dann wird der Bezug der<br />
fünf Tage oder die Wahl der geeigneten<br />
Weiterentwicklungsmassnahme<br />
für 2019 vorbereitet.<br />
Text: Sina Bühler<br />
Bild: Swisscom
Gastautor<br />
«Die SDA ist ein systemrelevantes<br />
Unternehmen für unsere Wirtschaft.» Dies sagt<br />
ein FDP-Politiker dem Westschweizer Radio RTS<br />
in Lausanne. Vor dem Tamedia-Hauptsitz in<br />
Zürich benutzt ein BDP-Politiker fast dieselben<br />
Worte. Wenn sich Vertreter von wirtschaftsnahen<br />
Parteien so äussern und einen Streik der<br />
Angestellten einer Agentur, die sämtliche<br />
Schweizer Medien l<strong>auf</strong>end und anonym mit<br />
Inhalten versorgt, verteidigen, dann zeigt dies:<br />
Er war erfolgreich. Paradoxerweise hat der<br />
Streik der SDA mehr dafür getan, diesem Unternehmen<br />
Bekanntheit, Achtung und Wert zu<br />
verschaffen, als die Verleger, die vorgeben, die<br />
SDA mit der Privatisierung zu retten. Die SDA ist<br />
aus der Anonymität herausgetreten. Sie ist zum<br />
Medienstar geworden, mit einem Streik, der<br />
exemplarisch war punkto Beteiligung und<br />
demokratischer Durchführung. Die SDA zeigt,<br />
wie vorgegangen werden muss, um die Schweizer<br />
Medien aus der Krise herauszuführen. Die<br />
Medien müssen von ihren Machern selbst in die<br />
Hand genommen werden. Die Zivilgesellschaft<br />
muss intervenieren, um die Medien im Dienst<br />
der Demokratie zu retten. So wie es die Bürgergemeinschaft<br />
gezeigt hat, als sie sich für die<br />
Radio- und Fernsehgebühren aussprach. Die<br />
gute Nachricht: Mit der neuen Abgabe ab 2019<br />
wird genügend Geld zur Unterstützung der SDA<br />
vorhanden sein. Einer SDA, die nicht gezwungen<br />
sein wird, sich zu kannibalisieren, um ihren<br />
« privaten Eigentümern» eine Dividende auszuschütten.<br />
Sondern einer SDA, die im Dienste<br />
<strong>alle</strong>r Medien steht und wie die SRG <strong>alle</strong>n Bürgerinnen<br />
und Bürgern gehört. Und die den vom<br />
Verschwinden bedrohten Medien Abonnementsermässigungen<br />
gewähren kann. Ohne SDA wird<br />
es für die Regionalzeitungen schwierig, über<br />
regionenübergreifende Fragen zu berichten.<br />
Ohne SDA wird sich der Niedergang der Zeitungen<br />
und der Bezahlmedien – konkurrenziert<br />
durch die oft unentgeltlichen digitalen Informationen<br />
– un<strong>auf</strong>haltsam beschleunigen.<br />
Der Streik der SDA<br />
weist uns den Weg<br />
Frédéric Gonseth, Filmemacher und<br />
Co- Präsident von Medien für <strong>alle</strong>, FIJOU,<br />
hat <strong>auf</strong> eigene Initiative eine<br />
18-minütige Reportage («L’Agence<br />
pressée») über den Streik der SDA-<br />
Redaktion im Januar gedreht:<br />
www.youtube.com/watch?v=8G5PTH-<br />
6V4Uk&t=23s<br />
7
Weiterbildung muss in die GAV. Der Stand der Dinge.<br />
SGB: jedes Jahr fünf Tage Weiterbildung für <strong>alle</strong>. Interview.<br />
Das weltweite Geschäft mit dem Lebenslangen Lernen<br />
Grafiken: Die Schweiz, Land der (Weiter-)<strong>Bildung</strong>sunterschiede<br />
Dossier 9<br />
Unser<br />
<strong>Recht</strong> <strong>auf</strong><br />
<strong>Bildung</strong>
10 Dossier<br />
Gewerkschaften, GAV und Weiterbildung:<br />
Machen wir jetzt Nägel mit Köpfen!<br />
Zwei Wochen Weiterbildungsurlaub stehen in<br />
den besten GAV, gar nichts in den schlechtesten.<br />
Doch nun wird über neue Ideen für die<br />
berufliche Umschulung verhandelt.<br />
Text: Sylvie Fischer<br />
Bilder: Yves Leresche<br />
Die digitale Revolution verändert die Arbeit. Es braucht<br />
deshalb einen besseren Zugang zur Weiterbildung. Denn<br />
berufliche Veränderungen können während des gesamten<br />
Berufslebens notwendig sein. In der Schweiz besteht<br />
kein Anspruch <strong>auf</strong> Weiterbildung. Diese liegt in erster<br />
Linie in der Eigenverantwortung der Arbeitnehmenden.<br />
Nun wollen die Gewerkschaften diesen Anspruch in die<br />
Gesamtarbeitsverträge <strong>auf</strong>nehmen. In den künftigen Verhandlungen<br />
haben also die Bestimmungen, die einen <strong>Bildung</strong>surlaub<br />
oder eine Unterstützung durch den Arbeitgeber<br />
vorsehen, wachsendes Gewicht.<br />
So steht es um die <strong>syndicom</strong>-GAV<br />
Die kürzlich von <strong>syndicom</strong> ausgehandelten Gesamtarbeitsverträge<br />
bieten in vielen Fällen besonders vorteilhafte<br />
Bedingungen: Das Musterbeispiel ist der GAV Swisscom<br />
AG vom 8. Januar 2018. In Artikel 2.4 sieht er einen<br />
Anspruch <strong>auf</strong> 5 Tage Weiterbildung pro Jahr für die berufliche<br />
Entwicklung vor. Der Umsetzungsplan ist bis am<br />
1. Januar 2019 noch zu definieren (siehe Seite 21).<br />
Auch der GAV Sunrise 2018–2021 umfasst einen Anspruch<br />
<strong>auf</strong> Aus- und Weiterbildung, den das Unter nehmen<br />
nur in begründeten Ausnahmefällen verweigern kann.<br />
Die Massnahmen für die berufliche Entwicklung werden<br />
in einem jährlichen Gespräch zwischen Mitarbeiter und<br />
Vorgesetztem festgelegt (Art. 38). Die Dauer der Weiterbildung<br />
und die finanzielle Unterstützung werden individuell<br />
vereinbart.<br />
Im GAV für die grafische Industrie, der ab Juni neu ausgehandelt<br />
wird, ist für bis zu 15 Arbeitnehmende ein<br />
jährlicher Anspruch <strong>auf</strong> einen bezahlten <strong>Bildung</strong>surlaub<br />
von höchstens 2 Wochen zum Besuch von Weiterbildungskursen<br />
vorgesehen (Art. 210). Dieser Anspruch<br />
kann <strong>auf</strong> verschiedene Arbeitnehmende <strong>auf</strong>geteilt werden.<br />
Personen, die mit der Ausbildung von Lernenden betraut<br />
sind, haben zusätzlich einmal innert zweier Jahre<br />
Anspruch <strong>auf</strong> einen <strong>Bildung</strong>surlaub von höchstens drei<br />
Tagen.<br />
Die Mitarbeitenden der PostLogistics AG können innerhalb<br />
von 2 Jahren bis zu drei Tage (bezahlte Abwesenheit)<br />
für die von den Gewerkschaften angebotenen Ausund<br />
Weiterbildungen beziehen (Art. 2.14.4 und 2.14.2).<br />
Im GAV Post CH AG ist keine Mindestdauer für den <strong>Bildung</strong>surlaub<br />
vorgesehen. Von der Arbeitgeberin angeordnete<br />
Weiterbildungen hingegen werden als Arbeitszeit<br />
angerechnet und finanziert (Art. 2.17.8, in Kraft bis am<br />
31. Dezember 2018).<br />
Das administrative, operationelle und technische Personal<br />
der Flugsicherung schliesslich ist etwas schlechter<br />
gestellt: Den Mitarbeitenden werden zwar ebenfalls bis zu<br />
3 bezahlte Tage zur beruflichen Entwicklung pro Jahr gewährt.<br />
Aber wenn sie nicht bezogen werden, verfällt der<br />
Anspruch. Besser wären Konten, <strong>auf</strong> denen die Ansprüche<br />
gesammelt werden. Ausserdem tragen die Mitarbeitenden<br />
die Schulungskosten (Art. 2.4, in Kraft bis Ende 2019).<br />
Günstige Regeln in anderen Branchen<br />
Auch im Bausektor haben die Gewerkschaften eher grosszügige<br />
Regeln in die Gesamtarbeitsverträge schreiben<br />
können: bis 5 Tage bezahlter <strong>Bildung</strong>surlaub pro Jahr im<br />
GAV für die Berufe der Steinbearbeitung im Kanton<br />
Waadt. Ebenfalls 5 Tage im GAV für das Maler- und Gipsergewerbe<br />
in der Deutschschweiz und im Tessin, Art. 26.<br />
Die Kurskosten und weitere Ausgaben werden teilweise<br />
durch einen Fonds finanziert. 5 Tage <strong>Bildung</strong>surlaub pro<br />
Jahr in Absprache mit dem Arbeitgeber stehen im GAV für<br />
das Schweizerische Marmor- und Granitgewerbe.<br />
Auch der GAV MEM enthält in Art. 23.3 eine vorteilhafte<br />
Bestimmung. Den Firmen wird empfohlen, pro Vollzeitstelle<br />
jährlich mindestens 5 Tage oder einen entsprechenden<br />
finanziellen Beitrag für die Weiterbildung zur<br />
Verfügung zu stellen. Der GAV wird gegenwärtig neu verhandelt.<br />
Eine der Forderungen ist die Gründung eines paritätischen<br />
Vereins Berufspasserelle 4.0. Die Arbeitnehmenden<br />
sollen für die Anforderungen der digitalen<br />
Wirtschaft qualifiziert werden. Bei gleichbleibendem<br />
Lohn und Kündigungsschutz sollen sie eine berufsbegleitende<br />
Ausbildung mit theoretischen und praktischen<br />
Modulen besuchen und einen Abschluss mit einem eidgenössisch<br />
anerkannten Fachdiplom erlangen können<br />
(Unia-Seite: bit.ly/2ItUbta).<br />
Nicht <strong>alle</strong>s, was glänzt ...<br />
Einige der zunächst grosszügig erscheinenden GAV sehen<br />
nur eine beschränkte Kostenübernahme vor. Dies ist etwa<br />
der Fall beim GAV für das Plattenlegergewerbe Deutschschweiz.<br />
Dort wird ein Maximalbetrag von 300 Franken<br />
jährlich für 5 Kurstage pro Person gewährt. Allerdings<br />
wird für Lernende eine Pauschale von 200 Franken pro<br />
Jahr für Ausbildungskurse entrichtet. Andere GAV verlangen<br />
eine Rückerstattung der Kurskosten, wenn der Arbeitnehmende<br />
aus dem Unternehmen ausscheidet: Bis zu 5<br />
Tage bezahlten <strong>Bildung</strong>surlaub pro Jahr umfasst der GAV<br />
Weiterbildung<br />
bei vollem<br />
Lohn: Das<br />
muss möglich<br />
sein.
für Waadtländer Garagen (Art. 32). Der Arbeitgeber kann<br />
aber eine Bestimmung vorsehen, wonach Arbeitnehmende,<br />
die das Unternehmen innerhalb einer bestimmten<br />
Frist verlassen, die Kurskosten ganz oder teilweise<br />
zurückbezahlen müssen (Art. 30.1). Interessant ist auch,<br />
dass dieser GAV einen Fonds für berufliche Umschulungen<br />
für Arbeitnehmende vorsieht, die <strong>auf</strong>grund ihres<br />
Alters oder anderer Umstände keine neue Ausbildung<br />
erwerben können. Über diesen Fonds wird eine Rente ausgerichtet,<br />
welche die Lohneinbusse ausgleicht, die durch<br />
die Änderung der beruflichen Tätigkeit hingenommen<br />
werden muss.<br />
Der GAV der schweizerischen Uhren- und Mikrotechnikindustrie<br />
verlangt, dass Arbeitnehmende, die Anspruch<br />
<strong>auf</strong> einen Weiterbildungsurlaub von jährlich maximal<br />
3 Tagen haben, mindestens 3 <strong>auf</strong>einanderfolgende<br />
Jahre im selben Betrieb oder Konzern beschäftigt sind<br />
(gültig ab 1.1.2017).<br />
Knausrig bis nichts<br />
Andere Gesamtarbeitsverträge sind knauseriger und<br />
gewähren nur einen Weiterbildungstag pro Jahr, so beispielsweise<br />
der GAV für das Schweizerische Carrosseriegewerbe<br />
(Art. 22.1, gültig vom 1.2.2018 bis 30.06.2019).<br />
Schlimmer noch: Einige GAV sehen überhaupt keinen<br />
Anspruch <strong>auf</strong> Weiterbildung vor oder beschränken sich<br />
dar<strong>auf</strong>, das Gesetz zu paraphrasieren. Dies ist der Fall bei<br />
Art. 2 des GAV der Genfer Ingenieurbüros. Eine ähnliche<br />
Bestimmung findet sich im GAV der mechatronischen<br />
Industrie Genf oder im GAV der Naville SA (Art. 14,<br />
wonach der Arbeitgeber die berufliche Entwicklung seiner<br />
Mitarbeitenden fördert und die praktischen Modalitäten<br />
festlegt).<br />
Einen konkreten Anspruch daraus abzuleiten, ist<br />
schwierig. In manchen Fällen verpflichten sich die Parteien,<br />
ein Berufsbildungsprojekt umzusetzen, was aber<br />
nicht weiter präzisiert wird. Die Verhandler der Gewerkschaften<br />
dürfen sich mit solch vagen Bestimmungen<br />
nicht mehr zufriedengeben.<br />
Wer hat, dem wird gegeben<br />
Bereits in den Texten zeigt sich, dass man den schon gut<br />
Ausgebildeten gerne noch Weiterbildungsmöglichkeiten<br />
gewährt (siehe Grafiken <strong>auf</strong> Seite 15): Kader im Baugewerbe<br />
(Poliere und Werkmeister) können 5 Tage nutzen,<br />
Art. 18.1., bei Coop auch die Delegierten einer vertragsschliessenden<br />
Arbeitnehmendenorganisation, die an<br />
einem Kurs ihrer Organisation teilnehmen (Art. 42.4).<br />
Was möglich wäre, wird nicht immer genutzt<br />
Was in den GAV steht, sagt aber nichts aus darüber, ob die<br />
Arbeitnehmenden diese Ansprüche tatsächlich nutzen.<br />
Auch hier gilt es anzusetzen. Der Anteil der Arbeitnehmenden,<br />
die bei der Kursteilnahme unterstützt wurden,<br />
war 2015 besonders tief in den Bereichen Gastgewerbe<br />
und Hotellerie (24 %), Immobilien (27 %) und Sonstige<br />
Dienstleistungen (27 %). Man muss die Gründe dafür herausfinden<br />
und Abhilfe schaffen.<br />
Im Sektor Gastgewerbe und Hotellerie sind die Weiterbildungsausgaben<br />
im Verhältnis zu den Personalkosten<br />
rekordtief (0,4 %). Die Bereiche verarbeitendes Gewerbe,<br />
Sonstige Dienstleistungen und Immobilien hinken ebenfalls<br />
hinterher. Die direkten Ausgaben für Weiterbildungskurse<br />
(durchschnittlich 0,8 % der gesamten Personalkosten)<br />
sollten aber insgesamt erhöht werden, um den<br />
Bedarf an einer lebenslangen Weiterbildung zu decken.<br />
Ausserdem sollten die Ungleichheiten beseitigt werden.<br />
Projekte wie die mit Movendo entwickelten «<strong>Bildung</strong>sbotschafterInnen»,<br />
die über die Weiterbildungsmöglichkeiten<br />
und die Finanzierung für Arbeitnehmende<br />
informieren, können helfen.Es darf nicht mehr sein, dass<br />
11 % der Unternehmen (2015) keinerlei Investitionen in<br />
die berufliche Weiterbildung tätigen und 58 % von ihnen<br />
die benötigten Qualifikationen durch Neueinstellungen<br />
abdecken … und damit einfach von den Anstrengungen<br />
anderer oder der Mitarbeitenden profitieren.<br />
Weiterbildung <strong>auf</strong> den Seiten der Eidgenossenschaft:<br />
bit.ly/2jKO2e6
12<br />
Dossier<br />
«Alle sollten Anspruch <strong>auf</strong> fünf Tage<br />
Weiterbildung pro Jahr haben.»<br />
Laura Perret Ducommun, Zentralsekretärin<br />
beim SGB für <strong>Bildung</strong> und Jugend, verlangt die<br />
Einführung eines allgemeinen <strong>Bildung</strong>surlaubs.<br />
Text: Sylvie Fischer<br />
Wenn man in den Gesamtarbeitsverträgen nach dem<br />
Stichwort Weiterbildung sucht, stellt man fest: In vielen<br />
GAV ist nichts oder höchstens ein Weiterbildungstag<br />
vorgesehen. Wie denken Sie über diese Tatsache?<br />
Im Gesetz oder in den GAV muss der Anspruch <strong>auf</strong> fünf<br />
Tage <strong>Bildung</strong>surlaub pro Jahr verankert werden. Als<br />
Dachorganisation von 16 Gewerkschaften halten wir eine<br />
solche Massnahme für voll und ganz gerechtfertigt. Sie<br />
würde Vorstösse <strong>auf</strong>greifen, die vor einiger Zeit lanciert<br />
wurden, aber erfolglos blieben. Der Weiterbildung sollte<br />
heute eine grössere Bedeutung beigemessen werden, da<br />
man im Verl<strong>auf</strong> seines Arbeitslebens mehrmals den Beruf<br />
wechselt. Es gibt zwar GAV, in denen Weiterbildungstage<br />
oder -fonds vorgesehen sind. Wir wissen aber nicht,<br />
wie gross der Anteil der Angestellten ist, die davon profitieren.<br />
Zu diesem Thema sollte eine empirische Untersuchung<br />
durchgeführt werden. Meiner Meinung nach fehlt<br />
im heutigen System vor <strong>alle</strong>m die Finanzierung: Angestellte<br />
mit Familie haben keine Zeit für den Besuch einer<br />
Weiterbildung oder ganz einfach kein Geld dafür. Gemäss<br />
dem Weiterbildungsgesetz sind die Angestellten<br />
prioritär selbst für ihre Weiterbildung verantwortlich, die<br />
Arbeitgeber sollen diese begünstigen. Die Finanzierung<br />
und Unterstützung durch die Arbeitgeber hätte im Gesetz<br />
verbindlicher festgehalten werden müssen.<br />
Seit dem 1. Januar 2018 gibt es neue Bundesbeiträge für<br />
Weiterbildungen. Sie stellen fest, dass die Angestellten<br />
schlecht informiert sind über die vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten.<br />
Worum handelt es sich genau?<br />
Drei Möglichkeiten sind zu erwähnen: Seit diesem Jahr<br />
gibt es neu Bundesbeiträge für Kurse, die <strong>auf</strong> eine Berufsprüfung<br />
oder eine höhere Fachprüfung vorbereiten.<br />
Wer die entsprechende Prüfung absolviert, erhält unabhängig<br />
vom Prüfungserfolg 50 Prozent der Kurskosten<br />
zurückerstattet. Eine zweite Finanzierungsmöglichkeit<br />
richtet sich an Unternehmen oder Berufsverbände, die<br />
den Arbeitenden eine Grundbildung (Lesen, Schreiben,<br />
Mathematik, digitale <strong>Bildung</strong>) anbieten möchten. Seit<br />
Anfang dieses Jahres können Unternehmen Gesuche für<br />
die Finanzierung von 20 bis 40 Lektionen, die während<br />
der Arbeitszeit stattfinden, einreichen. Nicht zu vergessen<br />
sind die Berufsbildungsfonds der Kantone und Branchen,<br />
etwa der Baubranche. Gemäss Artikel 60 des<br />
Berufsbildungsgesetzes können diese Fonds von Weiterbildungswilligen<br />
beansprucht werden.<br />
Weiterbildung ist in ihrer heutigen Form oft ein Spiegel<br />
sozialer Ungleichheiten. Wer sie am meisten nötig<br />
hätte – gering qualifizierte Personen, Teilzeiterinnen<br />
oder solche, die nicht in der Schweiz ausgebildet<br />
wurden –, profitiert am wenigsten davon. Wie kann<br />
dieses Problem gelöst werden?<br />
Man könnte sicherstellen, dass <strong>alle</strong> Erwachsenen in der<br />
Schweiz über einen Abschluss <strong>auf</strong> der Sekundarstufe II<br />
verfügen, der für den Arbeitsmarkt mindestens benötigt<br />
wird. 95 % der jungen Erwachsenen besitzen einen solchen<br />
Abschluss, bis zu 600 000 Erwachsene aber nicht.<br />
<strong>Für</strong> Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz<br />
Weiterbildung dient<br />
den Einzelnen und gibt<br />
dem Unternehmen<br />
Konkurrenzvorteile.<br />
kommen, müssen Vorlehren geschaffen werden: Das<br />
neue Berufsbildungsgesetz/Weiterbildungsgesetz sieht<br />
vor, dass die Kantone Bundesbeiträge für solche Basiskurse<br />
erhalten, in denen die Kompetenzen für den Besuch<br />
einer Ausbildung und die Integration in den Arbeitsmarkt<br />
erworben werden können. Es wäre gut, wenn<br />
die regionalen Arbeitsvermittlungszentren ihre Praxis<br />
neu ausrichteten: Berufliche Wechsel für Erwerbslose<br />
sollen möglich sein, ohne dass wie heute zwingend<br />
Gründe wie eine Allergie <strong>auf</strong> bestimmte Substanzen oder<br />
das Verschwinden eines Berufs vorliegen müssen.<br />
Mit der Digitalisierung gehen Arbeitsplätze verloren.<br />
Braucht es nicht eine Reform der Berufsbildung?<br />
Die Studien zum Verlust von Arbeitsplätzen durch die<br />
Digitalisierung gelangen zu unterschiedlichen Schlüssen.<br />
Das geht von einer Einbusse von 47 % der Stellen in<br />
10 bis 20 Jahren in den USA (Frey, Osborne) und 54 % der<br />
Arbeitsplätze in Europa (Bruegel) bis hin zu einem Verlust<br />
von 12 % der Stellen in Deutschland (ZEW) oder nur<br />
9 % (OECD). Auf jeden Fall aber muss die Berufsbildung<br />
auch am Arbeitsplatz an die neuen technologischen<br />
Kompetenzen angepasst werden. Unternehmen, die über<br />
hoch qualifiziertes Personal verfügen, haben einen Wettbewerbsvorteil:<br />
Sie können den Produktionsprozess optimieren<br />
und Innovationen vornehmen. Gut ausgebildete<br />
Angestellte bleiben dem Unternehmen auch länger<br />
treu (manche Ausbildungen bedingen, dass man eine<br />
bestimmte Zeit im Unternehmen verbleibt oder die Kurskosten<br />
teilweise zurückbezahlt).<br />
Was ist weiter zu tun?<br />
Interessant wäre eine Bilanz der Kompetenzen, die für<br />
Arbeitnehmende ab 40 <strong>alle</strong> fünf Jahre erstellt würde.<br />
Und eine kostenlose Umschulung, wenn ein Beruf verschwindet.<br />
Allgemein sollten Mittelkürzungen im Bereich<br />
der Aus- und Weiterbildung, insbesondere <strong>auf</strong><br />
Ebene Kanton, vermieden werden.<br />
skbf-csre.ch/de/bildungsmonitoring/bildungsbericht-2014
Dossier<br />
Hast du was dazugelernt, oder<br />
bist du nur arbeitsmarktfähig?<br />
13<br />
Lebenslanges Lernen könnte faire Chancen für<br />
<strong>alle</strong> und ein interessanteres Leben bringen.<br />
Wenn sich denn die Gewerkschaften ernsthaft<br />
darum kümmern.<br />
Text: Bo Humair<br />
Mit der Weiterbildung ist das eine merkwürdige Sache.<br />
Wir lernen ein Leben lang dazu. Ob wir wollen oder nicht.<br />
Ein natürlicher Vorgang, denn unser Überleben hängt davon<br />
ab. Doch darüber hinaus teilen die meisten von uns<br />
den Wunsch, ein bisschen klüger zu werden. Versteht<br />
man die Dinge, lebt es sich besser.<br />
Also kultivieren wir uns. Wir lernen im Austausch, wir<br />
bauen soziale Netze. Nicht erst seit Renaissance und Aufklärung<br />
gilt: Wissen, Können und Kooperation emanzipieren<br />
uns von Zwängen. Nichtwissen aber zwingt uns in<br />
Abhängigkeiten. Mechanikerinnen tüfteln, Informatiker<br />
diskutieren rund um die Uhr über Blockchains, gute Ärztinnen<br />
verfeinern ihr Gehör, Lehrer ihre Neugierde. Und<br />
es gibt sie tatsächlich, die Ekstase des Erkennens, der<br />
Moment, da es uns wie Schuppen von den Augen fällt. Dagegen<br />
kommt nicht einmal die Verblödungsmaschine der<br />
Unterhaltungsindustrie an.<br />
Permanente Weiterbildung ist unsere zweite Natur.<br />
Das ist das eine. Doch irgendetwas hat sich da verschoben,<br />
in den letzten Jahrzehnten. Wir lernen immer seltener,<br />
was uns interessiert und uns reicher macht. Umso<br />
häufiger aber, was uns «arbeitsmarktfähig» hält. «Skills»<br />
eben. Wir sind gehalten, durch «livelong learning», lebenslanges<br />
Lernen, immer neue Skills zu erwerben. Indem<br />
wir die Mühen der Weiterbildung <strong>auf</strong> uns nehmen,<br />
investieren wir in unser «Humankapital». Wir betreiben<br />
Selbstvermarktung, machen uns zum Produktionsfaktor.<br />
Wer seine Haut <strong>auf</strong> den Stellenmarkt trägt, «benchmarkt»<br />
sich, tritt also in Konkurrenz zu andern Skills-Trägern<br />
und -Trägerinnen.<br />
Viele dieser Skills sind dummes Wissen. So ziehen wir<br />
etwa keinen Nutzen daraus, wenn jemand monatelang<br />
einen besonders ausgeklügelten Algorithmus entwickelt,<br />
um die «Dichte» unserer Arbeit (sprich: den Druck) zu<br />
er höhen. Oder wenn sich jemand durch das Erlernen<br />
einer Kommunikationssoftware zum Heimarbeiter qualifiziert<br />
– und degradiert. In diesem Mehr-Wissen liegt<br />
keine Befreiung von Zwängen mehr.<br />
Auff<strong>alle</strong>nd ist, wie genau diese veränderte Vorstellung<br />
von lebenslangem Lernen die veränderten Produktionsformen<br />
der kapitalistischen Wirtschaft und die globalisierte<br />
Konkurrenz spiegelt. Die Anforderung, dauernd<br />
neue «Skills» zu erwerben, geht Hand in Hand mit immer<br />
unsichereren Jobs.<br />
Wenn wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter<br />
also ein «<strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> Weiterbildung» einfordern, stellen<br />
sich ein paar Fragen. Wer bestimmt die Inhalte der Weiterbildung?<br />
Wer die Formen? Wer richtet sie aus? Wer<br />
finanziert sie, und wer gibt die Zeit dafür? Wir tun gut daran,<br />
etwas genauer hinzuschauen.<br />
Mit Karacho in die Unwissensgesellschaft<br />
Das <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> Weiterbildung setzten die französischen<br />
Gewerkschaften schon 1968 durch. Es war Teil des Kompromisses<br />
zwischen Regierung und Gewerkschaften, der<br />
die Mai-Revolte beendete. Dieses <strong>Recht</strong> brachte Frankreich<br />
<strong>auf</strong> einen der vorderen Plätze in der Rangliste der<br />
Länder mit hohem Weiterbildungsanteil. In der Praxis<br />
wurde dieses <strong>Recht</strong> zuletzt in ein persönliches <strong>Bildung</strong>skonto<br />
gekleidet: Pro Jahr Vollzeitarbeit werden den<br />
Viele der «Skills»,<br />
die wir lernen sollen,<br />
sind dummes<br />
Wissen ohne Wert.
14<br />
Dossier<br />
Arbeitnehmenden in den ersten fünf Jahren 24 Stunden<br />
Weiterbildung gutgeschrieben, in den Folgejahren<br />
12 Stunden. Maximal können so 150 Stunden gesammelt<br />
werden. Nur braucht der Besuch einer Weiterbildung die<br />
Zustimmung des Unternehmens. Verweigert es diese über<br />
sechs Jahre, wird das Konto um 100 Stunden erhöht. Der<br />
zuständige, paritätisch geführte Fonds sagte in den vergangenen<br />
zwei Jahren rund 700 000 Weiterbildungen zu.<br />
Doch nun hat Präsident Emmanuel Macron einen neoliberalen<br />
Big Bang und die weitgehende Privatisierung der<br />
Weiterbildung angekündigt. Künftig sollen die Unternehmen<br />
<strong>alle</strong>in über die Weiterbildung entscheiden.<br />
1968 war auch das Jahr, in dem das Buch «Die Wissensgesellschaft»<br />
von Robert Maynard Hutchins erschien. Im<br />
Kern meint der Begriff, der entscheidende Rohstoff für<br />
moderne Ökonomien seien weder Öl noch Mineralien,<br />
sondern Wissen. Das blieb lange eine akademische Debatte.<br />
Aber seit den 1980er Jahren explodiert die <strong>Bildung</strong><br />
zum weltumspannenden Milliardenmarkt.<br />
Das Business mit dem «LLL»<br />
Inzwischen haben ungezählte Experten Zehntausende<br />
von Berichten zur Weiterbildung verfasst, sämtliche internationalen<br />
Organisationen wie die OECD oder die<br />
UNO-Organisationen verfügen über eigene Abteilungen,<br />
und es gibt kaum ein Land, auch nicht das ärmste, das<br />
nicht dickbäuchige Lifelong-Learning-Strategien ausgerufen<br />
hätte. In der EU sind ganze Heerscharen mit «LLL»<br />
befasst. Darum herum scharen sich <strong>Bildung</strong>skonzerne,<br />
deren Umsatz exponentiell steigt. Die Szene – mit ihren<br />
Ländermodellen – ist längst unübersichtlich geworden.<br />
«Macht mal Pause mit dem LLL-Geschwätz», findet<br />
Sharon Gewirtz vom Londoner Kings College. Wer sich in<br />
den Niederungen der Weiterbildung umschaut, sehe ein<br />
ernüchterndes Bild. In einer Grossstudie machte die Bertelsmann-Stiftung<br />
im Februar 2017 eklatante Mängel in<br />
der EU fest. In zehn Ländern gab es keinerlei Anstrengungen,<br />
«die finanziellen oder personellen Ressourcen für lebenslanges<br />
Lernen bereitzustellen.» Und in kaum einem<br />
Land wurde die starke Diskriminierung der Arbeiterschichten<br />
bei der <strong>Bildung</strong> angepackt. Von Ausländern gar<br />
nicht zu reden. Schlusslicht ist das durchprivatisierte<br />
Grossbritannien.<br />
Dieser Befund deckt sich mit Erhebungen der EU, der<br />
Internationalen Arbeitsorganisation ILO und der OECD.<br />
– Länder, deren <strong>Bildung</strong>ssysteme öffentlich finanziert<br />
sind und die über starke sozialpartnerschaftliche Mechanismen<br />
verfügen, liegen bei der Weiterbildung vorne<br />
(Dänemark, Schweden, Belgien …). Besonders wichtig,<br />
schreibt die ILO, ist der «soziale Dialog». Dagegen<br />
hängen Länder mit privat finanzierten <strong>Bildung</strong>ssystemen<br />
weit zurück. Die USA geben mehr als zwei BIP-Prozentpunkte<br />
weniger für <strong>Bildung</strong> aus als etwa Frankreich.<br />
«Macht mal Pause<br />
mit dem LLL-<br />
Geschwätz» Sharon Gewirtz<br />
– Konzerne tun wenig für Weiterbildung, ausser für die<br />
eigenen Belange. Dabei werden höher Qualifizierte<br />
bevorzugt. Diese Strategie verschärft <strong>Bildung</strong>sunterschiede.<br />
Wollen Gewerkschaften lebenslanges Lernen durchsetzen,<br />
sollten sie <strong>auf</strong> starker öffentlicher Finanzierung und<br />
sozialpartnerschaftlicher Organisation beharren. Die<br />
Programme müssen prioritär <strong>auf</strong> Ausgleich der Chancen<br />
zielen und vor Jobverlust schützen. Die Grundlagen werden<br />
bei der Berufsbildung gelegt (lernen zu lernen). Vor<br />
<strong>alle</strong>m aber sollten sie eine starke eigene, innovative<br />
<strong>Bildung</strong>soffensive entfalten. Ziel: Emanzipation durch<br />
kooperatives Lernen.<br />
Institut Gewerkschaftsforschung:<br />
boeckler.de<br />
Fotostrecke<br />
Das Titelfoto, die Bilder des Dossiers und das kleine Bild im<br />
Inhaltsverzeichnis stammen vom Waadtländer Fotografen<br />
Yves Leresche. <strong>Für</strong> seine Reportage über die Vermittlung von<br />
Wissen hat er Orte kreativer Wissensproduktion ausgewählt,<br />
das FabLab, der Makerspace und das Hackuarium (Biolabor)<br />
in Renens und das FabLab in Zürich.<br />
Yves Leresche hat sich einen Namen als Reportage- und<br />
Porträtfotograf gemacht. Seine Bilder stellen die Vermittlung<br />
und den Austausch von Wissen zwischen Lehrenden und<br />
Lernenden ins Zentrum.<br />
Mehr darüber unter: yvesleresche.ch<br />
Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der<br />
FabLabs, des Makerspace und des Hackuarium für ihre<br />
Unterstützung.
Die Digitalisierung erfordert eine Neuverteilung des Wissens, weil sonst die<br />
weniger gut Ausgebildeten übergangen werden. Auch Ältere, Frauen, Migranten<br />
und Migrantinnen – <strong>alle</strong> sollen Zugang zur Weiterbildung haben.<br />
15<br />
Die Die Schweiz Schweiz bildet bildet viel viel aus… aus…<br />
Anteil Anteil der Bevölkerung der zwischen zwischen 25 und 25 64 und Jahren, 64 Jahren,<br />
die an die Aus- an Aus- oder oder Weiterbildungen teilnimmt teilnimmt<br />
100 % 100 %<br />
Grundstufe Grundstufe Mittelstufe Mittelstufe Höhere Höhere Ausbildung Ausbildung<br />
80% 80%<br />
60% 60%<br />
40% 40%<br />
20% 20%<br />
…aber …aber sie bildet sie bildet sehr sehr ungleich ungleich aus aus<br />
Die Teilnahme Die Teilnahme an Aus- an Aus- und Weiterbildungen und variiert variiert stark stark<br />
zwischen zwischen Leuten Leuten mit primären mit primären Abschluss Abschluss und Leuten und Leuten mit höheren mit höheren<br />
Diplomen Diplomen (Spanne (Spanne in Prozent) in Prozent)<br />
35% 35%<br />
30% 30%<br />
25% 25%<br />
20% 20%<br />
15 % 15 %<br />
10 % 10 %<br />
5% 5%<br />
0%<br />
0%<br />
0%<br />
0%<br />
S S CH CH NL NL FL FL F F D D A A GB GB I I I EU EU<br />
GR GR B B D D E E EU EU GB GB I I I S S F F CH CH<br />
Quellen: Quellen: Eurostat Eurostat 2011, BFS 2011, 2016 BFS 2016<br />
Quelle: Quelle: Eurostat Eurostat 2016 2016<br />
Mit Mit zunehmenden Alter Alter bildet bildet man man<br />
sich sich weniger weniger weiter weiter<br />
Prozent Prozent der Leute, der Leute, die an die Weiterbildungsaktivitäten<br />
an teilnehmen, nach nach Alter Alter<br />
76,4%<br />
69,6% 69,6%<br />
67,7 67,7 % %<br />
57,1% 57,1%<br />
Indikator für den Erwerb von Wissen<br />
In der Schweiz besuchen über 60 % der 25- bis 64-Jährigen<br />
eine Aus- oder Weiterbildung. Einzig in Schweden und<br />
Luxemburg scheint dieser Anteil noch höher. Doch internationale<br />
Vergleiche sind schwierig. Die <strong>Bildung</strong>ssysteme sind<br />
verschieden, die statistische Erfassung auch. In der Schweiz<br />
werden sämtliche <strong>Bildung</strong>sformen mitgezählt. Von privaten<br />
Kursen über die obligatorische bis hin zur nachobligatorischen<br />
<strong>Bildung</strong>. Wenn man, wie das BFS, die Teilnahme an<br />
<strong>alle</strong>n Lernformen als Indikator für die Weiterbildung<br />
betrachtet, wird ihr Anteil vermutlich überschätzt.<br />
Die Vergessenen der Weiterbildung<br />
25–34 25–34<br />
35–44 35–44<br />
45–54 45–54<br />
55–64 55–64<br />
Jahre Jahre<br />
Jahre Jahre<br />
Jahre Jahre<br />
Jahre Jahre<br />
Quellen: Quellen: BFS, Mikrozensus BFS, Mikrozensus Weiterbildung Weiterbildung 2016 2016<br />
Wer Wer weniger weniger ausgebildet ist, ist, bekommt weniger weniger<br />
Weiterbildung<br />
Durch Durch den Arbeitgeber den unterstützte Weiterbildung<br />
Pikanterweise erachtet es der Bundesrat als eine staatliche<br />
Aufgabe, «Weiterbildungstätigkeit unter den bildungsmässig<br />
Benachteiligten speziell zu fördern» (Bundesrat, 2007).<br />
Denn die <strong>Bildung</strong>schancen sind sehr ungleich verteilt:<br />
Fast 80 % der 25- bis 34-Jährigen nehmen an der Weiterbildung<br />
teil, während es bei den 55- bis 64-Jährigen weniger<br />
als 60 % sind.<br />
Grundstufe Grundstufe<br />
31% 31%<br />
Mittelstufe Mittelstufe<br />
56% 56%<br />
Höhere Höhere Ausbildung<br />
75%<br />
30% 30%<br />
54% 54%<br />
72% 72%<br />
33% 33%<br />
58% 58%<br />
77% 77%<br />
Rekordhohe Ungleichheit zwischen gut und<br />
schlecht Ausgebildeten<br />
In der Schweiz ist die Teilnahme am Prozess des lebenslangen<br />
Lernens extrem ungleich verteilt. Arbeitgeber<br />
unterstützen 75 % der schon sehr gut Ausgebildeten bei der<br />
Weiterbildung, aber nur 31 % der Arbeitenden mit Grundstufe.<br />
Im internationalen Vergleich ist das eine rekordhohe<br />
Schlechterstellung derjenigen, die Weiterbildung besonders<br />
nötig hätten. Frappant auch die Unterschiede zwischen<br />
Männern und Frauen.<br />
Quellen: Quellen: OFS-MRF OFS-MRF 2016, BFS 2016, 2017 BFS 2017<br />
Behinderte bekommen weniger weniger Weiterbildung<br />
Teilnahme Teilnahme an mindestens an einer einer informellen Weiterbildung<br />
ohne ohne Diplom, Diplom, ganze ganze Bevölkerung<br />
10 % 10 % 20,4% 20,4% 28,1%<br />
Behinderte und Migranten ausgeschlossen<br />
Der Anteil der Menschen mit einer starken Behinderung, die<br />
an einer Weiterbildung teilnehmen, ist dreimal geringer als<br />
jener der Menschen ohne Behinderungen. 2016 haben über<br />
70 % der Schweizerinnen und Schweizer eine Weiterbildung<br />
absolviert, aber nur 60 % der Ausländerinnen und Ausländer,<br />
welche die Schule in der Schweiz besucht haben.<br />
Menschen Menschen<br />
Behinderte<br />
mit starker mit starker<br />
Menschen Menschen<br />
Behinderung<br />
insgesamt insgesamt<br />
Nicht-Behinderte<br />
Quellen: Quellen: BFS, Schweizerische BFS, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) (SAKE) 2011 2011
16<br />
Eine bessere<br />
Arbeitswelt<br />
Das beste Mittel gegen<br />
die Krise: höhere Löhne<br />
Vor zehn Jahren brach die Finanzspekulation<br />
zusammen, dar<strong>auf</strong> folgte<br />
eine globale Wirtschaftskrise. Sie hat<br />
viele Millionen Existenzen vernichtet.<br />
In der EU wurde die Krise verstärkt<br />
durch die aggressive Tieflohn- und<br />
Sparpolitik Deutschlands, in der<br />
Schweiz durch den harten Franken<br />
der SNB. Er zerstörte Tausende KMU.<br />
Heute melden die meisten Länder<br />
neuen Aufschwung. <strong>Für</strong> die Schweiz<br />
rechnet das Seco mit 2,4 Prozent<br />
Wachstum. Doch hinter dem Nebel<br />
der Jubelnachrichten taucht eine brutalere<br />
Welt <strong>auf</strong>: Das reichste 1 Prozent<br />
hat mehr als 75 Prozent des Wohlstandes<br />
konfisziert, der seit 2008 geschaffen<br />
wurde. Die Gesellschaften sind ungleicher<br />
denn je.<br />
Auch in der Schweiz. Mit der Ungleichheit<br />
steigt die Zahl der prekären<br />
Jobs, der Druck, die Armut. Doch SVP<br />
und FDP ist das nicht genug. Sie<br />
eskalieren den Sparterror, greifen die<br />
Sozialwerke an und wollen gegen den<br />
Willen des Volkes noch mehr Steuergeschenke<br />
für die Aktionäre.<br />
Ökonomen von Verstand wissen,<br />
welcher Hebel am besten dagegen<br />
wirkt: Wir müssen die Erhöhung der<br />
Löhne erzwingen. Um mindestens<br />
drei Prozent.<br />
Grafische Industrie: In den Verhandlungen muss nun ein guter GAV gesichert werden. (© Margareta Sommer)<br />
wid.world und<br />
sgb.ch<br />
Petition: «Stopp dem<br />
Personal abbau bei der<br />
Swisscom»<br />
Die Swisscom ist ein hoch rentables<br />
Unternehmen, das jedes Jahr Milliardengewinne<br />
schreibt. Der Bund als<br />
Mehrheitsaktionär kassiert Dividenden<br />
von gegen 600 Millionen Franken.<br />
Kein Wunder, betrachtet der Bundesrat<br />
die Swisscom durch die Brille der<br />
Finanz und hält an seinen Gewinnvorgaben<br />
fest. Das setzt die Swisscom unter<br />
Druck. Infolge der technologischen<br />
Transformation muss das<br />
Unternehmen permanent in die Netze<br />
investieren und neue Geschäftsfelder<br />
entwickeln. Gleichzeitig brechen<br />
traditionelle Geschäfte ein oder werfen<br />
weniger Geld ab. So führte der<br />
Spardruck in den letzten Jahren zunehmend<br />
zu Stellenabbau, der für die<br />
Mitarbeitenden unerträglich geworden<br />
ist. Die Swisscom benötigt Innovationen.<br />
Doch wie sollen Innovationen<br />
entstehen in einem Arbeitsumfeld,<br />
das geprägt ist von Demotivation und<br />
Resignation? Wachsender Arbeitsdruck,<br />
hohe Arbeitslast und die permanente<br />
Angst vor dem Stellenverlust<br />
haben ein unverantwortliches Mass<br />
erreicht. Deshalb hat <strong>syndicom</strong> konzernintern<br />
eine Petition lanciert, die<br />
den Bundesrat <strong>auf</strong>fordert, seine Eignerstrategie<br />
unverzüglich anzupassen<br />
und den Personalabbau zu stoppen.<br />
(Franz Schori)<br />
Zur Petition: bit.ly/2FhzsD9<br />
Vergleiche auch Seite 5
«Wir machen einen grossen Schritt für mehr Transparenz<br />
und weniger Willkür bei den Lohnerhöhungen.» David Roth<br />
17<br />
Lohnrechner Post:<br />
endlich Transparenz<br />
Die Lohnverhandlungen 2018 haben zu einem komplexen, aber<br />
fairen Lohnabschluss geführt. Mit diesem Lohnrechner bietet<br />
Dir <strong>syndicom</strong> eine einfache Möglichkeit, zu überprüfen, ob die<br />
Lohnerhöhung korrekt berechnet wurde.<br />
natürlich auch die jeweilige Firma. Bereits<br />
über 2000 Personen haben bis<br />
Redaktionsschluss von diesem neuen<br />
Instrument Gebrauch gemacht.<br />
Das ist ein grosser Schritt für mehr<br />
Transparenz und weniger Willkür bei<br />
den Lohnerhöhungen. Denn bislang<br />
konnten sich Vorgesetzte hinter der<br />
Komplexität des Lohnsystems verstecken<br />
und haben langjährigen Mitarbeitenden<br />
oft individuelle Lohnerhöhungen<br />
verweigert. Mit dem<br />
Lohnrechner können <strong>alle</strong> bis <strong>auf</strong> den<br />
Franken genau ermitteln, wie viel die<br />
Vorgesetzten pro Vollzeitstelle zur<br />
Verfügung haben.<br />
Je organisierter, umso besser<br />
Wer beim Lohnrechner mehrere<br />
Varianten ausprobiert und dabei die<br />
verschiedenen Firmen miteinander<br />
vergleicht, wird rasch feststellen, dass<br />
die Lohnabschlüsse unterschiedlich<br />
ausgef<strong>alle</strong>n sind. Dabei ist auch offensichtlich:<br />
Je stärker <strong>syndicom</strong> ist,<br />
desto besser f<strong>alle</strong>n die Lohnabschlüsse<br />
aus. (David Roth)<br />
Die Applikation<br />
berechnet<br />
Tausende von<br />
Lohnvarianten<br />
(© <strong>syndicom</strong>)<br />
Ist meine Lohnerhöhung korrekt berechnet?<br />
Wie viel hat mein/e Vorgesetzte/r<br />
für individuelle Loherhöhungen<br />
zur Verfügung? Diese Fragen<br />
können die Belegschaften von Post,<br />
PostAuto, PostAuto-Unternehmen,<br />
IMS und SPS ganz einfach klären. <strong>syndicom</strong><br />
hat für sie einen Lohnrechner<br />
erarbeitet, der die persönliche Lohnerhöhung<br />
berechnen kann. Dabei werden<br />
die drei Kategorien der Lohnerhöhung<br />
präzise ausgewiesen. Aufgeteilt<br />
ist das Resultat in den Pflichtanteil,<br />
die mögliche individuelle Erhöhung<br />
und die zustehende Einmalzahlung.<br />
Einfache Bedienung<br />
Hinter der einfach zu bedienenden<br />
Oberfläche stehen Tausende von<br />
Kombinationen. Berücksichtigt werden<br />
dabei die Lage im Lohnband, die<br />
Lohnstufe, die Lohnregion sowie<br />
Die Zahlen, die diesem Rechner<br />
zugrunde liegen, hat <strong>syndicom</strong> von<br />
der Post verlangt. Leider hat die<br />
Post bei IMS und PostAuto falsche<br />
Zahlen geliefert. Dafür hat sich die<br />
Post entschuldigt. Seit dem<br />
23. April sind die korrekten Daten<br />
in den Rechner eingespeist. Wer<br />
seine Lohnerhöhung davor berechnet<br />
hat, sollte den Lohnrechner<br />
noch einmal ausfüllen.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/lohn18<br />
Auch der Staat ist<br />
gefordert<br />
Permanente berufliche Aus- und Weiterbildung<br />
ist das Gebot der Stunde.<br />
Denn Berufsbilder wandeln sich<br />
schneller denn je. Dies kann zwei unerfreuliche<br />
Folgen haben: <strong>auf</strong> der<br />
einen Seite Menschen, die ihre<br />
Arbeitsmarktfähigkeit und damit die<br />
berufliche Perspektive verlieren. Auf<br />
der anderen Seite Unternehmen, die<br />
wegen des Fachkräftemangels <strong>auf</strong> dem<br />
Arbeitsmarkt keine geeigneten Mitarbeitenden<br />
finden. <strong>syndicom</strong> konnte<br />
innerhalb eines Jahres zuerst im GAV<br />
Sunrise die Aus- und Weiterbildung<br />
stärken, wenige Monate später auch<br />
im GAV Swisscom als Anspruch anmelden.<br />
Die Einsicht der Unternehmen,<br />
dass sie mehr tun müssen, steigt auch<br />
in anderen Branchen. So ist zurzeit bei<br />
der Neu-Verhandlung des GAV in der<br />
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie<br />
die Stärkung der <strong>Bildung</strong> ein<br />
zentrales Thema. Gefordert sind aber<br />
nicht nur die Sozialpartner, sondern<br />
auch der Staat. So sollte er über die<br />
Arbeitslosenversicherung die Aus- und<br />
Weiterbildung stärken. Sie muss greifen,<br />
bevor Beschäftigte erwerbslos<br />
werden – und erst recht danach. Trotz<br />
<strong>alle</strong>r Bemühungen wird es weiterhin<br />
Menschen mit ausgeprägten Schwierigkeiten<br />
<strong>auf</strong> dem Arbeitsmarkt geben.<br />
Hier greift nur ein Instrument: das<br />
<strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> Arbeit.<br />
Giorgio Pardini, Leiter Sektor ICT und<br />
Mitglied der Geschäftsleitung
18 Arbeitswelt<br />
«Das <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> Weiterbildung ist eine Antwort, um die<br />
Auswirkungen der Digitalisierung abzufangen.» Matteo Antonini<br />
Wir wollen weder 6-Tage-Woche<br />
noch Arbeit <strong>auf</strong> Abruf!<br />
So wehren sich Logistikarbeitende gegen Flexibilisierung:<br />
Sie verweigern schlicht ihr Einverständis. Das ist rechtens.<br />
Arbeitgeber versuchen, ihre Arbeitnehmenden<br />
immer flexibler einzusetzen<br />
und dies als selbstverständlich erscheinen<br />
zu lassen. Dabei kann man<br />
sich dagegen mit einfachen Mitteln<br />
wehren, ohne dass negative Konsequenzen<br />
drohen.<br />
In der Logistik sind derzeit massive<br />
Anstrengungen im Gange, die<br />
6-Tage-Woche bei immer mehr Angestellten<br />
durchzusetzen. Viele wissen<br />
nicht, dass sie ihr Einverständnis dafür<br />
verweigern können.<br />
<strong>syndicom</strong> rät grundsätzlich davon<br />
ab, das Einverständnis zu geben. Denn<br />
die negativen Konsequenzen einer<br />
6-Tage Woche sind offensichtlich: Das<br />
private Leben lässt sich immer schwieriger<br />
planen. Und die ohnehin schon<br />
hohe körperliche Belastung wächst.<br />
Genau aus diesen Gründen schützt<br />
das Gesetz die Arbeitenden. Sie können<br />
eine 6-Tage-Woche ablehnen.<br />
Wenn Du weiterhin an 5 Tagen pro<br />
Woche arbeiten möchtest, dann<br />
kannst Du Dich weigern, die notwendige<br />
Einverständniserklärung zu unterschreiben<br />
(Verordnung Arbeitsgesetz,<br />
Artikel 20). Du bist im <strong>Recht</strong>.<br />
Viele sind sich <strong>alle</strong>rdings nicht bewusst,<br />
dass sie diese Möglichkeit haben.<br />
Oft präsentieren Vorgesetzte die<br />
Vereinbarungen auch als reine Formalität.<br />
Nicht selten melden sich auch<br />
Personen bei <strong>syndicom</strong>, die unter<br />
Druck gesetzt werden, solche Vereinbarungen<br />
zu unterschreiben. Das ist<br />
absolut unzulässig, und es ist dringend<br />
nötig, dass Betroffene sich umgehend<br />
bei <strong>syndicom</strong> melden.<br />
Missbrauch mit dem Pikettdienst<br />
Noch perfider ist die Nichtbeachtung<br />
von Regeln im Pikettdienst. Wer <strong>auf</strong><br />
Pikett ist, kann kurzfristig für Arbeitseinsätze<br />
<strong>auf</strong>geboten werden. <strong>Für</strong> diese<br />
Bereithaltung bezahlt die Arbeitgeberin<br />
auch eine Pikettentschädigung.<br />
Immer öfter versuchen Betriebe diese<br />
Entschädigungen zu sparen, indem<br />
sie Personen auch ohne Pikettentschädigung<br />
kurzfristig <strong>auf</strong>bieten.<br />
Das ist in der Logistik eine nicht zulässige<br />
Arbeit <strong>auf</strong> Abruf. <strong>Für</strong> notfallmässige,<br />
ausserplanmässige Einsätze ist<br />
der Pikettdienst geradezu geschaffen<br />
worden. Wer ohne Einteilung in den<br />
Pikettdienst kurzfristig einspringt,<br />
schadet sich und seinen Kolleginnen<br />
und Kollegen. (David Roth)<br />
Nur wenn Pikettdienst abgemacht und entschädigt ist, soll man Pikett leisten. (© xavierarnau/iStock)<br />
seco.admin.ch –> Arbeitsgesetz- und<br />
-Verordnungen<br />
Weiterbildung ist die<br />
soziale Verantwortung<br />
der Unternehmen<br />
Das <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> Weiterbildung ist kurzund<br />
mittelfristig die einzige mögliche<br />
Antwort, um die Auswirkungen der<br />
Digitalisierung <strong>auf</strong> Logistikberufe<br />
abzufangen. Wir reden von der Digitalisierung<br />
der Arbeitsweise, der Industrie<br />
4.0, der Uberisierung der Gesellschaft.<br />
Im Gegensatz zu früheren<br />
industriellen Revolutionen werden<br />
die Arbeitenden diesmal nicht in neue<br />
Sektoren ausweichen können. Sie werden<br />
sich während der ganzen beruflichen<br />
L<strong>auf</strong>bahn weiterbilden müssen.<br />
Zeit und Geld dafür müssen von<br />
den Unternehmen bereitgestellt<br />
werden, die <strong>auf</strong> diese Art soziale Verantwortung<br />
übernehmen können.<br />
Genauso von diesem Wandel betroffen<br />
sind die «white collars», deren<br />
Arbeitsplätze von Algorithmen und<br />
der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz<br />
bedroht sind. Seien wir<br />
ehrlich: Es wird nicht leicht werden,<br />
einen Postbeamten in einen IT-Ingenieur<br />
zu verwandelnd oder eine Sekretärin<br />
in eine Industrieplanerin usw.<br />
Und die Arbeit wird stark flexibilisiert<br />
sein. Warum sollen wir uns also weiterbilden,<br />
wenn dies unsere Aussichten<br />
sind?<br />
Die Antwort ist klar: Die Umstellung<br />
würde ohne ständige Weiterbildung<br />
sehr viel härter ausf<strong>alle</strong>n. Denn<br />
sie zwingt die Firmen dazu, ihren<br />
künftigen Bedarf zu planen und diese<br />
Planung zusammen mit den eigenen<br />
Mitarbeitenden anzugehen.<br />
Matteo Antonini ist Leiter des Sektors Logistik und<br />
Mitglied der <strong>syndicom</strong>-Geschäftsleitung
«Die Kolleginnen und Kollegen geben ihr Bestes, erhalten<br />
dafür aber keine richtige Gegenleistung.» Angelo Zanetti<br />
19<br />
Wir wollen die grossen Firmen<br />
in den GAV zurückholen.<br />
(© <strong>syndicom</strong>/Margareta Sommer)<br />
Die grafische Industrie muss gute<br />
Arbeitsbedingungen garantieren<br />
Der Arbeitgeberverband viscom hat den GAV für die grafische<br />
Industrie gekündigt. Er läuft am 31. Dezember aus.<br />
Im Juni beginnen wir mit neuen Verhandlungen.<br />
Der landesweite GAV betrifft rund<br />
450 Betriebe, die etwa 4000 Mitarbeitende<br />
beschäftigen. Dabei handelt es<br />
sich um ein wichtiges Instrument zur<br />
Regelung der Arbeits bedingungen in<br />
einem sich ständig wandelnden<br />
Sektor.<br />
In den vergangenen drei Jahren<br />
fehlte es nicht an Fusionen von Kleinbetrieben,<br />
Schliessungen oder auch<br />
Konkursen. Doch gleichzeitig gibt es<br />
Betriebe und Konzerne, die gut verdienen<br />
und erhebliche Geldsummen investieren.<br />
Deshalb werden wir jeden<br />
Versuch eines weiteren Abbaus der<br />
heutigen Arbeitsbedingungen mit<br />
<strong>alle</strong>r Kraft bekämpfen.<br />
Dies auch deshalb, weil aus der von<br />
unserer Branche im letzten Herbst<br />
durchgeführten Umfrage klar hervorging,<br />
dass die Kolleginnen und Kollegen<br />
trotz Hiobsbotschaften ihr Bestes<br />
geben (Flexibilität, Engagement,<br />
Professionalität und, bei denjenigen<br />
mit 42-Stunden-Woche, Gratisarbeit),<br />
aber dafür keine richtige Gegenleistung<br />
erhalten, wie etwa Lohnerhöhungen.<br />
2017 stiegen die Preise, aber die<br />
Löhne der Kolleginnen und Kollegen<br />
blieben unverändert.<br />
Bei den neuen Verhandlungen<br />
wird auch ein besonderes Augenmerk<br />
<strong>auf</strong> die Fortbildung gerichtet. Unser<br />
GAV enthält diesbezüglich bereits<br />
heute gute Bestimmungen, wenn wir<br />
an das aktuelle Angebot von Helias<br />
denken. Es gibt aber sicher noch<br />
Verbesserungspotenzial, besonders<br />
bezüglich der Umsetzung dieser Massnahmen.<br />
Firmen in den GAV zurückholen<br />
<strong>syndicom</strong> engagiert sich aber auch in<br />
den Betrieben, die beschlossen haben,<br />
<strong>auf</strong> die Sozialpartnerschaft zu verzichten.<br />
Dazu gehören Orell Füssli, Swissprinters<br />
und, nicht zu vergessen,<br />
Tamedia, die nach der Schliessung<br />
von Ringier Print in Adligenswil und<br />
der dar<strong>auf</strong> folgenden Übernahme von<br />
deren Zeitungen und Tagesblättern<br />
immer mehr eine Monopolstellung im<br />
Zeitungsdruck einnimmt. Es ist klar,<br />
dass ohne Kollektivvertrag keine<br />
Gewähr mehr für gute Arbeitsbedingungen<br />
besteht. Deshalb kämpfen wir<br />
an der Seite der Arbeitnehmenden<br />
dafür, dass diese Betriebe <strong>auf</strong> ihrem<br />
Weg wieder kehrtmachen.<br />
Nur die Mobilisierung bringt Erfolg<br />
Bei solchen Gelegenheiten kommt<br />
den Arbeitnehmenden, die dem GAV<br />
unterstehen, eine ganz wichtige Rolle<br />
zu. Denn es reicht nicht aus, sich mit<br />
Forderungen und einer kompakten,<br />
kämpferischen Delegation an den<br />
Verhandlungstisch zu setzen. Wir<br />
benötigen auch die Unterstützung<br />
und Mitwirkung all jener, die in diesen<br />
450 Betrieben arbeiten.<br />
Mitwirkung bedeutet konkret, sich<br />
mit den Kolleginnen und Kollegen im<br />
Betrieb zu solidarisieren. Es bedeutet,<br />
sich die Zeit zu nehmen, um die<br />
Zwischenergebnisse der Verhandlungen<br />
zu diskutieren. Nach jeder<br />
Verhandlungsrunde wird ein Newsletter<br />
verschickt werden. Mitwirkung<br />
bedeutet auch, an Versammlungen<br />
oder Aktionen teilzunehmen, die die<br />
GAV-Strategiegruppe organisiert. Kurz,<br />
es braucht Solidarität.<br />
(Angelo Zanetti)<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/branchen/giv/
20 Arbeitswelt<br />
«Über <strong>Bildung</strong> können wir Berufsleute die Zukunft unserer<br />
Arbeitswelt entscheidend mitgestalten.» Michael Moser<br />
Das Unwesen mit den Praktika<br />
Praktika grassieren. Immer mehr junge Menschen müssen vor der Lehre ein Praktikum ablegen.<br />
In Wahrheit handelt es sich oft nur um eine üble Form der Ausbeutung.<br />
Eigentlich sollten Praktika beim Berufseinstieg<br />
helfen – nach der Lehre<br />
oder einem Studium. Doch in den letzten<br />
Jahren kam ein neues Phänomen<br />
<strong>auf</strong>: Vorlehrpraktika. Dabei werden<br />
Jugendliche für bis zu einem Jahr zu<br />
Niedriglöhnen im Betrieb eingesetzt.<br />
Angeblich um den Beruf kennenzulernen.<br />
Vor <strong>alle</strong>m im Sozial- und Gesundheitsbereich,<br />
aber auch in Coiffeurbetrieben,<br />
wird immer öfter verlangt, vor<br />
der Lehre ein Praktikum zu absolvieren.<br />
Doch diese Praxis hat es in sich.<br />
Vergangenen Sommer berichteten<br />
beispielsweise zwei junge Frauen in<br />
der Unia-Zeitung «work» von den Arbeitsbedingungen<br />
als Praktikantinnen<br />
in einer Kita. Mit 16, ohne Ausbildung<br />
und zum Praktikumslohn von<br />
900 Franken im Monat, sollten sie dieselbe<br />
Arbeit wie ausgelernte Berufsfachleute<br />
leisten. Eine Lehrstelle war<br />
dabei nicht garantiert. Einer der beiden<br />
jungen Frauen wurde gar erst<br />
nach einem halben Jahr gesagt, dass<br />
in Wahrheit nur zwei Lehrstellen für<br />
fünf Praktikantinnen zur Verfügung<br />
stünden.<br />
Fronarbeit für nix und gar nichts<br />
Um eine Ausbildung handelt es sich<br />
dabei nicht. Die jungen Frauen haben<br />
kaum Instruktionen erhalten, beuschten<br />
keine Schule, und es gab statt<br />
Lernzielen nur harte Arbeit. Aufgrund<br />
solcher Fälle hat die Unia Jugend eine<br />
Kampagne gegen Vorlehrpraktika gestartet,<br />
die mit der Vergabe eines<br />
«Apprentice Simply Ignored-Award»<br />
an einen Coiffeurbetrieb gipfelte. Der<br />
Coiffeur verlangt von <strong>alle</strong>n künftigen<br />
Lernenden, ein Jahr unbezahlt und<br />
ohne Aussicht <strong>auf</strong> eine Lehrstelle ein<br />
Praktikum zu absolvieren. Mehr noch:<br />
Wer die Lehre in einem anderen Betrieb<br />
absolviert, schuldet 1500 Franken<br />
für die angebliche Ausbildung. Es<br />
ist klar: Das ist reine Ausbeutung junger<br />
Menschen.<br />
Und in den <strong>syndicom</strong>-Branchen?<br />
Noch sind Vorlehrpraktika nicht<br />
üblich. Dass diese unsozialen, ausbeuterischen<br />
Anstellungen bei uns<br />
nicht einreissen, dafür setzt sich die<br />
<strong>syndicom</strong> in ihren Branchen ein. Besonders<br />
die IG Jugend, die Interessenvertretung<br />
<strong>alle</strong>r unter 31 bei <strong>syndicom</strong>.<br />
(Dominik Fitze)<br />
Arbeit zum Praktikumslohn von 900 Franken, ohne garantierte Lehrstelle. (© fotolia)<br />
alt.workzeitung.ch/tiki-read_article.php?articleId=2952&topic=1<br />
Wenn <strong>Bildung</strong> etwas<br />
Eigenes ist<br />
Wenn Arbeit nicht einfach etwas Vorgeschriebenes<br />
ist, sondern ein Beruf,<br />
dein Beruf, dann hat die Tätigkeit, die<br />
wir ausüben, um unseren Lebensunterhalt<br />
zu verdienen, plötzlich eine<br />
andere Bedeutung. Man erledigt nicht<br />
für Geld eine Aufgabe, sondern man<br />
stellt für Lohn seine Fähigkeiten zur<br />
Verfügung. Was ein fundamentaler<br />
Unterschied ist.<br />
Die Grundbildung der grafischen<br />
Industrie wird seit der Gründung des<br />
Typographenbundes 1858 zwischen<br />
den Arbeitenden und den Arbeitgebern<br />
ausgehandelt, paritätisch erarbeitet<br />
und in der Branche umgesetzt.<br />
Das heisst, Berufsleute bestimmen<br />
mit, was in ihren Berufslehren, wie<br />
etwa dem Drucktechnologen oder neu<br />
dem Interactive Mediadesigner, ausgebildet<br />
wird.<br />
Somit wird nicht einfach vorgegeben,<br />
was zu tun ist, sondern wir schaffen<br />
uns die Möglichkeiten und die<br />
Grenzen unseres Handwerkes selbst.<br />
So können wir als Berufsleute über<br />
<strong>Bildung</strong> die Zukunft unsere Arbeitswelt<br />
entscheidend mitgestalten.<br />
Am Schluss profitieren sogar die<br />
Unternehmungen. Sie haben <strong>auf</strong> den<br />
ersten Blick zwar weniger Macht bei<br />
sich selbst, dafür aber Berufsleute in<br />
ihrer Branche, die ihr Handwerk eigenständig<br />
erweitern und so zu immer<br />
neuer Blüte treiben können.<br />
Michael Moser, Zentralsekretär Sektor Medien<br />
pbs-opf.ch
«Dass Migrantinnen und Migranten ohne Abschluss eine<br />
Ausbildung mit EFZ absolvieren, ist eine gute Sache.» Patrizia Mordini<br />
21<br />
Wenn die Erfahrung<br />
zählt – die Chance<br />
einer späten Lehre<br />
Als Migrantin oder Migrant ohne Abschluss<br />
bereits viele Jahre in einem Betrieb<br />
tätig und nun Lust <strong>auf</strong> einen Lehrabschluss?<br />
Die Nachholbildung nach<br />
Artikel 32 Berufsbildungsverordnung<br />
macht es möglich. Sie richtet sich an<br />
<strong>alle</strong> Erwachsenen, die beispielsweise<br />
aus familiären oder Altersgründen keine<br />
Lehre mehr machen können, aber<br />
dennoch eine vollständige Ausbildung<br />
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis<br />
(EFZ) absolvieren möchten.<br />
Wenn jemand zum Beispiel mindestens<br />
fünf Jahre Berufserfahrung in<br />
einem Betrieb wie der Post gesammelt<br />
hat, wovon drei im Bereich Logistik,<br />
kann er/sie innert zweier Jahre den Abschluss<br />
als Logistiker/Logistikerin Distribution<br />
erlangen. Als berufliche Erfahrung<br />
gilt die Summe <strong>alle</strong>r<br />
nachgewiesenen beruflichen Tätigkeiten<br />
im Logistikbereich. Und bereits absolvierte<br />
Grundbildungen können angerechnet<br />
werden. Über die Zulassung<br />
zum Qualifikationsverfahren entscheidet<br />
das kantonale Amt für Berufsbildung<br />
des Wohnorts. Verschiedene Berufsschulen<br />
bieten diese Lehrgänge an.<br />
Eine gute Sache. Sprich deinen Arbeitgeber<br />
<strong>auf</strong> diese Möglichkeit an. Wir bieten<br />
dabei gerne Unterstützung.<br />
Die Website www.logistiker-logistikerin.<br />
ch/art-32-bbv/ bietet einen Überblick.<br />
Patrizia Mordini, Leiterin Gleichstellung,<br />
Mitglied der Geschäftsleitung<br />
Der neue GAV Swisscom im Urteil<br />
von 250 Angestellten<br />
Erstmals hat <strong>syndicom</strong> «GAV-Infolunches» durchgeführt. An<br />
rund 30 Veranstaltungen wurde der neue Gesamtarbeitsvertrag<br />
erläutert und diskutiert. Einen regen Austausch gab es etwa<br />
über den Anspruch <strong>auf</strong> fünf Weiterbildungstage pro Jahr.<br />
Am 3. April nahmen in Liebefeld in der<br />
Nähe von Bern 19 Personen an der<br />
letzten der rund 30 Informationsveranstaltungen<br />
teil, die in Form von<br />
«GAV-Infolunches» von Bern bis Basel,<br />
von Bellinzona, Lausanne, Biel, Freiburg<br />
bis Luzern, Thun und Chur, von<br />
Genf über Zürich bis nach Sion organisiert<br />
wurden, um die Neuheiten des<br />
GAV Swisscom vorzustellen. Dieser<br />
tritt am kommenden 1. Juli in Kraft.<br />
Insgesamt hatten rund 250 Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter Gelegenheit,<br />
in Form von Anträgen ihre<br />
Wünsche für die künftige Weiterentwicklung<br />
des GAV zu äussern und diejenigen<br />
Anträge zu unterstützen, die<br />
ihnen am sinnvollsten erschienen.<br />
Allerdings ist noch nicht <strong>alle</strong>s geregelt.<br />
Der neue Anspruch <strong>auf</strong> fünf Weiterbildungstage<br />
pro Jahr für <strong>alle</strong> Mitarbeitenden<br />
kann erst ab Januar 2019<br />
geltend gemacht werden. Bis dahin<br />
muss das Kriterium der Arbeitsmarktfähigkeit,<br />
das Anspruch <strong>auf</strong> diese Weiterbildungen<br />
erst verleiht, enger definiert<br />
werden. Davon wird abhängen,<br />
für welche Art von Weiterbildungen<br />
diese fünf Tage bezogen werden können<br />
– Lernende beispielsweise haben<br />
keinen Anspruch dar<strong>auf</strong>. In keinem<br />
anderen GAV in der Schweiz sind ähnlich<br />
fortschrittliche Bestimmungen<br />
vorgesehen.<br />
Das <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> Abschalten<br />
Eine weitere wichtige Neuerung: Der<br />
Ferienanspruch wird gestaffelt nach<br />
Alter ab dem 35. Lebensjahr erhöht.<br />
Ausserdem sieht der GAV das <strong>Recht</strong><br />
vor, während der Freizeit nicht gestört<br />
zu werden (<strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> Nichterreichbarkeit).<br />
Der Mutterschaftsurlaub wird<br />
von 17 <strong>auf</strong> 18 Wochen erhöht und die<br />
Väter haben Anspruch <strong>auf</strong> drei statt<br />
zwei Wochen Urlaub. Zudem umfasst<br />
der GAV einen besseren Kündigungsschutz<br />
für Personal- und Gewerkschaftsvertreter.<br />
Lunch-Teilnehmer Georg schätzt<br />
den «direkten Kontakt mit der Gewerkschaft»,<br />
den diese Veranstaltungen ermöglichen.<br />
Er bedauert, dass der Anspruch<br />
<strong>auf</strong> Weiterbildung eher für<br />
Junge bestimmt ist: «Wir werden nicht<br />
mehr gefragt, obwohl wir diese ebenso<br />
oder noch mehr benötigen würden.»<br />
Marianne ist der Auffassung, dass<br />
in einem künftigen GAV ein Kündigungsschutz<br />
für die ältesten Arbeitnehmenden<br />
vorgesehen werden soll,<br />
«denn da sie am meisten kosten, sind<br />
sie auch als erste betroffen». Sie rechnet<br />
mit einer besseren Regelung für<br />
das Homeoffice im Einvernehmen mit<br />
dem Arbeitgeber, um die «Ungleichbehandlungen»<br />
in diesem Bereich aus<br />
der Welt zu schaffen. Daniel bedauert,<br />
dass der Anspruch <strong>auf</strong> Weiterbildung<br />
noch nicht klar geregelt ist. Er wisse<br />
zum Beispiel nicht, ob er auch für Umschulungen<br />
gilt.<br />
(Sylvie Fischer)<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/branchen/telecom/swisscom/<br />
Swisscom-Angestellte diskutieren ihre Visionen für die Weiterentwicklung des GAV. (© Alexander Egger)
22 Politik<br />
Aus und Weiterbildung<br />
im digitalen Zeitalter<br />
Alles geht schnell, zu schnell.<br />
Vor <strong>alle</strong>m in der Arbeitswelt.<br />
Das <strong>Bildung</strong>s system, von der<br />
Schule bis zur Weiter bildung,<br />
muss sich rasch anpassen.<br />
Sonst besteht die Gefahr,<br />
dass Generationen von<br />
heutigen und künftigen<br />
Arbeitnehmenden <strong>auf</strong> der<br />
Strecke bleiben. Aber welche<br />
Kompetenzen und Instrumente<br />
braucht es heute?<br />
Welche Rolle kommt bei<br />
dieser Transformation den<br />
Gewerkschaften zu?<br />
Text: Marc Rezzonico<br />
Bilder: Johan Mouchet/unsplash<br />
Diese Fragen, welche die Digitalisierung<br />
für die Weiterbildung <strong>auf</strong>wirft,<br />
lassen sich <strong>auf</strong> zwei Arten beantworten:<br />
Man kann die unzähligen Studien,<br />
Statistiken und Artikel lesen, die<br />
es über die <strong>Bildung</strong> im digitalen<br />
Zeitalter gibt. Oder man kann – wie<br />
es Platon in seinem Höhlengleichnis<br />
beschreibt – mithilfe einer<br />
Lichtquelle die Schatten betrachten,<br />
die sich an den Wänden abzeichnen,<br />
und dadurch allmählich begreifen,<br />
was geschieht. Wir wählen<br />
die zweite Möglichkeit – und als<br />
Lichtquelle die Lebensläufe!<br />
Das Ende des CV<br />
An die Stelle des<br />
CV tritt das digitale<br />
Dossier – und sein<br />
Algorithmus.<br />
<strong>Bildung</strong>, Arbeitswelt, Technologie<br />
und Digitalisierung folgen par<strong>alle</strong>l<br />
verl<strong>auf</strong>enden Wegen. An ganz bestimmten<br />
Orten kreuzen sich diese<br />
aber regelmässig: in den Büros der<br />
Personalverantwortlichen.<br />
Personalverantwortliche wissen,<br />
was die Berufswelt verlangt und welche<br />
Aus und Weiterbildungsziele,<br />
Technologien und Kernkompetenzen<br />
gefordert sind.<br />
Im Zentrum der Arbeit der Rekrutierer<br />
steht der Lebensl<strong>auf</strong>, der<br />
CV. «Lebensläufe sind grässlich»,<br />
sagte Laszlo Bock, ehemaliger HR<br />
Chef bei Google. «Sie erfassen nicht<br />
die ganze Person. Bestenfalls liefern<br />
sie Informationen über ihre frühere<br />
Tätigkeit. Sie sagen aber nichts darüber<br />
aus, was sie jetzt kann oder<br />
künftig beherrschen wird. Auch zur<br />
Persönlichkeit eines Bewerbers, zu<br />
seinem Charakter, seiner Überzeugungskraft<br />
und Kommunikationsfähigkeit<br />
sowie zu seinen allgemeinen
Arbeitgeber nutzen Softwareprogramme und digitale Dossiers, um unsere Kompetenzen zu<br />
ermitteln. Und bald ist die Bewerbung passé: Es wird die Arbeit sein, die den Arbeitssuchenden<br />
findet. Jetzt muss massiv in eine Aus und Weiterbildung investiert werden, die wieder sämtliche<br />
Arten von Intelligenz <strong>auf</strong>wertet, damit wir <strong>auf</strong> die angel<strong>auf</strong>enen Veränderungen vorbereitet sind.<br />
23<br />
Kompetenzen erfahren wir praktisch<br />
nichts.»<br />
Die Unternehmen suchen deshalb<br />
nach anderen Methoden, um<br />
Mitarbeitende auszusuchen. Einige<br />
nutzen Persönlichkeitstests. Andere<br />
entwickeln immer ausgeklügeltere<br />
Softwareprogramme, um die<br />
gesuchten Kompetenzen herauszufiltern.<br />
Bei <strong>alle</strong>n diesen Prozessen<br />
besteht ein hohes Risiko der Persönlichkeitsverletzung.<br />
Dem müssen<br />
die Vertreter der Arbeitnehmenden<br />
entgegenwirken.<br />
Unilever etwa verlangt von Kandidierenden<br />
gar keine Lebensläufe<br />
mehr und setzt stattdessen <strong>auf</strong> eine<br />
Kombination von spielerischen Formen<br />
von Evaluationen, Videointerviews<br />
und Problemlösungsübungen.<br />
Hier endet die glänzende Karriere<br />
des Lebensl<strong>auf</strong>s, wie man ihn kennt.<br />
An seine Stelle tritt ein digitales<br />
Dossier. Algorithmen analysieren<br />
das Dossier sowie die sozialen<br />
Medien und «matchen» Stellen mit<br />
Nutzerprofilen. Die passenden<br />
Nutzer werden dann eingeladen,<br />
sich zu bewerben. In naher Zukunft<br />
wird es also die Arbeit sein, die die<br />
Arbeitssuchenden findet.<br />
Zusammenfassend lassen sich<br />
zwei Phänomene festhalten: Die<br />
Personalverantwortlichen interessieren<br />
sich nicht mehr so sehr für<br />
die Vergangenheit der Bewerber als<br />
vielmehr für ihr Potenzial in der<br />
Zukunft. Und es ist nicht mehr der<br />
Arbeitssuchende, der nach einer<br />
Beschäftigung Ausschau hält, sondern<br />
umgekehrt.<br />
Heute ist oft schon gestern<br />
Werfen wir einen Blick <strong>auf</strong> einige<br />
aktuelle Fakten:<br />
– Heute reichen oft nur fünf Jahre,<br />
bis eine technische Idee, ein neuer<br />
Beruf oder neue ökonomische<br />
Modelle Alltag werden. Man denke<br />
zum Beispiel an die Kryptowährungen,<br />
die Plattformwirtschaft<br />
oder Berufe wie «Big Data Architect»<br />
und «ZumbaLehrer» (in der<br />
LinkedIn Rangliste 2014 der Berufe,<br />
die sich in den letzten fünf<br />
Jahren am stärksten verbreitet<br />
haben, steht der ZumbaLehrer an<br />
dritter Stelle!).<br />
– 2016 haben in der Schweiz fast<br />
80 % der 25 bis 34Jährigen in<br />
den vorangegangenen zwölf<br />
Monaten eine Weiterbildung besucht.<br />
Bei den 35 bis 54Jährigen<br />
waren es 69 %, bei den 55 bis<br />
64Jährigen 57 %. Sagt das Bundesamt<br />
für Statistik.<br />
– Die Lebensdauer einer Fachkompetenz<br />
ist von 30 Jahren in den<br />
80erJahren <strong>auf</strong> gerade 5 Jahre gesunken<br />
(DeloitteBericht).<br />
– Rund 30 % der Erwerbstätigen <strong>alle</strong>r<br />
Arbeitsgruppen, aber 42 % der<br />
unter 30Jährigen ziehen eine berufliche<br />
Umschulung in Betracht.<br />
– In der Schweiz gibt es beispielsweise<br />
neu die berufliche Weiterbildung<br />
zum Solarinstallateur<br />
oder Solarteur. Er ist qualifiziert,<br />
die Beratung, Projektierung, Installation,<br />
Inbetriebnahme und<br />
Wartung in den Bereichen Photovoltaik,<br />
Solarthermie und Wärmepumpen<br />
zu koordinieren und<br />
durchzuführen.<br />
– Crowdworking (Arbeiten über eine<br />
digitale Plattform) betrifft in<br />
irgendeiner Form bereits mehr als<br />
eine Million Personen in der<br />
Schweiz (gemeinsame Studie der<br />
Universität Hertfordshire und des<br />
Unternehmens Ipsos MORI, in Zusammenarbeit<br />
mit der Foundation<br />
for European Progressive Studies,<br />
UNI Europa und <strong>syndicom</strong>, siehe<br />
<strong>syndicom</strong> <strong>magazin</strong> 1).<br />
Wie man sehen kann, ist der Verkehr<br />
in der Welt der Arbeit und der<br />
Aus und Weiterbildung dichter und<br />
komplexer geworden als je zuvor.<br />
Gelenkt wird er von den Personalverantwortlichen,<br />
die zunehmend<br />
digitale Werkzeuge einsetzen. Bis<br />
zum Tag, wo «die Arbeit den Arbeitssuchenden<br />
finden wird», ohne<br />
menschliche Beteiligung. Und hier<br />
zeigt sich nun die Rolle, die die Gewerkschaften<br />
wahrnehmen müssen.<br />
Neue Gewerkschaftsstrategien<br />
Gewerkschaften<br />
müssen energisch<br />
Investitionen in<br />
<strong>Bildung</strong> fordern.<br />
Wenn junge Berufstätige wenige Jahre<br />
nach Abschluss ihrer Ausbildung<br />
an eine berufliche Umschulung denken,<br />
so liegt das häufig da ran, dass<br />
ihr Beruf bald verschwinden wird.<br />
Wenn die Mehrheit der Arbeitnehmenden<br />
Weiterbildungen besucht,<br />
tun sie das, weil sie fürchten, ihre<br />
Kompetenzen würden schnell veralten.<br />
Wenn ein Installateur fünf<br />
Berufe gleichzeitig ausübt, verdrängt<br />
er vier Personen. Wenn<br />
digitale Plattformen für einige die<br />
einzige Einnahmequelle darstellen,<br />
geraten «Arbeitszeiten» und andere<br />
wichtige Elemente des Arbeitsvertrags<br />
unter die Räder.<br />
Die Gewerkschaften müssen<br />
den Arbeitenden in solchen Situationen<br />
zur Seite stehen und <strong>auf</strong><br />
korrekten Arbeitszeiten und Löhnen<br />
bestehen, etwa mit dem universellen<br />
Arbeitsvertrag, den <strong>syndicom</strong><br />
fordert. Vor <strong>alle</strong>m aber müssen sie<br />
bei Staat und Unternehmen besondere<br />
Anstrengungen bei der Ausund<br />
Weiterbildung durchsetzen.<br />
Transversale Kompetenzen<br />
Es reicht heute nicht mehr aus, über<br />
gute fachliche Kompetenzen zu verfügen<br />
und eine Fremdsprache zu beherrschen.<br />
Immer mehr achten die<br />
Rekrutierer <strong>auf</strong> das Knowhow, das<br />
es braucht, um in der Berufswelt zu<br />
bestehen. Bei diesen sogenannten<br />
transversalen Kompetenzen handelt<br />
es sich beispielsweise um Führungs,<br />
Kommunikations und Projektmanagementfähigkeiten,<br />
Teamfähigkeit,<br />
Zahlenverständnis,<br />
kritisches Denken, Verhandlungsgeschick,<br />
Informationsbeschaffung<br />
und – am heikelsten – die Kreativität.<br />
Diese Kompetenzen werden<br />
schon im Kindesalter erworben und<br />
entwickeln sich weiter. Sie ermöglichen<br />
es, zu lernen, harmonisch zu<br />
interagieren und sich an diverse<br />
Lebenssitua tionen anzupassen. Im<br />
schweizerischen Schulsystem werden<br />
sie aber nur sporadisch geübt.<br />
Lernen zu lernen<br />
Hier zeichnet sich eine Antwort ab.<br />
Die Aus und Weiterbildung im digitalen<br />
Zeitalter muss (wieder) <strong>alle</strong><br />
Arten von Intelligenz <strong>auf</strong>werten,<br />
damit <strong>alle</strong> gleich befähigt werden,<br />
neue berufliche L<strong>auf</strong>bahnen einzuschlagen,<br />
um den Veränderungen<br />
der Arbeitswelt zu begegnen.<br />
Anders ausgedrückt: Bei dieser<br />
Aus und Weiterbildung dürfen die<br />
Noten in Mathematik, Deutsch oder<br />
Französisch <strong>alle</strong>in die künftigen<br />
Berufs chancen nicht mehr beeinträchtigen.<br />
vpodbildungspolitik.ch
24<br />
Dank digitalen Kommunikationstechniken haben Kinder und andere Lernende<br />
jederzeit Zugang zum Wissen. Etliche Firmen tüfteln am Lernen von morgen.<br />
ELearning,<br />
MOOCS und<br />
Serious Games<br />
Kleine Umschau in digitaler<br />
Pädagogik<br />
Wir kennen den Begriff ELearning,<br />
der einfach eine Onlineschulung bezeichnet,<br />
also die Möglichkeit, sich<br />
im Internet <strong>auf</strong> einer rund um die<br />
Uhr zugänglichen Plattform<br />
weiterzubilden.<br />
Die bekannteste Art des ELearnings<br />
sind die MOOCS (Massive<br />
Open Online Course), Fernschulungen,<br />
die von vielen Teilnehmenden<br />
gleichzeitig absolviert werden können.<br />
Sie werden oft von Universitäten<br />
oder anderen höheren Schulen<br />
angeboten. Die sehr stark standardisierten<br />
MOOCS eröffneten den Weg<br />
zum «Adaptive Learning », also zum<br />
personalisierten Lernen je nach<br />
Lerntempo, Schwierigkeiten und<br />
Vorlieben des Schülers oder der<br />
Schülerin.<br />
Zur Schulung von Personen,<br />
die lieber selbstständig und fortl<strong>auf</strong>end<br />
lernen oder das tun müssen,<br />
gibt es die Serious Games (Spiele,<br />
die nicht primär unterhalten sollen,<br />
sondern der <strong>Bildung</strong>, Information,<br />
Kommunikation und dem Marketing<br />
dienen). Dazu zählen Projekte<br />
wie die schulische Unterstützung<br />
via Chat (z.B. Profenpoche). Berufsberatungstools<br />
(z.B. Hello Charly).<br />
Auf eine Lesedauer von 20 Minuten<br />
zusammengefasste aktuelle Bücher<br />
(z.B. Koober). Ein Uber des <strong>Bildung</strong>swesens,<br />
der in wenigen Minuten<br />
einen Lehrer ins Haus schickt (z.B.<br />
SmartPapi). Spielerische <strong>Bildung</strong><br />
(Pistache) und massgeschneiderte,<br />
anonyme Tutorials (Studypool).<br />
Schule ohne Wandtafeln<br />
Wie man sieht, unterliegen die<br />
Schülerinnen und Schüler keinen<br />
festen Stundenplänen, und die<br />
Lehrpersonen werden zu Coaches<br />
oder online erreichbaren Präsenzen.<br />
Die kreative, vernetzte, partizipative<br />
Schule von morgen kommt somit<br />
ohne Pulte und Wandtafeln aus und<br />
passt das Lernen dem Schüler oder<br />
der Schülerin an – und nicht umgekehrt.<br />
(Marc Rezzonico)<br />
ethz.ch/de/dieethzuerich/lehre/<br />
innovation/moocs.html<br />
Anzeige<br />
Eine Fülle an Aktivitäten<br />
<strong>auf</strong> Freizeit.ch!<br />
Finden Sie online<br />
über 7'000 Freizeitaktivitäten<br />
originelle Wochenend-Ideen<br />
<strong>alle</strong> News Ihrer Region<br />
aktive Facebook Community<br />
sowie attraktive Gewinnspiele,<br />
Aktions-Coupons zum Herunterladen<br />
und monatliche Newsletter<br />
SOMMER-<br />
UMFRAGE<br />
Vom 13. Juni bis<br />
13. Juli teilnehmen<br />
und tolle Preise<br />
gewinnen !
<strong>Recht</strong> so!<br />
25<br />
Fragen an den <strong>syndicom</strong>-<strong>Recht</strong>sdienst:<br />
Guten Tag, seit vielen Jahren arbeite ich bei derselben<br />
Arbeitgeberin in derselben Tätigkeit. Seit meinem Berufsabschluss<br />
habe ich keine weiteren Ausbildungen mehr<br />
absolviert. Nun habe ich die Befürchtung, dass ich im<br />
Vergleich zu meinen jüngeren Kollegen als ungenügend<br />
ausgebildet gelte und später eher auch mal von einer<br />
Kündigung betroffen sein könnte. Damit ich mithalten kann,<br />
möchte ich mich gerne weiterbilden lassen. Habe ich<br />
gegenüber meiner langjährigen Arbeitgeberin einen<br />
Anspruch <strong>auf</strong> Weiterbildung?<br />
Ich habe mir eine berufsrelevante Weiterbildung herausgesucht,<br />
die ich gerne besuchen möchte. Mir ist es jedoch<br />
nicht möglich, diese selbst zu finanzieren und vollumfänglich<br />
in der Freizeit zu besuchen. Die Arbeitgeberin würde<br />
sich an den Kosten beteiligen. Was gilt es hier zu beachten?<br />
Ebenfalls finden einige Ausbildungsmodule tagsüber unter<br />
der Woche statt, und die Ausbildung ist zusätzlich mit viel<br />
Selbststudium verbunden. Ist meine Arbeitgeberin<br />
verpflichtet, mir hierfür frei zu geben oder auch Arbeitszeit<br />
zum Selbststudium zu gewähren? Schliesslich profitiert sie<br />
vom erworbenen Wissen auch mit.<br />
Antwort des <strong>syndicom</strong>-<strong>Recht</strong>sdienstes<br />
Das berufliche Fortkommen muss<br />
auch als ein von der <strong>Für</strong>sorgepflicht<br />
des Arbeitgebers erfasstes geschütztes<br />
Gut anerkannt werden. Ob den<br />
Arbeitnehmern ein generelles <strong>Recht</strong><br />
<strong>auf</strong> Weiterbildung zusteht, ist<br />
differenziert anzusehen. Ein Anspruch<br />
liegt dann vor, wenn er sich<br />
aus dem Arbeitsvertrag oder einem<br />
anwend baren Gesamtarbeitsvertrag<br />
ergibt. Hingegen liegen keine<br />
Gerichts urteile vor, die einen generellen<br />
Anspruch als solches zuerkennen<br />
würden. Auch das Bundesgesetz über<br />
die Weiterbildung (WeBiG) stellt die<br />
Verantwortung des Einzelnen in den<br />
Vordergrund.<br />
Ausbildungen sind nur notwendig<br />
und deren Kosten damit zu ersetzen,<br />
wenn sie von der Arbeitgeberin<br />
angeordnet wurden. Die Arbeitgeber<br />
beteiligen sich oftmals in der Praxis<br />
dennoch an Ausbildungskosten,<br />
sehen aber Rückzahlungspflichten<br />
vor. Eine solche Aus- oder Weiterbildungsvereinbarung<br />
ist jedenfalls<br />
gültig, wenn sie den vom Mitarbeitenden<br />
zurückzuvergütenden Betrag und<br />
den Zeitraum fixiert, innert dem die<br />
Kündigung eine Rückzahlungspflicht<br />
auslöst. Oftmals wird eine abgestufte<br />
Rückzahlungspflicht vereinbart.<br />
Nein, nur die von der Arbeitgeberin<br />
angeordnete Ausbildung ist als<br />
lohnpflichtige Arbeitszeit anzurechnen.<br />
Allfällig bezahlte Arbeitszeit<br />
zwecks Besuche der Kurse oder<br />
Selbststudium sind ebenfalls in der<br />
Vereinbarung zu regeln und können<br />
demzufolge einer Rückzahlungspflicht<br />
unterliegen. Liegt deine<br />
Vereinbarung vor, wende dich an uns.<br />
Gerne beraten wir dich persönlich.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/recht/rechtso
26 Freizeit<br />
Tipps<br />
Wenn Weiterbildung viel mehr<br />
ist als Weiterbildung<br />
Hanspeter Truniger erzählt in diesem<br />
Magazin <strong>auf</strong> Seite 30, wie sehr<br />
ihm die gewerkschaftlichen Kurse<br />
geholfen haben, in einem Postkonzern,<br />
der ständig umgebaut und neu<br />
organisiert wurde, seinen Weg zu<br />
finden. In einem Heft über Weiterbildung<br />
gehört dies vermerkt: Die<br />
Kurse von Movendo, Helias etc. sind<br />
mehr als Orte der Wissensvermittlung:<br />
Sie schaffen sozialen Zusammenhalt.<br />
Oft finden sich lokal besonders<br />
reizvolle Schulungsangebote, veranstaltet<br />
von einzelnen Gewerkschaftsbünden<br />
und Kartellen. Sich<br />
umschauen lohnt. Kontaktadressen<br />
findest Du <strong>auf</strong> der Seite sgb.ch unter<br />
«Kantonale Bünde».<br />
Weiterbildung ist inzwischen<br />
eine gigantische Industrie geworden.<br />
Um frustrierende oder teure<br />
Überraschungen zu vermeiden,<br />
holst Du Dir besser Rat bei Deinem<br />
Gewerkschaftssekretär. Zwei<br />
Movendo- Kurse können wir warm<br />
empfehlen: «Frontalangriff <strong>auf</strong> das<br />
Arbeitsgesetz» mit Luca Cirigliano<br />
vom SGB am 29.9. in Olten. Und<br />
«Die Krise, der Euro und die<br />
Schweiz» mit den Ökonomen David<br />
Gallusser und Daniel Kopp. Details<br />
<strong>auf</strong> der Seite von Movendo.<br />
Zwei kurze Promemoria noch:<br />
Am 28. Juni findet in Freiburg die<br />
grosse Tagung «Digitalisierung?<br />
Weiterbildung!» statt.9.00 bis 16.30<br />
Uhr, Anmeldung über movendo.ch.<br />
Und bei Sheila Winkler erfahren<br />
die Kolleginnen und Kollegen von<br />
PostAuto <strong>alle</strong>s über die l<strong>auf</strong>enden<br />
Kurse für PeKo-Mitglieder und Vertrauensleute.<br />
In der gegenwärtigen<br />
Streitlage um den Betrieb geht es<br />
um das Elementare: Im GAV und<br />
Gesetz und Dinge wie Zeiterfassung.<br />
Also ums Ganze.<br />
Sheila.Winkler@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Was bleibt von 68? Ueli Mäder<br />
malt ein Schweizer Sittenbild<br />
1968 begann das Schweizer Fernsehen,<br />
in Farbe zu senden. Nun sah<br />
man auch in Bern und Wallisellen,<br />
wie bunt die Proteste da draussen in<br />
der Welt waren. Der Mai kam auch<br />
in die Schweiz. Tausende demonstrierten<br />
gegen den Vietnamkrieg.<br />
Angehende Lehrerinnen streikten in<br />
Locarno. Lehrlinge rebellierten<br />
gegen autoritäre Lehrmeister.<br />
Schülerinnen gründeten Drittweltgruppen.<br />
Und überall brach die<br />
Kultur <strong>auf</strong>.<br />
50 Jahre später fragt Ueli Mäder,<br />
der produktivste Schweizer Soziologe<br />
(«macht.ch»), wie der Mai die<br />
Schweiz verändert hat. Er tut dies<br />
nicht analytisch, er befragt seine<br />
eigene Generation. Das ist seine<br />
soziologische Methode, die Alltagssoziologie.<br />
Mehr als 100 Interviews<br />
mit damaligen Protagonistinnen<br />
und Protagonisten hat er dafür<br />
geführt, Manche führen inzwischen<br />
klingende Namen. Claudia Honegger,<br />
Ruth Dreifuss, Thomas Held,<br />
Barbara Gurtner, Peter Bichsel, Jürg<br />
Marquard, Regula Renschler, Urs<br />
Jaeggi ... Das liest sich, in tausend<br />
Episoden und Tupfern zeitweise wie<br />
ein Roman. So entsteht ein veritables<br />
Sittenbild der Schweiz von 1968,<br />
aber noch mehr der heutigen Befindlichkeiten.<br />
Scheinbar nebenbei,<br />
belegt mit vielen Dokumenten, wird<br />
deutlich, dass manche Debatten<br />
und Projekte von damals heute noch<br />
die Tiefenströmungen unserer<br />
Gesellschaft bilden. Jetzt hat man<br />
nur noch ein dringenden Wunsch:<br />
Dass ein 1980er dasselbe mit seiner<br />
Generation anstellen möchte.<br />
100 Jahre Landesstreik im<br />
Theater<br />
©Eve Lagger<br />
Vom Donnerstag, 16. August, bis<br />
Sonntag, 23. September 2018, wird<br />
die Alte Hauptwerkstätte SBB nördlich<br />
des Bahnhofs Olten Schauplatz<br />
des Theaterspektakels «1918.ch –<br />
100 Jahre Landesstreik» sein. Rund<br />
zwanzig Theatergruppen aus <strong>alle</strong>n<br />
Landesteilen haben ihren eigenen<br />
szenischen Beitrag in den vier Landessprachen<br />
vorbereitet. Jeden<br />
Abend werden zwei Szenen aus zwei<br />
verschiedenen Kantonen die Aufführungen<br />
ergänzen und so jeder<br />
der 24 Aufführungen eine andere<br />
Farbe verleihen. Diese Beiträge vervollständigen<br />
das Hauptstück, das<br />
unter der Regie von Liliana Heimberg<br />
von Laienschauspielerinnen<br />
und -schauspielern dargestellt wird.<br />
<strong>Für</strong> dieses Projekt haben Historiker<br />
und Fachleute mitgeholfen, die<br />
Ereignisse von 1918 nachzuzeichnen,<br />
als 250 000 Erwerbstätige anlässlich<br />
des einzigartigen und einzigen<br />
Generalstreiks in der<br />
Geschichte der Schweiz ihre Arbeit<br />
niederlegten. Diese vier Tage im<br />
November 1918 haben bedeutende<br />
soziale Errungenschaften ermöglicht.<br />
Die vom Oltner Komitee vertretene<br />
Arbeitnehmerbewegung forderte<br />
unter anderem die Einführung<br />
der AHV und des Frauenstimmrechts.<br />
Diese wurden infolge der zunehmenden<br />
Bedeutung der Arbeitnehmerbewegungen<br />
schrittweise<br />
<strong>auf</strong> demokratischem Weg eingeführt.<br />
Das Projekt soll zeigen, dass<br />
die ganze Schweiz davon betroffen<br />
war. Mithilfe von Historikern wurden<br />
lokale Geschichten und regionale<br />
Inhalte inszeniert, welche die<br />
Gesamtdarstellung vervollständigen.<br />
Tickets können heute schon<br />
über unten den stehenden Link bestellt<br />
werden.<br />
movendo.ch, <strong>syndicom</strong>.ch/mitgliederservice/aus-<br />
und weiterbildung<br />
Ueli Mäder: 68 – was bleibt? Rotpunktverlag<br />
Zürich. 2018, 368 S. illustriert. CHF 49.90<br />
1918.ch
1000 Worte<br />
Ruedi Widmer<br />
27
28 Bisch im Bild Tag der Arbeit<br />
«Lohngleichheit. Punkt. Schluss!» Am 1. Mai forderten die Gewerkschaften die<br />
Einhaltung des 37 Jahre alten Verfassungsgrundsatzes. Heute verdienen Frauen<br />
im Durchschnitt noch immer 20 % weniger als die Männer.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
5<br />
4
1, 10 13 000 für Lohngleichheit in Zürich. Subito! (© Christian Capacoel)<br />
2 Der 1. Mai der Buchhändler in Zürich: mehr Personal in die Läden! (© Christian Capacoel)<br />
3, 5, 7 In Lausanne machten die Frauen klar: Ändert sich nichts, streiken wir 2019! (© Sylvie Fischer)<br />
4 In Bern akzeptiert der Grossrat den 1. Mai immer noch nicht als Feiertag. Wir waren trotzdem da. (© Susanne Oehler)<br />
6, 9 Lohngleichheit forderten 2500 Demonstranten in Basel – und solidarisierten sich mit Flüchtlingen. (© Frantisek Matous)<br />
8 In Locarno hatten nicht die Funktionäre, sondern die Arbeiterinnen und Arbeiter das Wort. (© Giovanni Valerio)<br />
29<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9 10
30<br />
Aus dem<br />
Leben von ...<br />
Hanspeter Truniger<br />
Alles neu, immer dranbleiben<br />
1957 in Münsterlingen TG geboren,<br />
lernte Hanspeter Truniger Pöstler. Es<br />
war der Beginn einer wechselreichen<br />
L<strong>auf</strong>bahn, bestimmt durch zahlreiche<br />
Reorganisationen der Post und<br />
begleitet von diversen Aus- und<br />
Weiterbildungen. Begonnen hat er als<br />
Briefträger in Pratteln BL. Nach einigen<br />
Jahren Zustelldienst absolvierte<br />
Truniger die vierjährige Ausbildung zum<br />
Betriebs beamten. Er spezialisierte sich<br />
zum Qualitätsberater. Mit 50 erwarb er<br />
das EFZ als Logistiker. Heute ist er Teil<br />
des Teams Qualität im Briefzentrum<br />
Härkingen SO. Seit der Lehre gewerkschaftlich<br />
organisiert, präsidiert<br />
Truniger bei <strong>syndicom</strong> den Bereich<br />
PostMail Schweiz.<br />
Text: Oliver Fahrni<br />
Bild: Monika Flückiger<br />
Weiterbildung ist und<br />
bringt Wertschätzung<br />
«Ich staune, was diese Maschinen<br />
machen. Vor noch gar nicht so langer<br />
Zeit haben wir in Basel in der<br />
Briefausgabe per Hand sortiert, nach<br />
120 Postbotenbezirken. Ausserdem<br />
mussten wir 3000 Postfachkunden<br />
kennen. Heute schafft eine Sortieranlage<br />
32 000 Briefe bis Format B5<br />
biegbar und 6 Millimeter Dicke in<br />
einer Stunde.<br />
Mein Beruf, den ich mit einem<br />
gewissen Stolz Pöstler nenne, hat<br />
sich in den bald 45 Jahren meiner<br />
L<strong>auf</strong>bahn grundlegend verändert.<br />
Sein Reiz liegt darin, die Menschen<br />
in Verbindung zu bringen, verlässlich<br />
und pünktlich. Es ist vorgekommen,<br />
dass wir Briefe weitergeleitet<br />
haben, die in Morseschrift oder in<br />
Spiegelschrift adressiert waren. Das<br />
ist Service public.<br />
Ich habe die Trennung von Post<br />
und Swisscom erlebt, die Auslagerung<br />
von PostFinance, den Wechsel<br />
zur Aktiengesellschaft, den wachsenden<br />
Druck. Aus 18 Briefzentren sind<br />
3 geworden. Die Reorganisation<br />
dreht sich immer weiter. Jetzt will<br />
der Nationalrat den Zustellschluss<br />
12.30 Uhr ins Gesetz schreiben.<br />
Damit würden rund 1500 Pöstlerstellen<br />
zu Teilzeitjobs, von denen man<br />
nicht leben kann. Hier hat die Post<br />
eine soziale Verantwortung.<br />
In meiner Aufgabe in Härkingen<br />
versuche ich, die Qualität des Service<br />
public in meinem Bereich hochzuhalten.<br />
Es geht um gute Abläufe im<br />
3-Schichten-Sortierdienst, zum Teil<br />
mit ungelerntem oder temporärem<br />
Personal. Am Ende dreht sich <strong>alle</strong>s<br />
um die richtige Adressierung.<br />
Ohne die Gewerkschaft könnte<br />
ich die Arbeit, die ich heute mache,<br />
nicht machen. Sie hat mich in<br />
meiner beruflichen Entwicklung<br />
getragen. Zuerst bei meiner Ausbildung<br />
zum Betriebsbeamten. Nebenbei<br />
habe ich zahlreiche Kurse<br />
besucht, bei der damaligen PTT-Union,<br />
bei Movendo und an anderen<br />
Orten. Mein erster Kurs war ein<br />
Jugendkurs, 1975.<br />
Als PeKo-Präsident habe ich<br />
einmal meine ganze PeKo an einen<br />
Kurs mitgenommen. Permanente<br />
Weiterbildung ist der Schlüssel eines<br />
erfüllten Berufslebens. Wer nicht<br />
mit der Zeit geht, der muss mit der<br />
Zeit gehen, sagt man. Weiterbildung<br />
macht Lust <strong>auf</strong> mehr, eröffnet<br />
Horizonte, weckt Neugierde und<br />
macht das Arbeitsleben interessant.<br />
Sicher ist das manchmal auch<br />
beschwerlich. Ich hatte das Glück,<br />
dass mir meine Frau half, das<br />
Computerwissen anzueignen. Sie<br />
hatte eine k<strong>auf</strong>männische <strong>Bildung</strong>.<br />
Manchmal muss man um seine<br />
Qualifikation kämpfen. Ein Chef<br />
wollte mich einmal nicht an einen<br />
Movendo-Kurs lassen. Die Uniformierten<br />
sollten dumm bleiben, die<br />
L<strong>auf</strong>bahnen waren nicht durchlässig.<br />
Dies hat sich zum Besseren<br />
gewendet. Mit 50 konnte ich bei der<br />
Post mein EFZ als Logistiker erwerben.<br />
Das öffnet Türen. Weiterbildung<br />
ist eine Form der Wertschätzung.<br />
Und sie bringt dir neue<br />
Wertschätzung.»<br />
<strong>syndicom</strong> Post: bit.ly/2KEpek5
Impressum<br />
Redaktion: Sylvie Fischer, Giovanni Valerio,<br />
Marc Rezzonico, Marie Chev<strong>alle</strong>y<br />
Tel. 058 817 18 18, redaktion@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Porträts, Zeichnungen: Katja Leudolph<br />
Fotos ohne ©Copyright-Vermerk: zVg<br />
Layout und Korrektorat: Stämpfli AG, Bern<br />
Druck: Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, 3001 Bern<br />
Adressänderungen: <strong>syndicom</strong>, Adressverwaltung,<br />
Monbijoustrasse 33, Postfach, 3001 Bern<br />
Tel. 058 817 18 18, Fax 058 817 18 17<br />
Inserate: priska.zuercher@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Abobestellung: info@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Abopreis ist im Mitgliederbeitrag inbegriffen. <strong>Für</strong><br />
Nichtmitglieder: Fr. 50.– (Inland), Fr. 70.– (Ausland)<br />
Verlegerin: <strong>syndicom</strong> – Gewerkschaft<br />
Medien und Kommunikation, Monbijoustrasse 33,<br />
Postfach, 3001 Bern<br />
Das <strong>syndicom</strong>-Magazin erscheint sechsmal im Jahr.<br />
Ausgabe <strong>Nr</strong>. 6 erscheint am 6. Juli 2018<br />
Redaktionsschluss: 28. Mai 2018.<br />
31<br />
Das <strong>syndicom</strong>-Kreuzworträtsel<br />
Der Spargel wächst und Reisezeit ist<br />
reka-Zeit: Zu gewinnen gibt es einen<br />
Gutschein über 50 Franken, gespendet<br />
von unserer Dienstleistungspartnerin<br />
reka. Das Lösungswort wird in der<br />
nächsten Ausgabe zusammen mit dem<br />
Namen der Gewinnerin oder des<br />
Gewinners veröffentlicht.<br />
Lösungswort und Absender <strong>auf</strong> einer<br />
A6-Postkarte senden an: <strong>syndicom</strong>-<br />
Magazin, Monbijoustrasse 33, Postfach,<br />
3001 Bern. Einsendeschluss: 10.6.18<br />
Die Gewinnerin<br />
Die Lösung des <strong>syndicom</strong>-Kreuzworträtsels<br />
aus dem <strong>syndicom</strong>-Magazin<br />
<strong>Nr</strong>. 4 lautet: SERVICE. Gewonnen hat<br />
Erika Frei aus Uster. Sie erhält hat eine<br />
Coop-Geschenkkarte im Wert von<br />
40 Franken. Wir gratulieren herzlich!<br />
Anzeige<br />
ALLES IST BESSER<br />
GESCHÜTZT<br />
ALS MENSCHEN AUF DER FLUCHT<br />
Werde aktiv <strong>auf</strong><br />
amnesty.ch<br />
AI_MAG_Beobachter_182x58_d_4c_Sticker.indd 1 30.08.16 09:43
32 Inter-aktiv<br />
<strong>syndicom</strong> social<br />
Nachlässigkeit bei Twitter! 3.5.2018<br />
Habt Ihr Euch in den letzten Tagen in<br />
Euren Twitter-Account eingeloggt? Dann<br />
musstet Ihr wahrscheinlich Euer Passwort<br />
ändern. Schuld daran war ein Bug<br />
(Daten wurden nicht verschlüsselt!), der<br />
330 Millionen Nutzerinnen und Nutzer<br />
betraf. Twitter beruhigte die User: Es sei<br />
kein Hackerangriff oder Missbrauch der<br />
Daten festgestellt worden. Tweet tweet!<br />
Stephanie Vonarburg 4.5.2018<br />
@SVonarburg<br />
Ein Urteil zugunsten der Pressefreiheit:<br />
Die 4 Journalisten von<br />
«il caffè» sind in <strong>alle</strong>n Anklagepunkten<br />
freigesprochen worden:<br />
Die Artikelserie über einen Arztfehler<br />
war weder unlauterer<br />
Wettbewerb noch eine Diffamierung.<br />
cdt.ch/ticino/lugano/…<br />
Welttag der Pressefreiheit 3.5.2018<br />
Zum Welttag der Pressefreiheit sprach in Lugano Idil Eser,<br />
Direktorin von Amnesty International in der Türkei.<br />
<strong>syndicom</strong> hat die Veranstaltung mitorganisiert.<br />
Adaptive Learning 17.4.2018<br />
Am 17. April wird die Fernfachhochschule Schweiz<br />
20 Jahre alt. Sie ist die erste eidgenössisch anerkannte<br />
Hochschule für angewandte Wissenschaften, die ein<br />
personalisiertes und adaptives Fernstudium anbietet.<br />
UNI Europa Forum Brüssel 16.4.2018<br />
Das Forum vom April war der Rolle der<br />
digitalen Technologien in der Gewerkschaftsarbeit<br />
gewidmet, wies aber auch<br />
<strong>auf</strong> die grundlegende Bedeutung des<br />
persönlichen Kontakts hin.<br />
Social Media Gate 3.5.2018<br />
Stoff für einen Krimi: Facebook verk<strong>auf</strong>t den Zugang zu<br />
den Daten seiner Nutzer an Cambridge Analytica, Twitter<br />
ebenfalls, der Fall wird <strong>auf</strong>gedeckt, Cambridge Analytica<br />
stellt den Betrieb ein und formiert sich unter dem Namen<br />
Emerdata neu!<br />
Sebastian Gänger @sebigaenger 2.5.2018<br />
Wir sind ein Team: @inside_sda,<br />
@<strong>syndicom</strong>_de, <strong>syndicom</strong>_fr und @<br />
impressumCH. EINER für <strong>alle</strong>, <strong>alle</strong> für<br />
einen! ! Herzl. Dank @SVonarburg & Co.!<br />
Kompetenzen Erwachsener 4.5.2018<br />
Weiterbildung 4.5.2018<br />
Lust <strong>auf</strong> eine Weiterbildung oder eine Einführung in eine<br />
digitale Aktivität? Schaut Euch unsere Kurse (für Mitglieder)<br />
<strong>auf</strong> helias.ch und movendo.ch an.<br />
1. «Festival de l’Éducation» in Genf 2019<br />
Die Schweiz nimmt an der nächsten<br />
Runde des Programms für die<br />
internationale Erhebung der<br />
Kompetenzen Erwachsener (PIAAC)<br />
der OECD teil. Diese startet 2021.<br />
Erhoben werden auch Daten zu den<br />
grundlegenden IKT-Kenntnissen von<br />
Erwachsenen.<br />
educa.ch<br />
Das «Festival der <strong>Bildung</strong>» in Genf sollte am 18. April<br />
stattfinden. Es wurde <strong>auf</strong> Frühjahr 2019 verschoben.<br />
Die Veranstaltung wird sich mit dem über Internet<br />
zugänglichen Wissen und den Modellen der Wissensvermittlung<br />
(MOOC) befassen. Im digitalen Zeitalter strebt<br />
die Schule nach einem neuen <strong>Bildung</strong>sparadigma!<br />
Serious Games 25.4.2018<br />
Mit wem hat Marco Polo gechattet? Sind Smartphones<br />
geeignet, um damit zu lernen? Mit der Lern-App «A Touch<br />
of History» bieten die Pädagogische Hochschule Zug und<br />
Samsung Schweiz einen spielerischen und interaktiven<br />
Zugang zur Geschichte.




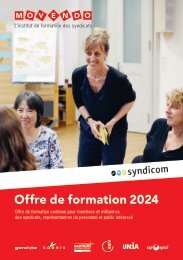



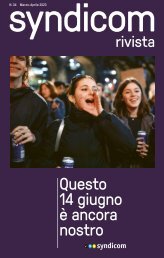

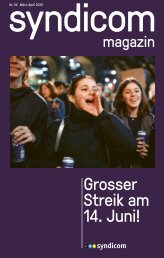


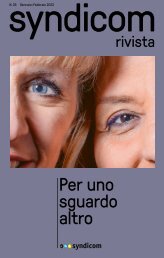
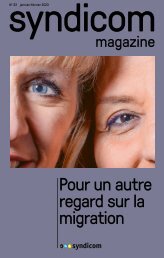
![2202456_[230122]_Syndicom_33_2023_DE_LOW_150_dpi](https://img.yumpu.com/67501302/1/164x260/2202456-230122-syndicom-33-2023-de-low-150-dpi.jpg?quality=85)