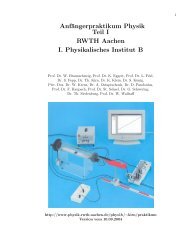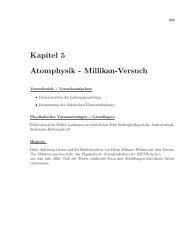Kapitel 3 Halbleiter
Kapitel 3 Halbleiter
Kapitel 3 Halbleiter
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.1. HALBLEITEREIGENSCHAFTEN UND HALL–EFFEKT 73<br />
Substanz ∆E ni µn µp<br />
m eff<br />
n<br />
me<br />
m eff<br />
p<br />
eV cm −3 cm 2 V −1 s −1 cm 2 V −1 s −1<br />
Ge 0.67 2.3 · 10 13 3900 1900 0.56 0.37<br />
Si 1.10 1.3 · 10 10 1500 600 1.08 0.59<br />
Diamant 5.47 6.7 · 10 28 1800 1600 0.2 0.25<br />
InSb 0.16 1.5 · 10 16 78000 750 0.036 0.18<br />
GaAs 1.43 1.3 · 10 6 8500 400 0.17 0.6<br />
Tabelle 3.3: Charakteristische Daten einiger <strong>Halbleiter</strong> bei 300 K: Energielücke ∆E, Inversionsdichte<br />
ni, Ladungsträgerbeweglichkeiten µn und µp, effektive Massen von Kristall- und Defektelektronen.<br />
ist. In der Tabelle 3.3 sind die charakteristischen Größen einiger undotierter <strong>Halbleiter</strong> aufgelistet.<br />
Die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit ist gegeben sowohl durch diejenige der Dichten<br />
n und p (Gl. 3.19) als auch der Beweglichkeiten. Wie beim Leiter sind die Beweglichkeiten<br />
bestimmt durch die Wechselwirkungen der Ladungsträger mit dem Gitter, wobei wegen der<br />
(im Verhältnis zum Leiter) geringen Konzentration in Gl. 3.9 nicht die Fermigeschwindigkeit,<br />
sondern die thermische Geschwindigkeit maßgeblich ist. Damit ergibt sich für den <strong>Halbleiter</strong> eine<br />
Temperaturabhängigkeit der Beweglichkeiten gemäß Gl. 3.11 zu<br />
3<br />
−<br />
µn, µp ∼ T 2 (3.21)<br />
Für die Leitfähigkeit (Gl. 3.17), die die Produkte aus Konzentrationen und Beweglichkeiten<br />
enthält, folgt damit die folgende Temperaturabhängigkeit:<br />
∆E<br />
− 2k<br />
σi = σi◦e B T (3.22)<br />
Für einen undotierten <strong>Halbleiter</strong> läßt sich also durch die Messung der Temperaturabhängigkeit<br />
von σ die Bandlücke experimentell bestimmen. Für die bekannteren <strong>Halbleiter</strong> sind die<br />
Bandlücken sowie einige weitere Parameter in der Tabelle 3.3 angegeben. Eine Messung der<br />
Leitfähigkeit selbst<br />
σi = qeni(µn + µp) (3.23)<br />
liefert das Produkt aus Inversionsdichte und der Summe der Beweglichkeiten, jedoch nicht Dichten<br />
und Beweglichkeiten getrennt.<br />
3.1.1.5 Dotierte <strong>Halbleiter</strong><br />
Die Leitfähigkeit reiner <strong>Halbleiter</strong> kann gezielt verändert werden durch Dotierungen, d.h. durch<br />
Hinzufügung von Stoffen aus benachbarten Gruppen des Periodensystems der Elemente. Solche<br />
dotierten oder Störstellen-<strong>Halbleiter</strong> weisen dann eine geänderte Bandstruktur auf.<br />
Wird Silizium z.B. mit Arsen (5. Gruppe) dotiert, so entsteht unterhalb des leeren Leitungsbandes<br />
ein Niveau, das vom 5. Valenzelektron des Arsens herrührt. Diese Zustände heißen Donatorniveaus,<br />
weil sie Elektronen an das Leitungsband abgeben. Es entstehen keine Löcher im<br />
Valenzband. Der <strong>Halbleiter</strong>typ heißt negativer oder n-<strong>Halbleiter</strong>. Je näher das Donatorniveau an<br />
me