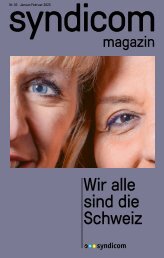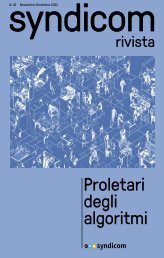syndicom magazin Nr. 6 - Gratis ist nicht gratis
Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.
Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>syndicom</strong><br />
<strong>Nr</strong>. 6 Juli–August 2018<br />
<strong>magazin</strong><br />
<strong>Gratis</strong><br />
<strong>ist</strong> <strong>nicht</strong><br />
<strong>gratis</strong>
Anzeige<br />
Bitte streich dir<br />
den 22. September<br />
rot und dick<br />
in der Agenda an!<br />
Auf zur Lohndemo am 22. September!<br />
Komm auch du nach Bern auf den Bundesplatz!<br />
Faire Löhne für alle –<br />
für Lohngleichheit,<br />
gegen Diskriminierung!<br />
Gewerkschaften und Frauenorganisationen rufen zur<br />
nationalen Kundgebung in Bern auf.<br />
Bauen wir Druck auf, damit es endlich vorwärts geht.<br />
13.30 Uhr Treffpunkt auf der Schützenmatte<br />
15.00 Uhr Schlusskundgebung auf dem Bundesplatz<br />
mit viel Musik und kurzen Reden<br />
<strong>syndicom</strong>-Mitglieder reisen kostenlos an.<br />
Online anmelden und weitere Informationen unter:<br />
my.<strong>syndicom</strong>.ch ∕ lohndemo
Inhalt<br />
4 Teamporträt<br />
5 Kurz und bündig<br />
6 Die andere Seite<br />
7 Gastautor<br />
8 Dossier: <strong>Gratis</strong><br />
13 Tödliche <strong>Gratis</strong>medien<br />
16 Arbeitswelt<br />
22 Service public 2.0<br />
25 Recht so!<br />
26 Freizeit<br />
27 1000 Worte<br />
28 Bisch im Bild<br />
30 Aus dem Leben von ...<br />
31 Kreuzworträtsel<br />
32 Inter-aktiv<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
Konzerne zwingen ihre Kunden mit digitalen<br />
Techniken, immer mehr Arbeiten selbst zu übernehmen.<br />
Andere, arbeitsaufwendige Dienstle<strong>ist</strong>ungen<br />
werden <strong>nicht</strong> mehr erbracht. Beides<br />
bringt den Konzernen enorme Produktivitätsgewinne.<br />
Beispiele sind das digitale Powerhouse<br />
bei Postfinance (was für ein Name für simple<br />
Auslagerungen!), der Selbsthilfe-Chat bei<br />
Swisscom oder der Onlinearzt Deiner Krankenkasse.<br />
Solche Prozesse, die sich derzeit beschleunigen,<br />
ver<strong>nicht</strong>en lebendige Arbeit und bringen<br />
den Unternehmen gewaltige Gewinnsteigerungen.<br />
Diese Gewinne, erworben durch versteckte<br />
<strong>Gratis</strong>arbeit, verschwinden in den Taschen der<br />
Aktionäre. Dies bis hin zum Umbau der Unternehmung<br />
zur digitalen Plattform, in der jede<br />
soziale Verantwortung verschwindet und das<br />
unternehmerische Risiko auf die Mitarbeitenden<br />
abgewälzt wird. Der Steuersitz wird ebenfalls so<br />
gelegt, dass möglichst keine Steuern anfallen.<br />
Dieser Sezession der Unternehmen von der<br />
Gesellschaft stellen wir unser Modell der besseren,<br />
sozialen Digitalisierung gegenüber. Wir<br />
müssen die Verteilung der Produktionsgewinne<br />
und neue Investitionen in einen ausgebauten<br />
Service public durchsetzen. In digitalen Zeiten<br />
wird er im Zentrum der Gesellschaft stehen –<br />
und er muss <strong>gratis</strong> sein!<br />
4<br />
8<br />
22<br />
Daniel Münger, <strong>syndicom</strong>-Präsident
4<br />
Teamporträt<br />
«Gemeinsames Engagement lohnt sich»<br />
Dominic Steinmann (30)<br />
Aufgewachsen in Ried-Brig VS. Arbeitet<br />
in Zürich sowie im Wallis seit März 2017<br />
als selbstständiger Fotograf. Studierte<br />
in England Press and Editorial Photography.<br />
Zuvor Volontär bei Keystone<br />
und bei der NZZ. Seit September 2017<br />
Mitglied von <strong>syndicom</strong>.<br />
www.dominicsteinmann.com<br />
Markus Forte (40)<br />
Er besuchte am MAZ in Luzern den<br />
Lehrgang Pressefotografie. Seit 2005<br />
arbeitet er als freischaffender Fotograf<br />
für Kunden aus dem Medien- und<br />
Corporate-Publishing-Bereich. Er lebt<br />
in Zürich und fotografiert überall.<br />
Seit 2004 Mitglied von <strong>syndicom</strong>.<br />
www.markusforte.com<br />
Miriam Künzli (41)<br />
Sie studierte Fotografie in München<br />
und Luzern und arbeitet als Freelancerin<br />
für verschiedene Zeitungen<br />
und Unternehmen in Deutschland und<br />
der Schweiz. Lebt mit ihrer Familie in<br />
Zürich. Seit 2008 Mitglied von <strong>syndicom</strong><br />
und engagiert in der Kommission<br />
Freie. www.miriamkuenzli.com<br />
Text: Nina Scheu<br />
Bild: Tom Kawara<br />
«Eine deutliche<br />
Verbesserung der<br />
Verträge erreichen»<br />
«Zuerst war es ein Schock: Im Oktober<br />
2017 bekamen wir mit, dass<br />
Ringier Axel Springer (RASCH) den<br />
freien Fotografinnen und Fotografen<br />
neue Verträge schicke, in denen ein<br />
‹Full Buyout› verlangt würde, die<br />
totale Abtretung des Urheberrechts.<br />
Das bedeutet, dass der Verlag unsere<br />
Bilder <strong>nicht</strong> nur unbeschränkt oft in<br />
allen seinen Publikationen verwenden<br />
darf, sondern sie auch an andere<br />
Kunden weiterverkaufen könnte,<br />
<strong>gratis</strong> und ohne uns zu fragen. Noch<br />
schlimmer: Wir hätten das Recht verloren,<br />
unsere Bilder selbst weiterzuverwerten.<br />
Dabei <strong>ist</strong> der Pressetarif<br />
gerade deshalb so tief, weil die Fotos<br />
nur zur einmaligen Nutzung abgegeben<br />
werden und jede weitere Verwendung<br />
abgegolten werden muss.<br />
Mit Unterstützung der Gewerkschaften<br />
und der Fotoverbände bildete<br />
sich eine recht grosse Gruppe von<br />
FotografInnen, die sich an einem<br />
Runden Tisch im Regionalsekretariat<br />
von <strong>syndicom</strong> treffen konnte. Wir<br />
bekamen jur<strong>ist</strong>ische Unterstützung<br />
für das weitere Vorgehen und Hilfe<br />
bei der Formulierung eines Gegenvorschlags,<br />
den wir mit RASCH verhandeln<br />
wollten. Eine Facebook<br />
Gruppe half bei der gegenseitigen<br />
Vernetzung, und so starteten wir eine<br />
Petition, die von über 800 Personen<br />
unterschrieben wurde. Die Gruppe<br />
verschickte unzählige Briefe, und wir<br />
kontaktierten unsere Kolleginnen<br />
und Kollegen auch per Telefon.<br />
Wir rieten ihnen, statt der Pauschalverträge<br />
unseren Gegenvorschlag zurückzuschicken<br />
– und sei es nur als<br />
Zeichen des Protests. Aber bei einigen<br />
war die Angst zu gross, keine<br />
Aufträge mehr zu bekommen. Trotzdem<br />
war der Druck auf das RASCH<br />
Management so stark, dass wir zum<br />
Gespräch eingeladen wurden. Im<br />
Februar konnten wir eine deutliche<br />
Verbesserung der Verträge erreichen<br />
und das ‹Full Buyout› verhindern.<br />
Aber unseren Gegenvorschlag haben<br />
wir nur teilweise durchgebracht.<br />
Es war viel Arbeit. Aber es hat uns<br />
gezeigt, dass wir zusammen einiges<br />
erreichen können – und dass noch<br />
viel mehr möglich gewesen wäre,<br />
wenn alle mitgezogen hätten. Im<br />
Berufsalltag sind wir (zu) oft Einzelkämpfer.<br />
Die Kontakte, die jetzt entstanden<br />
sind, sind ein Anfang, um<br />
das zu ändern.»
Kurz und<br />
bündig<br />
Anträge für den SGB-Kongress 2018 \ Entscheidungen am <strong>syndicom</strong>-<br />
Kongress \ Ständeratskommission verschlechtert die Arbeitsbedingungen \<br />
Jubiläum des Landesstreiks \ Drei Alternativen für Le Matin \<br />
GIV-GAV: Ausbau essenziell \<br />
5<br />
SGB-Kongress 2018<br />
Der SGB-Kongress 2018 findet am<br />
30. November und 1. Dezember 2018<br />
statt. Anträge, die am Kongress behandelt<br />
werden sollen, müssen mindestens<br />
3 Monate vorher zuhanden des Vorstandes<br />
eingereicht werden. Der Vorstand<br />
hat die Ordnungsfr<strong>ist</strong> auf den 15. August<br />
2018 festgelegt. Die statutarische Fr<strong>ist</strong><br />
bleibt der 30. August 2018. Fragen bitte<br />
an kommunikation@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
<strong>syndicom</strong>-Kongress<br />
Nachdem am Kongress im November<br />
2017 <strong>nicht</strong> alle Anträge behandelt werden<br />
konnten, fand am 9. Juni 2018 der<br />
Fortsetzungskongress statt. Es konnten<br />
ordnungsgemäss alle Anträge behandelt<br />
werden. Die Entscheidungen werden nun<br />
zur Publikation aufbereitet. Sie sind ab<br />
dem 5. Juli 2018 unter <strong>syndicom</strong>.ch/<br />
kongress17 einzusehen.<br />
Ständeratskommission verschlechtert<br />
die Lage der Kader<br />
Am 20. Juni hat die Kommission für<br />
Wirtschaft und Abgaben des Ständerats<br />
(WAK-S) unter der Federführung von<br />
Konrad Graber und Karin Keller-Sutter<br />
beschlossen, die Arbeitsbedingungen<br />
für die Arbeitnehmenden in der Schweiz<br />
weiter zu verschlechtern. Geht es nach<br />
diesem Willen, dürften Arbeitnehmende,<br />
deren Arbeitsvertrag sie als Fachspezial<strong>ist</strong>en<br />
oder Kader auswe<strong>ist</strong>, <strong>nicht</strong> mehr<br />
in den Genuss grundlegendster Arbeitsschutzbestimmungen<br />
kommen. Die<br />
wöchentliche Höchstarbeitszeit würde<br />
praktisch abgeschafft, und der Schutz<br />
vor Arbeit in der Nacht sowie die Sonntagsruhe<br />
wären massiv bedroht.<br />
100 Jahre Landesstreik in<br />
Olten am 10. November<br />
Seit dem Generalstreik am 12. November<br />
1918 <strong>ist</strong> ein Jahrhundert vergangen. Am<br />
Samstag, 10. November, ab 14 Uhr, findet<br />
in der alten SBB-Hauptwerkstätte<br />
beim Bahnhof Olten der Jubiläumsanlass<br />
zu diesem h<strong>ist</strong>orischen Ereignis<br />
statt. <strong>syndicom</strong> wird zusammen mit<br />
dem SGB, der SP und der Robert- Grimm-<br />
Gesellschaft an diesem Jahrestag<br />
teilnehmen. Bundesrätin Simonetta<br />
Sommaruga und SGB-Präsident Paul<br />
Rech steiner werden an diesem symbolischen<br />
Ort Reden halten. Anmeldungen<br />
für die Veranstaltung sind möglich<br />
unter http://anmeldung.generalstreik.<br />
ch/. Mehr Infos auf der Website zum<br />
100-Jahr-Jubiläum des Landesstreiks<br />
1918: www.generalstreik.ch.<br />
Le Matin: Drei Alternativen<br />
zum Ende im Print<br />
Die Delegation des Personals von Le<br />
Matin hat der Tamedia-Geschäftsleitung<br />
drei Lösungen vorgeschlagen, die<br />
das Verschwinden der Printausgabe<br />
verhindern oder zumindest die Zahl der<br />
betroffenen Mitarbeitenden verringern<br />
sollen. Erstens die Weiterführung der<br />
gedruckten Ausgabe ohne Job-Abbau<br />
durch eine neue Vermarktungsstrategie<br />
und zusätzliche Einnahmen. Zweitens<br />
die Übernahme des Titels durch<br />
die Redaktion, zusammen mit neuen<br />
Investoren. Drittens die massive Entwicklung<br />
des Internetauftritts matin.<br />
ch zu einem vollständigen Angebot und<br />
seine Ausstattung mit entsprechenden<br />
Mitteln. Damit diese Alternativen<br />
geprüft werden können, drängt das<br />
Personal auf die Verlängerung der<br />
Konsultationsfr<strong>ist</strong>.<br />
GIV-GAV: erste Verhandlungsrunde<br />
Am 13. Juni traf sich die Verhandlungsdelegation<br />
von <strong>syndicom</strong> und syna mit<br />
der Delegation von viscom zur ersten<br />
Verhandlungsrunde über den neuen<br />
Gesamtarbeitsvertrag der grafischen<br />
Industrie. Ein Konsens <strong>ist</strong> noch <strong>nicht</strong> in<br />
Sicht, aber die Sozialpartner glauben<br />
an eine grafische Branche mit Zukunft.<br />
Bis zur nächsten Verhandlungsrunde<br />
versuchen wir, viscom davon zu überzeugen,<br />
dass ein Ausbau, wenn auch<br />
auf einem bescheidenen Niveau, essenziell<br />
für das Image unserer Branche<br />
<strong>ist</strong>.<br />
Agenda<br />
Juli<br />
ab 6.<br />
Menschenrecht<br />
Standaktionen von amnesty durch den<br />
Sommer überall in der Schweiz gegen<br />
die Anti-Menschenrechtsinitiative der<br />
SVP. Denn Menschenrechte machen<br />
uns stark. Details: amnesty.ch/de/<br />
ueber-amnesty/veranstaltungen/2018<br />
August<br />
16.–19.<br />
Openair Gampel<br />
Gurten (11.-14.7.) verpasst? Macht<br />
<strong>nicht</strong>s. In den Walliser Bergen rockt es<br />
sich bestens. Aufregendes Programm:<br />
openairgampel.ch/2018/lineup<br />
Zweitagespass: CHF 159.-<br />
16.8.–2.9.<br />
Spektakel am Zürcher<br />
Theaterspektakel<br />
Hohe Bühne und Strassenkunst und<br />
dazu noch <strong>gratis</strong> das Spektakel des<br />
Zürcher Bildungsbürgertums.<br />
Zwischendurch ans Quartierfest.<br />
Programm, Infos: theaterspektakel.ch<br />
22.–26 .<br />
Berner Literaturfest<br />
40 Autorinnen und Autoren lesen an<br />
den verschiedendsten Orten in der<br />
Berner Altstadt. Flanieren und feiern.<br />
Programm: berner-literaturfest.ch<br />
Mehr Festivals, etwas Poesie im Seetal<br />
und in Schweden: salonlit.ch/buchorte/literaturfestivals<br />
Vorschau<br />
22.<br />
Frauen: Genug <strong>ist</strong> genug<br />
Grosse Kundgebung diverser Organisationen<br />
für Lohngleichheit und gegen<br />
Diskriminierung der Frauen auf dem<br />
Bundesplatz in Bern.<br />
Ab 13.30 Uhr, Schützenmatte<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/agenda
6 Die andere<br />
Hans-Jürg Schürch<br />
Seite<br />
<strong>ist</strong> Betriebswirt mit einer Weiterbildung zum Master of Human<br />
Resource Management. Er <strong>ist</strong> seit 2007 bei T-Systems, seit<br />
diesem Jahr als Director HR T-Systems Schweiz und<br />
Österreich und Mitglied beider Geschäftsleitungen.<br />
1<br />
Wie <strong>ist</strong> die Marktlage in ihrer Branche?<br />
Je technologiegetriebener unsere<br />
Kunden ihr Geschäft betreiben, desto<br />
mehr IT-Unterstützung benötigen<br />
sie. Sie holen sich diese zunehmend<br />
<strong>nicht</strong> mehr im klassischen Outsourcing,<br />
sondern beziehen ihre<br />
Applikationen und Services aus der<br />
Cloud. Dadurch verändern sich die<br />
Preismodelle: Heute koex<strong>ist</strong>ieren Fixpreismodelle,<br />
Preismodelle, bei denen<br />
nur der tatsächliche Gebrauch<br />
verrechnet wird, oder eine Kombination<br />
aus beiden.<br />
2<br />
Wie beurteilen Sie die Investitionen<br />
Ihrer Kundinnen und Kunden in die<br />
IT?<br />
Kein Unternehmen kann es sich heute<br />
le<strong>ist</strong>en, <strong>nicht</strong> in die Digitalisierung<br />
zu investieren. Neu <strong>ist</strong> aber, dass bei<br />
Neuanschaffungen <strong>nicht</strong> die IT-Abteilung<br />
alleine entscheidet. Mehr und<br />
mehr werden die Fach abteilungen<br />
wie Marketing, HR, Finance oder Sales<br />
stark involviert, damit Tools implementiert<br />
werden. Das erleichtert<br />
die Prozesse und deckt die Bedürfnisse<br />
der Kunden besser ab.<br />
3<br />
Was bedeutet Digitalisierung für Sie?<br />
Digitalisierung geht in meinem Verständnis<br />
weit über IT und Technologie<br />
hinaus. Es <strong>ist</strong> ein fundamental<br />
neuer Ansatz: die Bedürfnisse der<br />
Kunden und die eigenen Prozesse<br />
durchgängiger zu konzipieren und<br />
mittels Technologie innovativer zu<br />
gestalten – und damit komfortabler<br />
nach aussen und effizienter nach innen.<br />
Dabei nimmt die Automatisierung<br />
eine zentrale Rolle ein.<br />
4<br />
Haben Sie Dienstle<strong>ist</strong>ungen im<br />
Bereich der künstlichen Intelligenz?<br />
Selbstlernende Algorithmen in Verbindung<br />
mit Big Data, Internet of<br />
Things oder Cloud sind mächtige<br />
Instrumente für Wettbewerbskraft.<br />
Wir haben in unserem Portfolio auch<br />
KI-Services, denn wir forschen an der<br />
Vernetzung im Auto genauso wie im<br />
Gesundheitswesen, an der Smart City<br />
ebenso wie an der Smart Factory.<br />
Gleichzeitig sind wir uns der Risiken<br />
bewusst. Daher hat sich die Deutsche<br />
Telekom kürzlich einen Ethikkodex<br />
für den Umgang mit KI auferlegt.<br />
5<br />
Welches sind die Herausforderungen<br />
in der Branche?<br />
Bei immer mehr Daten, die gesammelt,<br />
ausgewertet und verarbeitet<br />
werden, steigen die Anforderungen<br />
an Datenschutz, Datensicherheit und<br />
generell das Risikobewusstsein gegenüber<br />
den Gefahren aus dem Internet.<br />
Cybersecurity-Services müssen<br />
daher immer hochmodern sein und<br />
sich ganzheitlich auf die gesamte<br />
Wertschöpfungskette beziehen. Denn<br />
das kleinste Leck kann hohen finanziellen,<br />
aber auch grössten Imageschaden<br />
bedeuten.<br />
6<br />
Wie bewerten Sie das Lohnniveau in<br />
Ihrer Branche? Liegt Ihre Firma eher<br />
höher oder eher tiefer als der Schnitt?<br />
Unsere Branche <strong>ist</strong> sie <strong>nicht</strong> die klassische<br />
Hochlohnbranche, was man<br />
beim zunehmenden Fachkräftemangel<br />
eigentlich vermuten müsste. Die<br />
Bandbreite bei den Löhnen <strong>ist</strong> sehr<br />
gross. Eine spannende Aufgabe, eine<br />
gute Firmenkultur oder die Beteiligung<br />
an Aus- und Weiterbildung<br />
steigern auch die Attraktivität. Unter<br />
diesen Aspekten <strong>ist</strong> T-Systems im<br />
Vergleich sehr gut aufgestellt.<br />
Text: Sina Bühler<br />
Bild: Yoshiko Kusano
Gastautor<br />
«<strong>Gratis</strong>» hat in Zeiten der digitalen<br />
Ökonomie einen schalen Beigeschmack. Etliche<br />
Onlinemedien und -dienste sind kostenlos – und<br />
das drückt in einigen Branchen unangenehm auf<br />
die Löhne. Doch unter der Oberfläche des digitalisierten<br />
Kapitalismus hat etwas Unerhörtes<br />
stattgefunden: die Entwicklung freier Produktionsmittel,<br />
die auf den ersten Blick auch <strong>gratis</strong><br />
sind und doch viel mehr als das. Begonnen hat<br />
diese Entwicklung am 5. Januar 1984, als der<br />
US-Informatiker Richard Stallman die Arbeit an<br />
dem Computer-Betriebssystem GNU zur freien<br />
Verwendung durch die Allgemeinheit aufnahm.<br />
34 Jahre später läuft es unter dem Namen Linux<br />
auf Millionen Rechnern und Servern in aller Welt.<br />
Diese Idee der freien Software hat <strong>nicht</strong> nur<br />
zahlreiche weitere Programme hervorgebracht.<br />
Sie hat sich auch auf die Produktion frei verfügbaren<br />
Wissens – allen voran in der Wikipedia –<br />
und auf Maschinen erweitert. Als «freie Hardware»<br />
stehen inzwischen auch<br />
Produktions maschinen wie 3D-Drucker, Traktoren<br />
oder Computerplatinen für die Gerätesteuerung<br />
zur Verfügung. Damit <strong>ist</strong> in Teilen etwas<br />
eingetreten, was Friedrich Engels noch als Aufgabe<br />
des Sozia lismus gesehen hatte: «die Übertragung<br />
der Produktionsmittel an die Produzenten»<br />
– aus dem Kapitalismus heraus. Dies<br />
gelang, weil Richard Stallman das System von<br />
Patenten und Copyright aushebelte. Er stellte<br />
die GNU-Software unter eine Lizenz, die neben<br />
freier Verwendung und Veränderbarkeit auch<br />
festlegte, dass jede neue Version dieser Software<br />
unter die selbe Lizenz gestellt wurde. Inzwischen<br />
gibt es weitere Varianten eines Urheberrechts,<br />
das eben jene Vergesellschaftung<br />
festschreibt. Dazu gehören die Creative-Commons-Lizenzen<br />
für Text-, Bild- oder Tonerzeugnisse.<br />
All die Programme, die mit diesen Lizenzen<br />
operieren, bilden de facto eine<br />
Geschenkökonomie, die sich innerhalb der kapital<strong>ist</strong>ischen<br />
Profitökonomie etabliert hat – und<br />
vielleicht der Anfang eines neuen Zeitalters <strong>ist</strong>.<br />
Der Keim einer<br />
Geschenkökonomie<br />
Niels Boeing <strong>ist</strong> Diplom-Physiker,<br />
Technikjournal<strong>ist</strong> und Mitgründer des<br />
Fab Lab in Hamburg St. Pauli, einer<br />
offenen Werkstatt für computergesteuerte<br />
Produktionsmaschinen.<br />
Von ihm <strong>ist</strong> zuletzt erschienen:<br />
«Von wegen. Überlegungen zur freien<br />
Stadt der Zukunft.» Nautilus-Flugschrift,<br />
Hamburg 2015<br />
7
Kleines Handbuch der digitalen Ökonomie. Clickarbeit und Datenklau.<br />
Der Facebook-<strong>Gratis</strong>fake und andere heimliche Regeln.<br />
Wie «<strong>gratis</strong>» den Journalismus und die Öffentlichkeit zerstört hat.<br />
Dossier 9<br />
So teuer<br />
<strong>ist</strong> <strong>gratis</strong><br />
wirklich
10 Dossier<br />
<strong>Gratis</strong> <strong>ist</strong> <strong>nicht</strong> <strong>gratis</strong>: So funktioniert die<br />
Ökonomie des digitalen Zeitalters wirklich<br />
Wir lieben das Internet und seine Social Media<br />
wie Facebook, weil sie (me<strong>ist</strong>) <strong>gratis</strong> sind.<br />
Doch dahinter verbirgt sich der rabiate Umbau<br />
der Gesellschaft durch die kalifornischen<br />
Weltkonzerne.<br />
Text: Oliver Fahrni<br />
Bilder: Alexander Egger<br />
Seltsam. Ich videofoniere mit dem Sohn einer Freundin in<br />
Tokio – und es kostet mich <strong>nicht</strong>s. Ich lasse mir 2 867 894<br />
Texte, Bilder und Filme über die politische Lage in den<br />
USA aus vielen Archiven heraussuchen. Sie werden in<br />
Sekunden geliefert – doch niemand stellt mir Rechnung.<br />
Das Klavierkonzert von Khatia Buniatishvili in Toulouse<br />
<strong>ist</strong> ebens0 <strong>gratis</strong> wie meine Playl<strong>ist</strong> mit Underground-Musik<br />
auf Youtube. Ich benutze – völlig unentgeltlich – GPS,<br />
Verschlüsselungstechnik, Satellitentechnik und checke<br />
die Hütte, die ich in Sizilien vielleicht mieten möchte, auf<br />
meinem Bildschirm aus der Luft und von allen Seiten.<br />
Dies <strong>ist</strong> kein Werbespot für Google, sondern eine Frage:<br />
Wie geht das? Wie kann dies alles und noch viel mehr<br />
<strong>gratis</strong> sein? Denn die Bereitstellung dieser Informationen<br />
und Dinge kostet hohe Summen. Bei Google arbeiten<br />
60 000 Leute. Sie betreiben 900 000 Server und verbrauchen<br />
so viel Strom wie eine riesige Stadt. Das Internet <strong>ist</strong><br />
inzwischen der drittgrösste Stromfresser, nach China und<br />
den USA. Und obschon Google meine Kreditkarte niemals<br />
belastet, wächst und wächst der Konzern rasend schnell,<br />
machte im vergangenen Jahr 110 Milliarden Dollar Umsatz<br />
(Staatshaushalt der Schweiz: rund 70 Milliarden) und<br />
15 Milliarden Gewinn. Google/Alphabet hat sich offiziell<br />
zum Ziel gesetzt, «die Information der Welt zu organisieren».<br />
Damit könnte der Konzern an der Börse bald eine<br />
Billion Dollar wert sein. Die grössten Chemie- und Ölmultis<br />
und sogar Banken sind Leichtgewichte dagegen.<br />
Cent verdienen. Eigentlich <strong>ist</strong> er chronisch in den roten<br />
Zahlen, überschuldet und bankrott. Aber seine Aktionäre<br />
sind mit diesem irren Verlustgeschäft schwerreich geworden:<br />
Derzeit wiegt der Twitter-Konzern an der Börse rund<br />
33 Milliarden Dollar.<br />
Absurd? Nein, aber eine neue Logik: Offensichtlich<br />
funktioniert diese aufs Internet gebaute Wirtschaft nach<br />
anderen Regeln als nach der alten, klassischen Dreiheit:<br />
Produkt, Preis, Profit. Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter<br />
sollten wir das verstehen.<br />
Facebook und seine 2,2 Milliarden Mitarbeitenden<br />
Längst herumgesprochen hat sich ein Satz aus dem Silicon<br />
Valley: Ist etwas <strong>gratis</strong>, b<strong>ist</strong> du die Ware. Das <strong>ist</strong> das<br />
eine.<br />
Wie der kanadische Forscher Dallas Smythe schon im<br />
vorigen Jahrhundert schrieb: «Medien handeln mit der<br />
Publikumsware.» Erst recht Social Media. Die Daten, die<br />
wir etwa bei Facebook im Dauerbetrieb preisgeben, sind<br />
der Rohstoff dieser Ökonomie. Die Algorithmen ihre Produktionsmittel.<br />
Und die Information ihre Ware.<br />
Mit <strong>gratis</strong> war also <strong>nicht</strong>s. Wir bezahlen erstens, indem<br />
wir den Konzernen ihren Rohstoff liefern. Sie müssen ihn<br />
<strong>nicht</strong>, wie etwa Metalle, erst mühsam aus Minen buddeln.<br />
Es genügt, uns auf dem Netz anzuzapfen. Im Jargon der<br />
Branche heisst das denn auch «Data-Mining».<br />
Algorithmen sortieren diese Datenberge so, dass unsere<br />
Gewohnheiten und Vorlieben, unser Einkommen, unser<br />
Konsum und unsere Kreditwürdigkeit, aber auch unsere<br />
Krankheiten und heimlichen Neurosen wirtschaftlich<br />
verwertbar werden. Google etwa verkauft damit <strong>nicht</strong> nur<br />
Werbeplätze auf Hunderttausenden von Internetseiten.<br />
Dieses Datengold wird auch teuer gehandelt. Global.<br />
Darum blätterte Facebook 2014 für den bei Jugendlichen<br />
besonders beliebten Nachrichtedienst WhatsApp 20 Milliarden<br />
Dollar auf den Tisch.<br />
Was <strong>ist</strong> bloss mit dem Kapitalismus los?<br />
<strong>Gratis</strong> <strong>ist</strong> in diesem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem<br />
eigentlich <strong>nicht</strong> vorgesehen. Alles <strong>ist</strong> Ware, alles wird verkauft,<br />
alles hat seinen Preis. Bis hin zu Emotionen und Gefühlen.<br />
Auch mit der Umweltzerstörung wird längst spekuliert<br />
(CO²-Zertifikate), und der Systemzusammenbruch<br />
<strong>ist</strong> ein handelbares Wertpapier in Form von «strukturierten<br />
Produkten». So steht es um die Essenz kapital<strong>ist</strong>ischer<br />
Ökonomie.<br />
Darum ahnen wir: <strong>Gratis</strong> <strong>ist</strong> ein Fake. Im besten<br />
Fall eine optische Täuschung. Die Besitzer des Google-<br />
Konzerns geben niemals wertvolles Wissen und Können<br />
ohne Bezahlung her. Oder warum sollte Facebook Milliarden<br />
von Mitteilungen, Bildern, Filmen, News hin und her<br />
schaufeln, ohne damit fetten Profit zu machen? Tut Facebook<br />
ja auch <strong>nicht</strong>, im ersten Quartal schrieb der Konzern<br />
5,5 Milliarden Dollar Gewinn.<br />
Schwerreich durch hohe Verluste<br />
Und wie sollen wir den <strong>Gratis</strong>kurznachrichtendienst Twitter<br />
begreifen? Der Konzern, über den zum Beispiel der<br />
US-Präsident Donald Trump mit seinen 13 Millionen Followern<br />
Weltpolitik macht, wird wahrscheinlich nie einen<br />
Wir bezahlen<br />
für die <strong>Gratis</strong>dienste<br />
mit<br />
unseren<br />
Daten und<br />
Fronarbeit.
Manchen scheint das harmlos. «Einfach gezielte Werbung»,<br />
meint ein Kollege. Nur leicht irritiert ihn die Tatsache,<br />
dass Amazon inzwischen weiss, was wir in ein paar<br />
Stunden oder Tagen kaufen werden, lange bevor wir uns<br />
dazu entschieden haben.<br />
Noch riecht das nach altem Warenkapitalismus. Denn<br />
das Geld für die Werbung stammt aus der klassischen Produktion,<br />
also aus dem Mehrwert, den sich die Aktionäre<br />
von der Arbeit ihrer Beschäftigten abschneiden.<br />
Nur zielen die Strategen der kalifornischen Weltkonzerne<br />
GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) und Co.<br />
sehr viel weiter. Ihnen geht es um individuelle Verhaltenssteuerung.<br />
Beim Konsum und darüber hinaus. Damit<br />
kommen sie gut voran, wie etwa der Skandal um Facebook,<br />
Cambridge Analytica und Trumps Wahl offenbarte.<br />
Dass die aufbereiteten Facebook-Daten dafür bei den Meinungsmachern<br />
landeten, war keine Panne, sondern das<br />
Geschäftsmodell. In jüngster Zeit ploppten bei diversen<br />
Wahl- und Abstimmungskämpfen (zuletzt in Irland) auf<br />
normalen Internetseiten kurzzeitig und zielgruppengenau<br />
suggestive Propagandafenster auf, sogenannte Dark-<br />
Ads. Naiv, wer da mit seinen Daten um sich wirft, die sich<br />
die Konzerne mit dem Versprechen «<strong>gratis</strong>» erschleichen.<br />
Doch wir tun noch viel mehr. Wir bezahlen für die<br />
scheinbar kostenlosen Dienste, indem wir kräftig für die<br />
GAFA und Co. arbeiten. Täglich, ohne Lohn und oft ohne<br />
es zu wissen. So stellen wir die Inhalte etwa von Facebook<br />
her. Egal, wie relevant sie sind. Hautsache, wir liefern den<br />
«Stoff», mit dem die Anbieter wuchern. Wir produzieren<br />
den Wert.<br />
Wir sind die verlängerte Werkbank der Konzerne<br />
In endlosen Feedbackschleifen trainieren wir die Algorithmen<br />
der Anbieter und ihre Künstliche Intelligenz. Wir<br />
lehren die Sprachbots der Callcenter reden. Wer bei<br />
Onlinehändlern ordert, erledigt gleich auch die Buchhaltung,<br />
besorgt die Warenbewirtschaftung, das Design,<br />
Teilen wäre gut. Doch<br />
die Share-Economy <strong>ist</strong><br />
exakt das Gegenteil.<br />
Marketingaufgaben. Und einiges mehr. Wir halten die<br />
Maschine am Laufen.<br />
Dabei werden wir, wie der deutsche Analytiker Timo<br />
Daum in seinem Buch «Das Kapital sind wir» schreibt, «als<br />
verlängerte Werkbank der Softwarehersteller in Dienst<br />
genommen». In Umrissen <strong>ist</strong> da bereits die neue Logik der<br />
digitalen Ökonomie erkennbar.<br />
Wer sorgsam mit der eigenen Zeit umgeht, wird bemerken,<br />
dass diese Fronarbeit immer mehr Lebenszeit<br />
stiehlt. Dennoch le<strong>ist</strong>en viele dieses «Clickworking» bereitwillig,<br />
weil es den GAFA gelungen <strong>ist</strong>, die Social Media<br />
mit einem Hauch neuer Lebensformen und kalifornischer<br />
Surfer-Freiheit zu tarnen. «Sammle Momente, <strong>nicht</strong><br />
Dinge» <strong>ist</strong> einer ihrer Werbesprüche für die Millennials<br />
dieser Welt. Besitz scheint out, teilen in. Hauptsache, vernetzt.<br />
«Sharing is caring» heisst ein anderer Slogan aus<br />
den Marketingabteilungen.<br />
Richtig. Warum sollten wir <strong>nicht</strong> per Carsharing reisen?<br />
Oder unsere Wohnung zur Verfügung stellen, während<br />
wir Ferien machen? Oder dem Nachbarn bei einem<br />
Rohrbruch zur Hand gehen? So werden Ressourcen besser<br />
genutzt, und man schlägt der Logik der Verwertung, in<br />
der alles seinen Preis hat, ein Schnippchen.<br />
Der Haken daran <strong>ist</strong> die brutale Wirklichkeit. Gemeinnützige<br />
Plattformen sind an den Rand gedrängt. Airbnb,<br />
Ebay und andere neue Konzerne aber scheffeln mit unserer<br />
Bereitschaft, zu teilen, Monsterumsätze. Sie haben die
12<br />
Dossier<br />
Gemeinnützigkeit kommerzialisiert und kapitalisiert.<br />
Wenn ausgerechnet kalifornische Richter als erste den<br />
Fahrdienst Uber scharf reguliert haben, quittierten sie damit<br />
<strong>nicht</strong> nur die Pervertierung der schönen Idee vom<br />
Carsharing. Sie stellten auch die Frage, wie legitim die<br />
Uberisierung als wirtschaftliches Modell <strong>ist</strong>.<br />
Denn hinter dem Prinzip, billig gefahren zu werden<br />
und dies <strong>gratis</strong> über eine Plattform vermittelt zu bekommen<br />
(wie cool das <strong>ist</strong>!), kaschiert sich ein gesellschaftlicher<br />
Bruch: Die Arbeit le<strong>ist</strong>en (also den Wert schaffen)<br />
nun prekär Beschäftigte ohne soziale Absicherung. Sie<br />
arbeiten auf Abruf, mit unbegrenzten Arbeitsstunden, unversichert.<br />
Und sie müssen mehrere Jobs kumulieren, um<br />
ihr Auskommen zu sichern, arbeiten oft nebenbei als<br />
Kuriere, Klempner und Multidienstle<strong>ist</strong>er.<br />
Dies <strong>ist</strong> das Kernmodell der neuen Ökonomie, das sich<br />
hinter «Playlabour», «Mikrounternehmern», freier Zeitgestaltung<br />
und anderem Lifestyle-Gerede verbirgt. Kaum<br />
ein Bereich, der <strong>nicht</strong> gerade uberisiert wird. Konzerne<br />
holen sich Produktideen, Zulieferteile, Software, Konstruktionspläne,<br />
Design etc. zunehmend von irgendwoher,<br />
durch Ausschreibung auf Plattformen weltweit. Hauptsache<br />
billig.<br />
Die Welt als Konzerngelände<br />
Dieser radikale Umbau <strong>ist</strong> <strong>nicht</strong> technikgesteuert, sondern<br />
folgt wirtschaftlichen Interessen: Er treibt die Arbeitsteilung<br />
auf die Spitze. Er senkt den Preis für die Arbeit<br />
und entgrenzt die Arbeitszeiten. Er drückt, durch<br />
Auslagerung in Heimarbeit, die Kosten der Produktion.<br />
Er zerstört soziale Absicherung, schafft also noch mehr<br />
erzwungen-willige und billige Arbeit. Und er treibt die<br />
Konzentration des Kapitals voran. Uber verdrängt das<br />
Taxigewerbe bis in die hintersten Ecken der Welt und<br />
<strong>Gratis</strong> <strong>ist</strong> real weder<br />
Facebook noch Google.<br />
<strong>Gratis</strong> oder so billig<br />
wie möglich soll bloss<br />
unsere Arbeit sein.<br />
attackiert jetzt global Automiete, Transport und Log<strong>ist</strong>ik.<br />
Amazon führt inzwischen (fast) alles, was käuflich <strong>ist</strong>, und<br />
zerstört damit überall den Detailhandel. Facebook, Google<br />
und ein paar andere kontrollieren und vermarkten<br />
immer grössere Teile der Nachrichten-, Wissens- und<br />
Kulturproduktion der Menschheit. Die Konzerne übernehmen.<br />
Sie verwandeln, wie es in den Social Media bereits<br />
angelegt <strong>ist</strong>, immer mehr öffentliche Räume und<br />
Dienste in kommerzielles Privatgelände.<br />
GAFA-Manager, etwa Facebook-Gründer Mark Zuckerberg,<br />
machen in ihren Interviews und Schriften daraus<br />
keinen Hehl. Sie sehen sich als die Fortschreibung der<br />
neoliberalen Revolution der 1980er-Jahre. Nur verschärft<br />
und radikaler.<br />
<strong>Gratis</strong> <strong>ist</strong> <strong>nicht</strong>, was sie uns bieten. <strong>Gratis</strong>, oder so<br />
billig wie möglich, soll unsere Arbeit sein.<br />
Timo Daum: «Das Kapital sind wir».<br />
Details: edition-nautilus.de
Dossier<br />
<strong>Gratis</strong>medien zerfleischen die<br />
Presse. Todeskampf ohne Ende?<br />
13<br />
Das jüngste Opfer <strong>ist</strong> die Tageszeitung<br />
Le Matin, die ab dem 22. Juli <strong>nicht</strong> mehr in gedruckter<br />
Form erscheint. Innert 20 Jahren <strong>ist</strong><br />
die Auflage der Bezahlzeitungen in der Schweiz<br />
um 1,15 Millionen Einheiten geschrumpft.<br />
Text: <strong>syndicom</strong><br />
Die heutige Situation hat viel mit dem Entscheid der Verleger<br />
zu tun, <strong>Gratis</strong>zeitungen zu lancieren und aufrechtzuerhalten.<br />
Eine davon <strong>ist</strong> 20 Minuten, die me<strong>ist</strong>gelesene<br />
Schweizer Zeitung mit einer Leserschaft von über 2,7 Millionen<br />
in der Deutschschweiz, in der Romandie und in der<br />
italienischsprachigen Schweiz. Die Onlineversion hat<br />
mehr als eine Million Nutzerinnen und Nutzer. In der<br />
Deutschschweiz kommen die rund 534 000 Leserinnen<br />
und Leser der Printausgabe von Blick am Abend hinzu. Diese<br />
<strong>Gratis</strong>zeitung wird auch im Internet von 119 000 Nutzerinnen<br />
und Nutzern gelesen. Das Ergebnis: Die heutige<br />
Generation sieht <strong>nicht</strong> ein, weshalb sie 500 Franken jährlich<br />
für eine Tageszeitung bezahlen sollte, wenn die Informationen<br />
auch umsonst angeboten werden (wobei es keine<br />
Rolle spielt, dass es sich mitunter nur um Fotoseiten<br />
von Grillabenden der Leserinnen und Leser handelt).<br />
<strong>Gratis</strong>zeitungen «verbreiten seichte Informationen,<br />
zum System erhobene Belanglosigkeit», schreibt Jacques<br />
Pilet, Gründer verschiedener Westschweizer Zeitungen,<br />
auf der Informationswebsite Bon pour la tête. «Ein Brei aus<br />
Agenturmeldungen und Klatschgeschichten, eine Auswahl<br />
unwichtiger, abgekochter Trivia. Drei Viertel der<br />
sind nordamerikanischer Herkunft und<br />
werden von den Agenturen vorgefertigt geliefert», so sein<br />
Urteil.<br />
Nur 12 % zahlen für Onlineartikel<br />
Die Leserinnen und Leser aber haben sich daran gewöhnt.<br />
Dies gilt vor allem für die Schweiz, wo der Anteil der Personen,<br />
die für den Zugang zu Onlinenachrichten bezahlen,<br />
mit 12 % sehr tief <strong>ist</strong>. Dieser Anteil sei kleiner als in<br />
zahlreichen der übrigen 36 Länder, die im Reuters Institute<br />
Digital News Report 2018 untersucht worden sind,<br />
sagt Linards Udris vom Forschungsinstitut Öffentlichkeit<br />
und Gesellschaft (fög) der Universität Zürich, einer der<br />
Autoren des Länderberichts Schweiz. «Die Schweiz unterscheidet<br />
sich von den anderen Ländern dadurch, dass<br />
<strong>Gratis</strong> angebote bei der Pressenutzung (Print und Online)<br />
an erster Stelle stehen, während diese andernorts zum<br />
Teil verschwunden sind. Über 50 % der Befragten nutzen<br />
wöchentlich die Ausgaben von 20 Minuten», stellt der Forscher<br />
fest.<br />
Die Bezahlpresse kann mit einer solchen Leserzahl<br />
<strong>nicht</strong> mithalten. Le Matin erreichte 218 000 Leserinnen<br />
und Leser, verzeichnete aber gemäss Tamedia im letzten<br />
Jahr einen Verlust von 6,3 Millionen Franken und innert<br />
zehn Jahren einen solchen von fast 34 Millionen Franken.<br />
Und selbst die Qualitätszeitungen leiden, wie die NZZ, die<br />
in einem Jahr fast 30 000 Leserinnen und Leser der Printausgabe<br />
einbüsste, dafür 16 000 neue Onlinenutzerinnen<br />
und -nutzer gewann.<br />
Schuld daran sind <strong>nicht</strong> die Leserinnen und Leser allein.<br />
Die Verleger haben die Qualität der Zeitungen geschwächt:<br />
Sie haben die Zahl der Auslandskorrespondentinnen<br />
und -korrespondenten sowie Fachredakteurinnen<br />
und -redakteure verringert, die Redaktionsbudgets zugunsten<br />
des Marketings gekürzt, sich aus dem GAV zurückgezogen,<br />
um die Löhne zu senken, und sie haben die<br />
Redaktionen und damit auch die behandelten Themen<br />
zusammengelegt und vereinheitlicht.<br />
Die <strong>Gratis</strong>zeitungen und die Bezahltitel stehen im<br />
Wettbewerb auf dem Markt für Pressewerbung, dessen<br />
Umsätze heute nur noch 1,117 Milliarden Franken betragen,<br />
11,7 % weniger als 2016. Gleichzeitig boomt die Onlinewerbung<br />
mit Umsätzen von 2,1 Milliarden Franken und<br />
einem Wachstum von 5,9 %, wobei die Suchmaschinenwerbung<br />
<strong>nicht</strong> mitgerechnet wurde.<br />
Schuld daran sind<br />
<strong>nicht</strong> die Leserinnen<br />
und Leser allein.
14<br />
Dossier<br />
Die WEKO handelt endlich<br />
Tamedia und Ringier kontrollieren zusammen 80 % der<br />
Auflage in der Schweiz. Die Konzentration der Titel bei<br />
den beiden Verlagshäusern und die Tatsache, dass Tamedia<br />
der grösste Aktionär der Schweizerischen Depeschenagentur<br />
(SDA) war, lasteten schwer auf den Erwartungen,<br />
die deren Hauptaktionär APA (seit der Fusion mit Keystone)<br />
in puncto Rendite an die Agentur hatte. Mit 36 gestrichenen<br />
Stellen bis 2019 <strong>ist</strong> die SDA ein weiteres Opfer<br />
der Krise von Anfang dieses Jahres. Es erstaunt, dass sich<br />
die Wettbewerbskommission (WEKO) <strong>nicht</strong> stärker für<br />
diese Konzentration – die sich mit der Übernahme der<br />
Basler Zeitung durch Tamedia noch verstärkt hat – interessiert<br />
hatte. Erst Anfang Mai stimmte die WEKO einer<br />
vertieften Überprüfung einer möglichen marktbeherrschenden<br />
Stellung im Fall der Goldbach-Übernahme<br />
(elektronische Medien und Werbeflächen) durch Tamedia<br />
zu.<br />
Zahl der gewerkschaftlich organisierten Journal<strong>ist</strong>innen<br />
und Journal<strong>ist</strong>en sinkt<br />
Leider schwindet auch die Zahl der gewerkschaftlich organisierten<br />
Journal<strong>ist</strong>en, die zum Kampf gegen den Verlust<br />
so vieler Arbeitsplätze bereit sind. Laut Stephanie Vonarburg,<br />
Verantwortliche des Sektors «Presse und elektronische<br />
Medien» bei <strong>syndicom</strong>, <strong>ist</strong> diese Entwicklung «darauf<br />
zurückzuführen, dass die Zahl der Personen, die diesen<br />
Beruf ausüben, sinkt. Ebenfalls hat sich der Organisationsgrad<br />
von 70 % auf rund 50 % in den vergangenen 20 Jahren<br />
reduziert. Aber die Branche beginnt jetzt, gewerkschaftliche<br />
Kämpfe zu führen, wie der Streik der SDA und<br />
der Widerstand in den Redaktionen der Tamedia zeigen»,<br />
sagt sie.<br />
Weniger gedruckte Zeitungen haben auch weniger Arbeitsplätze<br />
im Druckbereich zur Folge. Gemäss dem Bundesamt<br />
für Stat<strong>ist</strong>ik sind in diesem Sektor innerhalb von<br />
20 Jahren (1995–2015) zwei Drittel der Stellen verschwunden<br />
(Rückgang von 34 987 im Jahr 1995 auf 13 097 im Jahr<br />
2015). Gab es in der Schweiz 1995 noch 2537 Druckereien,<br />
waren es 2015 nur noch 1060.<br />
Ab dem 23. Juli wird Le Matin also die erste Schweizer<br />
Tageszeitung sein, die nur noch online erscheinen wird.<br />
Wird es möglich sein, mit einer auf 15 Personen beschränkten<br />
Redaktion – die mit dem Sport-Center und<br />
Newsexpress von Tamedia sowie dem Netz von 20 Minuten<br />
zusammenarbeitet – hochwertige Inhalte zu produzieren?<br />
«In der Regel gibt es mit einer reduzierten Redaktion bei<br />
Printmedien Probleme», sagt Linards Udris. «Die Redaktion<br />
der französischsprachigen Zeitung 20 Minutes <strong>ist</strong> kleiner<br />
als jene von 20 Minuten und liefert weniger Analysen<br />
oder eigene Texte bei Abstimmungen. Ihre Qualität <strong>ist</strong> somit<br />
niedriger. Wichtig <strong>ist</strong> die redaktionelle Strategie, und<br />
die Boulevardzeitung Le Matin kann somit kaum Inhalte<br />
mit 20 Minutes austauschen», meint er. Falls Le Matin auf<br />
ihre Stärke – exklusive Sportinformationen – verzichtet<br />
und stattdessen Agenturmeldungen übernimmt, bestehen<br />
Zweifel daran, ob die Zeitung überleben wird.<br />
In der Schweiz informieren sich rund 40 % der Mediennutzerinnen<br />
und -nutzer im Alter von 18 bis 24 Jahren, indem<br />
sie über Suchmaschinen nach Themen suchen oder<br />
die News über Social Media erhalten, gemäss dem Jahrbuch<br />
Qualität der Medien 2017 des fög. Direkt auf Zeitungs-Websites<br />
wird immer weniger häufig gesucht.<br />
Es braucht Leser,<br />
die bereit sind,<br />
für eigenproduzierte<br />
Inhalte zu bezahlen.<br />
Die Pressefinanzierung muss neu erfunden werden.<br />
Der Bundesrat will die Presse im Rahmen des neuen Mediengesetzes<br />
schützen. Ein Teil der Medienabgabe soll<br />
den Onlinemedien zukommen, die einen Le<strong>ist</strong>ungsauftrag<br />
erfüllen. Doch die Vorlage, die einen Teil der Gebühren<br />
für Onlineton und -videoangebote vorsieht, einen Teil<br />
für Presseagenturen, gleicht die Verluste der gedruckten<br />
Presse <strong>nicht</strong> aus. Unabhängig vom gewählten Modell<br />
braucht es Lesende, die bereit sind, für eigenproduzierte<br />
Inhalte, für Recherchen vor Ort und für eine Arbeit zu bezahlen,<br />
die sich von jener der Agenturen und der in Pools<br />
organisierten Redaktionen unterscheidet. Denn es sei ein<br />
für alle Mal gesagt: Gute Artikel sind nie <strong>gratis</strong>.<br />
https://bit.ly/2JZKGz7<br />
Fotostrecke<br />
Das Sujet zum Titelbild hat der Berner Fotograf Alexander<br />
Egger in Derborence gefunden. In Bern hat er die Fotos auf<br />
den Seiten 8 bis 14 und das kleine Foto fürs Inhaltsverzeichnis<br />
aufgenommen. Seine Reportage hat er dem Thema «Leben<br />
und Tod einer <strong>Gratis</strong>zeitung» gewidmet. Einer breit gestreuten<br />
Presse, die nach dem Blättern einfach liegen bleibt<br />
und so zu den Abfallbergen im öffentlichen Raum beiträgt.<br />
Alexander Egger macht in seinen Naturfotos interessante<br />
Studien zu Bewegung, Reflexen und Farbe. Mehr darüber auf<br />
seiner Website: alexanderegger.ch.
15<br />
<strong>Gratis</strong> <strong>ist</strong> teuer<br />
Umsatz 2017*, in Milliarden US-Dollar<br />
2,5 41<br />
110<br />
Quellen: Angaben der Unternehmen *Umsatz Twitter 2016<br />
<strong>Gratis</strong> <strong>ist</strong> spekulativ<br />
Verlust in Milliarden US-Dollar<br />
–2,53<br />
Twitter<br />
(2016)<br />
–3,44<br />
Snapchat<br />
(2017)<br />
Marktwerte im Vergleich in Milliarden US-Dollar<br />
Google<br />
Facebook<br />
ExxonMobil<br />
der teuerste Öl-Multi<br />
340<br />
528<br />
739<br />
Börsenwert<br />
33 Mia. US-Dollar<br />
Börsenwert<br />
27 Mia. US-Dollar<br />
JP Morgan Chase<br />
die teuerste Bank<br />
314<br />
Quellen: Angaben der Unternehmen<br />
<strong>Gratis</strong> <strong>ist</strong> schmutzig<br />
Das Web verbrauchte<br />
2017<br />
rund 8 Prozent<br />
des weltweiten<br />
Stroms.<br />
1,5 x<br />
Die Internet-Industrie<br />
stösst heute eineinhalb<br />
Mal soviel Treibhausgase<br />
aus wie der weltweite<br />
Flugbetrieb.<br />
<strong>Gratis</strong>: Du b<strong>ist</strong> die Ware<br />
Stand 2017, in US-Dollar<br />
Jedes LinkedIn-Mitglied<br />
<strong>ist</strong> 550 Dollar wert<br />
Jedes Facebook-Mitglied<br />
<strong>ist</strong> 280 Dollar wert<br />
550<br />
280<br />
Quellen: Planetoscope, Greenpeace France, Climatecare<br />
Quellen: Eigene Berechnungen nach Angaben der Unternehmen<br />
Online rahmt ab<br />
Netto-Werbeumsätze Schweiz 2013 und 2017,<br />
in Millionen Franken<br />
Werbeumsatz<br />
Presse<br />
TV<br />
Radio<br />
Online<br />
749<br />
774<br />
157<br />
151<br />
1117<br />
845<br />
Quelle: Stiftung Werbestat<strong>ist</strong>ik Schweiz<br />
1615<br />
2100<br />
Druckereien<br />
Angestellte<br />
– 31%<br />
4157<br />
+149%<br />
Jobsterben in der Druckbranche<br />
Zahl der Arbeitsplätze und der Druckereien in der Schweiz<br />
35000<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
Quellen: BFS, Betriebszählung<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
2002<br />
2004<br />
2006<br />
2008<br />
2010<br />
2012<br />
2014<br />
6839<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Die Tricks und Hebel der digitalen Ökonomie<br />
Nur sehr wenige Menschen würden sich wohl auf Facebook<br />
tummeln, wenn sie dafür auch noch bezahlen müssten.<br />
Sie geben ja schon ihre Daten preis und schaffen mit ihren<br />
Einträgen, Clips und Bildern die Inhalte von Facebook.<br />
Die erste Regel der digitalen Ökonomie heisst: Wer sich<br />
durchsetzen will, braucht Masse. <strong>Gratis</strong> <strong>ist</strong> der Hebel, um<br />
an diese Masse zu kommen. Im Falle von Facebook sind es<br />
heute 2,2 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Aber die Regel<br />
gilt für alle ähnlichen Internet-Konzerne.<br />
Dass Facebook und Co. alles andere als <strong>gratis</strong> sind, zeigen<br />
wir in diesem Dossier. Wir bezahlen mit Daten und Inhalten<br />
(also Clickarbeit). Was damit geschieht, wissen wir <strong>nicht</strong>.<br />
Wir geben sie in eine Black Box ein. Intransparenz <strong>ist</strong><br />
die zweite, eiserne Regel der digitalen Konzerne. Ihre<br />
Logarithmen ordnen und steuern zwar zunehmend via Big<br />
Data unser ganzes Leben, aber wie die gebaut sind und was<br />
sie anrichten, wird vor uns versteckt. Wer Monsterkonzerne<br />
wie Facebook oder Google zähmen will, bevor sie allein die<br />
Herrschaft übernehmen, muss drei Dinge anpacken:<br />
Logarithmen müssen transparent gemacht werden. Die<br />
Datenhoheit muss von den Konzernen zu den Nutzenden<br />
zurückgeführt werden. Und anonymisierte Metadaten<br />
müssen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.<br />
Die dritte Grundregel digitaler Ökonomie, nach Masse und<br />
Intransparenz heisst Verdrängung und Zerstörung.<br />
Die Internet-Konzerne schaffen zwar auch neuen Wert,<br />
aber im Wesentlichen verteilen sie bestehenden Wert zu<br />
ihren Gunsten um: Dafür brechen sie gewachsene<br />
wirtschaftliche und erkämpft soziale Strukturen auf.
16<br />
Eine bessere<br />
Arbeitswelt<br />
Zusammen sind die<br />
Redaktionen stärker!<br />
Gnadenlos forciert Tamedia die<br />
Medien konzentration. Ebenso gnadenlos<br />
<strong>ist</strong> der Umgang mit den Mitarbeitenden.<br />
Lassen wir uns durch ihre<br />
PR-Rhetorik <strong>nicht</strong> täuschen.<br />
Das letzte Kapitel dieses tragischen<br />
Schauspiels: Weil zu wenige<br />
Mitarbeitende freiwillig künden, werden<br />
sie mit Abgangsentschädigungen<br />
dazu «eingeladen», um den Fakt der<br />
Massenentlassung jur<strong>ist</strong>isch zu umgehen.<br />
Ja kein Sozialplan, scheint die<br />
Devise. Das Vorgehen <strong>ist</strong> grenzwertig.<br />
Aber Grenzen sind für Tamedia kein<br />
Problem. Sie stülpt ihre Medienkonzentrationsstrategie<br />
einfach über<br />
die Redaktionsgrenzen. Arbeitsplatzverlust,<br />
sinkende journal<strong>ist</strong>ische Qualität<br />
und einen schweizweiten Einheitsbrei<br />
nimmt sie in Kauf. Aus<br />
gewerkschaftlicher Sicht gibt es darauf<br />
nur eine Antwort: Der Widerstand<br />
in den Redaktionen muss auch Grenzen<br />
überwinden. Alle Tamedia-Redaktionen<br />
führen den gleichen Kampf für<br />
Qualitätsmedien mit Profil, für gute<br />
Arbeitsbedingungen. Gegen das Prinzip<br />
«Teile und Herrsche» hilft nur redaktionsübergreifende<br />
Solidarität.<br />
Chr<strong>ist</strong>ian Capacoel<br />
Der Widerstand in den Redaktionen muss auch Grenzen überwinden, wie es im Jahr 2014<br />
in Lausanne der Fall war. (© Yves Sancey)<br />
https://bit.ly/2I3bbSp<br />
Digitaler Service public<br />
Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue<br />
EU-Datenschutz-Grundverordnung<br />
(DSGVO). In Zukunft können Daten<br />
nur nach Zustimmung der Betroffenen<br />
verwendet werden. So, wie es in<br />
der EU-Grundrechtecharta verbrieft<br />
<strong>ist</strong>. Als Folge der extraterritorialen<br />
Wirkung der DSGVO können auch<br />
Firmen und Behörden in der Schweiz<br />
betroffen sein.<br />
Beim Umgang mit personenbezogenen<br />
Informationen müssen Firmen<br />
künftig garantieren, die Grundsätze<br />
der DSGVO bei der Verarbeitung von<br />
Beschäftigten- oder Kundendaten einzuhalten.<br />
Dies betrifft insbesondere<br />
die Rechtmässigkeit und Zweckbindung,<br />
aber auch die Datenminimierung.<br />
Tun sie dies <strong>nicht</strong>, drohen ihnen<br />
Geldbussen von bis zu 20 Millionen<br />
Euro.<br />
Der Skandal bei Facebook hat die<br />
Öffentlichkeit aufgeschreckt. Das Verhindern<br />
von Datenmissbrauch <strong>ist</strong> eine<br />
zentrale Voraussetzung, damit die<br />
digitale Transformation der Gesellschaft<br />
Gewinn bringt und breiter akzeptiert<br />
wird. Dies gilt es auch beim<br />
Entwickeln des digitalen Service public<br />
zu berücksichtigen.<br />
Giorgio Pardini <strong>ist</strong> Leiter Sektor ICT und<br />
Mitglied der Geschäftsleitung
Wenn selbst die Kirche wie eine Holding handelt und ihre<br />
Zeitung insolvent gehen lässt, müsste der Staat eingreifen<br />
17<br />
Giornale del Popolo : zweifelhafte<br />
Verträge für die Betroffenen<br />
Das Giornale del Popolo schliesst die Tore. Die Rechnung bezahlen<br />
die 30 Angestellten. Wie, <strong>ist</strong> noch <strong>nicht</strong> völlig geklärt<br />
Die Zeitung Giornale del Popolo <strong>ist</strong> von<br />
uns gegangen. Am 5. Juni hat das<br />
Amtsgericht die Insolvenz der Gesellschaft<br />
Nuova Società Giornale del Popolo<br />
S.A., deren Eigentümerin die Kurie<br />
von Lugano <strong>ist</strong>, bekannt gegeben.<br />
Nach 92 Jahren endet somit die<br />
Geschichte der letzten katholischen<br />
Tageszeitung in der Schweiz. Die Krise<br />
der Presse und der Information allgemein<br />
<strong>ist</strong> gewiss keine Neuigkeit (es genügt,<br />
auf Seite 13 zu lesen, was in der<br />
Westschweiz geschieht). Der Zusammenbruch<br />
des Werbemarktes, der<br />
Rückgang der Abonnements und die<br />
Habsucht der Verleger führten zum<br />
Verschwinden mehrerer Zeitungen.<br />
Und im Tessin rechtfertigt die Grösse<br />
des Marktes (360 000 Einwohner)<br />
<strong>nicht</strong> die Ex<strong>ist</strong>enz von drei Tageszeitungen.<br />
Mag es sich beim Giornale del<br />
Popolo um einen angekündigten Tod<br />
gehandelt haben – es gibt noch einige<br />
dunkle Stellen in dieser Geschichte.<br />
Die Zeiten<br />
Die Bekanntgabe der Schliessung<br />
machte die Kurie am 17. Mai. «Infolge<br />
der instabilen Entwicklung bei der<br />
Agentur für Werbeeinkünfte Publicitas<br />
AG hat die Situation, die sich für<br />
das Giornale del Popolo, zu wesentlichen<br />
Teilen getragen von den nun<br />
fehlenden Werbeeinnahmen dieser<br />
Agentur, ergeben hat, den Verleger vor<br />
die Notwendigkeit gestellt, heute die<br />
Bilanzen beim Amtsgericht von Lugano<br />
zu hinterlegen.<br />
Diese Massnahme beinhaltet, dass<br />
das Erscheinen der Tageszeitung ab<br />
Samstag, 19. Mai 2018, eingestellt<br />
wird. » Und die Entscheidung erfolgte<br />
in der Tat auch blitzartig : Man hatte<br />
vielmehr die Ankündigung einer Umstrukturierung<br />
bis zum Jahresende erwartet<br />
(vor allem, wenn man davon<br />
ausgeht, dass das Budget der ersten<br />
Monate 2018 durch 7000 Abonnenten<br />
gesichert gewesen wäre). Das hätte die<br />
Möglichkeit beinhaltet, Lösungen für<br />
die Zukunft und für die Mitarbeiter<br />
(Sozialplan) zu finden. Doch der Himmel<br />
war alles andere als wolkenlos.<br />
Das Wie<br />
Seit Jahren schrieb die Zeitung der<br />
Kurie rote Zahlen. Das Ende der Zusammenarbeit<br />
mit dem Corriere del<br />
Ticino hatte viele Fragen aufgeworfen.<br />
Bereits im Juli 2017 hatte <strong>syndicom</strong> einen<br />
langfr<strong>ist</strong>igen Plan des Verlags<br />
zum Schutz der Mitarbeiter gefordert.<br />
Die Insolvenz von Publicitas war<br />
eine «Ausrede», um die Verantwortlichkeit<br />
der Kurie gegenüber den Beschäftigten<br />
herunterzusetzen. «In diesem<br />
schwierigen Moment – so die<br />
Mitteilung weiter – wünscht der Bischof,<br />
allen Mitarbeitern, die nun gefordert<br />
sind, eine überaus mühevolle<br />
Situation auf sich zu nehmen, seinen<br />
innigsten Dank für den grossartigen<br />
und unerschütterlichen Einsatz während<br />
so vieler Jahre zum Ausdruck zu<br />
bringen. Es wird darüber nachgedacht,<br />
wie man die Folgen dieser erzwungenen<br />
Schliessung möglicherweise<br />
weniger belastend gestalten<br />
könnte.»<br />
Mit der Hinterlegung der Bilanzen<br />
beim Amtsgericht hat man es jedoch<br />
faktisch verhindert, irgendeinen Sozialplan<br />
auf den Weg zu bringen. Und<br />
das bei einem Arbeitgeber, der naturgemäss<br />
«verantwortungsbewusst»,<br />
«ethisch» und «sozial» sein müsste.<br />
Die Regeln<br />
Wenn sich aber selbst die Kirche wie<br />
eine Holding benimmt, indem sie die<br />
Insolvenz eines ihrer Unternehmen<br />
erklärt und die Lasten dem Staat aufbürdet,<br />
so müsste dieser doch zu Hilfe<br />
eilen.<br />
Die Entscheidungen der Manager<br />
(die «im Namen der Krise» Einschnitte<br />
am Personal vornehmen) dürfen <strong>nicht</strong><br />
auf die Gemeinschaft abgewälzt werden.<br />
Es bräuchte Gesetze, welche die<br />
Firmen mit ihrer Verantwortung konfrontieren.<br />
Im Falle des Giornale del<br />
Popolo wurde für die 30 ab dem 1. Juni<br />
arbeitslose Angestellten ein Solidaritätsfonds<br />
eingerichtet. Die Berechnungen<br />
zur Aufteilung der Fondsmittel<br />
brachten ziemlich unklare<br />
Vertragsverhältnisse (Unterschiede<br />
bei den Abfindungen, Pensionierte<br />
mit Gehaltsabrechnung, aber mit<br />
Hungerlöhnen, Entlohnungen unter<br />
dem Mindestsatz des alten Gesamtarbeitsvertrags<br />
von 2004) zum Vorschein,<br />
die einmal mehr die Forderung<br />
nach einem GAV, der seit<br />
14 Jahren fehlt, dringlich machen.<br />
Vielleicht hätte ein GAV für die<br />
Presse das Giornale del Popolo <strong>nicht</strong><br />
gerettet, eine Reglementierung hätte<br />
aber die Ungleichheiten begrenzt und<br />
den Dialog zwischen Direktion und<br />
Verleger sicher verbessert.<br />
<strong>syndicom</strong> hat das Konkursamt gebeten,<br />
die Datenbank mit 7000 Abonnenten<br />
zu bewerten und in der Konkursmasse<br />
zu berücksichtigen. Zwei<br />
pensionierte Redakteure des Giornale<br />
del Popolo haben eine Online-Zeitung<br />
angekündigt. Die Kurie will Überlegungen<br />
dazu anstellen, wie sie sich<br />
Gehör verschaffen kann. Auch ohne<br />
gedruckte Zeitschrift.<br />
Giovanni Valerio<br />
Die Redaktion abgebildet in der letzten Nummer der Zeitung. (© Ruben Rossello)<br />
https://bit.ly/2JNPVC0
18 Arbeitswelt<br />
«Wir brauchen eine Messung des Wohlstands, die den Beitrag<br />
der Frauen zur Bruttowertschöpfung aufzeigt » Margrit V. Zinggeler<br />
Kostenlose Dienstle<strong>ist</strong>ungen<br />
und Subunternehmerketten<br />
Kostenlose Dienstle<strong>ist</strong>ungen sind der<br />
erste Schritt zu den kostenpflichtigen<br />
«Prime Services». Nach der Beantragung<br />
des kostenlosen Dienstes und einer<br />
gewissen Gewöhnungszeit kann/<br />
muss man kostenpflichtige Zusatzdienste<br />
beziehen, damit sich die Gewinnmargen<br />
erhöhen. Folglich gerät<br />
die log<strong>ist</strong>ische Struktur immer mehr<br />
unter Druck. Als Gewerkschaft interessieren<br />
wir uns schon lange dafür,<br />
welche Konsequenzen kostenlose<br />
Dienstle<strong>ist</strong>ungen für die Arbeitsbedingungen<br />
haben. Im kostenlosen<br />
Versand (wie bei Zalando) <strong>ist</strong> die strukturelle<br />
«Return Log<strong>ist</strong>ic» (Millionen<br />
Pakete nur schon in der Schweiz) ein<br />
Phänomen, das man im Auge behalten<br />
muss, weil es viel manuelle Arbeit<br />
mit sehr hohen Kosten erfordert. Sie<br />
muss daher reguliert werden. Der von<br />
den kostenlosen Diensten verursachte<br />
Druck auf die Gewinnmargen <strong>ist</strong> die<br />
treibende Kraft hinter Externalisierung<br />
von Dienstle<strong>ist</strong>ungen oder Auftragsweitervergabe<br />
an Subunter -<br />
nehmer und Subsubunternehmer.<br />
Weni ger rentable Produkte werden oft<br />
Dritten anvertraut. GAV bleiben somit<br />
eine Priorität für die log<strong>ist</strong>ischen<br />
Dienste, die mit einem exponentiellen<br />
Anstieg der Anzahl Konkurrenten auf<br />
einem zunehmend wettbewerbsorientierten<br />
Markt konfrontiert sind. Über<br />
den GAV im Kurierwesen versucht <strong>syndicom</strong>,<br />
dem Sektor ein starkes Signal<br />
zu geben: Ja, gemeinsam schaffen wir<br />
es!<br />
Matteo Antonini <strong>ist</strong> Leiter des Sektors Log<strong>ist</strong>ik und<br />
Mitglied der <strong>syndicom</strong>-Geschäftsleitung<br />
Die ungeschriebene Geschichte<br />
des Wirtschaftswunders Schweiz<br />
Ohne die Arbeit der Frauen und deren Engagement für das<br />
Gemeinwesen wäre das <strong>nicht</strong> möglich gewesen.<br />
«Swiss made» oder «Swiss maid»? Der<br />
Unterschied <strong>ist</strong> <strong>nicht</strong> zu hören, und<br />
leicht überliest man ihn. Maid bedeutet<br />
im Englischen Magd oder auch junge<br />
Frau. Das Wortspiel inspirierte<br />
Prof. Margrit Zinggeler zum Titel ihres<br />
neusten Buches. Darin zeigt sie auf,<br />
dass das Wirtschafts wunder Schweiz<br />
ohne die Arbeit der Frauen und deren<br />
Engagement für das Gemeinwesen<br />
<strong>nicht</strong> möglich gewesen wäre.<br />
Nur einige Unverbesserliche würden<br />
ernsthaft bestreiten, dass die<br />
Frauen einen wesentlichen Beitrag<br />
zum wirtschaftlichen Erfolg der<br />
Schweiz gele<strong>ist</strong>et haben. Weshalb hat<br />
Margrit Zinggeler dennoch ihr Sabbatical<br />
geopfert, um diese offensichtliche<br />
Tatsache auf über 300 Seiten<br />
festzuhalten?<br />
Keine Geschichte von Männern<br />
für Männer<br />
Die h<strong>ist</strong>orische Aufarbeitung des wirtschaftlichen<br />
Erfolgs der Schweiz sei<br />
sehr einseitig. «Ich habe mich geärgert,<br />
dass hier eine Geschichte von<br />
Männern für Männer beschrieben<br />
wurde, die vor allem von Schlachten,<br />
Kriegen, Allianzen handelte», erklärt<br />
die Schweizer Professorin, die heute<br />
einen Lehrstuhl für Deutsch an der<br />
Eastern Michigan University innehat.<br />
Das rief nach einer notwendigen<br />
Richtigstellung.<br />
«Die Frauen wirtschaften, und<br />
die Männer erwerben»<br />
Nach den zwölf Kapiteln, in denen<br />
eine umfassende und detaillierte<br />
Analyse geliefert wird, fällt auf, dass<br />
sich trotz Industrialisierung, 68erund<br />
#metoo-Bewegung im Grunde<br />
nur wenig verändert hat.<br />
Es sind bis heute vor allem Dienstle<strong>ist</strong>ungsberufe,<br />
die Frauen offenstehen.<br />
Gesellschaftlich wenig anerkannt<br />
werden sie dementsprechend<br />
entlohnt. Nach Zinggeler sind es aber<br />
genau diese Tätigkeiten, die den wirtschaftlichen<br />
Erfolg ermöglichen. Und<br />
trotzdem werden sie durch das gängige<br />
Wohlstandsmass, das Bruttosozialprodukt,<br />
ungenügend erfasst.<br />
Zinggeler plädiert deshalb für eine<br />
alternative Messung des Wohlstands,<br />
die den Beitrag der Frauen zur Bruttowertschöpfung<br />
aufzeigt. Ein Beitrag,<br />
der sich oft im informellen, unbezahlten<br />
Bereich bewegt und dadurch in<br />
den offiziellen Stat<strong>ist</strong>iken <strong>nicht</strong> oder<br />
nur indirekt auftaucht.<br />
Chr<strong>ist</strong>ian Capacoel<br />
Zinggeler, Margrit V., 2017 : Swiss<br />
Maid. The Untold Story of Women’s<br />
Contributions to Switzerland’s Success.<br />
Peter Lang, New York. Zurzeit nur in<br />
Englisch, eine deutsche Übersetzung<br />
<strong>ist</strong> in Planung.<br />
Margrit V. Zinggeler erinnert daran, dass die Frauen bis 1971 <strong>nicht</strong> stimmen durften. (© Chr<strong>ist</strong>ian Capacoel)<br />
https://www.margritzinggeler.com/
« Die Digitalisierung darf <strong>nicht</strong> als Ausbeutungsinstrument<br />
missbraucht werden » David Roth<br />
19<br />
SBB und PostAuto beim<br />
Fremdgehen erwischt<br />
Im letzten Jahr versuchten SBB und PostAuto, mit dem<br />
Fahrdienst Uber eine Zusammenarbeit aufzubauen.<br />
Die Gewerkschaften verhinderten das. Das <strong>ist</strong> gut.<br />
Vollkosten lassen Löhne schmelzen<br />
Die vollen Kosten für Angestellte sind<br />
in herkömmlichen Unternehmen bis<br />
doppelt so hoch wie der ausbe zahlte<br />
Lohn. Im uberisierten Modell müssen<br />
die Sozialversicherungsbeiträge, Admin<strong>ist</strong>ration<br />
und Arbeits räume, Fahrzeuge,<br />
Ferien und Spesen von Scheinselbstständigen<br />
alleine getragen<br />
werden. Entsprechend müssten die<br />
Löhne, also die Honorare, bei Selbstständigen<br />
auch fast doppelt so hoch<br />
sein. Die Unternehmen, die diese Aufträge<br />
vergeben, denken gar <strong>nicht</strong> daran,<br />
dies zu tun.<br />
Keine Zusammenarbeit mit Uber. (© Manu Friederich)<br />
In der Internetapplikation des öffentlichen<br />
Verkehrs (öV-App) wären<br />
Uber-Dienste vorgeschlagen worden,<br />
als Alternative oder ergänzende Verbindungsmöglichkeiten.<br />
Durch das<br />
energische Einschreiten der Gewerkschaften<br />
alarmiert, stellten die Betriebe<br />
die Zusammenarbeit wieder ein.<br />
Dieses Ende <strong>ist</strong> ein klares Zeichen,<br />
dass die Digitalisierung <strong>nicht</strong> als Ausbeutungsinstrument<br />
missbraucht<br />
werden darf. Denn in der digitalisierten<br />
Arbeitswelt <strong>ist</strong> das Zerstückeln<br />
grosser Aufträge in viele kleine Jobs<br />
leichter zu koordinieren. Und das nutzen<br />
gerade Plattformen dazu, um vertragliche<br />
Arbeitsverhältnisse aufzulösen<br />
und Arbeitende als selbstständige<br />
Unternehmer und Unternehmerinnen<br />
zu behandeln.<br />
Bezahlen fürs Toilettenpapier<br />
Das hat oft schlimme Konsequenzen,<br />
wie jüngst ein Beispiel aus den USA<br />
zeigte. Lastwagenchauffeure mussten<br />
für ihr Fahrzeug und dessen Unterhalt<br />
bezahlen, bis hin zum Toilettenpapier<br />
in den Pausenräumen. Ihre Entlohnung<br />
wird <strong>nicht</strong> auf Basis der gele<strong>ist</strong>eten<br />
Arbeitsstunden, sondern aufgrund<br />
der Frachtmenge berechnet.<br />
Dies führte so weit, das für manche<br />
Lkw-Fahrende selbst nach einer<br />
100-Stunden-Woche die Kosten immer<br />
noch höher waren als die Einnahmen<br />
…<br />
Erste kantonale Regelungen<br />
Die me<strong>ist</strong> multinationalen Firmen verstehen<br />
es zudem blendend, sich nationalen<br />
Gesetzen und Steuerabgaben zu<br />
entziehen. Gegensteuer gibt hier eine<br />
Regelung für Taxianbieter in Genf<br />
( siehe Link unten). Diese müssen einen<br />
Firmensitz in der Schweiz haben,<br />
damit sie eine Lizenz erhalten. Genau<br />
dies fordern jetzt auch die TaxifahrerInnen<br />
von Lausanne. Nur: Isolierte<br />
kantonale Gesetzesanstrengungen<br />
können griffige nationale Regelungen<br />
<strong>nicht</strong> ersetzen.<br />
Bundesrat feiert, statt zu arbeiten<br />
Letztes Jahr feierte der Bundesrat den<br />
Tag der Digitalisierung. Dabei sonnte<br />
er sich im Glanz der schönen, neuen<br />
digitalen Welt. Aber er hat vergessen,<br />
die Hausaufgaben zu machen. Wenn<br />
die Schweiz die Chancen der Digitalisierung<br />
nutzen will, dann muss sie<br />
auch über entsprechend moderne Gesetze<br />
verfügen. Ansonsten sind Lohndumping<br />
und die daraus folgenden<br />
Arbeitskämpfe vorprogrammiert.<br />
David Roth<br />
ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_h1_31.html<br />
<strong>Gratis</strong> gibt es <strong>nicht</strong>s<br />
Das Geschäftsmodell der Printmedien<br />
läuft aus. Lange Zeit waren die Zeitungen<br />
Goldesel. Sie finanzierten Journalismus<br />
durch Anzeigen, und die Einnahmen<br />
sprudelten. Doch heute verdienen<br />
mit Werbung nur noch Tamedia<br />
und Ringier viel Geld, die<br />
globalen Techgiganten hingegen<br />
enorm viel Geld (Google, Facebook,<br />
Amazon & Co.). Wir alle tragen zu diesen<br />
tollen Gewinnen bei, wenn wir die<br />
<strong>Gratis</strong>zeitungen konsumieren und<br />
wenn wir den Suchmaschinen und<br />
den «sozialen» Medien fast alles über<br />
uns selber verraten. Wir verschenken<br />
ihnen wertvolles Wissen über alles,<br />
was uns interessiert, was wir bestellen,<br />
was wir lesen und konsumieren.<br />
Was bekommen wir im Gegenzug?<br />
Noch mehr Werbung. Dabei wissen<br />
wir: <strong>Gratis</strong> gibt es <strong>nicht</strong>s, denn Qualitätsarbeit<br />
kostet, überall. Es braucht<br />
Zeit, anständige Löhne und gute Arbeitsbedingungen,<br />
um sauber zu recherchieren,<br />
ansprechend zu gestalten,<br />
verlässlich zu drucken.<br />
Wir wollen genau, umfassend und<br />
ehrlich informiert werden, denn Wissen<br />
<strong>ist</strong> Macht, und die muss in der<br />
Demokratie geteilt und kontrolliert<br />
werden. Das geht nur, wenn uns die<br />
Medien auch etwas wert sind. Darum<br />
setzen wir uns als Gewerkschaft ein<br />
für neue Finanzierungsmodelle für<br />
unabhängige Qualitätsmedien.<br />
Stephanie Vonarburg leitet die Branche Presse<br />
und elektronische Medien und <strong>ist</strong> Mitglied der GL
20 Arbeitswelt<br />
«Die Teppichetage der Tamedia wird immer reicher, und<br />
bei uns stagnieren die Löhne.» Ein Drucker aus Bern<br />
Grafische Industrie:<br />
Der Medianlohn sinkt<br />
Obwohl die Zahl der Lernenden relativ<br />
konstant bei rund 2000 Personen<br />
bleibt, lockt unser Sektor die Jungen<br />
<strong>nicht</strong> in Massen an. Oder sie schliessen<br />
ihre Ausbildung zwar ab, orientieren<br />
sich dann aber anderweitig. Nicht<br />
umsonst <strong>ist</strong> in unserem Sektor die<br />
Alterskategorie der über 50-Jährigen<br />
beim Personal besonders stark vertreten.<br />
Um eine Zukunft aktiv aufzubauen,<br />
muss die Branche jetzt für Junge<br />
attraktiv werden! Wir stellen ausserdem<br />
fest, dass Personen, die ihre Arbeit<br />
verlieren, immer öfter ausserhalb<br />
des Sektors eine neue Stelle suchen.<br />
Und <strong>nicht</strong> zuletzt sagt uns das Bundesamt<br />
für Stat<strong>ist</strong>ik, dass der Medianlohn<br />
in der grafischen Industrie (ohne Kaderfunktion)<br />
von 2010 bis 2016 <strong>nicht</strong><br />
nur <strong>nicht</strong> gestiegen, sondern sogar um<br />
5,1% gesunken <strong>ist</strong>. Die Delegation von<br />
<strong>syndicom</strong> und Syna setzt sich deshalb<br />
mit der Aufgabe an den Verhandlungstisch,<br />
eine Verschlechterung des heutigen<br />
GAV zu verhindern, aber auch<br />
mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen<br />
attraktiv zu gestalten – aus wirtschaftlicher<br />
Sicht, aber <strong>nicht</strong> nur.<br />
Die Verhandlungen gehen am<br />
20. September in die zweite Runde.<br />
Angelo Zanetti<br />
https://bit.ly/2xDHWpI<br />
Ohne GAV lupft es uns den Hut<br />
Die Mitarbeiter der TamediaDruckzentren Bern, Lausanne<br />
und Zürich wollen wieder in den GAV.<br />
Es 23.00 Uhr, die Mitarbeitenden der<br />
Nachtschicht in den Tamedia-Druckzentren<br />
Bern, Lausanne und Zürich<br />
treten an die Maschinen. Das erste<br />
Mitglied der Kerngruppe schwärmt<br />
aus und drückt allen Kollegen und<br />
Kolleginnen ein rotes Chäppli und<br />
Klebeetiketten in die Hand. «Ohni<br />
GAV lupfts eus de Huet», steht da<br />
drauf.<br />
Die Kolleginnen und Kollegen setzen<br />
sich die Mützen auf. Über 90 Prozent<br />
der Belegschaft der Druckzentren<br />
und der Prepress arbeiten in den kommenden<br />
32 Stunden mit rotem Kopfschmuck.<br />
In Lausanne vom 30. bis<br />
zum 31. Mai. Damit setzen sie ein starkes<br />
Zeichen. Die Mit arbeitenden sind<br />
sauer. Sie wollen wieder in den GAV.<br />
Ende 2015 trat Tamedia aus dem<br />
Arbeitgeberverband viscom und damit<br />
aus dem GAV grafische Industrie aus.<br />
Die Unternehmensleitung versucht<br />
seither, den wahren Grund zu verschleiern:<br />
die schrittweise Verschlechterung<br />
der Arbeitsbedingungen.<br />
Der neue, von viscom geschaffene<br />
Verband print and communications<br />
erlaubt es den Arbeitgebern,<br />
dem Beispiel von Tamedia zu folgen.<br />
Mit verheerenden Folgen für<br />
die Belegschaft. So auch bei der<br />
Banknotendruckerei Orell Füssli,<br />
wo sich die Belegschaft ebenfalls<br />
gegen den Austritt aus dem GAV<br />
wehrt. Hier hat der Kampf bereits<br />
die Form einer Protestpause angenommen.<br />
Bislang bleibt die Geschäftsleitung<br />
aber stur. Noch keine<br />
Gesprächsbereitschaft über die<br />
Absicherung des GAV zeigt bisher<br />
Ringier/Swissprinters. Von den per<br />
Ende 2018 aus dem viscom ausgetretenen<br />
Firmen <strong>ist</strong> bisher einzig<br />
die Stämpfli AG bereit, mit <strong>syndicom</strong><br />
über einen Betriebs-GAV zu<br />
verhandeln. Die Gespräche begannen<br />
im Juni. Er muss mindestens<br />
so gut wie der Branchen-GAV sein<br />
und mit der Gewerkschaft abgeschlossen<br />
werden.<br />
Als Erstes wurde in den drei Druckzentren<br />
Lausanne, Bern und Zürich<br />
die Arbeitszeit um 2 respektive 1.25<br />
Stunden erhöht und teilweise die<br />
Mahlzeitentschädigung gestrichen.<br />
Für die Druckereimitarbeitenden mit<br />
Nachtschicht heisst das, dass sie in<br />
der Frühschicht auch am Samstag antraben<br />
müssen.<br />
Somit bleibt den Schichtarbeitenden<br />
nur noch der Sonntag, um etwas<br />
mit der Familie zu unternehmen. Die<br />
Krux dabei <strong>ist</strong>, dass die Verkürzung der<br />
Wochenenden unentgeltlich vollzogen<br />
wird. Hochgerechnet wären dies<br />
bei einem tiefen Lohn 2700 Franken,<br />
die jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter<br />
jährlich der Tamedia schenkt.<br />
«Die Teppichetage der Tamedia wird<br />
immer reicher, und bei uns stagnieren<br />
die Löhne», sagt ein Drucker aus Bern.<br />
Auch die Schichtzuschläge sind der<br />
Tamedia-Geschäftsleitung seit Längerem<br />
ein Dorn im Auge.<br />
Um die Angriffe auf die Arbeitsbedingungen<br />
abzuwehren, forderten die<br />
Mitarbeitenden der drei Druckzentren<br />
mit einer Petition im April den<br />
Wiederbeitritt von Tamedia bei<br />
viscom und somit die Anerkennung<br />
des GAV der grafischen Industrie.<br />
280 Unterschriften hatte die Arbeitnehmervertretung<br />
gesammelt. Die<br />
Mitarbeitenden der Druckzentren<br />
le<strong>ist</strong>en zuverlässig qualitativ hochstehende<br />
Arbeit und verlangen im Gegenzug<br />
lediglich eine Garantie für die bestehenden<br />
Arbeitsbedingungen. Doch<br />
die Geschäftsleitung lehnt ab.<br />
32 Stunden später: Es <strong>ist</strong> 5.30 Uhr<br />
am Morgen, die letzte Schicht trägt<br />
noch immer Rot. «Wir zeigen, dass wir<br />
zusammenhalten und alle hinter der<br />
Forderung stehen«, sagt ein Zürcher<br />
Druckereimitarbeitender. «Das <strong>ist</strong> erst<br />
der Anfang!»<br />
Miriam Berger<br />
Jetzt sehen und tragen die Arbeitenden in den Druckzentren von Tamedia Rot. (© DR)<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/aktuell/artikel/ohni-gav-lupftseus-de-huet/
«Die Post hat Zukunft, wenn sie einen umfassenden Service<br />
public für das ganze Land wieder ins Zentrum setzt» David Roth<br />
21<br />
Angehörigenpflege<br />
geht uns alle an!<br />
Care-Arbeit: Die breite Öffentlichkeit<br />
assoziiert damit die Pflegeberufe.<br />
Schlecht bezahlt betreuen oftmals<br />
Frauen aus Osteuropa oder Asien unter<br />
schlechtesten Arbeitsbedingungen<br />
unsere Angehörigen in der Schweiz.<br />
VPOD und unia setzen sich zum Schutze<br />
dieser Frauen ein. Weniger im Bewusstsein<br />
der Öffentlichkeit <strong>ist</strong> hingegen<br />
die unbezahlte Care-Arbeit. Zum<br />
Beispiel wenn wir unsere Eltern oder<br />
den Partner, die Partnerin zu Hause<br />
pflegen.<br />
Es sind die Frauen, die den Bärenanteil<br />
dieser unbezahlten Arbeit<br />
le<strong>ist</strong>en. Damit sie mit dieser anspruchsvollen<br />
Aufgabe <strong>nicht</strong> an die eigenen<br />
Grenzen der Belastung gehen, Warnsignale<br />
entdecken und sich mit anderen<br />
austauschen können, bietet <strong>syndicom</strong><br />
den Kurs «Arbeiten und Angehörige<br />
pflegen – wie geht das?» an. Oft stehen<br />
diese Frauen über 50 im Erwerbsleben,<br />
und es ergibt sich ein neuer oder zusätzlicher<br />
Vereinbarkeitskonflikt. Darum<br />
werden auch arbeitsrechtliche Regelungen<br />
– auch im GAV Post und<br />
Swisscom – beleuchtet und verschiedene<br />
Entlastungsangebote vorgestellt.<br />
Dieser Kurs findet am 1. September in<br />
Zürich in Zusammenarbeit mit dem<br />
VPOD statt, und <strong>ist</strong> zunächst nur auf<br />
Deutsch. (https://bit.ly/2sndivp)<br />
Patrizia Mordini, Leiterin Gleichstellung,<br />
Mitglied der Geschäftsleitung<br />
Jagd auf übertriebene Gewinne<br />
bringt die Post ins Trudeln<br />
Susanne Ruoff, die oberste Pöstlerin, <strong>ist</strong> gefallen. Das Symptom<br />
eines angekündigten Niedergangs, wenn die Post <strong>nicht</strong> zu einem<br />
umfassenden Service public zurückfindet.<br />
Post-Chefin Ruoff <strong>ist</strong> der PostAuto-<br />
Skandal zum Verhängnis geworden.<br />
Mit ihr fällt die ganze PostAuto-Geschäftsleitung,<br />
und Vizepräsident des<br />
Verwaltungsrats, Adriano Vassalli, hat<br />
seinen Rücktritt angekündigt. Übergangs-CEO<br />
der Post wird nun Ueli<br />
Hurni, der seine lange Karriere bei<br />
PostFinance begonnen hatte.<br />
Landet weich dank astronomischen<br />
Entschädigungen: Susanne Ruoff. (© Keystone)<br />
Am Beginn des Skandals standen<br />
Betrügereien, die dem übertriebenen<br />
Gewinnstreben bei PostAuto geschuldet<br />
waren. Die Jagd nach Gewinn <strong>ist</strong><br />
die Folge der Profiterwartungen des<br />
Bundesrats und des Parlamentes an<br />
den ganzen Postkonzern. Ruoffs Management<br />
spiegelte diese unhaltbare<br />
Mischung: einerseits noch ein bisschen<br />
Service public, andererseits<br />
knallhartes Konzernmanagement für<br />
maximalen Profit. Das führt zu ständigen<br />
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen<br />
und gefährdet die flächendeckende<br />
Versorgung. Es steht<br />
im Widerspruch zur Wirtschafts- und<br />
Regionalpolitik, die <strong>nicht</strong> nur die Zentren<br />
stärken will. Ausdruck dieses Managements<br />
sind Entlassungen, Poststellenschliessungen,<br />
Auslagerungen,<br />
Umgehungen des GAV, Einschnitte<br />
beim Zustellungsdienst und einiges<br />
mehr, auf Kosten der gesamten Bevölkerung.<br />
Ruoff fällt weich – Tausende landen<br />
hart<br />
Susanne Ruoff hat über die Jahre als<br />
CEO astronomische Entschädigungen<br />
erhalten und fällt weich. Doch die Post<br />
<strong>ist</strong> längst ins Trudeln geraten. Sie baut<br />
stetig Dienstle<strong>ist</strong>ungen ab. Sogar im<br />
Vorzeigebereich PostFinance. Dort<br />
bangen derzeit 1000 Leute um ihre<br />
Stelle. Im Rahmen des Abbauprojekts<br />
«Victoria 2020» will die Geschäftsleitung<br />
500 Vollzeitstellen streichen.<br />
Zum einen Kundenberater der Geschäftskunden.<br />
Nur noch ein Fünftel<br />
der Geschäftskunden soll weiterhin<br />
direkt betreut werden, alle anderen<br />
sollen auf die überlasteten Callcenter<br />
und Maildienste ausweichen. Zudem<br />
bangen sehr viele Sachbearbeiterinnen<br />
und -bearbeiter in den Operationscentern<br />
um ihre Stelle.<br />
<strong>syndicom</strong> greift ein<br />
PostFinance steht bei den Menschen<br />
in der Schuld. Sie muss Anschlusslösungen<br />
finden. <strong>syndicom</strong> wird sich<br />
dafür einsetzen, dass möglichst viele<br />
Stellen erhalten werden können und<br />
dass die gekündigten Arbeitnehmenden<br />
wieder eine Chance auf dem Arbeitsmarkt<br />
bekommen. Dafür sollen<br />
sie eine Unterstützung erhalten, die<br />
über dem vorgesehenen Sozialplan<br />
liegt.<br />
Die PostFinance-Manager jammern<br />
gerne über äussere Umstände<br />
wie die Einschränkungen, die ihnen<br />
beim Hypothekengeschäft auferlegt<br />
sind. Das <strong>ist</strong> aber eine <strong>nicht</strong> abzuändernde<br />
Tatsache. Politisch <strong>ist</strong> ein Einstieg<br />
von PostFinance ins Hypothekargeschäft<br />
chancenlos, weil die Kantone<br />
in diesem Geschäft ihre Kantonalbanken<br />
<strong>nicht</strong> konkurrenzieren möchten.<br />
Das kann man gut oder schlecht finden,<br />
es <strong>ist</strong> aber die Realität.<br />
Wir müssen die Politik zwingen,<br />
die Profit-über-alles-Strategie der Post<br />
zu beenden. Die Post hat Zukunft,<br />
wenn sie den klaren Auftrag bekommt,<br />
zu einem umfassenden Service public<br />
für das ganze Land zurückzufinden.<br />
David Roth<br />
https://bit.ly/2JJvvKt
22 Politik<br />
So zähmt Service public<br />
2.0 die Digitalisierung<br />
Wir schlagen Alarm. Wenn<br />
die öffentliche Hand den<br />
digitalen Umbau <strong>nicht</strong> reguliert<br />
und sehr rasch einen<br />
digitalen Service public aufbaut,<br />
verliert die Schweiz ihre<br />
Souveränität an Weltkonzerne<br />
wie Facebook. Und der<br />
soziale Frieden kippt. Der<br />
Schlüssel zur Lösung <strong>ist</strong> die<br />
Datenhoheit.<br />
Text: Giorgio Pardini, Leiter<br />
Sektor ICT<br />
Bilder: alphaspirit<br />
Demokratie und sozialer Frieden<br />
zerfallen, wenn der Service public<br />
abgebaut wird. Denn der öffentliche<br />
Dienst garantiert die Versorgung<br />
aller mit elementar notwendigen<br />
Le<strong>ist</strong>ungen und Infrastrukturen.<br />
Er schafft Zugang zu Ausbildung,<br />
physischer Sicherheit, Lebenschancen,<br />
Recht, sozialer Sicherheit.<br />
Und vor allem bringt er, als Gegengewicht<br />
zu Kapital und Markt, ein<br />
Stück Chancengleichheit in eine<br />
zunehmend ungerechtere Gesellschaft.<br />
Der Service public muss weit<br />
mehr tun<br />
Weil sich die Schweiz verändert,<br />
muss sich auch der Service public<br />
an die veränderten Bedürfnisse anpassen.<br />
Früher hat er etwa überall<br />
Telefonkabinen aufgestellt, heute<br />
muss er Handynetze und WLAN<br />
Hotspots bauen. Doch um seiner<br />
Rolle gerecht zu werden, muss er<br />
weit mehr tun.<br />
Getrieben vom digitalen Umbau<br />
entstehen neue Geschäftsmodelle<br />
wie die Plattformökonomie. In<br />
weniger als zwei Jahrzehnten sind<br />
gigantische Weltkonzerne entstanden:<br />
Alphabet/Google, Amazon, Facebook,<br />
Apple (GAFA) und andere. Sie<br />
haben alle dieselbe Geschäftsgrundlage:<br />
den digitalen Fussabdruck<br />
ihrer OnlineKundschaft. Milliarden<br />
von Kundendaten werden rund um<br />
die Uhr gesammelt (Big Data), zusammengeführt,<br />
durch immer ausgefeiltere<br />
Algorithmen strukturiert<br />
und wirtschaftlich sowie politisch<br />
vermarktet – mit tiefgreifenden gesellschaftspolitischen<br />
Auswirkungen.<br />
Die GAFA übernehmen das<br />
Kommando<br />
Facebook verzeichnete im ersten<br />
Quartal 2018 rund 2,2 Milliarden<br />
aktive Nutzende, machte 2017 fast<br />
41 Milliarden Dollar Umsatz und<br />
Milliardengewinne. Durch ihre glo
Politik<br />
Um seiner Rolle gerecht zu werden, muss der Service public weit mehr tun als Handynetze<br />
und WLANHotspots zu bauen. Nur der Staat kann dafür sorgen, dass die Hoheit über die<br />
Daten bei den Nutzenden bleibt respektive wieder an sie zurückgeht. So ein digitaler Service<br />
public hätte im heutigen Parlament keine Chance. Eine Volksinitiative wäre ein Weg dazu.<br />
23<br />
bale Marktbeherrschung verfügen<br />
solche Weltkonzerne über mehr<br />
Kapital als die me<strong>ist</strong>en Staaten.<br />
In Bereichen wie Sicherheit, Überwachung,<br />
Meinungsbildung, Chancengleichheit<br />
und vielen weiteren<br />
über nehmen sie das Kommando.<br />
All dies basiert auf der Verwertung<br />
von Big Data. Was mit unseren Daten<br />
geschehen kann, war am Beispiel<br />
der USWahlen zu sehen. Mit<br />
der Auf bereitung und Nutzung von<br />
rund 87 Millionen FacebookProfilen<br />
wurde das Wahlverhalten zugunsten<br />
von Donald Trump gesteuert.<br />
Die GAFA, regelrechte Oligopole,<br />
üben weltweit Einfluss auf<br />
Staaten und Institutionen aus, ohne<br />
jegliche Kontrolle und allein den<br />
Aktionären verpflichtet. Diese Aktionärslogik<br />
dient weder dem sozialen<br />
Zusammenhalt noch einer gemeinwirtschaftlichen<br />
Verpflichtung. Im<br />
Gegensatz zum Service public, der<br />
seine Dienstle<strong>ist</strong>ungen den Bürgerinnen<br />
und Bürgern zur Verfügung<br />
stellt, demokratischer Kontrolle unterliegt<br />
und allfällige Gewinne der<br />
Allgemeinheit zuführt.<br />
Das Mandat des Service public auf<br />
die digitale Welt ausdehnen<br />
Wie bei jeder technologischen Entwicklung<br />
mit hohen Risiken muss<br />
der Staat im Interesse der Allgemeinheit<br />
Regeln und Leitplanken<br />
setzen. Im Wesentlichen geht es<br />
hier um die zentrale Frage, wer die<br />
Hoheit über die Daten der Nutzenden<br />
hat. Nur der Staat kann dafür<br />
sorgen, dass sie bei den Nutzenden<br />
bleibt respektive wieder an sie zurückgeht.<br />
Deshalb müssen wir darüber<br />
nachdenken, wie wir das Mandat<br />
des Service public auf die<br />
digitale Welt ausdehnen können.<br />
Das <strong>ist</strong> notwendig, wenn wir <strong>nicht</strong><br />
wollen, dass der digitale Umbau zu<br />
sozialen Verwerfungen führt.<br />
Aber auch die beste Regulierung<br />
bleibt toter Buchstabe, wenn<br />
die öffentliche Hand <strong>nicht</strong> selbst<br />
Akteurin der Digitalisierung wird<br />
und einen digitalen Service public<br />
aufbaut. Das muss sie sehr rasch<br />
Eine Volksinitiative<br />
wäre ein Weg,<br />
einen solchen<br />
Service public zu<br />
verwirklichen.<br />
tun, will der Staat seine Souveränität<br />
und seine Handlungsfähigkeit<br />
<strong>nicht</strong> schon in den nächsten Jahren<br />
vollständig an die Weltkonzerne verlieren.<br />
Was nur die öffentliche Hand kann<br />
Einige zentrale Aufgaben dieses<br />
digitalen Service public können<br />
praktischerweise die öffentlichen<br />
Unternehmen wie Swisscom oder<br />
Die Post le<strong>ist</strong>en. Dafür brauchen sie<br />
sehr rasch einen verbindlichen<br />
Auftrag samt Spielraum und Mittel<br />
für die anfallenden Investitionen.<br />
Darum muss die schleichende Privatisierung<br />
dieser Unternehmen gestoppt<br />
werden. Gerade weil die Digitalisierung<br />
die Arbeits und<br />
Lebensverhältnisse dereguliert,<br />
müssen die öffentlichen Unternehmen<br />
im Besitz der Allgemeinheit<br />
bleiben.<br />
Keine Frage: Mächtige Lobbys<br />
werden alles daran setzen, einen<br />
solchen Service public zu verhindern.<br />
Obschon er von hohem Interesse<br />
für uns alle <strong>ist</strong>, hätte er im heutigen<br />
Parlament keine Chance. Um<br />
ihn durchzusetzen, werden wir die<br />
Instrumente der direkten Demokratie<br />
aktivieren müssen. Eine Volksinitiative<br />
wäre ein Weg dazu.<br />
https://bit.ly/2JPUwb7<br />
Stärkung des<br />
Service public<br />
Die Delegierten des SGB<br />
haben eine Resolution<br />
beschlossen.<br />
Ende Mai haben die Delegierten<br />
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes<br />
(SGB) eine Resolution<br />
beschlossen, die die Stärkung<br />
des Service public fordert. Die Digitalisierung<br />
<strong>ist</strong> für den Service<br />
public eine Chance, die er nutzen<br />
muss.<br />
So muss sich die Steuerpolitik<br />
am Finanzbedarf des Service<br />
public ausrichten. Es braucht eine<br />
Mindestbesteuerung, die den<br />
Steuerwettbewerb unter den Kantonen<br />
verhindert. Sparmassnahmen<br />
beim Bundespersonal und<br />
bei den Angestellten von Kantonen<br />
und Gemeinden werden abgelehnt<br />
genauso wie eine Marktlogik,<br />
die den Service public<br />
zerstört: keine Verkehrspolitik,<br />
die zu Dumpingpreisen und<br />
Dumpinglöhnen führt, keine Aufhebung<br />
des Kabotageverbots,<br />
keine Liberalisierung des internationalen<br />
und nationalen Personenfernverkehrs!<br />
Die Digitalisierung <strong>ist</strong> eine<br />
Chance für den Service public,<br />
wenn die Unternehmen das Personal<br />
schulen und weiterbilden. Es<br />
braucht einen Ausbau und keinen<br />
Abbau in der digitalen Transformation<br />
der Dienstle<strong>ist</strong>ungen. Angesichts<br />
des Drucks auf die Löhne<br />
in der Verkehrsbranche, bei Post<br />
und Kurierdiensten sowie im<br />
Sozialwesen und der akuten Verschlechterung<br />
der Arbeitsbedingungen<br />
fordern die Delegierten,<br />
dass alle Service publicBeschäftigten<br />
vorbildlichen Gesamtarbeitsverträgen<br />
unterstellt werden.<br />
In öffentlichen Betrieben wie SBB,<br />
Swisscom und Post müssen die<br />
Kaderlöhne auf 500 000 Franken<br />
beschränkt werden. (comm.)
24 Politik<br />
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) wendet sich gegen den Revisionsentwurf<br />
des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG).<br />
Dieser würde den Versicherungen mehr Macht geben und die Willkür fördern.<br />
VVGReform<br />
nur für die Versicherungen<br />
Der Versicherer könnte den<br />
Vertrag einseitig ändern<br />
Der Bundesrat sieht eine Revision<br />
des Versicherungsvertragsgesetzes<br />
(VVG) vor, welche die Lage der Versicherten<br />
gegenüber Versicherungsgesellschaften<br />
deutlich verschlechtern<br />
würde. Der Schweizerische<br />
Gewerkschaftsbund (SGB) lehnt den<br />
Entwurf deshalb ab.<br />
Die Vorlage des Bundesrates<br />
würde Verschlechterungen mit sich<br />
bringen und gäbe den Versicherern<br />
noch mehr Macht, zu schalten und<br />
walten, wie sie wollen.<br />
• Einer der grössten Negativpunkte<br />
<strong>ist</strong> die Möglichkeit zur einseitigen<br />
Vertragsänderung durch<br />
die Versicherer. Damit könnten die<br />
Versicherungen von einem Tag auf<br />
den anderen die Vertragsbedingungen<br />
einseitig anpassen, ohne Einverständnis<br />
des Versicherten!<br />
• Ältere Arbeitnehmende könnten<br />
aus der Krankentaggeldversicherung<br />
ausgeschlossen werden.<br />
• Versicherungen dürften künftig<br />
bei einer Kündigung des Arbeitsvertrags<br />
oder der Krankentaggeldversicherung<br />
nachträglich Le<strong>ist</strong>ungen für<br />
bereits eingetretene Schadensfälle<br />
kürzen oder einstellen.<br />
Die Schweizer Arbeitnehmenden<br />
sind schlecht gegen Krankheit<br />
geschützt. Für den Schutz vor einem<br />
Erwerbsausfall wegen einer Krankheit,<br />
die <strong>nicht</strong> zur Invalidität führt,<br />
gibt es lediglich eine freiwillige Versicherung.<br />
Diese unterliegt oftmals<br />
dem VVG.<br />
Der Gesetzgeber müsste dringend<br />
eine Lösung für die Probleme im Zusammenhang<br />
mit den intransparenten<br />
und für die Versicherten <strong>nicht</strong><br />
nachvollziehbaren Prämienberechnungen<br />
vorschlagen. Der Arbeitgeber<br />
und die Versicherungsgesellschaft<br />
können vereinbaren, dass<br />
die Le<strong>ist</strong>ungen mit Beendigung<br />
des Arbeitsverhältnisses eingestellt<br />
werden.<br />
Dieser skandalöse Gesetzesentwurf<br />
schafft neue Probleme, ohne die<br />
Situation zu regeln.<br />
Luca Cirigliano, SGBZentralsekretär<br />
http://www.sgb.ch/publikationen/artikel/<br />
Anzeige<br />
Mit Reka-Geld liegt für<br />
<strong>syndicom</strong>-Mitglieder<br />
mehr drin.<br />
Als Mitglied beziehen Sie bei <strong>syndicom</strong><br />
Reka-Geld mit 7 % Rabatt. Alle 9‘000<br />
Annahmestellen in der ganzen Schweiz<br />
finden Sie unter rekaguide.ch<br />
7 %<br />
Rabatt!<br />
Mit Reka liegt mehr drin.
Recht so!<br />
25<br />
Fragen an den <strong>syndicom</strong>-Rechtsdienst :<br />
Guten Tag<br />
Ich habe letzten Herbst meine Berufsausbildung abgeschlossen<br />
und bis heute keine Stelle gefunden. In den Absagen<br />
hiess es, dass sie jemanden mit beruflicher Erfahrung<br />
suchen. Nun habe ich ein Angebot für ein einjähriges,<br />
unbezahltes Praktikum erhalten. Ich weiss, dass schon einige,<br />
die mit mir abgeschlossen haben, solche Praktikumsstellen<br />
angenommen haben. Wenn ich <strong>nicht</strong> zusage, findet<br />
sich sicher jemand anderer für das Praktikum.<br />
Was empfehlen Sie mir?<br />
Ich wäre schon bereit, ein unbezahltes Praktikum zu machen.<br />
Doch <strong>ist</strong> für mich ein Jahr ohne Lohn und ohne Ferien<br />
einfach zu lang. Nach meiner Ausbildung habe ich kein Geld<br />
mehr und bin nun darauf angewiesen, etwas zu verdienen.<br />
Ausserdem bringe ich mit meiner Ausbildung ja auch schon<br />
viel Wissen mit. Muss ich effektiv so lange <strong>gratis</strong> arbeiten?<br />
Wenn ich nun dieses einjährige, unbezahlte Praktikum<br />
annehme und danach trotzdem keine Festanstellung<br />
bekomme, erhalte ich überhaupt Arbeitslosengeld? Dafür<br />
muss ich doch mindestens zwölf Monate lang Beiträge<br />
bezahlt haben. Da bin ich ja gleich doppelt bestraft.<br />
Antwort des <strong>syndicom</strong>-Rechtsdienstes<br />
Das Praktikum <strong>ist</strong> gesetzlich <strong>nicht</strong><br />
ausdrücklich geregelt. Daher <strong>ist</strong> es<br />
wichtig, dass ein schriftlicher Praktikumsvertrag<br />
gemacht wird. Darin<br />
sollten die Dauer, das angestrebte<br />
Ziel, eine Regelung bei Krankheit sowie<br />
der Lohn (inkl. AHV-, ALV-Beiträge<br />
und allfälliger UVG-Beiträge)<br />
enthalten sein. Auch eine anschliessende<br />
Festanstellung kann bereits<br />
vereinbart werden. Ziel eines Praktikums<br />
<strong>ist</strong> es, das erworbene theoretische<br />
Wissen unter fachlicher Begleitung<br />
in der Praxis zu vertiefen, um<br />
den Berufseinstieg zu erleichtern.<br />
Erledigen Sie während des Praktikums<br />
die gleichen Arbeiten wie die<br />
Fest angestellten und werden Sie<br />
<strong>nicht</strong> betreut, so handelt es sich um<br />
ein befr<strong>ist</strong>etes Arbeitsverhältnis. In<br />
diesem Fall besteht auch ein regulärer<br />
Lohnanspruch.<br />
Ein Praktikum sollte grundsätzlich<br />
<strong>nicht</strong> länger als ein Jahr dauern.<br />
Dann haben Sie auch Anspruch auf<br />
mindestens vier Wochen Ferien. Bei<br />
Praktika von kürzerer Dauer müssen<br />
die Ferien anteilsmässig gewährt<br />
werden. Unbezahlte Praktika sollten<br />
hingegen nur kurze Zeit dauern, d.h.<br />
maximal einen Monat. Ein typisches<br />
Beispiel dafür sind Schnupperpraktika,<br />
die me<strong>ist</strong> nur einige Tage oder<br />
eine bis zwei Wochen dauern. Dauert<br />
das Praktikum länger, muss ein Lohn<br />
ausgerichtet werden, auch wenn dieser<br />
tiefer <strong>ist</strong> als bei einer Festanstellung.<br />
Übrigens sind mehrere Praktika<br />
nacheinander, auch wenn diese nur<br />
von kurzer Dauer sind, beim gleichen<br />
Arbeitgeber und im gleichen Arbeitsbereich<br />
<strong>nicht</strong> zulässig.<br />
Die Arbeitslosenkasse prüft in einem<br />
solchen Fall, ob das Praktikum für<br />
den Berufsabschluss erforderlich <strong>ist</strong><br />
und somit zur Ausbildung zählt. Bejaht<br />
sie dies, gelten Sie als beitragsbefreit<br />
und haben Anspruch auf 90 Taggelder.<br />
Deshalb <strong>ist</strong> es wichtig, dass<br />
Sie bei einem Praktikum etwas lernen<br />
und <strong>nicht</strong> einfach <strong>gratis</strong> arbeiten.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/recht/rechtso
26 Freizeit<br />
Tipps<br />
Weiterbildung: Druck auf den<br />
eigenen Arbeitgeber machen<br />
Sommerferien sind ein guter<br />
Zeitpunkt, um ein paar Gedanken<br />
an die Verfeinerung der eigenen<br />
Möglichkeiten zu verschwenden.<br />
Weiterbildung will gut bedacht sein.<br />
Und rechtzeitig geplant.<br />
Üblicherweise wird sie in der<br />
Schweiz als individuelle Anstrengung<br />
betrachtet. Wir Gewerkschaften<br />
machen Weiterbildung aber<br />
zunehmend zu einem Verhandlungsthema<br />
mit den Arbeitgebern.<br />
In diversen GAV haben wir erste<br />
Schritte zu einem Recht auf Weiterbildung<br />
verankern können (siehe<br />
www.gav-service.ch).<br />
Frage deinen Sekretär, was dir<br />
zusteht. Es geht immer um zwei<br />
Dinge: Zeit und Geld. Informiere<br />
dich über Bildungsangebote, die<br />
dich interessieren. Dann sprich mit<br />
den Vorgesetzten und HR-Verantwortlichen.<br />
Es kann gut sein, dass<br />
sie dich erst einmal auflaufen lassen.<br />
Ins<strong>ist</strong>iere! Das Recht auf<br />
Bildung <strong>ist</strong> ein neues Thema, wir<br />
müssen es mit etwas Druck erst<br />
alltäglich machen.<br />
Das <strong>ist</strong> das eine. Aber kluge Weiterbildung<br />
heisst viel mehr, als den<br />
eigenen Marktwert zu erhöhen. In<br />
den Kursen der Gewerkschaft und<br />
anderer Anbieter machen wir uns<br />
für uns selbst klüger und stärker.<br />
Wirtschaft und Recht werden lesbarer.<br />
Sprachen machen uns beweglicher.<br />
Digitale Kenntnisse souveräner.<br />
Und Kurse zu Konfliktlösung,<br />
Organisation, Lebensführung machen<br />
uns vieles leichter.<br />
Bei Movendo etwa: Frontalangriff<br />
auf das Arbeitsgesetz (26.9.).<br />
Wie funktioniert meine Pensionskasse<br />
(2.10.). Mit Mindmap die Infoflut<br />
bewältigen (12.1o.). Bei Helias:<br />
Indesign für Einsteiger (29.8.). Bei<br />
<strong>syndicom</strong>: Wie mache ich mich<br />
selbstständig? (24.8.). Und etliche<br />
andere mehr.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/mitgliederservice/<br />
aus-und-weiterbildung und: movendo.ch<br />
© Jürgen Bauer<br />
Paul Mason: Was nach dem<br />
Kapitalismus kommt<br />
Naomi Klein, die messerscharfe<br />
Globalisierungskritikerin, schreibt<br />
über dieses Buch: «Paul Mason entwirft<br />
eine visionäre, fesselnd formulierte<br />
und reale Alternative. Er wird<br />
heftige Debatten auslösen – und<br />
zwar genau jene, die wir unbedingt<br />
führen müssen.» Das verspricht.<br />
Der britische TV-Journal<strong>ist</strong><br />
Mason (BBC) hat mit in seinem<br />
Buch Postkapitalismus eine doppelte<br />
Botschaft für uns: Das Wirtschafts-<br />
und Gesellschaftssystem<br />
Kapitalismus <strong>ist</strong> ein Auslaufmodell.<br />
Und wie immer, wenn eine Ordnung,<br />
die 500 Jahre lang geherrscht<br />
hat, ihrem Ende zuneigt, kann man<br />
die Grundrisse der kommenden<br />
Ökonomie schon erkennen.<br />
Das <strong>ist</strong> ermutigend, denn unsere<br />
Gegenwart sitzt in einer Falle: Zum<br />
einen ahnen alle, dass der Kapitalismus<br />
auf die Auslöschung der Gattung<br />
Mensch hintreibt und auf dem<br />
Weg dorthin Panik und Elend anrichtet.<br />
Derzeit etwa die Demokratie<br />
in Europa zerstört. Zum anderen <strong>ist</strong><br />
es den Besitzenden gelungen, ihre<br />
kapitale Herrschaft als einzig mögliche<br />
Form der Gesellschaft in die<br />
Köpfe zu hämmern.<br />
Furchtlos analysiert Mason diesen<br />
Zustand und sucht für uns die<br />
Werkplätze der neuen, werdenden<br />
Ordnung auf. Viele davon sind in<br />
den Entwicklungen des Kapitalismus<br />
schon angelegt, der nun «an die<br />
Grenzen seiner Anpassungsfähigkeit<br />
gestossen <strong>ist</strong>». Die digitale Revolution<br />
legt diese Grenzen offen.<br />
Und in ihr erkennt Mason die Werkzeuge<br />
einer neuen Welt. Wer zündende<br />
Gedanken sucht und ein<br />
Buch mit kritischem Blick lesen<br />
kann, sollte sich Postkapitalismus<br />
unbedingt vornehmen.<br />
Paul Mason: «Postkapitalismus.<br />
Grundrisse einer kommenden Ökonomie.»<br />
Suhrkamp, 2016. 400 Seiten, CHF 21.90<br />
Auf der Flucht. Ein paar Orte,<br />
wo es sich besser ex<strong>ist</strong>iert<br />
Wer in diesen Wochen <strong>nicht</strong> gen<br />
Süden brettert, findet in der Nähe<br />
Orte, wo sich das Leben entschleunigt<br />
und man erleichtert entdeckt:<br />
Jenseits von Facebook und despotischen<br />
Bildschirmen sind wir selber<br />
klug genug, Gedanken zu fassen<br />
und die Welt in einen eigenen Blick<br />
zu nehmen.<br />
Etwa auf der Terrasse des Ethnograpischen<br />
Museums Neuenburg<br />
(MEN). Man schaut auf den See und<br />
bruncht (22.7, 23.9.) und erfährt,<br />
was Gesellschaften zusammenhält,<br />
in Führungen durch die thematische<br />
Ausstellung und die wirklich<br />
aufregende Sammlung (50 000 Stücke<br />
aus Afrika und Ozeanien, aus<br />
der Arktik und dem industriellen<br />
Europa). Auf Anmeldung: 032 717<br />
85 60. Oder via reception.men@ne.<br />
ch. Mehr Infos: men.ch.<br />
Was wollen Fotos und was machen<br />
sie mit uns in Zeiten des Selfie?<br />
Abgesehen von seinen immer<br />
erhellenden Ausstellungen <strong>ist</strong> das<br />
das Fotomuseum Winterthur mit<br />
seiner Sammlung und seinen Veranstaltungen<br />
eines der grossen internationalen<br />
Zentren für die Kultur<br />
des Bildes. Derzeit stellt Jürgen Teller<br />
aus. Die Wahrheit im Blick des<br />
anderen. Infos, Fotostiftung, Fotoblog,<br />
Newsletter: fotomuseum.ch.<br />
Vor dem 16. September sollte<br />
man den Weg ins H<strong>ist</strong>orische Museum<br />
Bern gehen. Diesmal <strong>nicht</strong> für<br />
den genialen Einstein, sondern für<br />
einen heilsamen Gang: «Flucht»<br />
heisst die Ausstellung, in der wir in<br />
Film, Bild, Konferenz und direkt<br />
Menschen begegnen, die vor Krieg<br />
und Tod ins oft mörderische und<br />
eiskalte Exil flüchten. Das rückt den<br />
Kopf zurecht. Die Infos dazu holt<br />
man sich am besten von der Agenda<br />
der Internetseite von AllianceSud,<br />
weil ein häufiger Besuch dieser Seite<br />
sowieso lohnenswert <strong>ist</strong>.<br />
alliancesud.ch
1000 Worte<br />
Ruedi Widmer<br />
27
28 Bisch im Bild Im Juni 2018 engagiert sich <strong>syndicom</strong>:<br />
für eine Rückkehr unter den Schutz des GAV grafische Industrie, am nationalen<br />
Frauentag vom 14. Juni, an der Seite der Eisenbahner der SBB im Protest gegen<br />
die Sparmassnahmen.<br />
2<br />
1<br />
3<br />
4<br />
5
1, 2 Mit einer roten Mütze auf dem Kopf fordern die Angestellten der grafischen Industrie, wieder einem GAV unterstellt zu sein<br />
(im Bild die Druckzentren Bussigny und Zürich).<br />
3 In Bern und in anderen Schweizer Städten protestierten am 18. Juni die SBB-Angestellten gegen die geplanten Sparmassnahmen.<br />
4, 5 Mit dem Slogan «Lohngleichheit <strong>ist</strong> auch dein Bier!» wurde an den Veranstaltungen zur Lohngleichheit vom 14. Juni das Lohngleichheitsbier<br />
ausgeschenkt. Im Casa del Popolo in Bellinzona fand ein Lohngleichheits-Apéro statt. (© Dominik Fitze et Lorena Gianolli)<br />
6, 7, 8, 9 Am 9. Juni 2018 fand in Bern die Fortsetzung des <strong>syndicom</strong>-Kongresses vom November 2017 statt, an dem <strong>nicht</strong> alle Anträge behandelt werden<br />
konnten. Nun sind alle Beschlüsse gefasst (<strong>syndicom</strong>.ch/kongress17). (© Sam Buchli)<br />
10 Der Kongress unterstützte den Kampf der PostAuto-Chauffeure gegen <strong>Gratis</strong>arbeit. (© Sam Buchli)<br />
11 Die Interessengruppe Migration feiert 40 Jahre Tätigkeit unseres Mitglieds Gerda Kern. (© Sam Buchli)<br />
29<br />
6<br />
8<br />
7<br />
9<br />
10 11
30<br />
Aus dem<br />
Leben von ...<br />
Lionel Beuret<br />
Die Arbeitszeit reicht <strong>nicht</strong> für alles aus<br />
Lionel Beuret (1966) <strong>ist</strong> in Les Breuleux<br />
(JU) aufgewachsen. Dort absolvierte er<br />
eine Mechanikerlehre, bevor er in Walliser<br />
Skigebieten tätig wurde. Nach der<br />
Heirat 1988 trat er eine Stelle als Facharbeiter<br />
und Lager<strong>ist</strong> in der Postgarage<br />
an. Wegen einer Restrukturierung und<br />
Schliessung ergriff er zehn Jahre<br />
später die Gelegenheit, Chauffeur zu<br />
werden. Er absolvierte die Ausbildung<br />
zum Lastwagen- und zum Postautofahrer.<br />
Seit dieser beruflichen Neuorientierung<br />
<strong>ist</strong> er als Chauffeur in der<br />
Regie Le Locle tätig.<br />
Seit 30 Jahren <strong>ist</strong> Lionel Beuret Gewerkschaftsmitglied,<br />
zuerst bei der<br />
PTT-Union, dann bei <strong>syndicom</strong>. Seit<br />
dem 1. Januar 2018 <strong>ist</strong> er Präsident der<br />
Betriebskommission von PostAuto.<br />
Text: Sylvie Fischer<br />
Bild: Yves Leresche<br />
Ich liebe meinen Beruf.<br />
Deshalb erledige ich<br />
die nötigen Arbeiten in<br />
jedem Fall<br />
Als Postautochauffeur hatte man<br />
schon immer viele verschiedene Aufgaben<br />
zu erledigen. Die dafür vorgesehene<br />
Arbeitszeit reicht aber <strong>nicht</strong><br />
immer. Vor zwanzig Jahren gab es<br />
noch Angestellte in der Garage, die<br />
uns bei der Kontrolle der Fahrzeuge<br />
halfen. Auch unter Kolleginnen und<br />
Kollegen unterstützte man sich gegenseitig.<br />
Heute <strong>ist</strong> man me<strong>ist</strong>ens<br />
allein.<br />
Wie über 1300 andere Fahrerinnen<br />
und Fahrer habe ich die Petition<br />
«Keine <strong>Gratis</strong>arbeit bei PostAuto» unterschrieben.<br />
Sie fordert, dass alle<br />
Arbeiten für PostAuto (auch jene, die<br />
<strong>nicht</strong> im Dienstplan abgebildet sind)<br />
als Arbeitszeit erfasst und <strong>nicht</strong> in<br />
die Freizeit verlagert werden. Wir<br />
fordern auch, dass die Arbeitsle<strong>ist</strong>ungen<br />
im Personalstundennachweis<br />
nachvollziehbar ausgewiesen werden.<br />
Die gute Nachricht: PostAuto geht<br />
auf die Petition ein und will über<br />
diese heiklen Punkte verhandeln.<br />
Wir haben immer mehr Elektronik,<br />
die bei Dienstantritt eingerichtet<br />
werden muss. Die neuen ISA-Kassen<br />
für den Verkauf elektronischer<br />
Billette müssen aufgestartet werden.<br />
Ebenso das PA 700 für das Scannen<br />
der Fahrausweise und der im<br />
Strassenverkehrsgesetz (SVG) vorgeschriebene<br />
digitale Fahrtschreiber.<br />
Er kontrolliert die Geschwindigkeit<br />
und die Arbeitszeit und liefert bei<br />
Unfällen wichtige Informationen.<br />
Dann gilt es auch, den Wasser- und<br />
Ölstand zu prüfen und eine technische<br />
Kontrolle des Fahrzeugs innen<br />
und aussen vorzunehmen.<br />
Die Zeit, um alle diese Aufgaben<br />
zu erledigen, <strong>ist</strong> zu knapp bemessen.<br />
Deshalb müssen wir früher zur Arbeit<br />
kommen, damit wir es schaffen.<br />
Mein Dienstchef weiss das. Aber<br />
regio nal sind die Unterschiede bei<br />
der Zeit, die für diese Aufgaben angerechnet<br />
wird, beträchtlich.<br />
Bei Dienstende muss noch vollgetankt,<br />
Additiv nachgefüllt und das<br />
Fahrzeuginnere gewischt werden.<br />
Alle elektronischen Systeme müssen<br />
abgestellt, die Frontscheibe und die<br />
Karosserie geputzt, die Kasse weggeräumt<br />
werden. Auch hier muss man<br />
Freizeit dafür opfern.<br />
Was <strong>nicht</strong> erfasst wird, sind die<br />
Buchhaltung am Monatsende und<br />
die Zahlungen an PostAuto. Das<br />
mache ich in den Pausen. Ich liebe<br />
meinen Beruf. Deshalb nehme ich<br />
– aus beruflicher Gewissenhaftigkeit<br />
– es auf mich, auf jeden Fall alle nötigen<br />
Arbeiten zu erledigen.<br />
Manchmal geraten wir in Staus.<br />
Oder wir werden durch den Schnee<br />
aufgehalten. Nur wenn diese Verspätungen<br />
länger als eine Viertelstunde<br />
dauern, fülle ich dafür einen Rapport<br />
aus. Wenn es weniger lange dauert,<br />
verzichte ich darauf.<br />
PostAuto <strong>ist</strong> für mich kein Unternehmen<br />
wie jedes andere. Man hängt<br />
an ihm, wie an den Erinnerungen an<br />
Schulreisen – die man mit Postauto<br />
machte. Ich hoffe auf erfolgreiche<br />
Verhandlungen.<br />
https://bit.ly/2HFXaKr
Impressum<br />
Redaktion: Sylvie Fischer, Giovanni Valerio,<br />
Marc Rezzonico, Marie Chevalley<br />
Tel. 058 817 18 18, redaktion@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Porträts, Zeichnungen: Katja Leudolph<br />
Fotos ohne ©Copyright-Vermerk: zVg<br />
Layout und Korrektorat: Stämpfli AG, Bern<br />
Druck: Stämpfli AG, Wölfl<strong>ist</strong>rasse 1, 3001 Bern<br />
Adressänderungen: <strong>syndicom</strong>, Adressverwaltung,<br />
Monbijoustrasse 33, Postfach, 3001 Bern<br />
Tel. 058 817 18 18, Fax 058 817 18 17<br />
Inserate: priska.zuercher@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Abobestellung: info@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Abopreis <strong>ist</strong> im Mitgliederbeitrag inbegriffen. Für<br />
Nichtmitglieder: Fr. 50.– (Inland), Fr. 70.– (Ausland)<br />
Verlegerin: <strong>syndicom</strong> – Gewerkschaft<br />
Medien und Kommunikation, Monbijoustr. 33,<br />
Postfach, 3001 Bern<br />
Das <strong>syndicom</strong>-Magazin erscheint sechsmal im Jahr.<br />
Ausgabe <strong>Nr</strong>. 7 erscheint am 7. September 2018<br />
Redaktionsschluss: 30. Juli 2018.<br />
31<br />
Das <strong>syndicom</strong>-Kreuzworträtsel<br />
Zu gewinnen gibt es eine Geschenkkarte<br />
im Wert von 40 Franken, gespendet von<br />
unserer Dienstle<strong>ist</strong>ungspartnerin Coop.<br />
Das Lösungswort wird in der nächsten<br />
Ausgabe zusammen mit dem Namen<br />
der Gewinnerin oder des Gewinners veröffentlicht.<br />
Lösungswort und Absender auf einer<br />
A6-Postkarte senden an: <strong>syndicom</strong>-<br />
Magazin, Monbijoustrasse 33, Postfach,<br />
3001 Bern. Einsendeschluss: 14.8.18<br />
Der Gewinner<br />
Die Lösung des <strong>syndicom</strong>-Kreuzworträtsels<br />
aus dem <strong>syndicom</strong>-Magazin<br />
<strong>Nr</strong>. 5/2018 lautet: BILDUNG. Gewonnen<br />
hat Hans Bader aus Märstetten.<br />
Er erhält Reka-Checks im Wert von<br />
50 Franken von unserer Dienstle<strong>ist</strong>ungspartnerin<br />
Reka. Wir gratulieren<br />
herzlich!<br />
Anzeige
32 Inter-aktiv<br />
<strong>syndicom</strong> social<br />
Le Matin wird digital.<br />
Ein Zeichen der Zeit? 7.6.2018<br />
Am 22. Juli 2018 erscheint die orange Tageszeitung<br />
zum letzten Mal in gedruckter<br />
Version. Damit verbunden sind rund 40 Entlassungen.<br />
24 Journal<strong>ist</strong>innen und Journal<strong>ist</strong>en<br />
verlieren ihre Stelle. Dieser Entscheid<br />
von Tamedia <strong>ist</strong> tatsächlich allein<br />
durch die Verluste des Titels 2017 in Höhe<br />
von 6,3 Mio. Franken begründet.<br />
UNI Global Union 10.6.2018<br />
Der von Chr<strong>ist</strong>ina Colclough ver fasste<br />
neue Bericht von UNI Global Union<br />
fokussiert auf die Online-Talentplattformen<br />
und die Arbeitsmarktintermediäre.<br />
Er <strong>ist</strong> in französischer und eng lischer<br />
Sprache erhältlich unter<br />
http://www.thefutureworldofwork.org<br />
Inside SDA/ATS @inside_sda 10.6.2018<br />
Einige Beispiele: Der Personalbestand sinkt, aber neu<br />
gibt es einen HR-Verantwortlichen, einen Generalsekretär<br />
und einen Head Executive Sales bei der SDA.<br />
#ENOUGH 18 13.6.2018<br />
Reserviere Dir bereits das Datum vom 22. September<br />
2018. An diesem Tag findet in Bern die grosse Kundgebung<br />
für die Lohngleichheit statt! Als <strong>syndicom</strong>-Mitglied kannst<br />
Du mit dem öV <strong>gratis</strong> anreisen.<br />
<strong>syndicom</strong> bereitet sich auf die<br />
neuen Herausforderungen vor 9.6.2018<br />
<strong>syndicom</strong>-Kongress: Wie wollen wir als<br />
Gewerkschaft die Herausforderungen der<br />
Digitalisierung angehen?<br />
GAV Swisscom 2018 <strong>ist</strong><br />
unterzeichnet! 4.6.2018<br />
Unter anderem enthält er das Recht auf<br />
Nichterreichbarkeit während der Freizeit,<br />
den Anspruch auf fünf bezahlte Weiterbildungstage<br />
pro Jahr und den Schutz<br />
der Daten der Mitarbeitenden am<br />
Arbeitsplatz.<br />
Adèle Thorens @adelethorens 7.6.2018<br />
@Le Matin wird verschwinden, die Zeitung, die im B<strong>ist</strong>rot<br />
alle lasen. Aber wie der Bundesrat in seiner Antwort auf<br />
meine Frage von letzter Woche schrieb, gibt es (fast)<br />
keine Möglichkeiten, die Informationsvielfalt zu schützen.<br />
Die Post – Lohnrechner 2018 19.6.2018<br />
Seit der Lohnrechner der Post 2018 auf unserer Website<br />
online <strong>ist</strong>, wurde er fast 17 000-mal benutzt.<br />
Danke für Euer Vertrauen!<br />
Vegane Emojis 6.6.2018<br />
Die Digitalisierung beschleunigt<br />
sich – 500 Stellen gefährdet<br />
29.5.2018<br />
Nestlé hat die Restrukturierung<br />
ihrer Informatik und die Verlagerung<br />
ins Technologiezentrum in Spanien<br />
angekündigt. Rund 500 Stellen<br />
könnten verschwinden. Gibt es in<br />
der Schweiz kein geeignetes qualifiziertes<br />
Personal? Oder geht es nur<br />
ums Geld?<br />
Bei den Emojis hat sich ein kleines Detail geändert.<br />
Habt Ihr es schon bemerkt? Im Salat fehlt seit Anfang Juni<br />
das gekochte Ei. Denn Google <strong>ist</strong> darum besorgt, alle Internetnutzer<br />
zufriedenzustellen, auch Veganer.<br />
Künstliche Intelligenz und<br />
Fussball-WM 13.6.2018<br />
Nicht fehlen darf natürlich eine Bemerkung<br />
zur Fussball-WM! Goldman Sachs hat künstliche<br />
Intelligenz – basierend auf Machine<br />
Learning – den Ausgang der Fussball-WM<br />
2018 berechnen lassen. Der Sieger wird –<br />
Spoiler Alert – Brasilien heissen!


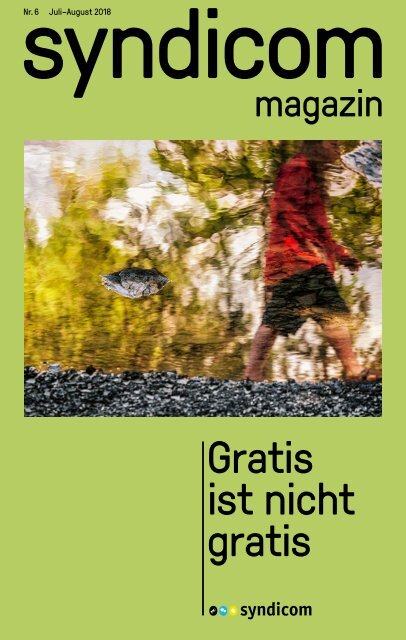

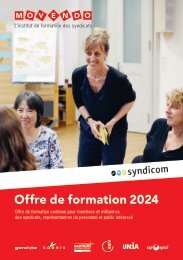



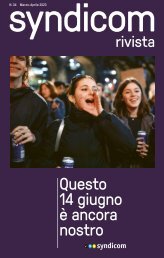

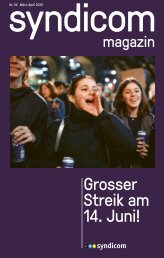


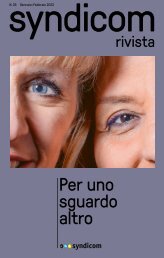
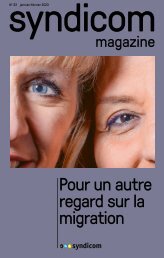
![2202456_[230122]_Syndicom_33_2023_DE_LOW_150_dpi](https://img.yumpu.com/67501302/1/164x260/2202456-230122-syndicom-33-2023-de-low-150-dpi.jpg?quality=85)