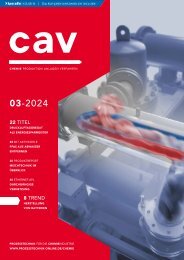KEM Konstruktion 11.2019
Trendthemen: Messe SPS 2019, Machine Learning, Digitalisierung, Verwaltungstools, Additive Manufacturing, Predictive Maintenance; KEM Porträt: Peter Lutz, Director Field Level Communications, OPC; KEM Perspektiven: Digitale Pioniere - Rolls-Royce nutzt Virtual und Augmented Reality bereits
Trendthemen: Messe SPS 2019, Machine Learning, Digitalisierung, Verwaltungstools, Additive Manufacturing, Predictive Maintenance; KEM Porträt: Peter Lutz, Director Field Level Communications, OPC; KEM Perspektiven: Digitale Pioniere - Rolls-Royce nutzt Virtual und Augmented Reality bereits
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MAGAZIN<br />
UNTERNEHMEN<br />
Lapp nutzt eine neue Herangehensweise beim Innovationsprozess<br />
Jeder Traum braucht seinen Raum<br />
Das Thema Innovation ist nicht nur fest in den Grundwerten der Lapp-Gruppe verankert, es wird<br />
auch aktiv gelebt. Ergänzend zum klassischen Stage-Gate-Ansatz hat das Unternehmen den neuen<br />
Innovation-for-Future-Prozess entwickelt. Dieser Prozess gibt auch radikalen sowie disruptiven<br />
Ideen Raum, in dem sie reifen und sich entfalten können.<br />
Bernd Müller, freier Journalist, i. A. der U.I. Lapp GmbH, Stuttgart<br />
Die Entwicklung einer Predictive-Maintenance-<br />
Lösung von Lapp kam mit dem klassischen<br />
Stage-Gate-Prozess nicht recht voran. Der<br />
neue Innovation-for-Future-Prozess gibt den<br />
Entwicklern jetzt den notwendigen Freiraum<br />
denn dort kennt man Ziele, Marktpotenzial<br />
und auch Geschäftsmodell am Anfang des<br />
Prozesses oft noch gar nicht. Doch der ökonomische<br />
Wandel, der durch die rasante Digitalisierung,<br />
neue Geschäftsmodelle sowie eine<br />
Unsicherheit über die Zukunft geprägt ist,<br />
erfordert auch eine neue Herangehensweise<br />
beim Innovationsprozess.<br />
Innovation, etwas Neues zu schaffen und erfolgreich zu vermarkten,<br />
ist zu einem Hype geworden. Noch vor zehn Jahren waren<br />
Unternehmen eher auf Lean-Themen fixiert, also die Kosten-Optimierung<br />
von Produkten und Prozessen. Doch nicht jeder, der von<br />
Innovation spricht, ist auch wirklich innovativ. Fairerweise muss man<br />
zudem zwischen Consumer-Produkten und dem B2B-Geschäft<br />
unterscheiden. Hersteller von Smartphones etwa müssen ihre Produkte<br />
jedes Jahr neu erfinden, weil die Produktlebenszyklen kurz<br />
sind. Anders sieht es bei der Verbindungstechnologie aus, in der<br />
Lapp seit 60 Jahren erfolgreich ist: Die Produktlebenszyklen sind<br />
lang, zahlreiche Produkte bleiben über Jahrzehnte im Programm.<br />
Wenn Guido Ege über Innovation spricht, nutzt der Leiter Produktmanagement<br />
und Entwicklung bei Lapp gerne Metaphern. Auch<br />
„Raum“ sei so eine Metapher – für Methoden, Prozesse und Freiheiten,<br />
um Innovationen zu entwickeln, die vorher undenkbar waren:<br />
„Früher war dieser Raum bei Lapp begrenzt.“ Der klassische Stage-<br />
Gate-Prozess definierte die Leitplanken, innerhalb derer der Innova -<br />
tionsprozess ablief. Wurden bestimmte Ziele erfüllt – Funktionalität,<br />
Kosten, Termine – ging der Daumen der Gatekeeper nach oben.<br />
Wenn nicht, ging er nach unten und das Projekt wurde beendet. Für<br />
radikale, transformative und disruptive Innovationen war kaum Platz,<br />
Entstehen des Innovationsprozesses<br />
Zwei Innovationsprojekte aus der jüngeren<br />
Vergangenheit von Lapp zeigen beispielhaft,<br />
wie die klassische Herangehensweise ins<br />
Leere laufen kann. Sie waren der Startschuss<br />
dafür, einen neuen Innovationsprozess zu<br />
entwickeln – Innovation for Future:<br />
Für die korrekte und einfache Markierung von<br />
konfektionierten Kabeln hat ein Innovationsteam von Lapp mittels<br />
Design-Thinking mehrere Lösungen entwickelt, aus denen eine<br />
besonders hervorstach: Cloudmarking. Dabei lädt der Maschinenbauer<br />
die Informationen für die Markierungen in eine Cloud, wo der<br />
Konfektionär sie herunterladen und ausdrucken kann. Der Vorteil<br />
ist, dass jedes Label eindeutig seiner Position im Schaltplan zugeordnet<br />
ist, das Befestigen anschließend schneller erfolgen kann und<br />
Fehlerquellen minimiert werden. Im Rahmen des Design-Thinking-<br />
Prozesses wurden von Anfang an Kunden eingebunden, mit denen<br />
in etlichen Iterationsrunden – sogenannten Sprints – das Konzept<br />
verbessert wurde, das es am Ende allerdings nur auf Papier gab.<br />
Guido Ege: „Wir haben zu spät begonnen, an die Umsetzung zu<br />
denken und einen Partner für die Softwareentwicklung einzubinden.“<br />
Mittlerweile ist Cloudmarking wieder auf dem Weg und ein<br />
indischer Dienstleister entwickelt die entsprechende Software.<br />
Im zweiten Projekt hatten sich Entwickler im Sinne der vorausschauenden<br />
Wartung Gedanken darüber gemacht, wie der Ausfall von Leitungen<br />
vorhergesagt werden kann. Sie fanden Hinweise darauf, dass<br />
ein Zusammenhang zwischen der nachlassenden Übertragungsfähigkeit<br />
und der Alterung sowie der Ausfallwahrscheinlichkeit der Leitung<br />
besteht. Die Lösung war allerdings technisch sehr anspruchsvoll,<br />
weshalb der Fokus der Entwickler lange Zeit ausschließlich auf der<br />
Technik lag. „In diesem Fall hat sich niemand gefragt, welche Kunden<br />
das brauchen und wieviel sie dafür zu bezahlen bereit sind“, erklärt<br />
Bild: Lapp<br />
24 K|E|M <strong>Konstruktion</strong> 11 2019