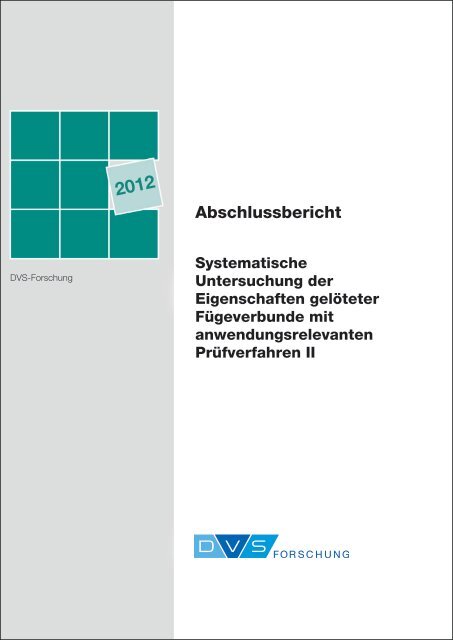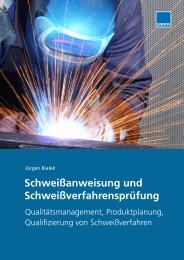SB_16.558NLP
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2012<br />
Abschlussbericht<br />
DVS-Forschung<br />
Systematische<br />
Untersuchung der<br />
Eigenschaften gelöteter<br />
Fügeverbunde mit<br />
anwendungsrelevanten<br />
Prüfverfahren II
Systematische Untersuchung der<br />
Eigenschaften gelöteter<br />
Fügeverbunde mit<br />
anwendungsrelevanten<br />
Prüfverfahren II<br />
Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben<br />
IGF-Nr.: 16.558 N<br />
DVS-Nr.: 07.062<br />
Technische Universität Dortmund Lehrstuhl für<br />
Werkstofftechnologie Fakultät Maschinenbau<br />
RWTH Aachen University Institut für<br />
Oberflächentechnik im Maschinenbau<br />
Förderhinweis:<br />
Das IGF-Vorhaben Nr.: 16.558 N / DVS-Nr.: 07.062 der Forschungsvereinigung Schweißen und<br />
verwandte Verfahren e.V. des DVS, Aachener Str. 172, 40223 Düsseldorf, wurde über die AiF im<br />
Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)<br />
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen<br />
Bundestages gefördert.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen<br />
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind online abrufbar<br />
unter: http://dnb.dnb.de<br />
© 2012 DVS Media GmbH, Düsseldorf<br />
DVS Forschung Band 231<br />
Bestell-Nr.: 170340<br />
I<strong>SB</strong>N: 978-3-96870-230-8<br />
Kontakt:<br />
Forschungsvereinigung Schweißen<br />
und verwandte Verfahren e.V. des DVS<br />
T +49 211 1591-0<br />
F +49 211 1591-200<br />
forschung@dvs-hg.de<br />
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung in andere Sprachen, bleiben<br />
vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlages sind Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen und die<br />
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen nicht gestattet.
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Zusammenfassung 2<br />
2 Änderungen/Anpassungen gegenüber dem ursprünglichen<br />
Arbeitsplan aufgrund von Anregungen und Empfehlungen vom<br />
projektbegleitenden Ausschuss (PA) und in Übereinstimmung<br />
mit dem PA 3<br />
3 Zusammensetzung des Projekt begleitenden Ausschusses 4<br />
4 Forschungsthema 8<br />
5 Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche<br />
Problemstellung 8<br />
5.1 Anlass für den Forschungsantrag 8<br />
5.2 Ausgangssituation 8<br />
5.3 Stand der Forschung und Technik 9<br />
6 Forschungsziel/Forschungsergebnisse/Lösungsweg 10<br />
6.1 Forschungsziel 10<br />
6.2 Angestrebte Forschungsergebnisse 11<br />
6.3 Lösungsweg zur Erreichung des Forschungszieles 11<br />
6.3.1 Projektpakete 12<br />
6.3.2 Prüfmethoden und zu untersuchende Lot- und Grundwerkstoffe 13<br />
6.4 Lötung der Zug- und Scherzugproben 17<br />
6.5 Gefüge der gelöteten Proben 22<br />
6.6 Potentiostatische Messungen mit wässerigen Medien 35<br />
6.7 TGA-Untersuchungen 37<br />
6.8 Korrosionsuntersuchungen in der Klimakammer 40<br />
6.9 Quasistatische Zug- und Scherzugversuche 42<br />
6.10 Quasistatische Zugversuche nach Korrosionsangriff im<br />
Kondenswassertest 52<br />
6.11 Quasistatische Zugversuche nach Heißgaskorrosionsangriff 54<br />
6.11.1 Grundwerkstoff 55<br />
6.11.2 Lötnaht 55<br />
6.11.3 Zugfestigkeit 60<br />
6.12 Dynamisches Verhalten ohne Korrosionsangriff 61<br />
6.13 Dynamisches Verhalten nach dem Korrosionsangriff 69<br />
6.14 Ermittlung der thermomechanischen Kennwerte 70<br />
6.14.1 Ermittlung der E-Moduln der Grund- und Lotwerkstoffe 71<br />
6.14.2 Ermittlung der Wärmeausdehnungskoeffizienten 73<br />
6.14.3 Ermittlung der Wärmeleitfähigkeiten 78<br />
6.14.4 Ermittlung der Fliesskurven 80<br />
6.15 Simulation der gelöteten Zugproben mit Lötfehlern 82<br />
Seite 6 von 132
6.15.1 Einbauen von Lötfehlern 83<br />
6.15.2 Validierung der Simulation 89<br />
6.15.3 Anpassung der Vernetzungsstrategie 94<br />
6.15.4 Parameterstudie – konzentrierte Gasporen 107<br />
7 Wirtschaftliche Bedeutung des Forschungsthemas für kleine<br />
und mittlere Unternehmen (kmU) 114<br />
8 Innovativer Beitrag und industrielle Anwendungsmöglichkeiten<br />
der angestrebten Forschungsergebnisse 114<br />
9 Publikationen 115<br />
10 Geplante Publikationen 115<br />
11 Einschätzung zur Realisierbarkeit des vorgeschlagenen und<br />
aktualisierten Transferkonzepts 115<br />
12 Durchgeführter Plan zum Ergebnistransfer in die Wirtschaft 117<br />
13 Literaturquellen 119<br />
14 Internetquellen 121<br />
15 Abbildungsverzeichnis 121<br />
16 Tabellenverzeichnis 131<br />
Seite 7 von 132
4 Forschungsthema<br />
Systematische Untersuchung der Eigenschaften gelöteter Fügeverbunde mit anwendungsrelevanten<br />
Prüfverfahren II<br />
5 Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Problemstellung<br />
Ausgangspunkt des Projektes war die Problematik, dass zu wenige und nur schlecht auf<br />
reale Bauteile übertragbare Daten zu den Festigkeiten von Lotwerkstoffen existierten.<br />
Zudem werden diese stark von den Lötbedingungen beeinflusst.<br />
5.1 Anlass für den Forschungsantrag<br />
Das Löten bietet zahlreiche allgemein bekannte Vorteile gegenüber anderen Fügetechnologien,<br />
so dass es in zahlreichen Bereichen genutzt wird. Ein klarer Nachteil<br />
ergab sich jedoch aus dem Mangel an Kenndaten zu Lotwerkstoffen und gelöteten<br />
Verbindungen sowie der fehlenden Möglichkeit, diese auf reale Bauteile und Belastungen<br />
zu übertragen. So wird die Festigkeit von Fügeverbunden durch eine Vielzahl<br />
miteinander in Wechselwirkung stehender Faktoren, wie z. B. die Lötspaltgeometrie,<br />
beeinflusst. Die Simulation wurde als Werkzeug im Bereich der Löttechnologie nur<br />
selten eingesetzt. Aus den deshalb notwendigen Vorversuchen und der damit häufig<br />
verbundenen Unsicherheit beim Anwender ergaben sich klare wirtschaftliche Nachteile<br />
für das Löten als Fügetechnologie, die dessen Einsatz in der industriellen Praxis häufig<br />
erschweren bzw. in einigen Fällen sogar verhinderten. Ein erster wichtiger Schritt hin<br />
zur Lösung dieses Problems konnte mit dem IGF-Vorhaben Nr. 15.113 N (Laufzeit<br />
01.07.2007-30.06.2009) geleistet werden. Hier wurden die Festigkeiten gelöteter<br />
Fügeverbunde bei quasistatischer und thermischer Belastung untersucht und simuliert.<br />
In der Praxis liegen neben diesen Belastungsarten meist jedoch zusätzlich sowohl<br />
dynamische Belastungen als auch korrosive Angriffe vor, die in diesem Vorhaben<br />
berücksichtigt werden. Weiterhin ist eine Übertragung der Ergebnisse auf weitere Lotund<br />
Grundwerkstoffkombinationen erstrebenswert gewesen, um eine universelle<br />
Anwendbarkeit der erarbeiteten Methodiken zu demonstrieren. Zahlreiche industrielle<br />
Nachfragen zu der beschriebenen Thematik zeigten den deutlichen Forschungsbedarf<br />
zur verlässlichen Ermittlung und Simulation der Eigenschaften gelöteter Fügeverbunde.<br />
5.2 Ausgangssituation<br />
Allgemein existierte im gesamten Bereich der Löttechnik ein deutlicher Mangel an<br />
verlässlichen und übertragbaren Werkstoffkenndaten, universellen Prüfmethoden und<br />
etablierten Simulations- und Modellierungstools. Bisherige Prüfverfahren erlaubten<br />
keine Übertragbarkeit auf andere Löt- oder Prüfbedingungen. FEM-Betrachtungen –<br />
sofern überhaupt genutzt – beschränkten sich meist auf die Analyse der beim Abkühlprozess<br />
auftretenden Eigenspannungen. Jedoch wurden in vorangegangenen Forschungsprojekten<br />
Methoden zur Ermittlung verlässlicher Kenndaten entwickelt und<br />
angewendet. Sowohl in realen Versuchen als auch in der Simulation wurden die<br />
mechanischen Eigenschaften unter quasistatischer, mehrachsiger Beanspruchung bei<br />
Temperaturen bis hin zu 600 °C erfolgreich untersucht. Die Werkstoffkenndaten,<br />
Methoden und Modelle wurden so ermittelt bzw. gestaltet, dass sie für die weitere<br />
Forschungsarbeit genutzt werden können.<br />
Seite 8 von 132
5.3 Stand der Forschung und Technik<br />
Die Eigenschaften einer Lötverbindung werden durch zahlreiche Faktoren bestimmt.<br />
Auch wenn die einzelnen Faktoren größtenteils bekannt sind, ergibt sich aus ihrem<br />
komplexen Zusammenspiel eine besondere Herausforderung bei der Vorhersage der<br />
Eigenschaften gelöteter Fügeverbunde. Hauptfaktor sind die verwendeten Lot- und<br />
Grundwerkstoffe. Die Festigkeit des Lotwerkstoffs bestimmt in der Regel maßgeblich<br />
die Festigkeit der Lötverbindung [Aws07]. Zu beachten ist dabei jedoch, dass die<br />
Eigenschaften des Lötgutes aufgrund des Lötprozesses und der damit verbundenen<br />
Diffusionsvorgänge von denen des Lotes im Ausgangszustand abweichen können.<br />
Weiter hat die Festigkeit des Grundwerkstoffs selbst aufgrund der Stützwirkung bei<br />
kleinen Spaltbreiten einen signifikanten Einfluss auf die Festigkeit des Fügeverbundes.<br />
Auch nach dem Lötprozess ergeben sich weitere Einflussfaktoren, wie z. B. höhere<br />
Einsatztemperaturen und korrosive Schädigungen auf die Belastbarkeit gelöteter Fügeverbunde.<br />
Sie führen allgemein zu einer Abnahme der Festigkeit. Die Art der mechanischen<br />
Beanspruchung – in der Realität meistens dynamisch – hat wesentlichen Einfluss<br />
auf die Festigkeit der Lötverbindung [Hen11]. Da dynamische Belastungen im<br />
Allgemeinen zu einem Versagen bei niedrigeren Spannungen als quasistatische führen<br />
[Ask96], ist die Untersuchung von Lötverbindungen unter dynamischen Belastungen<br />
für die Auslegung von entsprechenden Bauteilen notwendig.<br />
Ein FE-Modell zur Ermittlung der Spannungen nicht nur infolge des Abkühlvorgangs<br />
nach erfolgter Lötung [Eig99 und Sch97], sondern auch infolge einer externen Last<br />
unter Berücksichtigung der thermisch induzierten Spannungen wurde in früheren<br />
Forschungstätigkeiten erfolgreich erstellt und anhand einer Vielzahl von Lötungen<br />
validiert [Bob10.1]. Dabei wurden elastisch-plastische Werkstoffmodelle unter Berücksichtigung<br />
der Temperaturabhängigkeit der Materialparameter eingesetzt, um eine<br />
möglichst hohe Übereinstimmung zwischen den realen Mess- und den berechneten<br />
Werten zu erhalten. Zur Abbildung der im Lötprozess entstandenen Phasen aufgrund<br />
von Wechselwirkungen zwischen Lot- und Grundwerkstoff wurden zwei Lösungswege<br />
verfolgt. Einerseits wurden über den gesamten Lötspalt konstante Werkstoffeigenschaften<br />
angenommen, die aus den experimentell ermittelten Messwerten errechnet<br />
wurden (Bild 1a). Auf der anderen Seite wurde ein Ansatz verfolgt, bei dem die Phasen<br />
innerhalb des Modells abgebildet wurden (Bild 1b). Bei diesem Ansatz bekommt der<br />
Konstrukteur einen genaueren Einblick über die Stellen, an denen die Spannungsspitzen<br />
besonders hoch sind und an denen gleichzeitig ein Bauteilversagen potenziell<br />
initiiert wird. Dabei war die Genauigkeit der berechneten Spannungen unmittelbar<br />
abhängig von der möglichst realen Abbildung des Materialverhaltens.<br />
Seite 9 von 132
GW<br />
Lötbereich<br />
GW<br />
Grundwerkstoff<br />
Diffusionszone<br />
Lot<br />
Diffusionszone<br />
Grundwerkstoff<br />
a) homogenes Modell b) Modell mit Zwischenphasen<br />
Bild 1:<br />
Innerhalb der Simulation zugrunde gelegte Geometriemodelle zur Abbildung<br />
der Fügezone<br />
Somit ist die Kenntnis über die thermischen und mechanischen Eigenschaften der<br />
beteiligten Grund- und Lotwerkstoffe sowie ggf. über die einzelnen Lötgutphasen zur<br />
Vorhersage der Eigenschaften von Lötverbindungen erforderlich. Im Einzelnen werden<br />
folgende Kennwerte, jeweils in Abhängigkeit von der Temperatur, benötigt: Wärmeleitfähigkeit,<br />
Wärmeausdehnungskoeffizient, Fließkurve und E-Modul. Im Rahmen des<br />
IGF-Vorhabens Nr. 15.113 N wurden Methoden zur Herstellung geeigneter Proben<br />
und zur Ermittlung der Kennwerte entwickelt und erfolgreich angewendet. Diese<br />
Methoden und die für vier Grund- und vier Lotwerkstoffe ermittelten Daten können als<br />
Basis für die zukünftige Forschung genutzt werden.<br />
6 Forschungsziel/Forschungsergebnisse/Lösungsweg<br />
Ziel des Projektes war es, für ausgewählte Werkstoffkombinationen verlässliche<br />
Anwendungsdaten zu ermitteln und mit einer neuen Modellierungsmethodik die<br />
Möglichkeit zu schaffen, die mechanische Belastbarkeit von Lötverbunden vorhersagen<br />
zu können. Die Ergebnisse sollten in geeigneter Form dem Anwender zugänglich<br />
gemacht werden, um so in der Praxis in der Konstruktion eingesetzt werden zu können.<br />
6.1 Forschungsziel<br />
Ziel des Forschungsvorhabens war es, dem Anwender zu ermöglichen, die Festigkeit<br />
und Lebensdauer von gelöteten Fügeverbunden bei quasistatischer und dynamischer<br />
Belastung sowie bei unterschiedlichen Betriebstemperaturen und nach korrosiver<br />
Schädigung vorherzusagen. Hierzu war die Simulation in der Löttechnik als Hilfsmittel<br />
anzuwenden und weiterzuentwickeln. In diesem Projekt sollten vorhandene Materialmodelle<br />
so verbessert werden, dass unterschiedlichste Belastungen simuliert und<br />
Einflussfaktoren wie Lötspaltgeometrien und Mehrphasigkeit des Lötgutes berücksichtigt<br />
werden konnten. Die thermischen und mechanischen Kennwerte für die Löttechnologie<br />
typischer Werkstoffe sollten ermittelt und umfangreiche mechanische<br />
Prüfungen sowie Korrosionstests durchgeführt werden, um neben wissenschaftlichen<br />
Erkenntnissen dem Anwender verlässliche Daten liefern zu können.<br />
Seite 10 von 132