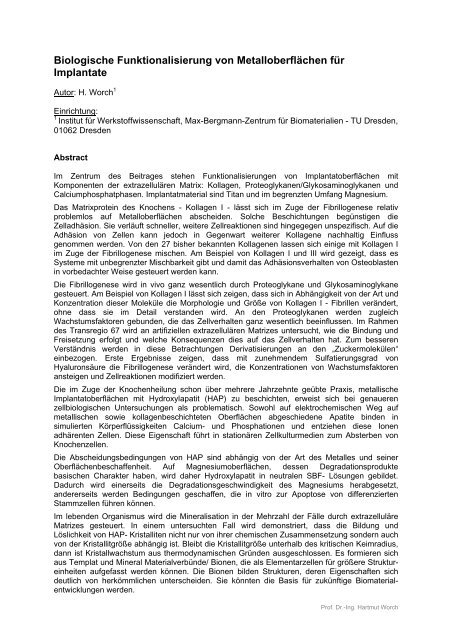Zukunftsfähige medizinische Implantate
Zukunftsfähige medizinische Implantate
Zukunftsfähige medizinische Implantate
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Biologische Funktionalisierung von Metalloberflächen für<br />
<strong>Implantate</strong><br />
Autor: H. Worch 1<br />
Einrichtung:<br />
1<br />
Institut für Werkstoffwissenschaft, Max-Bergmann-Zentrum für Biomaterialien - TU Dresden,<br />
01062 Dresden<br />
Abstract<br />
Im Zentrum des Beitrages stehen Funktionalisierungen von Implantatoberflächen mit<br />
Komponenten der extrazellulären Matrix: Kollagen, Proteoglykanen/Glykosaminoglykanen und<br />
Calciumphosphatphasen. Implantatmaterial sind Titan und im begrenzten Umfang Magnesium.<br />
Das Matrixprotein des Knochens - Kollagen I - lässt sich im Zuge der Fibrillogenese relativ<br />
problemlos auf Metalloberflächen abscheiden. Solche Beschichtungen begünstigen die<br />
Zelladhäsion. Sie verläuft schneller, weitere Zellreaktionen sind hingegegen unspezifisch. Auf die<br />
Adhäsion von Zellen kann jedoch in Gegenwart weiterer Kollagene nachhaltig Einfluss<br />
genommen werden. Von den 27 bisher bekannten Kollagenen lassen sich einige mit Kollagen I<br />
im Zuge der Fibrillogenese mischen. Am Beispiel von Kollagen I und III wird gezeigt, dass es<br />
Systeme mit unbegrenzter Mischbarkeit gibt und damit das Adhäsionsverhalten von Osteoblasten<br />
in vorbedachter Weise gesteuert werden kann.<br />
Die Fibrillogenese wird in vivo ganz wesentlich durch Proteoglykane und Glykosaminoglykane<br />
gesteuert. Am Beispiel von Kollagen I lässt sich zeigen, dass sich in Abhängigkeit von der Art und<br />
Konzentration dieser Moleküle die Morphologie und Größe von Kollagen I - Fibrillen verändert,<br />
ohne dass sie im Detail verstanden wird. An den Proteoglykanen werden zugleich<br />
Wachstumsfaktoren gebunden, die das Zellverhalten ganz wesentlich beeinflussen. Im Rahmen<br />
des Transregio 67 wird an artifiziellen extrazellulären Matrizes untersucht, wie die Bindung und<br />
Freisetzung erfolgt und welche Konsequenzen dies auf das Zellverhalten hat. Zum besseren<br />
Verständnis werden in diese Betrachtungen Derivatisierungen an den „Zuckermolekülen“<br />
einbezogen. Erste Ergebnisse zeigen, dass mit zunehmendem Sulfatierungsgrad von<br />
Hyaluronsäure die Fibrillogenese verändert wird, die Konzentrationen von Wachstumsfaktoren<br />
ansteigen und Zellreaktionen modifiziert werden.<br />
Die im Zuge der Knochenheilung schon über mehrere Jahrzehnte geübte Praxis, metallische<br />
Implantatoberflächen mit Hydroxylapatit (HAP) zu beschichten, erweist sich bei genaueren<br />
zellbiologischen Untersuchungen als problematisch. Sowohl auf elektrochemischen Weg auf<br />
metallischen sowie kollagenbeschichteten Oberflächen abgeschiedene Apatite binden in<br />
simulierten Körperflüssigkeiten Calcium- und Phosphationen und entziehen diese Ionen<br />
adhärenten Zellen. Diese Eigenschaft führt in stationären Zellkulturmedien zum Absterben von<br />
Knochenzellen.<br />
Die Abscheidungsbedingungen von HAP sind abhängig von der Art des Metalles und seiner<br />
Oberflächenbeschaffenheit. Auf Magnesiumoberflächen, dessen Degradationsprodukte<br />
basischen Charakter haben, wird daher Hydroxylapatit in neutralen SBF- Lösungen gebildet.<br />
Dadurch wird einerseits die Degradationsgeschwindigkeit des Magnesiums herabgesetzt,<br />
andererseits werden Bedingungen geschaffen, die in vitro zur Apoptose von differenzierten<br />
Stammzellen führen können.<br />
Im lebenden Organismus wird die Mineralisation in der Mehrzahl der Fälle durch extrazelluläre<br />
Matrizes gesteuert. In einem untersuchten Fall wird demonstriert, dass die Bildung und<br />
Löslichkeit von HAP- Kristalliten nicht nur von ihrer chemischen Zusammensetzung sondern auch<br />
von der Kristallitgröße abhängig ist. Bleibt die Kristallitgröße unterhalb des kritischen Keimradius,<br />
dann ist Kristallwachstum aus thermodynamischen Gründen ausgeschlossen. Es formieren sich<br />
aus Templat und Mineral Materialverbünde/ Bionen, die als Elementarzellen für größere Struktureinheiten<br />
aufgefasst werden können. Die Bionen bilden Strukturen, deren Eigenschaften sich<br />
deutlich von herkömmlichen unterscheiden. Sie könnten die Basis für zukünftige Biomaterialentwicklungen<br />
werden.<br />
Prof. Dr.-Ing. Hartmut Worch