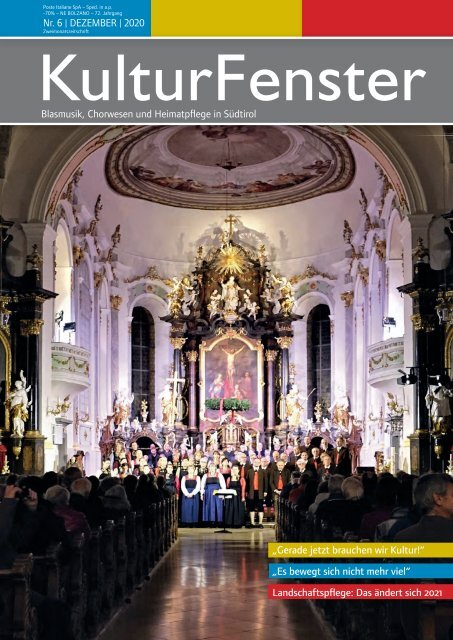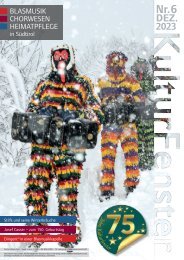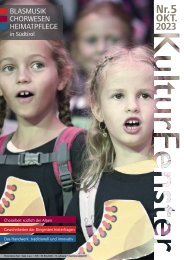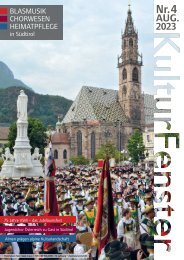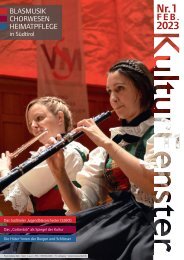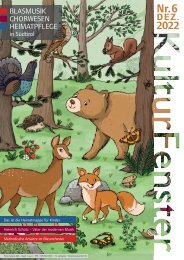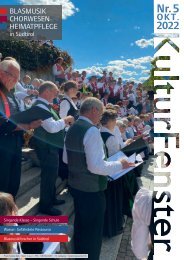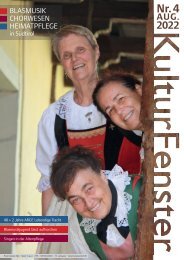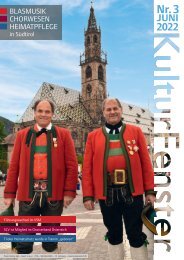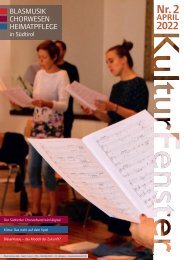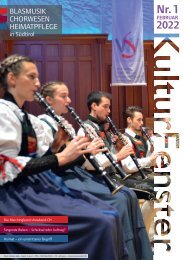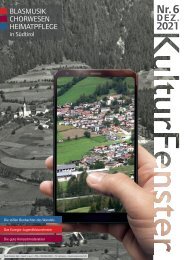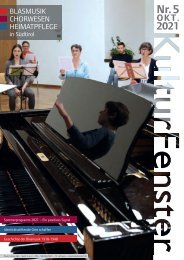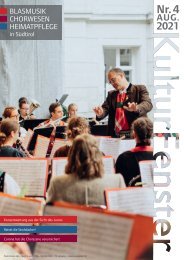Kulturfenster Nr. 06|2020 - Dezember 2020
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Poste Italiane SpA – Sped. in a.p.<br />
-70% – NE BOLZANO – 72. Jahrgang<br />
<strong>Nr</strong>. 6 | DEZEMBER | <strong>2020</strong><br />
Zweimonatszeitschrift<br />
KulturFenster<br />
Blasmusik, Chorwesen und Heimatpflege in Südtirol<br />
„Gerade jetzt brauchen wir Kultur!“<br />
„Es bewegt sich nicht mehr viel“<br />
Landschaftspflege: Das ändert sich 2021
• Geleitwort •<br />
• Inhalt •<br />
• Chorwesen<br />
„Leben kann man nur<br />
vorwärts“ – Gedanken von<br />
Obmann Deltedesco 3<br />
AGACH - Brücken schlagen<br />
zwischen Menschen und<br />
Regionen 4<br />
„Gerade jetzt brauchen<br />
wir Kultur!“ - Vollversammlung<br />
des SCV 6<br />
Dirigentenworkshop mit Jan<br />
Scheerer im Kolpinghaus Bozen 7<br />
„Singen isch inser Leben“ –<br />
ein Lied zum Jahreswechsel 9<br />
Kirchenchor Vahrn gründet<br />
Kinder- und Jugendchor 11<br />
Höchste Tiroler Auszeichnung<br />
für Irene Vieider 12<br />
Büchertisch: „Als ich die Stille<br />
fand“ von Franz Welser-Möst 13<br />
Der Blick nach vorne<br />
Leben kann man nur vorwärts: Diesen Satz des<br />
großen Philosophen Sören Kierkegaard (1813<br />
bis 1855) stellt der Obmann des Südtiroler<br />
Chorverbandes (SCV), Erich Deltedesco, in den<br />
Mittelpunkt seiner Botschaft an Obfrauen und<br />
Obmänner, Sängerinnen und Sänger, Chorleiterinnen<br />
und Chorleiter zu Weihnachten und<br />
Neujahr. Die Corona-Pandemie habe vieles<br />
lahmgelegt, aber man dürfe jetzt nicht die Flinte<br />
ins Korn werfen, sondern müsse im Sinne des<br />
dänischen Philosophen nach vorne schauen,<br />
so der Obmann. „Wir hoffen alle, dass wir unsere<br />
Tätigkeit bald wieder in vertrauter Form<br />
und mit neuer Kraft aufnehmen können.“<br />
Brücken schlagen zwischen Menschen und<br />
Regionen – das war von Anfang an die Devise<br />
der AGACH, der Arbeitsgemeinschaft Alpenländischer<br />
Chorverbände. Der Präsident der<br />
AGACH, Erich Deltedesco, wirft einen Blick<br />
zurück in die Anfänge der AGACH vor mehr<br />
als vierzig Jahren. Damals, Anfang der 70er<br />
Jahre des vergangenen Jahrhunderts war nur<br />
eine Handvoll Verbände aus dem Alpenraum<br />
vertreten, heute sind es 16 Verbände mit fast<br />
• Blasmusik<br />
Das Feuilleton und die Blasmusik 14<br />
„Es bewegt sich nicht mehr viel“ –<br />
Jahreshauptversammlung des VSM 19<br />
„Schauen wir nach vorne“ –<br />
Ausblicke auf das Tätigkeitsjahr 2021 22<br />
Die Jugendseiten:<br />
303 Leistungsabzeichen verliehen 23<br />
Jumbos – der neue Name<br />
für die Jugendkapelle Bozen 24<br />
Ars Nova: Robert Neumairs Musik<br />
zum Stummfilm „Der müde Tod“ 26<br />
Erlesene Konzertreihe in der<br />
Hofburg Brixen 28<br />
Generalversammlung unter<br />
besonderen Abzeichen –<br />
MK Zwölfmalgreien 29<br />
Gratulation zur Goldenen Hochzeit<br />
von Ehrenkapellmeister Sepp Walder<br />
und seiner Frau Christl 29<br />
Neues: Die Bücher „Itallegro“<br />
von Jutta Eckes und<br />
„Bolero“ von Maurice Ravel 30<br />
5000 Sängerinnen und Sängern. ,,Heute ist es“,<br />
so Deltedesco, ,,eine kulturelle Gemeinschaft<br />
von singenden Menschen des Alpenbogens“.<br />
Über mangelnde Wertschätzung klagt der Heimatpflegeverband<br />
Südtirol in Richtung Landesamt<br />
für Raum und Landschaft. Seit rund<br />
50 Jahren habe man als erster Ansprechpartner<br />
für alle jene fungiert, die ein bäuerliches<br />
Kleindenkmal errichten oder erhalten wollten,<br />
und dafür ,,Herz, Zeit und Energie“ aufgewendet“,<br />
mit Ende des Jahres <strong>2020</strong> sehe<br />
man sich jedoch gezwungen, die Bearbeitung<br />
der entsprechenden Gesuche um Beiträge<br />
an das Landesamt abzutreten, so der<br />
Geschäftsführer des Heimatpflegeverbandes,<br />
Josef Oberhofer. Obfrau Claudia Plaikner sichert<br />
aber zu: „Wir bleiben Ratgeber für alle<br />
offenen Fragen in diesem Bereich.“<br />
Im Hauptartikel des VSM bemängelt der<br />
Autor die „fundierten Presseberichte“ für<br />
Konzertveranstaltungen der Blasmusik. Er<br />
geht auf Spurensuche und wird in vielerlei<br />
Hinsicht fündig.<br />
•Heimatpflege<br />
Alfons Gruber<br />
Thema: Wenn die Wertschätzung fehlt 31<br />
Franz Fliri und seine Arbeit als Sachbearbeiter<br />
für die Heimatpflege 34<br />
„Die Neuausrichtung des HPV“ –<br />
Interview mit Claudia Plaikner 36<br />
Zur Geschichte der Weihnachtsgeschenke 38<br />
Die Salzkirche – Dinge des Alltags aus<br />
Geschichte und Gegenwart 40<br />
Südtiroler Beteiligung beim Kongress<br />
„Heimat in Europa“ 41<br />
Einsatz des Heimatpflegeverbandes für<br />
eine intakte Nahversorgung 42<br />
Das ehemalige Hotel „Post“ in Toblach<br />
ist leider Geschichte 43<br />
Die Drei Zinnen als Bergskulptur und Blickfang 44<br />
Ein Marterl und ein Bildstock in Lana<br />
und Völlan wurden restauriert 45<br />
Hängebrücke „Hofmannssteg“ in Mareit<br />
soll nicht abgerissen werden 46<br />
Arge Lebendige Tracht: Falten, Krausen<br />
und Plissee – eine Ausstellung 47<br />
„Mühlbach bei Franzensfeste von 1897 – 1947“ 48<br />
„Wenn des Singen net war“ 49<br />
„Tramin in Vergangenheit und Gegenwart“ 50<br />
2<br />
KulturFenster
Vorweg<br />
Chorwesen<br />
„Leben kann man nur vorwärts“<br />
Gedanken des Obmanns zum Jahresende<br />
Sehr geehrte Obfrauen und Obmänner, sehr<br />
geehrte Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe<br />
Sängerinnen und Sänger!<br />
Mit folgenden oder ähnlichen Worten habe<br />
ich in den letzten Jahren immer meine<br />
Dankesworte am Ende des Jahres begonnen:<br />
„Nur noch wenige Tage trennen<br />
uns vom Jahreswechsel. Anlass und Gelegenheit<br />
für uns alle im Südtiroler Chorverband<br />
Bilanz zu ziehen und mit Dankbarkeit<br />
einen Blick zurückzuwerfen. In<br />
vielen Veranstaltungen auf Landes- und<br />
Bezirksebene zeigte sich wiederum, dass<br />
der Chorgesang in Südtirol einen wichtigen<br />
Stellenwert hat, die Vielfalt und die Schönheit<br />
des Chorgesangs, sowie die Begeisterung<br />
für das Lied haben viele hunderte,<br />
ja tausende Sänger/innen einem breiten<br />
Publikum nahegebracht.“<br />
Heuer ist alles anders, die Corona-Pandemie<br />
hat uns alle und ganz besonders auch<br />
das Chorleben schwer getroffen und mehr<br />
oder weniger die ganze Jahrestätigkeit des<br />
Verbandes und der Chorgemeinschaften<br />
lahmgelegt. Das gesamte Schulungsprogramm<br />
(mit Ausnahme des Workshops für<br />
Chorleiter/innen im September), die Jahreshauptversammlung<br />
im März und alle geplanten<br />
Veranstaltungen auf Bezirks- und<br />
Landesebene mussten abgesagt werden.<br />
Eine solche Krisensituation konnte sich<br />
vorher niemand von uns vorstellen. Die<br />
Chöre durften sich einige Monate nicht<br />
mehr zur Probe treffen, das geplante Konzert<br />
oder die festliche Mitgestaltung eines<br />
Gottesdienstes waren einfach nicht mehr<br />
möglich. Ab Ende Mai waren zwar Proben<br />
und Aufführungen wiederum zugelassen,<br />
allerdings aufgrund der Sicherheitsbestimmungen<br />
in ganz bescheidenem Maße. Es<br />
musste in Kleinstgruppen geprobt werden,<br />
das auch vom sozialen Gesichtspunkt so<br />
wichtige regelmäßige Zusammentreffen in<br />
der Chorgemeinschaft hat allen sehr gefehlt,<br />
aber es war ein Hoffnungsschimmer<br />
auf „bessere Zeiten“. Leider hat sich die<br />
Lage im Herbst wieder verschlechtert. Aufgrund<br />
der strengen, aber sicherlich notwendigen<br />
Vorschriften zur Eindämmung<br />
der Pandemie wurde jegliche Chortätigkeit<br />
untersagt. Die vielfache Befürchtung, dass<br />
diese neuerliche Pause negative Auswirkungen<br />
auf den Weiterbestand vieler Chöre<br />
haben könnte, ist nicht von der Hand zu<br />
weisen. Auf der anderen Seite aber gehört<br />
das Singen zur Natur des Menschen, Singen<br />
im Chor verbindet alle Gesellschaftsschichten,<br />
Bevölkerungsgruppen und Altersstufen,<br />
vermittelt vielseitige Geselligkeit<br />
und schenkt Geborgenheit.<br />
Immer wieder höre ich von vielen Sängerinnen<br />
und Sängern wie sehr sie sich<br />
auf die Zeit freuen, wo regelmäßige Chorarbeit,<br />
gemeinsames Singen, Zusammentreffen<br />
wieder möglich sein wird. Und dies<br />
gibt mir die Hoffnung, dass diese Abstinenz<br />
die Chorgemeinschaft zusätzlich<br />
fördert und das Zusammengehörigkeitsgefühl<br />
wachsen lässt. Liebe Chorverantwortliche,<br />
ihr gebt euch sehr viel Mühe,<br />
dass der Chorbetrieb - in welcher Form<br />
auch immer - aufrechterhalten bleibt. Eure<br />
großen Bemühungen und Anstrengungen<br />
tragen ganz wesentlich zum Weiterbestand<br />
unserer Chöre bei. Es ist mir ein persönliches<br />
Anliegen dafür jeder und jedem von<br />
Euch von ganzem Herzen zu danken und<br />
ich bitte alle Sänger/innen die Sache des<br />
Chorgesangs trotz widrigster Verhältnisse<br />
auch weiterhin mitzutragen.<br />
Liebe Obfrauen und Obmänner, Chorleiterinnen<br />
und Chorleiter, Sängerinnen<br />
und Sänger: „Leben kann man nur vorwärts“<br />
stellte einst der dänische Philosoph<br />
Søren Kierkegaard fest. Es ist der<br />
Blick nach vorne, der die Zukunft gestaltet.<br />
In der zuversichtlichen Hoffnung, dass<br />
wir alle gemeinsam baldmöglichst unsere<br />
Tätigkeit in der vertrauten Form wieder<br />
aufnehmen können, wünsche ich Euch<br />
allen im Namen des Vorstandes und Musikrates<br />
ein gesegnetes und besinnliches<br />
Weihnachtsfest, sowie Gottes Segen, Gesundheit<br />
und Wohlergehen für das kommende<br />
Jahr.<br />
Erich Deltedesco<br />
Obmann des Südtiroler Chorverbandes<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 3
Das Thema<br />
Brücken schlagen zwischen<br />
Menschen und Regionen<br />
Die AGACH als besonderes Beispiel des europäischen Gedankens<br />
Die Chorweihnacht der AGACH ist die wohl traditionsreichste Veranstaltung dieses Verbandes, hier im Bild die Chorweihnacht von<br />
2019 in Pfronten im Allgäu.<br />
Als vor nunmehr 41 Jahren die AGACH gegründet<br />
wurde, war dies zu einer Zeit, als<br />
der völkerverbindende Charakter der Europäischen<br />
Gemeinschaft langsam Konturen<br />
annahm.<br />
Die kulturelle, soziale aber auch ökonomische<br />
Eigenart der kleinen Räume, der<br />
Regionen in Europa kam zum Vorschein.<br />
Aus diesen Erwägungen schlossen sich<br />
im Jahre 1972 die Regionen des zentralen<br />
Alpenbogens zur ARGE-ALP (Arbeitsgemeinschaft<br />
Alpenländer) zusammen,<br />
um diesen ökologisch wie kulturell sensiblen<br />
Raum durch das politische Zusammenwirken<br />
der Regierungen behutsam in<br />
den großeuropäischen Bereich zu integrieren,<br />
ohne die durch Jahrhunderte gewachsene<br />
Lebensform zu gefährden, oder gar<br />
in Frage zu stellen. In diesem politischen<br />
Gedankenfeld fanden kulturelle Verantwortungsträger<br />
es an der Zeit, sich in ihrem<br />
Bereich für eine gemeinsame Strategie<br />
einzusetzen, im Hinblick auf Wahrung<br />
der Tradition, Überwindung von Gegensätzen<br />
durch Dialog und Entwicklung von<br />
Ideen. Man war überzeugt, dass das Zusammenwachsen<br />
der europäischen Völker<br />
nicht alleine nach den Regeln der<br />
Wirtschaft von statten gehen darf, sondern<br />
dass in kleinen Schritten auch die Kultur<br />
ihren Beitrag leisten soll und muss. Franz<br />
Elena, der Präsident des ehemaligen Tiroler<br />
Sängerbundes 1860, war es gewesen,<br />
der anlässlich eines Sängertreffens im<br />
Oktober 1973 in Kramsach die Idee aussprach,<br />
einen Zusammenschluss deutschsprachiger<br />
Bünde im Alpenland nach Art<br />
der politischen Arge-Alp für die Zukunft<br />
zu planen. Viele tastende Gespräche im<br />
kleinen Kreis führten 1977 zur Formulierung<br />
gemeinsamer Aufgaben und im August<br />
1978 reifte dann der Entschluss zur<br />
Gründung einer handlungs- und entscheidungsfähigen<br />
Arbeitsgemeinschaft. Mit der<br />
organisatorischen Vorbereitung und Erarbeitung<br />
einer Satzung wurde der Südtiroler<br />
Sängerbund mit seinem Obmann Siegfried<br />
Tappeiner betraut.<br />
Am 20. Jänner 1979 wurde dann im<br />
Sitzungssaal des Südtiroler Landtages „die<br />
Arbeitsgemeinschaft der Chorverbände im<br />
deutsch- und ladinischsprachigen Alpenbereich-<br />
AGACH“ (aus der Gründungsurkunde)<br />
gegründet, mit dem Ziel im Sinne<br />
der ARGE-ALP das eigene Kulturgut zu erhalten,<br />
zu pflegen und dessen Weiterentwicklung<br />
zu fördern. Gründungsmitglieder<br />
waren der Bayerische Sängerbund, der<br />
Fürstlich-Liechtensteinische Sängerbund,<br />
4<br />
KulturFenster
Chorwesen<br />
Siegfried Tappeiner, der<br />
Gründungspräsident der AGACH<br />
der Oberösterreichisch-Salzburgische Sängerbund,<br />
der Schwäbisch-Bayerische Sängerbund,<br />
der Südtiroler Sängerbund, der<br />
Tiroler Sängerbund 1860 und der Vorarlberger<br />
Sängerbund. Es war eine Sternstunde<br />
für Europa im Kleinen. Zum Gründungspräsidenten<br />
wurde Dr. Siegfried Tappeiner<br />
bestimmt. Mehr als dreißig Jahre lang befruchtete<br />
er als Präsident mit immer wieder<br />
neuen Ideen die Arbeitsgemeinschaft.<br />
Von Anfang an war es für ihn klar, dass es<br />
nicht nur eine Verbindung deutschsprachiger<br />
Chorverbände sein sollte, sondern<br />
eine Gemeinschaft, die auch Regionen anderer<br />
Sprachen im Alpenland einschließen<br />
sollte, also auch die italienischen und französischen<br />
Sprachgebiete und so kamen<br />
in den Folgejahren die Sängerbünde aus<br />
P. Urban Stillhard, künstlerischer Leiter<br />
der AGACH<br />
Aosta, aus Friaul, dem Trentino und Bozen<br />
(Federazione Cori dell’Alto Adige) dazu. Vor<br />
einigen Jahren wurden die Chorverbände<br />
aus Graubünden, Kärnten, Steiermark und<br />
Wallis aufgenommen, sodass mittlerweile<br />
16 Verbände mit insgesamt 4.775 Chören<br />
und 128.200 Sänger/innen aus Deutschland,<br />
Italien, Österreich und der Schweiz<br />
zur AGACH gehören. Im Moment gibt es<br />
keine Erweiterungstendenzen, die Arbeitsgemeinschaft<br />
soll nicht zu einem unübersichtlichen<br />
Gebilde werden, in dem sich der<br />
einzelne Verband nicht mehr wiederfindet.<br />
Von Anfang an war die AGACH als projektorientierte<br />
Arbeitsgemeinschaft konzipiert.<br />
Sie verbindet musikalisch aktive<br />
Menschen diesseits und jenseits des Alpenbogens<br />
über Sprachbarrieren und Staatenzugehörigkeit<br />
hinweg zu einer völkerverbindenden<br />
Gemeinschaft. Ziel und Zweck<br />
dieses Zusammenschlusses war der kulturelle<br />
Austausch der Chorverbände untereinander<br />
und das Bemühen um gemeinsame<br />
musikalische und fachspezifische<br />
Veranstaltungen. An dieser Zielsetzung hat<br />
sich bis heute nichts geändert, ja diese projektorientierte<br />
Zusammenarbeit ist mit der<br />
Zeit immer intensiver geworden. Im Laufe<br />
der Jahre wurden und werden regelmäßig<br />
überregionale Konzerte und Chöre-Festivals<br />
organisiert, Symposien abgehalten,<br />
Kompositionsaufträge vergeben, Uraufführungen<br />
auf die Bühne gebracht, Publikationen<br />
herausgegeben. Die AGACH ist ein<br />
loser Zusammenschluss von Chorverbänden<br />
des Alpenraumes. Bei allen Aktivitäten<br />
wird den kulturellen Eigenheiten der einzelnen<br />
Regionen viel Aufmerksamkeit gewidmet,<br />
die Eigenständigkeit und Entwicklung<br />
der Verbände bleiben unangetastet.<br />
Die Schwerpunkte sind also vielfältig. Einer<br />
davon, die wohl traditionsreichste Veranstaltung<br />
der AGACH, ist die Chorweihnacht,<br />
welche seit 1982 alljährlich von<br />
einem anderen Mitgliedsverband organisiert<br />
wird und auch heute noch immer zu<br />
einer der erfolgreichsten und populärsten<br />
Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft<br />
zählt. Ausschlaggebend dafür ist sicherlich<br />
die Öffnung des Literaturspektrums<br />
vom rein alpenländischen Volkslied hin<br />
zu einem etwas breiteren Programm mit<br />
Liedern und Komponisten, die weit über<br />
den Alpenbogen hinausgehen. Trotz dieser<br />
Öffnung hin zu einem zeitgemäßen Repertoire<br />
ist der regionale Charakter des Konzertes<br />
dennoch erhalten geblieben und<br />
nicht verloren gegangen.<br />
Zwei Mal jährlich treffen sich die Präsidenten<br />
und Delegierte der Mitgliedsverbände<br />
zum Gedankenaustausch und zur<br />
Erarbeitung der gemeinsamen Projekte.<br />
Organisiert und vorbereitet werden die Tagungen<br />
und Veranstaltungen abwechselnd<br />
von einem anderen Mitgliedsverband. Die<br />
Verständigungsbereitschaft ist trotz Sprachbarrieren<br />
sehr hoch, Sprachbarrieren waren<br />
und sind nie ein Hindernis. Um den<br />
Ablauf der Gespräche etwas flüssiger zu<br />
gestalten, wird seit einigen Jahren mit Simultanübersetzung<br />
gearbeitet. Der Sitz der<br />
AGACH ist seit der Gründung – nicht zuletzt<br />
wegen der Zweisprachigkeit – beim<br />
Südtiroler Chorverband angesiedelt. Mit<br />
Genugtuung kann ich heute feststellen:<br />
Erich Deltedesco ist Präsident der<br />
AGACH.<br />
die Prophezeiung des damaligen Landeshauptmannes<br />
von Südtirol Dr. Silvius Magnago<br />
im AGACH Gründungsjahr 1979 hat<br />
sich verwirklicht: aus der politischen Vision<br />
eines engen Zusammenwachsens der Bevölkerung<br />
des Alpengebietes ist eine geistige<br />
und kulturelle Einheit von singenden<br />
Menschen des Alpenbogens geworden. Die<br />
Arbeitsgemeinschaft Alpenländischer Chorverbände<br />
(AGACH) wird auch weiterhin an<br />
ihrem Ziel festhalten, Brücken zu schlagen<br />
zwischen Menschen verschiedener Weltanschauungen<br />
und verschiedener geistiger<br />
und sozialer Zugehörigkeit. Sie wird auch<br />
weiterhin Botschafter für länderübergreifendes<br />
Denken, Handeln und Fühlen im<br />
Alpenraum sein.<br />
Erich Deltedesco<br />
Präsident der AGACH<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 5
Aus Verband & Bezirken<br />
„Gerade jetzt brauchen<br />
wir Kultur!“<br />
Wehmut und Optimismus bei der Vollversammlung des Südtiroler Chorverbandes<br />
„Ich bitte euch, gerade in<br />
diesen schweren Zeiten in<br />
irgendeiner Weise allen zu<br />
zeigen, dass die Chöre noch<br />
da sind, denn gerade jetzt<br />
brauchen wir Kultur!“ Diese<br />
Worte richtete Landesrat Philipp<br />
Achammer an die Vertreter<br />
der Chöre des Südtiroler<br />
Chorverbandes, der am 28.<br />
Oktober seine Vollversammlung<br />
als Videokonferenz abhielt.<br />
Verbandsobmann Erich<br />
Deltedesco freute sich über<br />
die zahlreiche Teilnahme der<br />
Chorverteter an der virtuellen<br />
Sitzung. Auf dem Programm stand vor allem<br />
der Rückblick auf das Arbeitsjahr 2019, in<br />
dem der Chorverband noch sein reiches<br />
Programm anbieten konnte. Zugleich wurde<br />
auch mit Optimismus in die Zukunft geblickt.<br />
„Mit einer gewissen Wehmut“ blickte<br />
Geschäftsführer Dietmar Thanei auf das<br />
Tätigkeitsjahr 2019 zurück und erinnerte<br />
an die vielen Veranstaltungen, die momentan<br />
nicht mehr möglich sind: So hatte der<br />
Chorverband elf sehr gut besuchte mehrtägige<br />
Schulungen angeboten, darunter<br />
auch die beliebten Sommerkurse für Kinder<br />
und Jugendliche, die Kindersingwoche in<br />
Tisens, die Bubensingwoche und die Musicalwochen.<br />
Es habe auch viele „Augenblicke<br />
der Begegnung“ gegeben: Ein Höhepunkt<br />
war der Festakt zum 70-jährigen<br />
Bestehen des Chorverbandes gewesen,<br />
aber auch die Bezirkskonzerte, Kulturreisen<br />
und Chörefestivals in den Bezirken. Ein<br />
wichtiges Ereignis war das 7. Gesamttiroler<br />
Wertungssingen in Auer gewesen, an dem<br />
sich das „hohe Niveau“ der Gesamttiroler<br />
Chor- und Gesangskultur gezeigt habe. Mit<br />
dem Schulamt führte der Südtiroler Chorverband<br />
zum 18. Mal das Projekt „klang“<br />
durch, das das Singen in der Grundschule<br />
fördern will. Der Landesjugendchor Südtirol<br />
hatte sich zu neun Proben versammelt<br />
und drei gut besuchte Konzerte gegeben.<br />
Landesrat Philipp Achammer war<br />
Gast bei der Vollversammlung des<br />
Südtiroler Chorverbandes.<br />
Thanei bedankte sich bei den Partnerverbänden<br />
für die gute Zusammenarbeit: „Gerade<br />
in dieser Zeit ist es wichtig die Kräfte<br />
zu bündeln!“ „Versuchen wir zuversichtlich<br />
nach vorne zu schauen!“, sagte Verbandschorleiterin<br />
Renate Unterthiner in<br />
ihrem Ausblick auf die musikalische Tätig-<br />
Auch für Helga Huber, dem „guten<br />
Geist“ der Geschäftsstelle, war<br />
die Vollversammlung <strong>2020</strong> eine<br />
außergewöhnliche und neue Situation.<br />
keit der Chöre und des Chorverbands.<br />
So gab sie gleich das<br />
Wort einer Kindersinggruppe,<br />
die „Let´s say Hello“ für alle Sitzungsteilnehmer<br />
sang. „Singen<br />
macht Mut“, sagte die<br />
Verbandschorleiterin. In diesem<br />
Sinne werden auch unter<br />
schwierigen Bedingungen<br />
Projekte geplant. So gelang<br />
es einen Lehrgang für Chorleiterausbildung<br />
an einigen<br />
Musikschulen einzurichten.<br />
In Brixen und Auer besuchen<br />
ihn vier Personen, in Naturns<br />
läuft der Lehrgang schon das<br />
zweite Jahr, in Bruneck startet er <strong>2020</strong>/21.<br />
„Motiviert eure Sängerinnen und Sänger ,<br />
an diesem Lehrgang teilzunehmen!“, sagte<br />
Unterthiner. Ein wichtiges Projekt sei auch<br />
der „Landeskinderchor“ für Kinder von<br />
8-11 Jahren und der „Landesjuniorchor“<br />
für Jugendliche von 12-16 Jahren. Hier soll<br />
gesangsfreudigen und begabten Kindern<br />
die Möglichkeit geboten werden, mit anderen<br />
Kindern zu singen. Die Chöre wird<br />
es in allen drei Landesteilen geben, sie<br />
werden zwei Probetage und ein gemeinsames<br />
Konzert absolvieren. Aufgrund der<br />
momentanen Situation wird man vielleicht<br />
im Frühjahr mit dem Vorsingen und den<br />
Proben beginnen. Der dritte Schwerpunkt<br />
des Chorverbandes im musikalischen Bereich<br />
ist das „Singende Klassenzimmer“,<br />
das in Zusammenarbeit mit den Schulen<br />
das Singen in der Schule fördern soll. Das<br />
Projekt wurde vorerst auf nächstes Jahr<br />
verschoben.<br />
Verbandsobmann Erich Deltedesco<br />
dankte allen ehrenamtlichen Mitarbeitern<br />
im Verband und im Vorstand für ihren<br />
Einsatz. Sein Dank galt auch allen Sponsoren,<br />
allen voran der Südtiroler Landesregierung.<br />
Als deren Vertreter rief Landesrat<br />
Philipp Achammer die Chöre auf, optimistisch<br />
zu bleiben, die Moral hochzuhalten,<br />
aber auch die Regeln immer einzuhalten.<br />
6<br />
KulturFenster
Chorwesen<br />
Eine bereichernde Fortbildung<br />
Dirigenten-Workshop mit Jan Scheerer<br />
Chorsingen? - oder doch lieber<br />
gleich Bungee-Springen? Das ist<br />
auch nicht gefährlicher! Gemeinsames<br />
Singen gilt seit der Pandemie<br />
als ein gefährliches Hobby,<br />
dabei ist es doch so viel mehr:<br />
Musik, Gemeinschaft, Ritual und<br />
Können. Aber viele sind verunsichert:<br />
Wie können, wie dürfen, wie<br />
sollen wir im Herbst wieder proben<br />
ohne ein Sicherheitsrisiko<br />
entstehen zu lassen?<br />
Umso wichtiger war jetzt<br />
zu diesem Zeitpunkt die<br />
– ich sage es gleich vorneweg<br />
– gewaltig schöne<br />
Fortbildung für Chor-Dirigenten<br />
mit Jan Scheerer.<br />
Jan Scheerer ist bestens<br />
bekannt aus Dietenheim,<br />
wo er drei Sommer lang<br />
unterrichtete. Inzwischen<br />
ist er Professor an der Musikhochschule<br />
in Leipzig.<br />
Eine einzigartige Gelegenheit<br />
für die Südtiroler Chordirigenten<br />
in diesem Jahr,<br />
dieses Wochenende im September<br />
mit ihm genießen zu<br />
können. Wie soll das gehen,<br />
fragten sich einige im Vorfeld,<br />
mit Chor im Kolpinghaus? Aber<br />
fangen wir am Anfang an: „Was<br />
wollt Ihr am Sonntag gelernt haben“,<br />
fragte Jan Scherer die Teilnehmer,<br />
, und da kamen schon<br />
die ersten Fachfragen: Wie kann<br />
ich den Chor motivieren, gut zu<br />
starten? Was kann ich tun, damit<br />
der Chor intoniert bleibt? Welches<br />
Repertoire eignet sich für welchen<br />
Chor? Welche Atemübungen sind<br />
für Chöre geeignet? Wie vermittle<br />
ich den Atem?!<br />
Die Nullposition! Gleich nach<br />
der kurzen Vorstellungsrunde geht<br />
es los. Alle stehen auf Anfang.<br />
Aus der Stille entsteht die Musik!<br />
Ich stehe still, gebe die Töne,<br />
versenke mich in die Stimmung<br />
und bleibe kurz stehen und dann<br />
erst kommt der Impuls. Immer<br />
wieder in den kommenden drei<br />
Tagen erinnert uns Jan Scheerer<br />
an diese wichtigen Sekunden vor<br />
jedem Dirigat. Und dann kommt<br />
sie schon, die „Wurf-Fall“ Bewegung.<br />
Aus der Nullposition schießt<br />
„eine kleine Rakete aus dem kleinen<br />
Finger“ und zieht die Hände<br />
impulsartig nach vorne, bevor sie<br />
in die Gravitationsbewegung nach<br />
unten fallen. Gar nicht so leicht,<br />
diese kleine Übung, Wurf-Fall,<br />
nicht stehenbleiben… wirklich Fallenlassen!<br />
Und hier liegt schon eines der<br />
echten Dirigier-Geheimnisse, die Jan<br />
uns an diesem Wochenende wieder<br />
und wieder verriet. Nur der Impuls<br />
nach vorne vermittelt den Sängern<br />
den Atemimpuls! Frontal vermitteln<br />
wir Dirigenten den Atemimpuls,<br />
horizontal das Timing. Auch<br />
wer das schon mal wusste, wird es<br />
immer wieder gern trainieren,<br />
denn jetzt geht es weiter - Was<br />
deine Oberarme machen - das<br />
wird direkt dem Zwerchfell des<br />
Sängers vermittelt. Wie sehr wir<br />
nicht nur den Ausdruck sondern<br />
den Chorklang selbst formen<br />
können, das ist auch mir neu.<br />
Wie wir allein durch die Handstellung<br />
Einfluss auf den Klang<br />
nehmen, bekamen wir anschließend<br />
vom Chor selbst zu hören.<br />
Ob eine Gruppe „drückt“ oder<br />
nicht, lässt sich mit der Handstellung<br />
manipulieren.<br />
Und damit kommen wir zur<br />
Frage der Intonation. Aber zurück<br />
zur ersten Stunde mit Jan:<br />
Einführung, Trockenübungen<br />
Der Workshop mit Jan<br />
Scheerer war die einzige<br />
Schulung, die heuer<br />
stattfinden konnte.<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 7
Aus Verband und Bezirken<br />
mit Basics. Schneller werden heißt kleiner<br />
werden, langsamer bedeutet größer<br />
werden. Leise wird es kleiner nach oben,<br />
lauter breiter nach unten. Das wussten<br />
wir schon, aber wie dirigiert man im "flüssigen<br />
Honig"? Und genau darin liegt eines<br />
der Geheimnisse , die ein Ensemble sofort<br />
spürt. Und was für ein Ensemble!<br />
Und was für ein Ensemble! Der Kammerchor<br />
des professionellen Chors „Alla-<br />
Breve“ aus Wolkenstein stellte sich dankenswerter<br />
Weise zur Verfügung. Sie<br />
intonierten die ersten Takte „Waldesnacht“<br />
von Brahms, morgens um halb<br />
neun Uhr, blitzsauber intoniert und innig<br />
und schon standen einigen von uns<br />
die Tränen in den Augen. Was wir nicht<br />
wussten: Auch dieses Ensemble sah sich<br />
nach der langen Corona-Pause zum ersten<br />
Mal wieder. „Waldesnacht, Du wunderkühle“,<br />
noch nie habe ich es so schön,<br />
so tief empfunden, so wohlartikuliert gehört.<br />
Zum ersten Mal wieder Chor live!<br />
Das Ensemble „AllaBreve“ bewegte und<br />
ermöglichte durch seine Professionalität,<br />
dass die Dirigenten auch wirklich lernten,<br />
was eine Geste bewirken kann, oder eben<br />
auch nicht. Und das unter erschwerten<br />
Umständen. Viele Chöre beginnen jetzt<br />
erst unter diesen schwierigen Umständen<br />
Wege zu finden, wie sie proben und<br />
konzertieren können.<br />
Die Sitze im Kolpinghaus waren mit Distanz<br />
gestellt, mit einem Mindestabstand<br />
1,5 Meter. Trotz der Aufstellung klang es<br />
einheitlich. „Anders“, sagte eine Chorsängerin,<br />
fühle man sich. „Es genügt nicht<br />
nur, gut hinzuhören und sich auch auf<br />
den Nachbarn einzulassen. Es fühlt sichsich<br />
an, als ob man stattdessen Flügel<br />
hätte. So auf Distanz im Chor zu singen<br />
benötigt ganz andere Antennen, neue<br />
Wahrnehmungsorgane…“. Die werden<br />
wir alle in den kommenden Monaten entwickeln<br />
müssen.<br />
Die Autorin des Artikels, Friederike<br />
Haupt, leitet die GospelCantorei Meran,<br />
ist Stimmbildnerin für „Edu Voce<br />
mit Qi Gong“ und als Musikjournalistin<br />
und Sprecherin tätig.<br />
Parallel zum Masterkurs gab es die Möglichkeit, bei Martha Basten<br />
einen Kurs für Anfänger und leicht Fortgeschrittene zu belegen.<br />
KulturFenster<br />
Redaktion KulturFenster<br />
Ihre Beiträge für das Chorwesen senden Sie bitte an: info@scv.bz.it (Südtiroler Chorverband)<br />
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des KulturFensters ist Mittwoch 13. Jänner <strong>2020</strong>.<br />
8<br />
KulturFenster
Chorwesen<br />
„Singen isch inser Lebm“<br />
Ein Lied zum Jahreswechsel<br />
Geschätzte Chorleiterinnen<br />
und Chorleiter,<br />
liebe Sängerinnen und<br />
Sänger!<br />
Ein verrücktes, schwieriges,<br />
fragwürdiges, unerwartetes<br />
und oft auch trauriges Jahr neigt<br />
sich nun bald dem Ende zu. Wer hätte sich<br />
am Anfang dieses Jahres gedacht, dass wir<br />
an so vielen Festtagen, an verschiedenen<br />
Konzerten oder sonstigen Auftritten, unsere<br />
Stimmen nicht erklingen lassen können?<br />
Wer hätte gedacht, dass wir kurz vor Weihnachten<br />
noch nicht genau wissen, ob und<br />
in welcher Chorformation wir singen werden?<br />
Wer hätte gedacht, dass ein Virus die<br />
ganze Welt auf den Kopf stellt und die Kultur<br />
weitestgehend zum Stillstand bringt?<br />
Ich denke, niemand…<br />
Wenn wir nun das Jahr <strong>2020</strong> hinter uns<br />
lassen, hoffen wir natürlich alle auf fröhliche<br />
und sorglose Momente im Jahr 2021,<br />
wo wir hoffentlich wieder gemeinsam musizieren,<br />
lachen und tanzen können. Blicken<br />
wir optimistisch in die Zukunft und<br />
freuen wir uns auf das gemeinsame Singen,<br />
denn: „Singen isch inser Lebm, hot<br />
do Herrgott ins gebm, wisset net wos i tät,<br />
wenn i`s Singen net hätt.“<br />
Mit diesem wunderschönen Lied aus<br />
dem Chorheft mit dem Titel, "Seltenheimer<br />
Lieder", bei dem vor allem die Musiklehrerin<br />
und Chorleiterin Renate Altmann mitgewirkt<br />
hat, wünsche ich Euch von Herzen<br />
eine besinnliche Zeit und alles erdenklich<br />
Gute für das Jahr 2021.<br />
Verbandschorleiterin<br />
Renate Unterthiner<br />
Zur Person<br />
Renate Altmann stammt aus einer musikalischen Reichenauer Familie aus<br />
Kärnten. Es wurde schon seit frühester Kindheit mit der Familienmusik Rossmann<br />
musiziert und gesungen.<br />
Ihr Studium am Kärntner Landeskonservatorium beendete sie mit Auszeichnung<br />
(Instrumentalpädagogik und Chorleitung). Sie nahm an Forschungswochen des<br />
Kärntner Volksliedwerkes teil, bei denen es um die Aufsammlung alten Kulturgutes<br />
ging. Das Liedheft "Geah nar eina in Rosengarten" mit dem Gurktaler Viergesang<br />
stammt aus dieser Zeit. In weiterer Folge sind auch andere Publikationen<br />
von Liedheften, Hackbrettschule, Harfenschule und Ensemblehefte entstanden.<br />
Sie unterrichtet in den Musikschulen Feldkirchen und Althofen die Fächer Hackbrett<br />
sowie Harfe. Musik ist ihre große Leidenschaft. So übernahm sie bereits<br />
mit 23 Jahren in ihrer Heimatgemeinde den Singkreis Reichenau und gab dort<br />
18 Jahre lang den Ton an. 1990 wurde der Gurktaler Viergesang gegründet und<br />
seit 2004 singt sie beim Singkreis Klagenfurt Seltenheim mit, wo unter ihrer Mitarbeit<br />
das Chorheft mit dem Titel "Seltenheimer Lieder" entstanden ist, das unter<br />
anderem auch das Lied „Singan is unser Lebm“ beinhaltet.<br />
"Musiklehrerin und Chorleiterin zu sein bedeutet für mich persönlich: Liebe zur<br />
Musik und zum Chorgesang, Leidenschaft, Gemeinschaft, Gefühl, Kraft, Freiheit,<br />
Emotion, Balsam für Herz und Seele."<br />
Alle Informationen zu den Veranstaltungen und Schulungen des Südtiroler Chorverbands<br />
auf www.scv.bz.it und auf Facebook!<br />
Dominikanerplatz 7, I-39100 Bozen<br />
Tel.: 0471 971833<br />
E-Mail: info@scv.bz.it<br />
www.scv.bz.it<br />
facebook.com/SuedtirolerChorverband<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 9
Aus Verband und Bezirken<br />
10<br />
KulturFenster
Chorwesen<br />
Ein wichtiger Startschuss<br />
in die Zukunft<br />
Kirchenchor Vahrn gründet einen Kinder- und Jugendchor<br />
Der Kirchenchor Vahrn gründete einen Kinder- und Jugendchor.<br />
Ein wichtiger Schritt in die Zukunft ist dem<br />
Kirchenchor Vahrn gelungen. Schon seit längerer<br />
Zeit beschäftigt sich der Ausschuss<br />
mit dem Thema „Zukunft und Weiterentwicklung<br />
des Chores“.<br />
In diesem Zusammenhang entstand die<br />
Idee eines Kinder- und Jugendchores, die<br />
sofort von den Ausschussmitgliedern befürwortet<br />
und mitgetragen wurde. Als Chorleiter<br />
konnte der allseits bekannte Musikprofessor<br />
Rudi Chizzali gewonnen werden.<br />
So gab es im Februar den Startschuss zur<br />
Gründung des Kinder- und Jugendchores<br />
mit dem Hintergrund, den Kindern des<br />
Dorfes die Musik und vor allem die Freude<br />
am Singen näher zu bringen.<br />
Auf Anhieb meldeten sich 14 Kinder.<br />
Die ersten Termine waren bereits vereinbart,<br />
doch mussten die Proben aufgrund<br />
der Corona- Pandemie abgesagt werden.<br />
Im August <strong>2020</strong> war es dann endlich so-<br />
weit: Unter strenger Einhaltung der Sicherheitsregeln<br />
konnte der neue Chor mit der<br />
Probentätigkeit beginnen.<br />
Der Obmann des Kirchenchors Vahrn,<br />
Michael Baur, freut sich über den Erfolg<br />
des Projekts: „Auf erfrischend spielerische<br />
und dynamische Weise gelingt es<br />
dem Chorleiter, den Kindern die Musik zu<br />
vermitteln, alle Beteiligten haben sichtlich<br />
großen Spaß!“ Die Proben werden vom<br />
Chorleiter sowie von Pius Leitner, Mitglied<br />
des Kirchenchores und Pate des Kinderund<br />
Jugendchores und von Obmann Michael<br />
Baur begleitet. Einige Auftritte standen<br />
bereits auf dem Programm, mussten<br />
aber aufgrund der erneut steigenden Infektionszahlen<br />
abgesagt werden. „Wir hoffen,<br />
dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren<br />
und die Probentätigkeit planmäßig<br />
weiterführen können“, betont der Obmann.<br />
Jedenfalls ist ein erster wichtiger Schritt für<br />
die Zeit nach Corona gesetzt.<br />
„Auf erfrischend spielerische und dynamische Weise<br />
gelingt es dem Chorleiter, den Kindern die Musik zu<br />
vermitteln, alle Beteiligten haben sichtlich großen Spaß!“<br />
(Michael Baur)<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 11
Aus Verband und Bezirken<br />
„Ihre Begeisterung ist uns<br />
Vorbild“<br />
Vorstandsmitglied Irene Vieider bekam die höchste Tiroler Auszeichnung<br />
Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landeshauptmann Günther Platter<br />
verliehen das Ehrenzeichen des Landes Tirol an Irene Vieider.<br />
Am Ende des Jahres blickt man zurück: Neben<br />
der alles bestimmenden Corona-Pandemie<br />
gab es auch einige erfreuliche Ereignisse,<br />
an die man sich jetzt zum Jahresende<br />
erinnern sollte.<br />
Dazu gehört sicher auch die Verleihung<br />
des Ehrenzeichens des Landes Tirol an Irene<br />
Vieider, die als Vorstandsmitglied des Südtiroler<br />
Chorverbandes für den Bereich Kinder<br />
und Schule zuständig ist – waren diese<br />
Bereiche doch lange Zeit ihr beruflicher Lebensinhalt.<br />
Irene Vieider, geboren 1955 in<br />
Tiers, war langjährige Schuldirektorin der<br />
Mittelschulen Blumau und Kastelruth. Außerdem<br />
stand sie für viele Jahre als Landesmusikschuldirektorin<br />
dem Bildungsund<br />
Kulturwesen in Südtirol vor. Seit 2016<br />
ist Vieider ehrenamtlich als Vorsitzende der<br />
Katholischen Frauenbewegung der Diözese<br />
Bozen-Brixen tätig. Ihr Engagement gilt den<br />
Frauen in der Kirche und in der Gesellschaft,<br />
aber auch der Chorkultur und der<br />
Förderung des Chorgesangs im Kindesalter.<br />
Die Landeshauptleute von Tirol und<br />
Südtirol. Günther Platter und Arno Kompatscher,<br />
haben Irene Vieider am 20. Februar<br />
das Ehrenzeichen verliehen. Das<br />
Ehrenzeichen des Landes ist die höchste<br />
Tiroler Auszeichnung. Landeshauptmann<br />
Arno Kompatscher dankte den bei dieser<br />
grenzüberschreitenden Veranstaltung ausgezeichneten<br />
vier Frauen und sechs Männern:<br />
"Die Geehrten geben als verdiente<br />
Persönlichkeiten uns und den folgenden<br />
Generationen ein Beispiel. Ihr Engagement<br />
für das Gemeinwohl, für die Kultur<br />
und Tradition sowie ihr stetiger Einsatz für<br />
unsere vereinenden Werte und Ihre aktive<br />
Hilfeleistung für die Schwächeren unserer<br />
Gesellschaft stiften Gemeinschaft und Zusammenhalt."<br />
Tirols Landeshauptmann<br />
Günther Platter sagte: "Diese höchste<br />
Auszeichnung des Landes ist jenen vorbehalten,<br />
die sich durch ihr hervorragendes<br />
Wirken ganz besondere Verdienste um Tirol<br />
erworben haben. Wo immer jede und<br />
jeder einzelne von Ihnen tätig war, ob in<br />
der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur,<br />
der Musik oder im kirchlichen Bereich,<br />
sie alle haben Tirol entscheidend weiterentwickelt<br />
und vorangebracht. Die mit Ihrem<br />
Wirken verbundene, so deutlich spürbare<br />
Begeisterung ist uns Vorbild. Für Ihren persönlichen<br />
Beitrag zu unserer lebenswerten<br />
Heimat und Ihr verantwortungsvolles Handeln<br />
gegenüber der nächsten Generation<br />
bedanke ich mich sehr herzlich."<br />
12<br />
KulturFenster
Chorwesen<br />
•Büchertisch•<br />
Franz Welser-Möst<br />
Als ich die Stille fand<br />
Ein Plädoyer gegen den Lärm der Welt<br />
Die Stille als Schlüssel unserer Welt: Ein<br />
leidenschaftliches Plädoyer des gefeierten<br />
Dirigenten für genaueres Zuhören,<br />
Konzentration und Ruhe in einer<br />
sich immer schneller drehenden Zeit.<br />
Bei einem schweren Autounfall erlebte<br />
Franz Welser-Möst als Jugendlicher<br />
den Klang der Ewigkeit: ein Zustand,<br />
den er seither in der Musik sucht.<br />
Welser-Möst nimmt uns mit auf eine<br />
Reise durch sein Leben in der Musik:<br />
von seiner Jugend in Oberösterreich<br />
über seine Begegnungen mit Herbert<br />
von Karajan bis hin zu den Engagements<br />
in London, Zürich, an der<br />
Wiener Staatsoper und beim weltberühmten<br />
Cleveland Orchestra. Machtspiele<br />
hinter den Kulissen und Gedanken<br />
über den modernen Musikmarkt<br />
bleiben nicht ausgespart.<br />
Wie Musik uns hilft, unsere<br />
Welt auch in Momenten der<br />
Krise zu ordnen<br />
Vor allem aber erzählt er vom Sichimmer-wieder-Neuerfinden,<br />
von Musik<br />
als Impuls für soziale Fragen und<br />
als Hilfe, unsere chaotische Welt zu<br />
ordnen. Sein Dirigentenleben ist eine<br />
Inspiration: Hören wir besser auf unsere<br />
Welt, um sie zu verstehen und<br />
mit Leidenschaft zu beleben.<br />
Franz Welser-Möst<br />
Als ich die Stille fand<br />
Ein Plädoyer gegen den Lärm der Welt<br />
Format 13,5 x 21 cm, 192 Seiten, ca.<br />
20 Abbildungen Hardcover mit Schutzumschlag,<br />
22,00 Euro<br />
Pressekontakt:<br />
Friederike Harr & Anna Klaus<br />
presse@brandstaetterverlag.com<br />
T +43-(0)1-5121543-252<br />
F +43-(0)1-5121543-231<br />
Der Autor:<br />
Franz Welser-Möst prägt als Musikdirektor des Cleveland Orchestra die unverwechselbare<br />
Klangkultur des großen Orchesters. Als Gastdirigent verbindet<br />
ihn eine enge Partnerschaft mit den Wiener Philharmonikern. Er stand<br />
zwei Mal am Pult des Neujahrskonzerts. Bei den Salzburger Festspielen ist er<br />
regelmäßig Gast. Für sein Wirken erhielt der Dirigent bedeutende Ehrungen,<br />
seine CD- und DVD-Aufnahmen wurden vielfach ausgezeichnet.<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 13
Das Thema<br />
Das Feuilleton und<br />
die Blasmusik<br />
Eine Spurensuche von Bernd Neuschl<br />
Dieser Beitrag wurde bereits in der ehemaligen<br />
Bläserzeitschrift „eurowinds“ veröffentlicht<br />
und freundlicherweise vom Verlag<br />
für den Nachdruck im KulturFenster<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Die Berichterstattung über Blasmusik ruft<br />
des Öfteren Kopfschütteln hervor, fundierte<br />
Musikkritiken sind dagegen die Ausnahme.<br />
Warum ist das so? Und was können wir besser<br />
machen?<br />
Es gibt den Profifußballer und den Bolzplatzkicker.<br />
Auch wenn der Vergleich hinkt:<br />
Blasmusiker lassen sich in zwei ähnliche<br />
Lager einteilen. Auf der einen Seite agieren<br />
die professionellen Berufsblasorchester<br />
und exzellent verästelten Auswahlensembles,<br />
auf der anderen Seite erden<br />
ambitionierte Amateurmusiker in den traditionell<br />
verwurzelten Musikvereinen den<br />
Stamm des kulturellen Miteinanders. Beide<br />
Seiten dieser Medaille spiegeln sich auch<br />
in der Presse wider: Hier publiziert das<br />
Feuilleton mit seinen Fachleuten, welche<br />
selten bis gar nicht ein Sinfonisches Blasorchester<br />
besprechen, da gibt es die Lokalpresse,<br />
die eher freie Mitarbeiter denn<br />
Redaktionsmitglieder zu den Musikvereinen<br />
schickt. Fundierte Musikkritiken sind<br />
rar, denn der kompetente Konzertbericht<br />
hängt in seiner Qualität maßgeblich vom<br />
Wissen und Stil seines Verfassers ab.<br />
Auch wenn Laien an den Konzertpulten<br />
musizieren, die Berichterstattung darf niemals<br />
laienhaft sein. Ob Profibläser oder Laienmusiker:<br />
Positive Pressestimmen sind<br />
mehr als ein bunt beflügelnder Federschmuck<br />
für einen fruchtbaren Balztanz<br />
in Sachen Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Die Präsenz und die Rolle der Musikkritik<br />
in der Blasmusik wird seit jeher diskutiert,<br />
sind in der Szene jenseits von Fachzeitschriften<br />
doch nur wenige fundierte<br />
Rezensionen zu finden.<br />
Es soll kein Vorwurf sein, aber oftmals<br />
hat dieser rasende Reporter vom musikalischen<br />
Tuten und Blasen keine Ahnung.<br />
Der Bericht gleicht in der Konsequenz<br />
einem paraphrasierten Programmblatt<br />
mit obligatorisch abgehakten W-Fragen.<br />
Die Enttäuschung bei den Interpreten ist<br />
damit vorprogrammiert, beim Aufschlagen<br />
der Zeitung trötet ihnen trübsinniges Moll<br />
statt strahlendem Dur entgegen – das ist<br />
alles andere, als eine Würdigung der mühevollen<br />
Probenarbeit und der gelungenen<br />
Darbietung. Andere Berichte balancieren<br />
dagegen zwischen verklärter Lobhudelei<br />
und zünftigem Verriss. Es muss leider<br />
festgehalten werden: Hochwertige Rezensionen<br />
wie sie im Feuilleton erscheinen,<br />
sind in der Bläsersinfonik so gut wie nicht<br />
zu finden. Drei Gründe haben die Orchester<br />
selbst zu verantworten. Eine provokante,<br />
streitbare Spurensuche:<br />
Reputation von Blasorchester<br />
und Repertoire<br />
Sinfonieorchester und ihre Dirigenten genießen<br />
mit ihrem Repertoire immer noch<br />
eine weitaus höhere Reputation bei Zuhörern<br />
und Zeitungen, als jedes noch so<br />
gute Blasorchester. Die Konzertprogramme<br />
der Top-Orchester decken alle Epochen<br />
der Musikgeschichte ab und greifen auf<br />
eine Fülle hochwertiger Werke, Solisten<br />
und Dirigenten zurück. Hier fehlt der geteilten<br />
und vergleichsweisen jungen, wilden<br />
Bläserwelt jenseits von Transkriptionen<br />
ein verbindlicher, konventionalisierter<br />
14<br />
KulturFenster
Blasmusik<br />
Kanon an identitätsstiftenden, etablierten<br />
Meisterwerken mit hohem Wiedererkennungswert,<br />
der auch im Studium für angehende<br />
Musikjournalisten oder Musikwissenschaftler<br />
gelehrt wird. Zum Beweis<br />
ein Selbstversuch: Fragen Sie klassische<br />
Dirigenten nach den wichtigsten Komponisten<br />
der Musikgeschichte, so wird sich<br />
eine große Schnittmenge ergeben. Fragen<br />
Sie dagegen Kapellmeister nach den<br />
bedeutendsten Komponisten für Blasorchester,<br />
können Sie gleich im Blasorchesterlexikon<br />
schmökern. Es mangelt nicht<br />
wenigen Dirigenten an der Basis an Selbstbewusstsein,<br />
sich von strohfeurigen Verlagsdiktaten<br />
loszulösen, um genau das in<br />
den Mittelpunkt zu stellen, was wirklich<br />
zählt: qualitativ hochwertige Musik.<br />
Die Kritikfähigkeit von<br />
Laienblasorchestern<br />
Max Reger konnte nicht sonderlich gut mit<br />
Kritik umgehen. An einen Kritiker soll er<br />
geschrieben haben: „Ich sitze im kleinsten<br />
Raum des Hauses. Ihre Kritik habe<br />
ich vor mir. Bald werde ich sie hinter mir<br />
haben.“ Wer nur Jubelhymnen erwartet,<br />
ist als Künstler nicht glaubwürdig. Das gilt<br />
besonders für ambitionierte Blasorchester.<br />
Nun ist ein Konzert kein Wettbewerb, der<br />
Kritiker kein Juror. Dennoch: Wer ein professionelles<br />
wie faires Feedback bekommen<br />
möchte, muss sich auch professionelleren<br />
Maßstäben stellen.<br />
Lobhudelei um des Burgfriedens willens<br />
ist weder angebracht noch zielführend,<br />
sondern gefährlich. Beschönigende, inhaltlich<br />
falsche Berichte mögen oberflächlich<br />
glänzen, haben aber den Wert einer<br />
Rolex-Uhr vom Strandverkäufer. Gleiches<br />
gilt für Verrisse: Ein kompetenter Kritiker<br />
darf sich nicht nur die faulen Kirschen aus<br />
dem Konzert herauspicken. Tadel muss angebracht<br />
und in homöopathischer Dosierung<br />
verabreicht werden. Das motivierende<br />
Lob für ehrenamtliche Kulturarbeit sollte<br />
dagegen selbstverständlich überwiegen.<br />
Der Weltklasse-Violinist Daniel Hope<br />
meinte zum Thema Kritikfähigkeit: „Eine<br />
schlechte Kritik, wenn sie kenntnisreich<br />
und fundiert ist, kann einem Künstler helfen<br />
und ihn weiterbringen.“ Joachim Kaiser,<br />
eine Ikone der Kritikerzunft, meint zu<br />
der Rolle des Rezensenten: „Nicht der subjektive<br />
Kritiker, der seine persönlichen Eindrücke<br />
entfaltet, ist gefährlich oder verwerflich.<br />
Der voreingenommene Rezensent ist<br />
„Auch wenn Laien an den Konzertpulten musizieren,<br />
die Berichterstattung darf niemals laienhaft sein.“<br />
es viel eher, der nur das wahrnimmt, was<br />
er aus taktischen oder persönlichen oder<br />
ideologischen Gründen wahrnehmen will.“<br />
Die Kritikfähigkeit der Musikvereine steigt<br />
folglich mit der Bereitschaft des Kritikers,<br />
seine Vorurteile gegenüber dem Blasorchesters<br />
abzubauen.<br />
Die Grenzen der Qualität<br />
Es gibt sie, die hervorragenden Blasorchester:<br />
Musikkorps, Auswahlorchester, Verbandsorchester<br />
und exzellente Vereinsorchester.<br />
Von denen soll jetzt auch nicht<br />
die Rede sein, fi nden sie in den Musikmedien<br />
doch mehr und mehr die Beachtung,<br />
die sie sich verdient und hart erarbeitet<br />
haben. So war das Neujahrskonzert<br />
2013 der Bläserphilharmonie Mozarteum<br />
Salzburg unter Hansjörg Angerer, das live<br />
im Fernsehen übertragen wurde, eine erleuchtende<br />
Sternstunde im Bläserkosmos.<br />
Es geht vielmehr um die breite Masse der<br />
Musikvereine. Ein Redakteur des Südwestrundfunks<br />
(SWR) meinte einmal auf meine<br />
Frage, warum sich Blasorchester so selten<br />
live im Radio oder Fernsehen präsentieren,<br />
dass die Qualität der Vereine den<br />
Ansprüchen der Medien nicht immer gerecht<br />
wird. Viele Kapellen meinen, allein<br />
die Wahl eines schweren Werkes rechtfertige<br />
die gewünschte Medienpräsenz und<br />
ein positiv schallendes Echo in der Presse.<br />
Es gibt sie, aber wir brauchen<br />
mehr davon<br />
Wollen Blasorchester von den Medien ernst<br />
genommen werden, müssen also die Basics<br />
stimmen: Lieber ein leichteres Stück,<br />
und das sauber geblasen. Der Mangel an<br />
Reputation und renommiertem Repertoire,<br />
(Bernd Neuschl)<br />
Verlagsdiktate und das vielzitierte Festzelt-Stigma<br />
haben dazu geführt, dass die<br />
überwiegende Mehrheit der Musikjournalisten<br />
leider immer noch kultiviert die Nase<br />
rümpft, steht ein Blasorchester zur Besprechung<br />
an. Das traurige Fazit lautet also:<br />
Selbst ein gut ausgebildeter C3-Karajan<br />
kann in einer Behelfsphilharmonie unter<br />
Basketballkörben noch kein Hoch-Feuilleton<br />
erwarten. Das ist aber kein Status Quo.<br />
Denn daneben gibt es erfreulicherweise etablierte<br />
Vereine und Auswahlorchester, die<br />
mit ihren professionell ausgebildeten Dirigenten<br />
und einem modernen Vereinsmanagement<br />
konsequent auf konstant wachsende<br />
Qualität setzen. Sowohl im Konzert<br />
als auch in der Nachbesprechung. Es gibt<br />
sie, die gelungenen Konzertberichte, aber<br />
wir brauchen noch mehr davon.<br />
Was ein qualifizierter<br />
Konzertbericht leistet<br />
Die meisten Berichterstatter können nur<br />
über das schreiben, was sie kennen. Und<br />
bereits nach wenigen Sätzen merkt der<br />
aufmerksame Leser, ob ein Konzertbericht<br />
aus berufener Feder geflossen ist. Der<br />
Dirigent Leopold Stokowski sagte hierzu:<br />
„Am gefährlichsten sind jene Kritiker, die<br />
von der Sache nichts verstehen, aber gut<br />
schreiben.“<br />
Ein Berichterstatter in Sachen Blasorchester<br />
muss also nicht nur eine fundierte<br />
musikalische Bildung haben, er muss mit<br />
dem Medium Blasorchester vertraut sein,<br />
mit der Besetzung der Register und wichtigen<br />
Komponisten und Werken. Im Idealfall<br />
hat er sich bereits vorab mit den Hauptwerken<br />
des Konzerts beschäftigt und mit<br />
diesem Wissen entsprechend seine Hörerwartung<br />
justiert, ohne sich dabei für über-<br />
„Wer ein professionelles wie faires Feedback bekommen<br />
möchte, muss sich auch professionelleren Maßstäben<br />
stellen.“<br />
(Bernd Neuschl)<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 15
Das Thema<br />
raschende Klangmomente zu verschließen.<br />
Er hört, analysiert, bewertet und würdigt<br />
das Gehörte im Kontext des konzertanten<br />
Rahmens mit all seinen Gegebenheiten.<br />
Dabei muss er die Balance wahren zwischen<br />
subjektiver Emotionalität und objektiver<br />
Sachlichkeit. Es geht dabei nicht<br />
in Facebook-Manier um „Daumen hoch“,<br />
oder „Daumen runter“, sondern um eine<br />
faire Würdigung der geleisteten Probenarbeit.<br />
Kritik, wenn sie denn angebracht ist,<br />
muss konstruktiv verpackt werden. Joachim<br />
Kaiser fasst die Kompetenzen des<br />
guten Kritikers wie folgt zusammen: „Der<br />
Kritiker soll sich über ein Konzert so äußern,<br />
dass es dem Interpreten hilft, dem<br />
Fachmann etwas sagt, das Konzertpublikum<br />
zur Diskussion animiert und darüber<br />
hinaus noch all diejenigen interessiert, die<br />
das Konzert gar nicht besucht haben.“<br />
Für wen ein stimmiger Konzertbericht<br />
gedacht sein soll und wie er verfasst werden<br />
kann, darauf wollen wir nun genauer<br />
eingehen:<br />
„Eine schlechte Kritik,<br />
wenn sie kenntnisreich<br />
und fundiert ist, kann<br />
einem Künstler helfen<br />
und ihn weiterbringen.“<br />
(Daniel Hope, Violinist)<br />
Für die Konzertbesucher<br />
und Leser<br />
Der Kritiker ist verpflichtet, dafür zu sorgen,<br />
dass hochwertige Bläsersinfonik als<br />
künstlerisch wertvolles Kulturgut noch<br />
mehr in der Öffentlichkeit kommuniziert<br />
wird. Wichtig sind nicht die genaue Anzahl<br />
der Konzertbesucher und die „liebevolle<br />
Dekoration“ in der Halle. Das sind allenfalls<br />
Randnotizen. Falls die Veranstaltung<br />
ausverkauft ist, dann muss das natürlich<br />
erwähnt werden. Von Bedeutung ist vielmehr<br />
die Wirkung des Orchesters und der<br />
Werke auf die Zuhörer. Wie reagieren sie?<br />
Wie fällt der Applaus nach einem zeitgenössischen<br />
Werk aus? Welche Komposition<br />
sorgt beim Schlürfen des Pausensekts oder<br />
beim Abholen der Mäntel für lebhafte Diskussionen?<br />
Der Kritiker erklärt schließlich,<br />
warum da ein Stück „für offene Münder<br />
gesorgt hat“. Im Prinzip muss der Rezensent<br />
mit seinem Konzertbericht den nicht<br />
da gewesenen Besuchern, also allen anderen<br />
Lesern, eine bunt bebilderte Postkarte<br />
des Konzertabends schicken: Es war toll<br />
hier, ihr habt etwas verpasst! Mit abgehobenen<br />
Fachbegriffen sollte dabei sparsam<br />
gekocht werden. Die geneigten Leser sind<br />
nämlich nicht bereit, parallel zur Zeitung<br />
in einem Fremdwörterlexikon zu blättern.<br />
Wenn ein Konzertbericht viel Aufmerksamkeit bekommen<br />
soll, ist ein professioneller Fotograf an vorderster<br />
Front eine strategisch kluge Investition. Denn<br />
nach wie vor gilt: Ein Bild sagt mehr als tausend<br />
Worte.<br />
(Bernd Neuschl)<br />
Für den Dirigenten<br />
Was für artistische Verrenkungen er auf seinem<br />
Podium fabriziert, über welch großes<br />
Repertoire an mimischer und gestischer<br />
Ausdruckskraft er verfügt – das alles ist<br />
nett zu lesen, dient aber nicht der Musik.<br />
Interessant wird es, wenn seine Programmauswahl<br />
genauer unter die Lupe genommen<br />
wird: Was für Kenntnisse hat er in Sachen<br />
Repertoire vorzuweisen? Schafft er<br />
eine Balance zwischen Bekanntem und<br />
Neuem? Kann er die Werke in einen Kontext<br />
stellen? Ist seine Dramaturgie stimmig?<br />
Schafft er einen Spannungsbogen<br />
nicht nur in den einzelnen Werken, sondern<br />
über den ganzen Abend? Hat er ein<br />
Gespür für Höhepunkte und für Ruhepole?<br />
Wie interpretiert er die Werke? Wie reagiert<br />
das Orchester auf ihn? Wie reagiert er auf<br />
das Orchester? Auch nicht vergessen werden<br />
darf: Die Macht der Feder kann Karrieren<br />
beflügeln oder zerstören.<br />
Für die Musiker<br />
Wenn ein motiviertes Blasorchester viele<br />
engagierte Proben auf sich genommen hat,<br />
weil es erkannt hat, dass die Erarbeitung<br />
einer Komposition wegen ihrer herausragenden<br />
Qualität lohnend ist, dann muss<br />
dies der Rezensent als berufener Botschafter<br />
der Musik erkennen und entsprechend<br />
würdigen. Um aber beschreiben zu können,<br />
wie ein Blasorchester geklungen hat,<br />
welche Leistung es erbracht hat, dafür bedarf<br />
es mehr als akademischen Sachverstand.<br />
Beschrieben werden können hier<br />
die Klangqualität des Orchesters, Tempo<br />
und Agogik, die rhythmische Sauberkeit<br />
und das Zusammenspiel, die Phrasierung,<br />
die Intonation, die dynamischen Differenzierungen<br />
und die Bühnenpräsenz des Orchesters.<br />
Wann swingt ein Orchester? Wann<br />
groovt es? Besonders hervorzuheben sind<br />
natürlich überzeugende Leistungen von<br />
Solisten, denn das motiviert nachhaltig<br />
den Probebetrieb und stärkt deren Rolle<br />
als Vorbilder besonders in Musikvereinen.<br />
Für den Komponisten<br />
Vor allem bei einem neuen Werk kann die<br />
Frage wichtig sein, wie eine Komposition<br />
von den Zuhörern aufgenommen wurde:<br />
Hat sie für Begeisterung oder Ratlosigkeit<br />
gesorgt? War sie fesselnd, unterhaltend,<br />
16<br />
KulturFenster
Blasmusik<br />
kurzweilig oder langweilig? Wie behandelt<br />
der Komponist das Medium Blasorchester?<br />
Was will der Komponist mit diesem Werk<br />
aussagen? Wie bringt er Inhalt, Form und<br />
seine individuelle Klangsprache auf einen<br />
Nenner? Oberflächlich auf Effekte setzend,<br />
oder tiefgründig und voller musikalischer<br />
Substanz? Wie ist die Komposition handwerklich<br />
gemacht? Form, Kontrapunkt,<br />
Themenverarbeitung, Harmonisierung<br />
und Instrumentierung lassen sich bereits<br />
nach einem ersten Höreindruck grob einordnen.<br />
Und ganz entscheidend: Wie ist<br />
der Repertoirewert der Komposition einzustufen?<br />
Ein schöpferischer und damit<br />
wertvoller Beitrag für die Literatur der Bläsersinfonik<br />
oder eine belanglose, eklektische<br />
Schablonenkomposition? Ein Konzertbericht<br />
kann selbstverständlich keine<br />
Rezension über Neuerscheinungen sein,<br />
dennoch sollten ausgewählte Punkte dieser<br />
Rubrik in wenigen Sätzen berücksichtigt<br />
werden, wenn sie dazu beitragen soll,<br />
den Stellenwert der Blasmusik als hochkulturelle<br />
Kunstform verstärkt in die Öffentlichkeit<br />
zu tragen.<br />
Wie schreiben?<br />
Die Zielgruppe bestimmt Stil und Syntax.<br />
Allereinfachste Schlagermusik kann<br />
getrost auf Bild-Zeitungs-Niveau besprochen<br />
werden. Dennoch gibt es Leser, die<br />
bemängeln jene hochgestochene, kunstvoll<br />
durchtränkte Wortwahl, die manchen<br />
Musikkritiken innewohnt. Joachim Kaiser<br />
rechtfertigte deshalb die Noblesse seiner<br />
intellektuellen Sprache, indem er postuliert:<br />
„Kunstvoll komponierte wie interpretierte<br />
Musik bedarf einer ebenso kunstvollen<br />
Sprache in der Würdigung.“ Die Schönheit<br />
der Sprache ist gleichzeitig ihre bezwingende<br />
Macht. Für all das braucht der<br />
Berichterstatter ein vitales Vokabular an<br />
musikalischen Fachbegriffen, das dosiert<br />
Verwendung findet, einen ebenso großen<br />
Wortschatz, der verständlich, mitunter süffig<br />
zu lesen und mit einer feinen Prise Ironie<br />
aufbereitet wird. Der exzentrische Frank<br />
Zappa meinte einmal: „Über Musik zu reden<br />
ist wie über Architektur zu tanzen.“<br />
Eine bunte Palette an Stilmitteln<br />
Wer Worte zum Klingen bringen will, benötigt<br />
also eine bunte Palette an literarischen<br />
Stilmitteln: Klangfiguren wie Alliterationen<br />
in Kombination mit Adjektiven, aussagekräftige<br />
Bilder wie Metaphern, Personifikationen<br />
und Vergleiche. Und ganz wichtig:<br />
Ein Synonymwörterbuch. Es gibt eine<br />
Fülle wunderbar passender Begriffe für<br />
musikalische Parameter. Paradebeispiel<br />
Marsch: Wirkt ein Trauermarsch eher<br />
schmerzvoll, schleppend, lastend, oder<br />
niederschmetternd und düster? Kommt<br />
ein Parademarsch jubelnd, stürmisch, emphatisch,<br />
hochfliegend oder glänzend aus<br />
den Schalltrichtern?<br />
Im Zeitalter neuer Medien<br />
Wir leben in einem Zeitalter der Daten-<br />
Sintflut. Smartphones und Tablet-PCs ertränken<br />
uns bei Schritt und Tritt mit Informationen,<br />
die nur noch schwer nach<br />
Wichtigkeit zu filtern sind. Unsere Augen<br />
„Der Kritiker soll sich<br />
über ein Konzert so<br />
äußern, dass es dem<br />
Interpreten hilft, dem<br />
Fachmann etwas sagt,<br />
das Konzertpublikum zur<br />
Diskussion animiert und<br />
darüber hinaus noch all<br />
diejenigen interessiert,<br />
die das Konzert gar nicht<br />
besucht haben.“<br />
(Joachim Kaiser, Musikkritiker)<br />
werden mit Nachrichten und Kurzmeldungen<br />
regelrecht geflutet, die klassische<br />
Tageszeitung und das E-Paper haben ihre<br />
Monopolstellung in Sachen Meinungsbildung<br />
verloren. Mit der Masse an Möglichkeiten<br />
der Meinungsbildung hat sich das<br />
Rezeptionsverhalten geändert: In Internetkaufhäusern<br />
und Musikdatenbanken<br />
können Kunden Konzerteinspielungen Bewertungen<br />
mit Sternen geben. Youtube-Videos<br />
von Konzerten werden kommentiert<br />
und Statusmeldungen über neue Kompositionen<br />
auf Facebook goutiert und geteilt.<br />
Jeder kann zum Kritiker werden. Die<br />
Meinung eines Einzelnen hat keinen Hoheitsanspruch<br />
mehr.<br />
Blasorchester haben zwei Möglichkeiten,<br />
mit diesem Rezeptionsverhalten umzugehen:<br />
Entweder sie springen auf die Welle<br />
auf, oder sie gehen unter. Die Leser selektieren<br />
den Informationsüberfluss nicht nur<br />
nach Bedarf, sondern nach besonderen<br />
Auffälligkeiten. Wenn ein Konzertbericht<br />
viel Aufmerksamkeit bekommen soll, ist<br />
Wenn ein motiviertes Blasorchester viele engagierte<br />
Proben auf sich genommen hat, weil es erkannt<br />
hat, dass die Erarbeitung einer Komposition wegen<br />
ihrer herausragenden Qualität lohnend ist, dann<br />
muss dies der Rezensent als berufener Botschafter<br />
der Musik erkennen und entsprechend würdigen.<br />
(Bernd Neuschl)<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 17
Das Thema<br />
ein professioneller Fotograf an vorderster<br />
Front eine strategisch kluge Investition.<br />
Denn nach wie vor gilt: Ein Bild sagt mehr<br />
als tausend Worte. Fotos von Ehrungen in<br />
allen Ehren, aber als Blickfänger taugen<br />
sie nicht. Es lohnt also, für das Konzert in<br />
Absprache mit der Redaktion einen Fotografen<br />
zu engagieren, der stimmungsvolle<br />
Konzertmomente ohne störenden Blitz einfangen<br />
kann. Hat ein Bild erst einmal das<br />
Leserinteresse geweckt, wird nicht nur die<br />
Überschrift und Bildunterschrift gelesen,<br />
sondern im Idealfall der gesamte Text. Eine<br />
fundierte Berichterstattung ist folglich die<br />
Symbiose aus aussagekräftigem Bild und<br />
kompetentem Bericht.<br />
Jenseits des geschriebenen<br />
Wortes<br />
Der technische Fortschritt ermöglicht es<br />
dem zeitgemäßen Orchester zudem, sich<br />
jenseits von Autoren-Lizenzen auf Internet-Plattformen<br />
ins rechte Licht zu rücken:<br />
Werkausschnitte als Hörproben<br />
dürfen im Streaming-Verfahren pro Werk<br />
bis zu 90 Sekunden präsentiert werden.<br />
Bei vielen Konzert-Highlights lässt sich so<br />
ein aussagekräftiger Image-Film schneiden<br />
und für Interessierte und Sponsoren<br />
hochladen. Positive Pressestimmen sind<br />
also nicht die einzigen bunt beflügelnden<br />
Federn, mit denen sich zeitgemäße Blasorchester<br />
für einen fruchtbaren Balztanz<br />
in Sachen Öffentlichkeitsarbeit schmücken<br />
können.<br />
Was sagen Dirigenten?<br />
Was Blasorchesterdirigenten an Kritiken wichtig ist, dazu haben wir drei Meister<br />
ihres Fachs befragt:<br />
Dominik M. Koch: Als eines der schönsten Zitate einer Konzertkritik empfinde ich das<br />
folgende: „Der enormen Spannung, in weiten Bögen ausgeführt, konnte man sich<br />
kaum entziehen und verspürte eine packende Gegenwärtigkeit – ein imposanter, von<br />
viel programmatischer Vision geprägter Beitrag, der Dirigent Dominik M. Koch zum<br />
heimlichen Star des Abends avancieren ließ.“ Im Grunde gehören Konzertkritiken<br />
zu jedem Konzert. Die Qualität des Textes hängt sehr von der Kompetenz und dem<br />
Sachverstand dieser Person ab. Danach richtet sich auch, wie wichtig ich einen Beitrag<br />
einschätze. Die Kritik muss vor allem der Wahrheit entsprechen und mit Sachverstand<br />
geschrieben sein. Auf inhaltliche Fehler und zu sehr subjektive Geschmäcker<br />
kann ich ebenso verzichten wie auf Berichte, die nur lobend und übertrieben<br />
überschwänglich sind, gerade bei schwächeren Konzerten.<br />
Johan de Meij: Rezensionen können sowohl für den Interpreten als auch für die Musik<br />
von Vorteil sein. Sie können ein positives Licht auf das Blasorchester und sein Repertoire<br />
werfen. Daher muss der Rezensent seine Themen gut kennen, er sollte auch in<br />
diesem Bereich ausgebildet werden. Im Allgemeinen denke ich, dass Kritiken äußerst<br />
relativ sind: Sie sagen nur etwas über die Meinung einer einzigen Person aus, die nicht<br />
immer die allgemeine Meinung der Zuhörer widerspiegelt.<br />
Toni Scholl: Eines der schönsten Zitate aus einer Kritik war das folgende: „Dieses<br />
Werk bot Toni Scholl reichlich und viel mehr als üblich die Gelegenheit, seine Fähigkeiten<br />
als Klangfarbenmagier zu entfalten.“ Kritiken sind für uns Künstler wichtig,<br />
da sie oft auch eine vermittelnde Funktion innehaben. Dabei empfinde ich Zeitungskritiken<br />
als ebenso wichtig wie die Publikumsmeinung. Eine gelungene Kritik soll im<br />
Idealfall dem Leser vermitteln und wiedergeben, was die Künstler auf der Bühne und<br />
auch das Publikum empfunden haben. Sie lobt das, was des Lobens wert ist und<br />
kritisiert das andere. Es ist wichtig, nicht nur einzelne Momente zu kritisieren, sondern<br />
das Gesamte im Auge zu behalten. Ein Kollege sagte mir einmal in einer Konzertpause:<br />
Vertraue Deinen Musikern! Diese simplen drei Worte haben mich musikalisch<br />
sehr viel weiter gebracht.<br />
18<br />
KulturFenster
Aus Verband und Bezirken<br />
Blasmusik<br />
72. VSM-Jahreshauptversammlung<br />
„Es bewegt sich nicht mehr viel!“<br />
Die 72. Jahreshauptversammlung des VSM musste heuer als Videokonferenz abgehalten werden.<br />
Im 3. Anlauf hat es geklappt: Am 27. Oktober<br />
hat der Verband Südtiroler Musikkapellen<br />
über Videokonferenz seine heurige<br />
Jahreshauptversammlung abgehalten. 183<br />
Musikkapellen haben sich eingeloggt, um<br />
über Bildschirm die Versammlung im Raiffeisensaal<br />
zu verfolgen.<br />
Eigentlich hätte die Versammlung traditionell<br />
im März stattfinden sollen. Wegen<br />
des damaligen Corona-<br />
Lockdowns musste diese<br />
aber abgesagt und auf unbestimmte<br />
Zeit verschoben werden.<br />
Nach den Lockerungen<br />
im Sommer hat der Verbandsvorstand<br />
den 17. Oktober als<br />
neuen Termin festgelegt. Wegen<br />
der Anfang Oktober wieder<br />
vermehrt auftretenden<br />
Neuinfektionen wurde auch<br />
dieser Termin kurzfristig abgesagt<br />
und die Versammlung<br />
für den 27. Oktober als Videokonferenz<br />
einberufen.<br />
Das Klarinettenensemble<br />
„Klari-di-netten“ von der Musikschule<br />
Unterland hat die<br />
Versammlung vor Ort musikalisch<br />
umrahmt. Verbandsobmann<br />
Pepi Fauster, Verbandskapellmeister<br />
Meinhard Windisch, Verbandsjugendleiter<br />
Hans Finatzer und Verbandsgeschäftsführer<br />
Andreas Bonell haben am<br />
Präsidiumstisch Platz genommen. Die 6<br />
Bezirksobmänner saßen im Hintergrund<br />
an den Computern, um die Teilnehmerzahl<br />
und die Abstimmungen optisch und<br />
schriftlich zu dokumentieren.<br />
ÖBV-Präsident Erich Riegler machte<br />
übers Internet der Versammlung Mut für<br />
die Zeit nach der Krise.<br />
Das Dreijahresmotto des Verbandes „Blasmusik<br />
bewegt“ stehe heuer unter besonderen<br />
Vorzeichen, erklärte Verbandsobmann<br />
Pepi Fauster zum Auftakt der Versammlung:<br />
„Coronabedingt bewegt sich nicht<br />
mehr viel – die Pandemie hemmt uns kulturell,<br />
künstlerisch und sozial.“ Der Stillstand<br />
oder auch die eingeschränkte Tätigkeit<br />
bringe die Musikkapellen in immer<br />
größere Schwierigkeiten:<br />
„Ich mache mir Sorgen<br />
und damit bin ich nicht<br />
allein!“<br />
Das Jahr 2019 war<br />
noch ein Jahr voller Tätigkeiten<br />
und schöner Initiativen,<br />
erinnerte Verbandsgeschäftsführer<br />
Andreas Bonell in seinem<br />
Bericht. Diese schlugen<br />
sich entsprechend auch<br />
auf den Bilanzbericht von<br />
Verbandskassier Elmar<br />
Seebacher nieder.<br />
Verbandskapellmeister<br />
Meinhard Windisch<br />
und Verbandsjugendleiter<br />
Hans Finatzer analysierten<br />
die derzeitige Si-<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 19
Aus Verband und Bezirken<br />
Keine VSM-Jahreshauptversammlung ohne Musik – das Klarinettenensemble „Klari-di-netten“ sorgte diesmal für den „guten Ton“.<br />
tuation aus musikalischer Hinsicht und<br />
im Jugendbereich. Dabei gelte es nach<br />
wie vor, den schwierigen Spagat zwischen<br />
den Übereifrigen und den Übervorsichtigen<br />
zu schaffen. Die Jugendarbeit sei<br />
dabei besonders in Mitleidenschaft gezogen,<br />
denn vor allem die zahlreichen<br />
und wichtigen Sommerangebote mussten<br />
gestrichen werden: „Die jungen Leute<br />
sind in der Pandemie die großen Verlierer.“<br />
Verbandsstabführer Klaus Fischnaller<br />
konnte coronabedingt nicht persönlich<br />
an der Versammlung teilnehmen und<br />
mahnte in seiner schriftlich übermittelten<br />
Stellungnahme, die Krise als Chance zu<br />
erkennen und die Musik in Bewegung<br />
aus einem neuen Blickwinkel zu sehen:<br />
„Raum schaffen für Neues, neu bewegen,<br />
Gewohntes hinterfragen und dabei neue<br />
Wege entdecken“, damit man vorbereitet<br />
sei, wenn der Alltag wieder einkehre.<br />
ÖBV-Präsident Erich Riegler begleitete<br />
die Versammlung ebenfalls übers Internet<br />
und überbrachte die Grußworte via Bildschirm.<br />
Obwohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen<br />
in Österreich von den<br />
italienischen abweichen, sei das Ergebnis<br />
mittlerweile ziemlich das gleiche, bestätigte<br />
er: „Nichts geht mehr!“ Riegler zeigte<br />
sich dennoch zuversichtlich, dass es gemeinsam<br />
gelinge, diese Krise zu überwinden,<br />
daraus zu lernen und neue Kraft zu<br />
schöpfen, damit die Blasmusik gestärkt<br />
aus dieser Zeit des Stillstandes herauskomme.<br />
Gleichzeitig sprach er jetzt schon<br />
die Einladung zu den anstehenden Feierlichkeiten<br />
im kommenden Jahr aus, wenn<br />
der Österreichische Blasmusikverband<br />
sein 70-jähriges Bestandsjubiläum feiert.<br />
Eine (fast) überhörte Petition<br />
Mit der Neuregelung des Dritten Sektors<br />
ergeben sich für die<br />
ehrenamtlichen Verbände<br />
und Vereine<br />
ein neuer bürokratischer<br />
Mehraufwand<br />
und steuerliche Nachteile,<br />
hob VSM-Obmann<br />
Pepi Fauster bei<br />
der Versammlung hervor.<br />
Zudem habe Corona<br />
die Musikkapellen<br />
und alle anderen<br />
ehrenamtlichen Vereine<br />
vor große strukturelle,<br />
soziale und<br />
finanzielle Probleme gestellt: Die unsichere<br />
Gesetzeslage und die ausufernde<br />
Bürokratie gefährden die Vereine, besonders<br />
die kleinen, analysierte er. Daher<br />
genehmigte die Versammlung eine<br />
entsprechende Petition, die unter anderem<br />
die politischen Vertreter dazu auffordert,<br />
„dahingehend einzuwirken, dass die<br />
neuen Bestimmungen auf das Südtiroler<br />
Vereinswesen abgestimmt werden.“ Landeshauptmann<br />
Arno Kompatscher, zugeschaltet<br />
via Bildschirm, und Kulturlandesrat<br />
Philipp Achammer, der persönlich zur<br />
Versammlung im Raiffeisensaal in Bozen<br />
gekommen war, gingen in ihren Grußworte<br />
nicht direkt auf diese Petition ein. Landes-<br />
Wieviel Unterstützung bekommen die<br />
ehrenamtlich tätigen Vereine? Dieser<br />
Frage musste sich Kultur-Landesrat<br />
Philipp Achammer stellen.<br />
20<br />
KulturFenster
Blasmusik<br />
hauptmann Kompatscher stellte aber in<br />
Aussicht, dass man versuche, mit einer<br />
eigenen Durchführungsbestimmung zum<br />
Autonomiestatut das Ehrenamt in Südtirol<br />
zu regeln. Landesrat Achammer sicherte<br />
hingegen den Kapellen einen Sonderfonds<br />
zu, der zwar „keine großen Beträge beinhaltet,<br />
aber ein kleines Zeichen der Wertschätzung<br />
sein soll.“<br />
Klari-di-netten<br />
Katharina Casal (Es- und B-Klarinette),<br />
Sophia Pichler (B-Klarinette), Evelyn Pardatscher<br />
(B-Klarinette) und Melanie Richermo<br />
(Bassklarinette) haben am 15.<br />
Februar als Ensemble „Klari-di-netten“<br />
unter der Leitung von Alexandra Pedrotti<br />
am landesweiten Wettbewerb „Musik in<br />
kleinen Gruppen“ in Auer teilgenommen.<br />
Mit 94,33 von 100 Punkten haben sie ein<br />
hervorragendes Ergebnis erzielt. Auf Vorschlag<br />
der Verbandsjugendleiterin Uta<br />
Praxmarer wurde das Quartett nun eingeladen,<br />
die heurige VSM-Jahreshauptversammlung<br />
musikalisch zu umrahmen<br />
und ihr damit zumindest eine kleine musikalische<br />
Note zu verleihen, die einer Versammlung<br />
des Verbandes Südtiroler Musikkapellen<br />
würdig ist.<br />
Landeshauptmann Arno Kompatscher versprach, sich für eine Südtiroler Lösung des<br />
Ehrenamtes einzusetzen.<br />
Abschied“ vom Klarinettenensemble uraufgeführt.<br />
Der Choral ist sowohl in der<br />
großen Besetzung einer Musikkapelle<br />
als auch in verschiedenen Bläserensembles<br />
spielbar und wird an alle Musikkapellen<br />
verteilt.<br />
Stephan Niederegger,<br />
VSM-Medienreferent<br />
Ein neuer Choral zum Abschied<br />
Bereits seit längerem wurde von mehreren<br />
Seiten angeregt, eine Alternative<br />
zum landauf landab oft gespielten „Kameradenlied“<br />
anzubieten. Wegen seines<br />
auf den Krieg bezogenen Textes sei<br />
das Lied auch in instrumentaler Version<br />
nicht immer passend, wurde bemängelt.<br />
Auf Initiative des Verbandskapellmeisters<br />
Meinhard Windisch wurde der Komponist<br />
Hannes Kerschbaumer daher beauftragt,<br />
einen neuen Choral zu schreiben.<br />
Anlässlich der Jahreshauptversammlung<br />
wurde dieser Choral mit dem Titel „Zum<br />
Der Südtiroler Komponist Hannes Kerschbaumer hat eine Alternative zum nicht<br />
immer passenden „Kameradenlied“ geschaffen.<br />
KulturFenster<br />
Redaktion KulturFenster<br />
Ihre Beiträge (Texte und Bilder) für die Blasmusikseiten senden Sie bitte an: kulturfenster@vsm.bz.it<br />
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des KulturFensters ist Mittwoch 13. Jänner <strong>2020</strong>.<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 21
Aus Verband und Bezirken<br />
Schauen wir nach vorne!<br />
Ausblicke in das Tätigkeitsjahr 2021<br />
Für das Jahr <strong>2020</strong> werden wir uns nicht<br />
schwer tun, das Unwort des Jahres zu finden.<br />
„Corona“ hat unsere Welt und unsere Gesellschaft<br />
massiv getroffen und verändert. Die<br />
Pandemie hat auch die Tätigkeit der Musikkapellen<br />
sehr stark eingeschränkt. Im Rückspiegel<br />
haben wir die Situation schon einige<br />
Male betrachtet.<br />
Wir wissen alle, dass beim Autofahren<br />
der Blick in den Rückspiegel notwendig ist.<br />
Aber warum ist dieser klein und die Frontscheibe<br />
groß? Ja, genau deshalb, weil<br />
der Blick nach vorne noch viel wichtiger<br />
ist. Vor uns öffnet sich - ähnlich<br />
wie wenn ich in ein unbekanntes Land<br />
fahre - wieder ein neues Jahr. Wie es<br />
darin aussieht, wissen wir nicht. Es<br />
gibt aber sicher Sonnentage, attraktive<br />
Plätze, besondere Herausforderungen<br />
und schöne Erlebnisse, neue Möglichkeiten<br />
und wohl auch Überraschungen.<br />
Verlauf der Pandemie<br />
Nach der ersten Welle im Frühjahr, die<br />
so unerwartet über uns hereingebrochen<br />
ist und uns unvorbereitet angetroffen<br />
hat, hat uns die zweite Welle im<br />
Oktober/November noch stärker erwischt.<br />
Durch die angesetzten Maßnahmen erhoffen<br />
wir uns alle, dass die Ansteckungen<br />
möglichst zurückgehen und geschlossene<br />
Bereiche wieder öffnen können. Wir im Verband<br />
werden – so wie bisher – wieder im<br />
Sinne unserer Musikkapellen mit den zuständigen<br />
Stellen in Politik und Sanität Wege<br />
zum Wiederbeginn des gemeinsamen Musizierens<br />
bei Proben und Auftritten suchen.<br />
Bewährtes beibehalten<br />
Der Verbandsvorstand hat sich für 2021 vorgenommen,<br />
die bisher bewährten Initiativen<br />
in allen Bereichen wieder als Tätigkeit einzuplanen<br />
und zur passenden Zeit flächendeckend<br />
zu aktivieren. Gemeint ist dabei vor<br />
allem die Aus- und Weiterbildung der aktiven<br />
Musikantinnen und Musikanten, der<br />
Kapellmeister*innen, Jugendleiter*innen<br />
und Stabführer, die teilweise zentral, aber<br />
auch aufgeteilt in allen sechs Bezirken aufscheinen<br />
wird.<br />
Besondere Veranstaltungen sollen als<br />
Leuchttürme herausstechen und musikalische<br />
Farbe in den Alltag bringen. In der<br />
Verwaltung werden nach wie vor Hilfe und<br />
Unterstützung für die Organisation der Vereine<br />
angeboten. In diesem Sinne empfehlen<br />
wir auch allen Mitgliedskapellen, mit<br />
Mut und Zuversicht bisher Bewährtes wieder<br />
in Betracht zu ziehen und aufzugreifen.<br />
Umdenken – neue Ziele setzen –<br />
Qualität vor Quantität<br />
Der durch die Corona-Pandemie erzwungene<br />
gewaltige Einschnitt in der Tätigkeit<br />
stellt uns beim Wiederbeginn vor die wichtigen<br />
Fragen: Soll alles wie bisher so weitergeführt<br />
werden? Sind wir im Stande, das<br />
bisher Erreichte wieder 1:1 umzusetzen? Ist<br />
das überhaupt notwendig? Wäre das zukunftsorientiert?<br />
Corona wird uns wahrscheinlich wohl<br />
vieles lehren, wenn wir uns lehren lassen.<br />
Was uns sicher gut tun würde, ist das „Weniger<br />
ist mehr“ oder „Qualität vor Quantität“.<br />
Wenn wir daran denken, wie wir in Zukunft<br />
den Nachwuchs in unseren Musikkapellen<br />
finden sollen und wie wir nachher unsere<br />
jungen und älteren Mitglieder zum fleißigen<br />
Mitmachen motivieren können, werden<br />
obige Gedanken von großer Wichtigkeit sein.<br />
Freude und Lust entstehen nicht durch viele<br />
Proben und viele Konzerte, sondern sicher<br />
durch eine interessante und effiziente Probenarbeit<br />
und durch Konzerte, die berühren.<br />
Es werden in Zukunft besondere Ideen<br />
und Kreativität gefragt sein!<br />
Uns gegenseitig helfen –<br />
Partner suchen<br />
Sich gegenseitig helfen, ist immer gut. In<br />
schweren Zeiten zusammenstehen und<br />
dem anderen die Hand reichen, ist noch<br />
besser. Das heißt für mich, dass wir im<br />
neuen Jahr Maßnahmen treffen sollen,<br />
die uns beim Neustart unserer Tätigkeiten<br />
nützlich sind, uns Ideen zum Musizieren<br />
liefern, uns auf neue Gedanken<br />
bringen, uns interessante und machbare<br />
Wege aufzeigen. Wir sind alle aufgerufen,<br />
uns solidarisch zu zeigen und mitzuhelfen,<br />
aus dieser Krise möglichst unbeschadet<br />
herauszukommen. Sehr sinnvoll<br />
ist dabei immer, wenn man sich nicht<br />
durch Alleingänge die Kräfte raubt, sondern<br />
um sich blickt, nach Partnern Ausschau<br />
hält und sich Verbündete mit ins<br />
Boot holt. In der Gruppe und im Team<br />
geht alles leichter!<br />
Schluss<br />
Abschließend danke ich allen Verantwortungsträgern<br />
im Verband, in den Bezirken<br />
und Musikkapellen für die gute Zusammenarbeit<br />
im Jahr <strong>2020</strong> und für das erwiesene<br />
Verständnis in schwierigen Fragen. Für den<br />
Neustart, der hoffentlich möglichst bald beginnen<br />
sollte, helfen uns nur Freude und<br />
Optimismus. Die Leidenschaft zum Musizieren<br />
und zum Miteinander im Verein ist<br />
eine starke Triebfeder! Und denken wir immer<br />
an das Wertvolle und Schöne, das wir<br />
durch unser Engagement im Dienste an unserer<br />
Gesellschaft leisten! Dafür können wir<br />
uns gerne fest einsetzen!<br />
Viel Glück für 2021,<br />
vor allem Gesundheit!<br />
Pepi Fauster, Verbandsobmann<br />
22<br />
KulturFenster
Die Jugendseiten<br />
Blasmusik<br />
303 Leistungsabzeichen verliehen<br />
Erleichterung und Dankbarkeit über ein bisschen Normalität<br />
Die Prüfungen wurde coronabedingt mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit<br />
abgehalten.<br />
Am letzten Oktoberwochenende wurden die<br />
im März und Juni coronabedingt ausgefallenen<br />
Prüfungen zu den Leistungsabzeichen<br />
nachgeholt. Dazu hatte Verbandsjugendleiter<br />
Hans Finatzer mit seinem Team<br />
ein eigenes Sicherheitskonzept erarbeitet,<br />
damit die Prüfungen – heuer unter Ausschluss<br />
der Öffentlichkeit – überhaupt abgehalten<br />
werden konnten.<br />
Sowohl bei den Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmern, aber auch bei den Lehrpersonen<br />
und den Juroren sei „große Erleichterung<br />
und Dankbarkeit über ein bisschen<br />
Normalität“ spürbar gewesen, freute sich<br />
Finatzer. Bis zum Schluss habe man versucht,<br />
allen gesundheitlichen und gesetzlichen<br />
Vorgaben gerecht zu werden, um<br />
die Prüfungen ordnungsgemäß abhalten<br />
zu können. Von den ursprünglich angemeldeten<br />
323 Jugendlichen, konnten schließlich<br />
20 coronabedingt nicht zur Prüfung<br />
antreten. Für sie wurden über die Musikschulen<br />
alternative Termine angeboten,<br />
„damit auch sie die Prüfung in eine der<br />
drei Leistungsstufen absolvieren können“,<br />
erklärt Finatzer.<br />
Hans Finatzer,<br />
VSM-Verbandsjugendleiter<br />
Am Samstag wurden die Bronze- und<br />
Silberprüfungen an den Musikschulen von<br />
Auer, Bruneck, Klausen, Lana und Schlanders<br />
abgenommen. Am Sonntag konnten<br />
an der Musikschule Eppan 23 Diplome in<br />
Gold überreicht werden.<br />
Ein weiteres Novum war heuer auch<br />
der Anmeldemodus zur Prüfung. Erstmals<br />
mussten alle Anmeldungen über das<br />
neue Online-Portal auf der VSM-Homepage<br />
erfolgen. Dieses neue Angebot habe<br />
die Feuertaufe bestanden. Mit den Erfahrungen<br />
dieser ersten Anwendung soll das<br />
Anmeldeportal schrittweise auf alle Kursangebote<br />
des Verbandes ausgebaut werden,<br />
bestätigt Finatzer. Er habe es seit seinem<br />
Amtsantritt im März 2019 als Auftrag<br />
gesehen, dieses Projekt vorangetrieben<br />
und zusammen mit der Firma „Effekt!“<br />
aus Neumarkt konzipiert.<br />
Stephan Niederegger<br />
VSM-Medienreferent<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 23
Die Jugendseiten<br />
JUmBOS - die Jugendkapelle der<br />
Stadtkapelle Bozen<br />
Auf Gemeinsamkeiten und Freude an der Musik wird Wert gelegt<br />
Steckbrief<br />
Name: Die JUmBOs, Jugendkapelle Bozen<br />
Musikkapelle: Stadtkapelle Bozen<br />
Jugendteam: Heidi Schwarz und viele Helferinnen und Helfer<br />
Jungmusikanten: ca. 25 Kinder und Jugendliche von 8-18 Jahren<br />
Im Herbst 2019 hat sich die Jugendkapelle<br />
Bozen den neuen Namen JUmBOs gegeben.<br />
Dieser Name steht für Jugend, für Bozen und<br />
für jede Menge neuen Schwung und Elan<br />
in der Jugendarbeit.<br />
Für die Stadtkapelle Bozen ist die Jugendarbeit<br />
eine schwierige Angelegenheit,<br />
da Bozen mit den ihren verzweigten Gebieten<br />
und unterschiedlichen Zonen schwer<br />
zu überblicken ist. Anders als in den Gemeinden<br />
auf dem Lande, wo man sich<br />
bereits von klein auf kennt, kommen die<br />
Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen<br />
Teilen der Altstadt und kennen sich<br />
meist kaum untereinander. Trotzdem oder<br />
gerade deswegen hat man es sich zum Ziel<br />
gemacht, Kinder und Jugendliche der Altstadt<br />
und Umgebung zusammenzubringen,<br />
sie für das gemeinsame Musizieren<br />
zu begeistern und sie auf ihr großes Ziel<br />
vorzubereiten, nämlich die Aufnahme in<br />
die Stadtkapelle Bozen.<br />
Verschiedene Kulturen und Sprachen<br />
vereinigen sich in dieser jungen Truppe,<br />
denn so wie es auch in der Stadtkapelle<br />
Bozen Brauch ist, ist es auch den JUmBOs<br />
wichtig, nicht auf Unterschiede wie Herkunft<br />
und Sprache, sondern auf Gemeinsamkeiten<br />
und Freude an der Musik Wert zu<br />
legen. Seit einiger Zeit wächst nicht nur die<br />
Begeisterung unter den Jugendlichen, sondern<br />
auch die Jugendkapelle selbst wächst<br />
stetig und so sind mittlerweile über 25 Kinder<br />
und Jugendliche im Alter zwischen 8<br />
und 18 Jahren bei den JUmBOs dabei,<br />
sozusagen Jung und Alt. Das gegenseitige<br />
Verständnis und der gegenseitige Respekt<br />
sind bei allen Aktivitäten wichtig und richtig.<br />
Gerade in so einer schwierigen Zeit, wie<br />
sie es in diesem Jahr <strong>2020</strong> durch Corona<br />
ist, ist es von großer Bedeutung, den Kontakt<br />
zu den Jungmusikantinnen und -musikanten<br />
aufrecht zu erhalten. So wurde<br />
im Frühjahr das online-Video „Die JUm-<br />
BOs at homework“ erstellt, für welches zuerst<br />
alle ihre Stimme getrennt voneinander<br />
zu Hause eingespielt und dann zu einem<br />
gemeinsamen Clip zusammengeführt haben,<br />
als Erinnerung, Motivation und Hoffnung<br />
auf eine bessere Zukunft.<br />
Die JUmBOs beginnen im September mit<br />
wöchentlichen Proben und das Jahr endet<br />
traditionell mit einem Konzert im Mai am<br />
Blumenmarkt in Bozen. Dazwischen gibt<br />
es traditionelle Ziele wie das Weihnachtskonzert,<br />
das Konzert in der Goetheschule,<br />
das Spielen bei kirchlichen Anlässen und<br />
gemeinsame Ausflüge. Im Sommer darf<br />
Musik auch nicht fehlen, das beweist unsere<br />
Jugend bei den gemeinsamen Jugendbläserwochen<br />
zusammen mit der Jugend<br />
der Musikkapellen Kurtatsch, Penon, Neumarkt,<br />
Montan und Truden.<br />
Für die Zukunft ist es sehr wichtig, die<br />
Mädchen und Jungs zu fördern, guten<br />
Kontakt zu den Familien der Jungmusikantinnen<br />
und -musikanten zu halten, ihnen<br />
gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und<br />
Lehrern den Zugang zur Musik zu ermöglichen<br />
und gemeinsam mit allen Generationen<br />
innerhalb der Musikkapelle den<br />
Fortbestand der Stadtkapelle zu sichern.<br />
Jugendkapelle JUmBOs –<br />
Koordination Verbandsjugendleiter<br />
Hans Finatzer<br />
24<br />
KulturFenster
Blasmusik<br />
Drei der Jungmusikanten der JUmBOS<br />
Eva Niederwanger<br />
Eva<br />
Mein Name: Eva Niederwanger<br />
Alter: 11 Jahre<br />
Ich spiele: Klarinette<br />
Ich lerne dieses Instrument, weil: Es mir Spaß macht.<br />
In meiner Freizeit höre ich gerne: Rockmusik und Popmusik<br />
Was gefällt dir besonders an der Juka? Dass wir Konzerte machen und alle zusammen<br />
Spaß haben.<br />
3 Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest: Mein Instrument, den Volleyball<br />
und die Freunde der Jugendkapelle.<br />
Wenn ich einen Wunsch frei hätte… würde ich gern in der Musikkapelle mit Papi spielen.<br />
Martin Cruciotti<br />
Martin<br />
Mein Name: Martin Cruciotti<br />
Alter: 12 Jahre<br />
Ich spiele: Saxophon<br />
Ich lerne dieses Instrument, weil: Weil es mir Spaß macht, wie mein Atem sich in<br />
Musik verwandelt.<br />
In meiner Freizeit höre ich gerne: Jede Art von Musik, auch die, die ich nicht sehr mag.<br />
Was gefällt dir besonders an der Juka? In Gemeinschaft zu spielen.<br />
3 Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest: Mein Sax, meine Play Station,<br />
meinen besten Freund<br />
Wenn ich einen Wunsch frei hätte … Friede, Gesundheit und Freude auf die Welt bringen.<br />
Greta<br />
Greta Aster<br />
Mein Name: Greta Aster<br />
Alter: 12 Jahre<br />
Ich spiele: Trompete<br />
Ich lerne dieses Instrument, weil: ...ich mich darin wiederfinde.<br />
In meiner Freizeit höre ich gerne: Alle möglichen Musikgattungen.<br />
Was gefällt dir besonders an der Juka? Das gemeinsame Musizieren und Spaß haben<br />
3 Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest: Meine Familie, meine Trompete<br />
und ein Pferd.<br />
Wenn ich einen Wunsch frei hätte ...würde ich mir wünschen einen Weg zu finden, die<br />
Welt verbessern zu können.<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 25
Ars Nova<br />
Mit einem leichten<br />
arabischen Touch<br />
Robert Neumairs Musik zum Stummfilm „Der müde Tod“<br />
Seit 2008 finden in Halle (Saale) die Filmmusiktage<br />
Sachsen-Anhalt statt. Seit 2013<br />
wird im Rahmen dieser Musiktage die interdisziplinäre<br />
Masterclass – DAS ORCHE-<br />
STER organisiert. Diese richtet sich an Studierende,<br />
Absolventen und Interessierte<br />
aus dem Bereich Filmmusik-Komposition.<br />
Dabei werden die Workshop-Teilnehmer<br />
von erfahrenen Dozenten betreut und ihnen<br />
die Möglichkeit geboten, mit Orchestern<br />
zu arbeiten. In Kooperation mit der<br />
Staatskapelle Halle steht ihnen dazu ein<br />
großes Sinfonieorchester zur Verfügung.<br />
In Zusammenarbeit mit der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung<br />
erhielten 2015 die<br />
Komponisten die Möglichkeit, einen Ausschnitt<br />
des Stummfilm-Klassikers „Der<br />
müde Tod“ (Fritz Lang 1921) zu vertonen.<br />
Auch der junge Komponist Robert Neumair<br />
aus dem Pustertal hat sich für diese<br />
Masterclass beworben, dazu Filmszenen<br />
vertont und seine Musik mit dem Orchester<br />
aufgenommen.<br />
Das „deutsche Volkslied in sechs<br />
Versen“, so der Untertitel zum Film, ist<br />
die romantisch-tragische Geschichte einer<br />
jungen Frau, die den Ehemann vom Tod<br />
zurückfordert. Wenn sie eines von drei Leben<br />
retten kann, deren Lichter bereits flackern,<br />
soll sie ihn zurückbekommen. Diese<br />
drei Episoden sind orientalisch (Rache der<br />
Gläubigen), venezianisch (Mord auf dem<br />
Karneval) und chinesisch (kaiserlicher Tyrann).<br />
In allen drei Fällen scheitert sie beim<br />
Versuch, ihren Geliebten zu retten. Neumairs<br />
Musik ist daher melancholisch angehaucht<br />
mit einem leichten arabischen<br />
Touch zur orientalischen Episode. Eingeleitet<br />
von Englischhorn, Klarinette und<br />
Oboe wird das neue Thema von den Streichern<br />
übernommen. Die musikalisch-dramatische<br />
Wendung unterstreicht die darauf<br />
folgende Verfolgungsszene durch Hinzunahme<br />
der Blechbläser und des Schlagzeugs.<br />
Nach einer rhythmischen Passage<br />
kehrt wieder etwas Ruhe ein, sobald die<br />
gestopften Hörner das Hauptthema spielen.<br />
Neumair untermalt die Geschichte<br />
Zur Person:<br />
Robert Neumair ist am 27. Jänner 1982 geboren und in St. Georgen bei Bruneck<br />
aufgewachsen. Bereits im Alter von 3 Jahren hat er begonnen, Steirische Harmonika<br />
zu lernen, später Klavier, Trompete, Schlagzeug, Bariton, Akkordeon, Gitarre<br />
und E-Bass. Am Tiroler Landeskonservatorium in Innsbruck hat er Trompete bei<br />
Prof. Erich Rinner und Klavier bei Gösta Müller studiert.<br />
In der Folge sammelte er bei verschiedenen Orchestern wichtige Erfahrungen für<br />
seinen weiteren musikalischen Werdegang. Derzeit ist er stellvertretender Solotrompeter<br />
der Deutschen Radiophilharmonie (Saarbrücken/Kaiserslautern)<br />
und Mitglied des Bläserensembles „Bozen Brass“.<br />
Bereits 2010 hat er seine eigene Firma „Soundfactory“ mit angeschlossenem<br />
Tonstudio gegründet. Kompositionen und Arrangements für<br />
verschiedene Ensembles, Musikkapellen, Blas- und Sinfonieorchester<br />
sowie Musikvideos, Film- und Theatermusik zählen zu seinem<br />
umfangreichen kompositorischen Schaffen.<br />
www.robertneumair.com<br />
26<br />
KulturFenster
Blasmusik<br />
mit sehr düsteren und rhythmischen Elementen.<br />
Ein Ritardando und Decrescendo<br />
führen zum Übergangsmotiv der Oboen,<br />
das wieder zur „orientalischen Musik“<br />
weiterleitet. Ein Trompetensolo begleitet<br />
die Liebesszene, bevor die Schlussphase<br />
sehr traurig – weil ohne Happy End – mit<br />
drei aufeinanderfolgenden as-Moll-Akkorden<br />
ausklingt.<br />
Das rund 4 ½ minütige Werk ist für Sinfonieorchester<br />
(Streicher 14-12-10-8-6, Bläser<br />
3-3-3-3 Blechbläser 4-3-3-1 Schlagzeug<br />
1-4) angelegt und derzeit noch nicht verlegt.<br />
Stephan Niederegger<br />
Partitur<br />
2 Takte Vorzähler<br />
A q=80<br />
& b b Andantino<br />
b<br />
4<br />
Flöte 1<br />
!<br />
& b b b<br />
4<br />
Flöte 2<br />
& b b b<br />
4<br />
Oboe 1<br />
& b b b 4<br />
Oboe 2<br />
& b b<br />
4<br />
Englischhorn Ó Œ<br />
œ<br />
"<br />
& b<br />
4<br />
Klarinette in Bb 1 Ó Œ<br />
œ<br />
"<br />
& b<br />
4<br />
Klarinette in Bb 2<br />
!<br />
& b<br />
4<br />
Bass-Klarinette<br />
?<br />
b b b<br />
4<br />
Fagott 1<br />
?<br />
b b 4<br />
Fagott 2 b<br />
?<br />
b b 4<br />
Kontrafagott b<br />
TMC 00:42:00<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
˙<br />
˙<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
3<br />
œ œ œ œ # œ<br />
3<br />
œ œ œ œ # œ<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
˙.<br />
˙.<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
œ<br />
œ<br />
!<br />
!<br />
! nœœœ œ..<br />
œ œ.<br />
œ nœœ œ . ˙.<br />
J<br />
3<br />
p<br />
! ! !<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
Ó<br />
Ó<br />
!<br />
!<br />
Œ<br />
œ ˙<br />
Œ<br />
œ ˙<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
Der müde Tod<br />
Filmmusik zum Stummfilm für den Filmmusikworkshop "Masterclass" in Halle/Saale<br />
nœ<br />
p<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
3<br />
œ œ œ œœ<br />
3<br />
œ œ œ œœ œ ˙<br />
!<br />
!<br />
3<br />
œœœ ˙<br />
!<br />
!<br />
œ ˙<br />
3<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
œ<br />
œ<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
œ # œ œ œ<br />
œ # œ œ œ<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
nœ<br />
œ œ œ..<br />
œ œ.<br />
3<br />
!<br />
nœ<br />
œ œ œ..<br />
œ œ.<br />
3<br />
˙<br />
p<br />
w<br />
w<br />
˙<br />
p<br />
œ œœœ œ œ œ ˙ œ ˙<br />
p<br />
p<br />
w<br />
w<br />
p<br />
!<br />
˙<br />
˙<br />
˙<br />
œ<br />
J<br />
œ<br />
J<br />
œ œ<br />
œ<br />
nœ.<br />
œ œ œ œœ<br />
3F<br />
œ<br />
Ó œ<br />
F<br />
3<br />
œ œ<br />
œ<br />
nœ.<br />
œ œ œ œœ<br />
F<br />
w<br />
w<br />
w<br />
w<br />
w<br />
w<br />
w<br />
!<br />
R. Neumair<br />
œ œ œ œ œ œ œ œ œ<br />
f<br />
3<br />
œ œ œ œ œ œ œ œ œ<br />
f<br />
3<br />
œ œ œ œ œ œ œ œ œ<br />
f<br />
œ<br />
3<br />
f<br />
œ œ œ<br />
f<br />
œ<br />
f<br />
œ œ<br />
˙ œ<br />
f<br />
˙-<br />
f œ-<br />
œ œ œ<br />
f<br />
˙<br />
f<br />
œ<br />
˙-<br />
f<br />
œ -<br />
˙<br />
Horn in F 1<br />
Horn in F 2<br />
Horn in F 3<br />
Horn in F 4<br />
Posaune 1<br />
Posaune 2<br />
Bass-Posaune<br />
Tuba<br />
Pauken<br />
Becken<br />
Harfe<br />
& b b 4<br />
& b b 4<br />
& b b 4<br />
& b b 4<br />
?<br />
b b 4<br />
b<br />
?<br />
b b 4 w<br />
b<br />
"<br />
?<br />
b b 4<br />
b<br />
w<br />
"<br />
?<br />
b b 4<br />
b<br />
!<br />
?<br />
b b 4<br />
b<br />
w æ "<br />
ã<br />
4<br />
!<br />
& b b b 4<br />
?<br />
b b 4<br />
b<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
Con sord.<br />
Con sord.<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
w<br />
w<br />
!<br />
w æ !<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
w<br />
w<br />
!<br />
w æ !<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
Ó ˙<br />
"<br />
w<br />
w<br />
!<br />
w æ Y<br />
Chrashbecken<br />
"<br />
w<br />
g<br />
p<br />
!<br />
Con sord.<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
w<br />
!<br />
Ó<br />
˙<br />
Con sord.<br />
w<br />
"<br />
w æ !<br />
n<br />
g w<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
w<br />
!<br />
!<br />
w<br />
w æ !<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
w<br />
!<br />
!<br />
w<br />
w æ !<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
w<br />
Ó ˙<br />
p<br />
Ó<br />
˙<br />
w<br />
w æ !<br />
!<br />
!<br />
w<br />
w<br />
w æ Y<br />
"<br />
w g<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
Ó<br />
œ<br />
œ<br />
F<br />
Ó<br />
œ<br />
œ<br />
F<br />
Ó<br />
œ<br />
œ<br />
F<br />
Ó<br />
œ<br />
œ<br />
F<br />
Ó. œ -<br />
w<br />
w<br />
Ó<br />
w æ Y<br />
æ<br />
n<br />
g<br />
n˙<br />
Ó<br />
Œ<br />
Ó<br />
f<br />
œ<br />
f<br />
œnœnœœœœœœ<br />
Senza sord.<br />
œ<br />
œ<br />
œ<br />
œ<br />
˙<br />
˙<br />
˙<br />
˙<br />
œ - œ - œ -<br />
˙ œ -<br />
˙- œ-<br />
f<br />
˙- œ-<br />
˙<br />
f<br />
X.<br />
f<br />
˙.<br />
f<br />
!<br />
œ<br />
Violine I<br />
Violine II<br />
Viola<br />
Cello<br />
Kontrabass<br />
& b b b 4<br />
!<br />
& b b b 4<br />
!<br />
B b b 4<br />
b<br />
w<br />
"<br />
?<br />
b b 4<br />
b<br />
w<br />
"<br />
?<br />
b b b<br />
4<br />
w<br />
"<br />
w<br />
w<br />
w<br />
!<br />
!<br />
!<br />
!<br />
w<br />
w<br />
w<br />
w<br />
w<br />
w<br />
!<br />
!<br />
w<br />
w<br />
w<br />
!<br />
!<br />
w<br />
w<br />
w<br />
!<br />
!<br />
w<br />
w<br />
w<br />
!<br />
!<br />
w<br />
w<br />
w<br />
!<br />
!<br />
˙<br />
w<br />
w<br />
!<br />
!<br />
˙<br />
Ó<br />
Ó<br />
œ<br />
œ<br />
F<br />
˙ œ œ -<br />
œ -<br />
œ -<br />
w<br />
w<br />
F<br />
œ<br />
œ<br />
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2<br />
œ œ œ œ œ œ œ œ œ<br />
f<br />
3<br />
œ œ œ œ œ œ œ œ œ<br />
f<br />
3<br />
œ - Div.<br />
˙-<br />
œ<br />
-<br />
f<br />
œ œ<br />
-<br />
˙-<br />
f<br />
œ -<br />
˙- f<br />
œ -<br />
Die 1. Seite der Partitur zu „Der müde Tod“ (oben)<br />
Der Film „Der müde Tod“ ist 1921 unter der<br />
Regie des legendären österreichisch-deutschen<br />
Filmschaffenden Fritz Lang entstanden. (links)<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 27
Kritisch hingehört<br />
Verwöhnprogramm<br />
mit erlesener Bläsermusik<br />
Bürgerkapelle und Kulturverein Brixen bieten erfolgreiche<br />
Konzertreihe in der Hofburg<br />
Nach dem langen kulturellen und gesellschaftlichen<br />
Stillstand im Frühling<br />
haben die Bürgerkapelle Brixen und der<br />
Kulturverein Brixen Musik den heurigen<br />
„Musiksommer in der Hofburg“ unter anderen<br />
Vorzeichen, aber nicht minder erfolgreich<br />
veranstaltet, unterstützt von der<br />
Tourismusgenossenschaft und von der<br />
Gemeinde Brixen. Im wunderbaren Ambiente<br />
des Innenhofs der Brixner Hofburg<br />
waren sieben sehr ansprechende Konzerte<br />
zu erleben.<br />
Die Bläser des Haydn Orchesters haben<br />
den Beginn mit Mozarts Serenade „Gran<br />
Partita“ gemacht und die Reihe auch unter<br />
der Leitung des Startrompeters Marco<br />
Pierobon beendet.<br />
Dazwischen waren das Cinquino Brass<br />
Quintett (Brainstorm), Bozen Brass (Surprise)<br />
und die Musikkapelle Lana (Farben<br />
der Bläsermusik) zu hören. Das heimische<br />
Publikum war von den „jungen<br />
Talenten am Podium“ mit den Ensembles<br />
„MischMasch“, „Pentakis mit Schlag“<br />
und „Vipialma“ sehr angetan. Das junge<br />
preisgekrönte Quintett „Urban Brass“ aus<br />
Süddeutschland hat mit bester Bläserkultur<br />
und hoher Musikalität überzeugt<br />
(„Summertime on Broadway“).<br />
Zweifellos war aber die von der Bürgerkapelle<br />
Brixen gestaltete „Königliche<br />
Freiluftmusik“ ein besonderer Höhepunkt.<br />
Dabei wurde der ganze Innenhof der Hofburg<br />
optisch und akustisch mit einbezogen.<br />
Die Auszüge aus Händels „Wassermusik“<br />
und „Feuerwerksmusik“ wurden<br />
in gekonnter Instrumentation von den Registern<br />
der Bürgerkapelle stilsicher interpretiert,<br />
geleitet vom hochmotivierenden<br />
Kapellmeister Hans Pircher. Das Publikum<br />
hat die Aufführungen sehr geschätzt und<br />
die Anstrengungen von Organisatoren und<br />
Musikern mit viel Anerkennung und Applaus<br />
honoriert.<br />
Nathan Vikoler<br />
Sowohl akustisch als auch optisch ein Genuss: der Musiksommer in der Hofburg in<br />
Brixen (Fotos: Matthias Gasser)<br />
Zu den hochkarätigen Gästen bei den Sommerkonzerten in der Hofburg zählten auch<br />
die Bläser des Haydn Orchesters.<br />
28<br />
KulturFenster
Neues<br />
Blasmusik<br />
ITALLEGRO - für eine Pause im Alltag<br />
Italienische Musik-Begriffe von A-Z<br />
Jutta Eckes ist aus Leidenschaft Italianistin,<br />
Italienischdozentin an Musikhochschulen<br />
in Köln, Mainz und Darmstadt, Dolmetscherin,<br />
Übersetzerin, Lehrbuchautorin,<br />
und als Italienisch-Sprachcoach für Sängerinnen<br />
und Sänger bei Opernproduktionen<br />
feilt sie akribisch an Details.<br />
Ihre Begeisterung für<br />
die italienische Sprache<br />
entfachte sich<br />
früh – als sie mit<br />
acht Jahren zum ersten<br />
Mal in Italien<br />
war. Beim Spiel mit<br />
einem anderen Kind<br />
kam sie mit der „lucertola“<br />
(Eidechse)<br />
in Berührung – eine<br />
sprachliche Begegnung,<br />
die sie bis<br />
heute nicht mehr<br />
loslässt. Ihre neueste<br />
Publikation<br />
unter dem Titel<br />
„Itallegro“ (Italiano<br />
+ Allegro)<br />
tummelt sich in<br />
vielen Facetten<br />
der Musiksprache – im Zusammenspiel<br />
von Worten und dem Wesen von Musik.<br />
Sie übersetzt und erläutert rund 400 italienische<br />
Begriffe von „abbandono“ bis<br />
„zingara“. Die Autorin will auf unterhaltsame<br />
Weise, auch anhand von Anekdoten,<br />
den Blick auf die Sprache öffnen und<br />
die Lust am Italienischen wecken: etwa<br />
auf die Herkunft eines Wortes oder dessen<br />
Verwendung im alltäglichen Sprachgebrauch.<br />
Bei einer Reihe von Begriffen<br />
ergeben sich überraschende Einsichten.<br />
Die Texte sind durch Illustrationen vom<br />
iranischen Künstler Mehrdad Zaeri vervollständigt:<br />
„Sie beleuchten den Text, sie<br />
wiederholen ihn nicht.“<br />
Das handliche quadratische Buch ist<br />
im Verlag „Breitkopf & Härtel“ erschienen<br />
und lädt ein zum Schmunzeln, Nachdenken<br />
und Nachklingen lassen. Es öffnet<br />
ein Zeitfenster für eine Pause im Alltag.<br />
Auch die Aussprache kommt nicht<br />
zu kurz: die wichtigsten Regeln sind im<br />
Buch aufgelistet und die allermeisten Wörter<br />
– vorgesprochen – zum Download auf<br />
www.breitkopf.com im mp3-Format abrufbar.<br />
Stephan Niederegger<br />
„Bolero“ fürs klassische Bläserquintett<br />
Eine Empfehlung für ambitionierte Ensembles<br />
Bis vor kurzem waren zwar Proben und Aufritte<br />
der gesamten Musikkapelle möglich,<br />
für viele dennoch problematisch oder organisatorisch<br />
nicht durchführbar. Das Spiel in<br />
kleinen Gruppen war daher eine willkommene<br />
Alternative und motivierte mancherorts<br />
vermehrt zum Ensemblespiel.<br />
Viele Verlage haben sich daher im Corona-Frühjahr<br />
und Sommer vor allem auf<br />
dieses Repertoire konzentriert und teils<br />
auch neue Werke und Arrangements veröffentlicht.<br />
Beim Stöbern nach entsprechendem<br />
Notenmaterial fällt ein Werk besonders<br />
ins Auge: Maurice Ravels „Bolero“.<br />
Christian Beyer wagt mit dieser Bearbeitung<br />
etwas, bei dem die meisten Arrangeure<br />
sicher die Hände über dem Kopf<br />
zusammengeschlagen hätten. Das Ergebnis<br />
ist jedoch beachtlich: eine (stil- und<br />
sinnvoll gekürzte) Fassung des bekannten<br />
Meisterwerkes, das durch geschickte Instrumentation<br />
die Klangfarben und -möglichkeiten<br />
des klassischen Bläserquintetts<br />
(Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott)<br />
vollständig ausreizt. Das Ostinato der kleinen<br />
Trommel kann ad libitum hinzugefügt<br />
werden. Für die ersten vier Takte sind Klappengeräusche<br />
von Oboe und Klarinette für<br />
die Einführung des Rhythmus zuständig.<br />
Das Arrangement ist im Verlag „Breitkopf<br />
& Härtel“ erschienen.<br />
Stephan Niederegger<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 29
Musikpanorama<br />
Generalversammlung unter besonderen Vorzeichen<br />
MK Zwölfmalgreien hofft auf baldige Rückkehr zur Normalität<br />
Es lief heuer alles anders als geplant,<br />
in diesem Jubiläumsjahr der Zwölfmalgreiner:<br />
Nicht nur die verschiedenen Veranstaltungen<br />
zum 100-jährigen Bestehen,<br />
sondern auch die alljährliche Generalversammlung<br />
musste von März auf Oktober<br />
verschoben werden und fand im Stadttheater<br />
Gries statt.<br />
Dabei hielt die Musikkapelle Rückschau<br />
auf das Tätigkeitsjahr 2019 und die ersten<br />
Monate <strong>2020</strong>. Obmann Stefan Declara und<br />
Kapellmeister Stefan Aichner bedankten<br />
sich bei allen Musikantinnen und Musikanten<br />
für ihren Einsatz und ihre Motivation.<br />
Sie sprachen die Möglichkeiten zum<br />
Proben und für Auftritte in den nächsten<br />
Monaten an und äußerten ihren Wunsch<br />
auf eine baldige Rückkehr zur Normalität.<br />
Im Rahmen der Versammlung wurden<br />
auch drei neue Musikanten aufgenommen:<br />
Felix Kössler, Lars Kusstatscher und<br />
Thomas Spögler spielen nun in den Reihen<br />
der Zwölfmalgreiner mit.<br />
Brigitte Thurner<br />
Kapellmeister Stefan Aichner (ganz links) und Obmann Stefan Declara (ganz rechts)<br />
mit den neu aufgenommenen Musikanten Lars Kusstatscher, Felix Kössler und<br />
Thomas Spögler (v. l.) © MK Zwölfmalgreien/Oliver Oppitz<br />
Alles Gute zur Goldenen Hochzeit!<br />
Die MK Niederdorf gratuliert ihrem Ehrenkapellmeister Sepp Walder und seiner Frau Christl<br />
Die Musikkapelle Niederdorf hat<br />
ihrem Ehrenkapellmeister Sepp<br />
Walder und seiner Frau Christl<br />
zum runden Hochzeitsjubiläum<br />
gratuliert. Die Chronik der Musikkapelle<br />
berichtet vom Hochzeitsständchen,<br />
das die Musikanten<br />
am 10. Oktober 1970 dem jungen<br />
Brautpaar in Oberlienz gespielt<br />
haben.<br />
Walder dirigierte die Kapelle<br />
mit kurzer Unterbrechung von<br />
1970 bis 1998. Für seine Verdienste<br />
wurde er daraufhin zum<br />
Ehrenkapellmeister ernannt. Zudem war<br />
er 40 Jahre lang Chorleiter und Organist<br />
in Niederdorf, derzeit in St. Sigmund. Die<br />
Ehrenkapellmeister Sepp Walder und<br />
seine Frau Christl wurden anlässlich<br />
ihres goldenen Hochzeitsjubiläums vom<br />
Vorstand der MK Niederdorf überrascht.<br />
Tradition im Verein will es, dass<br />
den Mitgliedern zu besonderen<br />
Hochzeitsjubiläen gratuliert wird.<br />
Das dazu geplante musikalische<br />
Stelldichein ist ausnahmsweise<br />
nicht den Covid-19-Bestimmungen,<br />
sondern dem schlechten<br />
Wetter zum Opfer gefallen.<br />
Obmann Robert Burger und der<br />
Vereinsvorstand haben es sich<br />
aber nicht nehmen lassen, das<br />
Jubelpaar mit einem Geschenkskorb<br />
zu überraschen und die<br />
Glückwünsche der gesamten<br />
Kapelle zu überbringen: „Ein Hoch auf<br />
das Jubelpaar!“<br />
-sn-<br />
30<br />
KulturFenster
Das Thema<br />
Heimatpflege<br />
Wenn die<br />
Wertschätzung<br />
fehlt …<br />
Beiträge für Landschaftspflege: Verband gibt<br />
Abwicklung der Ansuchen ab – Die Hintergründe<br />
Seit rund 50 Jahren ist der Heimatpflegeverband<br />
Südtirol erster Ansprechpartner<br />
für all jene, die ein bäuerliches Kleindenkmal<br />
errichten oder erhalten möchten und<br />
dabei finanzielle Unterstützung brauchen.<br />
Mit Ende des Jahres <strong>2020</strong> sieht sich der<br />
Heimatpflegeverband gezwungen, die Bearbeitung<br />
der Gesuche um entsprechende<br />
Beiträge für die Landschaftspflege an das<br />
Landesamt für Landschaftsschutz abzutreten.<br />
Nicht der fehlende Wille, sondern<br />
ganz andere Gründe liegen hinter dieser<br />
Entscheidung.<br />
Ein geflochtener Speltenzaun am Wegesrand,<br />
ein uriger Backofen am Hofeingang,<br />
eine Mühle nahe des Baches, ein<br />
Strohdach auf dem Stadel oder eine traditionelle<br />
Trockensteinmauer als Hangstütze<br />
– derart selten sind diese einst<br />
üblichen bäuerlichen Objekte geworden,<br />
dass sie im Vorbeigehen sofort ins<br />
Auge fallen, dass sie bestaunt und fotografiert<br />
werden. Unwillkürlich verbindet<br />
man sie mit der „guten alten Zeit“. Aber<br />
nicht nur: Sie stehen auch für Langlebigkeit,<br />
für traditionelles Handwerk, für die<br />
typische Südtiroler Landschaft und nicht<br />
zuletzt für einfaches Leben mitten in einer<br />
einzigartigen Natur: In einem Ofen<br />
wurde das Brot für ein ganzes Jahr gebacken.<br />
Eine Trockenmauer übersteht<br />
viele Jahrzehnte und ist ein wahres Biotop<br />
für Pflanzen und Tiere. Ein geflochtener<br />
Zaun dient als Einfriedung von Weideflächen<br />
und ist durch unterschiedliche<br />
Formen gleichzeitig ein Markenzeichen<br />
für eine Talschaft. Ein Schindel- oder ein<br />
Strohdach erfüllten alle Kriterien, die man<br />
heutzutage unter dem Begriff Nachhaltigkeit<br />
anführt. Nicht zuletzt sind Bildstöcke,<br />
Kapellen, Weg- und Feldkreuze religiöse<br />
Zeugnisse unserer Kulturlandschaft.<br />
Zeichen der Zeit<br />
Aber warum sind sie dann so selten geworden?<br />
Warum haben viele dieser Objekte<br />
die „gute alte Zeit“ nicht überdauert?<br />
Der langjährige Geschäftsführer des<br />
Heimatpflegeverbandes, Josef Oberhofer,<br />
hat darauf eine pragmatische Antwort:<br />
„Die Weiterentwicklung des bäuerlichen<br />
und die Veränderung des gesellschaftlichen<br />
Lebens, die Technisierung auf<br />
dem Hof …“ – kurzum: Es ist der Lauf<br />
der Zeit, der diese bäuerlichen Objekte<br />
zu Raritäten hat werden lassen. Aber gerade<br />
deshalb dürfen sie nicht aussterben<br />
oder rein musealen Zwecken zugeführt<br />
werden, wie Claudia Plaikner, die<br />
Obfrau des Heimatpflegeverbandes, betont:<br />
„Sie sind nämlich prägende Elemente<br />
der Kulturlandschaft und erzählen<br />
sowohl von der bäuerlichen Wirtschaftsweise<br />
als auch von einem praktisch-ästhetischen<br />
Gefühl für die Gestaltung von<br />
Landschaft und Wohnort.“<br />
Wie alles begann<br />
Den großen Wert der bäuerlichen Kleindenkmäler<br />
erkannte der Heimatpflegeverband<br />
schon vor rund sechs Jahrzehnten.<br />
Damals, Anfang der 1960er-Jahre, konnte<br />
er zunächst eine finanzielle Unterstützung<br />
von Seiten des Landes für Arbeit und Material<br />
beim Decken von Strohdächern (siehe<br />
eigenen Bericht) durchsetzen. Aber erst<br />
rund 20 Jahre später startete der damalige<br />
Obmann, Ludwig Walther Regele, eine<br />
erneute Initiative, und zwar zur Rettung<br />
alter Mühlen, deren Sanierung daraufhin<br />
durch einen eigenen sogenannten Mühlenfonds<br />
über das Landesamt für Kultur<br />
gefördert wurde.<br />
Wegkreuze sind stille Zeugen<br />
christlichen Glaubens.<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 31
Das Thema<br />
Nach und nach konnten weitere<br />
bäuerliche oder typisch ländliche<br />
Objekte mit Geld aus diesem<br />
Fonds saniert und dadurch erhalten<br />
werden. Waren es zunächst<br />
einzelne, so ließ ein Zeitungsartikel<br />
von Verbandsgeschäftsführer<br />
Josef Oberhofer über die Fördermöglichkeiten<br />
das Interesse an<br />
der Erhaltung dieser Kleindenkmäler<br />
ab dem Jahr 1991 schlagartig<br />
steigen. Immer mehr Bauern<br />
entdeckten den Wert dieses oder<br />
jenes scheinbar nicht mehr nützlichen<br />
Objektes und suchten um<br />
Beiträge an. Die Bereitstellung der<br />
Gelder musste deshalb auf zwei<br />
Landesämter aufgeteilt werden.<br />
Die Errichtung bzw. Erneuerung<br />
von Holzzäunen, Stroh- und Schindeldächern,<br />
Trockensteinmauern,<br />
Harpfen und Waalen wurde aus<br />
Mitteln des Amtes für Landschaftsschutz<br />
gespeist, Wegkreuze, Bildstöcke, Kapellen,<br />
Mühlen, Sonnenuhren, Dorfbrunnen,<br />
Backöfen und andere Objekte wurden vom<br />
Amt für Kultur gefördert. Seit rund 15 Jahren<br />
werden alle Erhaltungsmaßnahmen aus<br />
Mitteln des Landschaftsschutzes gespeist.<br />
Tausende Objekte erhalten<br />
Man kann ruhig behaupten, dass durch<br />
die Landschaftspflegebeiträge Tausende<br />
von bäuerlichen Kleindenkmälern, die das<br />
Kultur- und Landschaftsbild Südtirols prägen,<br />
vor dem Verfall gerettet wurden. Nur<br />
durch die finanzielle Unterstützung war es<br />
den Eigentümern überhaupt möglich, sie zu<br />
bewahren. Andererseits wurden zahlreiche<br />
Bauern durch die Förderungen dazu animiert,<br />
Zäune, Mauern oder Dächer auf traditionelle<br />
Weise zu errichten und dadurch<br />
zum Fortbestand der typischen Südtiroler<br />
Kulturlandschaft beizutragen.<br />
Dass bei der Sanierung oder Errichtung<br />
von bäuerlichen Kleindenkmälern immer<br />
auch ein wenig Passion und Liebe zur Tradition<br />
vorhanden sein müssen, versteht<br />
sich schon allein aus der Tatsache, dass<br />
die Förderbeiträge eben nur Beiträge sind<br />
und der rein wirtschaftliche Vorteil selten<br />
gegeben ist. Auch gibt es immer weniger<br />
Fachleute, die sich auf traditionelles<br />
Handwerk verstehen, und das Weitergeben<br />
von Erfahrungen durch die Bauern selber<br />
scheitert oft an fehlender Zeit oder mangelndem<br />
Interesse. Die Entscheidung für<br />
Schindeldächer sind nachhaltig<br />
und langlebig. Im Unterschied<br />
zu den Strohdächern findet man<br />
sie im ländlichen Raum auf<br />
Bauernhöfen noch recht häufig.<br />
den Erhalt der Kulturlandschaft ist daher<br />
oft eine schwierige. Gerade deshalb gebührt<br />
jenen, die sie treffen, große Wertschätzung.<br />
Immerhin sind es mittlerweile<br />
500 bis 600 Gesuchsteller pro Jahr, und<br />
die Beiträge belaufen sich jährlich auf insgesamt<br />
etwa 1,5 Millionen Euro.<br />
Verband als Initiator<br />
Soweit die Fakten – nun zur Rolle des Heimatpflegeverbandes<br />
in diesem Bereich: Er<br />
ist und war seit jeher erster Ansprechpartner<br />
für Eigentümer bäuerlicher Kleindenkmäler.<br />
Er kümmerte sich um die Beratung<br />
sowie um die Beitragsabwicklung. Dabei<br />
setzte ab den 1990er-Jahren vor allem Geschäftsführer<br />
Josef Oberhofer alles daran,<br />
den Eigentümern ihre Entscheidung zu erleichtern.<br />
Er erwirkte u. a., dass jene, die<br />
die Arbeiten selber durchführen, eine sogenannte<br />
Eigenrechnung ausstellen können,<br />
um an Beiträge zu gelangen. Er bemühte<br />
sich auch um ehrenamtliche Sachbearbeiter,<br />
die die Antragsteller vor Ort beraten<br />
und durch den Genehmigungsprozess<br />
führen (siehe eigenen Bericht). Ja sogar<br />
bei verschiedenen Handwerkern<br />
wurde er vorstellig, um sie für die<br />
traditionellen Arbeitsweisen zu<br />
gewinnen: So ließen sich etwa<br />
zwei Dachdecker in die Kunst<br />
des Strohdach-Deckens einweihen.<br />
Im Verbandsbüro im Bozner<br />
Waltherhaus hingegen wurden<br />
die eingereichten Gesuche<br />
weiterbearbeitet und an die zuständigen<br />
Ämter weitergeleitet.<br />
Woran es hakt<br />
„Für uns ist diese Tätigkeit zur<br />
Tradition geworden, und man verspürt<br />
eine gewissen Genugtuung,<br />
wenn man da und dort ein neu errichtetes<br />
Schindeldach oder einen<br />
handwerklich hergestellten Holzzaun<br />
sieht“, sagt Josef Oberhofer.<br />
Allerdings habe sich der Aufwand<br />
zum Erhalt von Beiträgen in den<br />
vergangenen Jahren enorm erhöht, und vor<br />
allem sei die Kommunikation mit der Abteilung<br />
für Natur, Landschaft und Raumentwicklung<br />
schlechter geworden: „Die Eigentümer<br />
müssen nicht nur immer strengere<br />
Auflagen erfüllen, sondern die Gesuche<br />
sind auch zunehmend kompliziert. Außerdem<br />
erachtet man es im genannten Landesamt<br />
offenbar nicht als notwendig, den<br />
Heimatpflegeverband in Entscheidungen<br />
einzubinden oder wenigstens vorab zu informieren,<br />
wenn zum Beispiel die Beitragsrichtlinien<br />
abgeändert werden.“<br />
Sämtliche Bemühungen um einen regelmäßigen<br />
Gedankenaustausch seien in den<br />
vergangenen Jahren stets abgeblockt worden.<br />
Man fühle sich als Bittsteller, zumal der<br />
Verband nunmehr jedes Jahr ein Angebot<br />
mit Spesenabschlag einreichen müsse, um<br />
diese Tätigkeit überhaupt durchführen zu<br />
können – obwohl er sie nicht nur initiiert,<br />
sondern auch viele Bauern erst dazu motiviert<br />
hat, Südtirols charakteristische Kulturgüter<br />
zu erhalten. „Wir erfahren immer<br />
erst im letzten Augenblick, ob unser Ansuchen<br />
angenommen wurde“, beklagt Josef<br />
Oberhofer. „Das alles zeugt von mangelnder<br />
Wertschätzung gegenüber dem Verband.“<br />
Der Geschäftsführer des Heimatpflegeverbandes<br />
merkt andererseits aber<br />
auch an, dass sich ein Anspruchsdenken<br />
in der Bevölkerung breit gemacht habe und<br />
Beiträge mitunter als Rechtsanspruch betrachtet<br />
würden: „Auch hier geht es letztendlich<br />
um Wertschätzung.“<br />
32<br />
KulturFenster
Heimatpflege<br />
Seltener Anblick: ein Paarhof (Felder) in Villanders, dessen altes Wohnhaus mit einem Schindeldach, der Stadel mit einem<br />
Strohdach gedeckt ist. (Fotos: Josef Oberhofer)<br />
Die Entscheidung<br />
Viel Herz, Zeit und Energie hat der Heimatpflegeverband<br />
in den vergangenen<br />
Jahrzehnten in die Erhaltung von bäuerlichen<br />
Kleindenkmälern gesteckt. Doch<br />
angesichts dieser Entwicklungen sieht er<br />
sich nicht mehr imstande, diese Tätigkeit<br />
fortzuführen. Nach langen Überlegungen<br />
und eingehenden Diskussionen im Vorstand<br />
und mit den Sachbearbeitern hat<br />
der Verband beschlossen, sich mit Ende<br />
des Jahres <strong>2020</strong> aus der Abwicklung der<br />
Vergabe von Beiträgen für die Landschaftspflege<br />
zurückzuziehen.<br />
„Bleiben Ratgeber“<br />
Obfrau Claudia Plaikner und ihren Mitarbeitern<br />
ist das Thema jedoch weiterhin<br />
ein großes Anliegen: „Ob und wie die<br />
Eigentümer von bäuerlichen Kleindenkmälern<br />
beim Amt für Natur, Landschaft<br />
und Raumentwicklung um die Landschaftspflegbeiträge<br />
ansuchen können,<br />
ist unklar. Es ist für den Verband jedoch<br />
sehr wichtig, dass dies auch weiterhin<br />
geschieht, damit diese wertvollen kleinen<br />
kulturlandschaftlichen Akzente erhalten<br />
bleiben.“ Letztendlich hänge es<br />
aber vom Besitzer selbst ab, ob er generell<br />
den Wert dieser Kulturelemente erkennt<br />
und auch deren Umgebung pflegt.<br />
Die Obfrau betont, dass sich der Heimatpflegeverband<br />
weiterhin für die Förderung<br />
der Landschaftspflege einsetzen<br />
wird: „Zwar ist die Betreuung der Gesuchsabwicklung<br />
an das Verwaltungsamt<br />
für Raum und Landschaft zurückgefallen,<br />
wir bleiben jedoch Ratgeber<br />
für offene Fragen in diesem Bereich.“<br />
Dem Heimatpflegeverband gibt die<br />
nunmehr frei werdende Kapazität die Möglichkeit,<br />
sich einigen anderen wichtigen<br />
Bereichen verstärkt zu widmen, etwa der<br />
Sensibilisierung der Gesellschaft für die<br />
Baukultur des Landes, aber auch der Zusammenarbeit<br />
mit Schulen und Jugendorganisationen.<br />
Edurh Runer<br />
Landschaftspflege in Zahlen<br />
» 1.500.000 Euro werden jährlich ungefähr<br />
für Landschaftspflegebeiträge<br />
bereitgestellt.<br />
» 500 bis 600 Eigentümer stellen jährlich<br />
einen Beitragsantrag.<br />
» 322 Holzzäune wurden 2019 saniert<br />
bzw. errichtet, womit die Holzzäune<br />
an erster Stelle der Objekte stehen,<br />
die mit Hilfe von Beiträgen erhalten<br />
werden.<br />
» 154 Schindeldächer wurden 2019<br />
saniert bzw. errichtet – damit liegen<br />
diese an zweiter Stelle.<br />
» 9 Wegkreuze, 8 Bildstöcke, 6 Kapellen<br />
und 4 Mühlen lautet die weitere<br />
Reihenfolge der bäuerlichen Kleindenkmäler<br />
auf der Beitragsliste 2019.<br />
Die Anzahl der Strohdächer indessen<br />
sinkt kontinuierlich. Ungefähr 10 gibt es<br />
noch in ganz Südtirol, 4 davon in Vöran.<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 33
Das Thema<br />
Begutachten, beraten,<br />
begleiten<br />
Sachbearbeiter Franz Fliri blickt zurück<br />
Eine restaurierte Kapelle in Naturns: Franz Fliri hat die Arbeiten als ehrenamtlicher<br />
Sachbearbeiter begleitet.<br />
Franz Fliri<br />
In folgendem Bericht erzählt Franz Fliri, der dienstälteste Sachbearbeiter für die bäuerlichen<br />
Kleindenkmäler im Heimatpflegeverband Südtirol, über seine mehr als 30-jährige<br />
Tätigkeit, bei der er viele gute und nur wenige negative Erfahrungen gemacht hat.<br />
Mit der Einstellung der Tätigkeit des Verbandes im Bereich der Landschaftspflegeprämien<br />
geht nun auch die Ära der ehrenamtlichen Sachbearbeiter zu Ende.<br />
Aufgewachsen in einer großen Bergbauernfamilie<br />
auf dem Naturnser Sonnenberg,<br />
wurde der Bezug zur Natur- und<br />
Kulturlandschaft schon im Kindesalter<br />
gelegt. Der Grundsatz, mit der Natur<br />
zu leben und zu arbeiten, war überall<br />
sichtbar.<br />
Für mich war immer klar: Der Erhalt der<br />
Natur- und Kulturlandschaft mit all den<br />
bäuerlichen Kleindenkmälern ist zu unterstützen.<br />
Die Landesregierung unter Landeshauptmann<br />
Dr. Silvius Magnago sah<br />
dies auch so und sicherte eine finanzielle<br />
Unterstützung zu, wenn diese bäuerlichen<br />
Kleindenkmäler erhalten und<br />
gepflegt werden.<br />
Im Jahr 1987 wurde ich vom damaligen<br />
Kulturreferenten der Gemeinde Naturns,<br />
Josef Pircher, für die ehrenamtliche Tätigkeit<br />
als Sachbearbeiter beauftragt. Unter<br />
Anleitung des hoch geschätzten Rittner<br />
Heimatpflegers Hans Rottensteiner erfolgte<br />
die notwendige Einschulung.<br />
Seitdem bin ich in den Gemeinden im<br />
Untervinschgau, einige Jahre auch im Martelltal,<br />
ehrenamtlich und bis zur Pensionierung<br />
in meiner Freizeit unterwegs, und<br />
das sehr oft auch an Sonn- und Feiertagen.<br />
Wenn man mit Herzblut dabei ist, geht<br />
vieles leichter, man nimmt jede Anstrengung<br />
gerne in Kauf, da spielen das Wetter<br />
oder längere Fußmärsche keine Rolle.<br />
Bei den vielen Beratungen und Abnahmen<br />
über die Jahre herauf darf ich Folgendes<br />
anmerken:<br />
• Den allermeisten Antragstellern war und<br />
ist der Erhalt der bäuerlichen Kleindenkmäler<br />
ein großes Anliegen. Ein<br />
Verschwinden dieser prägenden Landschaftselemente<br />
– das war und ist auch<br />
ihnen bewusst – kommt einer Ausräumung<br />
der Landschaft gleich.<br />
• Für einige Eigentümer war der vom Gesetz<br />
festgelegte Beitrag jedoch viel zu<br />
niedrig angesetzt, somit wurde das Objekt<br />
dem Verfall preisgegeben.<br />
• Die Wertschätzung gegenüber den Sachbearbeitern<br />
für deren ehrenamtliche Tätigkeit<br />
verringerte sich in den vergangenen<br />
Jahren wesentlich. Dazu hat sicher<br />
die Hektik dieser Zeit beigetragen.<br />
34<br />
KulturFenster
Heimatpflege<br />
Viele Wetterunbilden hätte dieser Holzzaun im Schnalstal<br />
nicht mehr überstanden.<br />
Und so zeigt sich der Zaun heute.<br />
Ich zeige hier stellvertretend einige<br />
Erlebnisse auf:<br />
• Ich kann mich noch genau an das<br />
erste Beratungsgespräch am Naturnser<br />
Sonnenberg erinnern, bei dem<br />
ich auf die traditionelle Errichtung<br />
eines Lattenzaunes hinwies, inklusive<br />
der aufwendigen Antragstellung, mit<br />
Schreibmaschine geschrieben. Nach<br />
Abschluss der Arbeiten erfuhr dieser<br />
Zaun hohe Wertschätzung und war<br />
beispielgebend für den Erhalt des<br />
Landschaftsbildes.<br />
• In guter Erinnerung bleibt mir auch<br />
die Sanierung einer wasserbetriebenen<br />
Mühle in der Talsohle im Untervinschgau.<br />
Von Beginn an war ich<br />
dabei, sei es für die Beratung, sei es<br />
bei der Durchführung der Arbeiten.<br />
Eine wasserbetriebene Mühle in Funktion<br />
hat wirklich Seltenheitswert. Die<br />
Mühle ist für Vorführungen für Schulklassen,<br />
Einheimische sowie auch<br />
Touristen geöffnet.<br />
• Einen negativen Eindruck hinterließ<br />
es bei mir, wenn einige Antragsteller<br />
bei den zuständigen Ämtern die Verringerung<br />
oder Ablehnung des Beitrages<br />
aufgrund von nicht fachgerechter<br />
Ausführung hinterfragten.<br />
Der Anblick der vielen Ordner voll von Ansuchen,<br />
Beratungs- und Abnahmeprotokollen<br />
erweckt dennoch eine Zufriedenheit,<br />
etwas zum Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft<br />
beigetragen zu haben.<br />
Was die weitere Unterstützung seitens<br />
des Landes betrifft, hoffe ich sehr, dass dies<br />
nach wie vor gewährleistet bleibt.<br />
Bäuerliche Kleindenkmäler gibt es überall<br />
in ganz Südtirol, und sie müssen unabhängig<br />
vom Ort bzw. der Talschaft unterstützt<br />
werden. Ein Holzzaun im Vinschgau,<br />
ausgeführt in ortstypischer Bauweise, hat<br />
den gleichen Stellenwert wie am Salten<br />
oder Passeier, eine Trockenmauer am Vinschger<br />
Sonnenberg gleich wie im Eisacktal,<br />
Schindeldächer im Schnalstal gleich<br />
wie in Ulten; die Auflistung könnte beliebig<br />
weiter geschrieben werden.<br />
Ein Anliegen ist es mir, die Wertschätzung<br />
gegenüber der Natur- und Kulturlandschaft<br />
zu steigern, und zwar in allen<br />
Bevölkerungsschichten, damit die vielen<br />
wertvollen Kleinode unserer Heimat nicht<br />
nach und nach der Gewinnmaximierung<br />
geopfert werden. Das Tourismusland Südtirol<br />
wirbt weltweit mit der intakten Landschaft,<br />
die es mittlerweile fast gar nicht<br />
mehr gibt.<br />
Abschließend sage ich allen Beteiligten<br />
ein großes Vergelt`s Gott für die Begleitung<br />
über die ganzen Jahre herauf bei dieser<br />
doch aufwendigen Arbeit, vor allem auch<br />
meiner Familie für das Verständnis. Mit einschließen<br />
darf ich die Mitarbeiter im Verbandsbüro,<br />
Ehrenobmann Dr. Peter Ortner<br />
und Landesobfrau Dr. Claudia Plaikner.<br />
Franz Fliri<br />
Jetzt, nach 33-jähriger ehrenamtlicher<br />
Tätigkeit als Sachbearbeiter, kommt bestimmte<br />
Wehmut auf, aber bestimmte<br />
Gegebenheiten lassen ein Weiterarbeiten<br />
nicht mehr zu.<br />
Der Sachbearbeiter braucht viel Gespür, um Eigentümer vom Erhalt eines<br />
bäuerlichen Kleindenkmales zu überzeugen und sie gut zu beraten. Im Bild eine<br />
Trockensteinmauer in Partschins.<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 35
Das Thema<br />
„Menschen für unsere<br />
Themen sensibilisieren“<br />
Claudia Plaikner im Gespräch über die Neuausrichtung des<br />
Heimatpflegeverbandes<br />
Claudia Plaikner, Obfrau des<br />
Heimatpflegeverbandes Südtirol<br />
Wo eine Tür geschlossen wird, öffnet sich<br />
bekanntlich eine andere. Das hofft auch<br />
der Heimatpflegeverband Südtirol, wenn<br />
er nun den bürokratisch und zeitlich sehr<br />
aufwendigen Sachbereich der Landschaftspflegebeiträge<br />
(siehe eigenen Bericht) abgibt.<br />
Obfrau Claudia Plaikner hat sich mit<br />
ihrem Vorstand, den Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeitern bereits über neue Zukunftspläne<br />
abgesprochen.<br />
KulturFenster: Frau Plaikner, wie geht es<br />
Ihnen persönlich mit der Entscheidung<br />
des Heimatpflegeverbandes, ab 2021<br />
den Sachbereich der Landschaftspfl e-<br />
gebeiträge für bäuerliche Kleindenkmäler<br />
abzugeben?<br />
Claudia Plaikner: Tatsache ist, dass unsere<br />
Halbtageskraft Daniela Donolato Wiedenhofer<br />
in den vergangenen Jahren immer<br />
intensiver und fast ausschließlich<br />
mit der Bearbeitung der Unterlagen für<br />
die Landschaftspfl egebeiträge beschäftigt<br />
war. Abgesehen von den<br />
Kommunikationsproblemen mit<br />
der zuständigen Landesabteilung<br />
wurde es auch für unsere<br />
ehrenamtlichen Sachbearbeiter<br />
immer schwieriger, die Antragsteller<br />
zu betreuen, und die<br />
Wertschätzung ließ manchmal<br />
zu wünschen übrig. Die meisten<br />
Sachbearbeiter haben zudem ein<br />
Alter erreicht, in dem die körperlichen<br />
Anforderungen für diese<br />
Aufgabe langsam zu hoch werden.<br />
Deshalb war die Entscheidung<br />
des Verbandes am Ende<br />
einhellig und entschlossen. Ich<br />
persönlich habe mir auch schon<br />
länger Gedanken gemacht, wie<br />
wir die nun frei werdenden zeitlichen<br />
Ressourcen besser nutzen<br />
können.<br />
KF: Wie sieht der Plan aus?<br />
C. Plaikner: Es geht weniger um einen<br />
einzelnen Plan als um eine Neuausrichtung<br />
des Verbandes. Ich denke, wir müssen<br />
viel mehr Energie in die Sensibilisierung<br />
der Bevölkerung für die Themen<br />
der Heimatpflege stecken, angefangen<br />
bei der Jugend bis hin zu den Entscheidungsträgern<br />
vor Ort in den Gemeinden.<br />
KF: Wie wollen Sie die jungen Menschen<br />
für Ihre Themen gewinnen?<br />
C. Plaikner: Wir müssen in die Schulen<br />
und Jugendorganisationen gehen. Das bedarf<br />
natürlich einer guten Vorbereitung,<br />
zumal es noch an didaktischem Material<br />
und an konkreten Projekten fehlt. Aber<br />
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
im Verbandssitz sind sehr aufgeschlossen<br />
für junge Themen und auch für moderne<br />
Kommunikation. Dazu gehören die<br />
digitalen Kanäle und sozialen Medien, die<br />
wir künftig besser bedienen möchten.<br />
KF: Die Entscheidungsträger vor Ort sitzen<br />
in den Gemeindestuben, wo derzeit<br />
die neuen Bestimmungen im Gesetz für<br />
Raum und Landschaft das große Thema<br />
sind. Was kommt da auf die Gemeinden,<br />
was auf den Heimatpflegeverband zu?<br />
C. Plaikner: Die Gemeinden werden mit<br />
neuen und aufwendigen Aufgaben betraut.<br />
Deswegen ist es wichtig, deren Vertreter<br />
und Mitarbeiter inhaltlich zu begleiten,<br />
wenn es um die Ortsbild- und Landschaftsgestaltung<br />
geht. Aktuell ist diesbezüglich<br />
bereits ein Leader-Projekt für fünf Gemeinden<br />
im Pustertal in Ausarbeitung, das der<br />
Verband mit betreut. Es geht darum, die<br />
Attraktivität des ländlichen Raumes als<br />
Lebens- und Wirtschaftsraum zu erhal-<br />
„Die Gemeinden werden mit neuen und aufwendigen<br />
Aufgaben betraut. Deswegen ist es wichtig, deren<br />
Vertreter und Mitarbeiter inhaltlich zu begleiten,<br />
wenn es um die Ortsbild- und Landschaftsgestaltung<br />
geht.“<br />
36<br />
KulturFenster
Heimatpflege<br />
Die Baukultur, die Gestaltung des öffentlichen Raumes sowie die Erhaltung und Verbesserung des kulturellen und natürlichen<br />
Erbes sind einige der Themen, die der Heimatpflegeverband gemeinsam mit den Gemeinden aufarbeiten möchte. (Foto: HPV)<br />
ten und gleichzeitig weiterzuentwickeln.<br />
Da werden dann ganz unterschiedliche<br />
Themen wie die Baukultur, die Gestaltung<br />
des öffentlichen Raumes, die Erhaltung<br />
und Verbesserung des kulturellen und<br />
natürlichen Erbes, die Sensibilisierung<br />
für eine ressourcenschonende und gesunde<br />
Lebensart und anderes mehr in<br />
das Blickfeld genommen. Ziel des Verbandes<br />
ist es unter anderem, zu einer<br />
Anlaufstelle für Gemeinden zu werden,<br />
wo wir Hilfestellung bei der Ausarbeitung<br />
von Projekten geben. Generell möchten<br />
wir auch weiterhin kompetente Ansprechpartner<br />
für an der Erhaltung der Kulturund<br />
Naturlandschaft Interessierte und<br />
Engagierte sein.<br />
KF: Welche Schritte wird der Verband in<br />
Sachen Neuausrichtung als Erstes setzen?<br />
C. Plaikner: Wir möchten jedes Verbandsarbeitsjahr<br />
unter ein Schwerpunktthema<br />
stellen. 2021 wird es die Baukultur sein.<br />
Dabei denken wir an eine größere Tagung,<br />
zu der wir unsere Partner aus der<br />
Denkmalpflege, aus unseren Netzwerken<br />
und aus der Forschung zusammenbringen<br />
möchten. In Ausarbeitung ist im Moment<br />
auch unser Imagefolder, mit dem wir<br />
die Arbeit des Verbandes bekannter machen<br />
und um Mitstreiter werben möchten.<br />
Die Zeitschrift „KulturFenster“ wird<br />
ab der nächsten Ausgabe ein neues grafisches<br />
Bild sowie auch einige inhaltliche<br />
Verbesserungen erhalten.<br />
Interview: Edith Runer<br />
KulturFenster<br />
Redaktion KulturFenster<br />
Ihre Beiträge für die Heimatpflege im KulturFenster senden Sie bitte an: florian@hpv.bz.it<br />
Für etwaige Vorschläge und Fragen erreichen Sie uns unter folgender Nummer: +39 0471 973 693 (Heimatpflegeverband)<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 37
Informiert und Reflektiert<br />
Eine schöne Bescherung<br />
Zur Geschichte der Weihnachtsgeschenke<br />
Advent und Weihnachten sind heuer anders.<br />
Es finden keine Christkindlmärkte statt, größere<br />
Feiern mit Verwandten, Arbeitskollegen<br />
oder Freunden fallen aus. Auch der<br />
Austausch von Geschenken kann nicht unbeschwerlich<br />
erfolgen, wie in Zeiten vor<br />
Corona. Das bietet die Gelegenheit nachzudenken,<br />
wie das weihnachtliche Schenken<br />
entstanden ist und welche Entwicklungen<br />
es bis heute genommen hat.<br />
Der Brauch des Schenkens ist alt. Der<br />
Brauch des weihnachtlichen Schenkens<br />
nicht. Bis ins frühe 20. Jahrhundert war<br />
der Heiligabend beim Großteil der Familien<br />
in Tirol geprägt von Gebet, Räuchern,<br />
der Christmette und einem guten Essen.<br />
Als unsichtbarer Gabenbringer, der den<br />
Kindern Äpfel, Nüsse und Mispeln in einen<br />
Teller legte, galt der Heilige Nikolaus.<br />
Vom Nikolaus zum Christkind<br />
Anders in Deutschland. Da war das Christkind<br />
in adeligen Familien schon früh präsent,<br />
wie Hinweise zeigen. So schwärmt<br />
Lieselotte von der Pfalz (1652–1722) in ihren<br />
Erinnerungen, dass es „neue Kleider,<br />
Silberzeug, Puppen, Zuckerwerk und alles<br />
Mögliche brachte“.<br />
Um 1535 hat Martin Luther im Zuge<br />
der Reformation die Bescherung am Nikolausabend<br />
abgeschafft. Ob er auch der<br />
Erfinder des Christkindes ist, wie oft angenommen,<br />
kann nicht belegt werden,<br />
wenngleich er es als Gabenbringer<br />
erwähnt hat.<br />
Die deutsche Volkskundlerin Sabine<br />
Wienker-Piepho ortete die Verbreitung<br />
des Christkindes zuerst nur im evangelischen<br />
Deutschland, bis es sich dann<br />
nach Bayern ausbreitete und nach und<br />
nach Teil des familiären Feierns in katholischen<br />
Familien wurde. Beschenkt wurden<br />
die Kinder, die Wunschzettel ans Christkind<br />
schrieben.<br />
Grödner Kunst in Deutschland<br />
Auf den Weihnachtsmärkten in Deutschland<br />
und Österreich oder auf den Nikolausund<br />
Thomasmärkten in Tirol gab es<br />
Kerzen, Krippenfiguren, Spielzeug für<br />
Kinder und Christbaumschmuck zu<br />
kaufen. Den Händlern ging es natürlich<br />
um das Geschäft. Doch<br />
dies darf nicht nur kritisch gesehen<br />
werden, denn der Verkauf<br />
sicherte vielen Familien<br />
ihre Existenz. So waren<br />
die Erzeugnisse aus dem<br />
Grödental sehr beliebt. In<br />
einem Inserat in der „Bludenzer<br />
Zeitung“ in Vorarlberg im <strong>Dezember</strong><br />
1908 werden von einem Geschäft Puppen,<br />
Christbaumschmuck und „Grödner<br />
Holzspielwaren“ angeboten.<br />
Trotz der Bescherung, die bei vielen<br />
Familien in Tirol aus Armutsgründen ausblieb,<br />
standen der religiöse Inhalt, die<br />
Krippe und das Beisammensein im Mittelpunkt<br />
des Festes. Daher waren jene<br />
Weihnachten, an denen ein Platz in der<br />
Familie leer blieb, traurige Weihnachten.<br />
Während der Weltkriege gedachte man besonders<br />
der Männer an der Front. In der<br />
Tauferer Schulchronik ist nachzulesen:<br />
Spielzeugpferde zählten neben<br />
den Holzpuppen zu den<br />
beliebtesten Artikeln und<br />
wurden in verschiedenen Größen<br />
hergestellt, teils auf Rollbretter<br />
montiert, teils ohne.<br />
38<br />
KulturFenster
Heimatpflege<br />
Der Brauch des Schenkens ist alt. Der Brauch des<br />
weihnachtlichen Schenkens nicht. Bis ins frühe 20.<br />
Jahrhundert war der Heiligabend beim Großteil der<br />
Familien in Tirol geprägt von Gebet, Räuchern,<br />
der Christmette und einem guten Essen.<br />
„Die Mädchen strickten im Winter 1914–<br />
1915: 145 Paar Socken, 25 Wadenstutzen,<br />
82 Schneehauben, 40 Paar Pulswärmer,<br />
8 Paar Kniewärmer, 3 Paar Fäustlinge, 1<br />
Leibbinde und zupften eine Menge Wundfäden<br />
für die Soldaten; 3 große Säcke voll<br />
Erdbeer- und Brombeerblätter wurden von<br />
den Schülern gesammelt." In die Pakete<br />
wurden oft Tannen- oder Fichtenzweige<br />
gelegt, als weihnachtlicher Gruß.<br />
Zunehmende<br />
Kommerzialisierung<br />
Im Laufe des 20. Jahrhunderts erlebte<br />
das Weihnachtsfest große Veränderungen.<br />
Die wachsende Konzentration auf die Geschenke<br />
ging Hand in Hand mit der allgemeinen<br />
Kommerzialisierung. Rainer Kampling,<br />
Theologieprofessor an der Freien<br />
Universität Berlin, spricht von zwei Ausformungen<br />
des Festes, einem „christlich<br />
begründeten und gefeierten und einem<br />
säkularisierten Fest“.<br />
18. Jahrhundert zurückreicht und sich<br />
als Synonym für alle männlichen, weihnachtlichen<br />
Gabenbringer entwickelt<br />
hat, und dem Coca-Cola-Weihnachtsmann,<br />
der 1931 aus Werbezwecken<br />
entstanden und weltberühmt geworden<br />
ist.<br />
- Was schenken? In der Zeit des materiellen<br />
Überflusses entwickeln sich<br />
neue Formen des Schenkens: Gutscheine<br />
für Zeit, für Hilfeleistungen.<br />
In manchen Familien wird das Engele-Bengele-Spiel<br />
gepflegt, oder<br />
es wird vereinbart, dass nur selbstgemachte<br />
Geschenke ausgetauscht<br />
werden oder ganz darauf verzichtet<br />
wird.<br />
- Schenken heißt teilen… Solidarität mit<br />
Menschen, die Hilfe brauchen, wird<br />
auch in Südtirol jährlich durch große<br />
Spendenaktionen und Hilfsprojekte<br />
gefördert.<br />
- Weinachten und Neujahr: Bei den<br />
Römern gab es Neujahrsgeschenke,<br />
verbunden mit den Glückwünschen.<br />
Diese Tradition lebt fort in<br />
Geldgeschenken, die an Briefträger,<br />
Kaminkehrer und Hausmeister vergeben<br />
werden, oder in Geschenken an<br />
Geschäftskunden.<br />
- Geschenkpapier, ja oder nein? Ab 1910<br />
soll es Geschenkpapier, bedruckt mit<br />
weihnachtlichen Motiven gegeben haben,<br />
doch der genaue Zeitpunkt ist unklar.<br />
Heute werden auch alternative,<br />
phantasiereiche Verpackungen oder<br />
die Wiederverwendung von Papier propagiert,<br />
um Müll zu vermeiden.<br />
Barbara Stocker<br />
Literatur:<br />
Feichter, Josef, Tauferer<br />
Schul- und allgemeine<br />
Chronik, Mühlen 1984;<br />
Eberspächer Martina,<br />
Der Weihnachtsmann.<br />
Stuttgart 2002;<br />
Weber-Kellermann,<br />
Ingeborg, Das Weihnachtsfest.<br />
Luzern und<br />
Frankfurt 1978.<br />
Ein Kugelspiel<br />
aus Holz<br />
Fotos: Museum<br />
Gherdëina<br />
Welche Merkmale lassen sich<br />
heute beobachten?<br />
- Geben oder Schenken? Das Wort Schenken<br />
bedeutete ursprünglich „schief halten“<br />
im Sinne von „einschenken“. Die<br />
Geschenke wurden als Gaben bezeichnet.<br />
Darunter fallen Opfergaben, Liebesgaben,<br />
Almosen und andere. Heute<br />
ist von Gaben noch im sakralen Bereich<br />
die Rede.<br />
- Christkind oder Weihnachtsmann?<br />
Die unsichtbaren Gabenbringer Nikolaus<br />
und Christkind haben vom Weihnachtsmann<br />
Konkurrenz erhalten.<br />
Doch hier gilt es zu unterscheiden zwischen<br />
dem in Deutschland gebrauchten<br />
Begriff Weihnachtsmann, der bis ins<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 39
Informiert und Reflektiert<br />
Die Salzkirche<br />
Dinge des Alltags aus Geschichte und Gegenwart<br />
Für geweihtes Salz gab es in früheren Jahrhunderten<br />
ein besonderes Behältnis. Heute<br />
weiß kaum noch jemand, was eine Salzkirche<br />
ist.<br />
In vergangenen Jahrhunderten war<br />
Salz teuer, kostbar und etwas Besonderes.<br />
Auch im 20. Jahrhundert war es nicht immer<br />
selbstverständlich, Salz vorrätig zu<br />
haben. Als es im Zweiten Weltkrieg eine<br />
Knappheit gab, konnte man jemandem<br />
mit einem Säckchen Salz eine Freude bereiten,<br />
weiß der Volkskundler Hans Grießmair<br />
zu erzählen.<br />
Salz spielte nicht nur als Gewürz, zum<br />
Haltbarmachen von Speisen oder<br />
in der Volksmedizin eine Rolle, es<br />
hat bis zum heutigen Tag auch<br />
eine religiöse Bedeutung. Daher<br />
ist anzunehmen, dass es im<br />
18. Jahrhundert in Pfarrhaushalten,<br />
Klöstern und vielleicht<br />
auch in privaten Haushalten<br />
für das geweihte Salz eigene<br />
Behältnisse gab. Im Eisacktal,<br />
von Kollmann bis Feldthurns,<br />
sind Salzkirchen bekannt, aber auch aus<br />
Seis, Kastelruth, St. Peter und Lajen gibt<br />
es Anhaltspunkte dafür. Es handelt sich<br />
dabei um aus Holz geschnitzte Behälter<br />
in der Form einer Kirche mit einer größeren<br />
Öffnung an einer Stelle, damit das Salz<br />
hineingeschüttet und entnommen werden<br />
kann. Die Behälter sind nicht immer<br />
von fachlicher Hand geschnitzt, sondern<br />
wahrscheinlich in Heimarbeit entstanden.<br />
Wer eine Salzkirche besaß, wird sie um<br />
Dreikönig gefüllt haben, wenn Wasser und<br />
Salz geweiht wurden. Klaus Beitl schreibt,<br />
dass dort Salzsteine aufbewahrt worden<br />
sind, „die nach der Weihe am Dreikönigstag<br />
aus dem mit Chrysam- oder<br />
Taufwasser in einer Schüssel angesetztem<br />
Salz gewonnen werden“.<br />
Leider sind rund um die Salzkirchen<br />
mehrere Fragen offen,<br />
denn in der Literatur finden sich<br />
keine detaillierten Angaben zur<br />
Herstellung, Verwendung und<br />
Verbreitung.<br />
Barbara Stocker<br />
Literatur:<br />
Klaus Beitl, Volksglaube,<br />
Salzburg 1978<br />
Grießmair, Hans,<br />
Bewahrte Volkskultur, zweite, bearbeite<br />
und erweiterte Auflage, 2013<br />
Salzkirche mit Reliquie<br />
des hl. Johannes vom<br />
Kreuz, an der Turmfassade<br />
Darstellung des hl.<br />
Christophorus (Foto: Südtiroler<br />
Volkskundemuseum,<br />
SVM L/1203)<br />
40<br />
KulturFenster
Heimatpflege<br />
Nicht alles Gold,<br />
was glänzt<br />
Josef Oberhofer hielt bei einem Kongress<br />
des Bundes Heimat und Umwelt<br />
(Deutschland) einen Vortrag.<br />
Eine ganze Reihe von Landesgesetzen, EU-<br />
Richtlinien, internationalen Konventionen<br />
und Abkommen stellen den Schutz von Kultur-<br />
und Naturlandschaft in den Vordergrund.<br />
Doch nicht alles, was glänzt, ist auch wirklich<br />
Gold, wie Josef Oberhofer in einem Referat<br />
bei einem Kongress des Bundes Heimat<br />
und Umwelt in Deutschland kritisch bemerkte.<br />
Der Bund Heimat und Umwelt in Deutschland<br />
ist gewissermaßen der deutschlandweite<br />
Heimatpflegeverband, mit dem auch<br />
der Südtiroler Heimatpflegeverband gut zusammenarbeitet.<br />
Deshalb lud der Bund zu<br />
seinem zweiten großen Kongress unter dem<br />
Thema „Heimat in Europa“ auch die<br />
Südtiroler Beteiligung bei Kongress<br />
„Heimat in Europa“<br />
Südtiroler Heimatpfleger ein. Zwar musste<br />
die zweitägige Veranstaltung coronabedingt<br />
ins Internet verlegt werden, dennoch zeugen<br />
700 Klicks vom großen Interesse am Thema.<br />
Richtlinien, Programme<br />
und ihre Grenzen<br />
Beim Kongress ging es um wichtige Herausforderungen<br />
für „Heimat in Europa“,<br />
von der nachhaltigen Entwicklung über<br />
Partizipation und Inklusion bis hin zum digitalen<br />
Engagement. Josef Oberhofer, Geschäftsführer<br />
des Heimatpflegeverbandes,<br />
hielt einen Vortrag, in dessen Mittelpunkt<br />
die Frage stand, wo „Europa vor Ort“ ist, inwieweit<br />
also die kleine Provinz im Norden<br />
Italiens mit Hilfe von europäischen Richtlinien,<br />
aber auch internationalen Konventionen,<br />
EU-Programmen und dergleichen den<br />
Schutz der Kultur- und Naturlandschaft vorantreiben<br />
kann.<br />
Dabei nannte er u. a. die europäische<br />
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie,<br />
aber auch die Internationale<br />
Alpenschutzkonvention.<br />
Leider habe Italien bisher nur acht der<br />
neun Protokolle der Alpenschutzkonvention<br />
unterzeichnet und das für das Transitland<br />
Südtirol wichtige Verkehrsprotokoll<br />
außen vor gelassen, beklagte Josef Oberhofer.<br />
Dieses sehe vor, dass keine neuen<br />
alpenquerenden Straßen gebaut, Flughäfen<br />
nicht erheblich ausgebaut und die Schadstoff-<br />
und Umweltbelastungen begrenzt<br />
werden müssen. Die Folge: „Es wird auf<br />
allen Ebenen rücksichtslos weitergebaut,<br />
womit Südtirol wohl kaum die EU-Klimaziele<br />
für 2030 erreichen wird.“<br />
Anders sei es mit den Natura-2000-Gebieten,<br />
ein EU-Projekt mit dem Ziel der Artenvielfalt,<br />
das vor allem in der Südtiroler Bevölkerung<br />
gute Akzeptanz fi nde. Immerhin<br />
seien in Südtirol derzeit 44 Natura-2000-Gebiete<br />
ausgewiesen, die rund ein Fünftel der<br />
Landesfläche einnehmen.<br />
Etwas Vorsicht sei indessen bei den EU-<br />
Leader-Programmen geboten, zumal sich einige<br />
eher als Fluch denn als Segen herausgestellt<br />
hätten. Josef Oberhofer nannte als<br />
Beispiel ein Wegeprojekt im Martelltal: Das<br />
als Wander- und Viehtriebsweg geplante Projekt<br />
sollte nämlich in Wahrheit eine Quad-<br />
Piste werden.<br />
Internationaler Austausch<br />
sehr wichtig<br />
Selbst die Eintragung von Natur- und Kulturstätten<br />
in die Welterbeliste der UNESCO<br />
erreiche nicht immer den in ihren Ansätzen<br />
gut gemeinten Erfolg: „Die fokussierten<br />
Objekte und Kulturstätten werden häufig<br />
durch eine touristische Vermarktung ihrer<br />
Seele beraubt und zu einem kurzlebigen<br />
Eventobjekt degradiert.“ Ein Beispiel dafür<br />
seien die Dolomiten.<br />
Josef Oberhofer kam zum Schluss,<br />
dass es trotz oder gerade wegen der vielen<br />
Hürden, die einen Schutz von Kulturerbe<br />
und Landschaft schwierig machen,<br />
der internationale Austausch mit anderen<br />
Verbänden und Organisationen<br />
sehr wichtig sei. Er nannte<br />
u. a. den Bund Heimat und<br />
Umwelt, CIPRA International,<br />
Europa Nostra, aber auch die<br />
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino,<br />
die in gewissen Belangen ein<br />
guter Ansprechpartner sei.<br />
Natura-2000-Gebiete in Südtirol<br />
Karte: www.provinz.bz.it/natur-umwelt/<br />
natur-raum/natura2000/natura-2000-<br />
gebiete-in-suedtirol<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 41
Informiert und Reflektiert<br />
Für intakte Nahversorgung<br />
Verband warnt: Geplante Durchführungsverordnung im<br />
Bereich Einzelhandel nicht aufweichen<br />
Nur eine strikte Raumordnungs- und Handelspolitik kann die Ortszentren am Leben erhalten.<br />
Die geplante Durchführungsverordnung im<br />
Bereich Einzelhandel in den Gewerbegebieten<br />
unterstützt die kleinstrukturierten<br />
Familienbetriebe und die Nahversorgung.<br />
Der Heimatpflegeverband warnt davor, die<br />
Bestimmungen kurz vor der Verabschiedung<br />
noch aufzuweichen.<br />
Überall in Europa haben fehlgeleitete<br />
Politik und Raumplanung, aber auch getäuschte<br />
Konsumenten immer neue Geschäfte<br />
und Handelsketten an Orts- und<br />
Stadträndern zugelassen und dafür den<br />
Handel in den Zentren sterben lassen. Im<br />
Bundesland Tirol zum Beispiel hat mehr<br />
als ein Drittel der Gemeinden kein eigenes<br />
Lebensmittelgeschäft mehr. In Südtirol<br />
konnte diese Entwicklung in den vergangenen<br />
Jahrzehnten mit einer gezielten<br />
Raumordnungs- und Handelspolitik und<br />
auch durch den steten Einsatz des Heimatpflegeverbandes<br />
verhindert werden.<br />
Aber wenngleich der Einzelhandel auf<br />
der grünen Wiese sehr eingeschränkt<br />
ist, ist der Druck zu dessen Liberalisierung<br />
groß. Des Öfteren ist die Politik in<br />
der Vergangenheit daher von ihrer ehemals<br />
konsequenten Linie abgewichen.<br />
Umso erfreulicher ist es, dass der Entwurf<br />
zur neuen Durchführungsverordnung<br />
im Bereich Einzelhandel in den<br />
Gewerbegebieten teilweise sogar strenger<br />
zu sein scheint als die bestehenden<br />
Bestimmungen.<br />
Achtsamkeit ist dennoch angesagt,<br />
denn der Einfluss von Lobbys und Einzelinteressen<br />
könnte in letzter Minute noch<br />
dazu führen, dass die Bestimmungen aufgeweicht<br />
werden. Doch die Gemeinden<br />
brauchen dringend eine rechtliche Hand-<br />
In diesem Laden in Glurns findet wohl jeder etwas Passendes.<br />
habe, um die Bestrebungen für Detailhandel<br />
auf der grünen Wiese zu verhindern.<br />
Deshalb appelliert der Heimatpflegeverband<br />
an die zuständigen Politiker und Beamten,<br />
dem Liberalisierungsdruck standzuhalten<br />
und die Bestimmungen in der<br />
Durchführungsverordnung nicht mehr<br />
zu ändern, um die Ortszentren nachhaltig<br />
zu erhalten und zu fördern.<br />
42<br />
KulturFenster
Aus Verband & Bezirken<br />
Heimatpflege<br />
Wertvolles bauliches<br />
Kulturgut zerstört<br />
Abriss des ehemaligen Hotels „Post“ in Toblach nicht nachvollziehbar<br />
Leider zu oft muss das „Kultur-<br />
Fenster“ über den drohenden<br />
oder bereits erfolgten Abbruch<br />
von historisch wertvollen Gebäuden<br />
berichten. Aktuell ist<br />
es das ehemalige Hotel „Post“<br />
in Toblach, das im November<br />
dem Erdboden gleich gemacht<br />
wurde. Hier soll ein moderner<br />
Neubau entstehen.<br />
Die Bagger waren in den<br />
vergangenen Wochen eifrig am<br />
Werk, um dem historischen,<br />
ortsbildprägenden Hotel „Post“ am Kirchplatz<br />
von Toblach den Garaus zu machen.<br />
Wie aber kann so etwas passieren? Tatsache<br />
ist, dass das Gebäude, in<br />
dem schon im 19. Jahrhundert<br />
ein Postamt eingerichtet<br />
worden war, am Ende des Ersten<br />
Weltkrieges auf den von<br />
Bomben zerstörten Ruinen der<br />
zwei historischen Gaststätten<br />
„Kreuzwirt“ und „Stern“ aufgebaut<br />
worden und seitdem<br />
erhalten geblieben ist. Allerdings<br />
ist unbegreiflich, dass es<br />
nie unter Ensembleschutz gestellt<br />
wurde, zumal die anderen<br />
Gebäude am selben Platz<br />
sehr wohl unter Ensembleschutz<br />
stehen. Man fragt sich,<br />
welche Beweggründe eine Gemeinde<br />
zu so einer Haltung geführt haben.<br />
Das Hotel „Post“ war ein stattlicher Bau,<br />
der mit seinen eleganten Fenstern im Parterre,<br />
mit seiner Muschel am Scheitelpunkt<br />
der Eingangstür zur Theiss-Stube, mit den<br />
eleganten Lisenen, mit der bewegten Dachgestaltung<br />
die Formensprache des Historismus<br />
sprach. Toblach könnte es auch<br />
anders, wie das Beispiel des Grandhotels<br />
Toblach eindrücklich zeigt, aber auch die<br />
alte Gemeinde am Kirchplatz.<br />
Das Hotel „Post“ stellte neben seinem<br />
historischen und kunsthistorischen<br />
Das Gebäude ist Geschichte – es<br />
bleiben nur noch historische<br />
Aufnahmen wie diese. (Fotos: HPV)<br />
Eine der letzten Aufnahmen des<br />
Hotels „Post“: Hier wird künftig<br />
ein modernes Hotelgebäude mit<br />
Geschäften und Büros stehen.<br />
Wert auch einen starken Identifikationspunkt<br />
für die Toblacher Bevölkerung und<br />
die vielen Gäste dar, die den Hochpustertaler<br />
Ort besucht haben bzw. besuchen,<br />
und war damit Zeugnis der lokalen Sozial-<br />
und Tourismusgeschichte. Gerade<br />
auch die Reaktion vieler italienischsprachiger<br />
Gäste zeigt,<br />
wie stark ein Tourismusort<br />
auf seine historische Baukultur<br />
achten muss, um nicht zu<br />
einem anonymen Allerweltsort<br />
und damit auch für den<br />
Tourismus zusehends unattraktiv<br />
zu werden.<br />
Die Begründung, dass<br />
durch einen um circa sechs<br />
Meter zurückgesetzten<br />
Neubau der Kirchturm in<br />
der Ansicht freigestellt würde, ist aus<br />
kunsthistorischem Verständnis nicht<br />
nachvollziehbar. Man denke an herrliche<br />
Plätze in Italien, wo man über<br />
verwinkelte mittelalterliche<br />
Gassen die Kirche und den<br />
Campanile erst sieht, wenn<br />
man knapp vor ihm steht und<br />
damit der Überraschungseffekt<br />
noch größer ist.<br />
Die Wehmut und Traurigkeit<br />
über verlorene wertvolle<br />
Baukultur wird dann noch verstärkt,<br />
wenn man bedenkt,<br />
was der Ersatz für das abgerissene<br />
historische Gebäude<br />
wird: in der Regel anonyme<br />
globalisierte Kasernenarchitektur,<br />
ohne Flair, abweisend,<br />
nur an der größtmöglichen Kubaturrealisierung<br />
orientiert.<br />
Man kann sich auch des Verdachts nicht<br />
erwehren, dass nach den Gemeinderatswahlen<br />
und in der Zeit der Coronapandemie<br />
das Aufmerksamkeitsdefizit und die<br />
eingeschränkten Interventionsmöglichkeiten<br />
der Öffentlichkeit ausgenutzt wurden,<br />
um Tatsachen zu schaffen.<br />
Toblach wird durch diese Vorgangsweise<br />
kulturell ärmer, denn was verloren<br />
ist, ist für immer verloren.<br />
Heimatpflegeverband,<br />
Bezirk Pustertal<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 43
Aus Verband und Bezirken<br />
Drei Zinnen als Blickfang<br />
Kreisverkehr Toblach wurde künstlerisch gestaltet<br />
Die Drei Zinnen als Wahrzeichen der Dolomiten: Die leicht transparente Skulptur versinnbildlicht die „Bleichen Berge“,<br />
wie sie wegen des hellen Gesteins genannt werden. (Foto: A. Willeit)<br />
Die Landschafts-, aber auch die Ortsbildgestaltung<br />
sind Themen, denen der Heimatpflegeverband<br />
Südtirol künftig noch<br />
mehr Aufmerksamkeit schenken möchte.<br />
Ein gutes Beispiel für eine ansprechende<br />
Ortsbildgestaltung ist ein neuer Kreisverkehr<br />
in Toblach.<br />
Ein Kreisverkehr dient in erster Line<br />
dazu, lange Staus an Kreuzungen zu vermeiden.<br />
Die Insel eines Rondells bietet<br />
aber auch die Möglichkeit, durch eine<br />
originelle Gestaltung Botschaften zu senden.<br />
Das ist in Toblach an einem vielbefahrenen<br />
Kreisverkehr zwischen Alt- und<br />
Neu-Toblach besonders gut gelungen.<br />
Dort werden die Autofahrer seit kurzem<br />
durch eine imposante Bergskulptur auf<br />
das UNESCO-Welterbe Dolomiten und vor<br />
allem auf dessen Wahrzeichen, die Drei<br />
Zinnen, aufmerksam gemacht.<br />
Die Skulptur ist keine naturgetreue<br />
Nachbildung der Drei Zinnen, sondern<br />
eine Abstrahierung von Form und Material,<br />
wodurch es den beiden künstlerischen<br />
Gestaltern Paul S. Feichter und Albert Willeit<br />
gemeinsam mit der Firma Pellegrini gelungen<br />
ist, die Einzigartigkeit der „Bleichen<br />
Berge“ in den Mittelpunkt zu rücken. So<br />
wurde etwa eine frontale Ausrichtung der<br />
Bergskulptur gewählt, damit die berühmten<br />
Nordwände als Hauptansicht in Richtung<br />
Dorfzentrum von Toblach zu sehen sind und<br />
dabei nach Neu-Toblach und ins Höhlensteintal<br />
blicken. Das mag für Kundige zwar<br />
seitenverkehrt sein, doch für den Ort und<br />
die Wiedererkennbarkeit sei das wichtig,<br />
betonen die Gestalter, die im Auftrag der<br />
Gemeindeverwaltung und in Absprache mit<br />
dem Land gearbeitet haben. In der künstlerischen<br />
Darstellung gehe es ja nicht unbedingt<br />
um die Wiedergabe der Realität,<br />
sondern um eine Form der Interpretation.<br />
Dies zeigt sich in besonderer Weise auch<br />
durch die Innenbeleuchtung, mit der die<br />
stählerne Skulptur zu einer kristallinen Erscheinung<br />
und so auch nachts zu einem<br />
optischen Blickfang wird.<br />
Die Ausrichtung der Bergskulptur wurde so gewählt, dass die Nordwände als<br />
Hauptansicht in Richtung Zentrum von Toblach zu sehen sind und dabei nach<br />
Neu-Toblach und ins Höhlensteintal blicken. (Foto: wisthaler.com)<br />
44<br />
KulturFenster
Heimatpflege<br />
Zwei Kleinode<br />
verschönert<br />
Der Heimatschutzverein Lana berichtet<br />
war. Der Säulenbildstock aus den 1920er-<br />
Jahren, an dem das Marterl angebracht ist,<br />
hatte bisher beim Brandiskeller gestanden<br />
und wurde nun in der Brandisgaul aufgestellt.<br />
Albert Innerhofer dankte bei der Feier<br />
allen an dieser Aktion Beteiligten und auch<br />
Ferdinand Graf Brandis, der den Bildstock<br />
als Marterl zur Verfügung gestellt und die<br />
Verlegung zum Wasserfall ermöglicht hatte.<br />
Diakon Hubert Knoll segnete das Marterl.<br />
Die Gemeinde Lana hatte die Initiative,<br />
die knapp 3.000 Euro kostete, mit einem<br />
außerordentlichen Beitrag an den Heimatschutzverein<br />
ermöglicht.<br />
Neues Tafelbild beim<br />
Raimann-Bildstock<br />
Am Wasserfall fand der Bildstock mit dem Marterl einen neuen Platz. Im Bild<br />
Diakon Hubert Knoll, Georg Lösch, Albert Innerhofer und Simon Terzer (v. l.)<br />
(Foto: Elfriede Gabrieli)<br />
Der Heimatschutzverein Lana hat ein Marterl<br />
errichten und ein Holztafelbild restaurieren<br />
lassen.<br />
Im Oktober <strong>2020</strong> luden der Obmann des<br />
Heimatschutzvereines Lana, Albert Innerhofer,<br />
und der Vorsitzende des Gampenstraßenkomitees,<br />
Georg Lösch, zur Segnung<br />
eines Marterls für Karl Eschgfäller. Eschgfäller<br />
war ein Arbeiter am Gutshof Brandis<br />
gewesen und im Juli 1935 unterhalb der<br />
Gampenstraße von einem herabstürzenden<br />
Steinblock tödlich getroffen worden. Dieser<br />
hatte sich gelöst, als eine erstickte Mine vom<br />
Straßenbau nach der Sprengung explodiert<br />
Ebenfalls auf die Initiative des Heimatschutzvereines<br />
Lana geht das neue Tafelbild<br />
im Raimann-Bildstock bei der Herzwasserle-<br />
Quelle am viel begangenen Wanderweg in<br />
Völlan zurück. Der Bildstock war bereits vor<br />
rund zehn Jahren restauriert worden. Die<br />
Wasserquelle war damals neu gefasst und<br />
vor dem Bildstock ein neues Steinbrünnlein<br />
errichtet worden. Steter Wasseraustritt und<br />
viel Feuchtigkeit durch die Wasserquelle<br />
hatte das Holztafelbild allerdings ziemlich<br />
angegriffen. Elfriede Zöggeler Gabrieli und<br />
Albert Innerhofer vom Heimatschutzverein<br />
Lana stellten deshalb das Original sicher und<br />
ließen vom Restaurator und Maler Karl Christanell<br />
aus Algund eine Kopie des Ölbildes<br />
auf Leinwand „Die Kreuzigung Christi“ anfertigen.<br />
Bei dieser Wasserquelle, die hinter<br />
dem Bild im Felsen entspringt, handelt<br />
es sich laut mündlicher Überlieferung um<br />
ein Heilwasser, ein „wundertätiges Wasser“,<br />
das deshalb als „Herzwasserle“ bekannt ist.<br />
Simon Terzer/Albert Innerhofer<br />
Erinnerungstafel in der Bildstocknische<br />
(Foto: Simon Terzer)<br />
Ein neues Bild ziert nun diesen<br />
Bildstock in Völlan. (Foto: HSV Lana)<br />
Albert Innerhofer vor dem verschönerten<br />
Bildstock.<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 45
Aus Verband und Bezirken<br />
Hängebrücke nicht abreißen!<br />
Hofmannsteg in Mareit ist einmaliges landschaftliches Ensemble<br />
Es ist sehr befremdend, wenn man hört,<br />
dass die Hängebrücke „Hofmannsteg“ in<br />
Mareit, Gemeinde Ratschings, allem Anschein<br />
nach nicht saniert, sondern abgerissen<br />
und an anderer Stelle bachabwärts<br />
durch eine Fahrbrücke ersetzt werden soll.<br />
Man fragt sich: Wie kann es sein, dass<br />
die Verantwortlichen auf Orts- und Gemeindeebene<br />
dieses einmalige landschaftliche<br />
Ensemble, das Brücke und Umgebung<br />
bilden, nicht zu würdigen wissen.<br />
Die unzweifelhaft schöne Brücke, die seit<br />
Generationen besteht und von der Bevölkerung<br />
stets ungehindert begangen werden<br />
konnte, muss unbedingt erhalten bleiben.<br />
Das verlangt außerdem wohl auch<br />
der Umstand, dass sie sich im Naturdenkmal<br />
Achenrainschlucht befindet. Schließlich<br />
ist noch Folgendes anzumerken: Eine<br />
Tourismusgemeinde wie Ratschings, die<br />
ansonsten bestrebt ist, ihre Naturschönheiten<br />
– auch mit beträchtlichem finanziellen<br />
Aufwand – zur Geltung zu bringen,<br />
kann doch nicht ein attraktives Aushängeschild,<br />
wie es diese historische Hängebrücke<br />
ist, opfern. Da würde man die Welt<br />
nicht mehr verstehen.<br />
Heimatpflegeverband Südtirol<br />
Der Hofmannsteg soll abgerissen und an anderer Stelle durch eine befahrbare<br />
Brücke ersetzt werden. (Foto: HPV)<br />
KulturFenster<br />
Blasmusik, Chorwesen und Heimatpflege in Südtirol<br />
Redaktion KulturFenster<br />
Redaktionsschluss für die nächste<br />
Ausgabe des KulturFensters ist<br />
Mittwoch, 13. Jänner <strong>2020</strong>.<br />
Bitte Termin genau beachten!<br />
46<br />
KulturFenster
Arge Lebendige Tracht<br />
Heimatpflege<br />
Falten, Krausen und Plissee<br />
Interessante Ausstellung in der Juppenwerkstatt Riefensberg<br />
Im Zeichen guter Zusammenarbeit hat<br />
Angelika Neuner-Rizzoli, Trachtenexpertin<br />
aus Nordtirol, folgenden Beitrag gestaltet.<br />
Im Sinne der Europaregion Tirol beteiligte<br />
sich auch Südtirol mit einigen Ausstellungsstücken<br />
an diesem Projekt.<br />
Die Juppenwerkstatt Riefensberg im Bregenzerwald<br />
in Vorarlberg wurde von Martina<br />
Mätzler und einigen Mitstreiterinnen<br />
2003 gegründet. Förmlich in letzter Minute<br />
gelang es damals, das uralte Handwerk<br />
für die Herstellung des einzigartigen plissierten<br />
Glanzleinens für die Bregenzerwälder<br />
Juppe vor dem Vergessen zu bewahren.<br />
Die Juppenwerkstatt zeigt noch das<br />
ganze Jahr 2021 eine äußerst sehenswerte<br />
Sonderausstellung zum Thema<br />
„Falten, Krausen und Plissee“<br />
(www.juppenwerkstatt.at).<br />
Falten-Vielfalt<br />
Es gibt wohl keinen geeigneteren<br />
Ort als die Juppenwerkstatt, um<br />
das Thema „Falten“ aufzunehmen<br />
und von verschiedenen Seiten zu<br />
beleuchten. Falten werden gelegt,<br />
gezogen, abgenäht, gestärkt oder<br />
plissiert. Der Kreativität sind kaum<br />
Grenzen gesetzt. Sie geben dem<br />
Kleidungsstück Form, schaffen<br />
Weite, bändigen Stofffülle, unterstreichen<br />
Körperlichkeit und drücken<br />
barocke Festlichkeit aus. Die<br />
Palette der verarbeiteten Materialien<br />
reicht von Leinen, Baumwolle<br />
und Wollstoffen hin bis zur<br />
Seide. Nicht nur Stoffbahnen werden<br />
gefältelt, auch Klöppelspitzen<br />
und Baumwolltüll. Im späten 18.<br />
Jahrhundert war es sogar modern,<br />
überlange Strümpfe am Unterschenkel<br />
in feine, gleichmäßige<br />
Falten zusammenzuschieben.<br />
Textiles Rechteck<br />
wird Krause<br />
Die Halskrause der Alt-Lienzer Frauentracht<br />
geht auf die bäuerliche Festtagskleidung<br />
des 18. Jahrhunderts zurück, die ihrerseits<br />
die spanische Hofmode des 17. Jahrhunderts<br />
zum Vorbild hatte. Die Krause ist ein<br />
Musterbeispiel alter Handwerkskunst. Ein<br />
zirka 11 Meter langer und 15 Zentimeter<br />
breiter Leinenstreifen wird in mühsamer<br />
Handarbeit mit viel Stärke und einem Formeisen<br />
in die typische Form gebracht. Als<br />
Schutz vor Verschmutzung wird darunter<br />
ein Spitzengoller getragen, dessen Spitze<br />
über die Krause geschlagen wird.<br />
Blick über die Grenzen<br />
Von der Leiterin der Juppenwerkstatt, Martina<br />
Mätzler, und der dort ebenfalls tätigen<br />
Alt-Lienzer Frauentracht mit<br />
kostbarer Halskrause<br />
(Foto: Juppenwerkstatt Riefensberg/<br />
Christian Kerber, Riefensberg)<br />
Kunsthistorikerin Maria Rose Steurer-Lang<br />
wurde ich gebeten, bei der Erstellung der<br />
neuen Sonderausstellung mitzuhelfen. Auf<br />
den ersten Blick mögen sich die Trachtenlandschaften<br />
vor und hinter dem Arlberg<br />
stark unterscheiden. Bei den Vorbereitungsarbeiten<br />
und den Nachforschungen<br />
für den Ausstellungskatalog entdeckten<br />
wir ähnliche Elemente und Gemeinsamkeiten,<br />
die nicht nur auf die zeitweilige Verwaltungseinheit<br />
von Tirol und Vorarlberg<br />
zurückzuführen sind. Viel mehr verweisen<br />
sie zum Beispiel auch auf die wichtigen<br />
Handels- und Verkehrswege quer<br />
durch die Alpen.<br />
Vor allem auch durch die fachliche Unterstützung<br />
der Vorsitzenden der ARGE<br />
Lebendige Tracht, Agnes Andergassen,<br />
und freundlicher Leihgeber war<br />
es mir möglich, Trachten aus der Europaregion<br />
Tirol vorzustellen. Neben<br />
einer Bagana dl`ëila aus Gröden mit<br />
ihrem fein plissierten Leinenkragen<br />
und dem Guant a la fascena aus<br />
dem Fassatal, das mit drei übereinanderliegenden<br />
und jeweils genau<br />
gefältelten Tüchern getragen wird,<br />
konnten wir sowohl historische als<br />
auch erneuerte Trachten aus dem<br />
Lechtal, dem Unterinntal und Osttirol<br />
zeigen.<br />
Wertvolle Erfahrungen<br />
Die Arbeit mit der Tracht, das zeigten<br />
die Vorbereitungen dieser länderübergreifenden<br />
Ausstellung, verlangt<br />
viel Respekt und Einfühlungsvermögen.<br />
Die Zusammenarbeit mit den<br />
Vorarlberger Expertinnen hat mir gezeigt,<br />
wie wichtig es ist, den Blick von<br />
den kleinen Details auf ein großes<br />
Ganzes zu richten. Dazu gehört die<br />
Bekleidungsgeschichte der vergangenen<br />
Jahrhunderte genauso wie<br />
eine Beobachtung der landschaftlichen<br />
Verbreitung einzelner Elemente. Ich<br />
bin dankbar für diese Erfahrungen und die<br />
gemeinsame Arbeit.<br />
Angelika Neuner-Rizzoli<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 47
Aus Verband und Bezirken<br />
•Büchertisch•<br />
Armin Mutschlechner (Hrsg.)<br />
Mühlbach bei Franzensfeste 1897–1947<br />
„So sollte man Geschichte schreiben“<br />
Stimmen:<br />
„So sollte man Geschichte schreiben! Mit<br />
Mitgefühl für die Zukurzgekommenen, das<br />
aus den wunderbaren Zeilen schimmert.<br />
Man kann tage-, wochen-, ja monatelange<br />
im Buch schmökern und wird nie müde."<br />
Hannes Obermair, Historiker<br />
Diese Dorfchronik ist besonders: Nach<br />
Jahren aufgeteilt und auf Doppelseiten<br />
thematisch geordnet, lädt sie zum<br />
Schmökern und Blättern ein.<br />
Sie versammelt eine Vielzahl an unveröffentlichten<br />
Fotos, Verträgen, Briefen sowie<br />
Zeitungsausschnitten und gewährt<br />
so einen unverfälschten Blick auf die<br />
Geschichte. Dabei reicht sie weit über<br />
die üblichen Themen um Vereine und<br />
Kirche hinaus: Es geht um Brandstiftung<br />
und Mord, um die Schwarze-Luise und<br />
den Dr. Mallepell, um die Ledigensteuer<br />
und um Gasthaus-Dynastien. Die bisher<br />
nicht aufgearbeitete lokale Zeit von<br />
Faschismus, Option und Nationalsozialismus<br />
wird kritisch hinterfragt. Einzigartig<br />
ist die Spurensuche nach vergessenen<br />
Mitbürgerinnen und Mitbürgern.<br />
Armin Mutschlechner (Hrsg.):<br />
Mühlbach bei Franzensfeste<br />
Softcover, 21 x 29,7 cm, 312 Seiten,<br />
über 1.000 Abbildungen, Karte mit historischen<br />
Straßennamen & Hausnummern,<br />
Kritisches, Kurioses und allerlei Wissenswertes,<br />
Raetia-Verlag, 35,00 Euro<br />
Autor Armin Mutschlechner ist kein „studierter"<br />
Historiker, aber sein Einsatz hat<br />
sich als wahrer Glücksgriff erwiesen. Er hat<br />
einen bleibenden Wert geschaffen, der einen<br />
festen Platz in der kollektiven Identität<br />
der Mühlbacher einnehmen wird.<br />
Oskar Zingerle, Der Brixner<br />
Armin Mutschlechner hat einen neuen Typ<br />
von Dorfbuch erfunden.<br />
Andreas Oberhofer,<br />
Stadtarchivar Bruneck<br />
„Es ist die Stärke von Mutschlechner, dass<br />
er mit sicherer Hand örtliche Strukturen<br />
und Verhältnisse ebenso sichtbar macht<br />
wie zahllose Episoden und Skurrilitäten, in<br />
denen Niedertracht, Mittelmaß und Weltoffenheit<br />
aufblitzen. [...] Mutschlechners<br />
handwerkliche Hand wie sein künstlerisches<br />
Talent zur Montage und Collage zeigen sich<br />
in der exzellenten Bildbehandlung: Fotos<br />
und Bilddokumente sind nie rein illustrativ<br />
eingesetzt, sondern von eingehenden<br />
Beschreibungen und Personenprofilen<br />
unterfüttert und in der Technik bewertet“.<br />
Hans Heiss<br />
(aus ff <strong>Nr</strong>. 45/<strong>2020</strong>, S. 40/41)<br />
Armin Mutschlechner hat insofern Geschichte<br />
geschrieben, als er die Geschichte<br />
von Mühlbach in den Jahren zwischen<br />
1897 und 1947 mit ungeheurem Fleiß<br />
und beeindruckender Akribie einfühlsam<br />
nachgezeichnet und damit ein Werk geschaffen<br />
hat, das beispielgebend ist für<br />
Dorfchroniken insgesamt.<br />
Alfons Gruber.<br />
Armin Mutschlechner, 1969 in Meran<br />
als Sohn einer Arbeiterfamilie<br />
geboren, aufgewachsen in Weißbrunn/Ultental<br />
und seit 1974 in<br />
Mühlbach ansässig.<br />
Nach den Pflichtschuljahren<br />
Lehre mit Gesellenbrief „Kunstschlosser“,<br />
gefolgt von Jahren<br />
als Techniker, Bühnenbauer, Programmverantwortlicher<br />
in Südtiroler<br />
Kleinkunstbetrieben und gute<br />
20 Jahren als Jugendarbeiter in<br />
er Offenen Jugendarbeit tätig. Als<br />
Künstler Intervention im öffentlichen<br />
Raum und Verfasser von<br />
Gebrauchslyrik oder themenspezifischen<br />
Essays.<br />
Lokale Zeitgeschichte, Familienforschungen<br />
und Nachlässe sind die<br />
aktuellen Arbeitsschwerpunkte,<br />
wobei er darauf Wert legt, weder<br />
studierter Historiker, noch Dorfchronist<br />
zu sein, aber dennoch<br />
nach wissenschaftlichen Maßstäben<br />
zu arbeiten. Mutschlechner<br />
ist Vater von drei Kindern, und er<br />
engagiert sich für die Schwachen<br />
in der Mühlbacher Dorfgemeinschaft<br />
(u.a. Lebensmittelbank)<br />
oder in der örtlichen Pfarrgemeinde,<br />
indem er die Sonntagsmessen<br />
oder Beerdigungen via<br />
Livestream überträgt.<br />
48<br />
KulturFenster
Heimatpflege<br />
Meinhard Feichter<br />
„Wenn des Singen net war“<br />
Bewegende Familiengeschichte zum 80. Geburtstag von Sepp Oberhöller<br />
Am 8. Oktober feierte der Volksmusiker, Landwirt<br />
und Familienvater Sepp Oberhöller seinen<br />
80. Geburtstag. Zu diesem Anlass ist sein Familienporträt<br />
„Wenn des Singen net war“ erschienen,<br />
eine bewegende Zeitreise von der<br />
Geburt seines Vaters Luis 1894 bis heute.<br />
Das Singen und die Musik habe ihn und<br />
seine Familie zeitlebens nicht nur begleitet,<br />
sondern auch in schwierigen Zeiten Zuversicht<br />
und Halt gegeben, erzählt der Jubilar.<br />
Daher auch der vielsagende Titel des Buches,<br />
denn „wenn das Singen nicht wäre, wäre<br />
unser Leben wohl ganz anders verlaufen.“<br />
Erst durch das Singen im Kreise der Familie<br />
und mit Freunden sowie durch die öffentlichen<br />
Auftritte ist er mit seinen Geschwistern<br />
und seinen Kindern weit umher gekommen<br />
und hat viele Freunde und Bekannte kennengelernt.<br />
Und wohl gerade dadurch hätten<br />
sich immer wieder neue Türen geöffnet<br />
und Wege geebnet, wo manchmal kein<br />
Weiterkommen möglich schien, erinnert er<br />
sich. Wenn er von den Anfängen am Dillerhof<br />
in Reinswald, das Leben am Wackerhof<br />
in Spinges, dem neuen Haus am Roa<br />
(Hinterleiter), der Auswanderung ins Pustertal<br />
auf den Hoferhof in Reischach und<br />
schließlich vom Kauf des Jörglmoarhofes in<br />
Moos bei St. Lorenzen erzählt, dann leuchten<br />
seine Augen voller Dankbarkeit und Zufriedenheit<br />
über das Erlebte. Aus dieser<br />
Dankbarkeit heraus war es ihm ein Anliegen,<br />
seine Geschichte niederzuschreiben,<br />
um seine Erfahrungen, aber vor allem seine<br />
Begeisterung und Liebe zur Musik weiterzugeben<br />
und anderen zu zeigen, „wie der<br />
Glaube und die Musik in allen Lebenslagen<br />
helfen können.“<br />
Meinhard Feichter: „Die<br />
Geschichte der Familie<br />
Oberhöller ist ein<br />
beeindruckendes Zeugnis<br />
von Bodenständigkeit,<br />
Gemeinschaftssinn und<br />
Glaube, aber vor allem<br />
für die Kraft der Musik,<br />
die Herzen verbindet –<br />
über alle Grenzen hinweg.“<br />
Auf der Suche nach einem Autor, der<br />
seine Erinnerungen und Gedanken treffend<br />
zu Papier bringen könne, hat er vor rund vier<br />
Jahren Meinhard Feichter kontaktiert. Damit<br />
schließe sich auch ein persönlicher Kreis,<br />
denn Meinhard Feichter – seines Zeichens<br />
Buchhändler, Sänger, Cellist und<br />
Autor – hat schon in den 1970er-Jahren<br />
zusammen mit den Geschwistern Oberhöller<br />
musiziert. Daraus entstand eine<br />
langjährige Freundschaft, „die nun im<br />
Niederschreiben der Oberhöller’schen<br />
Familiengeschichte ihre Fortsetzung findet“.<br />
Feichter gelingt eine spannende<br />
Reise durch das vergangene Jahrhundert,<br />
die das Schicksal von vier Generationen<br />
erzählt.<br />
Coronabedingt musste die offizielle<br />
Buchvorstellung auf unbestimmte Zeit<br />
verschoben werden. Derweil häufen sich<br />
in Sepp Oberhöllers Bauernstube die<br />
Anfragen um Zusendung des Buches,<br />
die er gerne – mit persönlichen Widmungen<br />
– erfüllt. Das Buch mit Audio-<br />
CD ist im Verlag Athesia-Tappeiner-Verlag<br />
erschienen und in den gängigen<br />
Buchhandlungen erhältlich.<br />
Stephan Niederegger<br />
Meinhard Feichter:<br />
„Wenn des Singen net war“<br />
288 Seiten, 246 mm x 173 mm, 288<br />
Seite, ca. 100 Abbildungen, Verlag: Athesia-Tappeiner<br />
<strong>2020</strong>, 28,00 Euro<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 49
•Büchertisch•<br />
Roland Zwerger<br />
Tramin in Vergangenheit und Gegenwart<br />
Aufsätze aus 30 Jahren<br />
Wer verlässliche Informationen über<br />
Tramins Vergangenheit braucht, wendet<br />
sich in der Regel an den Historiker<br />
Roland Zwerger. Er hat in Innsbruck<br />
Geschichte studiert, und seine Doktorarbeit<br />
trägt den Titel „Beiträge zur Geschichte<br />
von Tramin“. Unter anderem<br />
veröffentlichte Roland Zwerger 2001<br />
den Dorfführer „Tramin an der Südtiroler<br />
Weinstraße“. Seit knapp 30 Jahren<br />
schreibt er aber auch im Traminer<br />
Dorfblatt Beiträge zu Geschichte, Kultur<br />
und Wirtschaft von Tramin.<br />
Viele dieser Beiträge sind nun in<br />
einem Buch auf 640 Seiten zusammengefasst.<br />
Geordnet nach 13 Themen<br />
fi nden Leserinnen und Leser in „Tramin<br />
in Vergangenheit und Gegenwart“<br />
all jene Aufsätze, die die Herausgeber<br />
des Buches gemeinsam mit dem Autor<br />
aus dem Traminer Dorfblatt ausgesucht<br />
haben. Man beschloss auch, die Texte<br />
inhaltlich unverändert zu übernehmen,<br />
zumal sich in der Sprache des Autors<br />
ein akribischer Forscherfleiß gepaart<br />
mit Kritik und Humor findet.<br />
Das erste Kapitel „Geschichte und Geschichten“<br />
umfasst eine historische<br />
Chronik von Tramin, die mit dem Menhir<br />
von Rungg beginnt und mit dem 3000.<br />
Einwohner im Jahre 1994 endet. Beindruckend<br />
ist die Fülle an historisch gesicherten<br />
Nachrichten zum Handwerk in Tramin,<br />
ein Kapitel, das in besonderer Weise das<br />
Schmiedehandwerk behandelt. Natürlich<br />
ist der Weinbau in Tramin ein zentrales<br />
Thema, interessant sind aber auch die Artikel<br />
über die alten Wirtshäuser und Höfe.<br />
Schier unglaublich erscheint die Detailfülle<br />
im Kapitel „Familien und Persönlichkeiten“,<br />
in dem wir neben den bedeutenden<br />
historischen Familien auch Wissenswertes<br />
erfahren über den hochbegabten und jungen<br />
Professor Adam Aigenler, den Radrennfahrer<br />
Richard Menapace, über den<br />
Kunstmaler Guido Waid oder über den<br />
Begründer des Heimatschutzes Kunibert<br />
Zimmeter. Der Autor beschäftigt sich auch<br />
mit der Toponomastik, der Namens- und<br />
Wappenkunde.<br />
Im Kapitel „Von Künstlern und Kunsthandwerkern“<br />
beweist Roland Zwerger einmal<br />
mehr seine Akribie, etwa wenn er einen<br />
Traminer Kachelofen mit Kacheln<br />
von Bartlmä Dill Riemenschneider in<br />
London ausfindig macht.<br />
Weitere Kapitel sind etwa „Patrozinien<br />
und Heilige“, „Katastrophen, Natur<br />
und Umwelt“ sowie „Vermischtes“.<br />
Das Buch wurde zum Anlass der beiden<br />
Jubiläen – 40 Jahre Verein für Kultur<br />
und Heimatpflege Tramin und 30<br />
Jahre Museum Tramin – herausgegeben<br />
und will auf diese Weise das kulturelle<br />
Engagement dieser beiden Einrichtungen<br />
unterstreichen.<br />
Der Verein für Kultur und Heimatpflege<br />
Tramin und das Hoamet-Tramin-Museum<br />
dankt allen, die zur Veröffentlichung<br />
des Buches beigetragen<br />
haben. Erhältlich ist „Tramin in Vergangenheit<br />
und Gegenwart“ in Tramin<br />
bei Foto-Buch Geier, Despar Oberhofer<br />
und im Kunsum Tramin.<br />
Verein für Kultur und<br />
Heimatpflege Tramin<br />
„Franz Broschek gepr. Huf- und Wagenschmied" steht auf dem Schild über dem<br />
Tor zu lesen. Der selbstbewusste Meister ließ die Inschrift später groß auf die<br />
Fassade seines Hauses malen. (Foto: VKHT)<br />
50<br />
KulturFenster
Heimatpflege<br />
Frohe Weihnachten und<br />
ein gutes neues Jahr<br />
Wenn i a Liachtl war …<br />
Wenn i a Liachtl war,<br />
wûrat i ålm scheinen,<br />
fir di, fir mi,<br />
fir die Deinen und Meinen …<br />
Wenn i a Liachtl war,<br />
wûr i glänzn,<br />
fir ålle, dia’s brauchn,<br />
und bsunders fir dia, dia am Bodn stÜauchn …<br />
Wenn i a Liachtl war,<br />
wûrat i flimmerà und fÚnklen,<br />
wia a Stearà doubn am Himmlszelt,<br />
fir ålle Menschn af der Welt …<br />
Wenn i a Liachtl war –<br />
Und warat i â nû so kloan –<br />
nårÜ winschat i,<br />
i war’s in dëin Augablick lei fir di alloan …<br />
„Kånnsch mi du gspierà?” … –<br />
Und wenn ja …,<br />
nårÜ stÜeichlt di ’s Christkind,<br />
des der mit åll sei Liab und Wär*<br />
iatz bsunders gånz nåh!<br />
Marina Ruzzon, Gluràs<br />
(Aus: „Wenn wieder Winter weard“)<br />
Der Verband Südtiroler Musikkapellen (VSM), der Heimatpflegeverband Südtirol (HPV),<br />
der Südtiroler Chorverband (SCV) sowie die Schriftleitung mit den Redaktionen<br />
der Zeitschrift KULTURFENSTER wünschen allen frohe, gesegnete Weihnachten<br />
und viel Glück und Segen im neuen Jahr 2021.<br />
<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 51
Danke<br />
Danke an alle Rettungskräfte<br />
Danke an alle Pflegekräfte<br />
Danke an alle, die im Supermarkt arbeiten.<br />
Danke an alle Polizisten<br />
Danke an alle Ärzte<br />
Danke an alle Menschen,<br />
die durch ihre Arbeit dem Coronavirus ausgesetzt sind,<br />
aber trotzdem weitermachen!<br />
Ohne euch ginge es nicht!<br />
Impressum<br />
Mitteilungsblatt des Verbandes Südtiroler<br />
Musikkapellen, des Südtiroler Chorverbandes<br />
und des Heimapflegeverbandes Südtirol<br />
Eigentümer und Herausgeber:<br />
Verband Südtiroler Musikkapellen, Bozen<br />
Ermächtigung Landesgericht Bozen<br />
<strong>Nr</strong>. 27/1948<br />
Schriftleiter und im Sinne des Pressegesetzes<br />
verantwortlich:<br />
Dr. Alfons Gruber<br />
Als Pressereferenten für die Darstellung der<br />
entsprechenden Verbandsarbeit zuständig:<br />
VSM: Stephan Niederegger,<br />
E-Mail: kulturfenster@vsm.bz.it<br />
SCV: Paul Bertagnolli,<br />
E-Mail: info@scv.bz.it<br />
HPV: Florian Trojer,<br />
E-Mail: florian@hpv.bz.it<br />
Unverlangt eingesandte Bilder und Texte<br />
werden nicht zurückerstattet.<br />
Redaktion und Verwaltung:<br />
Verband Südtiroler Musikkapellen,<br />
I-39100 Bozen, Schlernstraße 1, Waltherhaus<br />
Tel. 0471 976387 - Fax 0471 976347<br />
E-Mail: info@vsm.bz.it<br />
Einzahlungen sind zu richten an:<br />
Verband Südtiroler Musikkapellen, Bozen,<br />
Waltherhaus<br />
Raiffeisen-Landesbank, BZ<br />
IBAN: IT 60S03493 11600 0003000 11771<br />
SWIFT-BIC: RZSBIT2B<br />
Jahresbezugspreis: Euro 20<br />
Gefördert von der Kulturabteilung<br />
der Südtiroler Landesregierung.<br />
Druck: Ferrari-Auer, Bozen<br />
Das Blatt erscheint als Zweimonatszeitschrift,<br />
und zwar jeweils am 15. Februar, April, Juni,<br />
August, Oktober und <strong>Dezember</strong>.<br />
Redaktionsschluss ist der 15. des jeweiligen<br />
Vormonats.<br />
52<br />
KulturFenster