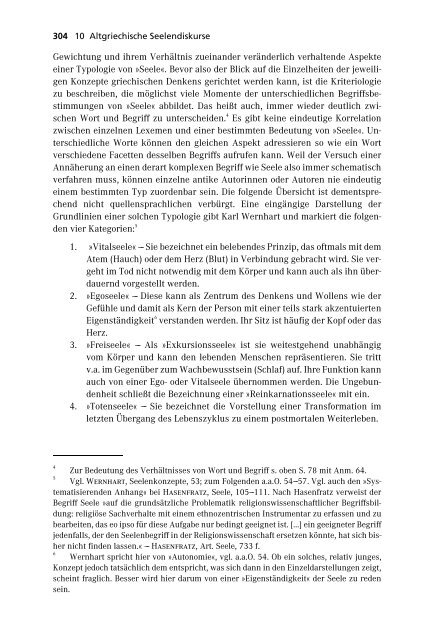Christoph Tödter: Hoffnung auf Vollendung (Leseprobe)
Über Jahrhunderte hinweg gehörte die Seele im christlichen Europa untrennbar zum Selbstbild des Menschen. Heute ist sie wenigstens für eine wissenschaftliche Beschreibung des Menschseins kaum mehr relevant. An ihre Stelle treten Bewusstsein und Selbst, Geist und Denken, Identität und Person oder Erleben und Existenz. Aber die religiöse Innerlichkeit des Psalters zeigt, dass eine solche konzeptionelle Beschreibung dennoch den Seelenbegriff aufnehmen kann, auch wenn er kein quellensprachliches Korrelat hat. Wovon die Psalmen handeln und was sich im Seelebegriff abbildet, ist weder der Grund für Leben noch für Unsterblichkeit, sondern eine ehrfürchtige Betrachtung der zwischen Schuld und Widerfahrnis erlebten Gegenwart des individuellen Daseins vor Gott in seiner Hoffnung auf Vollendung.
Über Jahrhunderte hinweg gehörte die Seele im christlichen Europa untrennbar zum Selbstbild des Menschen. Heute ist sie wenigstens für eine wissenschaftliche Beschreibung des Menschseins kaum mehr relevant. An ihre Stelle treten Bewusstsein und Selbst, Geist und Denken, Identität und Person oder Erleben und Existenz. Aber die religiöse Innerlichkeit des Psalters zeigt, dass eine solche konzeptionelle Beschreibung dennoch den Seelenbegriff aufnehmen kann, auch wenn er kein quellensprachliches Korrelat hat. Wovon die Psalmen handeln und was sich im Seelebegriff abbildet, ist weder der Grund für Leben noch für Unsterblichkeit, sondern eine ehrfürchtige Betrachtung der zwischen Schuld und Widerfahrnis erlebten Gegenwart des individuellen Daseins vor Gott in seiner Hoffnung auf Vollendung.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
304<br />
10 Altgriechische Seelendiskurse<br />
Gewichtung und ihrem Verhältnis zueinander veränderlich verhaltende Aspekte<br />
einer Typologie von »Seele«. Bevor also der Blick <strong>auf</strong> die Einzelheiten der jeweiligen<br />
Konzepte griechischen Denkens gerichtet werden kann, ist die Kriteriologie<br />
zu beschreiben, die möglichst viele Momente der unterschiedlichen Begriffsbestimmungen<br />
von »Seele« abbildet. Das heißt auch, immer wieder deutlich zwischen<br />
Wort und Begriff zu unterscheiden. 4 Es gibt keine eindeutige Korrelation<br />
zwischen einzelnen Lexemen und einer bestimmten Bedeutung von »Seele«. Unterschiedliche<br />
Worte können den gleichen Aspekt adressieren so wie ein Wort<br />
verschiedene Facetten desselben Begriffs <strong>auf</strong>rufen kann. Weil der Versuch einer<br />
Annäherung an einen derart komplexen Begriff wie Seele also immer schematisch<br />
verfahren muss, können einzelne antike Autorinnen oder Autoren nie eindeutig<br />
einem bestimmten Typ zuordenbar sein. Die folgende Übersicht ist dementsprechend<br />
nicht quellensprachlichen verbürgt. Eine eingängige Darstellung der<br />
Grundlinien einer solchen Typologie gibt Karl Wernhart und markiert die folgenden<br />
vier Kategorien: 5<br />
1. »Vitalseele« --- Sie bezeichnet ein belebendes Prinzip, das oftmals mit dem<br />
Atem (Hauch) oder dem Herz (Blut) in Verbindung gebracht wird. Sie vergeht<br />
im Tod nicht notwendig mit dem Körper und kann auch als ihn überdauernd<br />
vorgestellt werden.<br />
2. »Egoseele« --- Diese kann als Zentrum des Denkens und Wollens wie der<br />
Gefühle und damit als Kern der Person mit einer teils stark akzentuierten<br />
Eigenständigkeit 6 verstanden werden. Ihr Sitz ist häufig der Kopf oder das<br />
Herz.<br />
3. »Freiseele« --- Als »Exkursionsseele« ist sie weitestgehend unabhängig<br />
vom Körper und kann den lebenden Menschen repräsentieren. Sie tritt<br />
v.a. im Gegenüber zum Wachbewusstsein (Schlaf) <strong>auf</strong>. Ihre Funktion kann<br />
auch von einer Ego- oder Vitalseele übernommen werden. Die Ungebundenheit<br />
schließt die Bezeichnung einer »Reinkarnationsseele« mit ein.<br />
4. »Totenseele« --- Sie bezeichnet die Vorstellung einer Transformation im<br />
letzten Übergang des Lebenszyklus zu einem postmortalen Weiterleben.<br />
4<br />
Zur Bedeutung des Verhältnisses von Wort und Begriff s. oben S. 78 mit Anm. 64.<br />
5<br />
Vgl. Wernhart, Seelenkonzepte, 53; zum Folgenden a.a.O. 54---57. Vgl. auch den »Systematisierenden<br />
Anhang« bei Hasenfratz, Seele, 105---111. Nach Hasenfratz verweist der<br />
Begriff Seele »<strong>auf</strong> die grundsätzliche Problematik religionswissenschaftlicher Begriffsbildung:<br />
religiöse Sachverhalte mit einem ethnozentrischen Instrumentar zu erfassen und zu<br />
bearbeiten, das eo ipso für diese Aufgabe nur bedingt geeignet ist. […] ein geeigneter Begriff<br />
jedenfalls, der den Seelenbegriff in der Religionswissenschaft ersetzen könnte, hat sich bisher<br />
nicht finden lassen.« --- Hasenfratz, Art. Seele, 733 f.<br />
6<br />
Wernhart spricht hier von »Autonomie«, vgl. a.a.O. 54. Ob ein solches, relativ junges,<br />
Konzept jedoch tatsächlich dem entspricht, was sich dann in den Einzeldarstellungen zeigt,<br />
scheint fraglich. Besser wird hier darum von einer »Eigenständigkeit« der Seele zu reden<br />
sein.