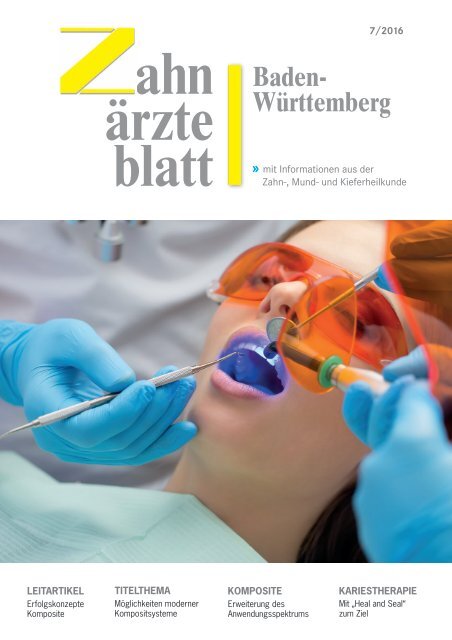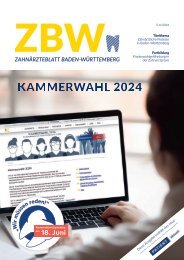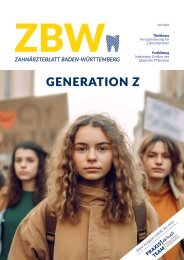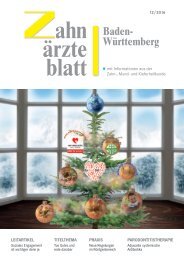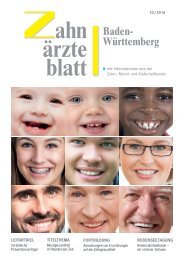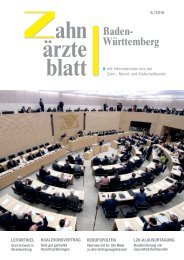Möglichkeiten moderner Kompositsysteme
Ausgabe 7/2016
Ausgabe 7/2016
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
7/2016<br />
ahn<br />
ärzte<br />
blatt<br />
Baden-<br />
Württemberg<br />
Informationen<br />
» aus mit der Informationen Zahn-, Mund- aus und der<br />
Kieferheilkunde<br />
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde<br />
LEITARTIKEL<br />
Erfolgskonzepte<br />
Komposite<br />
TITELTHEMA<br />
<strong>Möglichkeiten</strong> <strong>moderner</strong><br />
<strong>Kompositsysteme</strong><br />
KOMPOSITE<br />
Erweiterung des<br />
Anwendungsspektrums<br />
KARIESTHERAPIE<br />
Mit „Heal and Seal“<br />
zum Ziel
PICASSO UND<br />
DEUTSCHLAND<br />
DIE SAMMLUNG WÜRTH IN KOOPERATION MIT DEM MUSEO PICASSO MÁLAGA<br />
KUNSTHALLE WÜRTH<br />
SCHWÄBISCH HALL<br />
6.4.–18.9.2016<br />
TÄGLICH 10 –18 UHR<br />
EINTRITT FREI<br />
Zur Ausstellung erscheint ein<br />
Katalog im Swiridoff Verlag.<br />
www.kunst.wuerth.com<br />
Pablo Picasso,<br />
Venus und Amor, 1968<br />
Sammlung Würth, Inv. 3006<br />
Foto: Volker Naumann<br />
Die Sammlung Würth in Kooperation mit<br />
Alle Aktivitäten der<br />
Kunsthalle Würth sind<br />
Projekte der Adolf Würth<br />
[]<br />
GmbH & Co. KG.
Editorial 3<br />
Foto: Fotolia<br />
Foto: J. Manhart<br />
» Komposite. Ein geniales Wort, wie einst<br />
Amalgam. Abgeleitet vom lateinischen Verb „componere“,<br />
was im Partizip Perfekt Passiv so viel<br />
wie „zusammengesetzt“ bedeutet. Die Komposite<br />
sind ein Hightech-Verbundwerkstoff und erfreuen<br />
seit vielen Jahrzehnten Patienten, Zahnärzte und<br />
Dentalindustrie. Während früher das klassische<br />
Bohren und Füllen (meist mit Amalgam) in den<br />
Zahnarztpraxen zur Standardmethode bei der<br />
Kariesbehandlung gehörte, verwendet man heute<br />
zunehmend zahnfarbene Komposite – und das nicht<br />
nur, weil die ästhetischen Ansprüche der Patientinnen<br />
und Patienten gestiegen sind, sondern weil die<br />
Komposite gleichzeitig eine substanzschonende<br />
Restaurationstechnik möglich machen. Wie wichtig<br />
die Zusammensetzung der Komposite, insbesondere<br />
die Be- und Verarbeitung für Patient und Zahnarzt<br />
sind, erfahren Sie im Zahnärzteblatt zwar nicht<br />
zum ersten Mal, aber in dieser Ausgabe erstmalig<br />
aus verschiedenen Perspektiven. So zeigt Prof.<br />
Dr. Jürgen Manhart von der Münchner Poliklinik für<br />
Zahnerhaltung und Parodontologie in seinem Fortbildungsbeitrag<br />
ab Seite 8 ff. die „<strong>Möglichkeiten</strong><br />
<strong>moderner</strong> <strong>Kompositsysteme</strong>“ bei direkten Kompositrestaurationen<br />
im Frontzahnbereich. Im ersten<br />
Teil der Serie geht er dabei auf Indikationen und die<br />
ästhetische Analyse ein. Der zweite Teil wird in der<br />
ZBW-Sommerausgabe folgen.<br />
» ZBW-Interview. Die sogenannte R2-Technik ist<br />
ein zweiphasiges Vorgehen bei der Herstellung tief<br />
subgingivaler Kompositrestaurationen. Sie soll eine<br />
effektive Behandlungsoption für Problemsituationen<br />
im Seitenzahnbereich bieten, aber ist sie schon<br />
so weit etabliert, dass sie das Spektrum der minimalinvasiven<br />
Vorgehensweisen in der restaurativen<br />
Zahnheilkunde in der Praxis erweitern kann? Das<br />
ZBW hat bei Prof. Dr. Diana Wolff, stellvertretende<br />
Direktorin der Heidelberger Poliklinik für Zahnerhaltungskunde,<br />
nachgefragt. Ihre Antworten, u. a. zur<br />
Flexibilität der R2-Technik lesen Sie im Beitrag „Erweiterung<br />
des Anwendungsspektrums“ ab Seite 16 ff.<br />
» Schrumpfung. Zu den größten Problemen<br />
bei der Verwendung von dentalen Kunststoffen<br />
gehört die Polymerisationsschrumpfung. Wie diese<br />
Schrumpfung durch ausgeklügelte Adhäsivsysteme<br />
und schichtweise Verarbeitung kompensiert werden<br />
kann, beschreibt die Autorin Ruth Schildhauer in<br />
ihrem Beitrag „Strategien gegen den Schrumpf“ ab<br />
Seite 19 ff.<br />
» Kommunikation. Gesundheitsthemen kommen<br />
in den Medien immer gut an. Zahnärztliche und<br />
zahnmedizinische Themen sind dabei ein wichtiger<br />
Bestandteil der medialen Berichterstattung, auch in<br />
Baden-Württemberg. Die Tageszeitungen berichteten<br />
sehr informativ und in breiter Form über zahnmedizinische<br />
Themen wie Zahnerhaltung, insbesondere<br />
Prävention, die Bonusregelung, Prophylaxe,<br />
Wurzelbehandlung, Zahnersatz, Zahnzusatzversicherungen,<br />
Zahngesundheit aber auch Themenfelder<br />
wie Soziales Engagement, Flüchtlinge und<br />
viele weitere Themen. Eine genauere Analyse des<br />
Medienechos lesen Sie im Beitrag „Zahnärzteschaft<br />
als kompetenter Medienpartner“ von Christian<br />
Ignatzi ab Seite 32 ff.<br />
Die Präsenz der Zahnärzteschaft Baden-Württemberg<br />
auf zahlreichen Verbrauchermessen im Land<br />
durch das Forum Zahngesundheit gilt ebenfalls als<br />
Kommunikation. Die Zahnärztinnen und Zahnärzte<br />
sind dort stets gesuchte Ansprechpartner in allen<br />
Fragen rund um die Zahn- und Mundgesundheit.<br />
Bereits auf sechs Verbrauchermessen bewies sich<br />
das Forum Zahngesundheit in diesem Jahr als Publikumsmagnet.<br />
Vier weitere Auftritte werden folgen.<br />
Mehr dazu im Beitrag „Zahnärzteschaft zeigt Präsenz“<br />
auf Seite 36 f.<br />
» claudia.richter@izz-online.de<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
4 Inhalt<br />
Leitartikel<br />
Titelthema<br />
7<br />
Dr. Bernhard Jäger<br />
Erfolgskonzept Komposite<br />
22<br />
Gesundheitsrisiken durch Dentalmaterialien<br />
Komposite weiter auf dem Prüfstand<br />
Titelthema<br />
Berufspolitik<br />
8<br />
Direkte Restaurationen im Frontzahnbereich (Teil 1)<br />
<strong>Möglichkeiten</strong> <strong>moderner</strong> <strong>Kompositsysteme</strong><br />
26<br />
Landesweiter Erfahrungsaustausch der<br />
Senioren- und Behindertenbeauftragten<br />
Der Versorgungsauftrag umfasst<br />
auch Menschen mit Demenz<br />
Fortbildung<br />
30<br />
16<br />
ZBW-Interview zu Kompositrestaurationen<br />
mit der R2-Technik<br />
Erweiterung des Anwendungsspektrums<br />
28<br />
Mikroinvasive Kariestherapie<br />
Mit „Heal and Seal“ zum Ziel<br />
Kommunikation<br />
19<br />
Komposite<br />
Strategien gegen den Schrumpf<br />
32<br />
Breites Medienecho<br />
Zahnärzteschaft als kompetenter Medienpartner<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Inhalt<br />
5<br />
Kommunikation<br />
Leserreise<br />
36<br />
Forum Zahngesundheit – Drehscheibe<br />
der Information und Kommunikation<br />
Zahnärzteschaft zeigt Präsenz<br />
44<br />
Fachexkursion der Landeszahnärztekammer<br />
Sieben Tage in Tibet<br />
Prophylaxe<br />
38<br />
Wann sind Zahnveneers sinnvoll?<br />
ZDF-Filmaufnahmen im ZFZ Stuttgart<br />
46<br />
Landeszentrale Auftaktveranstaltung zum<br />
Tag der Zahngesundheit<br />
Freiburger Münsterplatz im Fokus<br />
Regionen<br />
Kultur<br />
48<br />
Landesmuseum Württemberg zeigt Bestände<br />
Wahre Schätze<br />
39<br />
In der Akademie für Zahnärztliche<br />
Fortbildung Karlsruhe<br />
Oberbürgermeister Frank Mentrup zu Gast<br />
3<br />
42<br />
47,54<br />
49<br />
49<br />
Rubrik<br />
Editorial<br />
Praxis<br />
Buchtipp<br />
Termine<br />
Leserforum<br />
Internet<br />
Besuchen Sie auch die ZBW-Website<br />
» www.zahnaerzteblatt.de<br />
Dort finden Sie neben der Online-Ausgabe des ZBW<br />
zusätzliche Informationen, Fotos, weiterführende<br />
Links sowie ein ZBW-Archiv ab dem Jahr 2006.<br />
Aktuelle Infos<br />
(dazu einfach den QR-Code scannen)<br />
50 Namen und Nachrichten<br />
52 Amtliche Mitteilungen<br />
54 Personalia<br />
59 Zu guter Letzt<br />
59 Impressum<br />
ZDF-Filmaufnahmen über Zahnveneers<br />
40<br />
TuTZiG Tagen und Treffen, Zahnärzt/innen im Gespräch<br />
Notfall ist ein heißes Eisen<br />
» http://www.zdf.de/volle-kanne<br />
/volle-kanne-5991486.html<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
FORTBILDUNGSFORUM<br />
Eine Initiative der Zahnärztinnen und Zahnärzte in Baden-Württemberg<br />
Kursprogramm September 2016<br />
Zwischen Patient und PC – Assistenzteam 2016<br />
Qualifikationstraining für Assistenzmitarbeiterinnen<br />
Andrea Räuber, Edingen-Neckarhausen<br />
Kurs-Nr. 16FKM19922 € 275,– (für Zahnmedizinische Fachangestellte)<br />
Sinusbodenelevation für Einsteiger – Ein praktischer Arbeitskurs<br />
Prof. Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf<br />
Kurs-Nr. 16FKZ30325 € 395,– (für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
9 Fortbildungspunkte<br />
Die 3B-Formel: Berechnen – Begründen – Bekommen!<br />
Abrechnungsworkshop zur Analogie, Abdingung und Erstattung<br />
Andrea Räuber, Edingen-Neckarhausen<br />
Kurs-Nr.: 16FKT19913 € 375,– (für das Praxisteam)<br />
8 Fortbildungspunkte<br />
Fit für die Kids- und Junior-Prophylaxe<br />
Annette Schmidt, Tutzing<br />
Kurs-Nr. 16FKM31223 € 225,– (für Zahnmedizinische Fachangestellte)<br />
Lokalanästhesie, perioperative Medikation und Lachgassedierung<br />
Prof. Dr. Gerhard Wahl, Bonn<br />
Kurs-Nr. 16FKZ30426 € 325,– (für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
7 Fortbildungspunkte<br />
Risikoorientierte Behandlungsplanung und Patientenführung in der Parodontologie<br />
PD Dr. Dirk Ziebolz, Göttingen<br />
Kurs-Nr. 16FKZ31127 € 325,– (für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
9 Fortbildungspunkte<br />
P³: Paro-dontitis versus Peri-Implantitis-Prophylaxe<br />
Annette Schmidt, Tutzing<br />
Kurs-Nr.: 16FKM31224 € 225,– (für Zahnmedizinische Fachangestellte)<br />
Von Streithammeln und –hähnen… - Gute Lösungen für schwierige Situationen in der<br />
Zahnarztpraxis<br />
Konflikte erkennen und lösen – mit den Werkzeugen der Mediation<br />
Elke Schulz, Esslingen<br />
Kurs-Nr. 16FKM20126 € 225,– (für Zahnmedizinische Fachangestellte)<br />
Strukturierte Fortbildung Parodontologie, Teil 1-3<br />
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Petra Ratka-Krüger, Freiburg<br />
Kurs-Nr.: 16FKZ40301 € 3.400,– (für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />
101 Fortbildungspunkte<br />
September<br />
16.<br />
September<br />
17.<br />
September<br />
17.<br />
September<br />
23.<br />
September<br />
24.<br />
September<br />
24.<br />
September<br />
24.<br />
September<br />
28.<br />
23.11.-26.11.2016<br />
25.01.-28.01.2017<br />
10.02.-11.02.2017<br />
Infos: Fortbildungsforum Freiburg, Merzhauser Straße 114 –116, 79100 Freiburg<br />
Telefon 07 61 45 06 -1 60 oder -1 61, Telefax 07 61 45 06-4 60<br />
www.ffz-fortbildung.de
Leitartikel 7<br />
Erfolgskonzept Komposite<br />
Kompositmaterialien gehören in der modernen konservierend-restaurativen Zahnheilkunde seit<br />
Jahrzehnten zur Standardversorgung in der täglichen Praxis. Es ist wohl der meistangewandte<br />
Werkstoff in der täglichen Praxis. Die Materialien werden als Füllungen, Inlays, Veneers und als<br />
adhäsive Befestigungsmaterialien angewandt. Für viele Patienten ist eine Zahnfüllung nicht nur<br />
ein Defektersatz, sondern die Füllungen sollen auch ästhetisch aussehen.<br />
2003 waren 40 Prozent der befragten Patienten mit dem<br />
Aussehen ihrer Frontzähne unzufrieden. Immer mehr Patienten<br />
verlangen heute nach zahnfarbenen Füllungen,<br />
nicht nur im Frontzahn-, sondern auch im Seitenzahnbereich.<br />
Manche Firmen versuchten die Weiterentwicklung<br />
der Komposite zu umgehen und durch Werbemaßnahmen<br />
zu beschleunigen.<br />
Ich erinnere mich noch an die Kampagne einer Firma,<br />
die den „weißen Amalgamersatz“ bei der Präsentation<br />
unter Mitwirkung vieler Professoren medienwirksam vorstellte.<br />
Es war ein Werbegag, der aber an der Wirklichkeit<br />
und an den Erfordernissen<br />
in der Praxis schnell<br />
verpuffte. Schnell verschwand<br />
dieses Produkt<br />
wieder vom Markt. Leider<br />
gab es damit zu viele<br />
Misserfolge.<br />
In den vergangenen<br />
Jahrzehnten gab es jedoch<br />
eine kontinuierliche<br />
Verbesserung der Kompositmaterialien.<br />
Noch<br />
im Jahre 1987 wurden<br />
okklusionstragende Kompositrestaurationen<br />
im<br />
Seitenzahnbereich als<br />
kontraindiziert angesehen.<br />
Die Gründe dafür waren unzureichende Verschleiß- und<br />
Bruchfestigkeit, starke Dimensionsänderung unter mechanischer<br />
und thermischer Belastung. Die Schrumpfung<br />
während der Polymerisation war ein großes Problem.<br />
Zudem war es schwierig, einen adhäsiven Verbund zum<br />
Dentin herzustellen.<br />
Das gehört heute zum Glück der Vergangenheit an. Seit<br />
Anfang der Neunzigerjahre gibt es jedoch deutlich verbesserte<br />
Materialien (Hybridkomposite) auf dem Markt, die<br />
durch höhere Verschleißfestigkeit und bessere physikalische<br />
und chemische Eigenschaften gekennzeichnet sind.<br />
Die meisten Patienten lehnen heute Amalgam ab und<br />
lassen ihre alten und insuffizienten Amalgam-Füllungen<br />
aufgrund der silbrigen Farbe und folglich der mangelnden<br />
Ästhetik gegen schönere, helle Füllungen austauschen.<br />
Viele Kolleginnen und Kollegen besuchen heute aufbauende<br />
und weiterführende Kurse, um ihre Technik und<br />
Arbeitsweise noch weiter zu verbessern. Standardisierte<br />
Vorgehensweise und verbesserte Adhäsive haben die Indikationen<br />
für Füllungen immer weiter erweitert. Sehr<br />
viele Praxen machen sehr erfolgreich minimalinvasive<br />
Versorgungen und vermeiden dadurch eine Teil- oder eine<br />
Vollkrone. Die Aufklärung darüber muss aber gut dokumentiert<br />
werden. Die korrekte Arbeitsweise und Anwendung<br />
erfordert einen großen Zeitaufwand. Deshalb muss<br />
der zeitliche Aufwand vergütet und vom Patienten dementsprechend<br />
bezahlt werden. Durch die Mehrkostenregelung<br />
haben wir dazu die Möglichkeit bekommen.<br />
Der GKV-Patient hat Anspruch auf eine Füllung, wenn<br />
der Zahn kariös erkrankt oder die alte Füllung insuffizient<br />
ist. Er hat darüber hinaus Anspruch auf plastische<br />
Füllungsmaterialien, die den<br />
gesetzlich geregelten Gewährleistungsansprüchen<br />
genügen<br />
(§ 136 b Abs. 2 SGB<br />
V) und die eine Kavität „lege<br />
artis“ versorgen. Wünscht<br />
der Patient außervertragliche<br />
Füllungen, so hat er die entstehenden<br />
Mehrkosten selbst<br />
zu tragen. Es ist mit ihm eine<br />
Vereinbarung gemäß § 28<br />
Abs. 2 SGB V zu treffen.<br />
Die Honorierung von<br />
Kompositfüllungen in der<br />
GOZ ist völlig unzureichend.<br />
Eine Minimalinvasive Versorgung,<br />
die sowohl Zeit als<br />
auch Können voraussetzt, wird in der jetzigen GOZ Verordnung<br />
leider nicht ausreichend honoriert und sollte über<br />
den § 2 der GOZ mit dem Patienten vereinbart werden.<br />
Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollten auch Privatversicherte,<br />
bei denen über dem 3,5 fachen Satz abgerechnet<br />
wird, nicht nur ausführlich informiert und aufgeklärt,<br />
sondern sie sollen den Heil- und Kostenplan ihres<br />
Zahnarztes bei der Versicherung oder Beihilfe einreichen<br />
und die Erstattungsleistung abklären. Das heißt, dass auch<br />
hier alle darüber hinausgehenden Gebühren privat bezahlt<br />
werden müssen. Besser als die beste Versorgung der kariösen<br />
Zähne mit Kompositen ist aber sorgfältige Mundhygiene,<br />
gesunde Ernährung und die regelmäßige Kontrolle<br />
durch den Zahnarzt. Durch regelmäßige Prophylaxe kann<br />
heute jeder die Kariesanfälligkeit seiner Zähne lebenslang<br />
vermindern.<br />
Dr. Bernhard Jäger<br />
stv. Präsident der LZK Baden-Württemberg<br />
Foto: Fotolia<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
8<br />
Titelthema<br />
Direkte Restaurationen im Frontzahnbereich (Teil 1)<br />
<strong>Möglichkeiten</strong> <strong>moderner</strong> <strong>Kompositsysteme</strong><br />
Mit direkten Kompositrestaurationen können heute höchste ästhetische Ansprüche im Frontzahnbereich<br />
befriedigt werden. Um vorhersagbare und vor allem reproduzierbare Ergebnisse zu erreichen, die sich durch<br />
eine hohe Natürlichkeit auszeichnen und perfekt in die umgebende Zahnsubstanz integrieren, ist eine profunde<br />
Kenntnis der technischen und ästhetischen Grundlagen ebenso erforderlich, wie ein Verständnis der korrekten<br />
Schichttechnik mit Kompositmassen in verschiedenen Farben und Transluzenzabstufungen.<br />
Ästhetische Aspekte haben insbesondere bei Zahnbehandlungen<br />
im Frontzahnbereich eine erhebliche<br />
Bedeutung. Die Patienten werden sowohl von der<br />
Werbung als auch durch Berichte in der Presse über<br />
„schöne Zähne” für das Thema Ästhetik sensibilisiert<br />
[1]. Große Teile der Bevölkerung haben daher mittlerweile<br />
ein ausgeprägtes Zahnbewusstsein entwickelt<br />
und sind auch bereit, für die (Wieder-)Herstellung eines<br />
schönen Lächelns entsprechende finanzielle Mittel<br />
zu investieren.<br />
Seit der erstmaligen Verwendung von Kompositen<br />
im Frontzahnbereich hat eine kontinuierliche Weiterentwicklung<br />
sowohl in der Adhäsivtechnik als auch in<br />
der Materialwissenschaft der Komposite stattgefunden<br />
[2]. Durch die Fortschritte im Bereich der Werkstoffe<br />
konnte im Gleichschritt der Indikationsbereich dieser<br />
Restaurationen deutlich ausgeweitet werden. Parallel<br />
hierzu wurde auch die intraorale Anwendung am Patienten<br />
durch Einführung und stetige Verbesserung der<br />
Schichttechnik perfektioniert [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,<br />
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Beginnend mit einfarbigen,<br />
chemisch härtenden Paste/Paste-Kompositen in retentiv<br />
präparierten Frontzahnkavitäten deckt man heute –<br />
von minimalinvasiven Defektversorgungen über kavitätenlose<br />
Zahnumformungen bis hin zu umfangreichen<br />
Frontzahnaufbauten, welche oft einen Großteil<br />
des Kronenvolumens eines Zahnes ersetzen – ein breites<br />
Indikationsspektrum mit direkten Kompositversorgungen<br />
ab [14, 18, 19, 20]. Diese Restaurationen werden<br />
mikroretentiv-adhäsiv an der Zahnhartsubstanz<br />
verankert, in einer polychromatischen Schichttechnik<br />
appliziert und mit Licht im sichtbaren Wellenlängen-<br />
Ausgangssituation. Auffällige, unästhetische alte Kompositfüllung<br />
an Zahn 12 (Abb. 1).<br />
Farbvorauswahl am nicht ausgetrockneten, feuchten Zahn<br />
(Abb. 2).<br />
Überprüfung der Farbauswahl mit individuellen Mustern<br />
von Schmelz- und Dentinkomposit (Abb. 3).<br />
Anfertigung eines Silikonschlüssels von der alten, anatomisch<br />
korrekten Zahnkontur (Abb. 4).<br />
ZBW 7/2016
Titelthema 9<br />
bereich polymerisiert [21]. Bei korrekter Anwendung<br />
des Adhäsivprotokolls und mit entsprechender Übung<br />
in der Schichttechnik konkurrieren direkte Kompositrestaurationen<br />
in vielen Fällen mit den ästhetischen<br />
Ergebnissen von Vollkeramikrestaurationen und gewährleisten<br />
gleichzeitig einen minimalinvasiven Umgang<br />
mit gesunder natürlicher Zahnhartsubstanz [22].<br />
Hochästhetische Frontzahnrestaurationen. Eine<br />
kontinuierlich steigende Zahl von Patienten akzeptiert<br />
mittlerweile kaum mehr Kompromisse bezüglich<br />
der Ästhetik von Frontzahnrestaurationen. Um<br />
Füllungen legen zu können, die von der Zahnhartsubstanz<br />
praktisch nicht mehr unterscheidbar sind,<br />
benötigt man Restaurationssysteme, die Kompositmassen<br />
in unterschiedlichen Opazitäten bzw. Transluzenzen<br />
und darin jeweils wiederum in ausreichenden<br />
Farbabstufungen anbieten (z. B. Filtek Supreme<br />
XTE, 3M Espe; Amaris, VOCO; Clearfil Majesty<br />
ES-2, Kuraray; Enamel Plus HFO, Micerium; IPS<br />
Empress Direct, Vivadent; Ceram-X Duo, Dentsply)<br />
[6, 7, 8]. Mit opaken Dentinfarben sowie transluzenten<br />
Schmelzmassen lassen sich bei Anwendung der<br />
mehrfarbigen (polychromatischen) Schichttechnik<br />
hochästhetische Restaurationen erzielen (Abb. 1 bis<br />
14) [5, 23]. Manche <strong>Kompositsysteme</strong> verfügen darüber<br />
hinaus noch über eine dritte Transluzenzstufe,<br />
die in ihrer Lichtdurchlässigkeit (mittelopak) zwischen<br />
den Schmelz- und Dentinmassen angesiedelt ist<br />
(z. B. Bodyfarben von Filtek Supreme XTE, 3M<br />
Espe). Teilweise umfassen diese <strong>Kompositsysteme</strong><br />
über 30 verschiedene Massen unterschiedlicher Farbe<br />
und Lichtdurchlässigkeit. Eine entsprechende Erfahrung<br />
im Umgang mit diesen Materialien ist somit unerlässlich.<br />
Der engagierte Behandler wird immer einen<br />
mehr oder weniger intensiven Lernprozess durchlaufen<br />
müssen, bis er reproduzierbar in der Lage ist, den<br />
Effekt der einzelnen Kompositfarben und -opazitäten<br />
in verschiedenen Schichtstärken, bei unterschiedlichen<br />
Situationen der natürlichen Zahnunterlage (z. B.<br />
verfärbte Dentinanteile), zu antizipieren.<br />
Die Farbwirkung der fertig geschichteten Restauration<br />
hängt neben der korrekten Auswahl der Grundfarbe<br />
des Zahnes und den zu deren Reproduktion ausgewählten<br />
Kompositmassen vor allem vom richtigen<br />
Verhältnis der Schichtdicken der unterschiedlich opaken<br />
bzw. transluzenten Kompositmassen ab. Generell<br />
kann man empfehlen, mit den sehr transluzenten<br />
Schmelzmassen eher sparsam umzugehen, da ansonsten<br />
die Gefahr besteht, dass die Füllung insgesamt zu<br />
transparent wird und dadurch – vor dem Hintergrund<br />
der dunklen Mundhöhle – graustichig wirkt (Abb. 15<br />
und 16) [24]. Die Hauptdomäne der hochästhetischen<br />
polychromatischen Schichttechnik ist die Versorgung<br />
von Defekten im Frontzahnbereich.<br />
Indikationen. Direkte Kompositrestaurationen im<br />
Frontzahnbereich werden entweder kavitäten- bzw.<br />
defektbezogen eingesetzt, um durch Karies, Trauma<br />
oder nicht kariöse Prozesse (Erosion, Abrasion, Attrition)<br />
verloren gegangene Zahnhartsubstanz in ihrer<br />
Zustand nach Entfernung der alten Füllung, Randanschrägung<br />
und Isolation mit Kofferdam (Abb. 5).<br />
Nach der Phosphorsäureätzung wird das Adhäsivsystem<br />
aufgetragen. Der Nachbarzahn ist mit Teflonband isoliert<br />
(Abb. 6).<br />
Schmelzkomposit wird extraoral in dünner Schicht auf den<br />
Silikonschlüssel aufgetragen (Abb. 7).<br />
Mithilfe des Silikonschlüssels wird die palatinale Führungsfläche<br />
bis zur Inzisalkante aufgebaut (Abb. 8).<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
10<br />
Titelthema<br />
Dünne palatinale Schmelzlamelle (0,5 mm) und fertig<br />
gestellte Inzisalkante (Abb. 9).<br />
Vorbereitung des Aufbaus der Approximalfläche durch<br />
Einbringen von Matrize und Holzkeil (Abb. 10).<br />
Nach dem Aufbau des Approximalraumes mit Schmelzkomposit<br />
können zur besseren Übersicht Keil und Matrize<br />
entfernt werden (Abb. 11).<br />
Nach Aufbau des Dentinkerns in der dreidimensionalen<br />
Schmelzschale erfolgt eine Individualisierung mit weißem<br />
Malfarbenkomposit (Abb. 12).<br />
ursprünglichen Kontur zu rekonstruieren, oder um<br />
alte, insuffiziente Versorgungen zu ersetzen. Seltener<br />
werden funktionelle Korrekturen, wie z. B. der Aufbau<br />
oder die Optimierung einer Front-Eckzahnführung,<br />
durchgeführt.<br />
Andererseits werden zunehmend auch nicht ausschließlich<br />
defektbezogene oder funktionell orientierte,<br />
sondern ästhetisch (teil-)motivierte, defektunabhängige<br />
Behandlungen durchgeführt. Hierzu zählen<br />
beispielsweise [11, 14, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,<br />
32, 33]<br />
• Zahnumformungen (Korrektur der Kronenmorphologie)<br />
(Abb. 17 bis 28)<br />
• Lückenschluss (Zahnverbreiterungen, Diastema mediale)<br />
• Korrekturen von Kronenanomalien<br />
• Kompositrestaurationen in Verbindung mit oder anstelle<br />
einer kieferorthopädischen Behandlung (Stellungs-<br />
und Achsenkorrekturen)<br />
• Reduktion schwarzer interdentaler Dreiecke im zervikalen<br />
Approximalraum (primär parodontal verursachte<br />
Defekte)<br />
• Direkte Kompositveneers (Korrektur von Zahnfarbe<br />
bzw. Zahnform und -stellung).<br />
Generell existiert keine eindeutige Grenze, bis zu<br />
der Restaurationen im Frontzahnbereich in der direkten<br />
Komposittechnik hergestellt werden können und<br />
ab deren Überschreitung nur mehr indirekte Verfahren<br />
angewendet werden sollten. Zusammenfassend kann<br />
man aber festhalten, dass mit vermehrter Anzahl an<br />
notwendigen (großen) Versorgungen, mit zunehmender<br />
Schwierigkeit aufgrund komplexer Farb-/Transparenz-/Textursituationen<br />
und mit steigendem ästhetischen<br />
Anspruch der Patienten irgendwann bei jedem<br />
Behandler ein – in Abhängigkeit von dessen individuellen<br />
Fähigkeiten – persönliches Limit erreicht wird,<br />
dessen Überschreitung die Vorteile der indirekten Versorgungen<br />
deren Nachteile überwiegen lassen.<br />
Vorteile und Nachteile. Der große Vorteil direkter<br />
Kompositrestaurationen im Frontzahnbereich liegt neben<br />
der sehr guten Ästhetik in der minimalinvasiven,<br />
substanzschonenden Vorgehensweise und dem geringen<br />
Risiko iatrogener Schäden für die zu versorgenden<br />
Zähne und umgebenden Gewebe [31]. Die Präparation<br />
ist rein defektbezogen und verläuft im Regelfall supragingival<br />
ohne Beeinträchtigung der biologischen<br />
Breite. Neben der Exkavation kariöser Zahnhartsubstanzanteile<br />
erfolgt lediglich eine Randabschrägung.<br />
Speziell bei den ästhetisch motivierten Behandlungen<br />
kann in vielen Fällen, im Gegensatz zur Korrektur mit<br />
Keramikveneers oder gar Vollkeramikkronen, auf eine<br />
Präparation des Zahnes verzichtet werden. Auch eine<br />
Abformung und die hierzu notwendige Verdrängung<br />
der marginalen Gingiva mit Retraktionsfäden unterbleiben.<br />
Das dadurch vermiedene Gewebstrauma eliminiert<br />
insbesondere bei einer fragilen Architektur<br />
der parodontalen Strukturen (dünner Biogewebstyp)<br />
die Gefahr des späteren Auftretens von Rezessionen<br />
nahezu vollständig [34, 35, 36, 37, 38, 39, 40]. Das<br />
Auftreten von irreversiblen Präparationstraumata [41]<br />
ZBW 7/2016
Titelthema 11<br />
und von postoperativen Schmerzen bzw. endodontischen<br />
Komplikationen ist im Zusammenhang mit<br />
Frontzahnkompositfüllungen selten. Im Gegensatz<br />
zu laborgefertigten Restaurationen liegt die Verantwortung<br />
für die direkte Restauration komplett in der<br />
Hand des Zahnarztes, es besteht keine Abhängigkeit<br />
vom Dentallabor bzw. Zahntechnikern inklusive damit<br />
assoziierter potenzieller Unwägbarkeiten (z. B. Terminverzug,<br />
Kommunikations- und Ästhetikprobleme,<br />
etc.). Im Vergleich zu indirekten Verfahren sind die für<br />
den Patienten anfallenden Kosten erheblich günstiger<br />
[31]. Ebenfalls ist der Behandlungsaufwand deutlich<br />
zeitsparender, da die direkten Kompositrestaurationen<br />
normalerweise in einer Sitzung fertiggestellt werden.<br />
Zu den größten Nachteilen direkter Kompositrestaurationen<br />
im Frontzahnbereich gehört sicherlich die<br />
eingeschränkte Vorhersagbarkeit des ästhetischen Resultats,<br />
vor allem bei Behandlern, die in der polychromatischen<br />
Schichttechnik nur über wenig Erfahrung<br />
verfügen [20]. Bei sehr großen Defekten oder Zahnumformungen<br />
können Schwierigkeiten mit der Matrizentechnik<br />
zu Gestaltungsproblemen im Bereich der Approximalkonturen<br />
führen. Zirkuläre und subgingivale<br />
Defekte limitieren ebenfalls aufgrund von Problemen<br />
mit dem Einsatz von formgebenden Matrizen bzw. der<br />
Trockenlegung oder der Sicherstellung kontaminationsfreier<br />
Bedingungen für die Adhäsivtechnik die<br />
sinnvolle Anwendung der direkten Kompositversorgungen.<br />
Bei der gleichzeitigen Versorgung zahlreicher<br />
großer, ästhetisch anspruchsvoller Defekte dürfen auch<br />
der dazu notwendige Zeitaufwand am Patienten nicht<br />
unterschätzt und die <strong>Möglichkeiten</strong> des Zahnarztes zur<br />
konstanten Aufrechterhaltung der dazu notwendigen<br />
hohen Konzentration während der kompletten Behandlungsdauer<br />
nicht überschätzt werden. Komposite sind<br />
zudem weniger verschleißbeständig als Keramiken<br />
[42, 43, 44, 45]. Langfristig kann es bei Kompositen<br />
durch Verschleißmechanismen somit auch zum Verlust<br />
des initial erzielten Oberflächenglanzes kommen,<br />
ebenso wie zu Konturveränderungen und zur Auflösung<br />
der im Rahmen der Ausarbeitung der Füllungen<br />
eingearbeiteten mikroanatomischen Texturmerkmale<br />
[46]. Diese Problematik ist vor allem bei Kompositfüllungen<br />
anzutreffen, bei denen der Werkstoff chairside<br />
nicht ausreichend polymerisiert wurde und somit das<br />
Kompositmaterial nicht über die optimalen mechanischen<br />
und chemischen Eigenschaften verfügt. Komposite<br />
sind auch hinsichtlich ihrer Farbstabilität nicht mit<br />
Keramiken vergleichbar [23, 47, 48, 49].<br />
Vorbereitende Maßnahmen. Bis auf wenige Ausnahmen,<br />
wie z. B. einer Notversorgung nach Trauma<br />
oder bei einer akuten Schmerztherapie, können<br />
Kompositrestaurationen im Frontzahnbereich geplant<br />
terminiert werden. Dabei sollte ein ausreichendes<br />
Zeitvolumen berücksichtigt werden, um die Restaurationen<br />
in Ruhe zu vollenden. Ästhetisch mangelhafte<br />
Frontzähne bzw. Frontzahnrestaurationen sind für die<br />
meisten Patienten, die mittlerweile über ein sehr ausgeprägtes<br />
Zahnbewusstsein verfügen, eine deutliche<br />
Belastung [33, 50].<br />
Schmelzschicht. Anschließend wird labial die finale<br />
Schmelzschicht adaptiert (Abb. 13).<br />
Endsituation. Die fertig ausgearbeitete und polierte Kompositrestauration<br />
integriert sich perfekt in die umgebenden<br />
Zahnstrukturen (Abb. 14).<br />
Nach Trauma. Alio loco angefertigte Kompositaufbauten<br />
nach Trauma. Durch eine zu transluzente Schichtung nur<br />
mit Schmelzkomposit wirken die Füllungen vor der dunklen<br />
Mundhöhle sehr grau (Abb. 15).<br />
Austausch. Zustand nach Austausch der Füllungen mit Dentin-<br />
und Schmelzfarben (Abb. 16).<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
12<br />
Titelthema<br />
Ausgangssituation. dysplastischer Zahn 22 vor<br />
der Umformung mit einem direkten Kompositanbau<br />
(Abb. 17).<br />
Wax-up durch den Zahntechniker an einartikulierten Modellen<br />
(Abb. 18).<br />
Mit dem Wax-up wird eine Formhilfe aus Silikon für die intraorale<br />
Modellation erstellt (Abb. 19).<br />
Konditionierung der nicht präparierten Zahnoberfläche mit<br />
Phosphorsäure (Abb. 20).<br />
Da eine Kontamination der Kavität mit Blut, Speichel<br />
oder Sulkusflüssigkeit die Haftfestigkeit und<br />
Randqualität von adhäsiven Füllungen drastisch beeinträchtigt,<br />
wird eine Zahnreinigung etwa eine Woche<br />
vor dem Füllungstermin zur Sicherstellung einer<br />
entzündungsfreien Gingivasituation empfohlen. Für<br />
komplexere bzw. umfangreichere Therapien, wie etwa<br />
der Schluss multipler Diastemata oder die Umformung<br />
mehrerer dysplastischer Zähne, ist es eine deutliche<br />
Erleichterung, wenn hierfür in einer vorbereitenden<br />
Sitzung Abformungen für Situationsmodelle angefertigt<br />
werden. An den einartikulierten Modellen kann der<br />
Zahntechniker ein Wax-up anfertigen [51], welches einerseits<br />
dem Patienten das anzustrebende Resultat der<br />
Therapie visualisiert und andererseits als Grundlage<br />
für die Anfertigung von Silikonschlüsseln dient, mit<br />
deren Hilfe der Zahnarzt in der Behandlungssitzung<br />
die auf dem Situationsmodell erarbeiteten Zahnkonturen<br />
auf einfache und zuverlässige Art und Weise in den<br />
Patientenmund übertragen kann [52].<br />
Ästhetische Analyse. Zu Beginn der Behandlungssitzung<br />
wird eine sorgfältige ästhetische Analyse des<br />
Zahnes und von dessen morphologischen und strukturellen<br />
Merkmalen durchgeführt. Neben der Zahnfarbbestimmung,<br />
inklusive der Verteilung unterschiedlicher<br />
Farbareale über die zu restaurierende Oberfläche,<br />
werden hier weitere für den ästhetischen Erfolg der<br />
Restauration wichtige Parameter erhoben [26]. Dazu<br />
zählt die korrekte Analyse der transluzenten Bereiche<br />
(Schneidekante, evtl. approximale Schmelzanteile)<br />
und opaken Areale des zu restaurierenden Zahnes<br />
und deren Dimensionen ebenso, wie die Feststellung,<br />
ob Dentinmamelons durch die Schmelzschicht hindurch<br />
sichtbar sind, oder ob ein Halo-Effekt entlang<br />
der Inzisalkante vorliegt [53, 54]. Auch individuelle<br />
Charakteristika, wie Schmelzrisse und deren Verfärbungsgrad<br />
oder weiße Entkalkungsflecken und deren<br />
Verteilungsmuster auf der Labialfläche, werden<br />
notiert. Vorzugsweise fertigt man hierzu eine Skizze<br />
des Zahnes an – analog dem Vorgehen der meisten<br />
Zahntechniker – in der die einzelnen in der ästhetischen<br />
Analyse erhobenen Details vermerkt werden.<br />
Beim Aufbau des Zahnes mit Komposit stehen dann<br />
die notwendigen Informationen, an welchen Stellen<br />
etwa opakere bzw. transluzentere Kompositmassen in<br />
entsprechenden Schichtstärken [55] eingesetzt werden<br />
müssen oder evtl. individuelle Charakterisierungen<br />
angebracht werden sollen, sofort verlässlich zur Verfügung.<br />
Die gesamte ästhetische Analyse wird unter standardisierten<br />
Lichtbedingungen am feuchten, nicht ausgetrockneten<br />
Zahn, vor dem Anlegen von Kofferdam<br />
und möglichst unter Ausschaltung starker Kontraste<br />
(z. B. Lippenstift) durchgeführt. Bei einer Dehydratation<br />
(z. B. durch den Einsatz von Druckluft aus der<br />
Multifunktionsspritze, Kofferdamapplikation, Mundatmung)<br />
wird das Wasser in den Schmelzporen reversibel<br />
durch Luft ersetzt, wodurch sich der Brechungsindex<br />
verändert und die Schmelzoberfläche in Abhängigkeit<br />
vom Austrocknungsgrad zunehmend weißlich-heller<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Titelthema 13<br />
Sorgfältiges Auftragen des Adhäsivsystems (Abb. 21).<br />
Auftragen einer ersten Schicht Dentinkomposit (Abb. 25).<br />
Aufbau der palatinalen Fläche mit Schmelzkomposit mittels<br />
der Silikonformhilfe (Abb. 22).<br />
Mit einer weiteren Schicht wird das Dentinvolumen komplettiert<br />
(Abb. 26).<br />
Dünne palatinale Schmelzlamelle (0,5 mm) und fertig gestellte<br />
Inzisalkante (Abb. 23).<br />
Fertigstellung der labial-approximalen Zahnkonturen mit<br />
Schmelzmasse (Abb. 27).<br />
Ein Matrizenstreifen wird im Approximalraum individuell<br />
ausgeformt und mit lichthärtendem Provisoriumsmaterial fixiert<br />
(Abb. 24).<br />
Durch die direkte Kompositrestauration konnte der Zapfenzahn<br />
22 in einen regulär geformten lateralen Schneidezahn<br />
umgestaltet werden (Abb. 28).<br />
Fotos: J. Manhart<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
14<br />
Titelthema<br />
Austrocknung. Situation nach Kofferdam wegen des Legens<br />
einer Seitenzahnfüllung. Durch den in der Front nicht komplett<br />
nach zervikal adaptierten Spanngummi entstand eine<br />
schräg verlaufende Linie der Austrocknung im Bereich der<br />
Frontzähne. Deutlich ist der Unterschied in Farbe und Opazität<br />
erkennbar (Abb. 29).<br />
Rehydrierung. Nach ca. 24 Stunden Rehydrierung durch den<br />
Speichel haben sich Farbe und lichtoptische Eigenschaften der<br />
ausgetrockneten Zahnanteile wieder in die Ausgangssituation<br />
zurückgestellt (Abb. 30).<br />
und opaker erscheint (Abb. 29 und 30) [56, 57, 58].<br />
Dadurch wäre eine korrekte Farbauswahl und Analyse<br />
der opaken bzw. transluzenten Zahnbereiche in dieser<br />
Behandlungssitzung nicht mehr möglich [59]. Nach<br />
Anfertigung der Kompositrestauration unter Kofferdam<br />
ist die Wasseraufnahme des ausgetrockneten<br />
Zahnes mit der damit einhergehenden optischen Wiederherstellung<br />
der Ausgangsfarbe und -transluzenz der<br />
natürlichen Zahnhartsubstanzanteile erst nach ca. 24<br />
Stunden vollständig abgeschlossen. Dies sollte bereits<br />
bei der Aufklärung des Patienten berücksichtigt werden,<br />
um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen:<br />
Bei Verwendung von Kofferdam während der Herstellung<br />
der Restauration wird die Kompositfüllung direkt<br />
nach dem Ausarbeiten und Polieren im Vergleich zum<br />
natürlichen Zahn etwas zu dunkel und zu transluzent<br />
erscheinen; erst nach Abschluss der Rehydrierung der<br />
Zahnhartsubstanz wird sich eine farblich perfekte Adaptation<br />
einstellen.<br />
Farb- bzw. Transluzenzabstufungen und eine sorgfältige<br />
dentale ästhetische Analyse.<br />
Den zweiten Teil des Beitrags „Direkte Restaurationen<br />
im Frontzahnbereich. <strong>Möglichkeiten</strong> <strong>moderner</strong><br />
<strong>Kompositsysteme</strong>” lesen Sie in der nächsten Ausgabe<br />
des ZBW.<br />
Das Literaturverzeichnis finden Sie unter www.<br />
zahnaerzteblatt.de oder kann beim IZZ bestellt werden<br />
unter Tel: 0711/222966-14, Fax: 0711/222966-21 oder<br />
E-Mail: info@zahnaerzteblatt.de.<br />
Prof. Dr. Jürgen Manhart<br />
Der Autor bietet Fortbildungen und praktische Arbeitskurse<br />
im Bereich der ästhetisch-restaurativen<br />
Zahnmedizin (Komposit, Vollkeramik, Veneers, postendodontische<br />
Versorgung, ästhetische Behandlungsplanung)<br />
an.<br />
Fazit. Der erfolgreiche Einsatz von direkten Kompositrestaurationen<br />
im Frontzahnbereich garantiert auch<br />
in einer Zeit wachsender ästhetischer Ansprüche bei<br />
gleichzeitigem Wunsch nach maximalem Erhalt von<br />
natürlicher Zahnhartsubstanz eine hohe Zufriedenheit<br />
auf Seiten der Patienten. Dies erfordert die Auswahl<br />
eines geeigneten Restaurationsmaterials mit genügend<br />
Prof. Dr. Jürgen<br />
Manhart<br />
Poliklinik für Zahnerhaltung und<br />
Parodontologie<br />
Goethestraße 70<br />
80336 München<br />
e-mail: manhart@manhart.com<br />
Internet: www.manhart.com,<br />
www.dental.education<br />
Anzeige<br />
Erste Hilfe.<br />
Selbsthilfe.<br />
Wer sich selbst ernähren kann, führt ein Leben in Würde.<br />
brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe, IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg<br />
Körperschaft des Öffentlichen Rechts<br />
Lorenzstraße 7, 76135 Karlsruhe, Fon 0721 9181-200, Fax 0721 9181-222, Email: fortbildung@za-karlsruhe.de<br />
Juli 2016<br />
Kurs Nr. 8440/32 Punkte<br />
Curriculum Alterszahnheilkunde<br />
Alte Menschen gut versorgen - Alterszahnheilkunde in der<br />
Praxis Teil I und II<br />
Referenten: Dr. Elmar Ludwig, Ulm<br />
Ulrich Pauls, M.A., Ahaus<br />
Datum: 08.-09. 07. 2016 Teil I und 11.-12.11.2016 Teil II<br />
Kurshonorar: 1000 € (eine ZFA ist inbegriffen)<br />
Kurs Nr. 6251/14 Punkte<br />
imp 6: Integration von chirurgischen und prothetischen<br />
Maßnahmen in der Implantologie<br />
Referenten: Dr. Jochen Klemke, M.A., Speyer<br />
Dr. Florian Troeger, M.A., Überlingen<br />
Datum: 15.-16.07.2016 Kurshonorar: 650 €<br />
Kurs Nr. 8364/16 Punkte<br />
par 8: Parodontale Regeneration<br />
Referent: Prof. Dr. Axel Spahr, Sydney<br />
Datum: 15.-16.07.2016 Kurshonorar: 650 €<br />
September 2016<br />
Kurs Nr. 8423/16 Punkte<br />
Implantatgetragene Restaurationen bei Patienten mit hohem<br />
ästhetischem Anspruch<br />
Referent: Dr. Peter Randelzhofer, München<br />
Datum: 16.-17.09.2016 Kurshonorar: 650 €<br />
Kurs Nr. 8508/8 Punkte<br />
Herbstkonferenz - Master‘s Day 2016<br />
„Was die Arbeit leichter macht“<br />
Datum: 23.09.2016<br />
Kurshonorar: 340 € für Zahnärzte,<br />
230 € für Zahnmedizinische Fachangestellte<br />
Veranstaltungsort: Kongresshaus Baden-Baden<br />
Kurs Nr. 6252/16 Punkte<br />
imp 7: Augmentative Verfahren bei der Implantation<br />
Referent: Dr. Jan Tetsch, Münster<br />
Datum: 21.-22.10.2016 Kurshonorar: 650 €<br />
Kurs Nr. 8501/18 Punkte<br />
Die Fachkunde für die Dentale Volumentomographie (DVT)<br />
Teil 1 und Teil 2<br />
Referent: Dr. Edgar Hirsch, Leipzig<br />
Datum: 22.10.2016 Teil I und 28.01.2017 Teil II<br />
Kurshonorar: 800 €<br />
Kurs Nr. 8509<br />
Die organisierte Rezeption - Gewinnen Sie täglich Zeit und<br />
Geld!<br />
Referentin: Brigitte Kühn, ZMV, Tutzing<br />
Datum: 28.10.2016 Kurshonorar: 180 €<br />
Kurs Nr. 8510<br />
Willkommen am Telefon!<br />
Referentin: Brigitte Kühn, ZMV, Tutzing<br />
Datum: 29.10.2016 Kurshonorar: 180 €<br />
November 2016<br />
Kurs Nr. 8495/19 Punkte<br />
Vollkeramische Restaurationen im Power-Pack<br />
Referent: Prof. Dr. Lothar Pröbster, Wiesbaden<br />
Datum: 25.-26.11.2016 Kurshonorar: 650 €<br />
Kurs Nr. 8444/16 Punkte<br />
Update Endodontie 2016<br />
Referent: Dr. Andreas Bartols, M.A., Karlsruhe<br />
Datum: 11.-12.11.2016 Kurshonorar: 750 €<br />
Oktober 2016<br />
Kurs Nr. 8421/16 Punkte<br />
Aktuelle Konzepte der Knochenaugmentation und<br />
Weichgewebsmanagements<br />
Referent: Prof. Dr. Fouad Khoury, Olsberg<br />
Datum; 07.-08.10.2016 Kurshonorar: 1000 €
16<br />
Titelthema<br />
ZBW-Interview zu Kompositrestaurationen mit der R2-Technik<br />
Erweiterung des Anwendungsspektrums<br />
Die in Heidelberg (weiter)entwickelte R2-Technik, ein zweiphasiges<br />
Vorgehen bei der Herstellung tief subgingivaler Kompositrestaurationen,<br />
soll eine effektive Behandlungsoption für Problemsituationen im<br />
Seitenzahnbereich bieten. Das ZBW hat Prof. Dr. Diana Wolff, stellvertretende<br />
Direktorin der Heidelberger Poliklinik für Zahnerhaltungskunde<br />
nach Vor- und Nachteilen befragt. Ist die in der Fachwelt rege diskutierte<br />
R2-Technik schon soweit etabliert, dass sie das Spektrum der<br />
minimalinvasiven Vorgehensweisen in der restaurativen Zahnheilkunde<br />
in der Praxis erweitern kann?<br />
das heißt Empfehlungen und Hinweisen,<br />
wie man in unvorhergesehenen<br />
Situationen mit Blutung<br />
und Kontaminierung des Arbeitsfeldes<br />
umgehen kann, hilft dieses<br />
Konzept, in diesen schwierigen<br />
Behandlungssituationen erfolgreich<br />
zu arbeiten.<br />
Für welche Indikationen kommt<br />
die R2-Technik in Frage?<br />
ZBW: Die R2-Technik erweitert<br />
das Anwendungsspektrum direkter<br />
Kompositrestaurationen.<br />
Was charakterisiert diese Technik<br />
und was ist der Heidelberger<br />
Anteil an dieser Technik?<br />
Prof. Dr. Wolff: Die R2-<br />
Technik umfasst ein<br />
zweiphasiges Vorgehen<br />
bei der Herstellung tief<br />
subgingivaler Kompositrestaurationen.<br />
Im<br />
ersten Schritt wird dabei<br />
die tief subgingivale<br />
approximale Kavität mit<br />
einem ersten Kompositaufbau<br />
im Sinne einer<br />
Kastenelevation gefüllt.<br />
Im zweiten Schritt erfolgt<br />
die Rekonstruktion<br />
der Restkavität mit Hilfe<br />
einer weiteren direkten<br />
Kompositrestauration.<br />
Hier liegt ein wichtiger<br />
Unterschied zwischen<br />
der Heidelberger R2-<br />
Technik und herkömmlichen<br />
Techniken.<br />
Weiterhin empfehlen<br />
wir die Verwendung<br />
einer speziellen<br />
Modellationstechnik,<br />
der sogenannten<br />
„Schneepflug-“ oder<br />
„Snowplough“-Technik (begründet<br />
von Opdam et al. 2003), bei<br />
welcher fließfähiges und visköses<br />
Komposit gemeinsam appliziert<br />
werden. Die Verwendung<br />
dieser Technik bei der Kastenelevation<br />
ermöglicht die Herstellung<br />
eines spaltfreien Übergangs im<br />
tief subgingivalen Bereich (Phase<br />
1) sowie einen gleichmäßighomogenen<br />
Übergang von der<br />
Kastenelevation in die sich daran<br />
anschließende Restauration<br />
(Phase 2).<br />
Flexibilität. Die R2-Technik kann flexibel eingesetzt werden, entweder<br />
bei kariös zerstörten Zähnen, bei Zähnen mit partiellem<br />
Zahnhartsubstanzverlust aufgrund von Frakturen und auch bei restaurativ<br />
schon vorbehandelten Zähnen.<br />
Ergänzend zur rein technischen<br />
Vorgehensweise bei der Herstellung<br />
haben wir begleitend ein Konzept<br />
zum erfolgreichen Weichgewebs-,<br />
Blutungs- und Adhäsivmanagement<br />
entwickelt. Mit strukturierten<br />
Anwendungshinweisen und<br />
sogenanntem „Troubleshooting“,<br />
Die R2-Technik kommt in Frage,<br />
wenn ein tief subgingivaler Defekt<br />
direkt restaurativ versorgt werden<br />
soll und übliche Vorgehensweisen<br />
unter Verwendung von Matrizenbändern,<br />
Keilen und Separierringen<br />
aufgrund der Ausdehnung<br />
des Defektes<br />
in den subgingivalen<br />
und knochennahen Bereich<br />
nicht mehr durchgeführt<br />
werden können.<br />
Die Technik kann flexibel<br />
eingesetzt werden,<br />
entweder bei kariös zerstörten<br />
Zähnen, bei Zähnen<br />
mit partiellem Zahnhartsubstanzverlust<br />
aufgrund von Frakturen<br />
und auch bei restaurativ<br />
schon vorbehandelten<br />
Zähnen.<br />
Die R2-Technik erweitert<br />
somit das Spektrum<br />
zahnerhaltender<br />
Maßnahmen in Fällen,<br />
in denen aufgrund der<br />
Tiefe des Defektes übli-<br />
Foto: Potente<br />
cherweise aufwändige<br />
chirurgische oder kieferorthopädische<br />
Maßnahmen,<br />
wie beispielsweise<br />
chirurgische Kronenverlängerungen<br />
oder<br />
kieferorthopädische<br />
Extrusionen durchgeführt werden<br />
müssten, oder in denen sogar eine<br />
Extraktion in Erwägung gezogen<br />
werden müsste.<br />
Hat sich inzwischen die zweiphasige<br />
direkte Restaurationstechnik<br />
etabliert, mit der sich selbst ex-<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Titelthema 17<br />
Breite, langfristig stabil bleiben.<br />
Der Knochen hat offenbar innerhalb<br />
bestimmter Grenzen die Fähigkeit,<br />
sich den Gegebenheiten<br />
anzupassen.<br />
Es gibt offenbar individuell deutlich<br />
unterschiedliche Reaktionen<br />
auf eine Missachtung der biologischen<br />
Breite?<br />
Rust. Bereits bei der Fortbildungstagung der südbadischen Zahnärzteschaft in Rust<br />
Anfang April standen subgingivale Kompositrestaurationen und die Heidelberger R2-<br />
Technik im Fokus.<br />
trem tief gelegene Kavitäten zufriedenstellend<br />
versorgen lassen?<br />
Ausgedehnte tief subgingival reichende<br />
Defekte im Seitenzahngebiet<br />
kommen in der Praxis<br />
zunehmend vor und die Restauration<br />
solcher Zähne stellt die<br />
Zahnärztin und den Zahnarzt vor<br />
große Herausforderungen. Hier<br />
bietet die R2-Technik einen interessanten<br />
neuen Lösungsansatz,<br />
der in Fachkreisen erfreulicherweise<br />
rege und auch kontrovers<br />
diskutiert wird.<br />
Was geschieht bei Unterschreitung<br />
des Toleranzbereichs der<br />
biologischen Breite, wie wird<br />
diese definiert?<br />
Der Bereich des bindegewebigen<br />
Attachments und des Saumepithels<br />
wird als sogenannte biologische<br />
Breite definiert. 1961 an<br />
Kadaverschädeln durch Gargiulo<br />
et al. vermessen, wurde dieser<br />
Bereich über mehrere Jahrzehnte<br />
mit einem Durchschnittswert<br />
von ca. 3 mm beschrieben. Mittlerweile<br />
wissen wir jedoch, dass<br />
es je nach Art des Zahnes und<br />
Lokalisation der Messung eine<br />
hohe intra- und interindividuelle<br />
Variationsbreite gibt. Laut gängiger<br />
Lehrmeinung sollte der<br />
Bereich der biologischen Breite<br />
nicht durch das Einbringen von<br />
beispielsweise Restaurationsrändern<br />
verletzt werden, um entzündlichen<br />
Prozessen und Knochenabbau<br />
vorzubeugen. Daraus<br />
ergab sich die Forderung, dass<br />
bei tief subgingivalen, die biologische<br />
Breite verletzenden Defekten<br />
eine Verlagerung des Alveolarknochens<br />
nach apikal (chirurgische<br />
Kronenverlängerung)<br />
oder eine Extrusion des Zahnes<br />
(Kieferorthopädische Extrusion)<br />
erfolgen müsse.<br />
Studienergebnisse zeigten<br />
jedoch auch, dass vor allem<br />
Überschüsse an Restaurationsmaterialien<br />
oder insuffiziente<br />
Restaurations- und Kronenränder<br />
zu entzündlichen Reaktionen<br />
und Knochenabbau führen.<br />
Langjährige klinische Beobachtungen<br />
von tief subgingivalen<br />
Kompositrestaurationen zeigten<br />
nicht immer Irritationen der umgebenden<br />
Weichgewebe und des<br />
Alveolarknochens, trotz partieller<br />
Verletzung der biologischen<br />
Breite. Wie ist dies zu erklären?<br />
Offenbar kommt es gerade in<br />
Knochennähe auch darauf an,<br />
die Restaurationsränder spaltund<br />
überschussfrei zu gestalten.<br />
Durch konsequente Nachsorge<br />
und Optimierung der häuslichen<br />
Reinigung können langfristig entzündungsfreie<br />
Verhältnisse geschaffen<br />
werden, die, trotz initialer<br />
Verletzung der biologischen<br />
Foto: Bamberger<br />
Unsere Beobachtungen zu den<br />
Reaktionen auf eine Verletzung<br />
der biologischen Breite führen zu<br />
dem Schluss, dass nicht die Verletzung<br />
per se problematisch ist,<br />
sondern dass möglicherweise die<br />
Art der Verletzung (insuffizienter<br />
Restaurations- oder Kronenrand<br />
mit Spalt oder Überschuss und<br />
eventuell verbliebenen Zementresten<br />
– versus – finierter spaltfreier<br />
Restaurationsrand aus<br />
Komposit)<br />
a) die Art des Restaurationsmaterials<br />
(Gussmetalle – Zemente –<br />
Keramiken – Komposite)<br />
b) das Ausmaß der Verletzung<br />
(gesamte Zirkumferenz bei Kronenversorgung<br />
– versus – anteilig<br />
umschriebener Bereich bei approximaler<br />
tief subgingivaler Kavität)<br />
ausschlaggebend für die individuelle<br />
Reaktion der umgebenden<br />
Weichgewebe ist. Die genauen<br />
Mechanismen sind jedoch bislang<br />
nicht ausreichend erklärbar. Deswegen<br />
laufen beispielsweise in<br />
Heidelberg Studien zur weiteren<br />
Erforschung des Themas.<br />
Um nicht missverstanden zu<br />
werden: Selbstverständlich haben<br />
Interventionen wie chirurgische<br />
Kronenverlängerung und kieferorthopädische<br />
Extrusion ihren festen<br />
und unverzichtbaren Platz im<br />
zahnärztlichen Behandlungsspektrum.<br />
Dennoch wäre es interessant,<br />
mehr darüber zu wissen, warum<br />
zuweilen bei einer Verletzung der<br />
biologischen Breite nichts Nachteiliges<br />
passiert und wie man sich<br />
diese Erkenntnis im klinischen Alltag<br />
zunutze machen kann.<br />
Worin besteht der Vorteil der R2-<br />
Technik für die tägliche Praxis des<br />
niedergelassenen Zahnarztes?<br />
Die R2-Technik bietet ein strukturiertes<br />
Konzept, mit welchem in<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
18<br />
Titelthema<br />
anspruchsvollen Behandlungssituationen<br />
erfolgreich gearbeitet<br />
werden kann. Die sehr komplexen<br />
Behandlungsanforderungen der<br />
Versorgung tief subgingivaler Kavitäten<br />
mit den Schwierigkeiten<br />
der anatomischen Zugänglichkeit,<br />
dem Blutungsmanagement, dem<br />
Einbringen des Restaurationsmaterials,<br />
der Ausarbeitung und der<br />
anatomischen Rekonstruktion bei<br />
großem Zahnhartsubstanzverlust<br />
werden durch ein stufenweises<br />
Konzept adressiert.<br />
Beispielsweise ermöglicht die<br />
Technik nach Einbringen der ersten<br />
Phase auch eine röntgenologische<br />
Kontrolle, mit welcher die<br />
Randschlüssigkeit der Kastenelevation<br />
geprüft werden kann.<br />
Zudem kann nach Einbringen der<br />
ersten Phase auch ein provisorischer<br />
Verschluss erfolgen, wenn<br />
aufgrund von Zeitmangel oder<br />
patientenbezogenen Faktoren<br />
die Weiterbehandlung limitiert<br />
sein sollte. Schließlich erweitert<br />
die Technik das zahnerhaltende<br />
Spektrum und ermöglicht hiermit<br />
eine Ausweitung des Behandlungsangebotes<br />
der Praxis.<br />
Was muss in der Nachsorge beachtet<br />
werden?<br />
Eine systematische Nachsorge<br />
sollte angestrebt werden. Hier legen<br />
wir Wert auf die Auswahl und<br />
Anwendung optimal passender<br />
Interdentalraumhilfsmittel, vor<br />
allem Interdentalraumbürstchen.<br />
Eine langfristig entzündungsfreie<br />
Zur Person<br />
Prof. (apl) Dr. Diana Wolff ist Stellvertreterin<br />
des Ärztlichen Direktors<br />
der Poliklinik für Zahnerhaltungskunde<br />
der Klinik für Mund-,<br />
Zahn- und Kieferkrankheiten des<br />
Universitätsklinikums Heidelberg.<br />
2007 wurde sie zur Spezialistin<br />
der Deutschen Gesellschaft für<br />
Zahnerhaltung (DGZ) (Präventiv-<br />
Restaurativ) ernannt und erhielt<br />
im Jahr 2012 die „Venia legendi“<br />
für das Fach Zahn-, Mund- und<br />
Kieferheilkunde. Im Jahr 2015<br />
wurde sie zur außerplanmäßigen<br />
Situation kann erreicht werden,<br />
indem der Patient entsprechend<br />
dafür motiviert und ihm Hilfsmittel<br />
zur adäquaten Umsetzung an die<br />
Hand gegeben werden. Weiterhin<br />
erfolgen bei uns regelmäßige<br />
Röntgenkontrollen, um neben der<br />
klinischen auch die Situation des<br />
Alveolarknochens beurteilen zu<br />
können.<br />
Wie ist die R2-Technik abrechnungstechnisch<br />
zu bewerten?<br />
Die mehrphasige R2-Technik ist<br />
zeitaufwändig und bedarf einer<br />
hohen Expertise des Behandlers.<br />
Mit den derzeit zur Verfügung<br />
stehenden Abrechnungsmodalitäten<br />
kann der Aufwand somit nur<br />
bedingt abgebildet werden. Für<br />
unsere Patienten steht in erster<br />
Linie der langfristige Erhalt ihrer<br />
Professorin der Ruprecht-Karls-<br />
Universität Heidelberg ernannt.<br />
Ihre Forschungsschwerpunkte<br />
sind restaurativ-minimalinvasive<br />
Versorgungen mittels Kompositen<br />
sowie orale Biofilmforschung.<br />
Prof. Wolff lehrt als Hochschuldozentin<br />
in den präklinischen<br />
und klinischen Semestern. Sie ist<br />
national und international als Referentin<br />
auf Fachkongressen tätig<br />
und ist Gutachterin für zahlreiche<br />
wissenschaftliche Publikationsorgane.<br />
Zähne bei gutem Nutzen-Risikound<br />
Nutzen-Kosten-Verhältnis im<br />
Vordergrund. Schwierige Behandlungssituationen<br />
können mit Hilfe<br />
herkömmlicher Versorgungstechniken<br />
häufig nicht mehr zufriedenstellend<br />
beherrscht werden. Auch<br />
wenn die R2-Technik aufwändiger<br />
als eine konventionelle Technik<br />
ist, so erscheint sie in Relation<br />
zu noch kostspieligeren und invasiveren<br />
Behandlungsalternativen<br />
(indirekte Restaurationen<br />
mit chirurgischer Kronenverlängerung<br />
oder kieferorthopädischer<br />
Extrusion, implantologische/prothetische<br />
Versorgungen nach Extraktion)<br />
in ausgewählten Fällen<br />
als eine sinnvolle Ergänzung des<br />
Behandlungsspektrums.<br />
Dorothea Kallenberg<br />
» info@zahnaerzteblatt.de<br />
Anzeige<br />
Werden auch Sie<br />
zum Helfer.<br />
German Doctors e.V.<br />
Löbestr. 1a | 53173 Bonn<br />
info@german-doctors.de<br />
Telefon +49 (0)228 387597-0<br />
Spendenkonto<br />
IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80<br />
BIC GENODEF1EK1<br />
www.german-doctors.de<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Titelthema 19<br />
Komposite<br />
Strategien gegen den Schrumpf<br />
Das Angebot an Kompositen ist in den vergangenen Jahren permanent<br />
gewachsen – und mit ihm die Produktpalette der Adhäsive.<br />
Frühere Zweifel an der Leistungsfähigkeit direkter Kompositrestaurationen<br />
sind weitgehend ausgeräumt. Die Polymerisationsschrumpfung,<br />
seit jeher das größte Problem bei der Verwendung von dentalen<br />
Kunststoffen, kann heute durch ausgeklügelte Adhäsivsysteme<br />
und schichtweise Verarbeitung weitgehend kompensiert werden. Die<br />
Suche nach dem idealen Restaurationsmaterial ist aber noch längst<br />
nicht abgeschlossen.<br />
Trend. Aus Sicht vieler Zahnmediziner hat mit den Compositen eine substanzschonendere<br />
Restaurationstechnik Einzug gehalten hat, vergleichbar mit der minimal-invasiven<br />
Chirurgie in der Medizin.<br />
Die Zeiten haben sich geändert.<br />
„Kam ein Patient vor 15 Jahren in<br />
die Praxis, interessierte ihn vor allem,<br />
ob er Schmerzen haben würde<br />
oder wie teuer ihn die Restauration<br />
zu stehen käme. Heute müssen<br />
Füllungen zuerst zahnfarben und<br />
ästhetisch sein, andere Probleme<br />
haben sich unterzuordnen. Und<br />
das betrifft auch die Ansprüche<br />
der Zahnärzte selbst“, konstatiert<br />
Prof. Dr. Roland Frankenberger<br />
aus Marburg. Diese Tendenz „in<br />
die Kosmetikecke abzuschieben“,<br />
hält der Autor der „Adhäsiv-Fibel“<br />
jedoch für grundfalsch. „Die konsequente<br />
Umstellung in Richtung<br />
Adhäsivtechnik hat unserem Berufsstand<br />
wesentlich mehr genützt<br />
als geschadet, und die Arbeit ist<br />
auch befriedigender geworden.“<br />
Neben den gewachsenen ästhetischen<br />
Ansprüchen hat auch die<br />
kontroverse Diskussion um den<br />
Füllungswerkstoff Amalgam dazu<br />
beigetragen, dass der Einsatz zahnfarbener<br />
Füllungsmaterialien in<br />
den vergangenen Jahren stark zugenommen<br />
hat – und dies mit dem<br />
Segen der Fachgesellschaften:<br />
„Während vor allem ältere Querschnittsstudien<br />
tendenziell bessere<br />
Resultate für Amalgam im Vergleich<br />
zu Kompositen aufwiesen,<br />
zeigen Longitudinalstudien, die<br />
vor allem in den vergangenen 15<br />
Jahren durchgeführt wurden, etwa<br />
gleich gute Ergebnisse“, erklärten<br />
die Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung<br />
(DGZ) und die Deutsche<br />
Gesellschaft für Zahn-, Mundund<br />
Kieferheilkunde (DGZMK)<br />
bereits 2005 in der gemeinsamen<br />
wissenschaftlichen Stellungnahme<br />
„Direkte Kompositrestaurationen<br />
im Seitenzahnbereich – Indikation<br />
und Lebensdauer“.<br />
Paradigmenwechsel. Es geht<br />
aber nicht nur darum, dass Amalgam<br />
durch einen zahnfarbenen<br />
Werkstoff abgelöst wurde und<br />
wird. Bedeutender ist aus Sicht<br />
vieler Zahnmediziner, dass damit<br />
eine substanzschonendere Restaurationstechnik<br />
Einzug gehalten<br />
hat, vergleichbar mit der minimalinvasiven<br />
Chirurgie in der Medizin.<br />
„Man muss sich immer wieder<br />
vor Augen führen, dass bei konventionellem<br />
Vorgehen zum Ersatz<br />
eines kleinen Volumens erkrankter<br />
Zahnhartsubstanz häufig ein<br />
Vielfaches an gesunder Zahnsubstanz<br />
geopfert wird“, wie Prof. Dr.<br />
Bernd Klaiber und Priv.-Doz. Dr.<br />
Burkard Hugo, Würzburg, 2004<br />
in „Innovative Verfahren in der<br />
Zahnheilkunde“ ausführten. „Was<br />
die Karies in Jahrzehnten nicht<br />
schafft, erledigt unter Umständen<br />
der Bohrer in nur wenigen Sekunden.“<br />
Ein solches Vorgehen habe<br />
bei den inzwischen zur Verfügung<br />
stehenden Materialien, Hilfsmitteln<br />
und Techniken keinen Sinn<br />
mehr. Die minimalinvasive Therapie<br />
als Teil eines Prophylaxeorientierten<br />
Restaurationskonzepts<br />
zwinge zum Umdenken.<br />
Blick zurück. Von einem Paradigmenwechsel<br />
war man noch weit<br />
entfernt, als man vor über 60 Jahren<br />
erstmals begann, Komposite<br />
im Frontzahnbereich einzusetzen,<br />
zumal die von Black erarbeiteten<br />
retentiven Kavitätengeometrien in<br />
der Anfangszeit übernommen wurden.<br />
Der Einsatz der ersten selbsthärtenden<br />
Produkte war nicht<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
20<br />
Titelthema<br />
terialeigenschaften, da Silane für<br />
eine Vernetzung der organischen<br />
und anorganischen Komponenten<br />
sorgen. Das Problem der Polymerisationsschrumpfung<br />
konnte<br />
er jedoch auch durch die Beimischung<br />
eines weiteren Dimethacrylats<br />
(TEGDMA) nicht beheben;<br />
es ist strukturell bedingt: Wenn<br />
die linearen Bis-GMA-Monomere<br />
polymerisieren, verkürzen sich die<br />
Abstände zwischen den einzelnen<br />
Molekülen – der Gesamtkomplex<br />
schrumpft.<br />
Mit <strong>moderner</strong> Füllkörpertechnologie<br />
versuchte man in den folgenden<br />
Jahrzehnten, die Polymerisationsschrumpfung<br />
zu reduzieren,<br />
konnte die Zwei-Prozent-Marke<br />
aber bisher nicht deutlich unterschreiten.<br />
Dass Kompositrestaurationen<br />
trotz dieser Problematik<br />
einen weltweiten Siegeszug antraten,<br />
ist auf die parallele Entwicklung<br />
der Adhäsivtechnik zurückzuführen.<br />
Bereits 1955 hatte Buonocore<br />
entdeckt, dass das Anätzen<br />
des Zahnschmelzes mit Phosphorsäure<br />
die Bindungsfähigkeit von<br />
Kunststoff an die Zahnhartsubstanz<br />
verbessern kann. Durch die<br />
Entwicklung ausgeklügelter Adhäsivsysteme<br />
und der schichtweisen<br />
Verarbeitung gelang es, einen Antagonismus<br />
zur Polymerisationsschrumpfung<br />
zu entwickeln, der<br />
dauerhafte Restaurationen letztlich<br />
erst möglich macht.<br />
Substanzschonend. Dank der Adhäsiv-Technik, mit der das Komposit im Zahn befestigt<br />
wird, muss für kleine Kompositfüllungen nur gerade so viel Zahnhartsubstanz<br />
entfernt werden, wie zur Beseitigung der Karies notwendig ist.<br />
unproblematisch; schon damals<br />
kämpfte man mit der Polymerisationsschrumpfung,<br />
so etwa der<br />
Schweizer Chemiker Oskar Hagger,<br />
der als „Vater der modernen<br />
Dentaladhäsive“ 1949 den ersten<br />
Marktführer im Kunststoffbereich,<br />
Sevriton, entwickelte. Knock und<br />
Glenn hatten die Idee, einem Füllungsmaterial<br />
auf Methylmethacrylat-Basis<br />
inerte Al2O3-Füllerpartikel<br />
beizumischen, was sie 1951<br />
zum Patent anmeldeten – ein Prinzip,<br />
das heute noch Bestand hat:<br />
Auch moderne Komposite setzen<br />
sich im Wesentlichen aus einem<br />
organischen Matrixbestandteil und<br />
anorganischen Füllkörpern zusammen.<br />
Pioniere. Aber erst mit Bowen<br />
und Buonocore nahm die Entwicklung<br />
der dentalen Komposite richtig<br />
Fahrt auf: Aus Bisphenol A und<br />
Glycidylmethacrylat synthetisierte<br />
Dr. Rafael L. Bowen Bisphenol-<br />
A-diglycidylmethacrylat (Bis-<br />
GMA), das er 1962 zum Patent<br />
anmeldete – ein bifunktionelles<br />
Molekül, das die organische Matrix<br />
fast aller modernen Composite<br />
bildet. Durch die Verwendung silanüberzogener<br />
Quarzpartikel als<br />
Füllkörper erzielte Bowen eine<br />
wesentliche Verbesserung der Ma-<br />
Alternatives Matrixsystem.<br />
Gleichzeitig ging und geht die<br />
Suche nach Kompositen mit<br />
Schrumpfkraft-reduzierter Matrix<br />
unvermindert weiter. Mit den<br />
Siloranen wurde 2007 ein neues<br />
Monomersystem eingeführt, das<br />
eine Alternative zum verbreiteten<br />
Bis-GMA-basierten System<br />
darstellt. Während die Bis-GMA-<br />
Monomere linear sind und durch<br />
die Polymerisation näher zusammenrücken,<br />
basiert die innovative<br />
Siloranchemie auf ringförmigen<br />
Strukturen, die bei der Polymerisation<br />
„aufklappen“. Dadurch kann<br />
die Polymerisationsschrumpfung<br />
auf unter ein Prozent beschränkt<br />
werden.<br />
Die neue Stoffklasse ist extrem<br />
hydrophob, wodurch bei der<br />
Verarbeitung ein spezielles Zweischritt-Adhäsiv<br />
benötigt wird. Namensgeber<br />
der Silorane sind die<br />
chemischen Bausteine Siloxan und<br />
Oxiran. Die Polymerisation wird<br />
nicht, wie beim Bis-GMA-System,<br />
durch Radikale angestoßen, sondern<br />
kationisch. Während das Material<br />
in Bezug auf Handhabung<br />
und Unempfindlichkeit gegenüber<br />
Umgebungslicht überzeugt, wurde<br />
wenige Jahre nach der Markteinführung<br />
bei Abrasionsstabilität<br />
und Röntgenopazität noch Verbesserungsbedarf<br />
gesehen.<br />
Stressbewältigung. Eine andere,<br />
neue Strategie, die bei Venus<br />
Diamond umgesetzt wurde,<br />
zielt auf die Abschwächung der<br />
sog. Polymerationsschrumpfkraft,<br />
letztlich der Kraft, die am Kavitätenrand<br />
zieht. Dieser „Polymerisationsstress“<br />
ist umso geringer,<br />
je elastischer das Polymer ist, was<br />
durch den Einbau eines Urethan-<br />
Monomers mit einer elastischen<br />
Zwischenkette in die herkömmliche<br />
Bis-GMA-Matrix erreicht<br />
wurde. Zusätzlich wurde für eine<br />
hohe Packungsdichte unterschiedlich<br />
großer Füllkörper gesorgt.<br />
Das Ergebnis: Die Schrumpfkraft<br />
ist der der Silorane vergleichbar.<br />
Außerdem weist das Material die<br />
besten physikalischen Eigenschaften<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Titelthema 21<br />
auf, etwa eine hohe Biegefestigkeit<br />
und wenig Abrasion.<br />
Andere Hersteller versuchen,<br />
durch Verzögerung des Schrumpfkraft-Aufbaus<br />
oder den Einbau<br />
von Modulatoren mit höherem<br />
Molekulargewicht, Einfluss auf<br />
den Polymerisationsstress zu<br />
nehmen – Voraussetzungen, um<br />
Techniken wie Bulk-Filling umzusetzen<br />
(s. Artikel „<strong>Möglichkeiten</strong><br />
<strong>moderner</strong> <strong>Kompositsysteme</strong>, Seite<br />
8 ff.).<br />
Anspruchsvoll. Nicht nur die Behandlung der Zahnsubstanz, auch die eigentliche Klebe-<br />
und Mehrschichttechnik für kleine und größere Kompositfüllungen erfordert anspruchsvolle<br />
Materialien und Instrumente mit Schutzhülle.<br />
Klassifikation. Angesichts der<br />
stetig wachsenden Produktpalette<br />
im Bereich Kompositrestaurationen<br />
ist es immer schwieriger, den<br />
Überblick zu behalten. „Vorbei ist<br />
die Zeit, in der Komposite ausschließlich<br />
hinsichtlich ihrer Füllergröße<br />
klassifiziert worden sind“,<br />
konstatierte der Komposit-Experte<br />
Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Mainz,<br />
2010 in einem Übersichtsartikel<br />
und schlug eine mögliche neue<br />
Ordnung für das erweiterte Angebot<br />
der Kompositmaterialien vor.<br />
Die Einteilung entsprechend ihrer<br />
Konsistenz sieht er als die praktikabelste<br />
für den Anwender an und<br />
stellt Komposite mit „normaler“<br />
oder eher geschmeidigerer Konsistenz<br />
den stopfbaren und hochfesten<br />
Materialien sowie den Flowables<br />
gegenüber.<br />
Diese sind für Ernst „wahre Allrounder“,<br />
vor allem wegen praktischer<br />
Aspekte, die nicht in Studien<br />
abgebildet werden. Ihre Bedeutung<br />
wird dadurch unterstrichen, dass<br />
einzelne Hersteller sogar Flowkomposite<br />
unterschiedlicher Konsistenz<br />
anbieten. Schwer erreichbare<br />
Kavitätenareale oder spitz<br />
auslaufende Winkel beispielsweise<br />
stellen mit Flowables kein Problem<br />
mehr dar, wie sich etwa auch<br />
bei der R2-Technik zeigt (siehe Interview<br />
mit Prof. Dr. Diana Wolff,<br />
Seite 16 ff.).<br />
Die Frage, welche Komposite –<br />
geschmeidigere oder hochfeste –<br />
nun die besseren sind, lässt sich<br />
nach Ernsts Einschätzung nicht<br />
pauschal für eine Gruppe beantworten,<br />
da Qualitätsunterschiede<br />
eher produktspezifisch sind. Aus<br />
seiner Sicht ist der persönliche<br />
Wohlfühlfaktor nicht zu unterschätzen<br />
und dürfte in seiner Wertigkeit<br />
manchen labortechnischen<br />
Parametern überlegen sein.<br />
» schildhauer@meduco.de<br />
Fotos: Fotolia<br />
Anzeige<br />
© Stephan Große Rüschkamp<br />
Damit ärzte ohne grenzen in Krisengebieten und<br />
bei Katastrophen auf der ganzen Welt schnell und<br />
unbürokratisch Leben retten kann – spenden Sie<br />
mit dem Verwendungszweck „Ohne Grenzen“.<br />
Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationen<br />
über ärzte ohne grenzen<br />
zu Spendenmöglichkeiten<br />
für einen Projekteinsatz<br />
Name<br />
11104964<br />
Anschrift<br />
E-Mail<br />
was hier fehlt, ist ihre spende.<br />
ärzte ohne grenzen e.V. • Am Köllnischen Park 1 • 10179 Berlin<br />
Spendenkonto 97 0 97<br />
Bank für Sozialwirtschaft<br />
blz 370 205 00<br />
www.aerzte-ohne-grenzen.de<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
22<br />
Titelthema<br />
Gesundheitsrisiken durch Dentalmaterialien<br />
Komposite weiter auf dem Prüfstand<br />
Durch Allergien oder Umweltbelastungen sind immer mehr<br />
Menschen in ihrer Gesundheit oder Lebensqualität eingeschränkt.<br />
Deshalb ist die Frage von Patienten nach bioverträglichen Dentalmaterialien<br />
verständlich, denn Dentale Restaurationen jeglicher Art<br />
werden in einem für Irritationen höchst sensiblen Bereich eingebracht.<br />
Gute Gründe, Komposite weiterhin verstärkt unter die Lupe<br />
zu nehmen und Patientenbeschwerden auf den Grund zu gehen.<br />
Risiko. Die Gefahr einer Allergisierung besteht bei Kompositen wenn die anwendende<br />
Zahnärztin oder der Zahnarzt mit dem Monomer des Komposits und mit den Dentinadhäsiven<br />
in Kontakt kommen.<br />
Schaut man in die Laienpresse<br />
oder in einschlägige Foren im Internet,<br />
stellt man fest, dass immer<br />
mehr Menschen den Verdacht hegen,<br />
an Unverträglichkeiten gegenüber<br />
Dentalmaterialien zu leiden.<br />
Nach aktuellen wissenschaftlichen<br />
Erkenntnissen ist das Risiko einer<br />
Gesundheitsschädigung durch<br />
zahnärztliche Materialien zwar als<br />
gering einzustufen – ganz im Gegensatz<br />
zu Kosmetika, bei denen<br />
das Risiko einer Materialunverträglichkeit<br />
um mindestens das 40-fache<br />
höher ist als bei Dentalmaterialien.<br />
Darauf wies Prof. Dr. Gottfried<br />
Schmalz, Regensburg, auf der<br />
41. Jahrestagung der südbadischen<br />
Zahnärzteschaft in Rust hin. Er<br />
plädierte dafür, dem Patienten zu<br />
erklären, dass es kein Null-Risiko<br />
gibt, aber bei Beachtung der entsprechenden<br />
Richtlinien die Häufigkeit<br />
von Nebenwirkungen auf<br />
zahnärztliche Werkstoffe gering ist.<br />
Dennoch kann es gegenüber sämtlichen<br />
gebräuchlichen dentalen Restaurationsmaterialien<br />
wie Amalgamen,<br />
Komposit-Kunststoffen oder<br />
Gussmetallen zu allergischen Reaktionen<br />
kommen. Dabei stehen Spätreaktionen<br />
vom Typ 4 gegenüber<br />
extrem seltenen Sofortreaktionen<br />
(Typ-1-Allergien) im Vordergrund.<br />
Kein allgemeines Risiko. Fest<br />
steht, dass Komposite wesentlich<br />
häufiger systemische Wirkungen<br />
entfalten können als bisher angenommen.<br />
Für die Biokompatibilität<br />
von lichthärtenden Kompositen<br />
ist primär nicht ihre Zusammensetzung,<br />
sondern ihre Verarbeitung<br />
von entscheidender Bedeutung.<br />
Dennoch ist laut Prof. Schmalz<br />
davon auszugehen, dass keine Gefährdung<br />
der Bevölkerung („allgemeines<br />
Risiko“) vorliegt. Das<br />
individuelle Risiko aber muss abgeklärt<br />
und es muss auf Nebenwirkungen<br />
geachtet werden, die von<br />
unangenehmen Reaktionen bis hin<br />
zu schwerwiegenden allergischen<br />
Symptomen (z. B. Asthma und Ekzeme)<br />
reichen können. Mittlerweile<br />
konnten als Auslöser solcher Reaktionen<br />
die in der Zahnmedizin<br />
häufig verwendeten Methacrylate<br />
identifiziert werden.<br />
Risiko für Behandler. Die Gefahr<br />
einer Allergisierung besteht bei<br />
Kompositen vor allem für den anwendenden<br />
Zahnarzt, der mit dem<br />
Monomer des Komposits und mit<br />
den Dentinadhäsiven in Hautkontakt<br />
kommt. Allergische Hautreaktionen<br />
bis hin zu schweren allergischen<br />
Kontaktekzemen können die<br />
Folge sein, weshalb Dentinadhäsiva<br />
nicht berührt werden sollen. Eine<br />
Umfrage bei 2208 dänischen Zahnärzten<br />
hat ergeben, dass bei 0,7 Prozent<br />
der Behandler Kontaktekzeme<br />
durch methacrylathaltige Materialien<br />
nachgewiesen werden konnten.<br />
Befürchtungen von Patienten.<br />
Bereits im Jahr 2000 schrieb Prof.<br />
Dr. Dr. Hans Jörg Staehle im Deutschen<br />
Ärzteblatt: „25 Prozent der<br />
Bevölkerung sind der Auffassung,<br />
durch Dentalmaterialien wie zum<br />
Beispiel Amalgam ausgeprägte<br />
Gesundheitsbeeinträchtigungen erlitten<br />
zu haben. Weitere 40 Prozent<br />
der Bevölkerung befürchten zumindest<br />
eine geringe Schädigung<br />
und nur noch eine Minderheit von<br />
unter 40 Prozent glaubt, durch Dentalmaterialien<br />
gesundheitlich nicht<br />
beeinträchtigt zu werden. Während<br />
bislang noch das Füllungsmaterial<br />
Amalgam im Vordergrund der Befürchtungen<br />
steht, gibt es Indizien<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Titelthema 23<br />
dafür, dass künftig vermehrt zahnärztliche<br />
Materialien auf Kunststoffbasis<br />
in den Blickpunkt des<br />
öffentlichen Interesses treten werden.“<br />
Risiken nicht beachtet? Vielleicht<br />
hat man zu Beginn der<br />
Komposit-Ära das Risiko von Unverträglichkeiten<br />
nicht genügend<br />
beachtet, schließlich hat man mit<br />
den modernen Kompositen eine<br />
Alternative zum Amalgam an die<br />
Hand bekommen, das zudem den<br />
Wünschen der Patienten nach zahnfarbenen<br />
Restaurationen sehr entgegenkam.<br />
Mit der Zunahme der<br />
Kompositfüllungen, die allmählich<br />
das Amalgam ablösen, verschiebt<br />
sich die Kritik in Richtung Komposite.<br />
In Anbetracht der chemischen<br />
Variationsbreite der Komposite im<br />
Vergleich zum sehr einfach strukturierten<br />
Amalgam scheint es auch<br />
nahezu unmöglich, den um ein<br />
Vielfaches komplexeren Metabolismus<br />
von Kunststoffmaterialien mit<br />
ihren unterschiedlichen Bestandteilen<br />
und Strukturen und deren Wirkungen<br />
zu erforschen.<br />
Kritik. Mit der Zunahme der Kompositfüllungen, die allmählich das Amalgam ablösen,<br />
verschiebt sich die Kritik in Richtung Komposite.<br />
Allergie und Unverträglichkeit.<br />
Dass Risiken nicht bekannt waren,<br />
galt bis vor kurzem auch für Titan,<br />
das seit mehr als zwei Jahrzehnten<br />
als eines der besten Materialien für<br />
Implantate gilt: Mehr als 95 Prozent<br />
aller Knochenimplantate werden<br />
aus Titanlegierungen, Zahnimplantate<br />
aus Reintitan hergestellt, weil<br />
man lange davon ausging, dass dieses<br />
Metall keine Allergien auslöst.<br />
Sabine Schütt vom Berliner Institut<br />
für Medizinische Diagnostik stellt<br />
richtig, dass die Aussage „keine<br />
Allergie“ nicht gleichbedeutend ist<br />
mit „keine Unverträglichkeit“. „Sicherlich<br />
verzeichnen wir bei Titanimplantationen<br />
hohe Einheilquoten.<br />
Dennoch gibt es immer wieder Patienten,<br />
bei denen es zu Unverträglichkeiten<br />
kommt, der Betroffene<br />
mit einer erhöhten Entzündungsantwort<br />
reagiert.“ Das liegt dann<br />
häufig daran, dass das eingebrachte<br />
Titan ständig oxidiert und die bakteriengroßen<br />
Titanoxidpartikel vom<br />
Immunsystem als fremd angesehen<br />
und von Makrophagen bekämpft<br />
werden. Testverfahren, die entwickelt<br />
wurden, um Titanunverträglichkeiten<br />
zu entlarven, erlauben<br />
inzwischen eine diagnostische Abklärung<br />
von individuellen Titanunverträglichkeiten<br />
vor dem Einsatz<br />
und bei bestehendem Verdacht auf<br />
proentzündliche Zusammenhänge.<br />
Vielfache Unverträglichkeit. Das<br />
ist auch mehr als notwendig in Anbetracht<br />
der Tatsache, dass man in<br />
Deutschland mit schätzungsweise<br />
acht Millionen Menschen rechnen<br />
muss, die entweder das Vollbild<br />
einer Vielfachen Chemikalienunverträglichkeit<br />
(abgekürzt MCS<br />
vom englischen Multiple Chemical<br />
Sensitivity) entwickelt haben oder<br />
in dieser Hinsicht gefährdet sind.<br />
Nachdem in den Achtziger- und<br />
Neunzigerjahren diskutiert worden<br />
war, ob dieses Krankheitsbild<br />
der Toxikologie oder der Psychosomatik<br />
zuzuordnen sei, setzt sich<br />
inzwischen ein multifaktorielles<br />
Störungsmodell durch, welches Aspekte<br />
beider Felder in einem „biopsycho-sozialen“<br />
Modell berücksichtigt.<br />
Symptome. Betroffene weisen<br />
ein Beschwerdebild mit zum Teil<br />
starken Unverträglichkeiten gegenüber<br />
vielfältigen Chemikalien auf.<br />
Am häufigsten genannt werden in<br />
diesem Zusammenhang Duftstoffe,<br />
Lösungsmittel, Pestizide, Zigarettenrauch,<br />
frische Farbe, Benzin und<br />
Autoabgase. Die Symptome, die am<br />
häufigsten auftreten, sind Übelkeit,<br />
Kopfschmerzen, Augenreizung,<br />
Kurzatmigkeit, laufende oder verstopfte<br />
Nase, Konzentrationsstörungen,<br />
Schwindel und Benommenheit.<br />
Im Zusammenhang mit<br />
Dentalmaterialien werden unter anderem<br />
Allergien, lichenoide Reaktionen,<br />
elektrochemische Reaktionen<br />
und toxische Belastungen genannt.<br />
Besteht der Verdacht auf Unverträglichkeiten<br />
gegenüber Dentalmaterialien,<br />
empfiehlt sich nicht<br />
nur bei diesem Personenkreis eine<br />
interdisziplinäre Abklärung, die<br />
unter anderem zahnärztliche, psychosomatische,<br />
allergologische und<br />
toxikologische Aspekte einbezieht.<br />
Zurückhaltung ist laut Prof. Staehle<br />
„bei der Anwendung umstrittener<br />
Testmethoden aus dem Bereich der<br />
Komplementärmedizin“ geboten.<br />
Spezialisierte Forschung.<br />
Auch der Pharmakologe Prof. Dr.<br />
Dr. Franz-Xaver Reichl, Leiter des<br />
Beratungszentrums für die Verträglichkeit<br />
von Zahnmaterialien an der<br />
Ludwig-Maximilians-Universität<br />
München, registriert eine Zunahme<br />
der Allergien gegenüber Zahnfüllungsmaterialien.<br />
Die Zahlen<br />
stammen vorwiegend aus skandinavischen<br />
Untersuchungen zur Bevölkerungsgesundheit<br />
und aus seiner<br />
eigenen beruflichen Erfahrung in<br />
Fotos: Fotolia<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
24<br />
Titelthema<br />
Deutschland. Seine Arbeitsgruppe<br />
ist spezialisiert auf Forschungsarbeiten<br />
im Bereich der Toxikologie,<br />
Allergologie, Biokompatibilität<br />
und Verträglichkeit dentaler Materialien.<br />
Neben allergischen Reaktionen<br />
speziell auf Methacrylate<br />
bei Zahnärzten und zahnärztlichem<br />
Personal weist er auf Gefahren<br />
durch die Konzentration von Monomeren,<br />
besonders von Methylmethacrylat,<br />
in der Raumluft von<br />
zahntechnischen Laboren hin. Für<br />
Patienten, die Probleme mit der<br />
Verträglichkeit von Zahnmaterialien<br />
haben, bietet Prof. Reichl in<br />
seinem Beratungszentrum mit der<br />
nach eigenen Angaben „mittlerweile<br />
weltgrößten Datenbank zur<br />
Freisetzungsrate von Inhaltsstoffe<br />
aus Zahnmaterialien“ Hilfe an.<br />
Untersucht wurden viele der kommerziell<br />
verfügbaren Komposite,<br />
Dentinadhäsive, Wurzelkanalfüllmaterialien,<br />
Prothesenmaterialien,<br />
Fissurenversiegler, Zemente, Keramiken<br />
und Dental-Legierungen.<br />
In Zusammenarbeit mit Kliniken<br />
und Instituten an der Ludwig-Maximilians-Universität<br />
München, an<br />
der Technischen Universität München<br />
und am Helmholtz-Zentrum<br />
in Neuherberg/München wurde ein<br />
Allergie-Testverfahren entwickelt,<br />
zum Nachweis einer eventuellen<br />
Allergie gegenüber Inhaltsstoffen<br />
aus Zahnmaterialien.<br />
Allergietestung. Zur Testung<br />
einer allergischen Reaktion gegenüber<br />
Zahnmaterialien wird heute<br />
als Standardverfahren der Epikutantest<br />
durchgeführt. Hierbei wird<br />
eine Serie von Testpflastern auf die<br />
Haut aufgeklebt, um festzustellen,<br />
ob eine Allergie gegen die getestete<br />
Substanz vorliegt. Dieser Test<br />
Allergien. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Risiko einer Gesundheitsschädigung<br />
durch zahnärztliche Materialien zwar als gering einzustufen, dennoch<br />
kann es gegenüber sämtlichen dentalen Restaurationsmaterialien wie Amalgamen,<br />
Komposit-Kunststoffen oder Gussmetallen zu allergischen Reaktionen kommen.<br />
zeigt, ob eine Kontaktallergie vom<br />
Spättyp vorliegt. Auf seiner Website<br />
gibt Prof. Reichl zu bedenken:<br />
„Hervorzuheben ist, dass fertige<br />
Prüfkörper aus polymerisierten<br />
Materialien nicht im Epikutantest<br />
eingesetzt werden können, da bekannt<br />
ist, dass einige relevante Inhaltsstoffe<br />
aus Komposits erst nach<br />
sechs Monaten freigesetzt werden.<br />
Ein Epikutantest dauert aber nur<br />
drei Tage, weshalb hier diese Substanzen<br />
damit gar nicht erfasst werden<br />
können.“<br />
Da Allergien und Kreuzallergien<br />
durch Anwendung des Epikutantests<br />
erst getriggert werden können,<br />
setzt man auf weitere Testmethoden.<br />
So werden zunehmend immunologische<br />
Tests für die Bestimmung<br />
einer Unverträglichkeit bei<br />
Patienten gegenüber Zahnmaterialien<br />
herangezogen, darunter der<br />
sogenannte Lymphozyten-Transformationstest<br />
(LTT). Er hat den<br />
Vorteil, dass der Betroffene nicht<br />
unmittelbar mit den zu testenden<br />
Substanzen in Berührung kommt,<br />
weil nur in seinem entnommenen<br />
Blut die allergische Bestimmung<br />
erfolgt. Aufgrund der von den Allergologischen<br />
Gesellschaften und<br />
vom Robert-Koch-Institut proklamierten<br />
(derzeit) eingeschränkten<br />
Anwendung des LTT zur Testung<br />
von Zahnmaterialien bei Patienten<br />
mit Unverträglichkeiten besteht allerdings<br />
derzeit keine Alternative<br />
zum Epikutantest. Für die Fülle der<br />
zu testenden Substanzen wäre der<br />
LTT wohl auch zu kostspielig.<br />
Dorothea Kallenberg<br />
» info@zahnaerzteblatt.de<br />
Anzeige<br />
Foto: Wikipedia<br />
www.plan.de<br />
Plan International<br />
Deutschland e. V.<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
dentEvent „Beruf & Familie“ | Stuttgart | 15. Oktober 2016<br />
Programm<br />
09.00 Begrüßung und Einführung durch die Gastgeberinnen<br />
Dr. Ute Maier, Vorsitzende des Vorstandes der KZV BW<br />
Dr. Renate Lüllwitz-Hoch, Beauftragte für Beruf/Familie<br />
der LZK BW<br />
09.15 Wirtschaftliche und steuerliche Chancen der Niederlassung<br />
Prof. Dr. jur. Vlado Bicanski, Rechtsanwalt und Steuerberater<br />
10.45 Kaffeepause<br />
11.15 From Zero to Hero: Der Weg vom Assistenten zum eigenen Chef!<br />
Dr. Daniel Jäger, Zahnarzt<br />
12.15 Mittagspause<br />
13.30 Wie verkaufe ich mich am besten? Bewerbung und Gehaltsverhandlungen<br />
für junge Zahnärzte/innen von Assistenz bis Anstellung<br />
Birgit Dohlus, Fachjournalistin für Zahnmedizin<br />
14.30 Kaffeepause<br />
15.00 Teamführung und Personal, wie motiviere und führe ich meine<br />
Mitarbeiter/innen?<br />
Dr. Susanne Woitzik, Diplom-Kauffrau<br />
16.00 Gemeinsamer Ausklang<br />
Zahnärztehaus Stuttgart<br />
Albstadtweg 9<br />
70567 Stuttgart<br />
JETZT<br />
ANMELDEN!<br />
Konferenzbeitrag: 89,- €<br />
Kostenfreie Teilnahme für Studierende<br />
Anmeldung und weitere Infos: www.lzk-bw.de unter „Termine“
26<br />
Berufspolitik<br />
Landesweiter Erfahrungsaustausch der Senioren- und Behindertenbeauftragten<br />
Der Versorgungsauftrag umfasst<br />
auch Menschen mit Demenz<br />
„Ich bin nicht nur ein Gero-Nerd, ich bin auch ein Demenz-Nerd“. Mit<br />
dieser Aussage war die Kieler Zahnärztin Dr. Claudia Ramm die ideale<br />
Referentin für den zweiten landesweiten Erfahrungsaustausch der<br />
baden-württembergischen Senioren- und Behindertenbeauftragten am<br />
4. Juni im Zahnärztehaus in Stuttgart.<br />
Gelungen. Der Arbeitskreis mit Referenten und Gästen beim zweiten landesweiten<br />
Erfahrungsaustausch der Senioren- und Behindertenbeauftragten (v. l.): Dr. Ulrike Heiligenhaus-Urmersbach,<br />
Dr. Konrad Bühler, Dr. Renate Lüllwitz-Hoch, Dr. Carla Tornier,<br />
Dr. Claudia Ramm, Dr. Elmar Ludwig und Dr. Ute Maier.<br />
Ihr Nerd-Bekenntnis und die Beharrlichkeit,<br />
mit der Dr. Claudia<br />
Ramm auf einen umfassenden Versorgungsauftrag<br />
der Zahnärztin und<br />
des Zahnarztes, der auch Menschen<br />
mit Demenz umfasst, hinwies, führte<br />
den Senioren- und Behindertenbeauftragten<br />
der Landeszahnärztekammer<br />
sicherlich auch vor Augen, warum<br />
sie sich als Zahnärztinnen und<br />
Zahnärzte ausgerechnet im Bereich<br />
der Alters- und Behindertenzahnheilkunde<br />
engagieren. Dr. Claudia<br />
Ramm stellte ihr selbst entwickeltes<br />
Konzept einer Sprechstunde für<br />
Menschen mit Demenz, basierend<br />
auf dem Marte-Meo-Prinzip vor.<br />
Das Marte-Meo-Prinzip ist eine<br />
Kommunikationsmethode, die mit<br />
Videounterstützung versucht, Zugang<br />
und Vertrauen zu Menschen<br />
mit Demenz aufzubauen, damit eine<br />
zahnmedizinische Betreuung und<br />
Behandlung erfolgen kann. Claudia<br />
Ramm und ihre Mitarbeiterinnen haben<br />
mit diesem Konzept beeindruckende<br />
Erfolge in der Praxis bei der<br />
Behandlung von Menschen mit Demenz<br />
erzielt. Sie zeigte ihre Behandlungserfolge<br />
anhand von zahlreichen<br />
Videoaufnahmen. Grundlage für die<br />
erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes<br />
in der Praxis ist umfassendes<br />
Wissen rund um eine demenzielle<br />
Erkrankung. Dr. Ramm skizzierte<br />
den Krankheitsverlauf vom Anfangsstadium<br />
bis zum schwersten<br />
Stadium, bei dem die Patienten sich<br />
oftmals nicht mehr selbst im Spiegel<br />
erkennen. Was erleben Menschen<br />
mit Demenz? Was brauchen sie?<br />
„Menschen mit Demenz haben die<br />
Fähigkeit verloren zu spüren und<br />
zu fühlen, wir arbeiten daher mit<br />
einem sogenannten Fühlkissen“,<br />
berichtete Dr. Ramm. „No brain, no<br />
pain“ – über die Vorstellungen einiger<br />
Kollegen kann sie nur den Kopf<br />
schütteln. Ihr uneingeschränkter<br />
Einsatz für Patienten mit Demenz<br />
kennt auch keine Entschuldigung für<br />
Angehörige, die aus Scham und weil<br />
sie nicht zu ihren dementen Eltern<br />
stehen können, nicht in die zahnärztliche<br />
Praxis kommen. „Dafür habe<br />
ich kein Verständnis“.<br />
Die Zahnärztin, die auch Landesbeauftragte<br />
der Deutschen Gesellschaft<br />
für Alterszahnmedizin<br />
(DGAZ) in ihrem Bundesland ist,<br />
verstand es mit ihrer Herzenswärme<br />
die Senioren- und Behindertenbeauftragten<br />
zu sensibilisieren, wie<br />
mit Patienten mit Demenz umgegangen<br />
werden sollte und welche<br />
besonderen Anforderungen diese<br />
Patienten an die Zahnärztin und den<br />
Zahnarzt stellen. „Bezugs- und Vertrauenspersonen<br />
sind ganz wichtig“,<br />
empfahl Dr. Ramm, „und ein Versorgungsnetzwerk<br />
zwischen Zahnarzt,<br />
Hausarzt, Geriater, Internist sowie<br />
Logopäden und Ergotherapeuten“.<br />
Prävention und Kontinuität sind bei<br />
der Behandlung von Menschen mit<br />
Demenz der Schlüssel zum Erfolg.<br />
Der Referent für Alterszahnheilkunde<br />
der LZK BW, Dr. Elmar Ludwig,<br />
zeigte sich beeindruckt vom<br />
Vortrag der Kollegin aus Kiel, obgleich<br />
er ihr Konzept bereits aus der<br />
gemeinsamen Arbeit in der DGAZ<br />
und seiner Forschungsreise als Walther-Engel-Preisträger<br />
kannte. „Es<br />
braucht Zeit, ein solches Konzept zu<br />
entwickeln – ich habe heute wieder<br />
viele Anregungen mitgenommen“.<br />
Soziale Verantwortung. Respekt<br />
und Anerkennung zollte auch die<br />
Vorstandsvorsitzende der KZV BW,<br />
Dr. Ute Maier, den Ausführungen<br />
von Dr. Claudia Ramm zum umfassenden<br />
Versorgungsauftrag, „wir haben<br />
eine soziale Verantwortung als<br />
Zahnärzte und können uns nicht nur<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Berufspolitik 27<br />
Idee. Dr. Schilling, SuB aus Tuttlingen, stellte ein im CPD-Kurs<br />
der Akademie Karlsruhe entwickeltes Plakat für Hausbesuche vor.<br />
Tradition. Dr. Ute Maier informiert über die aktuellen Entwicklungen<br />
betreffend die Abrechnung, gesetzliche Neuerungen und<br />
den Stand der Kooperationsverträge nach § 119b SGB V.<br />
Fotos: Mader<br />
die angenehmen Patienten herauspicken<br />
– wir müssen daran arbeiten,<br />
dass in der Kollegenschaft ein Umdenken<br />
stattfindet“.<br />
Es ist inzwischen gute Tradition,<br />
dass Dr. Ute Maier beim SuB-<br />
Erfahrungsaustausch über die aktuellen<br />
Entwicklungen betreffend<br />
die Abrechnung, gesetzliche Neuerungen<br />
und den Stand der Kooperationsverträge<br />
nach § 119b SGB V<br />
informiert. „Und wir sind Ute Maier<br />
auch sehr dankbar, dass sie sich diese<br />
Zeit bei ihrem vollen Terminkalender<br />
nimmt“, dankte Dr. Ludwig.<br />
Dr. Maier berichtete zunächst<br />
über die am 5.5.2016 in Kraft getretene<br />
Richtlinie des Gemeinsamen<br />
Bundesausschusses (G-BA) über<br />
die Verordnung von Krankenfahrten,<br />
Krankentransportleistungen<br />
und Rettungsfahrten nach § 92<br />
Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 SGB<br />
V (Krankentransport-Richtlinie).<br />
Zahnärzte können demnach bei<br />
zwingender medizinischer Notwendigkeit<br />
im Zusammenhang mit einer<br />
vertragszahnärztlichen Behandlungsbedürftigkeit<br />
Krankenfahrten<br />
u. a. für Pflegebedürftige (Pflegestufe<br />
2 oder 3) und Menschen mit<br />
Behinderungen (Schwerbehindertenausweis/aG/BI/H)<br />
zur ambulanten<br />
Behandlung verordnen. Dabei<br />
ist aus Sicht der KZV-Vorsitzenden<br />
die Entscheidung, welches Transportmittel<br />
jeweils das geeignete ist,<br />
aufgrund der Multimorbidität und<br />
den damit einhergehenden Risiken<br />
für den Zahnarzt nicht immer<br />
möglich. Sie empfiehlt deshalb<br />
grundsätzlich die vorherige Kontaktaufnahme<br />
mit dem Hausarzt und<br />
kündigte eine Hilfestellung zum<br />
Umgang mit der neuen Richtlinie<br />
in Zusammenarbeit mit Dr. Ludwig<br />
an. Breiten Raum in ihren Ausführungen<br />
und auch auf großes Interesse<br />
seitens der Senioren- und Behindertenbeauftragten<br />
stieß das Thema<br />
Kooperationsvertrag zwischen<br />
Altenpflegeeinrichtung und Zahnarzt.<br />
Der Abschluss der Verträge<br />
sei in Baden-Württemberg zwar anfangs<br />
etwas schleppend angelaufen,<br />
„inzwischen bekommen wir aber<br />
pro Woche einen bis zwei neue Verträge.“<br />
Man dürfe allerdings nicht<br />
auf eine unzureichende zahnärztliche<br />
Betreuung der Pflegeeinrichtungen<br />
in Baden-Württemberg schließen,<br />
da viele Zahnärztinnen und<br />
Zahnärzte Einrichtungen auch ohne<br />
Vertrag betreuten, sagte Dr. Maier.<br />
Im Rahmen ihres Berichts zu den<br />
Ergebnissen der aktuellen Vertragsverhandlungen<br />
informierte sie über<br />
ein besonders erfreuliches Ergebnis<br />
für alle, die sich in der aufsuchenden<br />
Betreuung engagieren: „Zukünftig<br />
sind Mengensteigerungen, die mit<br />
dem Aufsuchen von Versicherten<br />
in häuslicher und stationärer Pflege<br />
erbracht werden (Annexleistungen<br />
in Folge § 87 Abs. 2i und 2j sowie<br />
119b SGB V) budgetfrei bei AOK<br />
BW und SVLFG-LKK.“ Bei Krankenkassen,<br />
bei denen die Ausgabenvolumina<br />
unterschritten werden, gilt<br />
dies sowieso“.<br />
Hochrisikopatient. Dr. Elmar<br />
Ludwig verwies als Hilfestellung<br />
zur Ausgestaltung eines Kooperationsvertrages<br />
auf einen Beitrag<br />
in der Juniausgabe des Freien<br />
Zahnarztes, in dem er den organisatorischen<br />
Ablauf des eigenen<br />
Kooperationsverhältnisses mit einer<br />
Pflegeeinrichtung Schritt für<br />
Schritt beschreibt. Ein neues Formular<br />
zur Dokumentation eines<br />
Besuchs im Webauftritt der LZK<br />
sowie ein Powerpointvortrag und<br />
der Film über SuB Torben Wenz<br />
auf dem LZK-YouTube-Kanal ergänzen<br />
die Palette an praktischen<br />
Hilfestellungen zur Ausgestaltung<br />
von Kooperationsverträgen für die<br />
Kollegenschaft.<br />
Bei seinen weiteren Ausführungen<br />
konzentrierte sich Dr. Ludwig<br />
auf die Thematik der Delegation<br />
zahnärztlicher Leistungen im Zusammenhang<br />
mit der Behandlung<br />
von „Hochrisikopatienten“, zu<br />
denen Bewohner in Pflegeeinrichtungen<br />
zählen. Im Kreis der Beauftragten<br />
herrschte Einigkeit darüber,<br />
dass die Mundhöhle Hochrisikogebiet<br />
ist und eine Behandlung von<br />
pflegebedürftigen Bewohnern in<br />
Altenpflegeheimen ausschließlich<br />
dem Zahnarzt vorbehalten bleiben<br />
muss. Eine Aufweichung des Delegationsrahmens<br />
in dieser Hinsicht<br />
wird strikt abgelehnt. Dr. Ludwig<br />
verwies auf eine entsprechende<br />
Stellungnahme der DGAZ.<br />
» mader@lzk-bw.de<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
28<br />
Fortbildung<br />
Mikroinvasive Kariestherapie<br />
Mit „Heal and Seal“ zum Ziel<br />
Approximale Kariesläsionen im Seitenzahnbereich konnten – je nach Ausdehnung des Defektes – bisher nur<br />
durch Fluoridierung und Monitoring oder durch Zugangskavität, Exkavation und Restauration therapiert<br />
werden. Gegenwärtig gibt es zusätzlich zum Konzept „Drill and Fill“ die alternative Methode „Heal and Seal“.<br />
Bei der Therapie von approximalen Defekten sollte so<br />
non-invasiv wie möglich vorgegangen werden. Durch<br />
die Methode der Kariesinfiltration steht dem Praktiker<br />
statt einer Restauration ein alternatives Konzept ohne<br />
Zahnhartsubstanzverlust zur Verfügung. Mittels Kariesinfiltration<br />
können Läsionen verschlossen und von äußeren<br />
Einflüssen geschützt werden. Dies führt zur Arretierung<br />
der Karies; so wird ein Fortschreiten verhindert.<br />
Die Infiltrationsmethode ist gut untersucht und die Wirksamkeit<br />
ist klinisch belegt. Das Ziel ist es, die Porositäten<br />
der Schmelzkaries mit lichthärtenden Kunststoffen<br />
zu verschließen, um damit die Diffusionswege für kariogene<br />
Säuren zu blockieren und so eine Verlangsamung<br />
oder Arretierung des Kariesprozesses zu bewirken.<br />
Therapieentscheid. Um Indikation oder Kontraindikation<br />
der Infiltrationsmethode zu bestimmen, sind<br />
Bissflügelaufnahmen unerlässlich. Das Hauptanwen-<br />
dungsgebiet ist die nicht kavitierte Karies. Der Zahn<br />
darf im betreffenden Approximalraum noch keine Füllung<br />
oder Restauration aufweisen. Röntgenologisch<br />
sollten die approximalen Aufhellungen (Abb. 1) nur bis<br />
in die innere Schmelzhälfte (E2) oder das äußere Dentindrittel<br />
(D1) ausgedehnt sein, um die Indikation zur<br />
Infiltration stellen zu können.<br />
Läsionen, die nur bis in die äußere Schmelzhälfte reichen<br />
(E1), werden idealerweise fluoridiert und weiter<br />
beobachtet. Läsionen, die im Röntgenbild bis ins mittlere<br />
(D2) oder innere Dentindrittel (D3) vorangeschritten<br />
sind, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit kavitiert. Sie<br />
können mittels Infiltration nicht mehr therapiert werden –<br />
eine restaurative Therapie ist dann angezeigt.<br />
Durch das individuelle Kariesrisiko und die Progressionstendenz<br />
der Läsionen bei einzelnen Patienten sind<br />
die Therapieoptionen dennoch fließend im Übergang<br />
(Abb. 2). Zudem spielt die Kariesaktivität eine Rolle in<br />
Bissflügelröntgenaufnahme mit approximalen Läsionen im<br />
Seitenzahnbereich (Zahn 25 distal bis in die innere Schmelzhälfte<br />
(E2) ausgedehnt, Zahn 26 mesial und distal bis ins äußere<br />
Dentindrittel (D1) ausgedehnt) (Abb. 1).<br />
Röntgenologische Indikationsstellung und daraus folgende<br />
Therapieoptionen (Abb. 2).<br />
Klinische Ausgangssituation: Zahn 25 unter Kofferdam zur<br />
absoluten Trockenlegung (Abb. 3).<br />
Separierkeil. Einbringen des Separierkeils zur einfacheren<br />
Applikation der Folie (Abb. 4).<br />
Fotos: Dr. Bräuning<br />
ZBW 7/2016
Fortbildung 29<br />
der Entscheidungsfindung. Bei hohem Risiko und einer<br />
großen Tendenz zur Progression ist eventuell die Infiltration<br />
schon bei einer E1-Läsion indiziert. Bei Patienten<br />
mit niedrigem Kariesrisiko und geringer Kariesaktivität<br />
kann es sinnvoll sein, die Indikation zur Infiltration auch<br />
erst bei einer vorhandenen D1-Läsion zu stellen (siehe<br />
Tabelle Seite 31).<br />
Eine ausführliche Aufklärung für alle Patienten, bei<br />
denen Karies diagnostiziert wurde, ist deshalb erstrebenswert.<br />
Genau eruiert werden sollten die Vor- und<br />
Nachteile von Kariesinfiltration und der Alternative Füllung/Restauration<br />
oder auch nur Fluoridierung – je nach<br />
Läsionsgröße. Der Patient kann so die Entscheidung bei<br />
genauer Aufklärung mittragen. Im Folgenden sind die<br />
Vor- und Nachteile der Kariesinfiltration in der Praxis<br />
dargestellt.<br />
Infiltration Step by Step. Nach der Indikationsstellung<br />
mit der Bissflügelaufnahme und Sondierung, um<br />
eine Kavitation auszuschließen, wird der Zahn gesäubert.<br />
Eine Gingivitisprophylaxe (geeignete Mundspüllösung<br />
oder Professionelle Zahnreinigung) ist im Vorfeld<br />
aufgrund der möglichen Blutungsneigung der Gingiva<br />
sinnvoll.<br />
Danach muss Kofferdam gelegt werden (Abb. 3). Man<br />
sollte den praxiseigenen Kofferdam vor der Behandlung<br />
testen, ob er der Säure standhält. Latexfreier Kofferdam<br />
wird porös und eine speichelfreie Therapie ist nicht mehr<br />
möglich.<br />
Eine Anästhesie ist nicht unbedingt erforderlich, kann<br />
jedoch die anschließende Applikation des Separierkeils<br />
(Abb. 4) für Patient und Behandler vereinfachen.<br />
Es folgt das Einbringen des Folienapplikators, der auf<br />
der grünen Seite eine perforierte Stelle aufweist. Diese<br />
muss zum behandelnden Zahn hin zeigen. Auf den Folienapplikator<br />
kann nun ICON-Etch (Abb. 5) aufgeschraubt<br />
werden. Durch Ätzung von zwei Minuten entfernt fünfzehnprozentiges<br />
Salzsäuregel die pseudointakte Oberflächenschicht<br />
der Karies. Diese wird 30 Sekunden mit<br />
Wasser abgespült und weitere 30 Sekunden gut getrocknet.<br />
Verbleibende Flüssigkeit verhindert die Penetration<br />
der dünn fließenden methacrylatbasierten Harzmatrix.<br />
Wichtig ist die genaue Zeitmessung während der<br />
einzelnen Therapieschritte. ICON-Dry (Ethanol) wird<br />
zur weiteren Konditionierung und besseren Trocknung<br />
aufgetragen (Abb. 6) und nach 30 Sekunden mit Luft<br />
getrocknet. Jetzt sollte die OP-Lampe oder Brillenlampe<br />
ausgeschaltet werden. Danach wird der Folienapplikator<br />
gewechselt und ICON-Infiltrant appliziert<br />
(Abb. 7). Dieser penetriert während der nächsten drei<br />
Minuten in die Läsion. Entscheidend ist, dass überschüssiges<br />
Material aus der Folie austritt. Vor der Lichthärtung<br />
(40 Sekunden, Abb. 8) kann mit Luft, einem Scaler oder<br />
Zahnseide überschüssiger Kunststoff entfernt werden.<br />
Ein zweites Mal wird ICON-Infiltrant für weitere 60<br />
Sekunden aufgetragen (Abb. 9). Es empfiehlt sich, eine<br />
neue Folie zu verwenden. Vor und nach der Lichthärtung<br />
können Überschüsse entfernt werden (Abb. 10). Nach<br />
Entfernung des Kofferdams wird ein Fluoridlack (z. B.<br />
Duraphat) aufgetragen (Abb. 11). Dem Patienten wird<br />
abschließend eine geeignete Zwischenraumhygiene<br />
ICON-Etch. Applikation von ICON-Etch: Ein Folienapplikator<br />
wird mit der perforierten Seite zum zu behandelnden<br />
Zahn hin approximal adaptiert. Salzsäure wird aufgetragen<br />
(2 Minuten) (Abb. 5).<br />
Trocknung. Applikation von ICON-Dry (30 Sekunden):<br />
Durch das Vermischen mit Wasserresten und dem Ethanol<br />
kann die Läsion besser getrocknet werden (Abb. 6).<br />
ICON-Infiltrant. Applikation des ICON-Infiltranten: Ein Folienapplikator<br />
wird mit der perforierten Seite zum zu behandelnden<br />
Zahn hin approximal eingebracht. Der Infiltrant<br />
erreicht durch die Perforation die Zahnhartsubstanz (drei<br />
Minuten) (Abb. 7).<br />
Lichthärtung des Infiltranten (40 Sekunden) (Abb. 8).<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
30<br />
Fortbildung<br />
empfohlen. In der privaten Abrechnung kann die Gebührenposition<br />
2080a (gem. § 6 Abs. 1 GOZ) angewandt<br />
werden. In manchen Abrechnungsprogrammen können<br />
eigene Farben für spezielle Leistungen ausgewählt werden.<br />
Hier empfiehlt sich gerade für Mehrbehandlerpraxen<br />
die besondere Kennzeichnung der angewandten Infiltrationsmethode.<br />
Zweite Applikation des ICON-Infiltranten (60 Sekunden)<br />
(Abb. 9).<br />
Mikroinvasive Methode. Zahn 25 nach der Anwendung<br />
der Infiltrationsmethode: Eine okklusale Zugangskavität<br />
konnte durch die mikroinvasive Methode vermieden werden<br />
(Abb. 10).<br />
Fluoridgel. Applikation von Fluoridgel (Duraphat)<br />
(Abb. 11).<br />
Infiltrationspass für das Monitoring (Abb. 12).<br />
Nachsorge. Ein Kariesmonitoring sowohl visuell als<br />
auch röntgenologisch nach erfolgter Infiltration ist unerlässlich.<br />
Bissflügelaufnahmen, möglichst standardisiert,<br />
sollten regelmäßig angefertigt werden. Bei progredienter<br />
Karies trotz Infiltration oder Füllung muss dann entweder<br />
eine Füllung gelegt oder die Füllung ausgetauscht werden.<br />
Nach der Anwendung der Infiltrationsmethode kann<br />
bei diagnostizierter Progredienz auf dem Röntgenbild die<br />
Karies entfernt und anschließend eine Füllung gelegt werden.<br />
Jedem behandelten Patienten einen Infiltrationspass<br />
mitzugeben, ist sinnvoll (Abb. 12). Hier können die infiltrierten<br />
Zähne samt Läsionstiefe eingetragen werden. So<br />
ist die weitere Betreuung auch bei einem Behandlerwechsel<br />
gewährleistet.<br />
Klinische Untersuchungen. Verschiedene klinische<br />
Studien belegen die Wirksamkeit der Kariesinfiltration.<br />
Junge Erwachsene mit mittlerem Kariesrisiko wurden untersucht.<br />
Nur vier Prozent der infiltrierten Läsionen waren<br />
innerhalb von drei Jahren progredient. Bei der Kontrollgruppe,<br />
die nur lokal fluoridiert wurde, schritt die Karies<br />
in 42 Prozent der Läsionen weiter fort (Meyer-Lückel et<br />
al. 2012). In einer Population mit sehr hohem Kariesrisiko<br />
wurde an Milchzähnen radiologisch nachuntersucht. Hier<br />
lag die Progressionsrate von mittels Kariesinfiltration behandelten<br />
Zähnen bei 23 Prozent. Die Kontrollgruppe lag<br />
bei einem Wert von 62 Prozent (Ekstrand et al. 2010).<br />
Vorteile<br />
• Versiegelung der Kariesläsion<br />
• keine weitere Bakterienlast durch offene Läsionen<br />
• (noch) keine Füllung durch mikroinvasive Therapie<br />
• Schonung des Nachbarzahnes<br />
• Zahnsubstanzschonend: keine okklusale Zugangskavität<br />
bei approximaler Karies<br />
• „ohne Bohren“, ggf. ohne Anästhesie<br />
• ästhetische Lösung, Infiltration ist unsichtbar<br />
• Kein Lärm bei der Behandlung<br />
• neue Methode, Marketinginstrument<br />
• „Patientenbindung“ durch Infiltrationspass<br />
• 5-Jahres-Daten vorhanden<br />
• Therapiespektrum der Praxis wird erweitert<br />
Nachteile<br />
• Kontrollen notwendig<br />
• Privatleistung<br />
• Patient muss Compliance aufweisen<br />
• nur eingeschränkte Indikation – genaue Diagnostik<br />
erforderlich<br />
• Röntgenaufnahmen notwendig<br />
• Visuelle Kontrolle nicht möglich<br />
• anwendungssensibel, Lernkurve beim Behandler<br />
• Fortschreiten der Karies möglich<br />
ZBW 7/2016
Fortbildung 31<br />
• bei Behandlerwechsel ggf. andere Therapie notwendig<br />
• nur 5-Jahres-Daten vorhanden – klinische Langzeitergebnisse<br />
stehen noch aus<br />
• nur mit Kofferdam möglich (15 Prozent HCl)<br />
Die Kariesinfiltration schlägt die Brücke zwischen<br />
non-invasiver und restaurativer Therapie bei Approximalkaries.<br />
Statt frühem Zahnhartsubstanzverlust durch<br />
minimalinvasive Füllungstherapie ist es besser, den kariösen<br />
Prozess aufzuhalten: So kann der Therapiezyklus<br />
„kleine Füllung, große Füllung, Krone“ hinausgezögert<br />
werden. Zudem scheint die mikroinvasive Methode im<br />
Gegensatz zur invasiven Therapieoption die kosteneffizientere<br />
zu sein (Schwendicke et al. 2014).<br />
Zurzeit ist das Set zur Kariesinfiltration unter dem Handelsnamen<br />
„ICON“ nur bei der Firma DMG erhältlich.<br />
Das Literaturverzeichnis finden Sie unter www.zahnaerzteblatt.de<br />
oder kann beim IZZ bestellt werden unter<br />
Tel: 0711/222966-14, Fax: 0711/222966-21 oder E-<br />
Mail: info@zahnaerzteblatt.de.<br />
Dr. Anke Bräuning, M.A., M.Sc.<br />
Dr. A. Bräuning,<br />
M.A., M.Sc.<br />
Leitende Zahnärztin<br />
Parodontologie<br />
Akademie für Zahnärztliche<br />
Fortbildung Karlsruhe<br />
Läsionstiefe/<br />
Röntgenbefund<br />
E1<br />
E2<br />
D1<br />
Kavitation<br />
Therapie geringes<br />
Kariesrisiko<br />
Therapie hohes<br />
Kariesrisiko<br />
nein Fluoridierung Fluoridierung/Infiltration<br />
ja Fluoridierung Füllung<br />
nein Fluoridierung/Infiltration Infiltration<br />
ja Füllung Füllung<br />
nein Infiltration Infiltration/Füllung<br />
ja Füllung Füllung<br />
D2 ja Füllung Füllung<br />
D3 ja Füllung/Restauration Füllung/Restauration<br />
Approximalraumkaries. Alternativen bei der Therapie von Approximalraumkaries in Abhängigkeit von der Tiefe des kariösen Defekts.<br />
Anzeige<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
32<br />
Kommunikation<br />
Breites Medienecho<br />
Zahnärzteschaft als kompetenter Medienpartner<br />
Zahnärztliche und zahnmedizinische Themen sind ein wichtiger Bestandteil<br />
der medialen Berichterstattung, auch in unserem Bundesland.<br />
Im Jahr 2015 erreichte die Berichterstattung über zahnmedizinische<br />
Themen in baden-württembergischen Tageszeitungen eine Gesamtreichweite<br />
von 78.026.462 Exemplaren und noch deutlich mehr Lesern<br />
pro Exemplar.<br />
Betrachtet man die Medien (Presse,<br />
Hörfunk, Fernsehen, Internet)<br />
in Baden-Württemberg, zeigt sich<br />
deutlich: Gesundheitsthemen kommen<br />
immer an. Was in der Gesundheitspolitik<br />
und der Zahnmedizin<br />
im Fokus steht, überprüft täglich<br />
ein sogenannter Clippingdienst.<br />
Diese Agentur rezipiert alle Medien<br />
im Bundesland und sammelt<br />
Berichterstattungen über zahnmedizinischen<br />
Themen. Die Resonanz<br />
ist ein deutliches Zeichen:<br />
Allein im Januar und Februar dieses<br />
Jahres erreichten zahnmedizinische<br />
Beiträge in mehr als 560<br />
Ausgaben 17.912.544 Millionen<br />
Leser im Bundesland. Einschließlich<br />
März lag die Zahl der veröffentlichten<br />
Berichte bei 169, die<br />
jeweils in mehreren Zeitungen<br />
erschienen. Etwa in der Südwest<br />
Presse unter dem Titel „Gesund<br />
im Mund“, in den Stuttgarter<br />
Nachrichten unter dem Titel<br />
„Was tun bei empfindlichen<br />
Zähnen und Zahnfleisch?“<br />
oder in der Oberbadischen<br />
Zeitung unter der Überschrift<br />
„Zahnersatz aus<br />
Keramik“ – der Service für die Leser<br />
steht im Vordergrund. Im ersten<br />
Quartal summierten sich die Berichte<br />
über zahnmedizinische Themen<br />
in den Tageszeitungen Baden-<br />
Württembergs auf im Schnitt zwölf<br />
Zeitungsartikel pro Woche, die die<br />
gute Arbeit der Zahnärzteschaft beleuchteten.<br />
Die Themen sind vielfältig. Die<br />
Tageszeitungen berichten sehr informativ<br />
und in breiter Form über<br />
zahnmedizinische Themen wie<br />
Zahnerhaltung, insbesondere Prävention,<br />
die Bonusregelung, Prophylaxe,<br />
Wurzelbehandlung, Zahnersatz,<br />
Zahnzusatzversicherungen,<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Kommunikation 33<br />
Zahngesundheit aber auch Themenfelder<br />
wie Soziales Engagement,<br />
Flüchtlinge und viele weitere<br />
Themen.<br />
Zahnärzteschaft informiert.<br />
Das Informationszentrum Zahngesundheit<br />
(IZZ) bietet den<br />
Medien in<br />
Baden-Württemberg regelmäßig<br />
ein „Thema des Monats“<br />
zu zahnmedizinischen Aspekten.<br />
Die Clippinganalyse im<br />
ersten Quartal 2016 zeigt, dass<br />
Tageszeitungen gerne über Servicethemen<br />
berichten, die die<br />
Leserinnen und Leser auf Behandlungsmöglichkeiten<br />
aufmerksam<br />
machen und ihnen bei<br />
interessanten Fragestellungen<br />
viele Infos bieten. Diesen Servicegedanken<br />
greifen auch die<br />
Telefonaktionen auf, die das<br />
IZZ in Zusammenarbeit mit den<br />
Tageszeitungen zehnmal pro<br />
Jahr durchführt. Dabei stehen<br />
Zahnärztinnen und Zahnärzten<br />
den anrufenden Leserinnen und<br />
Lesern Rede und Antwort, worüber<br />
die Tageszeitungen im Anschluss<br />
ausführlich berichten.<br />
Darüber hinaus verschickt das<br />
IZZ Pressemitteilungen mit berufspolitischem<br />
Charakter, die<br />
die Medien auf wichtige Entwicklungen<br />
in der Standespolitik<br />
hinweisen.<br />
Wenn es um Beiträge über<br />
zahnmedizinische Themen im<br />
ersten Quartal des Jahres ging,<br />
setzten sich die Medien konkret<br />
mit unterschiedlichen Berichten<br />
auseinander und gingen<br />
dabei anhand konkreter Beispiele<br />
oft in die Tiefe.<br />
Positive Berichte. Von einem<br />
großen Andrang bei der Veranstaltung<br />
„Medizin am<br />
Abend“ zum Thema<br />
Zahngesundheit mit<br />
Prof. Dr. Dr. Hans Jörg<br />
Staehle berichtete Birgit<br />
Sommer in der Rhein-<br />
Neckar-Zeitung am<br />
22. Januar 2016. Den<br />
Infoabend beschreibt<br />
sie als „Veranstaltung,<br />
bei der sich die Zuhörer für<br />
umfangreiche Informationen<br />
vom Experten und für dessen<br />
handfeste Gesundheitstipps<br />
begeisterten.“ Am 19. April<br />
2016 erschien in den Stuttgarter<br />
Nachrichten und den Partnerzeitungen<br />
ein Interview mit<br />
Prof. Dr. Johannes Einwag. Der<br />
Direktor des Zahnmedizinischen<br />
Fortbildungszentrums (ZFZ)<br />
räumte darin mit Mythen übers<br />
Zähneputzen auf und gab Hinweise<br />
zum richtigen Umgang mit der<br />
Zahnbürste. Die Südwest Presse<br />
aus Ulm erläuterte in ihrem Beitrag<br />
von Marie-Louise Abele am<br />
5. Januar 2016, wie wichtig regelmäßige<br />
Vorsorge und gesunde<br />
Ernährung sind. Der Artikel „Prophylaxe<br />
statt Bohrer“ bringt den<br />
Leserinnen und Lesern der Zeitung<br />
die Wichtigkeit und nicht zuletzt<br />
den Nutzen der Prophylaxe näher<br />
und beleuchtet, welche weitreichenden<br />
Konsequenzen schlechte<br />
Zahngesundheit außerdem haben<br />
kann. Am 18. Februar 2016 berichtete<br />
Karin Willen in der Eßlinger<br />
Zeitung darüber, wie wichtig eine<br />
regelmäßige Professionelle Zahnreinigung<br />
(PZR) ist. Unter der<br />
Überschrift „Regelmäßig Experten<br />
putzen lassen“ mahnt sie allerdings<br />
auch, neben der PZR nicht auf das<br />
tägliche Zähneputzen zu verzichten.<br />
Daneben erklärt sie, wie genau<br />
eine PZR abläuft, für wen sie sich<br />
empfiehlt und welche Kosten dabei<br />
für Patientinnen und Patienten entstehen.<br />
Dabei hat sie auch konkrete<br />
Tipps parat: „Rauchen ist einer der<br />
Hauptrisikofaktoren für Parodontitis“,<br />
schreibt sie in ihrem Beitrag,<br />
und: „Eine ungünstige Bakterienzusammensetzung<br />
im Mund oder<br />
ein geringer Speichelfluss führen<br />
schneller zu Zahnbelägen.“ Die Leserinnen<br />
und Leser der Zeitung soll<br />
das sensibilisieren.<br />
Zahnpflege im Alter. Ein wichtiges<br />
Thema ist auch in den Medien<br />
Baden-Württembergs der demografische<br />
Wandel. Die Badische Zeitung<br />
hat sich diesem Thema angenommen<br />
und am 24. Februar 2016<br />
über Zahnpflege im Alter berichtet.<br />
Als Experte zitiert die Zeitung den<br />
„Landesbeauftragten bei der Deutschen<br />
Gesellschaft für Alterszahnmedizin“,<br />
Dr. Elmar Ludwig. Er<br />
informiert die Leserinnen und Leser<br />
der Zeitung, wie Zahn- und Zahnfleischerkrankungen<br />
entstehen und<br />
wie man sich auch im Alter noch<br />
davor schützen kann. „Bei guter<br />
Mundhygiene und Unterstützung<br />
durch den Zahnarzt lassen sich<br />
Zähne bis ins hohe Alter erhalten“,<br />
erläutert Dr. Ludwig in der Zeitung.<br />
Die Zahnpflege im Alter war bereits<br />
in einem IZZ-Presseforum ein<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
34<br />
Kommunikation<br />
großes Thema, das in Folge der<br />
gesteigerten Aufmerksamkeit<br />
schließlich ein umfangreicher<br />
Fernsehbeitrag der SWR-Sendung<br />
„odysso“ aufgegriffen hat.<br />
Soziales Engagement. In<br />
neuester Zeit nimmt die Berichterstattung<br />
über Flüchtlinge immer<br />
größeren Raum auch in den Medien<br />
Baden-Württembergs ein. Die<br />
Tageszeitungen beleuchten dabei<br />
u. a. die neuen Aufgaben, die auf<br />
Zahnärztinnen und Zahnärzte zukommen<br />
und berichteten über ihr<br />
Engagement. Christoph Holbein<br />
schrieb am 27. Februar 2016 im<br />
Schwarzwälder Boten in seiner<br />
Reportage „Blick in Löcher und<br />
Wurzelkanäle“ über die zahnärztliche<br />
Arbeit in der Landeserstaufnahmeeinrichtung<br />
in Meßstetten.<br />
Seit Oktober 2015 gibt es dort<br />
eine zahnärztliche Betreuung für<br />
Flüchtlinge.<br />
Land der Medien. Baden-Württemberg<br />
ist ein Land der Medien.<br />
17 große Regionalzeitungen berichten<br />
täglich, wie anhand der<br />
Beispiele dargelegt, über die zahnärztlichen<br />
und zahnmedizinischen<br />
Themen, die das Bundesland bewegen.<br />
Hinzu kommen 50 Lokalzeitungen,<br />
die mit einigen der Regionalzeitungen<br />
als Partnerzeitung<br />
eng verbunden sind. Das bedeutet:<br />
Berichte, die im überregionalen<br />
Teil beispielsweise der Stuttgarter<br />
Nachrichten erscheinen, sind oft<br />
auch für Leser in den umliegenden<br />
Kreisen verfügbar. Etwa in der Sindelfinger<br />
Zeitung, der Waiblinger<br />
Kreiszeitung oder dem Herrenberger<br />
Gäubote.<br />
Im audiovisuellen Bereich verfügt<br />
Baden-Württemberg über<br />
18 private Hörfunkprogramme,<br />
23 private Regionalfernsehsender<br />
und zusätzlich die öffentlichrechtlichen<br />
Programme des SWR.<br />
Ihre Informationen bekommen die<br />
Zeitungen durch eigene Recherchen<br />
oder Presseagenturen, etwa<br />
die Deutsche Presseagentur (dpa).<br />
In Baden-Württtemberg hat diese<br />
Agentur einen eigenen Landesdienst,<br />
den Landesdienst Südwest<br />
(lsw).<br />
» christian.ignatzi@izz-online.de<br />
Die Medien in Baden-Württemberg<br />
berichten zuverlässig und in einem<br />
großen Spektrum regelmäßig<br />
über zahnmedizinische Themen.<br />
Seien es Beiträge, die die Praxis<br />
der Zahnmedizin behandeln, seien<br />
es Berichte über soziales Engagement<br />
oder Berichte, die Leserinnen<br />
und Lesern Tipps geben, wie sie<br />
im alltäglichen Leben auf die Gesundheit<br />
ihrer Zähne achtgeben<br />
können. Das große Spektrum der<br />
Berichterstattung zeigt deutlich:<br />
Die Themen der<br />
Zahnmedizin stoßen<br />
auf ein breites<br />
Interesse in<br />
der Gesellschaft.<br />
In beeindruckender<br />
Manier findet<br />
Kommentar<br />
die Zahnärzteschaft<br />
Baden-Württemberg damit<br />
ein breites öffentliches Forum. Zeitungen,<br />
Fernseh- und Radiosender<br />
verknüpfen das Thema Gesundheit<br />
mit dem Zahnarzt. Die Reichweite<br />
erhöht sich zudem durch die Online-Angebote<br />
der Medien. Laut Angaben<br />
des Bundesverbands Deutscher<br />
Zeitungsverleger (BDZV) besuchen<br />
inzwischen 30,9 Millionen<br />
Besuchder im Alter von mehr als<br />
14 Jahren (43,9 Prozent) die Angebote<br />
der Zeitungen im Internet.<br />
Mehr als 9,6 Millionen mobile Nutzer<br />
informieren sich demnach per<br />
Smartphone oder Tablet-App über<br />
Im Fokus<br />
der Medien<br />
Collagen: IZZ<br />
das Tagesgeschehen. Die Verknüpfung<br />
der Begriffe „Gesundheit“<br />
und „Zahnarzt“ dient im besonderen<br />
Maße dem Image des Berufsstands.<br />
Die Medien wissen um die<br />
Wichtigkeit der Zahnärztinnen und<br />
Zahnärzte – und sie nutzen das<br />
für gegenseitige Synergieeffekte.<br />
Seit Jahren fragen Medien bei der<br />
Zahnärzteschaft regelmäßig nach<br />
interessanten Themen zur Veröffentlichung.<br />
Immer wieder nutzen<br />
sie die Möglichkeit, Telefonaktionen<br />
mit Experten<br />
aus der Zahnärzteschaft<br />
durchzuführen<br />
und ihren<br />
Leserinnen und<br />
Lesern damit einen<br />
gern genutzten<br />
Service zu bieten.<br />
Der große Erfolg der Telefonaktionen<br />
zeigt: Es herrscht großer<br />
Bedarf in der Gesellschaft auch an<br />
Dialogmöglichkeiten über die Medien.<br />
Das, und das positive Bild,<br />
das die Journalisten über alle Regierungsbezirke<br />
hinweg zeichnen,<br />
sorgt dafür, dass dieses positive<br />
Bild des Zahnarztes im Gespräch<br />
ist: am Arbeitsplatz, in der Politik<br />
und nicht zuletzt am Stammtisch.<br />
Letztendlich dient diese Breitenwirkung<br />
bis in den kleinsten Winkel<br />
der Gesellschaft jedem einzelnen<br />
Zahnarzt in Baden-Württemberg.<br />
Christian Ignatzi<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Kommunikation 35<br />
Anzahl der Veröffentlichungen über Zahnmedizinische Themen in den Tageszeitungen im Jahr 2015<br />
Zeitungen<br />
Pforzheimer Zeitung<br />
Mannheimer Morgen<br />
Stuttgarter Zeitung<br />
28<br />
56<br />
67<br />
Ludwigsburger Kreiszeitung<br />
Südkurier<br />
Badische Neuste Nachrichten<br />
Heilbronner Stimme<br />
Südwest Presse<br />
Badisches Tagblatt<br />
67<br />
81<br />
93<br />
96<br />
102<br />
114<br />
Schwarzwälder Bote<br />
Stuttgarter Nachrichten<br />
157<br />
170<br />
Rhein Neckar Zeitung<br />
Badische Zeitung<br />
289<br />
Anzahl<br />
Schwäbische Zeitung<br />
338<br />
der Artikel<br />
100 200 300 400<br />
Auf der Internetseite der jeweiligen Zeitung finden Sie Informationen über alle Partnerzeitungen<br />
Große Resonanz. Im Jahr 2015 veröffentlichte die Schwäbische Zeitung die meisten Artikel über zahnmedizinische Themen in Baden-<br />
Württemberg. Die Zahl umfasst Artikel, die in mehreren Lokalausgaben (siehe unten am Beispiel der „Stuttgarter Nachrichten“) erschienen<br />
sind. Im Falle der Schwäbischen Zeitung sind 17 Regionalausgaben beteiligt, bei der Badischen Zeitung sind es 19. Die Partnerzeitungen,<br />
die den sogenannten Mantel, den überregionalen Teil erhalten, sind in der Grafik nicht berücksichtigt, etwa die Fränkischen<br />
Nachrichten im Falle des Mannheimer Morgens. Insgesamt erreichten zahnmedizinische Themen so im Vorjahr 78.026.462 Leser.<br />
Mantel-Strukturen am Beispiel der Stuttgarter Nachrichten<br />
197<br />
Drei eigene Lokalausgaben<br />
Überregionale Inhalte in folgenden Regionalzeitungen<br />
Backnanger Kreiszeitung, Gäubote, Heidenheimer Neue Presse, Mühlacker Tagblatt,<br />
Murrhardter Zeitung, Nürtinger Zeitung/Wendlinger Zeitung, Rems-Zeitung,<br />
Sindelfinger Zeitung/Böblinger Zeitung, Kreiszeitung Böblinger Bote,<br />
Vaihinger Kreiszeitung, Waiblinger Kreiszeitung/Schorndorfer Nachrichten/<br />
Welzheimer Zeitung/Winnender Zeitung, Schwarzwälder Bote, Frankenpost,<br />
Neue Presse, Freies Wort und Südthüringer Zeitung<br />
Kooperationen. Das Beispiel der „Stuttgarter Nachrichten“ zeigt, wie viele Tageszeitungen in Baden-Württemberg aufgebaut sind: Der<br />
Haupttitel hat eigene Lokalausgaben und liefert außerdem den „Mantel“, also die überregionalen Seiten an lokale Partner. Zudem kooperieren<br />
einige Medien mit weiteren Verlagen. Artikel der „Stuttgarter Nachrichten“ erscheinen etwa auch oft im „Schwarzwälder Boten“.<br />
Grafiken : IZZ/Stuttgarter Nachrichten<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
36<br />
Kommunikation<br />
Forum Zahngesundheit – Drehscheibe der Information und Kommunikation<br />
Zahnärzteschaft zeigt Präsenz<br />
Das Forum Zahngesundheit war in diesem Jahr bereits auf sechs<br />
Verbrauchermessen präsent. Ob im Januar in Ludwigsburg auf den<br />
Gesundheitstagen „gesund und aktiv“ der Ludwigsburger Kreiszeitung,<br />
im Februar in Göppingen auf der Vitawell der Göppinger Kreisnachrichten,<br />
in Crailsheim auf der Vitawell der Hohenloher Zeitung Anfang<br />
März, auf der IBO in Friedrichshafen Mitte März, auf dem Mannheimer<br />
Maimarkt bis 10. Mai 2016 oder auf der Südwest Messe in Villingen-<br />
Schwenningen Ende Mai 2016. Und das Interesse war überall groß.<br />
Die Zahnärztinnen und Zahnärzte<br />
Baden-Württembergs sind bei<br />
Verbrauchermessen stets gesuchte<br />
Ansprechpartner rund um die<br />
Zahn- und Mundgesundheit. Gerade<br />
Themen wie Füllungsmaterialien<br />
aus Gold, Keramik oder<br />
Komposit, Zahnersatz, Implantate,<br />
Professionelle Zahnreinigung oder<br />
Bleaching beschäftigen die Besucher.<br />
Im Forum Zahngesundheit erhalten<br />
sie dann Antworten auf ihre<br />
Fragen, denn alle Beteiligten sind<br />
mit Freude und Kompetenz dabei.<br />
Der gesamte Aufbau ist so konzipert,<br />
dass der Besuch zum Erlebnis<br />
wird. Dabei stellen vier Leitfarben<br />
die vier Säulen der Zahngesundheit<br />
vor. Sie sind Teil des Corporate Designs<br />
für den gesamten Auftritt. Die<br />
rote Farbe markiert den Bereich der<br />
Mundhygiene mit der Plaque-Neon-Schau<br />
und dem Zahnputzbrunnen.<br />
Gelb symbolisiert den zahnärztlichen<br />
Beratungsbereich mit der<br />
sehr attraktiven Behandlungseinheit<br />
der Firma KAVO Biberach, die<br />
mit modernster Technik ausgerüstet<br />
ist. Blau steht für die Fluoridierung.<br />
In grüner Farbe wird der Bereich<br />
der Ernährung dargestellt. Die Momentaufnahmen<br />
von den vergangenen<br />
Verbrauchenmessen dieses<br />
Jahres spiegeln hier die vielfältigen<br />
Facetten des Forum Zahngesundheit<br />
wider.<br />
» claudia.richter@izz-online.de<br />
Info<br />
Im Jahresverlauf wird das Forum<br />
Zahngesundheit auf folgenden<br />
Verbrauchermessen präsent sein:<br />
• Baden Messe in Freiburg<br />
10. bis 18. September 2016<br />
• Allmendinger Gesundheitstage,<br />
eine Veranstaltung der<br />
Südwest-Presse<br />
22. und 23. Oktober 2016<br />
• Offerta in Karlsruhe<br />
29. Oktober bis 6. November<br />
2016<br />
• Familie & Heim in Stuttgart<br />
12. bis 20. November 2016<br />
Publikumsmagnet. Hell und freundlich begrüßt das Forum Zahngesundheit die Besucherinnen und Besucher bei Verbrauchermessen<br />
(hier beim Mannheimer Maimarkt).<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Kommunikation 37<br />
Zahnärztliche Beratung. Bei der Vitawell in Crailsheim waren Dr. Karin Langsch und ZA Dieter Bäuerlein gesuchte Ansprechpartner<br />
(links) und bei den Gesundheitstagen „gesund und aktiv“ in Ludwigsburg stand Dr. Edith Nadj-Papp Rede und Antwort (rechts).<br />
Richtige Mundhygiene. Wichtige Elemente im Forum Zahngesundheit sind der Zahnputzbrunnen und die Plaque-Neon-Schau, wie<br />
z. B. auf der Südwest Messe in Villingen-Schwenningen. Hier können Interessierte ihr Zahnputzverhalten auf den Prüfstand stellen.<br />
Sehen und Staunen. Ob mit der intraoralen Kamera oder mittels Schaukästen: Überall im Forum wird anschaulich dargestellt,<br />
worauf es bei der Mund- und Zahngesundheit ankommt (links: Dr. Klaus Baumann, Südwest Messe, rechts: Vitawell in Crailsheim).<br />
Fotos: Kleinbach (4), Potente (3)<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
38<br />
Kommunikation<br />
Wann sind Zahnveneers sinnvoll?<br />
ZDF-Filmaufnahmen im ZFZ Stuttgart<br />
„Volle Kanne“ heißt eine Sendung mit Servicethemen, die von<br />
Montag bis Freitag am Vormittag von 9:05 Uhr an im ZDF läuft. In<br />
der Sendung am 4. Juli geht es um Zahnveneers. Die Aufnahmen<br />
für diese Sendung fanden am 3. Juni im ZFZ Stuttgart statt. In<br />
den Hauptrollen: Dr. Konrad Bühler, Vorsitzender der Zahnmedizinischen<br />
Patientenberatungsstelle Baden-Württemberg, als TV-<br />
Zahnarzt und als seine TV-Assistentin Rosa Rubinaccio, ZFA im ZFZ<br />
Stuttgart. Und natürlich drei Patientinnen, die aus unterschiedlichen<br />
Gründen Zahnveneers erhalten haben.<br />
Behandlungserfolg. Die Patientin freut sich über den Behandlungserfolg.<br />
„Ich bin keine klassische Medizinjournalistin“,<br />
sagt die Filmemacherin<br />
Andrea Schuler über<br />
sich und ihre Arbeit, „ich mache<br />
am liebsten Filme zu sozialpolitischen<br />
Themen“. Einen Bericht<br />
über Geschlechtskrankheiten habe<br />
sie kürzlich gemacht, berichtet die<br />
Filmemacherin weiter über ihren<br />
letzten Film-Ausflug in die Medizin.<br />
„Ich erinnere mich noch gut an<br />
die interessante Begegnung mit einem<br />
Professor und die faszinierenden<br />
Aufnahmen der Chlamydien-<br />
Infektionen am Mikroskop“. Beim<br />
Thema Zähne hat sich Andrea<br />
Schuler gedacht, „das ist nicht so<br />
heikel wie Geschlechtskrankheiten,<br />
bildlich zwar sicher nicht so<br />
spannend, aber als Servicethema<br />
passt es perfekt“. Der eigentliche<br />
Aufhänger für die Filmproduktion<br />
war dann aber ein Beitrag in der<br />
FAZ, in dem die Vor- und Nachteile<br />
von Verblendschalen unter die<br />
Lupe genommen wurden. Auch der<br />
Vizepräsident der BZÄK, Prof. Dr.<br />
Dietmar Oesterreich, kam in diesem<br />
Beitrag zu Wort und warnte<br />
vor einem „Schnellschuss“ bei der<br />
Entscheidung für Zahnveneers.<br />
Ästhetik. Daraufhin hat sich<br />
Andrea Schuler auf den Themenvorschlag<br />
„Wann sind Zahnveneers<br />
sinnvoll?“ der Ulmedia Medienproduktions-GmbH<br />
in Ulm<br />
gemeldet, die für die Sendung<br />
„Volle Kanne“, die von Montag<br />
bis Freitag im ZDF ausgestrahlt<br />
Foto: Mader<br />
wird, einen Servicebeitrag produziert.<br />
Am Thema „Zahnveneers“<br />
reizte die langjährige Filmemacherin,<br />
dass im öffentlichen Bewusstsein<br />
bei Veneers vor allem<br />
ästhetische Aspekte im Vordergrund<br />
stehen, tatsächlich aber viele<br />
medizinische Indikationen für die<br />
Verblendschalen aus Keramik sprechen.<br />
„Daraus etwas zu machen,<br />
finde ich eine spannende Sache!“<br />
Drehtermin im ZFZ. Und es<br />
wurde in der Tat eine spannende<br />
Geschichte, die Andrea Schuler<br />
mit ihrem Team von Ulmedia nun<br />
am 3. Juni im ZFZ Stuttgart mit<br />
TV-Zahnarzt Dr. Konrad Bühler<br />
und seiner TV-Assistentin Rosa<br />
Rubinaccio gedreht hat.<br />
„Gschwind“ und „auf die Schnelle“<br />
aus rein ästhetischen Gründen,<br />
davor warnte auch TV-Zahnarzt<br />
Dr. Bühler im Interview und hob den<br />
minimalen Substanzabtrag bei Veneers<br />
hervor, die auch zum Lückenschluss<br />
oder bei rauen Zahnoberflächen<br />
medizinisch indiziert sein<br />
können. Im Filmbeitrag werden die<br />
Fälle dreier Patientinnen beleuchtet,<br />
die Zahnveneers erhalten haben: Für<br />
einen abgeschlagenen Zahn im Kindesalter,<br />
der zunächst mit Kunststoff<br />
aufgebaut wurde, sich aber immer<br />
wieder verfärbte und schließlich<br />
mit einem Veneer der ersten Generation<br />
versorgt wurde. Eine andere<br />
Patientin erhielt Veneers für die Versorgung<br />
ihrer Zapfenzähne und eine<br />
weitere Patientin entschied sich für<br />
Veneers aufgrund ihrer tiefgehenden<br />
Dentinverfärbungen und der Abrasionen.<br />
» mader@lzk-bw.de<br />
Info<br />
Der Beitrag wird voraussichtlich<br />
am 4. Juli 2016 in der ZDF-Sendung<br />
„Volle Kanne“ von 9:05<br />
Uhr an ausgestrahlt und ist danach<br />
noch ein Jahr in der Mediathek<br />
des ZDF zu sehen.<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Regionen<br />
39<br />
In der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe<br />
Oberbürgermeister Frank Mentrup zu Gast<br />
Zahnärztliche Fortbildung hat in Karlsruhe eine lange Tradition und<br />
ein beachtliches Innovationspotenzial. Davon konnte sich Oberbürgermeister<br />
Dr. Frank Mentrup einen sehr lebendigen Eindruck verschaffen,<br />
als er am 7. Juni die Akademie für Zahnärztliche Fortbildung<br />
kennenlernte. Der stellvertretende Präsident der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg, Dr. Bernhard Jäger, und der Direktor,<br />
Prof. Dr. Winfried Walther, empfingen den Gast in den Räumen der<br />
neugestalteten Akademie.<br />
Neue Akademie. Dr. Andreas Bartols, M.A., Dr. Anke Bräuning, M.A., M.Sc., ZTM<br />
Berthold Steiner, Frank Stöckel, Prof. Dr. Winfried Walther, Dr. med. Frank Mentrup, Dr.<br />
Bernhard Jäger, Dr. Michael Korsch, M.A., Dipl.-Ing. Rainer Benz (v. l.):<br />
Natürlich war dem Oberbürgermeister<br />
die Akademie durch den<br />
Karlsruher Vortrag schon vorher<br />
ein Begriff, aber die neuen Räumlichkeiten<br />
der Akademie kannte er<br />
bisher noch nicht<br />
Langjährige Tradition. Als berufliche<br />
Bildungseinrichtung hat<br />
die Institution eine fast 100-jährige<br />
Geschichte, denn sie geht auf das<br />
„Dentistische Ausbildungsinstitut“<br />
zurück, das im Jahr 1920 gegründet<br />
wurde. Erst 1960 wurde sie<br />
Teil der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg, die durch<br />
sie und das ZFZ in Stuttgart ihren<br />
gesetzlichen Fortbildungsauftrag<br />
erfüllt.<br />
Seit 1920 ist sehr viel passiert<br />
in der Zahnmedizin und nirgendwo<br />
wird das deutlicher als in den<br />
hellen und freundlichen Räumen<br />
für Fortbildungsteilnehmer und<br />
Patienten, die in der Lorenzstraße<br />
entstanden sind. Ein Rundgang<br />
orientierte den Oberbürgermeister<br />
über die Aufgaben und die<br />
Leistungsfähigkeit der Akademie.<br />
Er freute sich über die großzügig<br />
gestalteten Hörsäle und die anderen<br />
Optionen, im neuen Haus der<br />
Akademie Unterricht zu gestalten.<br />
So ist ihre Poliklinik eine „Lernklinik“.<br />
Die hier stattfindende Versorgung<br />
der Patienten kommt der<br />
Fortbildung zugute. Die klinischen<br />
Einrichtungen werden im Rahmen<br />
des Kursbetriebes zu Lernzwecken<br />
eingesetzt.<br />
Fortbildung für Zahnärztinnen,<br />
Zahnärzte und das ganze<br />
Foto: Akademie Karlsruhe<br />
Praxisteam ist laut Statut die Hauptaufgabe<br />
der Akademie. Sie arbeitet<br />
kontinuierlich an neuen Methoden<br />
und Lernformaten, um dieser Funktion<br />
gerecht zu werden. Das Spektrum<br />
der Themen ist in den letzten<br />
Jahren stark erweitert worden. Ihr<br />
Ziel ist praxisnahe Fortbildung, die<br />
das ganze Team dabei unterstützt,<br />
Routinen zu verbessern, Innovationen<br />
einzuführen und die organisatorischen<br />
Voraussetzungen für eine<br />
bessere Versorgung zu schaffen.<br />
Dabei sollte das „Neue“ nicht ungeprüft<br />
zur Anwendung kommen.<br />
Wissenschaft im Fokus. Ein<br />
weiterer Schwerpunkt der Akademie<br />
ist deswegen die zahnärztliche<br />
Wissenschaft. Die leitenden<br />
Zahnärzte, Dr. Anke Bräuning, Dr.<br />
Andreas Bartols und Dr. Michael<br />
Korsch, berichteten dem Oberbürgermeister<br />
aus ihrer Tätigkeit. Der<br />
Schwerpunkt ihrer Studien liegt<br />
in der klinischen Forschung sowie<br />
in der Versorgungsforschung.<br />
Die Akademie hat in den letzten<br />
Jahren ihre wissenschaftliche Tätigkeit<br />
verstärkt und international<br />
publiziert. Die guten internationalen<br />
Kontakte kommen in diesem<br />
Jahr wieder beim 6. Internationalen<br />
Workshop für Junge Prothetische<br />
Lehrer zum Tragen, der im<br />
Oktober stattfinden wird. Erwartet<br />
werden Prothetiker aus allen<br />
Kontinenten. Dr. Mentrup nahm<br />
die Einladung an, ein Grußwort<br />
zu sprechen. Bei einigen kleineren<br />
Anliegen der Akademie, wie einer<br />
besseren Ausweisung durch öffentliche<br />
Schilder, sagte er seine Unterstützung<br />
zu.<br />
Oberbürgermeister Dr. Mentrup<br />
fühlte sich sichtlich wohl bei seinen<br />
zahnmedizinischen Kolleginnen<br />
und Kollegen. Er freute sich,<br />
einen direkten Eindruck von dieser<br />
zahnärztlichen Institution zu gewinnen,<br />
die für den Bildungs- und<br />
Wissenschaftsstandort Karlsruhe<br />
in Zukunft eine immer wichtigere<br />
Rolle spielen wird.<br />
Prof. Dr. Winfried Walther<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
40<br />
Regionen<br />
TuTZiG Tagen und Treffen, Zahnärzt/innen im Gespräch<br />
Notfall ist ein heißes Eisen<br />
TuTZiG ist ein Qualitätszirkel im Landkreis Tuttlingen, der seit fast<br />
zwanzig Jahren besteht und sich um fachliche Weiterbildung im<br />
Rahmen zahnärztlicher Kollegialität bemüht. Die Fortbildung aus der<br />
Gruppe heraus durch mehrmalige Treffen im Jahr ist die eine Aufgabe,<br />
eine Einladung für die gesamte Kollegenschaft in der Region zu einer<br />
Fortbildung mit Referenten aus Wissenschaft und Politik die andere.<br />
Umfrage. Die selbstbestimmte interkollegiale Fortbildung in Form von Qualitätszirkeln<br />
erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.<br />
„Der Akute Zahnmedizinische<br />
Notfall“ war das diesjährige Thema.<br />
Die Referenten Knuth Wolf,<br />
Direktor und Leiter der Hauptverwaltung<br />
der KZV BW und OA Dr.<br />
Andreas Bartols von der Akademie<br />
für Zahnärztliche Fortbildung<br />
in Karlsruhe waren gebeten seitens<br />
der Selbstverwaltung und der Versorgungswissenschaft<br />
Stellung zu<br />
nehmen. Die exakte Abgrenzung<br />
zwischen sofort erforderlicher Behandlungsnotwendigkeit<br />
und aufschiebbaren<br />
Maßnahmen ist nicht<br />
immer möglich. Bedingt durch<br />
die bestehende Flüchtlingssituation<br />
tangiert der „akute zahnmedizinische<br />
Notfall“ die Praxen vor<br />
Ort verstärkt. Nicht das politische<br />
Hinterfragen stand im Vordergrund<br />
der Veranstaltung, sondern<br />
vielmehr eine Richtschnur für die<br />
therapeutischen <strong>Möglichkeiten</strong> zu<br />
erörtern.<br />
Knuth Wolf stellte das Asylbewerberleistungsgesetz<br />
aus dem<br />
SGB XII dar und dessen Konsequenzen<br />
für die Behandlung: Asylbewerber<br />
in den ersten 15 Monaten<br />
des Aufenthaltes in Deutschland<br />
haben Leistungsanspruch nach §<br />
4 AsylbLG, d. h. die Behandlung<br />
ist unaufschiebbar und beschränkt<br />
sich dann auf die Beseitigung akuter<br />
Erkrankungen und Schmerzzustände.<br />
Im Bereich der zahnmedizinischen<br />
Versorgung sind dies die<br />
KCH-Behandlungen nach BEMA<br />
Teil 1 und die KBR-Behandlungen<br />
nach BEMA Teil 2. Eine KFO Therapie<br />
nach BEMA Teil 3 oder eine<br />
Zahnersatztherapie nach BEMA<br />
Teil 5 ist grundsätzlich eine Einzelfallentscheidung<br />
unter der Voraussetzung<br />
der vorherigen Genehmigung<br />
des Kostenträgers.<br />
Für Asylbewerber, die sich länger<br />
als 15 Monate in Deutschland<br />
Fotos: Fotolia<br />
aufhalten, gilt der § 2 AsylbLG.<br />
Sie haben den gleichen Leistungsanspruch<br />
wie Sozialhilfeempfänger<br />
als GKV-Versicherte.<br />
Unbegleitet minderjährige<br />
Flüchtlinge bilden einen Sonderfall.<br />
Sie unterstehen der Obhut des<br />
Jugendamtes und haben Anspruch<br />
auf Leistungen der Jugendhilfe<br />
nach dem SGB VIII.<br />
Nach den Erklärungen zum Umgang<br />
mit dem Behandlungsausweis,<br />
ging Wolf auch noch auf die<br />
Behandlungspflicht entsprechend<br />
der Berufsordnung und der Aufklärungspflicht<br />
gemäß dem Patientenrechtegesetz<br />
ein. Bestehende<br />
Kommunikationsschwierigkeiten<br />
entbinden nie von der Aufklärungspflicht,<br />
und die dafür angewandten<br />
Methoden – Übersetzer,<br />
Piktogramme – sind unbedingt zu<br />
dokumentieren.<br />
Die abschließenden Fragen zu<br />
dem Block wurden von Knuth<br />
Wolf und dem ebenfalls eingeladenen<br />
Vorsitzenden der KZV BW BD<br />
Freiburg, Dr. Hans-Hugo Wilms<br />
ergänzend beantwortet. Es blieben<br />
keine Fragen offen. Zusammenfassend<br />
ergab sich daraus das Resümee:<br />
Das Therapiespektrum zur<br />
Beseitigung des akuten Schmerzzustandes<br />
liegt im Ermessen des<br />
Behandelnden unter Berücksichtigung<br />
der gesetzlichen Vorgaben.<br />
Was ist dieses Therapiespektrum?<br />
Nach einer Pause mit angeregten<br />
Gesprächen zum Thema<br />
unter den Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmern ging OA Dr. Andreas<br />
Bartols darauf ein.<br />
Brisanz. „Notfall ist ein heißes<br />
Eisen, an dem man sich nur die<br />
Finger verbrennen kann!“, zeigte<br />
er die Brisanz des Themas auf. Dr.<br />
Bartols unterscheidet zwischen der<br />
absoluten und relativen Indikation.<br />
Unfallverletzungen, pyogene<br />
Infektionen und Nachblutungen<br />
sind als absolute Indikationen sofort<br />
und unaufschiebbar zu behandeln.<br />
Wichtig war ihm, dass diese<br />
Zustände mit den nötigen Maßnah-<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Regionen 41<br />
men therapiert werden, z. B. Röntgendiagnostik<br />
bei Unfallverletzungen,<br />
Inzision bei Abszessen und<br />
nachhaltige Sofortmaßnahmen bei<br />
Nachblutungen. Eher ist der Patient<br />
der Klinik zuzuweisen.<br />
FürdieTraumatologiegaberBehandlungsstrukturen<br />
vor und verwies<br />
zudem auf die Internetseite<br />
www.dentaltraumaguide.org, die<br />
„kochbuchartig“ Hilfestellung<br />
gibt.<br />
Die relativen Indikationen, Pulpitiden,<br />
Zahnfrakturen und Kariesläsionen<br />
wurden von ihm in einem<br />
angeregten Vortrag unter den Gesichtspunkten<br />
der Versorgungswissenschaft<br />
dargestellt. Dabei stellte<br />
er den Spagat zwischen dem Leistungsangebot<br />
der Zahnheilkunde<br />
und der Erwartungshaltung der Patienten,<br />
auch der Eltern dar.<br />
Bartols ging auch auf die Möglichkeit<br />
der Knochentrepanation<br />
und der Heilanästhesie als Beseitigung<br />
der Schmerzzustände ein.<br />
Die endodontische Behandlung<br />
wurde als „one visit“ Therapie mit<br />
den entsprechenden instrumentellen<br />
Maßnahmen als gleichwertig<br />
den konservativen Behandlungen<br />
mit medikamentösen Einlagen gegenüber<br />
gestellt.<br />
Überraschend waren seine Ausführungen<br />
zu neuen Erkenntnissen<br />
der Kariestherapie. Nicht immer<br />
ist die vollständige Beseitigung der<br />
Karies bei der Gefahr einer Pulpenverletzung<br />
das Mittel der Wahl. Es<br />
werde diskutiert, dass auch das Belassen<br />
von Kariesresten bei einem<br />
bakteriendichten Verschluss, der<br />
aber im Bereich des Kavitätenrandes<br />
kariesfrei sein muss, zum Stillstand<br />
des Karieswachstums führe.<br />
Das wäre eine hilfreiche Therapie,<br />
z. B. bei Milchzähnen oder bei<br />
in der Compliance indifferenten<br />
Schmerzpatienten.<br />
Fazit. Ein in der Praxisroutine<br />
täglich vorkommendes Thema,<br />
die Schmerzbeseitigung, bedarf<br />
eigentlich keiner Erklärung mehr.<br />
Unter dem Gesichtspunkt der Therapie<br />
von Asylbewerbern, also bei<br />
Patienten, zu denen wir sprachlich,<br />
organisatorisch und wirtschaftlich<br />
einen anderen Zugang haben, wurde<br />
das Thema durch die kompetente<br />
und gelungene Aufbereitung seitens<br />
Spannend. Der akute zahnmedizinische Notfall war unter dem Gesichtspunkt der Behandlung<br />
von Asylbewerbern ein spannendes Thema bei der jährlichen Fortbildung im<br />
TuTZiG.<br />
der Referenten spannend. Die Veranstaltung<br />
brachte mehr Erkenntnisse<br />
und positive <strong>Möglichkeiten</strong>,<br />
als es die Initiatoren vorab erwartet<br />
hatten. Die Teilnehmer haben angeregt<br />
diskutiert, ihre Erfahrungen<br />
eingebracht und ihre Fragen offen<br />
gestellt. Die Behandlung akuter<br />
zahnmedizinischer Notfälle stellt<br />
auch eine Chance dar.<br />
Interesse an einem Qualitätszirkel in der Nähe<br />
Vergangenes Jahr hat die Landeszahnärztekammer<br />
eine Umfrage<br />
zur Arbeit der Qualitätszirkel im<br />
Land durchgeführt. Die selbstbestimmte<br />
interkollegiale Fortbildung<br />
in Form von Qualitätszirkeln<br />
erfreut sich nach wie vor großer<br />
Beliebtheit. Das zeigt das Umfrageergebnis.<br />
Im Kammerbereich<br />
Baden-Württemberg gibt es derzeit<br />
55 aktive Qualitätszirkel. Davon<br />
befinden sich allein 22 Zirkel<br />
im Regierungsbezirk Stuttgart.<br />
33 weitere Qualitätszirkel verteilen<br />
sich gleichmäßig auf alle<br />
anderen Regierungsbezirke. Laut<br />
Umfrageergebnis liegt die Stärke<br />
der Qualitätszirkelarbeit in ihren<br />
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.<br />
Die Umfrage hat auch ergeben,<br />
dass die meisten Qualitätszirkel<br />
autonom arbeiten wollen. Demzufolge<br />
beschränkt sich die Hilfestellung<br />
der LZK auf ganz pragmatische<br />
Dinge: Möchten Sie in<br />
einem bestehenden Qualitätszirkel<br />
in Ihrer Region aktiv mitwirken<br />
oder planen Sie einen zahnärztlichen<br />
Qualitätszirkel selbst<br />
zu gründen? Auf der Internetseite<br />
der Landeszahnärztekammer unter<br />
www.lzk-bw.de wurde im Be-<br />
Dies wurde auch in einer kleinen<br />
abschließenden Lesung aus dem<br />
Roman „Sungs Laden“ von Karin<br />
Kalisa dargestellt. Das gemeinsame<br />
Abendessen in der guten Atmosphäre<br />
des „Hofgut Hohenkarpfen“<br />
rundete eine gelungene Veranstaltung<br />
ab.<br />
Dr. Klaus Sebastian &<br />
Dr. Thomas Schilling<br />
reich Zahnärzte die Rubrik Qualitätszirkel<br />
neu überarbeitet. Die<br />
aktuelle Übersichtskarte zeigt, in<br />
welchem Regierungsbezirk sich<br />
diejenigen der 28 Qualitätszirkel<br />
befinden, die sich noch gerne<br />
weitere Mitglieder wünschen und<br />
die aktualisierte Adressliste informiert<br />
Sie über die jeweiligen Ansprechpartner.<br />
Falls kein Qualitätszirkel<br />
in Ihrer Nähe vorhanden<br />
ist, gründen Sie doch einen neuen<br />
Zirkel! Für dieses Engagement<br />
haben wir für Sie eine 8-Punkte-<br />
Checkliste zur Neugründung mit<br />
wertvollen Tipps erarbeitet. Der<br />
Service umfasst auch zum Download<br />
bereitstehende Musterformulare,<br />
die unbedingt zu beachtenden<br />
Fortbildungsleitsätze der<br />
BZÄK, KZBV und DGZMK und die<br />
Bewertungstabelle für die Punktebewertung<br />
der jeweiligen Qualitätszirkelsitzungen<br />
mit verschiedenen<br />
Bewertungsmöglichkeiten.<br />
Unser Appell an Sie: Ergreifen Sie<br />
die Initiative, machen Sie mit und<br />
entscheiden Sie sich aktiv für diese<br />
einmalige kreative Form einer<br />
kollegenfreundlichen und selbst<br />
verantworteten Fortbildung, es<br />
lohnt sich!<br />
nemitz@lzk-bw.de<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
42<br />
Praxis<br />
Wenn sich der Versicherer auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beruft…<br />
Überraschung!<br />
„In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen ist zum einen die<br />
Definition von Zahnersatz zu finden als auch die Beschreibung, dass<br />
die Vor- und Nachbehandlung (wie Wurzelbehandlung und Provisorien)<br />
zum Zahnersatz gezählt wird. Zum Zeitpunkt der Entfernung<br />
der Zähne 12 und 11 stand bereits fest, dass diese mit Implantaten<br />
versorgt werden müssen, somit ist auch diese Behandlung als Vorbehandlung<br />
zum Zahnersatz zu 60 Prozent erstattungsfähig...“. So<br />
schreibt das Versicherungsunternehmen XY.<br />
Wie reagiert man auf diese Antwort?<br />
Man liest die beigelegten<br />
Allgemeinen Versicherungsbedingungen<br />
durch. Und tatsächlich<br />
findet sich hier, dass der Erstattungssatz<br />
bei Zahnersatz, Kronen,<br />
Onlays und Inlays bei 60 Prozent<br />
liege. Weiter wird definiert: „Als<br />
Zahnersatz gelten prothetische<br />
und implantologische Leistungen<br />
“…„ einschließlich der damit in<br />
Zusammenhang stehenden Vorund<br />
Nachbehandlungen, wie z. B.<br />
Wurzelbehandlungen und Provisorien.“<br />
Versicherungsbedingungen.<br />
Die Versicherung hat hier eine<br />
ganz eigene Bestimmung von<br />
Zahnersatz und Zahnbehandlung<br />
festgelegt. Sie differenziert in der<br />
Erstattung danach, ob die Wurzelbehandlung<br />
im Vorfeld einer prothetischen<br />
Leistung durchgeführt<br />
wird oder isoliert.<br />
Gebührenrecht. Diese Unterscheidung<br />
kennt die GOZ nicht.<br />
Eine eindeutige Zuordnung der<br />
Behandlungsleistungen ist gegeben:<br />
Laut den gesetzlichen Vorgaben<br />
der GOZ und GOÄ finden sich<br />
Wurzelbehandlung, Herstellung<br />
von Einzelkronen, Teilkronen,<br />
Inlays, bzw. Einlagefüllungen in<br />
Kapitel C – Konservierende Leistungen.<br />
Somit müsste laut Vertrag zu<br />
100 Prozent erstattet werden. Der<br />
Verordnungsgeber kennt keine<br />
Differenzierungen bezüglich einer<br />
wann auch immer folgenden prothetischen<br />
Leistung.<br />
Eine Wurzelbehandlung bleibt<br />
eine konservierende Leistung, unabhängig<br />
davon, welche Behandlung<br />
danach folgt. Für einen Versicherten<br />
dürfte es auch allein aus<br />
der Lektüre der Versicherungsbedingungen<br />
schwer nachvollziehbar<br />
sein, in welchem Umfang er tatsächlich<br />
einen Erstattungsanspruch<br />
hat.<br />
Hinsichtlich dieser Diskrepanz<br />
ist es empfehlenswert den Versicherungsvertrag<br />
rechtlich danach<br />
überprüfen zu lassen, ob es sich<br />
eventuell um eine sogenannte überraschende<br />
Klausel oder einen Verstoß<br />
gegen das Transparenzgebot<br />
handeln könnte?<br />
Prüfung von Klauseln. Überraschungsklauseln<br />
sind Bestimmungen<br />
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen<br />
(AGB), die nach den<br />
Umständen, insbesondere nach<br />
dem äußeren Erscheinungsbild des<br />
Vertrags, so ungewöhnlich sind,<br />
dass der Vertragspartner des Verwenders<br />
mit ihnen nicht zu rechnen<br />
braucht.<br />
Gemäß § 305c BGB können überraschende<br />
und mehrdeutige Klauseln<br />
nicht zum Vertragsbestandteil<br />
werden, wenn sie so ungewöhnlich<br />
sind, dass der Vertragspartner<br />
des Verwenders mit ihnen nicht zu<br />
rechnen braucht. Dadurch soll der<br />
Vertragspartner vor eventuell unlauteren<br />
Absichten des Verwenders<br />
der AGB geschützt werden.<br />
Voraussetzung für das Vorliegen<br />
einer „Überraschungsklausel“ ist,<br />
dass sie „objektiv ungewöhnlich“<br />
erscheint, ein „Überraschungsmoment“<br />
besitzt, d. h. „der Klausel<br />
muss ein Überrumpelungs- oder<br />
Übertölpelungseffekt innewohnen“.<br />
Der Grad der Überraschung<br />
ist dabei abhängig von den „Erkenntnismöglichkeiten<br />
des typischerweise<br />
zu erwartenden Durchschnittskunden“.<br />
Prüfung durch Gerichte. Die<br />
Allgemeinen Geschäftsbedingungen<br />
der privaten Krankenversicherungen<br />
sind inzwischen ein<br />
Sammelsurium von Einschränkungen<br />
der Erstattung geworden. Der<br />
Maßstab den Gerichte an die Klarheit<br />
und Verständlichkeit, sowie<br />
die Transparenz dieser Versicherungsbedingungen<br />
anlegen ist nicht<br />
gering, bspw. LG Dortmund, Urteil<br />
vom 29.112012, Az. 2 O 220/12,<br />
BGH, Urteil vom 23.01.2008, Az.<br />
IV ZR 169/06, OLG Hamburg,<br />
Urteil vom 23.01.2001; Az. 9 U<br />
327/99. Ein genauerer Blick kann<br />
sich daher durchaus lohnen.<br />
Sachkostenlisten. Im Zusammenhang<br />
mit der Änderung von<br />
Allgemeinen Geschäftsbedingungen<br />
oder Tarifbedingungen wird<br />
oft der Versuch unternommen,<br />
sogenannte Sachkostenlisten in<br />
den Vertrag einzuführen. Hier ist<br />
besondere Vorsicht geboten. Denn<br />
nach deren wirksamer Einbeziehung<br />
in den Vertrag werden allein<br />
auf deren Basis die zahntechnischen<br />
Laborkosten erstattet. Gab es<br />
bei Abschluss des Vertrages noch<br />
keine Sachkostenliste, so kann diese<br />
auch später nicht als Erstattungsgrundlage<br />
herangezogen werden<br />
(AG Hamburg, Az.: 18 b C 196/13<br />
vom 12.09.2013).<br />
Ein Trost: Zweifel bei der Auslegung<br />
der AGBs gehen zu Lasten<br />
des Verwenders (§ 305c (2)<br />
BGB), also der Versicherung und<br />
der Auslagenersatz des Zahnarztes<br />
für zahntechnische Leistungen bestimmt<br />
sich grundsätzlich nach § 9<br />
GOZ.<br />
Autorenteam des<br />
GOZ Ausschusses<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Praxis 43<br />
Der Kammer-Ratgeber im Überblick – Teil 5<br />
PRAXIS-Handbuch – Schaltfläche<br />
„5. Praxisbegehung – Was nun?“<br />
Das PRAXIS-Handbuch der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg ist nicht nur ein umfangreiches Nachschlagewerk<br />
für die Zahnarztpraxis, sondern bereitet auch mit vielen Informationen und Muster-Dokumenten auf die Praxisbegehung<br />
durch die Aufsichtsbehörden vor. Über die Schaltfläche „5. Praxisbegehung – Was nun?“ des PRAXIS-<br />
Handbuchs werden z. B. eine Checkliste zur Ist-Analyse vor der Praxisbegehung angeboten. Sie finden auch einen<br />
umfangreichen Fragen- und Antwortenkatalog (FAQ) zur Aufbereitung von Medizinprodukten. Neben begehungsrelevanten<br />
Regelwerken werden der Leitfaden „Hygiene und Medizinprodukteaufbereitung“ als Praxis-Hygiene-Ratgeber<br />
sowie eine Vielzahl an Muster-Dokumenten der Hygiene-Qualitätssicherung zur Praxisindividualisierung per Direktlink<br />
bereitgestellt. Der Teil 5 stellt nun die Schaltfläche „5. Praxisbegehung – Was nun?“ des PRAXIS-Handbuchs vor.<br />
Grafik: LZK BW<br />
Wo finde/erhalte ich das PRAXIS-Handbuch?<br />
• Online über www.lzkbw.de<br />
• Als CD-ROM per Post bzw. als Download-Link über<br />
die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg.<br />
Die Schaltfläche „5. Praxisbegehung – Was nun?“<br />
im Überblick:<br />
Über die Schaltfläche „5. Praxisbegehung – Was<br />
nun?“ werden für die Zahnarztpraxis folgende Dokumente<br />
zur Verfügung gestellt:<br />
5.1 Checkliste zur Vorbereitung und Selbstprüfung<br />
Hier finden Sie eine Checkliste zur Vorbereitung und<br />
Selbstprüfung vor der Praxisbegehung (Isi-Analyse<br />
der Praxis).<br />
5.2 Fragen und Antworten (FAQ) zur Aufbereitung<br />
von Medizinprodukten<br />
Hier finden Sie einen umfangreichen Fragen- und<br />
Antwortenkatalog (FAQ) zur Aufbereitung von Medizinprodukten,<br />
im Schwerpunkt für den Bezirk Freiburg<br />
(in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium<br />
Freiburg).<br />
5.3 Gesetze & Vorschriften<br />
Hier finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten<br />
begehungsrelevanten Regelwerke.<br />
5.4 Praxis-Ratgeber<br />
Hier finden Sie den Leitfaden „Hygiene und Medizinprodukteaufbereitung“<br />
als Praxis-Hygiene-Ratgeber<br />
für die Zahnarztpraxis mit einem „allgemeinen Teil“<br />
und dem „Speziellen Fachteil – Aufbereitung von Medizinprodukten“.<br />
5.5 Muster-Hygiene-Qualitätssicherungsdokumente<br />
Hier finden Sie über Direktlinks eine Vielzahl an Muster-Qualitätssicherungsdokumenten<br />
für die Praxis<br />
(z. B. Muster-Standardarbeitsanweisungen, Muster-<br />
Hygieneplan, Muster-Hygiene-Formulare, Muster-<br />
Verfahrensanweisungen).<br />
5.6 Hilfe und Beratung durch die LZK BW<br />
Hier finden Sie die Ansprechpartner der Abteilung<br />
Praxisführung der LZK BW für die telefonische Beratung<br />
Ihrer Praxis sowie Informationen über die von<br />
der LZK BW angebotene Hygiene-Beratung in der<br />
Zahnarztpraxis. Für den Praxisführungsausschuss<br />
Dr. Carsten Ullrich, Mannheim<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
44<br />
Leserreise<br />
Fachexkursion der Landeszahnärztekammer<br />
Sieben Tage in Tibet<br />
Nach neunstündigem Flug hatten wir Peking erreicht, unsere örtliche<br />
Führung begleitete uns zum Hotel und sogleich begann das erste<br />
Abenteuer: Geldwechseln. Wir taten uns in einer Gruppe zusammen<br />
und so hielten wir nach etlicher Wartezeit unsere ersten Yuan-Banknoten<br />
in der Hand. Damit ging‘s auf zum ersten Erkundungsgang. Ein<br />
Spaziergang zum „Platz des Himmlischen Friedens“ und weiter zu den<br />
Toren der „Verbotenen Stadt“, die uns leider verschlossen blieben.<br />
Erhaben. Potala Palast, Lhasa, Winterpalast des Dalai Lama.<br />
Nur wenige Stunden Schlaf blieben<br />
uns, denn um vier Uhr früh trafen wir<br />
uns im Foyer zur Abfahrt zum Flughafen;<br />
Weiterflug nach Xining, wo<br />
uns unsere zweite Führung, Daniel,<br />
in Empfang nahm, um uns sogleich<br />
in eine noch unbekannte Welt der<br />
tibetischen Klosteranlagen zu entführen.<br />
Das lamaistische Kumbum<br />
mit seinem großen Klosterbezirk,<br />
der heute noch von 1000 Mönchen<br />
bewohnt wird war die erste Station.<br />
Die Einweisung, wie man über die<br />
große Schwelle zu gehen hat, war<br />
uns fortan ein wichtiger Begleiter.<br />
Sich drehende Gebetsmühlen, der<br />
Duft der Rauchopferhäuschen, die<br />
Wärme der mit flüssiger Yakbutter<br />
gefüllten Opferkerzen, sowie das<br />
besondere Dämmerlicht im Inneren<br />
der Versammlungs- und Gebetsräume,<br />
der Anblick riesiger Buddhaskulpturen<br />
und die vielen bunten<br />
Fähnchen bildeten von nun an unsere<br />
geheimnisvolle Umgebung. Der<br />
Besuch des Tibetan Medicine Museum<br />
mit seinem weltlängsten Thanka,<br />
einem 618 Meter langen und 2,5<br />
Meter breiten Seidenstoffgemälde,<br />
das alles zur tibetischen Geschichte<br />
und Kultur enthält, bildeten den kulturellen<br />
Abschluss dieses Tages, der<br />
mit dem Einsteigen in die Lhasa-<br />
Bahn enden sollte.<br />
Lhasa-Bahn. Über zwanzig Stunden<br />
Fahrt für ca. 2000 Kilometer<br />
Länge auf der höchsten Eisenbahnstrecke<br />
der Welt lagen vor uns. Etliche<br />
Kollegen sammelten sich vor<br />
dem Höhenmessgerät im Zug, um<br />
die Höhenangabe zu bestaunen,<br />
der Tangula-Pass lag immerhin auf<br />
5072 Meter Höhe und uns wurde ein<br />
wenig bange bei der Frage, wie wir<br />
mit der dünneren Luft zurechtkommen<br />
würden. Eine unbeschreiblich<br />
riesige und abwechslungsreiche<br />
Landschaft breitete sich vor uns aus.<br />
Am Nachmittag erreichten wir Lhasa,<br />
die einst verbotene Stadt und Tashi,<br />
unsere gute Seele und Reiseführer<br />
für die nächsten Tage, empfing<br />
uns und führte uns zum Hotel.<br />
Die kommenden Tage brachten<br />
uns mit seinem großartigen Wissen,<br />
welches er uns mit seinem tadellosen<br />
Deutsch vermitteln konnte, aus<br />
dem Staunen nicht mehr heraus:<br />
Das eng an den Berg geschmiegte<br />
Kloster Drepung, die ehemalige<br />
Residenz des Dalai Lama und das<br />
Kloster Sera gehörten genauso dazu,<br />
wie der Besuch des Potala Palastes,<br />
dem beeindruckenden Winterpalast<br />
des Dalai Lama, der von unzähligen<br />
tibetischen Pilgern in einem nicht<br />
enden wollenden Besucherstrom<br />
umrundet wurde.<br />
Pässe. Zwischendurch fuhren<br />
wir mit dem Bus auf der Südroute<br />
370 Kilometer nach Gyantse zum<br />
Kloster Pälkhor Chöde, wo bei unserer<br />
Ankunft ein großes Fest der<br />
Mönche der Gelbmützen und Rotmützen<br />
in vollem Gange war und<br />
weiter nach Shigatse. Pässe wie der<br />
Kampa La und der in 5560 Meter<br />
Höhe gelegene Karo La Gletscher,<br />
sowie der heilige Yamdrok See auf<br />
über 4400 Metern ließen uns träumen.<br />
Steinböcke, Yaks und traditionell<br />
gekleidete Tibeter sorgten für<br />
nicht enden wollende Eindrücke.<br />
Wer unterwegs mal in einer persönlichen<br />
Toilettenangelegenheit unterwegs<br />
war, sollte unweigerlich damit<br />
konfrontiert werden, dass dies in<br />
Tibet keineswegs eine persönliche<br />
Angelegenheit ist. Die Tibeter begegneten<br />
uns freundlich, wenn ein<br />
Mönch eine Kamera zur Verfügung<br />
hatte, zögerte er nicht, auch uns zu<br />
fotografieren. Jeden Morgen wurden<br />
wir von Tashi im Bus mit einem<br />
fröhlichen „Tashi delek!“ begrüßt.<br />
Es klingt noch heute in unseren<br />
Ohren. In der Provinzstadt Shigatse<br />
besuchten wir am nächsten Tag<br />
bei strahlendem Sonnenschein das<br />
Kloster Tashilhunpo, den Sitz des<br />
Panchen Lama, dem ranghöchsten<br />
religiösen Würdenträger der Gelugpa,<br />
der Tugend-Schule. Zuvor gab<br />
es bei einem reichhaltigen Frühstücksbüfett<br />
die Möglichkeit neben<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Leserreise 45<br />
Gigantisch. Die weltgrößte begehbare Stupa in Gyantse.<br />
Geschenk mit Symbolcharakter. Die Schwarzwälder Kuccuccsuhr,<br />
die Dr. Bernd Pflughaupt an Professor Dr. Tre Wang<br />
Tan Paim überreichte.<br />
Fotos: Gabriele Schluchter, Prof. Dr. U. Keller, Peter Gaebel<br />
dem Gewohnten auch Traditionelles<br />
wie Reissuppe, Yakbuttertee,<br />
Glückskekse (da ziemlich hart) und<br />
Tsampa, gekneteten Bällchen aus<br />
Hochlandgerstenmehl, zu probieren.<br />
Auf dem Weg zurück nach Lhasa<br />
hatten wir die Gelegenheit, die Herstellung<br />
von Räucherstäbchen in einer<br />
Manufaktur zu beobachten, ein<br />
Besuch in einem traditionellen<br />
tibetischen Dorf in der Abendsonne<br />
rundete die Eindrücke<br />
des Tages ab. Beim gemeinsamen<br />
Abendessen gab es wieder<br />
eine reiche Auswahl<br />
an gedünstetem Gemüse,<br />
neben Hühnchen<br />
auch Yakfleisch,<br />
Gerstennudeln,<br />
Reis und ein tibetisches<br />
Bier.<br />
Nationalheiligtum. Am<br />
nächsten Tag in Lhasa kamen<br />
wir vom belebten Barkhor<br />
Platz zum Nationalheiligtum<br />
Tibets, dem Jokhang Tempel.<br />
Um ihn führt ein innerer<br />
Wandlungsweg, der Barkhor, der<br />
von zahllosen tibetischen Pilgern<br />
im Uhrzeigersinn begangen wird.<br />
Entlang dieses Weges befinden sich<br />
bunte kleine Geschäfte, die endlich<br />
unseren Wunsch nach kleinen Andenken<br />
erfüllen konnten. Postkarten?<br />
Fehlanzeige. Die gab es nur im<br />
China Post Office. Dafür konnten<br />
wir etliche Straßenzahnärzte bei<br />
der Behandlung beobachten, was<br />
diese jedoch nicht so gerne sahen.<br />
Ein reichhaltiges Angebot an Zahnersatz<br />
wurde den Interessenten in<br />
der Auslage auf Plastikfolien angeboten.<br />
Dort lagen die Patienten auf<br />
improvisierten Stühlen und harrten<br />
ihrer Behandlung.<br />
Am letzten Tag unserer Reise<br />
wurden wir von Professor Dr. Tre<br />
Wang Tan Paim im „Traditional Tibetan<br />
Hospital“ empfangen, er hielt<br />
vor den gemalten Lehrtafeln einen<br />
beeindruckenden Vortrag über die<br />
traditionelle tibetische Medizin, im<br />
Nebenraum waren die maßgeblichen<br />
Buddhas zu finden. Er erklärte<br />
uns die ganzheitliche Sichtweise,<br />
die bei uns in der westlichen Medizin<br />
wegen der starken Spezifizierung<br />
doch oft zu kurz kommt. Erstaunt<br />
packte er unser mitgebrachtes<br />
Geschenk aus, eine echte Schwarzwälder<br />
Kuckucksuhr, von Bernd<br />
Pflughaupt überreicht. Dieser ließ<br />
es sich nicht nehmen, beigefügte Instruktionen<br />
auf Englisch und Chinesisch<br />
zu erläutern. Wir hoffen alle,<br />
dass er damit die Kuckucksuhr zum<br />
Funktionieren bringen kann.<br />
Anschließend hatten wir noch<br />
eine Diskussionsrunde mit einem<br />
dort tätigen Zahnarzt über den<br />
anscheinend in Tibet immer<br />
noch verbreiteten Karieswurm.<br />
Karius und Baktus sind dort<br />
noch nicht angekommen. Auch<br />
die Entstehung der Parodontitis<br />
wurde ebenso wie die Verwendung<br />
von Füllmaterialien noch lebhaft<br />
diskutiert. Nach dem Besuch des<br />
Sommerpalastes des Dalai Lama<br />
mit einem schönen Parkspaziergang<br />
klang unser Tag aus.<br />
Eine beeindruckende Reise<br />
ging zu Ende und bereichert von<br />
vielen neuen Erlebnissen und Erfahrungen<br />
traten wir die Heimreise<br />
an – in Gedanken hatte ich schon<br />
längst eine Ausgabe von Heinrich<br />
Harrers „Sieben Jahre in Tibet“ bestellt,<br />
um damit die Reise nachklingen<br />
lassen zu können. Sehr empfehlenswert.<br />
Weitere Impressionen finden Sie<br />
unter www.zahnaerzteblatt.de.<br />
Gabriele Schluchter,<br />
Prof. Dr. Ulrich Keller<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
46<br />
Prophylaxe<br />
Landeszentrale Auftaktveranstaltung zum Tag der Zahngesundheit<br />
Freiburger Münsterplatz im Fokus<br />
Fast ein Vierteljahrhundert ist es inzwischen her, dass die landeszentrale<br />
Auftaktveranstaltung zum Tag der Zahngesundheit in Freiburg<br />
ausgerichtet wurde. In diesem Jahr ist es endlich gelungen, den<br />
prominenten Münsterplatz nutzen zu dürfen, der hauptsächlich den<br />
Marktbeschickern vorbehalten ist. Das Motto „Gesund beginnt im<br />
Mund – mit Obst und Gemüse geht’s rund“ überzeugte schließlich die<br />
Stadt Freiburg, denn der Münstermarkt soll mit seinem Angebot an<br />
zahngesunden Produkten in die Veranstaltung mit eingebunden werden.<br />
Somit gab es nun grünes Licht für die Tage der Zahngesundheit,<br />
die vom 21. bis 24. September 2016 stattfinden werden.<br />
ErlebnisForum Zahngesundheit. Mitte September findet die landeszentrale Auftaktveranstaltung<br />
zum Tag der Zahngesundheit in Freiburg statt. Der bunte Münstermarkt<br />
wird dabei in die Aktionen rund um das weiße Pagodenzelt eingebunden sein.<br />
Aktionen. Am Mittwoch, 21. September<br />
2016 werden die Tage der<br />
Zahngesundheit um 11 Uhr unter<br />
der Mitwirkung des Vorstands der<br />
Landesarbeitsgemeinschaft für<br />
Zahngesundheit e. V. (LAGZ) und<br />
zahlreicher Prominenten aus Politik,<br />
Wissenschaft und Kultur feierlich<br />
eröffnet. Dazu werden zahlreiche<br />
Vertreter von Presse, Funk und<br />
Fernsehen erwartet. Vier Tage lang<br />
werden im und am ErlebnisForum<br />
Zahngesundheit auf dem Freiburger<br />
Münsterplatz, eingebettet<br />
in den Münstermarkt, zahlreiche<br />
attraktive Aktionen rund um die<br />
Zahn- und Mundgesundheit angeboten,<br />
und zwar von Mittwoch,<br />
21. September bis Freitag, 23. September<br />
von 9 bis 17 Uhr und am<br />
Samstag, 24. September von 9 bis<br />
14 Uhr. Der Freiburger Münstermarkt<br />
findet dabei von Mittwoch<br />
bis Freitag bis 13.30 Uhr und am<br />
Samstag bis 14 Uhr statt.<br />
Motto. Das diesjährige Motto<br />
„Gesund beginnt im Mund – mit<br />
Obst und Gemüse geht’s rund“<br />
zeigt deutlich: Zu den prophylaktischen<br />
Maßnahmen für eine gute<br />
Mund- und Zahnhygiene zählt auch<br />
eine gesunde Ernährung, am besten<br />
frisch vom Markt. Kinder, Jugendliche,<br />
Erwachsene und Senioren<br />
werden gleichermaßen eingeladen,<br />
Foto: Bamberger<br />
ins weiße Pagodenzelt auf dem<br />
Münsterplatz zu kommen, das –<br />
eingebettet in das bunte Marktgeschehen<br />
– zahlreiche Attraktionen<br />
und Informationen zur Prophylaxe<br />
und zahngesunder Ernährung<br />
anbieten wird. Ein Ernährungsparcours<br />
mit Quiz und schönen<br />
Preisen für die Schulkinder stellt<br />
zusätzlich eine ideale Verknüpfung<br />
zu den Marktständen dar.<br />
Engagement. Der Tag der<br />
Zahngesundheit zeigt das vorbildliche<br />
Zusammenspiel aller Mitwirkenden<br />
in der LAGZ, dem Informationszentrum<br />
Zahngesundheit<br />
Baden-Württemberg (IZZ) und der<br />
regionalen Arbeitsgemeinschaften<br />
für Zahngesundheit bei der Zahnund<br />
Mundgesundheit der kleinen<br />
und großen Patienten. Vor der offiziellen<br />
Eröffnung auf dem Münsterplatz<br />
werden die Medienvertreter<br />
bei einer Pressekonferenz, an<br />
der LAGZ, das IZZ und die Regionale<br />
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit<br />
Stadtkreis Freiburg<br />
und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald<br />
teilnehmen, über den<br />
aktuellen Zahngesundheitsstatus<br />
der Kinder und Jugendlichen in<br />
Baden-Württemberg informiert.<br />
Dass die Zähne der Kinder in<br />
Baden-Württemberg seit Jahren<br />
so gut sind, ist u. a. der Verdienst<br />
der 37 regionalen Arbeitsgemeinschaften<br />
für Zahngesundheit, die<br />
sich unter dem Dach der LAGZ in<br />
Baden-Württemberg für die Erhaltung<br />
und Förderung der Zahngesundheit<br />
bei Kindern und Jugendlichen<br />
einsetzen. Hinzu kommen<br />
über 1400 Patenzahnärzte. Mit<br />
dabei sind außerdem das Ministerium<br />
für Soziales und Integration<br />
Baden-Württemberg, die Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg,<br />
die Kassenzahnärztliche<br />
Vereinigung Baden-Württemberg,<br />
die Krankenkassen Baden-Württembergs<br />
sowie fördernde Mitglieder.<br />
» claudia.richter@izz-online.de<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Buchtipp<br />
47<br />
Kommentar zur Muster-Berufsordnung<br />
der BZÄK<br />
Die Berufsordnung<br />
richtig anwenden<br />
Das Berufsrecht ist eines der zentralen<br />
Regularien eines Freien Berufes.<br />
Über die ihnen zustehende<br />
Selbstverwaltungsautonomie haben<br />
die (Landes-)Zahnärztekammern<br />
Rahmenanforderungen an die Berufsausübung<br />
des Zahnarztes im<br />
Berufsrecht verankert. Dabei orientieren<br />
sich die (Landes-)Zahnärztekammern<br />
in hohem Maße an der<br />
Muster-Berufsordnung der Bundeszahnärztekammer<br />
(BZÄK).<br />
Wesentliche Elemente der Muster-<br />
Berufsordnung sind das Verhältnis<br />
des Zahnarztes zu seinem Patienten,<br />
des Zahnarztes zu seiner Kollegenschaft<br />
und die Art und Weise seines<br />
Auftrittes in der Öffentlichkeit. Wie<br />
jedes Regelwerk bedurfte auch das<br />
Berufsrecht für eine Erfassung möglichst<br />
vieler Lebenssachverhalte einer<br />
Abstrahierung. Dieser Umstand<br />
macht es für jemanden, der nicht<br />
täglich mit dem Berufsrecht befasst<br />
ist, häufig schwierig aus den einzelnen<br />
Regelungen herauszulesen, welche<br />
Sachverhalte von diesen erfasst<br />
werden.<br />
Aus diesem Grund hat ein in diesen<br />
Fragen erfahrenes Autorenteam,<br />
im Auftrag der Bundeszahnärztekammer,<br />
anhand von Rechtsprechung,<br />
Sinn und Zweck sowie Entstehungsgeschichte<br />
der einzelnen<br />
Normen, deren Bedeutungsgehalt<br />
und Anwendungsumfang transparent<br />
und nachvollziehbar gemacht.<br />
Ziel des Kommentars ist es, allen<br />
interessierten Kreisen, insbesondere<br />
jedoch den betroffenen Zahnärzten<br />
zu helfen, die Berufsordnung richtig<br />
anzuwenden.<br />
Neben einem umfangreichen<br />
Sachregister, das die Orientierung<br />
in der Kommentierung erleichtert,<br />
beinhaltet der Kommentar auch<br />
über 230 berufsrechtliche Entscheidungen<br />
nach Themenbereichen getrennt.<br />
RA Stefan Oschmann<br />
Der Kommentar zur Muster-Berufsordnung<br />
kann bei der Bundeszahnärztekammer,<br />
Iris Höhne,<br />
E-Mail: i.hoehne@bzaek.de, zum<br />
derzeitigen Preis von € 13,50<br />
zzgl. MwSt. und Versandkosten,<br />
bezogen werden.<br />
Anzeige<br />
8.Oktober 2016<br />
in Stuttgart<br />
im Hotel „Pullman“ in Stuttgart<br />
Einführung in die neuromuskuläre Funktionslehre mit Rainer Schöttl, D.D.S.(USA),<br />
ehemaliger internationaler Präsident des ICCMO<br />
THEMEN sind u.a.:<br />
Stimmt unser Bild von der<br />
Cranio-Mandibulären Funktion?<br />
Limitationen im Konzept<br />
der terminalen Scharnierachse<br />
Die neuromuskulär und reflexgesteuerte<br />
Cranio-Mandibuläre Funktion<br />
Kompensationen im Biss und chronische<br />
Muskelverspannungen<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Infos & Anmeldungen unter:<br />
www.tagungen.iccmo.de<br />
ZBW 7/2016
48<br />
Kultur<br />
Landesmuseum Württemberg zeigt Bestände<br />
Wahre Schätze<br />
Foto: © H. Zwietasch; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart<br />
Seit dem 21. Mai 2016 werden in zwei Flügeln im ersten Obergeschoss<br />
unter dem Titel „Wahre Schätze. Antike – Kelten – Kunstkammer“<br />
Herzstücke aus den Beständen des Landesmuseums<br />
Württemberg präsentiert.<br />
Die Ausstellung umfasst prächtige<br />
und einzigartige Objekte, wahre<br />
Schätze von internationalem Rang.<br />
Einen umfangreichen Blick in die<br />
Welt der Hochkulturen des Mittelmeerraums<br />
erlaubt die über Jahrhunderte<br />
gewachsene Sammlung zur<br />
Antike. Ihre Anfänge gehen auf die<br />
herzogliche Kunstkammer zurück.<br />
Im 19. Jahrhundert gingen Privatsammlungen<br />
in die „Königliche<br />
Staatssammlung Vaterländischer<br />
Kunst- und Altertumsdenkmale“<br />
über, vor allem griechische Vasen<br />
und filigraner Goldschmuck. 1906<br />
folgte die Schenkung des Stuttgarter<br />
Mäzens Ernst von Sieglin mit<br />
zahlreichen Objekten aus dem griechisch-römischen<br />
Ägypten – Marmorbildnisse<br />
von Alexander dem<br />
Großen, auf dünne Holztafeln ge-<br />
Merkur. Das Kerykeion<br />
(Heroldstab) in der<br />
Hand, läuft Merkur auf<br />
den Betrachter zu. Die<br />
Statuette von Johan<br />
Johan Gregor van der<br />
Schardt aus dem Jahr<br />
1575 stammt aus der<br />
reichsten bürgerlichen<br />
Kunstsammlung ihrer<br />
Zeit, dem Kabinett des<br />
Nürnberger Seidenhändlers<br />
Paulus Praun.<br />
malte, farbenprächtige Mumienporträts,<br />
eindrucksvolle Mumienmasken<br />
sowie Bronzen und Terrakotten<br />
von höchster Qualität. Das Spektrum<br />
der Sammlung reicht von der<br />
griechischen Bronzezeit über die<br />
Blütezeit Griechenlands und die Etrusker<br />
bis zum Imperium Romanum.<br />
Schatzkammer. Die Kunst- und<br />
Wunderkammern der Renaissance<br />
stehen in der Tradition der mittelalterlichen<br />
Schatzkammern. Die<br />
Stuttgarter Kunstkammer zählt zu<br />
den größten europäischen Sammlungen<br />
dieser Art. Sie umfasst Objekte<br />
aus dem 16. bis 18. Jahrhundert und<br />
führt mit teilweise singulären Beispielen<br />
die Vielfalt des Kosmos im<br />
Kleinen enzyklopädisch vor Augen.<br />
Neben „Wundern aus Menschen-<br />
hand“, kunsthandwerklichen Arbeiten<br />
von höchster Virtuosität, interessierten<br />
die Herzöge, die sie zusammentrugen,<br />
aber auch erstaunenswerte<br />
Naturalien und Exotika aus<br />
fernen Ländern. Damalige Bodenfunde<br />
der römischen und keltischen<br />
Besiedlungen Württembergs führten<br />
zu einer beginnenden Reflexion der<br />
Landesgeschichte. Mit ihren Kunstund<br />
Wunderkammern, die auch wegen<br />
des hohen Materialwertes und<br />
der Schönheit ihrer Sammlungen<br />
geschätzt wurden, traten die Fürsten<br />
untereinander in Wettstreit. Die<br />
neue Präsentation soll die Themen<br />
und Gesichtspunkte, nach denen geforscht,<br />
bestaunt und repräsentiert<br />
wurde, unter dem Aspekt des Sammelns<br />
zeigen.<br />
Die Grundlage für den dritten<br />
Ausstellungsteil, Prunkgräber und<br />
Machtzentren der frühen Kelten, bilden<br />
die europaweit herausragenden<br />
Bestände des Landesmuseums mit<br />
13 frühkeltischen Prunkgräbern des<br />
7. bis 5. Jahrhunderts vor Christus<br />
aus der Region um den Hohenasperg,<br />
die Heuneburg und aus dem<br />
Albvorland. Die Entdeckung und<br />
frühe Erforschung ist eng mit Württemberg,<br />
dem Herzogshof und der<br />
Königlichen Altertümersammlung,<br />
dem heutigen Landesmuseum Württemberg,<br />
verbunden.<br />
Landesmuseum/IZZ<br />
Info<br />
Wahre Schätze<br />
bis 31.12.2018<br />
Öffnungszeiten<br />
Täglich außer montags<br />
10 bis 17 Uhr<br />
Eintritt<br />
Erwachsene 5,50 Euro,<br />
ermäßigt 4,50 Euro<br />
Landesmuseum Württemberg<br />
Altes Schloss, Schillerplatz 6<br />
70173 Stuttgart<br />
Tel. 0711/89 525 111<br />
www.landesmuseum-stuttgart.de<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Termine 49<br />
» Zahnärztlicher Arbeitskreis für Praxisführung und Fortbildung e. V. (Z.A.P.F. e. V.)<br />
Wo?<br />
Zahnärztehaus<br />
Stuttgart<br />
Albstadtweg 9<br />
70567 Stuttgart<br />
Montag, 4. Juli 2016<br />
19.30 Uhr bis ca. 22.00 Uhr<br />
Referent:<br />
Gebühr:<br />
Thema: Bewertungsportale –<br />
Was tun, wenn der Patient schlecht bewertet<br />
RA Dr. Stefan Stelzl, Stuttgart<br />
Mitglieder: 0,00 Euro<br />
Nicht-Mitglieder: 50,00 Euro<br />
Fortbildungspunkte: 3<br />
Information und<br />
Anmeldung:<br />
Z.A.P.F. e.V.<br />
Margit Giese<br />
Großer Lückenweg 13<br />
75175 Pforzheim<br />
Tel. 0700-9273 5877<br />
Fax. 0700-9273 3291<br />
Mail: kurse@zapf.org<br />
Internet: www.zapf.org<br />
Leserforum<br />
» Berufspolitik<br />
ZBW 6/2016, S. 22<br />
Kern bleibt die praktische<br />
Kompetenz<br />
„Die ganze Veranstaltung war sicher<br />
teuer, dennoch nur von teleologischer<br />
Natur. Außerdem ist es<br />
gute Sitte, Entscheidungen strategischer<br />
Natur den demnächst zu<br />
wählenden Vorständen zu überlassen<br />
und diesen nicht eine Hypothek<br />
aufzubürden.<br />
Dr. W. H. Knupfer<br />
» LESERFORUM<br />
Schreiben Sie uns<br />
Oder diskutieren Sie mit unter<br />
info@zahnaerzteblatt.de<br />
Bitte geben Sie<br />
Namen und Anschrift an.<br />
Anzeige<br />
FLEXIBEL + ZUVERLÄSSIG + INNOVATIV…..wir sorgen dafür, dass die Technik läuft.<br />
REPAIRE & CARE PRODUKTE SUPPORT VERBRAUCHSMATERIAL<br />
• Eigene Werkstatt<br />
mit Prüfstand<br />
• Reparaturservice für<br />
Hand- und<br />
Winkelstücke<br />
• Dentale<br />
Technikgeräte<br />
• Autoklaven<br />
• Dentaleinheiten<br />
und Zubehör<br />
• Kompressoren<br />
• Röntgengeräte<br />
• u.v.m.<br />
• Abnahmeprüfungen nach<br />
RöV<br />
• STK DIN VDE 0751<br />
• Adaptionen<br />
• Anpassungen<br />
• Gerätedesign<br />
• Praxiserweiterung/Umzug<br />
• An großes Zentrallager<br />
angeschlossen mit über<br />
70000 Artikel<br />
• 24-Stunden Lieferservice<br />
• Kompetente Fachberatung<br />
in Kooperation<br />
Die neue ANCAR Serie 7<br />
FROMMER GMBH & CO KG · DAIMLERSTRASSE 11 · 78655 DUNNINGEN<br />
TELEFON: +49 (0) 7403/91408-0 · TELEFAX: +49 (0) 7403/91408-29 · E-MAIL: INFO@FROMMER-GMBH.DE · WWW.FROMMER-MEDITEC.DE<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
50<br />
Namen und Nachrichten<br />
Versorgungswerke für Zahnärzte<br />
Dr. Eva Hemberger zur<br />
Vorsitzenden gewählt<br />
Die Delegierten der Ständigen<br />
Konferenz der Versorgungswerke<br />
für Zahnärzte wählten Ende April<br />
in Düsseldorf die Präsidentin der<br />
Versorgungsanstalt, Dr. Eva Hemberger,<br />
Heidelberg, einstimmig zu<br />
ihrer Vorsitzenden. Bereits im Jahr<br />
2012 war Dr. Eva Hemberger zur<br />
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt<br />
worden.<br />
Die Ständige Konferenz der<br />
Versorgungswerke für Zahnärzte,<br />
deren Mitglied die Versorgungsanstalt<br />
ist, koordiniert die spezifischen<br />
Belange des Berufsstandes<br />
der Zahnärzte. Die Konferenz führt<br />
die Repräsentanten der Selbstverwaltungsorgane<br />
der Versorgungswerke<br />
und deren Geschäftsführungen<br />
zusammen. Sie dient dem<br />
Erfahrungsaustausch und der gegenseitigen<br />
Information sowie der<br />
Abstimmung der Positionen unter<br />
den Versorgungswerken.<br />
Die Präsidentin der Versorgungsanstalt,<br />
Frau Dr. Eva Hemberger,<br />
tritt damit die Nachfolge von Dr.<br />
Helke Stoll an. Der Vorsitzende<br />
des Verwaltungsrats der Zahnärzteversorgung<br />
Sachsen stand seit<br />
2000 an der Spitze der Ständigen<br />
Konferenz.<br />
Baden-Württembergische<br />
Versorgungsanstalt für Ärzte,<br />
Zahnärzte und Tierärzte<br />
Aktuelle Statistik<br />
Mehr Freiberufler<br />
Die Zahl der Selbständigen in den<br />
Freien Berufen ist im vergangenen<br />
Jahr wieder gestiegen. Das berichtet<br />
die Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung (FAZ) unter Berufung auf<br />
eine Statistik des Bundesverbands<br />
der Freien Berufe (BFB). Demnach<br />
habe es zum Jahresbeginn rund<br />
1,34 Millionen selbständige Freiberufler<br />
gegeben. Das sind knapp<br />
2,7 Prozent mehr als im Vorjahr.<br />
Den kräftigsten Zuwachs verzeichneten<br />
nach Angaben der Zeitung<br />
die technisch-naturwissenschaftlichen<br />
Berufe mit 4,1 Prozent.<br />
Die rechts-, wirtschafts- und<br />
steuerberatenden Berufe legten<br />
demnach um 3,1 Prozent zu, die<br />
Heilberufe um knapp zwei Prozent.<br />
In den Freien Kulturberufen liege<br />
das Plus bei 1,9 Prozent.<br />
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigten bei den<br />
selbständigen Freiberuflern stieg<br />
laut FAZ im vergangenen Jahr um<br />
rund 3,7 Prozent auf fast 3,2 Millionen.<br />
Dazu kämen noch knapp<br />
270.000 mitarbeitende Familienmitglieder.<br />
Die Freien Berufe seien ein<br />
Beschäftigungsmotor, zitiert die<br />
Zeitung BFB-Präsident Dr. Horst<br />
Vinken: „Mittlerweile ist jeder<br />
zehnte sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigte Mitglied in einem<br />
Freiberufler-Team.“ Die Freien<br />
Berufe eilten „von Rekordmarke<br />
zu Rekordmarke“. Deshalb erwarte<br />
Vinken von der Politik auch, dass<br />
sie diese Entwicklung „konstruktiv<br />
begleitet“. Stattdessen aber rüttele<br />
vor allem die EU-Kommission „an<br />
den freiberuflichen Grundfesten“.<br />
Wie die FAZ weiter berichtet<br />
halte die Kommission die vielen<br />
Sonderregelungen für Freiberufler<br />
für unangemessen. Brüssel wolle<br />
deshalb den Zugang zu den Freien<br />
Berufen öffnen. Die Branche wiederum<br />
beteuert, dass die Sonderregeln<br />
eine hohe Qualität garantierten<br />
und deshalb im Interesse<br />
der Verbraucher seien. „Wachstum<br />
durch Qualität bleibt der oberste<br />
Leitsatz für die Freien Berufe“,<br />
sagte Vinken der FAZ. Das müsse<br />
auch Europa verstehen. ZBW/FAZ<br />
Zitat<br />
„Der Mensch von heute<br />
denkt, fühlt, erlebt und<br />
handelt in der Erwartung<br />
permanenter Kommunikationschancen.<br />
Räumliche<br />
und zeitliche Beschränkungen<br />
sind aufgehoben.“<br />
Prof. Dr. Peter Vorderer, Psychologe<br />
und Soziologe an der<br />
Universität Mannheim in der „Welt“.<br />
Forsa-Umfrage<br />
Smartphone stresst<br />
Foto: Simon Fessler<br />
E-Mails checken, WhatsApp-<br />
Nachrichten lesen oder Termine<br />
im Kalender prüfen – für viele<br />
Menschen ist der regelmäßige<br />
Blick auf das Smartphone heute<br />
ganz normaler Alltag. Seit vor<br />
zwanzig Jahren das erste Handy<br />
mit mobilem Internetzugang – das<br />
„Nokia 9000 Communicator“ –<br />
auf den Markt kam, hat sich das<br />
Leben vieler Menschen stark<br />
verändert. Rund drei Viertel der<br />
Deutschen von 14 Jahren an (74<br />
Prozent) verwenden heute ein<br />
Smartphone (Bitkom). Der Nutzeranteil<br />
hat sich damit innerhalb<br />
von vier Jahren mehr als verdoppelt.<br />
Eine von der AOK in Auftrag<br />
gegebene repräsentative Forsa-<br />
Umfrage zeigt, dass sich mehr als<br />
jeder dritte Baden-Württemberger<br />
(36 Prozent) durch eingehende<br />
Mitteilungen oder Benachrichtigungen<br />
auf seinem Smart-<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Namen und Nachrichten<br />
51<br />
phone ab und zu gestresst fühlt.<br />
„Der permanente Blick aufs<br />
Smartphone führt zu einer Unterbrechung<br />
der jeweiligen Tätigkeit<br />
und verlangt Multitasking – dies<br />
kann zu permanentem Stress führen.<br />
Auch die große Menge an<br />
Informationen, die man über das<br />
Smartphone erhält, kann ein Auslöser<br />
sein“, sagt PD Dr. Sabine<br />
Knapstein, Ärztin und Psychotherapeutin<br />
bei der AOK Baden-<br />
Württemberg. „Beklagt werden in<br />
diesem Zusammenhang Schlafstörungen,<br />
physische Beschwerden<br />
– wie Rückenschmerzen oder<br />
Magenschmerzen – aber auch psychische<br />
Erkrankungen wie Burnout<br />
und Depression.“<br />
Wer sein Smartphone intensiv<br />
nutzt und mindestens einmal pro<br />
Stunde auf das Display schaut,<br />
fühlt sich häufiger durch eingehende<br />
Mitteilungen oder Benachrichtigungen<br />
gestresst als die unregelmäßigen<br />
Nutzer (46 Prozent<br />
vs. 22 Prozent). Besonders stark<br />
betroffen sind die 16- bis 29-Jährigen<br />
(46 Prozent). Knapstein:<br />
„Damit der Blick nicht dauernd<br />
aufs Smartphone fällt, kann es<br />
hilfreich sein, den Klingelton oder<br />
Vibrationsalarm auszuschalten,<br />
eine Armbanduhr zu tragen und<br />
einen normalen Wecker statt der<br />
Weckfunktion des Smartphones<br />
zu verwenden.“<br />
Jeder fünfte (20 Prozent) Baden-Württemberger<br />
greift häufig<br />
abends im Bett noch einmal zu<br />
seinem Smartphone: Frauen öfter<br />
als Männer (24 Prozent vs.<br />
16 Prozent) und Jüngere mehr<br />
als Ältere (46 Prozent vs. 4 Prozent).<br />
„Wenn man sich durch<br />
sein Smartphone gestresst fühlt,<br />
können Achtsamkeitsübungen<br />
helfen. Atmen Sie tief durch und<br />
konzentrieren Sie sich ganz auf<br />
sich selbst. Halten Sie kurz inne<br />
vor jeder neuen Herausforderung.<br />
Denn wer innehält macht<br />
eine bewusste Pause und nimmt<br />
sich, seine Sinne und Emotionen<br />
bewusst wahr. Dieses bewusste<br />
Wahrnehmen nennt man Achtsamkeit.“<br />
Positiv ist, dass die Baden-<br />
Württemberger bei Treffen mit<br />
Freunden nicht so häufig aufs<br />
Display schauen (9 Prozent) und<br />
während der Mahlzeiten zuhause<br />
mit der Familie meist ganz darauf<br />
verzichten (81 Prozent „so<br />
gut wie nie“). Sinnvoll sei es laut<br />
Knapstein, handyfreie Zeiten zu<br />
planen.<br />
ZBW/AOK<br />
Zitat<br />
„Parteien haben die<br />
Aufgabe, Antworten auf<br />
komplexe Fragen zu entwickeln,<br />
auch und gerade<br />
dann, wenn es dafür nicht<br />
bereits eine erkennbare Erwartung<br />
oder gar Mehrheit<br />
in der Bevölkerung gibt.“<br />
Bundestagspräsident Norbert<br />
Lammert appelliert gegenüber der<br />
Deutschen Presseagentur an die<br />
CDU, ihre Prinzipien zu wahren.<br />
Foto: Achim Melde.<br />
Anzeige<br />
SYNOPTISCHE ZAHNHEILKUNDE<br />
Spezialisten - Schnittstellen - Allgemeinzahnärzte<br />
STUTTGART 17.-19. NOVEMBER 2016<br />
50. Jahrestagung der NEUEN GRUPPE –LIEDERHALLE<br />
VORKONGRESS<br />
DONNERSTAG, 17. NOV. 2016<br />
Dr.Didier Dietschi, D.M.D.,Ph.D., PD:<br />
Mastering layering, anatomy and<br />
finishing of anterior composite<br />
restorations*<br />
Prof. Dr. Dr. Herbert Dumfahrt:<br />
Planung komplexer festsitzender<br />
Rehabilitationen als Basis für den<br />
Langzeiterfolg<br />
HAUPTKONGRESS<br />
FREITAG, 18. NOV. 2016<br />
Prof. Dr. Dr. hc Niklaus P. Lang: „Begin with the end in mind“ –<br />
eine auf Prinzipien basierende Behandlungsplanung<br />
Dr.Didier Dietschi, D.M.D., Ph.D.,PD: Restorative Dentistry –<br />
Possibilities and limitations in a synoptic treatment concept*<br />
Prof. Dr. Ronald Jung: Minimalinvasive Implantologie<br />
von der Diagnostik zur Krone<br />
Dr. Josef Diemer: Update Endodontie.<br />
<strong>Möglichkeiten</strong>, Grenzen, Alternativen<br />
SAMSTAG, 19. NOV. 2016<br />
Prof. Dr. Angelika Stellzig-Eisenhauer: Erwachsenenkieferorthopädie<br />
–Partner in der modernen zahnmedizinischen<br />
Gesamtrehabilitation<br />
Prof. Dr. Irena Sailer: Interdisziplinäre Kommunikation –neue<br />
synoptische Konzepte für voraussagbare prothetische Resultate<br />
Dres. Guiseppe und Delfino Allais:<br />
TIME & DENTISTRY –from problematic issue to resource**<br />
*englisch **englisch/deutsch<br />
INFO & ANMELDUNG<br />
www.neue-gruppe.com<br />
BOELD Communication GmbH<br />
Adlzreiterstr. 29 · 80337 München<br />
Tel. +49 89 18 90 46-0 · Fax+49 89 18 90 46-16
52<br />
Amtliche Mitteilungen<br />
Kassenzahnärztliche Vereinigung<br />
Baden-Württemberg<br />
Für die Wahlperiode vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2022 der<br />
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KdöR)<br />
sind die Stellen der bis zu drei<br />
hauptamtlichen Vorstandsmitglieder<br />
zu besetzen. Die Vorstandsmitglieder und aus deren Reihen die bzw. der Vorsitzende<br />
des Vorstandes werden durch die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen<br />
Vereinigung Baden-Württemberg gewählt.<br />
Zu den Aufgabengebieten gehören unter anderem das Abrechnungswesen, das<br />
Finanz- und Rechnungswesen, die EDV und das Rechts- und Vertragswesen.<br />
Sie haben Erfahrung im Management, Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick,<br />
Fähigkeit zur Erfassung komplexer Sachzusammenhänge, Kommunikationsfähigkeit,<br />
teamorientiertes Führungsverhalten, Engagement und Ideenreichtum,<br />
konzeptionelles Denken, Initiative und Organisationsstärke.<br />
Ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Zahnmedizin oder der Rechts-/ Wirtschaftswissenschaften<br />
(Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre) ist Voraussetzung.<br />
Außerdem sind Kenntnisse des Vertragszahnarztrechts erforderlich.<br />
Die Amtszeit beträgt nach § 79 Abs. 4 Satz 5 SGB V sechs Jahre. Mit den Vorstandsmitgliedern<br />
werden privatrechtliche Anstellungsverträge abgeschlossen. Die Verträge<br />
werden auf sechs Jahre befristet. Eine Wiederwahl ist möglich.<br />
Die bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich wieder zur Wahl.<br />
Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen richten Sie bitte bis<br />
spätestens 31.08.2016, 15.00 Uhr an die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-<br />
Württemberg, Herrn Dr. Dr. Alexander Raff, Vorsitzender der Vertreterversammlung, -<br />
Findungskommission -, Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart. Später eingegangene Bewerbungen<br />
können nicht berücksichtigt werden.<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Amtliche Mitteilungen 53<br />
Einladung zur<br />
Vertreterversammlung<br />
Die Vertreterversammlung der<br />
Landeszahnärztekammer Baden-<br />
Württemberg findet statt am<br />
Samstag, 23. Juli 2016, 10.00 Uhr<br />
bis 16.00 Uhr, in Stuttgart, Hotel<br />
Maritim.<br />
Die Tagesordnung wird auf Anforderung<br />
übermittelt. Die Kammermitglieder<br />
werden hiermit zur<br />
Vertreterversammlung eingeladen.<br />
Im Falle einer Teilnahme wird<br />
eine vorherige Anmeldung bei der<br />
LZK-Geschäftsstelle aus organisatorischen<br />
Gründen (per Fax: 07 11<br />
/ 2 28 45 40 oder Mail: falk@lzkbw.de)<br />
erbeten.<br />
Für den Fall, dass die o. g. Vertreterversammlung<br />
beschlussunfähig<br />
ist, wird bereits heute zu<br />
einer 2. Vertreterversammlung<br />
über dieselben Gegenstände eingeladen.<br />
Diese findet statt am Samstag,<br />
23. Juli 2016, 10.30 Uhr bis 16.30<br />
Uhr in Stuttgart, Hotel Maritim.<br />
Dr. Udo Lenke<br />
Präsident<br />
Weiterbildungsstätte<br />
Nach § 35 des Heilberufe-Kammergesetzes<br />
i. V. m. §§ 9 und 11<br />
der Weiterbildungsordnung wurde<br />
folgendes Kammermitglied zur<br />
Weiterbildung ermächtigt:<br />
Oralchirurgie<br />
Dr. med. Dr. med. dent.<br />
Matthias Karallus<br />
Zeppelinring 1<br />
88400 Biberach<br />
Dr. med. dent. Jörg Kälber<br />
Waiblinger Straße 7<br />
70372 Stuttgart<br />
Friedrich Michael Eiche<br />
Waiblinger Straße 7<br />
70372 Stuttgart<br />
Die anerkennungsfähige Weiter-bildungszeit<br />
beträgt gem. § 24 Abs. 1<br />
und Abs. 4 der Weiterbildungsordnung<br />
2 Jahre.<br />
Verlust von<br />
Zahnarztausweisen<br />
Die Ausweise von<br />
Dr. Susanna Isabel Richter<br />
Stühlinger Str. 19<br />
79106 Freiburg<br />
Geb. 04.09.1983<br />
Ausweis: 7.6.13<br />
wurden verloren, gestohlen beziehungsweise<br />
nicht zurückgegeben<br />
und werden für ungültig erklärt.<br />
Landeszahnärztekammer Baden-<br />
Württemberg mit den Bezirkszahnärztekammern<br />
BZK Freiburg<br />
Merzhauser Str. 114-116<br />
79100 Freiburg<br />
Tel.: (07 61) 45 06-0<br />
Fax: (07 61) 45 06-450<br />
BZK Karlsruhe<br />
Joseph-Meyer-Str. 8 – 10<br />
68167 Mannheim<br />
Tel.: (06 21) 3 80 00-0<br />
Fax: (06 21) 3 80 00-1 70<br />
BZK Stuttgart<br />
Albstadtweg 9<br />
70567 Stuttgart<br />
Tel.: (07 11) 78 77-0<br />
Fax: (07 11) 78 77-238<br />
BZK Tübingen<br />
Bismarckstr. 96<br />
72072 Tübingen<br />
Tel.: (0 70 71) 9 11-0<br />
Fax: (0 70 71) 9 11-209/233<br />
Anzeige<br />
Besitzen Sie Alt-, Zahn-, Bruchgold, Schmuck,<br />
Münzen, Feilungen, Gussstücke und<br />
Gekrätz in beliebiger Form und Größe?<br />
Wir kaufen sämtliche Arten von Scheidegut und Dental-Legierungen. 100% diskret, seriös und<br />
sicher seit über 20 Jahren in Luxembourg. Eine exakte Bestimmung des Feingehalts wird dabei<br />
ausschließlich von einer unabhängigen Scheideanstalt in D-Pforzheim durchgeführt. Die Abrechnung<br />
erfolgt dann auf Wunsch in Bar oder als Überweisung nach den ermittelten Feingehalten<br />
der wertrelevanten Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium zum besten Tageskurs.<br />
Reprodent LU Sàrl · 300 C route de Thionville · L-5884 Howald-Hesperange<br />
Tel.: 00352/295 995 1 · info@reprodent.net · www.reprodent.net<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
54<br />
Personalia<br />
Buchtipp<br />
25-jähriges Dienstjubiläum<br />
Ehrung für Cäcilia Falk<br />
10 Jahre Master-Network<br />
Praxisforschung<br />
Foto: Mader<br />
Dienstjubiläum. Zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum konnte Cäcilia Falk auch die<br />
Glückwünsche des Direktors der LZK BW, Axel Maag entgegennehmen.<br />
Die geschäftsführende Sekretärin<br />
der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg, Cäcilia Falk,<br />
feiert ihr 25-jähriges Dienstjubiläum.<br />
Am 1. Mai 1991 hat sie ihre<br />
Tätigkeit bei der Kammer unter dem<br />
damaligen Direktor Johann Glück<br />
aufgenommen. Ihr Aufgabenbereich<br />
umfasste neben der zahnärztlichen<br />
Weiterbildung auf den Fachgebieten<br />
Kieferorthopädie und Oralchirurgie<br />
auch die Kenntnisprüfungen für ausländische<br />
Zahnärztinnen und Zahnärzte<br />
sowie die Betreuung mehrerer<br />
Ausschüsse. Zugleich gehörte es zu<br />
Anzeige<br />
ihren Aufgaben, die Geschäftsstelle<br />
des Landesberufsgericht für Zahnärzte<br />
als verantwortliche Sekretärin<br />
zu betreuen. Die Geschäftsstelle der<br />
Landeszahnärztekammer Baden-<br />
Württemberg befand sich damals<br />
noch im gleichen Gebäude wie das<br />
Zahnmedizinische Fortbildungszentrum<br />
Stuttgart, im Herdweg 50 in<br />
Stuttgart.<br />
Seit 2009 bekleidet Cäcilia Falk<br />
das Geschäftsführende Sekretariat<br />
der LZK unter dem jetzigen Direktor<br />
der Kammer, Axel Maag.<br />
» mader@lzk-bw.de<br />
Manche lassen ihr<br />
ganzes Leben zurück.<br />
Um es zu behalten.<br />
Wir unterstützen Menschen, die auf der Flucht<br />
sind, damit sie ein Leben in Würde führen können.<br />
brot-fuer-die-welt.de/fluechtlinge<br />
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00<br />
Die Mitglieder einer Profession müssen<br />
ihre Position und ihre Bedeutung<br />
in der Gesellschaft ständig reflektieren<br />
und neu bestimmen. Die Zahnärzteschaft<br />
versteht sich als Profession,<br />
als ein besonderer Berufsstand,<br />
der dem Gemeinwohl verpflichtet ist<br />
und die grundsätzlichen Probleme<br />
der eigenen Berufsausübung selbst<br />
erkennt und löst. Fort- und Weiterbildung<br />
im Sinne des lebenslangen<br />
Lernens ist ein wichtiges Mittel dafür.<br />
Dieses Buch dokumentiert Forschungsarbeiten,<br />
die im Rahmen<br />
des Masterstudiengangs „Integrated<br />
Practice in Dentistry“ entstanden<br />
sind. Die Autoren sind Zahnärztinnen<br />
und Zahnärzte, die über den Tellerrand<br />
ihrer unmittelbaren beruflichen<br />
Tätigkeit hinausgeschaut und empirisch<br />
geforscht haben. Entstanden ist<br />
ein vielfältiges, glaubwürdiges und<br />
zur kritischen Diskussion herausforderndes<br />
Bild der Profession „Zahnmedizin“<br />
in unserer Gesellschaft. IZZ<br />
Simone Ulbricht, Michael Dick &<br />
Winfried Walther (Hrsg.)<br />
Praxisforschung und<br />
Professionsentwicklung<br />
in der Zahnmedizin<br />
10 Jahre Master-Network<br />
Integrated Dentistry e. V.<br />
Pabst Science Publishers<br />
1. Auflage 2016<br />
ISBN 978-3-95853-201-4<br />
30 Euro<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Personalia<br />
Nachruf<br />
Dr. Klaus Baumeister<br />
Tief betroffen haben wir vom Tod<br />
von Herrn Kollegen Dr. Klaus<br />
Baumeister erfahren, der im Alter<br />
von 88 Jahren am 20.05.2016 verstarb.<br />
Kollege Baumeister wurde im<br />
Jahr 1927 in Waibstadt geboren,<br />
nahm 1949 das Studium der Zahnheilkunde<br />
auf und eröffnete 1954<br />
seine zahnärztliche Praxis in<br />
Mannheim, die er bis 1998 führte.<br />
Am Ende seiner vertragszahnärztlichen<br />
Tätigkeit 1998 konnte<br />
Kollege Baumeister auch auf eine<br />
mehr als 40-jährige berufliche und<br />
ehrenamtliche Tätigkeit in den<br />
Gremien der Selbstverwaltungen<br />
des zahnärztlichen Berufsstandes<br />
zurückblicken.<br />
Er war Mitglied in den Vertreterversammlungen<br />
der Kassenzahnärztlichen<br />
Vereinigung Nordbaden,<br />
der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg, im Haushalts-<br />
und Kassenprüfungsausschuss<br />
der KZV Nordbaden, Vorsitzender<br />
des Umlageausschusses<br />
der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg und Mitglied<br />
weiterer Gremien der Selbstverwaltungsorgane.<br />
Besondere Verdienste hatte sich<br />
Kollege Baumeister durch seinen<br />
Weitblick beim Aufbau der Organisation<br />
und der Einführung des<br />
Mannheimer zentralen Notfalldienstes<br />
im Heinrich-Lanz-Krankenhaus<br />
erworben.<br />
Aufgrund seines besonderen<br />
Engagements für den zahnärztlichen<br />
Berufsstand wurde Kollege<br />
Baumeister 1983 die Ehrennadel<br />
der Deutschen Zahnärzteschaft<br />
und 1987 der Verdienstorden der<br />
Bundesrepublik Deutschland verliehen.<br />
Wir werden unseren Kollegen<br />
Herrn Dr. Klaus Baumeister ein<br />
ehrendes Andenken bewahren.<br />
Dr. Uwe Lückgen, Vorsitzender<br />
der Bezirksgruppe Karlsruhe<br />
ZBW 7/2016<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Zu guter Letzt 59<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Dr. Udo Lenke, Präsident der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg (LZK BW), und Dr. Ute Maier,<br />
Vorsitzende des Vorstands der Kassenzahnärztlichen<br />
Vereinigung Baden-Württemberg (KZV BW), für das<br />
Informationszentrum Zahngesundheit Baden-Württemberg<br />
– eine Einrichtung der LZK BW und KZV BW.<br />
Redaktion:<br />
Johannes Clausen, HC (ChR, verantw.)<br />
Informationszentrum Zahngesundheit<br />
Baden-Württemberg<br />
Telefon: 0711/222 966-10<br />
E-Mail: johannes.clausen@izz-online.de<br />
Andrea Mader (am),<br />
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg<br />
Telefon: 0711/228 45-29<br />
E-Mail: mader@lzk-bw.de<br />
Guido Reiter (gr),<br />
Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg<br />
Telefon: 0711/78 77-220<br />
E-Mail: guido.reiter@kzvbw.de<br />
Redaktionsassistenz: Gabriele Billischek<br />
Layout: Gabriele Billischek, Sandra Limley-Kurz<br />
Anschrift der Redaktion:<br />
Informationszentrum Zahngesundheit Baden-<br />
Württemberg, Königstraße 26, 70173 Stuttgart<br />
Telefon: 0711/222 966-14<br />
Telefax: 0711/222 966-21<br />
E-Mail: info@zahnaerzteblatt.de<br />
Autoren dieser Ausgabe: Dr. Anke Bräuning,<br />
Johannes Clausen, Christian Ignatzi, Dr. Bernhard<br />
Jäger, Dorothea Kallenberg, Prof. Dr. Ulrich Keller,<br />
Dr. Uwe Lückgen, Andrea Mader, Prof. Dr. Jürgen<br />
Manhart, Rocco Nemitz, Stefan Oschmann, Claudia<br />
Richter, Ruth Schildhauer, Dr. Thomas Schilling,<br />
Gabriele Schluchter, Dr. Klaus Sebastian, Dr. Carsten<br />
Ullrich, Prof. Dr. Winfried Walther.<br />
Titelseite: Foto: Fotolia<br />
Verantwortlich für Amtliche Mitteilungen der<br />
Kassenzahnärztlichen Vereinigung<br />
Baden-Württemberg (KZV BW):<br />
Dr. Ute Maier, Vorsitzende des Vorstands der<br />
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-<br />
Württemberg (KZV BW), KdöR<br />
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart<br />
Verantwortlich für Amtliche Mitteilungen der<br />
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg<br />
(LZK BW):<br />
Dr. Udo Lenke, Präsident der<br />
Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg (LZK BW), KdöR<br />
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart<br />
Hinweise: Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe<br />
gekürzt zu veröffentlichen. Ein Anspruch auf<br />
Veröffentlichung besteht nicht. Bei Einsendungen an<br />
die Redaktion wird der vollen oder auszugsweisen<br />
Veröffentlichung zugestimmt.Unaufgefordert<br />
eingegangene Fortbildungsmanus-kripte können<br />
nicht veröffentlicht werden, da die Redaktion<br />
nur mit wissenschaftlichen Autoren vereinbarte<br />
Fortbildungsbeiträge veröffentlicht. Alle Rechte an<br />
dem Druckerzeugnis, insbesondere Titel-, Namensund<br />
Nutzungsrechte etc., stehen ausschließlich den<br />
Herausgebern zu. Mit Annahme des Manuskripts<br />
zur Publikation erwerben die Herausgeber das<br />
ausschließliche Nutzungsrecht, das die Erstellung von<br />
Fort- und Sonderdrucken, auch für Auftraggeber aus<br />
der Industrie, das Einstellen des ZBW ins Internet, die<br />
Übersetzung in andere Sprachen, die Erteilung von<br />
Abdruckgenehmigungen für Teile, Abbildungen oder<br />
die gesamte Arbeit an andere Verlage sowie Nachdrucke<br />
in Medien der Herausgeber, die fotomechanische<br />
sowie elektronische Vervielfältigung und die<br />
Wiederverwendung von Abbildungen umfasst. Dabei ist<br />
die Quelle anzugeben. Änderungen und Hinzufügungen<br />
zu Originalpublikationen bedürfen der Zustimmung des<br />
Autors und der Herausgeber.<br />
Verantwortlich für den Anzeigenteil:<br />
Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH<br />
Zülpicher Str. 10<br />
40196 Düsseldorf<br />
Reiner Hoffmann<br />
Telefon: 02 11/505-27 875<br />
E-Mail: hoffmann@rp-media.de<br />
Die Seite Produktinformationen fällt in den<br />
Verantwortungsbereich Anzeigen, sie ist nicht Teil der<br />
Redaktion.<br />
Bezugspreis:<br />
Jahresabonnement inkl. MwSt. € 90,–,<br />
Einzelverkaufspreis inkl. MwSt. € 7,50.<br />
Bestellungen werden vom Verlag entgegengenommen.<br />
Die Kündigungsfrist für Abonnements beträgt 6 Wochen<br />
zum Ende des Bezugszeitraumes. Für die Mitglieder der<br />
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg ist der<br />
Bezugspreis mit dem Mitgliedsbeitrag abgegolten.<br />
Verlag und Herstellung:<br />
Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH<br />
Geschäftsführer: Dr. Karl Hans Arnold, Patrick Ludwig,<br />
Hans Peter Berk, Johannes Werle, Stephan Marzen<br />
Zülpicher Str. 10<br />
40196 Düsseldorf<br />
Telefon: 02 11/505-24 99<br />
Fax: 02 11/505-10 02 499<br />
E-Mail: kundenmagazine@rheinische-post.de<br />
Internet: www.rp-media.de<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 7/2016
60<br />
Produktanzeigen<br />
Presseinformationen<br />
KONSERVIERENDE ZAHNHEILKUNDE: Seitenzahnkomposit<br />
„Zahn-Art“ und „Zahn-hart“ auch im Seitenzahnbereich –<br />
Das richtige Komposit-System macht’s möglich: ENAMEL plus HRi Function<br />
Autor: Dr. Markus Th. Firla, WeCoMed GmbH<br />
Mit ENAMEL plus HRi Function (Micerium,<br />
Vertrieb Loser Leverkusen) steht dem Zahnarzt<br />
ein Restaurationswerkstoff für den<br />
Einsatz im Seitenzahnbereich zur Verfügung,<br />
mit dem je nach klinischem Fall und<br />
Anspruch des Patienten, respektive den „ästhetischen<br />
Restaurationskonzepten“ des Behandlers<br />
keine ästhetischen Kompromisse<br />
eingegangen werden müssen.<br />
Der vom Autor bereits vor über 20 Jahren für<br />
ästhetisch überzeugend wirkende adhäsive<br />
Komposit-Restaurationen verwendete Begriff der<br />
„Biomimetik“ (Perfekte Nachahmung lebender<br />
Prozesse oder Strukturen) gilt für das hier betrachtete<br />
Komposit in besonderer Weise. Hauptsächlich<br />
die Schmelzmasse ENAMEL HRi plus<br />
Function weist dieselben lichtoptischen Eigenschaften<br />
auf wie die bereits bekannten Restaurationswerkstoffe<br />
aus diesem Komposit-System.<br />
Die natürlichem Zahnschmelz ähnliche Härte<br />
und das ebenfalls vergleichbare Abrasionsverhalten<br />
von ENAMEL plus HRi Function eröffnen<br />
die uneingeschränkte Möglichkeit, Okklusalflächen<br />
nicht nur füllungstechnisch wiederherstellend,<br />
sondern auch CMD-therapeutisch funktionell<br />
– im Rahmen restaurativer Aufbaufüllungen<br />
– zu versorgen.<br />
Der hier exemplarisch dargestellte klinische Behandlungsfall<br />
soll zeigen, dass eine hochwertige<br />
Komposit-Füllung im okklusalen Seitenzahnbereich<br />
durchaus auch ausgefallene ästhetische<br />
Aspekte berücksichtigen kann, ohne dass die<br />
werkstoffkundliche und zahnärztliche Zuverlässigkeit<br />
zu kurz kommen müssen.<br />
Die Verwendung eines geeigneten fließfähigen<br />
Komposit-Materiales als Unterfüllung, wie ENA-<br />
MEL HRi Plus Flow HF (hier in Farbton A1), ist<br />
nach Meinung des Autors als Standardverfahren<br />
anzusehen. Zum einen weil eine zuverlässige<br />
Versiegelung des Dentins am Kavitätenboden<br />
bewirkt wird und zum anderen fließt ein<br />
„Flowable-Komposit“ mit geeigneter Viskosität<br />
und zweckmäßiger Adaptionsfähigkeit ideal in<br />
den unteren Kavitätenbereich ein. Hierdurch ist<br />
es möglich Teilmatrizen zusätzlich von innerhalb<br />
der Kavität zu stützen und zu sichern.<br />
Anatomisch vorgeformte Sektional-Matrizen<br />
gewährleisten eine ideale Rekonstruktion der<br />
physiologischen Zahnmorphologie, sind aber<br />
in Abhängigkeit der supra- und subgingivalen<br />
Ausdehnung des Zahnschadens mit Bedacht zu<br />
platzieren und für den Füllungsvorgang zu stabilisieren.<br />
Ganz besonders gilt dies, wenn das<br />
Einbringen der oberen Deckfüllung mit pastösen<br />
(stopfbaren) Komposit-Materialien vorgenommen<br />
wird. Im hier gezeigten Fall wurden drei<br />
verschiedene Teilmatrizen-Systeme herangezogen,<br />
bis der hier erfolgversprechende Kompromiss<br />
aus dünner, aber formstabiler, interdental<br />
eindeutig sicher positionierbarer und anatomisch<br />
korrekter Teilmatrizen-Eigenschaft erzielt werden<br />
konnte.<br />
Als Komposit für die oberflächlich abdichtende<br />
Deckfüllung wurde im zweizeitigen, aufeinander<br />
folgenden (adhäsiven) Schichtungsverfahren<br />
UD3 und EF3 des Seitenzahn-Komposites<br />
verwendet. Der Füllungsvorgang lässt sich mit<br />
diesen pastösen Kompositen recht einfach und<br />
schnell vollziehen.<br />
Direkte adhäsive Komposit-Restaurationen<br />
können betriebswirtschaftlich betrachtet sinnvollerweise<br />
– sowohl bei gesetzlich Krankenversicherten,<br />
als auch bei Privatpatienten – nur<br />
mit einem höheren Rechnungsbetrag für diese<br />
Extra-Leistung verbunden sein. Bei ersteren im<br />
Rahmen einer privaten Zuzahlung zu der durch<br />
den BEMA gesetzlich gewährten Grundleistung<br />
der okklusalen Seitenzahnfüllung; bei letzteren<br />
auf der Basis einer begründeten Erhöhung des<br />
durchschnittlichen Gebührensatzes über den<br />
2,3fachen Faktor gemäß GOZ § 5 Abs. 2 oder<br />
– im Ausnahmefall, wenn der Steigerungsfaktor<br />
über das 3,5-Fache gelegt werden muss, gemäß<br />
GOZ § 2 Abs. 1 bis 3.<br />
Denn hochwertige Kunst, hier als „Zahn-Art“<br />
zu sehen, hat und hatte schon immer auch ihren<br />
Preis. Gerade dann, wenn derartige Werke<br />
nicht nur in ästhetischer Hinsicht, sondern auch<br />
handwerklich zeitlos Bestand haben, wie diese<br />
mit hochwertigen Materialien ausgeführte Seitenzahn-Füllung.<br />
Abbildung 1: Der<br />
Universal-Komposit-<br />
Spritzenwärmer<br />
(ENA HEAT, Micerium)<br />
zur vorübergehenden<br />
thermischen<br />
Viskositätsreduzierung<br />
von pastösen<br />
Kompositen ist kein<br />
extravagantes Spielzeug,<br />
sondern effizientes<br />
Hilfsmittel für das „geschmeidige“ Einbringen<br />
stopfbarer Komposite auch in kleinste und komplex<br />
gestaltete Kavitäten.<br />
Abbildung 2: Eingangsbefund eines zu versorgenden<br />
unteren zweiten Prämolaren. Der Patient wünscht<br />
eine nicht als Füllung zu erkennende direkte Komposit-Restauration.<br />
Abbildung 3: Der tiefgreifende Defekt erforderte den<br />
Einsatz einer speziellen Teilmatrize. Zur „inneren Matrizen-Stabilisierung“<br />
und als leicht einfließbares, den<br />
Kavitätenboden sicher versiegelndes Unterfüllungsmaterial<br />
wurde Enamel plus HRi Flow HF (A1) verwendet.<br />
Abbildung 4: Mit verschiedenen Silikon-Modellierspitzen<br />
(die auf ein Metall-Instrument aufgesteckt<br />
werden) lässt sich das Komposite ENAMEL plus HRi<br />
Function sehr leicht einbringen und mühelos anatomisch<br />
gerecht gestalten.<br />
Abbildung 5: Ebenso ist es dem ästhetischen Empfinden<br />
des Patienten und des Behandlers überlas-sen,<br />
wie viel „künstlerische Verfeinerung“ (ZahnArt) in eine<br />
solche Restauration einfließen darf. Mit Malfarben, wie<br />
ENAMEL plus HFO (Dark-Brown), ist alles möglich.<br />
Abbildung 6: Die endgültig fertig gestellte direkte „biomimetische“<br />
Komposit-Füllung: Wieviel „ZahnArt“ eine<br />
derartige Restauration erfordert ist sicher diskutierbar.<br />
– Dem Patienten jedenfalls gefällt die „nicht ganz weiße,<br />
natürlich wirkende Füllung“ großartig… Und dem<br />
Zahnarzt hat das Legen auch noch Spaß gemacht!<br />
Die Beiträge dieser Rubrik beruhen auf Informationen der Hersteller und geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.<br />
www.zahnaerzteblatt.de
Partner des Zahnarztes<br />
Studienplatz Medizin und Zahnmedizin<br />
Studienberatung und NC-Seminare. Unser Ziel:<br />
Ohne ZVS schnell ins Studium (Medizin, Zahnmedizin,<br />
Tiermedizin, Biologie, Psychologie).<br />
Vorbereitung für Auswahlgespräche und Medizinertest.<br />
Info und Anmeldung:<br />
Verein der NC-Studenten e.V. (VNC)<br />
Argelanderstraße 50 • 53115 Bonn<br />
Telefon (02 28) 21 53 04 • Fax 215900<br />
STUDIUM IM EU-AUSLAND<br />
Zahn-, Tier, & Humanmedizin<br />
ohne NC & Wartezeit für Quereinstieg<br />
MediStart-Agentur | deutschlandweit<br />
www.medistart.de * Tel. (040) 413 436 60<br />
Mehr Zahnarzt -<br />
weniger Steuern!<br />
Beck · Schick · Lauk<br />
S t e u e r b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t<br />
Daimlerstr. 21 · 70372 Stuttgart · (07 11) 95 48 88 - 0 · Steuer@bslk.de · www.bslk.de<br />
Anerkannt und zertifiziert als Fachberater für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH)<br />
Ein Liquiditätsmangel kann überraschend<br />
auftreten und dann schwerwiegende Folgen<br />
haben. Wir führen für Zahnärzte<br />
eine klare Liquiditätsplanung<br />
durch, so dass alle Ausgaben<br />
rechtzeitig bekannt sind und<br />
bezahlt werden können.<br />
Liquidität schafft<br />
Sicherheit.<br />
ÄRZTE- UND<br />
ZAHNÄRZTE-<br />
BERATUNG<br />
Seit 1994<br />
KLAUS VOSSLER STEUERBERATUNG FÜR ZAHNÄRZTE<br />
Kesselstraße 17 • 70327 Stuttgart • Tel. 0711/40703060 • www.stb-vossler.de<br />
ANWALTSKANZLEI<br />
DR. REICHERT & KOLLEGEN<br />
ZAHNARZTRECHT<br />
Beratung bei allen<br />
Problemen einer Zahnarztpraxis.<br />
Praktische Erfahrung<br />
(Ehefrau Zahnärztin) und<br />
juristischer Schwerpunkt.<br />
Z. B. Vertragsgestaltungen bei Berufsausübungsgemeinschaften<br />
– Vertragszahnarztrecht<br />
– Standesrecht – Arbeitsverträge.<br />
Am Froschbächle 16 · 77815 Bühl<br />
Tel. 07223/949 10 · Fax 07223/949 191<br />
E-mail: kanzlei@reichert-recht.de<br />
www.reichert- zahnarztrecht.de<br />
KOMPETENZ DURCH FORTBILDUNG<br />
Praxisabgabe<br />
GÖPPINGEN<br />
Langjährige Praxis, 3–4 Zi.,<br />
Geschäftshaus in Toplage altershalber,<br />
vollbetriebsbereit, kurz-/<br />
mittelfristig abzugeben. Miete<br />
o. Kauf der Immo. (150 qm).<br />
E-Mail: thomlag@web.de<br />
umsatzstarke Praxis mit<br />
überdurchschn. Gewinn -<br />
süd-westl. Raum Stuttg.<br />
4 BHZ, hohes EW/ZA-<br />
Verhältnis, eingespieltes<br />
Personal, zentrale Lage,<br />
Immobilie auf Wunsch,<br />
THP 089 278130 -0 /Fax -13<br />
Für alle Krisenherde<br />
außerhalb Ihrer Küche.<br />
Spendenkonto: 41 41 41 · BLZ: 370 205 00 · DRK.de<br />
Eines für alle …<br />
CW/FDS Landpraxis<br />
Langjähr. Praxis, 3 Beh.-Zi.,<br />
110 qm, voll funktionsfähig,<br />
Dig.-Rö., ab Januar 2017<br />
abzugeben.<br />
Miete o. Kauf d. Räume<br />
E-Mail: Praxis53@gmx.de<br />
»Dauerhafte Hilfe<br />
hat einen Namen. Meinen!«<br />
Malteser Stiftung<br />
GE P R ÜF TE R<br />
S T IF T UN GS T R E UH ÄNDE R<br />
DE U T S C H E R<br />
10|2014-9|2017<br />
S T IF T U N GS S E R V IC E<br />
Mit einer eigenen Stiftung oder Zustiftung helfen sie dauerhaft Menschen in Not.<br />
Wir beraten Sie gerne!<br />
Michael Görner: (02 21) 98 22-123 | stiftung.malteser@malteser.org | www.malteser-stiftung.de<br />
objektiv - unabhängig –neutral<br />
• Businessplan –Finanzplanung<br />
• Controlling –Analyse<br />
• Finanzierung –öffentl. Fördermittel<br />
• Kooperationsformen / -modelle<br />
• Praxisbewertung<br />
H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH<br />
Kesselstraße 17 I70327 Stuttgart Iwww.hug-beratung.de |Fon 0711 -248 97 73
Stellenangebot<br />
Kreis Ludwigsburg<br />
Angest. ZÄ/ZA gesucht. Spät. Teilhabersch. möglich.<br />
www.Dr.Noffke.de<br />
Sonstiges<br />
Der richtige Partner …<br />
…immer für Sie da.<br />
– Umfangreiches Sortiment an Materialien, Instrumenten, Geräten<br />
– Beratung produktneutral –Praxisneugründung<br />
– Techn. Service inkl. Notdienst –Praxisübergabevermittlung<br />
–Praxisplanung<br />
– umfassendes Veranstaltungsprogramm<br />
Als Mitglied der Dental-Union stehen uns die Vorteile von Europas<br />
größtem Zentrallager imDentalhandel zur Verfügung.<br />
Interessante Aktionsangebote, Praxisübernahmen und<br />
Neugründungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage.<br />
Werbung gibt’s<br />
an jeder Ecke.<br />
Blut nicht.<br />
Fritz-Frey-Straße 16·69121 Heidelberg<br />
Tel.06221-47920·Fax 06221-479260<br />
info@funckdental.de ·www.funckdental.de<br />
Termine und Infos 0800 11 949 11 oder www.DRK.de<br />
Anzeigen-Bestellschein für private Gelegenheitsanzeigen im Zahnärzteblatt Baden-Württemberg<br />
rheinland RP Neusser MediaDruckerei media Service & GmbH kommunikation und Verlag GmbH gmbh Tel: Tel.: 0211/505-27875, 02131/4 0211-56904-133, 731-20, Fax: 0211/505-100 02131/4 0211-569 04-424 731-10 27875<br />
Anzeigenverkauf AnzeigenabteilungReiner Stefanie Hoffmann Bohlmann Zülpicher Monschauer Moselstr. 14, Straße Str. 41464 10, 1, 40549 40196 Neuss, Düsseldorf, E-Mail: zbw@ndv.de<br />
E-Mail: zbw@rheinland-mk.de<br />
Hoffmann@rp-media.de<br />
Folgender Text soll erscheinen<br />
❏ im nächst erreichbaren Heft ❏ in Heft<br />
Textformat: Mindesthöhe 30 mm.<br />
❏ 1-spaltig (43 mm breit)<br />
❏ 2-spaltig (90 mm breit)<br />
in der Rubrik<br />
❏ Stellengesuche<br />
❏ Stellenangebote<br />
❏ Praxis-Übernahme,<br />
-Abgabe, -Gemeinschaft<br />
❏ Kaufen/Verkaufen<br />
❏ Immobilien-Vermietung/<br />
-Verpachtung/-Verkauf<br />
❏ Seminare<br />
❏ Sonstiges<br />
€ 1,42/mm<br />
}€ 1,73/mm<br />
Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben<br />
Zusatzangaben:<br />
❏ unter Chiffre € 11,90 (Achtung: Texte ohne Angabe von Adresse oder Telefonnummer erscheinen grundsätzlich mit Chiffre!)<br />
Alle Preise einschl. 19% MwSt.<br />
Bitte unbedingt ausfüllen:<br />
Die Veröffentlichung Ihrer Anzeige kann nur per Lastschrift erfolgen.<br />
SEPA-Lastschriftmandat: Ichermächtige die RP Media Service GmbH, Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf, Gläubiger-Identifikationsnummer<br />
DE66 3007 0010 0379 6851 00, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise<br />
ich mein Kreditinstitut an, die von der RP Media Service GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.<br />
Name:<br />
Vorname:<br />
Straße:<br />
PLZ, Ort:<br />
Telefon (tagsüber):<br />
Geldinstitut:<br />
Bankleitzahl:<br />
BIC/SWIFT:<br />
Konto-Nr.: IBAN:<br />
Kontoinhaber:<br />
Datum:<br />
Unterschrift:
Ein<br />
Loch<br />
im<br />
Meer<br />
21.5.<br />
–21.8.<br />
2016<br />
Schlossplatz 2<br />
D-70173 Stuttgart<br />
Di, Do – So: 11–18 Uhr<br />
Mi: 11– 20Uhr<br />
www.wkv-stuttgart.de<br />
Zbyně k Baladrán, George Brecht,<br />
Matthew Buckingham, Annalisa Cannito,<br />
Chen Chieh-jen, Tacita Dean, Barry Flanagan,<br />
Sven Johne, Quinn Latimer, Zoe Leonard,<br />
Pia Linz, Hew Locke, László Moholy-Nagy,<br />
Mehreen Murtaza, Jean Painlevé, Lisa Rave,<br />
Julia Rometti / Victor Costales, Cristian Rusu<br />
Matthew Buckingham, Muhheakantuck. Everything Has a Name, 2003<br />
Courtesy: Matthew Buckingham, Daniel Marzona, Berlin und / and Murray Guy, New York
Internationaler<br />
Jahreskongress der DGZI<br />
30. September und<br />
1. Oktober 2016<br />
München | The Westin Grand München<br />
Wie viel Ästhetik<br />
braucht die<br />
Implantologie?<br />
Begrenzte Plätze und<br />
Hotelkontingente!<br />
Wissenschaftliche Leiter:<br />
Prof. Dr. Herbert Deppe<br />
Prof. (CAI) Dr. Roland Hille<br />
dgzi-jahreskongress.de<br />
Goldsponsor Silbersponsor Bronzesponsor<br />
FAXANTWORT | +49 341 48474-290<br />
Bitte senden Sie mir das Programm zum<br />
46. Internationalen Jahreskongress der DGZI<br />
am 30. September und 1. Oktober 2016 in München zu.<br />
Praxis-/Laborstempel<br />
Datum/Unterschrift<br />
E-Mail-Adresse (Bitte angeben!)