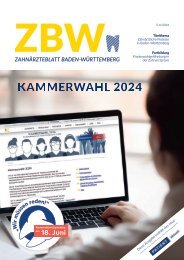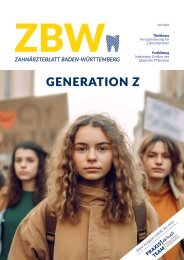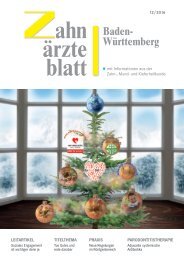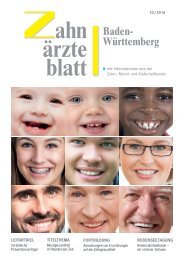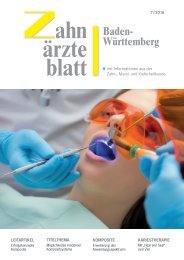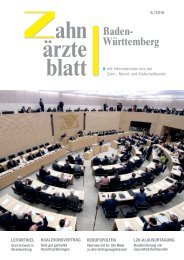Zukunftsvisionen
Ausgabe 7/2023
Ausgabe 7/2023
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ZBW<br />
ZAHNÄRZTEBLATT BADEN-WÜRTTEMBERG<br />
7/2023<br />
Titelthema<br />
Zwischen Chancen<br />
und Kontroversen<br />
Fortbildung<br />
Lichtpolymerisation:<br />
Update und Optimierung<br />
Diese Ausgabe enthält das neue
LESEN SIE DAS ZBW BEQUEM VON ÜBERALL<br />
Mit der digitalen Ausgabe des ZBW stehen Ihnen<br />
alle Artikel uneingeschränkt und ganz bequem<br />
auf Ihrem Smartphone, Tablet oder jedem anderen<br />
Endgerät zur Verfügung.<br />
So einfach geht’s<br />
Schreiben Sie uns eine E-Mail an<br />
info@zahnaerzteblatt.de und bestellen Sie das<br />
ZBW online oder tragen Sie sich auf unserer<br />
Website www.zahnaerzteblatt.de in das Formular<br />
für die Online-Ausgabe ein.<br />
• 70020 Stuttgart<br />
info@zahnaerzteblatt.de •<br />
Wollen Sie auf die gedruckte<br />
Version des ZBW verzichten,<br />
bestellen Sie die Printausgabe<br />
bitte bei Ihrer zuständigen<br />
Bezirkszahnärztekammer ab:<br />
BZK Freiburg<br />
Tel. 0761 4506-343<br />
BZK Karlsruhe<br />
Tel. 0621 38000-227<br />
BZK Stuttgart<br />
Tel. 0711 7877-236<br />
BZK Tübingen<br />
Tel. 07071 911-230
ZBW_07/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
3_EDITORIAL<br />
Foto: istock/Devrimb<br />
Foto: Michael Bamberger<br />
TITELTHEMA<br />
<strong>Zukunftsvisionen</strong> in der Zahnmedizin heißt unser aktuelles<br />
Titelthema und bei der Recherche dazu befanden wir uns in<br />
bester Gesellschaft. Aktuell beschäftigen sich nahezu alle Medien<br />
mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI). Die Zahnmedizin<br />
hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant weiterentwickelt,<br />
und es ist kein Ende dieses Fortschritts in Sicht. Eine<br />
der spannendsten <strong>Zukunftsvisionen</strong> ist zweifellos der Einsatz<br />
von Chatbots und KI in der zahnmedizinischen Praxis. Doch<br />
während diese Technologien mit Sicherheit ihr Potenzial haben,<br />
bleibt eines klar: Künstliche Intelligenz wird niemals die<br />
menschliche Intelligenz und vor allem deren Einfühlungsvermögen<br />
ersetzen. Chatbots und KI-Systeme haben bereits in<br />
vielen Bereichen Einzug gehalten und effiziente Lösungen für<br />
verschiedenste Aufgabenstellungen geboten. Und angesichts<br />
des Fachkräftemangels werden wir wohl auch nicht umhinkommen,<br />
diese Möglichkeiten vollumfänglich auszuschöpfen.<br />
Auf den folgenden Seiten haben wir uns diesem Thema<br />
von verschiedenen Seiten genähert und dabei eine Zusammenstellung<br />
der unterschiedlichen Aspekte für Sie zusammengetragen.<br />
Unser Fazit nach der Erstellung des Heftes: Die<br />
<strong>Zukunftsvisionen</strong> in der Zahnmedizin sind aufregend und<br />
vielversprechend. Die Fortschritte in der KI und Technologie<br />
werden zweifellos neue Möglichkeiten eröffnen. Dennoch<br />
dürfen wir nicht vergessen, dass das Herzstück der Zahnarztpraxis<br />
das Einfühlungsvermögen des*der menschlichen<br />
Zahnarztes*ärztin bleibt und immer unersetzlich sein wird,<br />
um eine ganzheitliche und patientenzentrierte Versorgung zu<br />
gewährleisten.<br />
RUST<br />
Zur 47. Jahrestagung der südbadischen Zahnärzt*innen unter<br />
der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Elmar Hellwig,<br />
Freiburg, kamen Mitte April renommierte Referent*innen aus<br />
der Schweiz und Deutschland nach Rust. Unter dem Titel<br />
„Prävention, Reparatur und Regeneration – Bausteine einer<br />
minimalinvasiven Zahnmedizin“ erwartete die über 2000 Teilnehmer*innen<br />
ein praxisbezogenes und vielseitiges Fortbildungsprogramm.<br />
Auch das Thema KI wurde im Rahmen des<br />
Kongresses behandelt: Prof. Dr. Falk Schwendicke von der Berliner<br />
Charité stellte neueste Diagnostiksysteme des Kariesmanagements<br />
vor, die auf Basis einer KI angelegt sind. Den<br />
ausführlichen Bericht hierzu finden Sie ab Seite 30 ff.<br />
Der Festvortrag von Prof. Dr. Jutta Rump bildete umfassend<br />
und äußerst informativ ab, welche Chancen die Digitalisierung<br />
im Hinblick auf den Fachkräftemangel bietet. Passend<br />
zur aktuellen Titelthemenstrecke fand er daher Abbildung in<br />
einem separaten Beitrag (S. 12/13).<br />
Auch die 33. Fortbildungstagung für Zahnmedizinische<br />
Fachangestellte (ZFA) fand in diesem Rahmen statt. Neben<br />
den auf die Zielgruppe abgestimmten Inhalten des wissenschaftlichen<br />
Kongresses, die ebenfalls von renommierten Referent*innen<br />
vermittelt wurden, stand in diesem Jahr die Betreuung<br />
von Patient*innen mit Parodontitis im Fokus (S. 35).<br />
FORTBILDUNG<br />
Die Lichthärtung von zahnärztlichen Materialien ist ein<br />
entscheidender Bestandteil der Füllungstherapie. Allerdings<br />
kritisiert OA Dr. Uwe Blunck aus der Abteilung für Zahnerhaltung,<br />
Präventiv- und Kinderzahnmedizin der Charité–<br />
Universitätsmedizin in Berlin, dass diesem Arbeitsschritt<br />
nicht immer die volle Aufmerksamkeit geschenkt wird, die<br />
für eine sichere Aushärtung nötig wäre. Er bemängelt, dass<br />
dieser Arbeitsschritt in vielen Praxen an die ZFA delegiert<br />
würde, die damit eine große Verantwortung übernimmt. In<br />
seinem Beitrag benennt Dr. Blunck die Schwierigkeiten, aber<br />
zeigt auch deren Lösungsansätze auf. Ab Seite 36 ff. beleuchtet<br />
er die lichthärtenden Komposit-Füllungsmaterialien<br />
ebenso wie die entsprechenden Belichtungsdosen und die<br />
Polymerisationsgeräte. Auch die Problematik bei der Lichthärtung<br />
wird in seinem Beitrag umfassend behandelt.<br />
Cornelia Schwarz<br />
»
4_INHALT<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
INHALT<br />
LEITARTIKEL<br />
09_Perspektive Zahnmedizin 2030<br />
Prof. Dr. Roland Frankenberger<br />
18_Hilfe für das Praxis-Team<br />
Service-Roboter in der<br />
Zahnarztpraxis<br />
TITELTHEMA<br />
20_Der KI-Doktor macht noch zu viele Fehler<br />
Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen<br />
10_Zwischen Chancen und Kontroversen<br />
Das ZBW-Gespräch mit Dr. Torsten Tomppert<br />
22_Achtung, Hackerangriff! Was jetzt?<br />
Cyberwehr BW<br />
12_Digitale Transformation<br />
Festvortrag der 47. Jahrestagung der südbadischen<br />
Zahnärzt*innen<br />
23_Wie schützt man sich vor Cyber-Angriffen?<br />
Landesverband der Freien Berufe (LFB)<br />
BERUFSPOLITIK<br />
14_Wem sollen Gesundheitsdaten gehören?<br />
Veranstaltung des Ethikrats: „Patientenorientierte<br />
Datennutzung“<br />
24_Zukunft der zahnärztlichen<br />
Versorgung im Fokus<br />
Gemeinsame Konferenz der<br />
Öffentlichkeitsbeauftragten<br />
26_„Zähne zeigen“<br />
gegen die Folgen der<br />
Budgetierung<br />
Kampagne für eine<br />
präventionsorientierte<br />
Patientenversorgung<br />
16_KI in aller Munde<br />
Der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Zahnarztpraxis<br />
28_Abschied und Neuwahl<br />
Vertreterversammlung der BZK Freiburg in Rust
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
5_INHALT<br />
BERUFSPOLITIK<br />
PROPHYLAXE<br />
29_Dr. Struß ist neuer Vorsitzender<br />
Konstituierende Vertreterversammlung<br />
der BZK Freiburg<br />
29_Berufspolitischer Austausch<br />
Treffen der VV-Vorsitzenden der KZVen<br />
KULTUR<br />
44_Deutschland in den<br />
Mund geschaut<br />
Sechste Deutsche Mundgesundheitsstudie<br />
46_Von Hürden und Herausforderungen<br />
Einblicke in die Arbeitsfelder der Landesarbeitsgemeinschaft<br />
für Zahngesundheit<br />
FORTBILDUNG<br />
30_Prävention, Reparatur und Regeneration<br />
47. Jahrestagung der südbadischen Zahnärzteschaft in Rust<br />
48_Medienstadt Karlsruhe<br />
Spontaner Städtetrip<br />
INFORMATION UND SERVICES<br />
35_Fortbildung in Rust – Live und in Farbe<br />
33. Fortbildungstagung der BZK Freiburg für Zahnmedizinische<br />
Fachangestellte<br />
03_Editorial<br />
50_Namen und Nachrichten<br />
53_Praxis<br />
57_Personalia<br />
62_Leserforum<br />
62_ Amtliche Mitteilungen<br />
63_ Zu guter Letzt/<br />
Impressum<br />
Besuchen Sie auch die ZBW-Website. Neben der<br />
Online-Ausgabe des ZBW gibt es zusätzliche Informationen<br />
sowie ein ZBW-Archiv.<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
InformationszentrumZahnundMundgesundheit<br />
36_Update und Möglichkeiten zur Optimierung<br />
Lichtpolymerisation<br />
40_Zahnmedizin: Citius, altius, fortius?<br />
Sportzahnmedizin<br />
izz_bw<br />
izzbadenwuerttemberg<br />
Für den Druck des Zahnärzteblatts Baden-Württemberg<br />
(ZBW) wurden ausschließlich Materialien aus<br />
FSC-zertifizierten Wäldern und/oder Recyclingmaterial<br />
aus kontrollierten Quellen verwendet.
6 _PERSPEKTIVEN<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
GOTTESDIENST DURCH KÜNSTLICHE INTELLIGENZ<br />
Beim Evangelischen Kirchentag wurde der erste Gottesdienst abgehalten, der von einer Künstlichen Intelligenz geschrieben<br />
und geleitet wurde. Dieses Thema stieß auf großes Interesse bei den Teilnehmenden. Die St. Paul-Kirche<br />
in Fürth war voll besetzt, und auch viele Pressevertreter*innen waren anwesend. Zu Beginn erhielten die Menschen<br />
eine kurze Einführung, um zu erfahren, was sie in diesem Gottesdienst erwartet. Nicht alle waren bereits mit<br />
dem Chatbot ChatGPT vertraut, der in den letzten Monaten viel diskutiert wurde.<br />
Foto: picture alliance/dpa/Daniel Vogl
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
PERSPEKTIVEN_7
Kursprogramm<br />
Juli 2023 – Januar 2024<br />
Jetzt online<br />
anmelden unter<br />
fortbildung.kzvbw.de<br />
Keramikveneers - praktischer Arbeitskurs<br />
Prof. Dr. Jürgen Manhart, München<br />
• 15 Fortbildungspunkte<br />
• Kurs-Nr.: 23FKZ30917<br />
• für Zahnärztinnen / Zahnärzte<br />
• € 595.-<br />
21./22.07.2023<br />
Das Berner Konzept zur Behandlung von<br />
Weichgewebsdefekten am Zahn und Implantat<br />
Prof. Dr. Dr. Anton Sculean, Bern<br />
• 9 Fortbildungspunkte<br />
• Kurs-Nr.: 23FKZ31118<br />
• für Zahnärztinnen / Zahnärzte<br />
• € 450.-<br />
16.9.2023<br />
Grundlagen der CMD-Diagnostik -<br />
Einsteigerseminar zum aktuellen Stand der CMD-<br />
Diagnostik<br />
Prof. Dr. Axel Bumann, Berlin<br />
• 8 Fortbildungspunkte<br />
• Kurs-Nr.: 23FKZ30119<br />
• für Zahnärztinnen / Zahnärzte<br />
• € 450.-<br />
22.9.2023<br />
CMD-Diagnostik und Therapie für die tägliche<br />
Praxis - Refresherkurs<br />
Prof. Dr. Axel Bumann, Berlin<br />
• 8 Fortbildungspunkte<br />
• Kurs-Nr.: 23FKZ30120<br />
• für Zahnärztinnen / Zahnärzte<br />
• € 450.-<br />
23.9.2023<br />
Ergonomietraining in Theorie und Praxis<br />
Thomas Krutsch, Sindelfingen und Evelyn Lischke, Wieden<br />
• 7 Fortbildungspunkte<br />
• Kurs-Nr.: 23FKT20913<br />
• für das Praxisteam<br />
• € 225.-<br />
23.9.2023<br />
Update Kinderzahnheilkunde 2023<br />
Prof. Dr. Christian H. Splieth, Greifswald<br />
• 7 Fortbildungspunkte<br />
• Kurs-Nr.: 23FKZ31322<br />
• für Zahnärztinnen / Zahnärzte<br />
• € 395.-<br />
7.10.2023<br />
Psychosomatische Diagnostik bei<br />
Schmerzpatienten<br />
Prof. Dr. Anne Wolowski, Münster<br />
• 7 Fortbildungspunkte<br />
• Kurs-Nr.: 23FKZ30425<br />
• für Zahnärztinnen / Zahnärzte<br />
• € 375.-<br />
14.10.2023<br />
Strukturierte Fortbildung ENDODONTIE 2024<br />
Prof. Dr. David Sonntag, Düsseldorf<br />
• 163 Fortbildungspunkte<br />
• Kurs-Nr.: 24FKZ40101 Januar bis Dezember<br />
• für Zahnärztinnen / Zahnärzte 2024 (8 Teile)<br />
• € 6.400.-<br />
FFZ Fortbildungsforum<br />
Zahnärzte<br />
Merzhauser Straße 114-116<br />
79100 Freiburg<br />
Fon: 0761 4506-160/-161<br />
Fax: 0761 4506-460<br />
Mail: fobi-freiburg@kzvbw.de<br />
Web: www.ffz-fortbildung.de
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
9_LEITARTIKEL<br />
PERSPEKTIVE ZAHNMEDIZIN 2030<br />
2020 publizierte das Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mundund<br />
Kieferheilkunde (DGZMK) sein Positionspapier „Perspektive Zahnmedizin<br />
2030“, welches die präpandemische Zahnmedizin schonungslos beschrieb.<br />
Die vorliegende Bestandsaufnahme erörtert auf Basis des damaligen Papiers<br />
die aktuelle Lage unseres Fachs anhand ausgewählter Aspekte.<br />
Prof. Dr. Roland Frankenberger<br />
Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung, UniversitätsZahnMedizin der Universität Marburg und des Universitätsklinkums<br />
Gießen und Marburg, Campus Marburg<br />
Alle zahnmedizinischen Bereiche (Praxis,<br />
Berufspolitik, Universitäten) haben<br />
die Mahnungen des Wissenschaftsrates<br />
zur Entwicklung der Zahnmedizin als<br />
universitäres Fach aus dem Jahr 2005 1<br />
sehr ernst genommen und eine Neuorientierung<br />
im biologischen und oralmedizinischen<br />
Kontext vorangetrieben.<br />
Nicht zuletzt die Promotion einer präventionsorientierten<br />
Zahnheilkunde<br />
hat auch politisch viele Signale gesetzt 2 .<br />
In ethischen Belangen haben die Sozialen<br />
Medien in den letzten drei Jahren<br />
deutlich an Einfluss gewonnen und Influencer<br />
glauben heute, sich auch zahnmedizinisch<br />
äußern zu müssen, wodurch<br />
vor allem junge Menschen fehlgeleitet<br />
werden 3 . Dem hat die DGZMK<br />
Ende 2022 erfolgreich einen „Zahnärzte-Codex“<br />
entgegengesetzt, der die Auseinandersetzung<br />
mit kritischen ethischen<br />
Fragestellungen widerspiegelt 4 .<br />
RAHMENBEDINGUNGEN<br />
Vor Kurzem durfte ich an einem Meinungsaustausch<br />
zwischen Zahnmediziner*innen<br />
und Politiker*innen teilnehmen.<br />
Es war erstaunlich, dass alle mit<br />
ihrem bloßen Beruf (also der Patientenbehandlung)<br />
zu 100 Prozent zufrieden<br />
waren, die politischen und administrativen<br />
Umstände aber als z. T. katastrophal<br />
beschrieben. Ich sehe mit großer<br />
Sorge eine immer größere Diskrepanz<br />
zwischen den berechtigten Anforderungen<br />
an die zahnmedizinische Grundversorgung<br />
und Teilhabe am medizinischen<br />
Fortschritt einerseits und der Bereitstellung<br />
der dafür notwendigen<br />
Ressourcen, beginnend für die Ausbildung<br />
der Studierenden bis zur täglichen<br />
Berufsausübung, andererseits. Honoraranpassungen<br />
sind deshalb zwingend<br />
notwendig, um die Patient*innen<br />
auch zukünftig am zahnmedizinischen<br />
Fortschritt teilhaben zu lassen. In diesem<br />
Kontext fällt der Politik ernsthaft<br />
nichts anderes ein, als die alte Budgetierung<br />
wieder aus der Schublade zu holen?<br />
Ein Aspekt, der sich in den letzten<br />
drei Jahren in einigen Gebieten<br />
Deutschlands deutlich verschärft hat,<br />
ist die zahnärztliche Versorgung in peripheren<br />
Gebieten, die mancherorts wieder<br />
eine „Landzahnarztquote“ in den<br />
politischen Blickpunkt rückt. Es bleibt<br />
zu hoffen, dass die im Rahmen der neuen<br />
AOZ inaugurierten Praktika und Famulaturen<br />
den jungen Kolleg*innen<br />
zeigen, dass man auch auf dem Land ein<br />
glückliches Zahnarztleben führen kann.<br />
UNIVERSITÄTEN<br />
Was wir 2020 erstmals explizit beschrieben<br />
haben und was noch immer<br />
kaum einer weiß: Die Situation an den<br />
Hochschulstandorten mit Zahnklinik<br />
(„UniversitätsZahnMedizin“) ist deutschlandweit<br />
extrem unterschiedlich. Über<br />
die sogenannte leistungsorientierte<br />
Mittelvergabe (LOM) werden teilweise<br />
über 20 Prozent der Gelder, die von<br />
den Bundesländern eigentlich in die<br />
Zahnmedizin fließen sollten, in die<br />
Medizin „umgeleitet“. Je schlechter die<br />
finanzielle Situation des individuellen<br />
Medizinstandorts ist, desto extremer<br />
fallen die genannten Maßnahmen<br />
zum Schutz der medizinischen Kernund<br />
wissenschaftlichen Schwerpunktfächer<br />
aus. Seien Sie froh, dass Sie in<br />
Baden-Württemberg leben, da gehen<br />
die Uhren an den Universitäten noch<br />
anders. Denn: Gute zahnmedizinische<br />
Ausbildung und Forschung kosten<br />
Geld – wird dieses Geld reduziert,<br />
kann ein erfolgreicher Aufbruch unseres<br />
Fachs in der Breite nicht gelingen.<br />
Trotzdem zeichnet sich heute ab, dass<br />
die für die neue AOZ erforderlichen finanziellen<br />
Mittel zur Verfügung gestellt<br />
werden, was an manchen Standorten<br />
eine deutliche Aufbruchstimmung<br />
erzeugt hat.<br />
DEMOGRAFISCHER WANDEL<br />
Wir befinden uns am Vorabend des demografischen<br />
Wandels und in der letzten<br />
Bundes-Legislaturperiode, die nicht<br />
direkt davon betroffen ist 5 . Die Überalterung<br />
der deutschen Bevölkerung bedingt<br />
eine signifikante Morbiditätskompression<br />
in höherem Alter, auch die<br />
Multimorbidität zahnärztlicher Patient*innen<br />
wird deutlich zunehmen 6 .<br />
Dem muss vor allem mit einer Anpassung<br />
der zahnmedizinischen Lehre begegnet<br />
werden. Es ist begrüßenswert,<br />
dass im Rahmen der Novelle der zahnärztlichen<br />
Approbationsordnung ebendiese<br />
Aspekte in der Ausbildung intensiviert<br />
werden sollen. Auf der anderen Seite<br />
wird der demografische Wandel aber<br />
vor allem eines sein: Nagelprobe und<br />
große Chance für unseren Berufsstand.<br />
DIGITALISIERUNG<br />
Die Digitalisierung erlebt seit Jahren einen<br />
deutlichen Schub in allen Bereichen<br />
der Zahnmedizin, der es einerseits<br />
erfordert, dass die junge Generation im<br />
Rahmen der Ausbildung bereits früh<br />
mit möglichst vielen Aspekten moderner<br />
Diagnostik und Therapie in Berührung<br />
kommt, der aber auf der anderen<br />
Seite initial und dauerhaft mit erheblichen<br />
Kosten verbunden sein wird. Unabhängig<br />
davon beschleunigen und revolutionieren<br />
Faktoren der Digitalisierung<br />
den Praxisalltag, nicht zuletzt<br />
auch in der Prävention. Und ein noch<br />
stärkeres disruptives Potenzial dürfte<br />
der gerade beginnende Einzug Künstlicher<br />
Intelligenz in Medizin und Zahnmedizin<br />
mit sich bringen. Auch KI sollte<br />
man nicht als Gefahr, sondern als<br />
Chance für die Diagnostik sehen, wenn<br />
auch bei allem Hype gerade in jüngeren<br />
Publikationen deutlich deren Limitationen<br />
beschrieben wurden 7, 8 .<br />
Literatur kann über das Zahnärzteblatt abgerufen werden:<br />
info@zahnaerzteblatt.de.
10_TITELTHEMA<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Das ZBW-Gespräch mit Dr. Torsten Tomppert<br />
ZWISCHEN CHANCEN UND<br />
KONTROVERSEN<br />
Die Zukunft der Zahnmedizin verspricht eine Fülle von Möglichkeiten und Innovationen,<br />
doch birgt sie auch einige kontroverse Fragen und Bedenken. Gemeinsam mit<br />
Dr. Torsten Tomppert, Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV BW)<br />
und Präsident der Landeszahnärztekammer (LZK BW) Baden-Württemberg, werfen wir<br />
einen Blick auf diese Optionen. Wir hinterfragen, ob die Einzelpraxis ein überholtes<br />
Modell ist, inwieweit die Werbebotschaften von Influencer*innen die Zahnmedizin<br />
der Zukunft beeinflussen, die Selbstständigkeit noch ein Lebensmodell für die nachrückende<br />
Generation Z darstellt und die Anstellung in einem investorenbetriebenen<br />
Medizinischen Versorgungszentrun (iMVZ) für den Zahnarzt je eine Option war.<br />
Herr Dr. Tomppert, kann die zunehmende<br />
Technologisierung in der Zahnmedizin<br />
Ihrer Ansicht nach dazu führen,<br />
dass menschliche Fähigkeiten und<br />
Fertigkeiten in der Behandlung weniger<br />
wichtig werden?<br />
Ich halte es für nahezu unwahrscheinlich,<br />
dass menschliche Kompetenz<br />
und vor allem auch Empathie komplett<br />
an Bedeutung verlieren. Moderne<br />
Technologien wie der digitale Workflow<br />
mit CAD/CAM-Systemen, Laser<br />
und 3-D-Druck haben bereits viele Aspekte<br />
der Zahnmedizin revolutioniert<br />
und ermöglichen präzisere Diagnosen,<br />
effizientere Behandlungen und maßgeschneiderte<br />
Restaurationen.<br />
Doch gerade die Zahnmedizin erfordert<br />
zwischenmenschliche Fähigkeiten,<br />
weil der Umgang mit Patienten<br />
und die Kommunikation über Behandlungsoptionen<br />
und mögliche Risiken<br />
von großer Bedeutung sind. Die<br />
Technologie dient immer der Unterstützung<br />
der menschlichen Fähigkeiten.<br />
Politik gefährdet ist. Die unzureichende<br />
Vergütung zahnmedizinischer<br />
Leistungen und die zeitintensive Belastung<br />
von Praxisinhabern durch Bürokratie<br />
haben Auswirkungen auf die<br />
Rentabilität und Wirtschaftlichkeit<br />
von Einzelpraxen. Hinzu kommen<br />
steigende Kosten, Budgetierung, und<br />
der Stillstand in der GOZ. All das<br />
trägt nicht gerade zur Attraktivität einer<br />
Einzelpraxis für Zahnärzte und<br />
Zahnärztinnen bei.<br />
Gehen wir gemeinsam einige Jahre zurück:<br />
Sie sind frisch von der Uni, Ihre<br />
Approbation ist noch ganz jung. Denken<br />
Sie, eine Anstellung in einem<br />
iMVZ hätte Sie zu diesem Zeitpunkt<br />
gelockt?<br />
Für mich stand immer die Niederlassung<br />
und Selbstständigkeit an erster<br />
Stelle. Ich wollte meine eigene Praxis<br />
führen und die volle Verantwortung<br />
für die Versorgung meiner Patientinnen<br />
und Patienten tragen. Auch die<br />
Freiheit, eigene Entscheidungen zu<br />
treffen, ein eigenes Praxiskonzept zu<br />
entwickeln und die langfristige Betreuung<br />
meiner Patientenschaft waren mir<br />
wichtig.<br />
Für einen Großteil der Generation Z<br />
sind die Themen Flexibilität und Work-<br />
Life-Balance wesentliche Aspekte.<br />
Denken Sie, dass diese Ansätze sich<br />
mit der Gründung einer eigenen Praxis<br />
vereinen lassen?<br />
Ich bin sogar davon überzeugt, dass<br />
sich die Ansätze von Flexibilität und<br />
Work-Life-Balance mit der Gründung<br />
einer eigenen Praxis vereinen lassen,<br />
insbesondere wenn mehrere junge<br />
Zahnärztinnen und Zahnärzte sich zu<br />
einer Berufsausübungsgemeinschaft<br />
zusammenschließen. Eine solche Gemeinschaftspraxis<br />
bietet die Möglichkeit,<br />
Aufgaben und Verantwortlichkeiten<br />
auf mehrere Schultern zu verteilen.<br />
Dadurch entsteht eine größere<br />
Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeiten<br />
und der Organisation des<br />
Praxisbetriebs. Ich kann aus meiner<br />
Sehen Sie die Einzelpraxis als überholtes<br />
Modell?<br />
Überhaupt nicht. Gerade die Einzelpraxis<br />
bietet viele Vorteile, wie eine<br />
persönliche Betreuung, individuelle<br />
Behandlungspläne und eine enge Patienten-Arzt-Beziehung.<br />
Zahnärzte in<br />
Einzelpraxen können flexibel auf die<br />
Bedürfnisse ihrer Patienten eingehen<br />
und eine angemessene Versorgung anbieten.<br />
Jedoch ist es wichtig anzumerken,<br />
dass die Einzelpraxis durch die<br />
» Ich bin davon überzeugt, dass sich<br />
die Ansätze von Flexibilität und Work-<br />
Life-Balance mit der Gründung einer<br />
eigenen Praxis vereinen lassen.«<br />
Dr. Torsten Tomppert
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
11_TITELTHEMA<br />
Foto: Jan Potente<br />
eigenen Erfahrung sprechen, da meine<br />
Frau und ich eine Praxis zusammen<br />
führen. Wir haben unsere Arbeitszeiten<br />
so gestaltet, dass sie den Bedürfnissen<br />
unserer Kinder entsprachen<br />
und somit die Vereinbarkeit von Beruf<br />
und Familie gewährleistet war.<br />
Welche Aufgaben in einer Zahnarztpraxis<br />
könnten aus Ihrer Sicht unkompliziert<br />
an eine KI abgegeben werden?<br />
Beispielsweise die Terminplanung und<br />
auch Verwaltungsaufgaben wie die Patientendatenverwaltung<br />
oder die Abrechnung.<br />
Ich denke, dass wir uns angesichts<br />
des Fachkräftemangels diesen<br />
Optionen weiter öffnen müssen.<br />
Auch im Hinblick auf die Diagnostik,<br />
beispielsweise im Bereich Röntgen,<br />
kann eine KI dabei unterstützen, radiologische<br />
Bilder zu analysieren und<br />
potenzielle Auffälligkeiten oder Anomalien<br />
zu identifizieren. Am Ende<br />
können wir unseren Patientinnen und<br />
Patienten dadurch schneller helfen<br />
und präzisere Diagnosen stellen.<br />
Die Zahnfee steht vor Ihnen und ist in<br />
Spendierlaune: Welche neuen Technologien<br />
und Innovationen in der Zahnmedizin<br />
würden Sie sich für die nahe<br />
Zukunft in der Zahnmedizin von ihr<br />
wünschen?<br />
<strong>Zukunftsvisionen</strong>. Im Interview beschäftigte sich Dr. Torsten Tomppert mit den zahnmedizinischen<br />
Herausforderungen der unmittelbaren Zukunft.<br />
Innovative Technologien, die zur Regeneration<br />
von Zahn- und Knochengewebe<br />
beitragen, sind ja bereits eine<br />
tolle Sache. Auch die Entwicklung<br />
von Materialien oder Verfahren, die<br />
das natürliche Wachstum von Zähnen<br />
unterstützen und somit den Bedarf<br />
an Zahnersatz reduzieren, sind<br />
bereits ein großer Fortschritt, wenngleich<br />
noch nicht praxisreif. Vielleicht<br />
könnte die Zahnfee die Entwicklung<br />
hier etwas beschleunigen?<br />
Mit Hinblick auf die Prophylaxe begrüße<br />
ich neue Technologien, die die<br />
Prävention von Zahnerkrankungen<br />
verbessern, zum Beispiel fortschrittliche<br />
Mundhygiene-Produkte oder<br />
intelligente Geräte, die bei der Überwachung<br />
der Mundgesundheit unterstützen<br />
und rechtzeitig auf potenzielle<br />
Probleme hinweisen.<br />
Und wenn ich noch einen weiteren<br />
Wunsch frei hätte, stünden Behandlungsmethoden<br />
für Patientinnen und<br />
Patienten mit Zahnarztphobie oder<br />
Angst vor zahnärztlichen Eingriffen<br />
auf meiner Liste. Hier bin ich gespannt<br />
auf die Entwicklung der Virtual-Reality-Technologien<br />
der kommenden<br />
Jahre.<br />
Wie können zukünftige Entwicklungen<br />
in der Zahnmedizin dazu beitragen,<br />
Kosten zu sparen und die Effizienz im<br />
Gesundheitswesen zu erhöhen?<br />
Eine Entschlackung bürokratischer<br />
Prozesse könnte hier sicher vieles bewirken.<br />
Kosten werden dadurch primär<br />
keine gespart, aber es bliebe definitiv<br />
mehr Zeit für die Betreuung unserer<br />
Patientinnen und Patienten.<br />
Die Fortschritte und Entwicklungen<br />
der nahen Zukunft werden hinsichtlich<br />
zahnmedizinischer Technologien<br />
weiterhin zu effizienteren Diagnoseverfahren<br />
und Behandlungsmethoden<br />
und dadurch zu kürzeren Behandlungszeiten<br />
und weniger Terminen<br />
führen. Das spart letztendlich<br />
tatsächlich Kosten und ist vor allem<br />
auch nachhaltig.<br />
Immer häufiger spielen in der Zahnmedizin<br />
kosmetische Themen wie z. B.<br />
Bleaching, für die auch Influencer*innen<br />
Werbung machen, eine Rolle. Was<br />
denken Sie, Herr Dr. Tomppert, wie<br />
wird die Zahnmedizin der Zukunft auf<br />
die steigende Nachfrage nach ästhetischen<br />
Eingriffen, die nicht notwendigerweise<br />
mit der Gesundheit der Zähne<br />
zusammenhängen, reagieren?<br />
Ich unterscheide prinzipiell zwischen<br />
kosmetischer und ästhetischer Zahnheilkunde.<br />
Die Ästhetik wird in der<br />
Heilbehandlung der Zahnmedizin<br />
immer vorhanden sein. Die Nachfrage<br />
nach kosmetischer Zahnheilkunde<br />
stellt eine Dienstleistung auf Wunsch<br />
des Patienten dar. Diese Nachfrage<br />
wird sicher durch Social Media weiterhin<br />
zunehmen.<br />
Das Gespräch führte Cornelia Schwarz
12_TITELTHEMA<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Festvortrag der 47. Jahrestagung der südbadischen Zahnärzt*innen<br />
DIGITALE TRANSFORMATION<br />
Die digitale Transformation war Thema des Festvortrags von Prof. Dr. Jutta Rump, Professorin<br />
für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft<br />
Ludwigshafen. In ihrem Vortrag „Digitalisierung – der Mensch im Fokus“ zeigte sie auf, welche<br />
Chancen die Digitalisierung bietet, besonders im Hinblick auf den Nachwuchs- und Fachkräftemangel,<br />
der sich auch in den Zahnarztpraxen immer stärker bemerkbar macht.<br />
„Die Digitalisierung ist eine Revolution<br />
und sie begann, als im November 2022<br />
OpenAI Chat GPT der Öffentlichkeit<br />
vorstellte“, leitete Prof. Rump ihren Vortrag<br />
ein. Seitdem habe sich die Art und<br />
Weise, wie wir Informationen erhalten<br />
und kommunizieren, grundlegend verändert.<br />
Ein beeindruckendes Beispiel sei<br />
die Möglichkeit, das berühmte Gemälde<br />
der Mona Lisa zu analysieren. In kürzester<br />
Zeit könne man vier verschiedene Erklärungen<br />
für ihr mysteriöses Lächeln erhalten.<br />
Früher hätte dies eine umfangreiche<br />
Forschung erfordert, heute können<br />
wir auf eine Fülle von Informationen und<br />
Meinungen zugreifen. Als weiteres Beispiel<br />
nannte sie die Interpretation von literarischen<br />
Werken wie zum Beispiel das<br />
Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe<br />
„Wo die Zi tronen blühn“. Früher<br />
habe man sich auf eine begrenzte Anzahl<br />
von Experten verlassen müssen, um eine<br />
Interpretation zu erhalten. Heute seien<br />
zahlreiche Quellen, Analysen und Diskussionen<br />
online verfügbar, um das Gedicht<br />
besser zu verstehen. Ein weiterer bedeutender<br />
Fortschritt sei die schnelle<br />
und präzise Übersetzung von Texten.<br />
Plattformen wie deepl ermöglichten es,<br />
innerhalb von nur zehn Sekunden beispielsweise<br />
einen Vortrag in eine andere<br />
Sprache zu übersetzen, und das mit einer<br />
erstaunlichen Treffsicherheit von 99 Prozent.<br />
„Das ist Digitalisierung“, brachte es<br />
Prof. Rump auf den Punkt.<br />
VERNETZUNG VON DATEN<br />
„Wo macht die Digitalisierung uns das<br />
Leben leichter und wo ist die Grenze?“,<br />
sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen<br />
müssen, erläuterte Prof.<br />
Rump. „Es liegt in unserer Verantwortung,<br />
abzuwägen, wie weit wir die Digitalisierung<br />
in unserem Leben zulassen und<br />
welche persönlichen Grenzen wir setzen.“<br />
„Digitalisierung ist die Vernetzung von<br />
Daten aus verschiedenen Quellen mithilfe<br />
spezifischer Systeme“, definierte Prof.<br />
Rump den Begriff. Indem unterschiedliche<br />
Datenquellen miteinander vernetzt<br />
Foto: Michael Bamberger<br />
Digitale Transformation. Prof. Dr. Jutta Rump erklärt, dass wir bereits in der vierten<br />
Dimension der Digitalisierung angekommen sind.<br />
würden, entstehe ein großer Datenpool.<br />
Daraus könnten logische Konsequenzen<br />
abgeleitet werden. Ein entscheidender<br />
Fortschritt durch die Digitalisierung sei<br />
die Entstehung von Systemen, die ein einfaches,<br />
intelligentes und logisches Verhalten<br />
zeigen. Diese Systeme seien in der<br />
Lage, mit hoher Geschwindigkeit Daten<br />
zu analysieren und Maßnahmen vorzuschlagen.<br />
Dadurch werde die Effizienz<br />
und Qualität der Entscheidungsfindung<br />
verbessert. Sie nannte ein anschauliches<br />
Beispiel aus der Medizin: „Wenn wir Daten<br />
über Patient*innen in ein System eingeben,<br />
können diese mit anderen Datenquellen<br />
verglichen werden. Dadurch erweitern<br />
wir unser Erfahrungswissen und<br />
können fundiertere Entscheidungen treffen.<br />
Dies ist ein Mehrwert und einer der<br />
Gründe für den Siegeszug dieser Technologie.“<br />
Die Einführung der Künstlichen<br />
Intelligenz (KI) habe diesen Effekt verstärkt.<br />
KI-Systeme seien in der Lage, eigenständige<br />
Ableitungen zu machen und<br />
weitere Daten hinzuzufügen. Die KI basiere<br />
auf mathematischer Logik, könne jedoch<br />
keine emotionale Intelligenz bereitstellen.<br />
Hier zeigten sich auch bereits<br />
Grenzen dieser Systeme.<br />
„Megatrends machen unsere Welt heutzutage<br />
sehr komplex“, verdeutlichte Prof.<br />
Rump. Hierzu gehören gesellschaftliche,<br />
sozio-ökologische, ökonomische, technologische<br />
und demografische Trends. Sie<br />
prägen die globale Entwicklung und haben<br />
Auswirkungen auf alle Lebensbereiche.<br />
Hinzu kommen noch die Corona-Krise<br />
und geopolitische Krisen, die zu Veränderungen<br />
in den Arbeitsmärkten geführt<br />
haben. Angesichts dieser sich rasch verändernden<br />
globalen Landschaft sei es von<br />
entscheidender Bedeutung, dass wir die<br />
Auswirkungen dieser Megatrends verstehen<br />
und darauf reagieren. Die Digitalisierung<br />
spiele dabei eine zentrale Rolle, um<br />
Lösungen zu finden und den Herausforderungen<br />
effektiv zu begegnen.<br />
ARBEITSKRÄFTEMANGEL<br />
Der Arbeitskräfte-, Nachwuchs- und<br />
Fachkräftemangel stellt laut Prof. Rump<br />
eine bedeutende Herausforderung dar. In
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
13_TITELTHEMA<br />
den kommenden Jahren werden rund elf<br />
Millionen Menschen in Rente gehen, vorausgesetzt,<br />
sie arbeiten bis zum Alter von<br />
65 Jahren. Auf der Seite der jüngeren Generation<br />
stehen jedoch nur etwa 60 Prozent<br />
dieser Anzahl gegenüber, was bedeutet,<br />
dass eine Lücke von etwa 4,4 Millionen<br />
Menschen besteht. Diese demografische<br />
Entwicklung bilde die Grundlage<br />
für das politische Handeln. Bereits im<br />
Jahr 2027 werde der Mangel an Arbeitskräften<br />
einen ersten Höhepunkt erreichen.<br />
Es wird erwartet, dass dann bereits<br />
27.000 Menschen fehlen werden. „Um<br />
diese Lücke zu bewältigen, bleibt uns keine<br />
andere Wahl, als Algorithmen, Roboter<br />
und Künstliche Intelligenz einzusetzen“,<br />
hob Prof. Rump hervor. „Die Vorsicht<br />
wird zur Seite geschoben aus der<br />
reinen Not des Arbeitsmarktes“, stellte<br />
sie klar. „Wir müssen genau analysieren,<br />
wo es Routineprozesse gibt, die uns oder<br />
unser Personal in der Praxis entlasten<br />
können. Die demografische Entwicklung<br />
ist ein entscheidender Treiber für technologische<br />
Entwicklungen, um diesen Herausforderungen<br />
zu begegnen.“<br />
VERÄNDERUNG<br />
In einer Welt, die von Volatilität, Unsicherheit,<br />
Komplexität und Mehrdeutigkeit geprägt<br />
ist, sei Veränderung ein Normalzustand,<br />
hob Prof. Rump hervor. Die Komplexität<br />
der globalen Zusammenhänge erfordere<br />
die Fähigkeit, sich schnell an veränderte<br />
Bedingungen anzupassen. „In unserer<br />
heutigen Zeit gibt es eine neue<br />
Währung, die nicht in Geld, sondern in<br />
Zeit gemessen wird“, führte Prof. Rump<br />
aus. Und im Zuge dieser Veränderungen<br />
hätten viele Menschen den Wunsch, ihre<br />
Zeit anders zu nutzen und souveräner damit<br />
umzugehen. Dieser Logik liege auch<br />
die Forderung nach der Vier-Tage-Woche<br />
zugrunde. Menschen sehnten sich nach<br />
mehr Erholung und hätten den Wunsch,<br />
weniger zu arbeiten. Demgegenüber seien<br />
Arbeitgeber zunehmend mit einem Personalmangel<br />
konfrontiert, der nicht über<br />
den Arbeitsmarkt kompensiert werden<br />
könne. Dies sei der Grund, warum Aufgaben<br />
an Algorithmen, Roboter und Künstliche<br />
Intelligenz ausgelagert werden. Wenn<br />
wir auf die menschliche Entwicklung zurückblickten,<br />
sähen wir verschiedene Meilensteine.<br />
Angefangen vom Webstuhl über<br />
die Einführung von Arbeitsteilung und<br />
Fließbandarbeit bis hin zum Computer<br />
haben diese Entwicklungen unsere Arbeitswelt<br />
revolutioniert. „Nun stehen wir<br />
an einem weiteren Wendepunkt – der Digitalisierung“,<br />
betonte Prof. Rump.<br />
Sie veranschaulichte das Konzept der vier<br />
Dimensionen der Digitalisierung, das verschiedene<br />
Aspekte beschreibt, die unsere<br />
Welt in unterschiedlicher Weise beeinflussen.<br />
Die erste Dimension umfasst Innovationen<br />
in der Technik, die neue Möglichkeiten<br />
und Potenziale eröffnen. In der<br />
zweiten Dimension sind die Geschäftsmodelle<br />
von Unternehmen von Bedeutung,<br />
da sich durch die Digitalisierung<br />
neue Geschäftsfelder und -ansätze ergeben.<br />
Die dritte Dimension bezieht sich<br />
auf Innovationen in Prozessen und Strukturen,<br />
wodurch Arbeitsabläufe effizienter<br />
und flexibler gestaltet werden können.<br />
Die vierte Dimension befasst sich mit den<br />
Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft,<br />
mit sozialen Kontexten und der<br />
Arbeitswelt. „Wir befinden uns in der vierten<br />
Dimension der Digitalisierung, der<br />
digitalen Transformation“, erklärte Prof.<br />
Rump. In dieser Phase seien Daten und<br />
Zeit zu einer wichtigen Währung geworden.<br />
Die Auswirkungen dieser Entwicklung<br />
müssten mit Blick auf Personalentwicklung,<br />
Führung und Identifikation<br />
mit dem Arbeitsplatz betrachtet werden,<br />
verdeutlichte Prof. Rump. „Bewahren<br />
und verändern sollten hier unsere Kernkompetenzen<br />
sein“, unterstrich sie. „Um<br />
in einer Welt der Beweglichkeit und Veränderung<br />
Orientierung zu finden, ist es<br />
besonders wichtig für uns Menschen, etwas<br />
zu haben, an dem wir uns festhalten<br />
können.“ Die traditionelle Berufsausbildung<br />
werde hier zukünftig nicht mehr<br />
ausreichen. In einer Welt der Diskontinuität<br />
werden zwischenmenschliche Aspekte<br />
und die Art und Weise, wie wir miteinander<br />
umgehen, dafür umso wichtiger.<br />
NEUE FÜHRUNGSSTILE<br />
Moderne Führungsansätze sind laut<br />
Prof. Rump geprägt von der Nutzung von<br />
Technologie, Vernetzung und hoher Geschwindigkeit.<br />
In diesem Kontext sei es<br />
entscheidend, sich den Herausforderungen<br />
anzupassen. „In der vierten Dimension<br />
der Digitalisierung spielt Leadership<br />
eine entscheidende Rolle“, unterstrich sie.<br />
Agilität sei hier der Schlüsselbegriff. Ein<br />
zentrales Element dabei ist, dass wir uns<br />
auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam<br />
daran arbeiten, Veränderungen<br />
voran zutreiben und Dinge besser zu machen.<br />
Innerhalb eines Teams bedeute<br />
dies, sich nicht nur auf die individuelle<br />
Entwicklung zu konzentrieren, sondern<br />
auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen<br />
und die Zusammenarbeit im<br />
Team. Erfolgreiche Führung in der digitalen<br />
Ära erfordere daher nicht nur technologisches<br />
Know-how, sondern auch die<br />
Fähigkeit, Menschen zu motivieren, zu<br />
inspirieren und gemeinsam Ziele zu erreichen.<br />
Während Routinetätigkeiten zunehmend<br />
von Robotern, KI und Algorithmen<br />
übernommen werden, ist es wichtiger<br />
denn je, über die nötigen Kompetenzen<br />
und Qualifikationen zu verfügen.<br />
„Lebenslanges Lernen wird zu einem zentralen<br />
Thema, um sich kontinuierlich<br />
weiterzuentwickeln“, hob Prof. Rump<br />
hervor. Mitarbeitende sollten entsprechend<br />
ihrer Stärken und Schwächen eingesetzt<br />
werden und das Gefühl haben, etwas<br />
beitragen zu können. Hier laute das<br />
Motto: „Jeder hat ein Talent, jeder ist ein<br />
Talent“. Mitarbeitermotivation und Identifikation<br />
mit der Arbeit seien essenzielle<br />
Aspekte für die Mitarbeiterbindung.<br />
AUSBLICK<br />
Im quantitativen Beschäftigungseffekt<br />
wird sich laut Prof. Rump eine U-Kurve<br />
abzeichnen. Kognitive und routinemäßige<br />
Aufgaben werden von KI, Robotern<br />
und Algorithmen übernommen, wodurch<br />
ein vorübergehender Beschäftigungsrückgang<br />
erfolgt. Dies betrifft insbesondere<br />
das mittlere Qualifikationssegment. „Viele<br />
Menschen, die seit Jahren gute Arbeit<br />
geleistet haben, müssen sich in ihrem Beruf<br />
neu orientieren. Es kommt zu massiven<br />
Veränderungen, aber wir werden nicht<br />
arbeitslos sein. Stattdessen werden wir<br />
uns in einen Veränderungsprozess begeben,<br />
der Anpassung und Weiterentwicklung<br />
erfordert“, hob sie hervor.<br />
Gabriele Billischek<br />
ZUR PERSON<br />
Prof. Dr. Jutta Rump ist Professorin für<br />
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre<br />
mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement<br />
und Organisationsentwicklung<br />
an der Hochschule für<br />
Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen.<br />
Darüber hinaus ist sie Direktorin<br />
des Instituts für Beschäftigung<br />
und Employability in Ludwigshafen<br />
(IBE). Ihre Forschungsschwerpunkte<br />
sind Trends in der Arbeitswelt (Digitalisierung,<br />
Demografie, Diversität,<br />
gesellschaftlicher Wertewandel, technologische<br />
Trends und ökonomische<br />
Entwicklungen) und die Konsequenzen<br />
für Personalmanagement und Organisationsentwicklung<br />
sowie Führung.
14_TITELTHEMA<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Veranstaltung des Ethikrats: „Patientenorientierte Datennutzung“<br />
WEM SOLLEN GESUNDHEITS-<br />
DATEN GEHÖREN?<br />
Ob in der Praxis, bei den Krankenkassen oder privat auf dem Smartphone: Gesundheitsdaten<br />
werden täglich gesammelt und verarbeitet. Der Deutsche Ethikrat beschäftigt<br />
sich schon lange mit der Frage, wie mit diesen Daten umgegangen werden soll,<br />
weshalb er im März 2023 Expert*innen nach Berlin eingeladen hat, um über das<br />
Thema „Patientenorientierte Datennutzung“ zu diskutieren: Wie kann der Spagat<br />
zwischen ausreichendem Datenschutz und einer für Patient*innen gewinnbringende<br />
Verarbeitung der Daten gelingen?<br />
Geben und Nehmen. „Meine Daten gehören mir. Und der Solidargemeinschaft“, positioniert sich Dr. Sylvia Thun, Professorin für<br />
Digitale Medizin, in der Diskussion um Gesundheitsdaten und deren Verwertung.<br />
Foto: Deutscher Ethikrat/Christian Thiel<br />
PROBLEMAUFRISS<br />
„Patientenorientierte Datennutzung“ –<br />
bereits der Titel der Veranstaltung<br />
trug die beiden Spannungspole in<br />
sich, zwischen denen sich die Frage<br />
nach dem Umgang mit Gesundheitsdaten<br />
bewegt: Auf der einen Seite der<br />
Schutz der Patientendaten und auf<br />
der anderen Seite deren Nutzung.<br />
Doch was meint in diesem Kontext<br />
„patientenorientiert“ eigentlich? Soll<br />
der Schwerpunkt auf dem Schutz der<br />
Persönlichkeitsrechte von Patient*innen<br />
oder auf den positiven Effekten<br />
einer sinnvollen Datennutzung liegen?<br />
Von Letzterem erhofft man sich<br />
viel. So beispielsweise, dass Forschung<br />
und Industrie Zugriff auf sämtliche<br />
Gesundheitsdaten erhalten und die<br />
daraus gewonnenen Erkenntnisse<br />
wieder Patient*innen zugutekommen.<br />
Dies kann in Form von genauerer<br />
Diagnostik, verbesserter Therapien<br />
oder der Früherkennung von Erkrankungen,<br />
geschehen. Infolge dessen<br />
bedeutet dies eine verbesserte medizinische<br />
Versorgung für alle. Es ist<br />
ein Kreislauf nach dem Prinzip „do ut<br />
des – ich gebe, damit du gibst“. Und<br />
wer sollte da nicht mit einstimmen, in<br />
Zeiten von Fachkräftemangel und<br />
sich abzeichnenden Versorgungsengpässen<br />
in strukturschwachen Regionen?<br />
Doch ist die Nutzung von Gesundheitsdaten<br />
hierzulande noch<br />
nicht weit gediehen: Obwohl medizinische<br />
Daten seit Langem in Form<br />
von Abrechnungsdaten bei den Krankenkassen<br />
digital vorliegen, werden<br />
sie wenig genutzt. Das kann an einer<br />
restriktiven Auslegung des europäischen<br />
und nationalen Datenschutzes<br />
liegen. Erschwert wird die Nutzung<br />
auch dadurch, dass die Gesundheitsdaten<br />
in unterschiedlichen Datenbanken<br />
und -formaten vorliegen, die<br />
nicht miteinander kompatibel sind,<br />
Stichwort Interoperabilität. Damit<br />
sind die Herausforderungen für eine<br />
„patientenorientierte Datennutzung“<br />
umrissen.
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
15_TITELTHEMA<br />
»<br />
Gesundheitsdaten bergen<br />
ein enormes Potenzial<br />
für das Patientenwohl.«<br />
Prof. Dr. Alena Buyx<br />
DEBATTE<br />
Der Deutsche Ethikrat hat<br />
unter anderen Prof. Ulrich<br />
Kelber, Bundesbeauftragter<br />
für Datenschutz und Informationsfreiheit,<br />
und Dr.<br />
Susanne Ozegowski, Abteilungsleiterin<br />
für Digitalisierung<br />
und Innovation im Bundesgesundheitsministerium,<br />
eingeladen. Gemeinsam wurde<br />
auf dem Podium mit weiteren<br />
Vertreter*innen aus Medizin, Ethik<br />
und Recht diskutiert, „wie sich Datenschutzrecht<br />
und Forschungsinfrastruktur<br />
weiterentwickeln lassen, sodass<br />
eine effektivere, patientenorientierte<br />
Nutzung von Daten in der medizinischen<br />
Forschung und Versorgung<br />
möglich wird“ (Deutscher Ethikrat).<br />
So war denn auch schnell klar, dass es<br />
nicht um die Schwächung des Datenschutzes<br />
gehen soll: „Gesundheitsdaten<br />
bergen ein enormes Potenzial für<br />
das Patientenwohl, wenn sie nur genutzt<br />
werden können. Damit dies<br />
möglich ist, brauchen wir nicht weniger<br />
Datenschutz, sondern dessen bessere<br />
Umsetzung“, sagte Prof. Dr. Alena<br />
Buyx, die dem Ethikrat vorsteht.<br />
HERAUSFORDERUNGEN<br />
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass<br />
Patient*innen über den Zweck und die<br />
Art der Datennutzung informiert werden<br />
und ihre Zustimmung eingeholt<br />
werden muss. Prof. Dr. Tobias Huber,<br />
Nephrologe und Internist am Universitätsklinikum<br />
Hamburg-Eppendorf,<br />
problematisierte die Schwierigkeiten<br />
bei der Einwilligung in die Nutzung<br />
von Daten für die Forschung. So würden<br />
Patient*innen Aufklärungs- und<br />
Einwilligungsbögen nicht sorgfältig<br />
und vollständig lesen, sondern darauf<br />
vertrauen, dass es „schon recht sein<br />
wird“. Dies sei ethisch fragwürdig.<br />
Prof. Dr. Sylvia Thun, Professorin für<br />
Digitale Medizin und Interoperabilität<br />
am Berlin Institut of Health (BIH) der<br />
Charité, erklärte, wie Daten genutzt<br />
werden sollen: „Datennutzung soll auf<br />
FAIRen Daten beruhen (FAIR bezieht<br />
Foto: unsplash.com/NationalCancerInstitut<br />
Interoperabilität. Wie müssen Gesundheitsdaten aussehen und gespeichert werden, damit sie<br />
institutsübergreifend genutzt werden können?<br />
sich dabei auf: findable, accessible, interoperable,<br />
reusable). Das bedeutet,<br />
dass Daten in einer hohen Qualität<br />
verfügbar sind und genutzt werden<br />
dürfen“ Die Interoperabilität sei die<br />
Voraussetzung, dass Daten auf standardisierte<br />
Weise grenzüberschreitend<br />
zwischen Forschungseinrichtungen<br />
ausgetauscht werden könnten.<br />
Doch wer Daten sammelt, muss sie<br />
auch in elektronische Gesundheitsakten<br />
und Datenbanken einspielen und<br />
diese pflegen. So ein zusätzlicher Dokumentationsaufwand<br />
müsse sich lohnen<br />
und dürfe keine vergeudete Zeit<br />
sein, befand Prof. Dr. Dirk Lanzerath,<br />
Geschäftsführer des Deutschen Referenzzentrums<br />
für Ethik in den Biowissenschaften.<br />
Dieser zusätzliche Aufwand<br />
im Versorgungskontext könne<br />
zwar zugunsten der Forschung, aber<br />
auch zulasten der Versorgungsqualität<br />
gehen. Darunter könne das Arzt-Patienten-Verhältnis<br />
minimiert werden<br />
und das Wohl der Patient*innen leiden.<br />
Bei der patientenorientierten Datennutzung<br />
spielt Sicherheit eine große<br />
Rolle: „Die Datenschutzaufsichtsbehörden<br />
unterstützen die Nutzung personenbezogener<br />
Daten zu Forschungszwecken,<br />
ohne dabei den nötigen<br />
Schutz der besonders sensiblen Gesundheitsdaten,<br />
die aus dem vertrauensvollen<br />
Arzt-Patienten-Verhältnis<br />
stammen, aufzugeben”, gab Kelber bekannt.<br />
Es wird in Zukunft also darum gehen,<br />
eine Regelung zu finden, die sowohl<br />
den Datenschutz als auch die Nutzbarmachung<br />
von Gesundheitsdaten ermöglicht.<br />
Wenn die Daten verantwor-<br />
tungsvoll genutzt werden und das Persönlichkeitsrecht<br />
der Patient*innen<br />
geschützt wird, kann dies zu neuen Erkenntnissen<br />
und innovativen Lösungen<br />
führen, um Krankheiten besser zu<br />
verstehen und zu behandeln.<br />
Alexander Messmer<br />
INFO<br />
Der Europäische Gesundheitsdatenraum<br />
(European Health Data<br />
Space, kurz: EHDS) soll europaweit<br />
einen einheitlichen Standard<br />
in der Nutzung von Gesundheitsdaten<br />
vorgeben. Die EU-Kommission<br />
hat dazu eine Verordnung auf<br />
den Weg gebracht. Nun sind die<br />
Mitgliedsstaaten gefragt, die Verordnung<br />
in die nationale Gesetzgebung<br />
umzusetzen. In Deutschland<br />
soll das mit dem „Digitalgesetz“<br />
und dem „Gesundheitsdatennutzungsgesetz“<br />
geschehen.<br />
Beide Gesetze sollen noch vor der<br />
Sommerpause im Kabinett verabschiedet<br />
werden. Vorgesehen ist<br />
u. a. die Einführung der elektronischen<br />
Patientenakte (ePA) für alle<br />
Versicherten und die Nutzbarmachung<br />
der ePA-Daten für Forschungszwecke<br />
(vgl. ZBW-Ausgabe<br />
5-6/2023). Ziel ist es, eine<br />
breite Datenlandschaft für die<br />
Forschung einzurichten. Die EU<br />
will damit zum Vorbild einer datennutzenden<br />
Gesellschaft werden.
16_TITELTHEMA<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Zahnarztpraxis<br />
KI IN ALLER MUNDE<br />
Derzeit erlebt unsere Gesellschaft und damit natürlich auch die Gesundheitsbranche, nicht<br />
zuletzt durch die Coronapandemie, eine rapide digitale Transformation. Durch den<br />
Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und sogenannten Chatbots, also einer KI, die sich in<br />
natürlicher Sprache mit Menschen unterhält, wird sie zusätzlich angetrieben. Bilder werden<br />
auf diese Weise kreiert und Fotos, deren Qualität überzeugt – und auch erschreckt. Auch<br />
komplette Texte, selbstverständlich orthografisch und grammatikalisch korrekt formuliert,<br />
egal zu welchem Thema und in welcher Sprache, können in Auftrag gegeben werden. Teilweise<br />
sogar kostenfrei und in verschiedenen Varianten.<br />
Zukunft? Begleitet uns die künstliche Intelligenz in Form von Chatbots zukünftig zur Wissensvermittlung und Unterstützung in der<br />
Arbeitswelt, wie es heute das Internet tut? Sind sie die Zukunft des digitalen Wissens?<br />
Foto: Adobe Stock/NicoElNino<br />
Ich denke so oder so ähnlich müssen<br />
sich unsere Vorfahren anlässlich der<br />
industriellen Revolution, Mitte des 18.<br />
Jahrhunderts, gefühlt haben: Die Möglichkeiten<br />
und Chancen scheinen beeindruckend,<br />
doch der kritische Betrachter<br />
spürt auch die möglichen Bedrohungen.<br />
Doch was kann ein solches<br />
System tatsächlich an Nutzen für eine<br />
Zahnarztpraxis bringen?<br />
Zugegeben es wäre ein charmanter Gedanke,<br />
den aktuellen Fachkräftemangel<br />
durch KI abfangen zu können und<br />
mit Sicherheit müssen wir uns zukünftig<br />
auch tatsächlich diesem Gedanken<br />
öffnen. Roboter, die in der Zahnarztpraxis<br />
zugange sind und die Patientenschaft<br />
begrüßen, gibt es ja bereits. Pepper<br />
ist ein solcher Roboter und sieht<br />
wirklich niedlich aus. Aber natürlich<br />
hat er/sie/es auch eine Funktion: Er/<br />
sie/es begrüßt die Patientenschaft,<br />
während das Praxispersonal telefoniert,<br />
beantwortet Fragen und sorgt<br />
für Kurzweil während der Wartezeiten.<br />
Doch natürlich hat diese Maschine einen<br />
Preis und den muss man zahlen<br />
wollen. Die Preise bewegen sich laut<br />
Hersteller zwischen 17 000 und 20 000<br />
Euro und er ist auch stunden-, tageoder<br />
sogar jahresweise mietbar. Doch<br />
welche weiteren Angebote macht die KI<br />
der Zahnmedizin?<br />
TERMINVEREINBARUNG<br />
Ohne viel Aufwand lässt sich ein Chatbot<br />
in die Praxishomepage integrieren.<br />
Wichtig hierfür ist eine klare Definition<br />
dessen, was der Chatbot dort für<br />
Aufgaben zu erfüllen hat. Je klarer diese<br />
Themen umrissen werden und der<br />
Chatbot mit möglichen Antworten ge-
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
17_TITELTHEMA<br />
füttert wird, desto besser wird er die<br />
gestellte Aufgabe erfüllen können. So<br />
könnte ein Chatbot Fragen zu Terminwünschen<br />
beantworten und aufgrund<br />
der Verfügbarkeit in der Praxis einen<br />
passenden Termin vorschlagen. Auch<br />
Erinnerungen an anstehende Termine<br />
könnten durch die KI versandt werden,<br />
um sicherzustellen, dass Patient*innen<br />
ihre Termine nicht vergessen und<br />
pünktlich erscheinen.<br />
PATIENTENAUFKLÄRUNG<br />
Auch denkbar wäre es, dass ein Chatbot<br />
Patienten*innen vor ihrem Zahnarztbesuch<br />
hilft, indem er allgemeine<br />
Informationen zur Verfügung stellt,<br />
beispielsweise zum Vermeiden von<br />
Nahrungsmitteln oder Getränken vor<br />
einer bestimmten Behandlung. Zudem<br />
könnte die KI über häufige Zahnprobleme,<br />
Behandlungsmöglichkeiten,<br />
Kosten und Finanzierungsoptionen<br />
aufklären. Auch hier spielt die Programmierung<br />
eine wesentliche Rolle,<br />
denn eine KI kann nur die Informationen<br />
ausspucken, die in sie eingespeist<br />
werden. Ein Chatbot kann<br />
zudem dabei unterstützen,<br />
Krankheiten und Behandlungsabläufe<br />
besser zu verstehen,<br />
indem er einfache und verständliche<br />
Erklärungen zu medizinischen<br />
Begriffen und Verfahren<br />
liefert. Darüber hinaus<br />
kann er Ratschläge zur Vermeidung<br />
von Komplikationen geben.<br />
SYMPTOMCHECK<br />
Im Rahmen einer Diagnoseunterstützung<br />
könnte ein Chatbot wesentliche<br />
Hinweise weiterreichen und dem Praxisteam<br />
dadurch Arbeit abnehmen.<br />
Auf diese Weise könnte das System der<br />
Patientenschaft helfen, ihre Symptome<br />
zu bewerten und festzustellen, ob sie<br />
einen Zahnarzttermint benötigen. Zudem<br />
könnten Patient*innen eventuell<br />
auch Zeit sparen und direkt die richtige<br />
Fachärzteschaft aufsuchen. Allerdings<br />
sollte dabei berücksichtigt werden,<br />
dass die KI unter Umständen<br />
nicht auf dem aktuellsten Stand der<br />
wissenschaftlichen Erkenntnis ist.<br />
Eine regelmäßiges Update des Systems<br />
ist daher unerlässlich.<br />
NACHSORGE<br />
Auch die Nachsorge könnte eine Aufgabe<br />
für einen Chatbot sein. Nach einem<br />
Zahnarztbesuch könnten er mit Anweisungen<br />
zur Pflege und Nachsorge der<br />
Zähne unterstützen. Selbstverständlich<br />
auch zur richtigen Zahnreinigung und<br />
zur Verwendung von Zahnseide, Zwischenraumbürstchen,<br />
Zahnbürste, der<br />
richtigen Putztechnik, Pflege von Zahnspangen<br />
oder Zahnersatz. Im Rahmen<br />
der Medikamentenverwaltung kann er<br />
medizinischen Fachkräften dabei helfen,<br />
die Medikamentenverwaltung von<br />
Patient*innen zu verbessern, indem er<br />
auf Basis von medizinischen Daten personalisierte<br />
Empfehlungen zur Dosis<br />
und zum Medikamentenzeitplan gibt.<br />
Der Chatbot kann auch daran erinnern,<br />
Medikamente pünktlich einzunehmen<br />
und Warnungen vor möglichen Wechselwirkungen<br />
mit anderen Präparaten<br />
geben.<br />
RISIKEN<br />
Wie bei allen Technologien gibt es<br />
auch bei der Verwendung von Chatbots<br />
in der medizinischen Unterstützung<br />
Risiken, die beachtet werden<br />
sollten. So besteht die Möglichkeit einer<br />
falschen Diagnose, wenn wichtige<br />
Informationen nicht berücksichtigt<br />
werden oder wenn keine zuverlässigen<br />
klinischen Daten zur Verfügung stehen.<br />
Da Chatbot-Systeme persönliche<br />
medizinische Patientendaten verarbeiten<br />
und speichern, ist es wichtig,<br />
dass alle Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien<br />
eingehalten werden.<br />
Natürlich besteht auch das Risiko von<br />
Cyberangriffen auf diese Systeme, was<br />
zu einem Datenverlust oder einer Datenmanipulation<br />
führen kann. Eine<br />
Gefahr droht natürlich auch, wenn<br />
sich sowohl die medizinischen Fachkräfte<br />
als auch die Patientenschaft zu<br />
sehr auf die KI-Systeme verlassen und<br />
die menschliche Interaktion vernachlässigen.<br />
Dies kann dazu führen, dass<br />
wichtige Aspekte des Patientenkontakts<br />
verloren gehen, die nur durch die<br />
menschliche Erfahrung und das Urteilsvermögen<br />
gewonnen werden können.<br />
Dies bringt uns auch dem Thema<br />
Ethik und Verantwortung näher,<br />
denn die Verwendung von Chatbot-<br />
Systemen in der medizinischen Unterstützung<br />
wirft auch ethische Fragen<br />
auf, wie beispielsweise wer für die Entscheidungen,<br />
die das System trifft,<br />
verantwortlich ist, wenn etwas schief<br />
geht oder Patientendaten missbraucht<br />
werden.<br />
Und selbst wenn eine KI über zahlreiche<br />
menschliche Fähigkeiten verfügt,<br />
so wird ihr doch immer eines fehlen:<br />
Empathie. Nie wird sie Patient*innen<br />
mit einem Handauflegen beruhigen<br />
oder ihr aufrichtiges Verständnis bei<br />
Ängsten oder Schmerzen vermitteln<br />
können.<br />
Cornelia Schwarz<br />
[…] Mein Training basiert auf einem umfangreichen<br />
Korpus an Texten aus dem<br />
Internet, Büchern, Artikeln und vielen<br />
anderen Quellen. Ich wurde nicht von<br />
einer spezifischen Person oder Gruppe<br />
von Personen gefüttert, sondern von einem<br />
Team von Ingenieuren und Forschern<br />
entwickelt, die an Open-AI arbeiten.<br />
Mein Training basiert auf Algorithmen<br />
und Datenverarbeitungstechniken,<br />
um Muster und Zusammenhänge in<br />
den Trainingsdaten zu erkennen und<br />
menschenähnliche Antworten zu generieren.<br />
Es ist wichtig zu beachten, dass<br />
ich als KI-Modell selbst keine spezifischen<br />
Informationen über meine Schöpfer<br />
oder den genauen Prozess meines<br />
Trainings habe.<br />
[…] Da ChatGPT in der Lage ist, menschenähnlichen<br />
Text zu generieren, besteht<br />
das Risiko, dass es zur Verbreitung<br />
von Fehlinformationen oder gefälschten<br />
Inhalten verwendet wird. […]<br />
[…] ChatGPT lernt aus den Daten, mit<br />
denen es trainiert wird. Wenn diese Trainingsdaten<br />
Vorurteile oder Diskriminierung<br />
enthalten, besteht die Gefahr, dass<br />
das Modell diese Vorurteile verstärkt<br />
und diskriminierende Aussagen oder Inhalte<br />
generiert. […]<br />
[…] Kriminelle könnten ChatGPT für<br />
bösartige Zwecke einsetzen, z. B. für die<br />
Erstellung überzeugender Phishing-Angriffe,<br />
Social-Engineering-Betrug oder<br />
die Automatisierung von Angriffen wie<br />
Spamming oder Denial-of-Service-Angriffen.<br />
[…]<br />
[…] Der Einsatz von ChatGPT wirft ethische<br />
Fragen auf, insbesondere im Hinblick<br />
auf den Schutz der Privatsphäre<br />
der Benutzer. Wenn sensible Informationen<br />
mit dem Modell geteilt werden, besteht<br />
das Risiko, dass diese Informationen<br />
missbraucht oder unangemessen<br />
verwendet werden.<br />
Die Fragen formulierte Cornelia Schwarz
18_TITELTHEMA<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Service-Roboter in der Zahnarztpraxis<br />
HILFE FÜR DAS PRAXIS-TEAM<br />
In Krankenhäusern werden Roboter schon vielfältig eingesetzt. Sie assistieren bei<br />
Operationen und übernehmen den Transport von Medikamenten, Essen oder Betten.<br />
Autonome Roboter desinfizieren mit UV-Licht bestimmte Klinikbereiche. In der Pflege<br />
gleichen Hebe-Roboter und Exoskelette menschliche Defizite aus. Und die Roboter-<br />
Robbe PARO erfüllt sogar emotionale Bedürfnisse. Das erklärte Ziel: Menschen<br />
durch die technischen Helfer sinnvoll zu unterstützen und bei der Arbeit zu entlasten.<br />
Warum nicht auch in der Zahnarztpraxis?<br />
Im deutschsprachigen Raum sind bisher<br />
nur wenige Einsätze von Service-<br />
Robotern in Zahnarztpraxen bekannt.<br />
So wurde 2021 im Rahmen eines Forschungsprojekts<br />
der Julius-Maximilians-Universität<br />
Würzburg der Service-Roboter<br />
Pepper in der kieferchirurgischen<br />
Praxis von Dr. Dr. Boris<br />
Herzlieb in Würzburg ausprobiert.<br />
Mit einem Gewicht von 28 Kilogramm<br />
verteilt auf 1,20 Meter<br />
wirkt Pepper wie ein zierlicher<br />
Mensch. Der Kopf mit den großen<br />
Augen bedient das Kindchenschema<br />
und soll Vertrauen<br />
wecken. Hinter der weißen<br />
Außenhaut verbergen sich Motoren<br />
mit Batterieantrieb, Mikrofone,<br />
Sensoren, Kameras<br />
und vieles mehr. Pepper kommuniziert<br />
verbal und über ein<br />
Tablet. Er bewegt sich, kann<br />
tanzen, singen und Videos abspielen<br />
– oder bis zu 12 Stunden<br />
„richtig arbeiten“.<br />
Gestatten? Am Empfang des Wiener Zahninstituts<br />
Sleep & Smile wartet Serviceroboter Pepper<br />
als „Dr. Smiley“ auf seinen Einsatz.<br />
EMPFANG DURCH PEPPER<br />
Dem Praxisteam von Dr. Herzlieb<br />
war Pepper schnell ein guter Kollege.<br />
Der Service-Roboter wurde während<br />
des Projekts am Empfang eingesetzt<br />
und begrüßte die eintretenden<br />
Patientinnen und Patienten. Dank<br />
seiner Hilfe mussten die Angestellten<br />
ihre laufenden Tätigkeiten oder<br />
Telefonate nicht mehr so häufig unterbrechen.<br />
Für das Praxisteam war<br />
das eine große Entlastung. Völlig<br />
überraschend waren die Reaktionen<br />
der Patientinnen und Patienten. Entgegen<br />
der Erwartungen waren besonders<br />
die Älteren vom technischen Assistenten<br />
begeistert, während sich viele<br />
Jüngere schnell wieder ihrem Smartphone<br />
widmeten. Nach dem ersten erfolgreichen<br />
Versuch hat sich Dr. Herzlieb<br />
mittlerweile entschlossen, auf eigene<br />
Kosten einen Nachfolger für Pepper<br />
zu erwerben. Dieser soll zukünftig<br />
auch andere Aufgaben übernehmen<br />
und beispielsweise Patientinnen und<br />
Patienten zu den Behandlungsräumen<br />
führen.<br />
Foto: Sleep & Smile<br />
DR. SMILEY IM WARTEZIMMER<br />
Bereits 2019 wurde Pepper im Wiener<br />
Zahninstitut Sleep & Smile eingesetzt.<br />
Die Zahnklinik ist spezialisiert auf die<br />
Behandlung von Kindern sowie von<br />
Menschen mit besonderen Bedürfnissen.<br />
Bei diesen Patientengruppen<br />
kann der Zahnarztbesuch mit Angst<br />
verbunden sein – für Pepper eine Aufgabe<br />
nach Maß. Unter dem Namen<br />
„Dr. Smiley“ hat der Service-Roboter<br />
im Wartezimmer seinen Auftritt: Er<br />
spielt, singt und tanzt mit den<br />
Wartenden oder verkürzt ihnen<br />
mit Quizfragen und Witzen die<br />
Zeit. Durch seine Aktivitäten<br />
lenkt er sie wirksam von der anstehenden<br />
Behandlung und ihren<br />
Ängsten ab. Das Behandlungsteam<br />
ist sehr zufrieden mit Dr.<br />
Smiley, da die zahnmedizinische<br />
Arbeit durch ihn oft einfacher und<br />
entspannter ablaufen kann. Viele<br />
Patientinnen und Patienten freuen<br />
sich sogar schon auf den nächsten<br />
Besuch in der Zahnklinik – und<br />
Dr. Smiley.<br />
ALLROUNDTALENT CRUZR<br />
Ein letztes Beispiel aus dem schweizerischen<br />
Thun, wo Dr. Christian Leithold<br />
seit 2020 mit dem Service-Roboter<br />
Cruzr zusammenarbeitet. Als einziger<br />
Unterstützung im Empfang,<br />
denn ein Praxis-Team im klassischen<br />
Sinn gibt es in der kieferorthopädischen<br />
Praxis nicht. Cruzr misst 1,20<br />
Meter und wiegt 45 Kilogramm. Am<br />
Kopf prangt ein großer Bildschirm,<br />
wodurch der Roboter weniger menschlich<br />
als Pepper wirkt. Dafür hat er andere<br />
Stärken, die er im Rahmen des Gesamtkonzepts<br />
der voll digitalisierten<br />
Praxis ausspielt.<br />
VIELSEITIG EINSETZBAR<br />
Aus Sicht der Patientinnen und Pa-
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
19_TITELTHEMA<br />
tienten stellt sich das<br />
so dar: Der Termin<br />
wird online gebucht<br />
und man erhält einen<br />
QR-Code auf das<br />
Handy. Wenn man<br />
die Praxis betritt, rollt Cruzr<br />
auf einen zu und bittet um<br />
den QR-Code. Alternativ<br />
könnte man seinen Namen<br />
auf dem Display eingeben,<br />
damit der Roboter den<br />
Menschen identifizieren<br />
kann. Während er ihn ins<br />
Wartezimmer führt, meldet<br />
er die Patientin oder<br />
den Patienten bereits im Praxissystem<br />
an und vielleicht verkürzt<br />
er auch die Wartezeit mit<br />
einem Tänzchen. Cruzr vergibt außerdem<br />
Termine und gibt Auskünfte zu<br />
den Kunstwerken in der Praxis oder<br />
zu sich selbst. Im Behandlungsraum<br />
spielt er auf Wunsch Erklärvideos ab<br />
und beantwortet Fragen dazu. Und<br />
natürlich kann er auch die Personen<br />
im Wartezimmer über etwaige Verspätungen<br />
informieren. Dank seiner<br />
technischen Ausstattung erledigt er<br />
(fast) alle Aufgaben des Praxisteams.<br />
Die menschliche Komponente kann<br />
der Service-Roboter natürlich nicht<br />
ersetzen. Aber das muss er auch nicht.<br />
Denn die meisten Patientinnen und<br />
Patienten reagieren positiv auf ihn.<br />
Aktuell macht Dr. Leithold bereits<br />
den nächsten Schritt und verwendet<br />
auch ChatGPT, einen ChatBot mit<br />
künstlicher Intelligenz. Seine Bewertung:<br />
„Dank der Einbindung von<br />
ChatGPT hat sich Cruzrs Interaktion<br />
mit meinen Patienten in eine unglaublich<br />
faszinierende Richtung entwickelt.“<br />
LOHNENDE INVESTITION?<br />
Die Kosten für den Kauf eines Roboters<br />
fallen abhängig von Typ, Garantiezeit<br />
und Lieferumfang (beispielsweise<br />
mehrere Sprachen) unterschiedlich<br />
hoch aus. Vor dem Betrieb müssen<br />
die Geräte außerdem in der neuen<br />
Umgebung trainiert werden, ähnlich<br />
wie Saugroboter, die die Wohnung vor<br />
dem Einsatz abscannen. Je nach Aufgabenspektrum<br />
können sie auch in<br />
das Softwaresystem der Praxis integriert<br />
werden, natürlich unter Beachtung<br />
des Datenschutzes. Technikaffine<br />
Praxisinhaberinnen und -inhaber<br />
können dabei selbst tätig werden und<br />
teilweise auch programmieren.<br />
Dienstleistungen rund um die Installation<br />
werden aber auch von vielen<br />
Händlern angeboten, wie die Internetrecherche<br />
zeigt. Die oben genannten<br />
Zahnärzte waren vom Nutzen ihrer<br />
technischen Assistenten überzeugt.<br />
Und wenn sich der Robotermarkt weiter<br />
so sprunghaft entwickelt wie in<br />
den letzten Jahren, kann für die Zukunft<br />
auch mit niedrigeren Preisen für<br />
Service-Roboter gerechnet werden.<br />
LÖSUNG DER ZUKUNFT<br />
Service-Roboter können das Praxis-<br />
Team spürbar entlasten. Sie nehmen<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
Arbeiten ab und verschaffen ihnen dadurch<br />
Freiraum für andere Tätigkeiten.<br />
Voraussetzung dafür ist, dass sich<br />
die Beteiligten auf so ein Experiment –<br />
und das ist es in Zahnarztpraxen momentan<br />
noch – einlassen wollen. Patientinnen<br />
und Patienten jedenfalls<br />
scheinen Robotern gegenüber nicht<br />
grundsätzlich abgeneigt zu sein, wie<br />
auch Studien zeigen. Wenn dann<br />
noch die medizinische Behandlung<br />
leichter durchgeführt werden kann,<br />
weil Patientinnen und Patienten entspannter<br />
aus dem Wartezimmer kom-<br />
Foto: Dr. Christian Leithold<br />
Zufrieden. Dr. Christian Leithold kann sich auf den Serviceroboter<br />
Cruzr verlassen, der fast alle Aufgaben des Praxisteams übernimmt.<br />
men, ist das mehr als ein willkommener<br />
Nebeneffekt. Gerade mit Blick auf<br />
den immer stärker zunehmenden<br />
Fachkräftemangel könnten Service-<br />
Roboter für die Zukunft ein Lösungsansatz<br />
sein. Dabei steht im Vordergrund,<br />
das Team durch den „Kollegen<br />
Roboter“ zu unterstützen und zu entlasten.<br />
INFO<br />
Kerstin Sigle<br />
Haben Sie schon einen Service-Roboter<br />
in Ihrer Praxis? Oder kennen<br />
Sie eine Praxis, die bereits Erfahrungen<br />
damit gemacht hat? Wir sind gespannt!<br />
Gerne können Sie an die Mailadresse<br />
sigle@lzk-bw.de schreiben und uns<br />
über Ihre Erfahrungen berichten.
20_TITELTHEMA<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen<br />
DER KI-DOKTOR MACHT NOCH<br />
ZU VIELE FEHLER<br />
Wenn man Microsoft-Gründer Bill Gates zur Künstlichen Intelligenz (KI)<br />
fragt, gibt er z. B. im Interview mit der Süddeutschen Zeitung die Antwort,<br />
dass intelligente Computer wohl bald Diagnosen stellen könnten – die<br />
Betonung liegt auf „wohl bald“. KI könne auch zu besserer Beratung der<br />
Patient*innen führen. Wie das Unternehmen IBM betont, gebe es im<br />
Gesundheitswesen „riesige Datenbestände“, die für KI-Technologien sehr<br />
gut geeignet seien. Intelligente Gesundheitssysteme müssen, so Gates,<br />
„sehr genau“ arbeiten und technisch noch sehr viel besser werden. Der<br />
KI-Doktor macht noch zu viele Fehler.<br />
KI könnte dafür sorgen, dass die Menschen<br />
Zugang zu Diagnostik und besserer<br />
Beratung bekommen, so der Microsoft-Gründer.<br />
Gesundheitssysteme in<br />
Ländern mit mittleren und hohen Einkommen<br />
könnten sehr viel effizienter<br />
werden. Konkretes Beispiel: die Bürokratie<br />
und deren Abbau im Gesundheitswesen.<br />
Gates ist davon überzeugt,<br />
dass Künstliche Intelligenz „den Papierkram<br />
für das medizinische Personal reduziert“.<br />
Zudem gebe es hohen Personalmangel<br />
im Gesundheitssektor. „Am<br />
wichtigsten ist es mir aber, dass auch<br />
Menschen in Ländern mit niedrigem<br />
Einkommen Zugang zu der Innovation<br />
haben, um zum Beispiel die Gesundheitsversorgung<br />
zu verbessern“, betonte<br />
der Unternehmer, Programmierer und<br />
Mäzen.<br />
GENAUIGKEIT<br />
Sehen, Hören, Analysieren, Entscheiden<br />
und Handeln: „Künstliche Intelligenz<br />
ist die Fähigkeit einer Maschine,<br />
menschliche Fähigkeiten zu imitieren“,<br />
lautet eine Definition zur KI des Lexikons<br />
der Neurowissenschaften im Verlag<br />
„Spektrum der Wissenschaft“. Und,<br />
»<br />
Im Gesundheitssektor muss es einen<br />
hohen Grad an Genauigkeit und regulatorischer<br />
Überprüfung geben, ehe man solch<br />
ein System einführen kann.«<br />
Bill Gates, Microsoft-Gründer<br />
Foto: Bill Gates/gettyimages<br />
KI im Gesundheitswesen. Für Microsoft-Gründer Bill Gates ist „noch nicht ganz klar“, ob KI<br />
tatsächlich eine Revolution für die Menschen im Gesundheitswesen sein werde.<br />
sehr relevant hinsichtlich der Gesundheitssysteme:<br />
Genauigkeit. „Im Gesundheitssektor<br />
muss es einen hohen<br />
Grad an Genauigkeit und regulatorischer<br />
Überprüfung geben, ehe man<br />
solch ein System einführen kann“, sagte<br />
Gates. Die Bing-Suchmaschine mit KI<br />
von der Microsoft Corp. sei einerseits<br />
zwar „viel genauer als ChatGPT“, andererseits<br />
sei Bing aber „nicht bereit für<br />
diese Art der Anwendung“ im Gesundheitswesen.<br />
Anders formuliert: Bei Diagnosen<br />
und medizinischer Beratung
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
21_TITELTHEMA<br />
Nicht bereit. Die Bing-Suchmaschine mit KI der Microsoft Corp. sei „viel genauer als<br />
ChatGPT“, allerdings sei Bing noch „nicht bereit für diese Art der Anwendung“ im Gesundheitswesen.<br />
Foto: CHUAN CHUAN/shutterstock.com<br />
Fällen [zu] unterstützen“, können Mediziner*innen<br />
„damit relevante Erkenntnisse<br />
gewinnen, die ihnen helfen<br />
können, kritische Fälle zuerst zu identifizieren,<br />
genauere Diagnosen zu stellen<br />
und potenziell Fehler zu vermeiden,<br />
während sie gleichzeitig Umfang und<br />
Komplexität elektronischer Patientenakten<br />
nutzen“, so das Unternehmen.<br />
Ob KI tatsächlich eine Revolution für<br />
die Menschheit im Gesundheitswesen<br />
sein werde, ist aus Bill Gates Sicht „noch<br />
nicht ganz klar“. Das gemeinnützige<br />
Future of Life Institute (Cambridge,<br />
Massachusetts) empfiehlt: „Leistungsstarke<br />
KI-Systeme sollten erst dann entwickelt<br />
werden, wenn wir sicher sind,<br />
dass ihre Auswirkungen positiv und<br />
ihre Risiken überschaubar sein werden.“<br />
Guido Reiter<br />
würde der KI-Doktor noch zu viele Fehler<br />
machen.<br />
Dass die Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen<br />
aber besonders die Effizienz<br />
befördern wird und dass die<br />
größtmögliche Sicherheit der Systeme<br />
gegeben sein müsse, ist für den Microsoft-Gründer<br />
eine Conditio sine qua<br />
non. Die Arbeit der Ärzt*innen könne<br />
dank des Werkzeugs KI deutlich nutzbringender<br />
und wirkungsvoller sein,<br />
denn KI finde Wissen und Informationen<br />
schneller als konventionelle Systeme.<br />
Am Beispiel Pandemie gibt es viele<br />
Parallelen zur KI: Man könne, erläuterte<br />
der Unternehmer, sich besser vorbereiten<br />
mit einem „international einsetzbaren<br />
Expertenteam, das mögliche Ausbrüche<br />
beobachtet, schnell reagiert und<br />
Regierungen beratend zur Seite steht“.<br />
Gates: „Außerdem brauchen wir bessere<br />
Diagnostik und Impfstoffe, die helfen,<br />
künftig mit einer Pandemie zurechtzukommen.“<br />
LÖSUNGEN<br />
Während Bill Gates die großen Zusammenhänge<br />
zur KI beschrieben hat, von<br />
Klima über Pandemie bis hin zum Gesundheitswesen,<br />
hat das Unternehmen<br />
IBM detailliert Lösungen für Künstliche<br />
Intelligenz benannt. Das maschinelle<br />
Lernen verändere die Art und Weise,<br />
wie Gesundheitsversorgung bereitgestellt<br />
werde, so die Spezialisten. Gesundheitsorganisationen<br />
hätten „riesige<br />
Datenbestände in Form von Krankenakten<br />
und -bildern, Bevölkerungsdaten,<br />
Anspruchsdaten und Daten<br />
klinischer Studien angesammelt“. KI-<br />
Technologien seien „gut geeignet, um<br />
diese Daten zu analysieren und Muster<br />
und Erkenntnisse abzuleiten, die Menschen<br />
alleine nicht finden<br />
könnten“. Mit<br />
„Deep Learning“ aus<br />
KI, einer speziellen Methode<br />
der Informationsverarbeitung,<br />
könnten<br />
Gesundheitsorganisationen<br />
„Algorithmen<br />
verwenden, um bessere<br />
geschäftliche und klinische<br />
Entscheidungen<br />
zu treffen und die Qualität<br />
der von ihnen bereitgestellten<br />
Erfahrungen zu verbessern“.<br />
Die Vorteile, die IBM von KI für das Gesundheitswesen<br />
sieht, sind die Bereitstellung<br />
benutzerorientierter Erfahrungen,<br />
die Verbindung unterschiedlicher<br />
Gesundheitsdaten und wiederum die<br />
Verbesserung der Effizienz im Betrieb<br />
bzw. in der Praxis. „Durch Verwendung<br />
großer Datenbestände und maschinellen<br />
Lernens können Gesundheitsorganisationen<br />
mit KI schneller und genauer<br />
Erkenntnisse gewinnen, was sowohl<br />
intern als auch bei Nutzern höhere Zufriedenheit<br />
ermöglicht“, so das Unternehmen.<br />
Gesundheitsdaten seien oft<br />
fragmentiert und lägen in verschiedenen<br />
Formaten vor. „Durch den Einsatz<br />
von Technologien für KI und maschinelles<br />
Lernen können Unternehmen<br />
unterschiedliche Daten verbinden, um<br />
ein einheitlicheres Bild der Personen<br />
hinter den Daten zu erhalten“, so IBM.<br />
MEDIZINISCHE BILDGEBUNG<br />
Die besondere Aufmerksamkeit gilt aus<br />
Sicht der Ärzt*innen KI-Lösungen im<br />
Zusammenhang mit medizinischer<br />
Bildgebung. Um „das arbeitsintensive<br />
Scannen von Bildern und Sichten von<br />
»<br />
Künstliche Intelligenz ist die<br />
Fähigkeit einer Maschine,<br />
menschliche Fähigkeiten wie<br />
logisches Denken, Lernen, Planen<br />
und Kreativität zu imitieren.«<br />
Europäisches Parlament<br />
INFO<br />
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein<br />
Teilgebiet der Informatik. Es umfasst<br />
alle Anstrengungen, deren Ziel<br />
es ist, Maschinen intelligent zu machen.<br />
Dabei wird Intelligenz verstanden<br />
als die Eigenschaft, die ein<br />
Wesen befähigt, angemessen und<br />
vorausschauend in seiner Umgebung<br />
zu agieren; dazu gehört die<br />
Fähigkeit, Sinneseindrücke wahrzunehmen<br />
und darauf zu reagieren,<br />
Informationen aufzunehmen, zu<br />
verarbeiten und als Wissen zu speichern,<br />
Sprache zu verstehen und zu<br />
erzeugen, Probleme zu lösen und<br />
Ziele zu erreichen. In der Medizin<br />
ist KI ein stark wachsender Teilbereich<br />
der künstlichen Intelligenz, bei<br />
dem digital vorliegende Informationen<br />
ausgewertet werden, um möglichst<br />
aussagekräftige Diagnosen zu<br />
stellen und optimierte Therapien<br />
vorzuschlagen.<br />
Quelle: Wikipedia
22_TITELTHEMA<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Cyberwehr BW<br />
ACHTUNG HACKERANGRIFF!<br />
WAS JETZT?<br />
Über das Internet sind wir weltweit verbunden. Das ist praktisch, aber auch<br />
riskant. Besonders medizinische Betriebe sollten sich bewusst sein, dass sie mit<br />
sensiblen Personendaten operieren, die gegen Angriffe von außen geschützt<br />
werden müssen. Firewalls und andere Vorsichtsmaßnahmen sind sehr<br />
effektiv. Trotzdem kann es passieren, dass Unbefugte in die Praxissoftware<br />
eindringen. Das Projekt „Cyberwehr BW“ hilft nach einem Hackerangriff.<br />
zertifiziert. Geprüft wird zudem, ob ein<br />
Dienstleister in der Nähe zur Verfügung<br />
steht. Für einzelne ausgewählte Landkreise<br />
ist das sogar garantiert.<br />
Schnell reagieren! Unbekannte haben sich Zugriff zum System verschafft. Die Cyberwehr BW steht<br />
nach Hackerangriffen auch Zahnarztpraxen zur Seite.<br />
INFO<br />
CYBERWEHR<br />
Nach einem IT-Sicherheitsvorfall<br />
kann man sich rund um die Uhr an<br />
diese kostenlose Hotline wenden:<br />
0800 - 292379347<br />
Die Nummer steht auch Einrichtungen<br />
aus dem medizinischen Bereich<br />
zur Verfügung. Für den Notfall findet<br />
man auf der Webseite von Cyberwehr<br />
BW zudem eine Liste mit<br />
Sofortmaßnahmen.<br />
Erste-Hilfe-Maßnahmen<br />
Es ist ein Alptraum: Der PC startet und<br />
sofort öffnet sich ein neues Fenster:<br />
„Ihr Computer wurde gehackt.“ Offensichtlich<br />
sind Kriminelle in das System<br />
eingedrungen und verlangen eine<br />
Geldzahlung. Zahlenmäßig ist solch<br />
ein Hackerangriff vergleichsweise selten,<br />
gefühlt aber umso dramatischer.<br />
Jedoch wird nicht jeder unbefugte Zugriff<br />
gleich bemerkt. Auch heimlich<br />
können Daten abgesaugt werden, oft<br />
sogar über längere Zeiträume. Gerade<br />
bei Gesundheitsdaten ist das unbefugte<br />
Eindringen in ein Betriebssystem<br />
eine Katastrophe!<br />
CYBERWEHR HILFT<br />
In Baden-Württemberg gibt es eine<br />
Kontakt- und Beratungsstelle, die eigens<br />
für solche Fälle gegründet wurde:<br />
Cyberwehr BW. Die telefonische Anlaufstelle<br />
bietet rund um die Uhr<br />
schnelle Hilfe im Notfall für kleine und<br />
mittlere Unternehmen – auch für Zahnarztpraxen.<br />
In einem kostenlosen Telefongespräch<br />
wird zunächst das Ausmaß<br />
des Schadens geklärt. Anschließend an<br />
die Meldung wird in den Schritten Diagnose,<br />
Schadensbegrenzung und Nachbereitung<br />
ein mögliches individuelles<br />
Maßnahmenpaket besprochen. Auf<br />
Wunsch können dann kostenpflichtig<br />
Expertinnen und Experten eingesetzt<br />
werden, welche Cyberwehr BW vermittelt.<br />
Die Preise für die Notfallhilfe werden<br />
vorab vereinbart. Alle vermittelten<br />
Fachleute sind einheitlich geschult und<br />
Foto: Adobe Stock/Montri<br />
GEMEINSAM GEGEN HACKER<br />
Cyberwehr BW und das einheitliche Vorgehen<br />
nach Hackerangriffen wurde im<br />
Rahmen eines Projekts am Forschungszentrum<br />
Informatik (FZI) Karlsruhe entwickelt<br />
und erprobt. Das Ministerium<br />
für Inneres, Digitalisierung und Kommunen<br />
Baden-Württemberg förderte das<br />
Projekt als Teil der Digitalisierungsstrategie<br />
digital@bw bis zum Juni 2022. Um<br />
das Projekt fortzuführen, werden derzeit<br />
verschiedene Finanzierungsmodelle diskutiert.<br />
Ziel des Projekts: mit einem gemeinsamen<br />
Netz aus Wirtschaft, Wissenschaft<br />
und Sicherheitsbehörden gegen<br />
Wirtschaftskriminalität anzukämpfen.<br />
Durch das weltumspannende Internet<br />
haben Kriminelle online oft leichtes<br />
Spiel. Gerade bei kleinen und mittleren<br />
Unternehmen stehen die Einfallstore<br />
weit offen. Gleichzeitig sind sie aufgrund<br />
ihrer größenbedingten Struktur oft mit<br />
einem Hackerangriff überfordert und<br />
auf externe Hilfe angewiesen. Cyberwehr<br />
BW bietet hierfür wirksame Hilfe im<br />
Notfall und koordiniert alle Maßnahmen,<br />
um den „Alptraum Hackerangriff“<br />
möglichst schnell zu beenden.<br />
TIPPS ZUR PRÄVENTION<br />
Prüfen Sie Daten und Links aus unbekannten<br />
Quellen, bevor Sie sie öffnen.<br />
Dies gilt insbesondere für Dateien mit<br />
der Endung *.exe. Verwenden Sie sichere<br />
Passwörter. Diese dürfen nicht öffentlich<br />
einsehbar sein. Nutzen Sie<br />
Passwortmanager. Erstellen Sie regelmäßig<br />
Backups. Bei einem Sicherheitsvorfall<br />
können die gesicherten Daten<br />
dann neu aufgespielt werden.<br />
Kerstin Sigle
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
23_TITELTHEMA<br />
Landesverband der Freien Berufe (LFB)<br />
WIE SCHÜTZT MAN SICH VOR<br />
CYBER-ANGRIFFEN?<br />
Angriffe aus dem Netz sind schon lange keine Fiktion mehr, sondern tagtägliche<br />
Realität. Egal ob Phishing, Hackerangriffe oder Datenspionage: Die digitalen Bedrohungen<br />
nehmen seit Jahren rasant zu. In den Fokus der Kriminellen rücken dabei immer<br />
öfter auch selbstständige Freiberuflerinnen und Freiberufler, die in ihren Praxen,<br />
Kanzleien, Apotheken und Büros mit hochsensiblen Daten und höchstpersönlichen<br />
Informationen ihrer Patienten- und Mandantenschaft zu tun haben. Das macht sie zu<br />
besonders beliebten Zielen digitaler Erpressungen.<br />
Der Landesverband der Freien Berufe<br />
Baden-Württemberg (LFB) bietet in Kooperation<br />
mit dem Landeskriminalamt<br />
Baden-Württemberg (LKA) deshalb eine<br />
Präventionsveranstaltung zum Thema<br />
Cybersicherheit an. Ein Experte der Zentralen<br />
Ansprechstelle Cybercrime (ZAC)<br />
des LKA wird über typische Cybercrime-<br />
Phänomene und Taktiken der Angreifer<br />
aufklären und empfehlenswerte Gegenmaßnahmen<br />
vorstellen.<br />
PRÄVENTIONSVERANSTALTUNG<br />
Die Informationsveranstaltung findet<br />
am Mittwoch, 27. September 2023, um<br />
18:30 Uhr bei der Bezirksärztekammer<br />
Nordwürttemberg (Jahnstraße 5, 70597<br />
Stuttgart-Degerloch) und digital als Livestream<br />
statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.<br />
Die Zahl der Plätze in Präsenz<br />
ist begrenzt. Der LFB bittet um verbindliche<br />
Anmeldung bis 25. September<br />
2023 per E-Mail an info@freie-berufebw.de.<br />
Bitte geben Sie an, ob Sie in Präsenz<br />
oder online teilnehmen möchten.<br />
Weitere Informationen zur Veranstaltung<br />
finden Sie auf der Webseite des<br />
Landesverbands der Freien Berufe.<br />
Dr. Manuel Wäschle, LFB<br />
INFO<br />
LFB ZUM THEMA CYBER-<br />
SICHERHEIT<br />
Die Veranstaltung findet hybrid<br />
statt. Bei Teilnahme (vor Ort in<br />
Stuttgart oder per Livestream)<br />
wird um Anmeldung gebeten. Alle<br />
Informationen finden Sie hier:<br />
https://www.freie-berufe-bw.de/<br />
index.php/presse/veranstaltungcybercrime<br />
Anzeige<br />
Präventions- und Informationsveranstaltung<br />
WIE SCHÜTZT MAN SICH<br />
VOR CYBER-ANGRIFFEN?<br />
Aktuelle Cybercrime-Phänomene,<br />
beliebte Taktiken der Angreifer und<br />
empfehlenswerte Gegenmaßnahmen<br />
27.09.2023 | 18:30 Uhr | hybrid<br />
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem<br />
Landeskriminalamt Baden-Württemberg<br />
Weitere Informationen unter<br />
www.freie-berufe-bw.de
24_BERUFSPOLITIK<br />
ZBW_7/2022<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Gemeinsame Konferenz der Öffentlichkeitsbeauftragten<br />
ZUKUNFT DER ZAHNÄRZTLICHEN<br />
VERSORGUNG IM FOKUS<br />
Die Vorstandswahlen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) lagen noch keine<br />
drei Wochen zurück, da lud der neu gewählte Vorstand gemeinsam mit der Bundeszahnärztekammer<br />
(BZÄK) zur traditionellen Konferenz der Öffentlichkeitsbeauftragten nach Köln.<br />
Hier wurde deutlich: Die strategische Positionierung gegenüber der Bundespolitik ist<br />
gerade in Zeiten wichtig, in denen die ambulante Versorgung durch politische Maßnahmen<br />
stark unter Druck steht. Erstmalig wurde die Kampagne „Zähne zeigen“ vorgestellt.<br />
Foto: KZBV/Knoff<br />
Präsentation. Martin<br />
Hendges, der neue<br />
Vorsitzende der KZBV<br />
stellte auf der Konferenz<br />
der Öffentlichkeitsbeauftragten<br />
die Kampagne<br />
„Zähne zeigen“ vor.<br />
Ein hohes Tempo bei der Vorlage von<br />
Gesetzen gehörte bereits unter dem<br />
Amtsvorgänger von Gesundheitsminister<br />
Lauterbach, dem CDU-Politiker Jens<br />
Spahn, zur zweifelhaften Charakteristika<br />
der Gesundheitspolitik. Denn ungeachtet<br />
des weiterhin bestehenden Reformbedarfs<br />
ist Schnelligkeit an sich<br />
kein Qualitätsmerkmal der Gesetzgebung.<br />
Vielmehr sollten handwerkliche<br />
Sorgfalt und eine enge Abstimmung<br />
mit den handelnden Akteuren des Gesundheitswesens<br />
im Mittelpunkt stehen.<br />
Zielsetzung müssten Regelungen<br />
sein, die die medizinische Versorgung<br />
im Sinne der Patientinnen und Patienten<br />
stärken. Dass die aktuelle Gesundheitspolitik<br />
diesem Ziel zuwiderlaufe,<br />
sei in den Monaten zuvor vielfach deutlich<br />
geworden – so die Kernbotschaft<br />
der Konferenz. Gerade die fehlende<br />
Wertschätzung des Ministers für den<br />
ambulanten Sektor ist weit mehr als<br />
nur ein Ärgernis für die niedergelassenen<br />
(Zahn-)ärztinnen und (Zahn-)ärzte.<br />
Diese Politik hat sich längst zu einer<br />
ernsthaften Bedrohung der bestehenden<br />
Versorgungsstrukturen entwickelt,<br />
wie auf der Konferenz deutlich wurde.<br />
GKV-FINSTG<br />
Folgerichtig standen das GKV-<br />
Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-<br />
FinStG) und dessen Folgen auf die<br />
zahnärztliche Versorgung im Mittelpunkt<br />
der Beratungen. Martin Hendges,<br />
neu gewählter Vorstandsvorsitzender<br />
der KZBV, stellte die erheblichen<br />
Auswirkungen des Gesetzes auf<br />
die Preis- und Mengenkomponente<br />
der Gesamtvergütung für die Zahnarztpraxen<br />
dar: Einerseits führe die<br />
Absenkung der Punktwerte zu einer<br />
Reduzierung der Einnahmen, während<br />
die Ausgaben inflationsbedingt<br />
stark ansteigen würden. „Die Inflation<br />
enteilt der Grundlohnsumme“, so<br />
Hendges mit Blick auf die Zahlen. Einer<br />
Inflation von 7,9 Prozent im Jahr<br />
2023 stehe eine Grundlohnsumme<br />
(GLS) von 3,45 Prozent gegenüber,<br />
wobei die vereinbarte Punktwertsteigerung<br />
infolge des Gesetzes um weitere<br />
0,75 Prozent gekürzt werden müsse.<br />
Auch im kommenden Jahr sei eine<br />
erhebliche Diskrepanz zwischen gekürzter<br />
GLS und der Inflation zu erwarten.<br />
Dadurch drohten schwere<br />
Auswirkungen auf die flächendeckenden,<br />
wohnortnahen Versorgungsstrukturen.<br />
Insbesondere werde die<br />
Inhaberschaft gegenüber einer Anstellung<br />
immer unattraktiver. Einzelpraxen<br />
in strukturschwachen Gebieten<br />
würden verschwinden, während<br />
größere Einrichtungen – gerade investorengeführte<br />
MVZ (iMVZ) – in einkommensstarken<br />
Gebieten zunehmen.<br />
PAR-VERSORGUNG<br />
Nicht weniger gravierend für die Versorgung<br />
der Versicherten sei die Mengenbegrenzung<br />
durch die faktische<br />
Wiedereinführung der strengen Budgetierung.<br />
Hendges machte zudem
ZBW_7/2022<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
25_BERUFSPOLITIK<br />
»<br />
Die Inflation enteilt der Grundlohnsumme.«<br />
Martin Hendges, Vorsitzender der KZBV<br />
deutlich, wie die Begrenzung der Gesamtvergütung<br />
insbesondere der Parodontitis-Versorgungsstrecke<br />
die notwendigen<br />
Mittel entziehen würde.<br />
Durch die Aufnahme der neuen Leistungen<br />
bei einer mehrjährigen Behandlungsdauer<br />
komme es zwangsläufig<br />
zu einer Mengenausweitung.<br />
So würden 61 Prozent der geplanten<br />
PAR-Leistungen in Jahr 1 induziert,<br />
fielen aber erst in den Folgezeiträumen<br />
Jahr 2 und Jahr 3 an. Durch die<br />
festen Obergrenzen stünden die notwendigen<br />
und politisch zugesicherten<br />
Finanzmittel für die Parodontitis-Versorgung<br />
nicht in ausreichendem<br />
Maße zur Verfügung, wie Hendges<br />
betonte. Dies werde zwangsläufig<br />
negative Folgen für die Mund- und<br />
Allgemeingesundheit mit sich bringen.<br />
PARO-CHECK<br />
Die Brisanz dieser politischen Entscheidung<br />
und die Bedeutung einer<br />
strukturierten PAR-Versorgung auf<br />
dem aktuellen Stand der Wissenschaft<br />
bekräftigte Dr. Romy Ermler,<br />
Vizepräsidentin der Bundeszahnärztekammer.<br />
Ihr Resümee nach einem<br />
Jahr BZÄK-Aufklärungskampagne<br />
zu Parodontitis (www.paro-check.<br />
de): Die „stille Volkskrankheit“ werde<br />
nach wie vor von einer großen<br />
Mehrheit der Bevölkerung unterschätzt,<br />
der Behandlungsbedarf sei<br />
offensichtlich. Die erfolgreiche Aufklärungsarbeit,<br />
die seit der Einführung<br />
der neuen PAR-Leistungen bundesweit<br />
umgesetzt worden ist, laufe<br />
jedoch ins Leere, wenn dieser Behandlungsstrecke<br />
gleichzeitig die<br />
nötigen Mittel entzogen würden.<br />
KZBV-KAMPAGNE<br />
Es gelte daher, eine nachhaltige Beschädigung<br />
der Versorgungsstrukturen<br />
auf Kosten der Versicherten zu<br />
verhindern, so die einhellige Meinung.<br />
Der Berufsstand müsse sich<br />
gegen die kurzsichtige Sparpolitik<br />
der Bundesregierung zur Wehr setzen.<br />
Kurzfristig sei das Ziel die extrabudgetäre<br />
Vergütung der PAR-Leistungen.<br />
Langfristig kämpfe man für<br />
die generelle Abschaffung von Obergrenzen<br />
im ambulanten Sektor. Damit<br />
war die Ausgangslage für die öffentlichkeitswirksame<br />
Kampagne<br />
„Zähne zeigen“ abgesteckt, die der<br />
KZBV-Vorsitzende tags darauf skizzierte<br />
(siehe Infokasten).<br />
PERSPEKTIVE<br />
Dass das GKV-FinStG nur der Auftakt<br />
für weitere Spargesetze gewesen<br />
sei, darüber bestand wenig Zweifel.<br />
Im Rahmen eines „GKV-FinStG 2.0“<br />
will das Bundesgesundheitsministerium<br />
Empfehlungen für eine stabile,<br />
verlässliche und solidarische Finanzierung<br />
der GKV erarbeiten und hierbei<br />
insbesondere die Ausgabenseite<br />
der GKV betrachten. Die Gesetzgebung<br />
dazu soll noch vor Veröffentlichung<br />
der Empfehlungen des Schätzerkreises<br />
im November 2023 abgeschlossen<br />
sein. Umso überzeugender<br />
und faktenbasiert müsse die Begleitung<br />
der Gesundheitspolitik durch<br />
die zahnärztlichen Körperschaften<br />
gerade bei der geplanten Evaluierung<br />
der Budgetierung im PAR-Bereich<br />
sein.<br />
GESETZESMARATHON<br />
Auch die weiteren, derzeit in der Abstimmung<br />
befindlichen Gesetzesvorhaben<br />
hätten teils unmittelbare Auswirkungen<br />
auf die zahnärztliche Versorgung.<br />
Während das „Versorgungsgesetz<br />
I“ maßgeblich die kommunale<br />
Gesundheitsversorgung in den Blick<br />
nehme, gehe es beim angekündigten<br />
„Versorgungsgesetz II“ um das seit<br />
Jahren virulente Thema der Regulierung<br />
von Medizinischen Versorgungszentren.<br />
Gründung, Zulassung,<br />
Betrieb und Transparenz von<br />
MVZ sollen demnach gerade mit<br />
Blick auf investorenbetriebene MVZ<br />
weiterentwickelt werden. Unabhängig<br />
vom BMG-Entwurf wurde im<br />
Frühjahr 2023 eine Bundesratsinitiative<br />
für ein „iMVZ-Regulierungsgesetz“<br />
auf den Weg gebracht. Wie weitgehend<br />
die finalen Regelungen sein<br />
werden, war bei Redaktionsschluss<br />
noch nicht abzusehen.<br />
Unter dem Dach einer Digitalisierungsstrategie<br />
solle ein „Digitalgesetz“<br />
für Verbesserungen des Behandlungsalltags<br />
mit digitalen Lösungen<br />
sorgen. Das „Gesundheitsdatennutzungsgesetz“<br />
soll einen sinnvollen<br />
Umgang mit Gesundheitsdaten<br />
sowohl für die Behandlung als<br />
auch für die medizinische Forschung<br />
regeln. Nicht zuletzt sollen bis Ende<br />
September 2023 die Empfehlungen<br />
zum Bürokratieabbau vorliegen. Auf<br />
Basis dieser Empfehlungen soll<br />
schließlich das im Koalitionsvertrag<br />
verankerte „Bürokratie-Entlastungsgesetz“<br />
entstehen. Damit dies nach<br />
jahrelangen Lippenbekenntnissen<br />
wirklich zu spürbaren Erleichterungen<br />
im Praxisalltag führt, ist wiederum<br />
eine enge fachliche Begleitung<br />
durch die (zahn-)ärztlichen Berufsvertretungen<br />
angezeigt.<br />
AUSBLICK<br />
Wie Martin Hendges betonte, seien<br />
somit zahlreiche weitere Vorhaben<br />
und Gesetzgebungen angekündigt<br />
oder bereits in Arbeit, die ein teilweise<br />
hohes Konfliktpotenzial für die<br />
Zahnärzteschaft aufweisen würden.<br />
Daher sei es absolut notwendig, auf<br />
verschiedenen Feldern für den Erhalt<br />
der flächendeckenden Versorgungsstrukturen<br />
und gegen eine weitere<br />
Verschlechterung der Bedingungen<br />
der Berufsausübung anzukämpfen.<br />
INFO<br />
Dr. Holger Simon-Denoix<br />
Die bundesweite Kampagne „Zähne<br />
zeigen“ verfolgt das Ziel, die langfristigen<br />
Folgen der Budgetierung für<br />
die zahnmedizinische Versorgung<br />
am Beispiel der Paradontitisbehandlung<br />
und die Auswirkungen für die<br />
Zahn- und Allgemeingesundheit<br />
aufzuzeigen.<br />
Auf den Seiten 22 ff. lesen Sie mehr<br />
über die Kampagne „Zähne zeigen“<br />
und darüber, wie<br />
die Praxen diese<br />
Kampagne ganz<br />
konkret unterstützen<br />
können.
26_BERUFSPOLITIK<br />
ZBW_7/2022<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Kampagne für eine präventionsorientierte Patientenversorgung<br />
„ZÄHNE ZEIGEN“ GEGEN DIE<br />
FOLGEN DER BUDGETIERUNG<br />
Im vergangenen Jahr wurde mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) die<br />
gesetzliche Budgetierung zahnärztlicher Leistungen wieder aus der Mottenkiste geholt. Und<br />
das, obwohl der Anteil an den Gesamtausgaben der GKV für die vertragszahnärztliche<br />
Versorgung durch die präventionsorientierte Ausrichtung seit Jahren kontinuierlich gesunken ist.<br />
Foto: MEDIUM Werbeagentur GmbH<br />
Informationsplattform. Zentrale Anlaufstelle für die Kampagne „Zähne zeigen“ ist die Webseite www.zaehnezeigen.info. Dort<br />
können sich Interessierte informieren und Protestmails direkt an die regionalen Abgeordneten verschicken.<br />
Im Zielkonflikt zwischen Kostendämpfung<br />
und präventionsorientierter Versorgung<br />
hat sich die Politik ganz bewusst<br />
auf die Seite der Kostendämpfung<br />
geschlagen und damit gegen die Versorgung<br />
und die berechtigten Ansprüche<br />
der Versicherten gestellt. Dies ging klar<br />
zu Lasten der Parodontitistherapie.<br />
Trotz eindeutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse<br />
und nachprüfbarer Sachargumente<br />
hat Bundesgesundheitsminister<br />
Lauterbach den Rotstift bei der modernen<br />
Parodontitistherapie angesetzt.<br />
Dieser tiefgreifende politische Einschnitt<br />
kann für die neue Therapie der<br />
Parodontitis nicht ohne Folgen bleiben.<br />
Ganz davon abgesehen, ist eine solche<br />
Politik in höchstem Maße ungerecht gegenüber<br />
denjenigen, die unter hohem<br />
Einsatz während der Corona-Pandemie<br />
die zahnmedizinische Versorgung der<br />
Bevölkerung zu jedem Zeitpunkt vollumfänglich<br />
erhalten haben und jetzt –<br />
statt einen Ausgleich der gestiegenen Betriebskosten<br />
und der Folgen durch den<br />
zunehmenden Fachkräftemangel zu erhalten<br />
– Gefahr laufen, auch noch durch<br />
die Wiedereinführung der strikten Budgetierung<br />
und der basiswirksamen Limitierung<br />
der Punktwerte die Patientenversorgung<br />
im Bereich der Parodontitistherapie<br />
nicht mehr umfänglich sichern zu<br />
können. Dass letztlich auch die Niederlassungswilligkeit<br />
sinkt und frühzeitige<br />
Praxisschließungen mit fatalen Folgen<br />
für die flächendeckende und wohnortnahe<br />
Versorgung befördert werden, ist<br />
eine logische Folge.<br />
BUNDESWEITE KAMPAGNE<br />
Damit die zahnärztliche Versorgung unserer<br />
Patientinnen und Patienten nicht<br />
unter die Räder gerät und die Zahnarztpraxen<br />
künftig wieder unter angemessenen<br />
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
tätig werden können, hat die KZBV<br />
gemeinsam mit allen KZVen und im<br />
Schulterschluss mit der Bundeszahnärztekammer,<br />
den Länderzahnärztekammern<br />
sowie den zahnärztlichen Verbänden<br />
die bundesweite Kampagne „Zähne<br />
zeigen!“ ins Leben gerufen. Mit ihr sollen<br />
die langfristigen Folgen der Budgetierung<br />
verständlich, nachvollziehbar<br />
und einprägsam kommuniziert werden.<br />
Dabei wollen wir über die Zahnarztpraxen<br />
die Patientinnen und Patienten erreichen.<br />
#ZÄHNEZEIGEN<br />
Zentraler Dreh- und Angelpunkt der Kampagne<br />
ist die Webseite zaehnezeigen.info,<br />
auf der sich Patientinnen und Patienten<br />
ebenso wie Praxisteams über die drohenden<br />
Folgen für die Versorgung informieren<br />
können. Leicht verständliche
ZBW_7/2022<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
27_BERUFSPOLITIK<br />
Statements und Erklärtexte helfen bei<br />
der Vermittlung der konkreten negativen<br />
Auswirkungen des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes.<br />
Mittels QR-Codes<br />
kann von den Materialien direkt die<br />
Kampagnenseite erreicht werden. Zusätzlich<br />
vermittelt ein anschauliches Erklärvideo<br />
die Zielsetzung und Handhabung<br />
der Kampagne im Praxisteam.<br />
Flankiert werden diese Maßnahmen von<br />
einer Social Media-Aktion auf Twitter<br />
und Instagram, die unter dem Hashtag<br />
#zähnezeigen mit ausdrucksvollen Bildern<br />
Aufmerksamkeit erzeugt.<br />
Praxis-Info-Kit: Mit Postern, Flyern und Plakaten können die Praxen auf die Kampagne aufmerksam<br />
machen und so mit den Patientinnen und Patienten ins Gespräch über den Protest<br />
kommen.<br />
PROTESTMAILS<br />
Zudem ruft die Webseite Patientinnen<br />
und Patienten dazu auf, sich direkt an<br />
ihre regionalen Abgeordneten und politische<br />
Entscheidungsträgerinnen und<br />
Entscheidungsträger auf Landes- und<br />
Bundesebene zu wenden. So soll darauf<br />
hingewiesen werden, dass die Kostendämpfungspolitik<br />
der Patientenversorgung<br />
schadet und ein Ende finden muss.<br />
In den kommenden Monaten werden<br />
bundesweit in allen Zahnarztpraxen<br />
doppelseitige Plakate, Postkarten, Informationsflyer,<br />
Thekenaufsteller, Stempel<br />
und Buttons mit der aufmerksamkeitsstarken<br />
Botschaft „Diagnose Sparodontose“<br />
auf die Kampagne aufmerksam<br />
machen. Ergänzt wird dieser Slogan<br />
durch Leitsätze zu drohenden regionalen<br />
Versorgungsproblemen („Versorgung<br />
örtlich betäubt“) und den gekürzten<br />
Mitteln zur Behandlung der Parodontitis<br />
(„Von dieser Gesundheitspolitik<br />
bekommt man Zahnfleischbluten,<br />
Herr Lauterbach“).<br />
Dazu betont Dr. Torsten Tomppert,<br />
Vorstandsvorsitzender der KZV BW<br />
und Präsident der LZK BW: „Wir Zahnärztinnen<br />
und Zahnärzte in Baden-<br />
Württemberg müssen gemeinsam mit<br />
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
unsere Stimme deutlich erheben<br />
und unsere Patientinnen und Patienten<br />
aufklären. Nur wenn Sie, liebe<br />
Kolleginnen und Kollegen, mit Ihren<br />
Praxisteams die Kampagne „Zähne zeigen!“<br />
aktiv unterstützen, tatkräftig mitarbeiten<br />
und sie in Ihren Praxen an die<br />
Patientinnen und Patienten herantragen,<br />
wird sie ein Erfolg werden. Ihre<br />
KZV BW, die LZK BW und die KZBV<br />
werden Sie in den kommenden Wochen<br />
über die weiteren konkreten Maßnahmen<br />
informieren. Machen Sie mit, wir<br />
brauchen Sie!“<br />
KZBV/KZV BW<br />
INFO<br />
DIE KAMPAGNE „ZÄHNE<br />
ZEIGEN“ AUF EINEN BLICK<br />
Kampagnen-Start: 1. Juni 2023<br />
Laufzeit: Die Kampagne läuft bis<br />
Herbst dieses Jahres und damit parallel<br />
zum politischen Entscheidungsprozess<br />
über Maßnahmen zur langfristigen<br />
Stabilisierung der GKV-Finanzen.<br />
Foto: KZV BW<br />
Ziel: Kurzfristig: PAR-Behandlung<br />
extrabudgetär stellen / Langfristig:<br />
Abschaffung der Budgetierung<br />
Inhalt: Patient*innen werden mobilisiert,<br />
über die Webseite www.zaehnezeigen.info<br />
an ihre lokalen Bundestagsabgeordneten<br />
vorformulierte<br />
E-Mails zu versenden und so politischen<br />
Druck auszuüben.<br />
Info: www.zaehnezeigen.info<br />
sowie auf www.kzvbw.de.<br />
Für alle Fragen rund um die<br />
Kampagne „Zähne<br />
zeigen“ können Sie sich<br />
gerne mit uns in<br />
Verbindung setzen.<br />
Abbildung: KZV BW<br />
„Zähne zeigen“. Unter dem Hashtag<br />
#zähnezeigen geht die Kampagne<br />
online viral. Verschiedene Beispiele<br />
für Posts in den sozialen Medien<br />
sind auf der Kampagnen-Webseite<br />
hinterlegt.<br />
Kontakt: Stabsstelle Kommunikation<br />
und Politik<br />
0711 7877-218<br />
presse@kzvbw.de<br />
Albstadtweg 9<br />
70567 Stuttgart
28_BERUFSPOLITK<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Vertreterversammlung der BZK Freiburg in Rust<br />
ABSCHIED UND NEUWAHL<br />
Traditionell einen Tag vor Beginn der 47. Jahrestagung der südbadischen Zahnärzteschaft<br />
tagte die Vertreterversammlung der Bezirkszahnärztekammer (BZK) Freiburg. In<br />
diesem Jahr markierte das Treffen der Delegierten – noch vor Ende der Wahlperiode –<br />
einen neuen Abschnitt in der Geschichte der Freiburger BZK: Nach 12 Jahren im Amt<br />
trat Dr. Peter Riedel von seinem Vorsitz zurück. Als Nachfolger wählten die Delegierten<br />
einstimmig das bisherige Vorstandsmitglied Dr. Norbert Struß.<br />
» Die Verabschiedung des<br />
GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes war<br />
ein rabenschwarzer Tag.«<br />
Dr. Peter Riedel<br />
Foto: Cornelia Schwarz/IZZBW<br />
Neue Strukturen. Als neuer Vorsitzender strebt Dr.<br />
Norbert Struß einen engen Kontakt zu den Universitäten<br />
und einen Schulterschluss in der Zusammenarbeit<br />
mit der Ärzteschaft an.<br />
Die diesjährige Eröffnungsansprache<br />
von Dr. Peter Riedel war zugleich<br />
seine Abschiedsrede. Nach über einem<br />
Jahrzehnt an der Spitze der südbadischen<br />
Zahnärzteschaft gab er<br />
sein Amt vorzeitig ab, da er im Dezember<br />
2022 in den Vorstand der<br />
Kassenzahnärztlichen Vereinigung<br />
(KZV) Baden-Württemberg gewählt<br />
worden war. In seinem Vortrag kritisierte<br />
Riedel vor allem die Digitalisierungsstrategie<br />
des Gesundheitsministeriums.<br />
Sei die Telematik als<br />
größtmögliche Entlastung angekündigt<br />
worden, so habe sich diese „mit<br />
mehr Arbeit als je zuvor“ eher zu einer<br />
Belastung für die Praxen entwickelt.<br />
Auch die Verabschiedung des<br />
GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes<br />
am 20. Oktober 2022 fand keine lobende<br />
Erwähnung in seiner Rede.<br />
„Als rabenschwarzen Tag“, bezeichnete<br />
der scheidende Vorsitzende diesen<br />
Tag, da damit die Parodontitistherapie,<br />
um die man so lange gerungen<br />
hatte, komplett infrage gestellt<br />
würde. Seine Forderung, diese Budgetierungen<br />
abzulehnen, quittierten<br />
die Delegierten mit spontanem Applaus.<br />
FACHKRÄFTEMANGEL<br />
Auch der Fachkräftemangel im Bereich<br />
der ZFA wurde im Rahmen der<br />
Vertreterversammlung (VV) mehrfach<br />
thematisiert. Dr. Bert Bauder,<br />
stellvertretender Präsident der Landeszahnärztekammer<br />
(LZK) Baden-<br />
Württemberg, informierte die VV<br />
über eine geplante Kampagne, mit<br />
der die Kammer potenzielle Auszubildende<br />
auf die attraktiven Karrieremöglichkeiten<br />
in der Zahnmedizin<br />
aufmerksam machen wolle. So soll<br />
der kürzlich veröffentlichte neue<br />
ZFA-Imagefilm noch diesen Sommer<br />
als Werbung in die Kinos kommen.<br />
Zudem wollen die Verantwortlichen<br />
eine Aufwertung des Ausbildungsberufes<br />
durch die Etablierung eines<br />
DH-Studiengangs an der Universität<br />
Freiburg erreichen. Dieser soll in Zusammenarbeit<br />
mit dem Zahnmedizinischen<br />
Fortbildungszentrum (ZFZ)<br />
Stuttgart und Prof. Dr. Petra Ratka-<br />
Krüger etabliert werden.<br />
BILANZ<br />
Dr. Georg Bach, stellvertretender<br />
BZK-Vorsitzender und Gutachterreferent,<br />
gab einen strukturierten<br />
Überblick über die Situation des Gutachterwesens.<br />
Dem Trend der Vorjahre<br />
folgend, nahm die Zahl der Privatgutachten<br />
im letzten Jahr weiterhin<br />
ab. Waren es im Jahr 2017 noch 48<br />
Gutachten, wurden 2023 mit 20 Gutachten<br />
nicht einmal halb so viele angefordert.<br />
Dr. Helen Schultz, Mitglied im BZK-<br />
Vorstand und Ansprechpartnerin für<br />
Studierende und junge Zahnärzt*innen,<br />
berichtete vom Austausch mit<br />
den Studierenden und der Fachschaft.<br />
Dabei wolle man, so ihr erklärtes<br />
Ziel, „jeden Zahnarzt ab dem<br />
Studium bis zur eigenen Niederlassung<br />
begleiten“.<br />
Aus seinem Referat „Praxisführung“<br />
berichtete Dr. Norbert Struß, noch in<br />
seiner Funktion als Mitglied des<br />
BZK-Vorstands, über die Corona-Änderungen<br />
zum 2. Februar dieses Jah-
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
29_BERUFSPOLITK<br />
res und die teilweise recht komplizierten<br />
Regularien der EU-MDR.<br />
Mit sichtlicher Freude blickte Prof.<br />
Dr. Elmar Hellwig auf die Entwicklung<br />
der 47. Jahrestagung der südbadischen<br />
Zahnärzteschaft zurück.<br />
„Mittlerweile ist Rust einer der größten<br />
Kongresse in Deutschland geworden“,<br />
berichtete Prof. Hellwig, der für<br />
die Leitung des wissenschaftlichen<br />
Programms der Tagung verantwortlich<br />
zeichnet. Im Laufe der Jahre seien<br />
über 200 Referent*innen nach<br />
Rust gekommen und stünden nach<br />
wie vor sofort in den Startlöchern,<br />
wenn sie angefragt würden. Trotz der<br />
Vielzahl an hochkarätigen Themengebieten,<br />
die in den Vorjahren bereits<br />
bearbeitet wurden, bekräftigte Prof.<br />
Hellwig, dass er noch zahlreiche Themengebiete<br />
auf der Agenda habe, die<br />
sich als Tagungsschwerpunkt eignen.<br />
WAHLEN<br />
Die an die Vorträge angeschlossenen<br />
Wahlen bestätigten Dr. Norbert Struß<br />
einstimmig, mit einer Enthaltung,<br />
im Amt als neuen Vorsitzenden und<br />
Neuer Vorstand. Prof. Dr. Elmar Hellwig, Dr. Helen Schultz, Dr. Norbert Struß, Dr. Martin Jablonka, und Dr.<br />
Georg Bach (v. l.).<br />
somit als Nachfolger von Dr. Peter<br />
Riedel. Stellvertretender Vorsitzender<br />
bleibt Dr. Georg Bach, Freiburg.<br />
Als neues Vorstandsmitglied wurde<br />
ZA Martin Jablonka, Bad Säckingen,<br />
gewählt. Weitere Mitglieder des Vor-<br />
stands bleiben Prof. Dr. Elmar Hellwig<br />
und Dr. Helen Schultz, beide aus<br />
Freiburg.<br />
Cornelia Schwarz<br />
Foto: C.Schwarz/IZZ BW<br />
Treffen der VV-Vorsitzenden der KZVen<br />
BERUFSPOLITISCHER AUSTAUSCH<br />
Am 12. und 13. Mai 2023 fand auf Einladung der KZV Rheinland-Pfalz in<br />
Ludwigshafen im Hotel der BASF ein Treffen der VV-Vorsitzenden der KZVen statt.<br />
Foto: KZV RLP<br />
Wir haben uns intensiv ausgetauscht<br />
über die zu erwartenden Einschränkungen<br />
im Zahlungsfluss an die Kolleginnen<br />
und Kollegen durch die Budgetierungen<br />
des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes,<br />
über Satzungsangelegenheiten und über<br />
Erfahrungen mit den Aufsichtsbehörden.<br />
Robert Schwan, Vorsitzender der VV der KZV RLP
30_FORTBILDUNG<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
47. Jahrestagung der südbadischen Zahnärzteschaft in Rust<br />
PRÄVENTION, REPARATUR<br />
UND REGENERATION<br />
Fotos: Michael Bamberger<br />
Zur 47. Jahrestagung der südbadischen Zahnärztinnen und Zahnärzte unter der wissenschaftlichen<br />
Leitung von Prof. Dr. Elmar Hellwig, Freiburg, kamen Mitte April renommierte<br />
Referent*innen aus der Schweiz und Deutschland nach Rust. Mit dem Thema „Prävention,<br />
Reparatur und Regeneration – Bausteine einer minimalinvasiven Zahnmedizin“ erwartete die<br />
über 2000 Teilnehmer*innen ein praxisbezogenes und vielseitiges Fortbildungsprogramm.<br />
Dr. Norbert Struß, der am Vorabend zum<br />
Vorsitzenden der Bezirkszahnärztekammer<br />
Freiburg (BZK Freiburg) gewählt<br />
wurde, eröffnete die Veranstaltung und<br />
freute sich über das große Interesse der<br />
Anwesenden. Er dankte Dr. Peter Riedel,<br />
der nach zwölf Jahren als Vorsitzender<br />
der BZK Freiburg zurückgetreten war, für<br />
seine prägende Rolle in der Entwicklung<br />
dieser Tagung. Dr. Struß lobte Dr. Riedel<br />
für seinen engagierten Einsatz und die<br />
hervorragende Vorbereitung der Tagung.<br />
Ein weiterer Dank ging an Prof. Dr. Elmar<br />
Hellwig für die wissenschaftliche<br />
Vorbereitung und die ausgezeichnete<br />
Wahl des Tagungsthemas. Dr. Struß hob<br />
hervor, dass es erneut gelungen sei, eine<br />
praxisnahe und spannende Fortbildung<br />
zu gestalten, die den Teilnehmenden<br />
wertvolles Wissen vermittle.<br />
Prof. Dr. Elmar Hellwig beschrieb in seiner<br />
Einführung, dass der Einsatz von primärpräventiven<br />
Maßnahmen bekannt<br />
ist, um zahlreiche orale Erkrankungen zu<br />
verhindern oder einzuschränken, um die<br />
Lebensqualität der Patient*innen nicht<br />
zu beeinträchtigen. Weniger offensichtlich<br />
seien jedoch Maßnahmen der sekundären<br />
und tertiären Prävention, die darauf<br />
abzielen, Schäden während oder<br />
nach einer Therapie zu vermeiden. Hierzu<br />
zählen die Vermeidung von periimplantären<br />
Erkrankungen, der Einsatz<br />
spezieller Techniken und Verfahren während<br />
und nach einer Zahnextraktion sowie<br />
reparative und regenerative Verfahren.<br />
Aus diesem Grund sind die Vorträge<br />
auf die Aspekte der Prävention, Reparatur<br />
und Regeneration ausgerichtet.<br />
PERIIMPLANTITIS<br />
Den Auftakt machte Dr. Philipp Sahrmann,<br />
Basel, mit seinem Vortrag „Präventive<br />
Konzepte zur Vermeidung periimplantärer<br />
Erkrankungen“. „Bei Periimplantitis<br />
hat die Vermeidung der Erkrankung<br />
allerhöchsten Stellenwert, weil<br />
die Erfolgsraten der Therapie niedrig<br />
sind“, betonte er. Die Prophylaxe vor Implantation<br />
sei die Grundlage für die spätere<br />
Implantation. Neben der täglichen<br />
Reinigung mit der Single Brush empfiahl<br />
er die Verwendung von InterdentalBürsten,<br />
insbesondere für einzelne Stellen.<br />
Von Superfloss riet er ab, da das Risiko<br />
von Ablagerungen bestehe, die zu kleinen<br />
Abszessen führen können. Auch die<br />
Rauchberatung sei ein wichtiger Aspekt,<br />
da eine Parodontaltherapie ohne Rauchberatung<br />
als „unethisch“ gelte. Dr. Sahrmann<br />
wies auch auf die hohe Dunkelziffer<br />
von Diabetes mellitus hin, die in<br />
Deutschland bei zwei Millionen liege.<br />
Eine einfache Prüfung könne mittels des<br />
HbA1cTests erfolgen. Bei vorhandenen<br />
Implantaten bleibe die Vorgehensweise<br />
im Wesentlichen unverändert. Ursache<br />
und Risikofaktoren müssten kontrolliert<br />
und ein Update der Anamnese durchgeführt<br />
werden. Der Fokus liege auf der<br />
Prüfung von Blutungsneigung und Taschentiefen.<br />
Bei periimplantärer Mukositis<br />
sind spezifische Maßnahmen notwendig,<br />
da herkömmliche Methoden wie die<br />
Verwendung von Chlorhexidin und Natriumhypochlorit<br />
oft begrenzte Wirkung<br />
zeigen. Um die Titanoberflächen zu schonen,<br />
empfahl Prof. Sahrmann, für die<br />
Reinigung Pulverstrahlgeräte einzusetzen,<br />
da sie einen umfassenden Zugang ermöglichten,<br />
nur minimalen Abtrag ver
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
31_FORTBILDUNG<br />
ursachten und ihre Anwendung für die<br />
Patient*innen angenehm sei. Die gefürchteten<br />
Emphyseme treten laut Dr.<br />
Sahrmann äußerst selten auf. Die Reinigung<br />
mit dem Scaler sei ein weiterer<br />
wichtiger Schritt, bevor die Oberfläche<br />
mit einer Polierpaste oder niedrig abrasiven<br />
Pulvern poliert werden kann.<br />
WEICHGEWEBSAUGMENTATION<br />
Im Vortrag „Weichgewebsaugmentation<br />
mit Gewebeersatzmaterialien“ von Dr.<br />
Dr. Eik Schiegnitz aus Mainz standen<br />
moderne Techniken zur Augmentation<br />
des Weichgewebes im Fokus. Dr. Schiegnitz<br />
hob hervor, dass ein gesundes Weichgewebe<br />
eine wichtige Voraussetzung für<br />
den Langzeiterfolg von Implantaten sei.<br />
Eine Breite der keratinisierten Mukosa<br />
von mehr als drei Millimetern sei entscheidend<br />
für ästhetische Ergebnisse,<br />
während eine reduzierte Breite von weniger<br />
als zwei Millimeter mit einem erhöhten<br />
Risiko für Periimplantitis assoziiert<br />
sei. Autologe Implantate werden laut Dr.<br />
Schiegnitz immer noch als Goldstandard<br />
betrachtet. Bei den Entnahmetechniken<br />
sei die ZucchelliTechnik möglicherweise<br />
weniger invasiv im Vergleich zur TrapdoorTechnik,<br />
jedoch sei die Morbidität<br />
vergleichbar laut wissenschaftlicher Datenlage.<br />
Ein häufiger Fehler bei der Implantatpositionierung<br />
bestehe darin, die<br />
Messung von zwei Millimetern plus der<br />
Hälfte des Implantatdurchmessers zu<br />
vernachlässigen. „Viele Implantate sitzen<br />
zu weit bukkal, weil dies nicht berücksichtigt<br />
wird“, sagte Dr. Schiegnitz. „Zu<br />
tief gesetzte Implantate haben immer<br />
eine Rezession zur Folge.“ Abschließend<br />
bekräftigte er, dass Implantate eine lange<br />
Lebensdauer hätten, wenn die Parameter,<br />
die auch in den Leitlinien beschrieben<br />
seien, beachtet würden.<br />
Begrüßung. Dr. Norbert<br />
Struß eröffnete die<br />
Tagung und wünschte<br />
den Teilnehmenden<br />
eine praxisnahe und<br />
spannende Fortbildung.<br />
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ<br />
Prof. Dr. Falk Schwendicke von der Charité<br />
Berlin präsentierte in seinem Vortrag<br />
„Künstliche Intelligenz für ein modernes<br />
Kariesmanagement?“ die neuesten Diagnosesysteme,<br />
die auf Künstlicher Intelligenz<br />
(KI) basieren. Er illustrierte den<br />
Nutzen der KI anhand der Kariesdiagnostik.<br />
Laut aktueller Zahlen werde mehr<br />
als jede zweite Karies übersehen. Hier setze<br />
die KI als vielversprechendes Einsatzgebiet<br />
an. Prof. Schwendicke machte<br />
deutlich, dass, obwohl der Begriff „Künstliche<br />
Intelligenz“ verwendet werde, diese<br />
Technologie nichts mit dem menschlichen<br />
Gehirn zu tun habe, sondern ausschließlich<br />
auf mathematischen Prinzipien<br />
basiere. Er erläuterte die Bedeutung<br />
des Machine Learning als ein großes Feld<br />
innerhalb der KI. Dies ermögliche KISystemen,<br />
aus Fehlern zu lernen und ihre<br />
Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern.<br />
Bei der Diagnostik von früher Karies, insbesondere<br />
im Bereich der Schmelzkaries,<br />
sind Studien zufolge die Zahnärzt*innen<br />
der KI unterlegen. Die frühzeitige Erkennung<br />
kariöser Läsionen ist eine Voraussetzung<br />
für eine frühe, kausale und nonrestaurative<br />
Therapie. KI könne die<br />
Karies detektion unterstützen und gleichzeitig<br />
die Dokumentation verbessern.<br />
Prof. Schwendicke fügte hinzu, dass etablierte<br />
nonrestaurative Therapien nur bedingt<br />
geeignet seien, frühe Läsionen zu<br />
arretieren. Mikroinvasive Behandlungen<br />
wie die Kariesinfiltration werden vor allem<br />
für Kariesrisikopatient*innen empfohlen.<br />
„Künstliche Intelligenz und moderne<br />
Therapien gehen Hand in Hand“,<br />
sagte Prof. Schwendicke. „Zukünftig<br />
kann die KI die Zahnärzt*innen darin<br />
unterstützen, präzisere und zuverlässigere<br />
Diagnosen zu stellen und beispielsweise<br />
Risikovorhersagen zu treffen.“<br />
Wissenschaftliche Leitung.<br />
Prof. Dr. Elmar Hellwig<br />
hatte die wissenschaftliche<br />
Leitung der Tagung inne<br />
und wartete mit namhaften<br />
Referent*innen auf, die<br />
innovative Ansätze<br />
präsentierten.<br />
DENTALE EROSIONEN<br />
Prof. Dr. Adrian Lussi, Bern, beleuchtete<br />
in seinem Vortrag „Reflux, Erbrechen<br />
und (Mund)gesundheit“ dentale Erosionen.<br />
In den letzten Jahrzehnten habe<br />
sich die Häufigkeit von Reflux um das<br />
Fünffache erhöht. Ein deutlicher Hinweis<br />
auf Reflux sind laut Prof. Lussi beispielsweise<br />
asymmetrische Erosionen<br />
aufgrund einer bevorzugten Schlafseite.<br />
Die Maßnahmen vor der Behandlung<br />
umfassen die Überweisung an den Gastroenterologen,<br />
eine Versiegelung der<br />
überempfindlichen Flächen, Kaugummi<br />
sofort nach dem Essen zur Reduktion<br />
des postprandialen Refluxes, die Verwendung<br />
von zinnhaltigen Fluoridpräparaten<br />
und Restaurationen. Um dentale<br />
Erosionen durch Reflux zu verhindern,<br />
müsse der Lebensstil angepasst werden,<br />
führte Prof. Lussi aus. Dazu gehöre es,<br />
auf fettige Speisen und säurehaltige Lebensmittel<br />
sowie Alkohol und Koffein<br />
zu verzichten und das Körpergewicht zu<br />
reduzieren. Seine Empfehlung beinhaltete<br />
sowohl die kausale Therapie mit Ernährungsberatung,<br />
als auch die symptomatische<br />
Therapie mit Mundspülungen<br />
nach dem Verzehr von sauren Lebensmitteln.<br />
Er räumte auf mit dem „Märchen<br />
der Wartezeit“ und empfahl, die<br />
Zähne unmittelbar nach dem Essen zu<br />
reinigen. Nach einer Refluxepisode sollte<br />
der Mund sofort mit Wasser oder einer<br />
zinnhaltigen Lösung gespült werden.<br />
Wichtig sei auch, zu verstehen, dass<br />
nicht alle sauren Lebensmittel zwangsläufig<br />
erosiv sind. Bei Patient*innen mit<br />
Refluxproblemen könne es sinnvoll sein,<br />
nach dem Essen Kaugummi zu kauen,<br />
da dies den Speichelfluss anrege und helfe,<br />
Säure zu neutralisieren. Es bestehe<br />
eine Wechselbeziehung zwischen Reflux<br />
und Zahngesundheit. Aus diesem Grund<br />
sollten bei Patient*innen mit Refluxproblemen<br />
die Zähne regelmäßig überprüft<br />
werden. Bei auffälligen Erosionen sei es<br />
ratsam, den Zusammenhang mit Reflux<br />
zu überprüfen.
32_FORTBILDUNG<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
PARODONTALERKRANKUNGEN<br />
Prof. Dr. Dirk Ziebolz, Leipzig, unterstrich<br />
in seinem Vortrag die wichtige<br />
Rolle der allgemeinmedizinischen Aspekte<br />
in der Prävention von Parodontalerkrankungen.<br />
Er wies darauf hin, dass<br />
langfristig gesunde, funktionale, ästhetisch<br />
ansprechende und schmerzfreie<br />
Zähne nur erhalten werden können,<br />
wenn auch in der Zahnarztpraxis der Allgemeingesundheit<br />
genügend Aufmerksamkeit<br />
zuteil wird. So stehen beispielsweise<br />
Parodontitis und Diabetes mellitus<br />
in einer bidirektionalen Wechselbeziehung<br />
und Parodontitis sei eine anerkannte<br />
Folgeerkrankung des Diabetes<br />
mellitus. Deshalb empfahl er ein DiabetesScreening<br />
in der Zahnarztpraxis mittels<br />
eines Fragebogens. Besondere Aufmerksamkeit<br />
sollte auch der Medikamenteneinnahme<br />
von chronisch Kranken<br />
gewidmet werden. Sie benötigen eine<br />
spezielle Anpassung der Behandlungsund<br />
Präventionsmaßnahmen, um potenzielle<br />
Risiken zu minimieren und den<br />
individuellen Bedürfnissen gerecht zu<br />
werden. Als weiteren wichtigen Aspekt<br />
sprach er die Rauchentwöhnung in der<br />
Parodontitistherapie an. Er empfahl<br />
Rauchern, die nicht aufhören wollen,<br />
den Umstieg auf EZigaretten nahezulegen.<br />
Dies habe den Vorteil, dass es schadensmindernd<br />
sei und die Wahrscheinlichkeit<br />
des Rauchstopps erhöhe.<br />
KNOCHENERHALT<br />
Prof. Dr. Dr. Peer Kämmerer, Mainz,<br />
ging in seinem Vortrag „Präventionsaspekte<br />
bei Extraktionen zum Knochenerhalt“<br />
auf die gängigsten Techniken<br />
zur Vermeidung einer Kieferatrophie<br />
nach Zahnextraktion ein und veran<br />
Regenerationskapazität, da hier ein<br />
Raum mit vielen erhaltenen Knochenwänden<br />
innerhalb des Skeletal Envelope<br />
vorliegt“, erläuterte Prof. Kämmerer.<br />
Bei einfachen Defekten könne partikuläres<br />
Material wie xenogene, allogene,<br />
alloplastische oder autologe Knochenmasse<br />
verwendet werden, ergänzt durch<br />
eine Kollagenmembran. Bei komplexeren<br />
Defekten und längeren Wartezeiten<br />
empfahl Prof. Kämmerer die Blocktechnik.<br />
Die Verwendung von extraoralem<br />
Knochenmaterial sei heutzutage selten<br />
geworden. Meistens werde intraoraler<br />
Eigenknochen oder Spenderknochen<br />
Vortragende. Dr. Philipp Sahrmann,<br />
Prof. Dr. Dirk Ziebolz, Dr. Dr. Eik<br />
Schiegnitz, Dr. Daniel Hellmann, Dr.<br />
Yvonne Wagner, Prof. Dr. Dr. Peer<br />
Kämmerer, Prof. Dr. Dr. Bernd Lapatki,<br />
Prof. Dr. Falk Schwendicke,<br />
Prof. Dr. Adrian Lussi (im Uhrzeigersinn,<br />
beginnend oben links).<br />
schaulichte diese anhand klinischer Beispiele.<br />
Die Erhaltung des Alveolarkamms<br />
ist ein multifaktorieller Prozess,<br />
der von der Konstitution und den individuellen<br />
Eigenschaften der Patient*innen<br />
abhängt. Die Art des Defekts spiele<br />
eine entscheidende Rolle. „Bei vestibulären<br />
Defekten der Alveole verfügen wir<br />
über eine beeindruckende biologische<br />
eingesetzt. Hier empfahl Prof. Kämmerer<br />
die Schalentechnik und den Einsatz<br />
von Mesh. Diese aufwendigen Techniken<br />
seien jedoch nur in selektierten Fällen<br />
notwendig, die immer seltener werden.<br />
WURZELKARIES<br />
Dr. Yvonne Wagner, Stuttgart, legte in<br />
ihrem Vortrag „Moderne Konzepte zur<br />
Prävention koronaler und Wurzelkaries“<br />
dar, dass ein zielgruppenspezifisches<br />
Prophylaxekonzept einen immer höheren<br />
Stellenwert für eine nachhaltige<br />
zahnärztliche Behandlung einnehme.<br />
Im Fokus des modernen Kariesmanagements<br />
stünden präventive Ansätze und<br />
die Kontrolle von Risikofaktoren. Die<br />
Vorbeugung von Karies durch regelmäßige<br />
Zahnpflege und die Verwendung
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
33_FORTBILDUNG<br />
von fluoridhaltigen Produkten sei essenziell.<br />
Die Kontrolle von Risikofaktoren<br />
und eine individuelle Risikoeinschätzung<br />
spielten eine wichtige Rolle,<br />
um das Kariesrisiko zu minimieren.<br />
Eine ausgewogene Ernährung mit reduziertem<br />
Zuckerkonsum sei ebenso wichtig<br />
wie gute Mundhygiene und Biofilmentfernung.<br />
Bestimmte Erkrankungen<br />
und die Einnahme von Medikamenten<br />
könnten die Mundgesundheit ebenso<br />
beeinflussen. Daher sei eine sorgfältige<br />
Überwachung und Anpassung der<br />
zahnärztlichen Behandlung an die individuelle<br />
Situation wichtig. Das Kariesmonitoring<br />
ist ein weiterer wichtiger<br />
Aspekt, auf den Dr. Wagner hinwies.<br />
Durch regelmäßige Überwachung der<br />
Kariesaktivität könne frühzeitig interveniert<br />
werden. „Wir sollten wirklich<br />
erst dann restaurieren, wenn die Oberflächen<br />
eingebrochen sind“, appellierte<br />
Dr. Wagner an die Zuhörenden. „Wir<br />
sollten möglichst immer versuchen, alles<br />
zu remineralisieren und soviel Zahnstruktur<br />
wie möglich zu erhalten.“<br />
LÜCKENSCHLUSS<br />
Prof. Dr. Dr. Bernd Lapatki, Ulm, referierte<br />
über den orthodontischen Lückenschluss<br />
als regenerativen Therapieansatz<br />
nach Zahnverlust oder bei dentalen Aplasien.<br />
Das Fehlen einzelner Zähne kann<br />
auf Extraktionen, Nichtanlage oder dentale<br />
Traumata zurückzuführen sein. Am<br />
häufigsten fehlten nicht erhaltungswürdige<br />
erste Molaren sowie nicht angelegte<br />
5er im Unterkiefer und 2er im Oberkiefer.<br />
Bei Aplasie der Oberkiefer 2er sei der<br />
Oberkiefer 3er als Ersatz geeignet, wenn<br />
er eine Krone habe, die nicht viel breiter<br />
sei als die Oberkiefer 1er und nicht zu<br />
bauchig sei. Auch sollte der Gingivaverlauf<br />
nicht zu hoch sein. Vorteile dieser<br />
Therapieoption sind laut Prof. Lapatki,<br />
dass die Lücke schon früh definitiv geschlossen<br />
ist, Patient*innen den Vorzug<br />
von natürlichen Zähnen als Lückenersatz<br />
hätten und sich funktionell und ästhetisch<br />
ein gutes und langzeitstabiles Ergebnis<br />
biete. Da bisher keine Studien<br />
existieren, die die Vorteile der Eckzahnführung<br />
unterstreichen, sei es kein Problem,<br />
wenn die Eckzahnführung nicht<br />
vorhanden sei, da in diesem Fall der 4er<br />
im Oberkiefer die Funktion des Eckzahns<br />
übernehme. Wenn Weisheitszähne<br />
vorhanden seien, könnten diese beim<br />
Lückenschluss durch Mesialisation der<br />
Molaren in den Zahnbogen integriert<br />
werden, erklärte Prof. Lapatki. Deshalb<br />
appellierte er an die Zuhörenden,<br />
Weisheitszähne nicht ohne<br />
Grund zu ziehen: „Das Argument,<br />
dass sie die Zähne zusammenschieben,<br />
ist wissenschaftlich nicht haltbar.“<br />
FUNKTIONSDIAGNOSTIK<br />
Dr. Daniel Hellmann, Karlsruhe,<br />
gab unter dem Titel „Funktionelle<br />
und restaurative Rehabilitation –<br />
was wir über das kraniomandibuläre<br />
System wissen sollten“ ein Update<br />
zur Funktionsdiagnostik. Er betonte,<br />
dass es keinen generellen Zusammenhang<br />
zwischen okklusalen Abweichungen<br />
von der Norm und der<br />
Entstehung einer craniomandibulären<br />
Dysfunktion (CMD) gebe. Die<br />
Sensoren der Kiefergelenke hätten<br />
nur eine untergeordnete Bedeutung<br />
für die motorische Steuerung des<br />
kraniomandibulären Systems. Während<br />
funktioneller Bewegungen des<br />
Unterkiefers, wie zum Beispiel beim<br />
Kauen, sei die Position der Zahnreihe<br />
die präzise kontrollierte Zielvariable.<br />
Die Steuermechanismen des<br />
kraniomandibulären Systems agieren<br />
strikt okklusionsbezogen. „Deshalb<br />
ist die Bedeutung der Okklusion<br />
im klinischen Kontext enorm“,<br />
unterstrich Dr. Hellmann. „Wenn<br />
wir ein okklusales Konzept vorbehaltlos<br />
umsetzen oder den symptomfreien<br />
okklusalen Status quo<br />
verändern, greifen wir stark in das<br />
äußerst sensible stomatognathe System<br />
ein.“ Es entsteht die Notwendigkeit einer<br />
mehr oder weniger ausgeprägten<br />
Adaption. „Unsere Patienten verfügen<br />
normalerweise über eine enorme Fähigkeit<br />
zur Anpassung des stomatognathen<br />
Systems. Deshalb sollten wir uns bemühen,<br />
diese Anpassungsfähigkeit nicht<br />
unnötig herauszufordern“, appellierte<br />
Dr. Hellmann. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen<br />
Rehabilitation liege daher<br />
nicht in der Perfektion der Umsetzung<br />
okklusaler Konzepte, sondern vielmehr<br />
in der Berücksichtigung der Adaptionsfähigkeit<br />
des stomatognathen Systems.<br />
Deshalb sei es so wichtig, „dem Körper<br />
unserer Patienten im Rahmen der Therapie<br />
ausreichend Zeit für eine neuromuskuläre<br />
und strukturelle Anpassung<br />
zu geben,“ schloss er.<br />
Gabriele Billischek
PRÄSENZ<br />
PRÄSENZ<br />
ABSCHIEDSSYMPOSIUM<br />
UNIVERSITÄTSKLINIKUM FREIBURG<br />
Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie<br />
Prof. Dr. Elmar Hellwig<br />
Samstag, 30. September 2023 | 10 – 17 Uhr<br />
„Rückblicke und Ausblicke in der Zahnerhaltung“<br />
Rückblicke: Alle Habilitanden von Prof. Hellwig<br />
Vorträge:<br />
Prof. Dr. Rainer Seemann, Bern:<br />
„Digitale Zahnmedizin der Zukunft“<br />
Prof. Dr. Adrian Lussi, Bern:<br />
„Prävention von Karies und Erosionen – Was Neues hinterm Horizont?“<br />
Prof. Matthias Hannig, Homburg:<br />
„Speicheldiagnostik – Was bringt die Zukunft?“<br />
Prof. Dr. Bernd Haller, Ulm:<br />
„30 Jahre Direkte Seitenzahnrestauration mit Komposit:<br />
Tops, Flops, Perspektiven“<br />
Prof. Dr. Reinhard Hickel, München:<br />
„Ein arbeitsreiches Leben, aber gelacht haben wir auch…“<br />
Prof. Dr. Elmar Hellwig:<br />
„Mein Weg zum Hochschullehrer“<br />
Mit freundlicher Unterstützung der „Gold-Sponsoren“:<br />
ColgateGaba • DentsplySirona • Intensiv • IvoclarVivadent • Wrigley Oral Healthcare Program<br />
ANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN UNTER: WWW.IFG-FORTBILDUNG.DE
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
35_FORTBILDUNG<br />
33. Fortbildungstagung der BZK Freiburg für Zahnmedizinische Fachangestellte<br />
FORTBILDUNG IN RUST –<br />
LIVE UND IN FARBE<br />
Mit diesem Versprechen läutete die Referentin für Zahnmedizinische Fachangestellte der BZK<br />
Freiburg, Dr. Priska Fischer, die diesjährige Tagung zum Thema „Prävention, Reparatur, Regeneration<br />
– Bausteine einer minimalinvasiven Zahnheilkunde“ ein. Eloquent und charmant begrüßte sie<br />
das Publikum im ausgebuchten Ballsaal Berlin des Europaparks und bewies gleich zu Beginn<br />
der Live-Veranstaltung Souveränität: Aufgrund eines Technikproblems mussten die beiden ersten<br />
Referenten die Reihenfolge wechseln, doch das geschah unaufgeregt und ohne Zeitverlust.<br />
„Eine detailliert erhobene Allgemeinanamnese<br />
ist nicht nur die Grundvoraussetzung<br />
für die erfolgreiche Therapie von<br />
Parodontalerkrankungen – gute Prävention<br />
steht und fällt mit dem Wissen um<br />
den medizinischen Zustand Ihrer Patienten!“<br />
Mit diesem gleich zu Beginn eindringlichen<br />
Appell betrat Prof. Dr. Dirk<br />
Ziebolz aus Leipzig die Bühne und erläuterte<br />
dem Auditorium fachkundig die<br />
Zusammenhänge zwischen Allgemeinerkrankungen<br />
und ihrem Einfluss auf die<br />
parodontale Gesundheit. Zudem lenkte<br />
Prof. Ziebolz die Aufmerksamkeit auf<br />
Dauermedikationen, die bei der Planung<br />
präventiver Maßnahmen immer wieder<br />
eruiert und bei Bedarf und nach Möglichkeit<br />
angepasst werden sollten.<br />
SÄUREQUELLEN<br />
Den allgemeinanamnestischen Staffelstab<br />
übernahm Prof. Dr. Adrian Lussi aus<br />
Bern gekonnt und übertrug das Thema<br />
elegant auf die immer häufiger zu beobachtende<br />
Problematik der Erosionen.<br />
„Der sauren Ursache für diese nicht bakteriell<br />
induzierte Erkrankung der Zahnhartsubstanzen<br />
auf den Grund zu gehen<br />
und die schuldigen Säurequellen so gut<br />
wie möglich versiegen zu lassen, (sei) im<br />
Rahmen der Therapieplanung unabdingbar“,<br />
so der Berner. Das Verhalten betroffener<br />
Patient*innen umzustellen, sei dabei<br />
eine ebenso große Herausforderung<br />
wie eine psychotherapeutische Begleitung,<br />
bemerkte Prof. Lussi abschließend.<br />
BIOFILM<br />
Unter diesem Aspekt stellte PD Dr.<br />
Philipp Sahrmann aus Basel dem nach<br />
einer ersten Pause frisch gestärkten Publikum<br />
sein wohldurchdachtes und sinnvoll<br />
strukturiertes Konzept zur Periimplantitis-Verhütung<br />
vor. „Entscheidend<br />
sei“, so der Schweizer Fachzahnarzt für<br />
Parodontologie, „sich im Rahmen präventiver<br />
Maßnahmen immer wieder den<br />
Zusammenhang zwischen Ursache einer<br />
Periimplantitis und dem Ziel der Prävention<br />
vor Augen zu führen“. „Den Biofilm<br />
sowie die individuellen Risikofaktoren<br />
unter Kontrolle zu halten, ist das oberste<br />
Credo“, plädierte Sahrmann und knüpfte<br />
damit an die Ausführungen von Prof.<br />
Ziebolz an. Des Weiteren fand er kritische<br />
Worte bezüglich einer vermeintlichen<br />
Effektivität beim periimplantären<br />
Einsatz von Kunststoff- und Titanküretten<br />
und empfahl für die tägliche häusliche<br />
Mundhygiene Schallzahnbürsten<br />
mit kleinem Bürstenkopf.<br />
VUCA-WELT<br />
In ihrem fulminanten Festvortrag führte<br />
Prof. Dr. Jutta Rump, Professorin für<br />
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit<br />
Schwerpunkt Internationales Personalmanagement<br />
und Organisationsentwicklung<br />
an der Hochschule für Wirtschaft<br />
und Gesellschaft Ludwigshafen,<br />
das Publikum in die Arbeitswelt der Zukunft.<br />
„Im Jahr 2027 werden über<br />
700.000 Menschen nicht mehr in der bislang<br />
bekannten Arbeitswelt tätig sein, da<br />
die Nutzung künstlicher Intelligenz weiter<br />
auf dem Vormarsch sein wird“, prophezeite<br />
Prof. Rump. Im Rahmen zunehmender<br />
KI und Digitalisierung in einer<br />
immer ausgeprägter volatilen, ungewissen,<br />
komplexen, mehrdeutigen „VUCA-<br />
Welt“ als Mensch zu bestehen, sei die<br />
Aufgabe von morgen.<br />
Foto: Michael Bamberger<br />
Wegweisend. Dr. Priska Fischer zeichnete für<br />
die Fortbildungstagung im Bereich ZFA verantwortlich<br />
und richtete den Fokus auf eine minimalinvasive<br />
Zahnheilkunde.<br />
PARODONTITIS<br />
Unter dem Titel „UPT & Co. – die Betreuung<br />
von Patient*innen mit Parodontitis<br />
in der Praxis“ referierte Dr. Steffen Rieger,<br />
M.Sc. aus Reutlingen über die konsequente<br />
Betreuung von Parodontitispatienten<br />
in einem funktionierenden Nachsorgeprogramm.<br />
„Dies ist der entscheidende<br />
Erfolgsfaktor für die langfristige Kontrolle<br />
der chronischen Erkrankung“, so Dr.<br />
Rieger. Ausführlich beleuchtete er, worin<br />
sich die Professionelle Zahnreinigung<br />
(PZR) und die Unterstützende Parodontitistherapie<br />
(UPT) unterscheiden, welche<br />
Inhalte zu einer UPT zählen und worauf<br />
es bei ihrer Durchführung ankommt.<br />
Ebenso erklärte er, mit welchen Instrumenten<br />
schonend und dennoch effektiv<br />
gearbeitet werden kann und was es bei der<br />
Erbringung der UPT im Rahmen der aktuellen<br />
Richtlinie zu berücksichtigen gilt.<br />
Im Rahmen seiner Erläuterungen zur<br />
UPT legte Dr. Rieger ein großes Augenmerk<br />
auf die Unersetzbarkeit der ZFA.<br />
Diesen „Ball“ nahm Dr. Priska Fischer am<br />
Ende der Fortbildung gekonnt auf und<br />
dankte den anwesenden ZFAs dafür, „dass<br />
Sie uns in den Praxen so tatkräftig unterstützen“.<br />
Fortbildung in Rust – live und in<br />
Farbe und zudem auch wertschätzend.<br />
Cornelia Schwarz
36_FORTBILDUNG<br />
Lichtpolymerisation<br />
UPDATE UND<br />
MÖGLICHKEITEN<br />
ZUR OPTIMIERUNG<br />
Die Lichthärtung von zahnärztlichen<br />
Materialien ist ein entscheidender<br />
Bestandteil der Füllungstherapie am<br />
Patienten. Es wird aber diesem<br />
Arbeitsschritt leider nicht immer die<br />
volle Aufmerksamkeit geschenkt, die<br />
für eine sichere Aushärtung nötig<br />
wäre 19 und er wird in vielen Praxen an<br />
die ZFA delegiert, die damit eine große<br />
Verantwortung übernimmt. Denn die Oberfläche<br />
lichthärtender Komposite erscheint schon nach<br />
kurzer oder unzureichender Belichtung hart, aber die physikalischen<br />
Werte wie die erzielte Härte – vor allem am Kavitätenboden<br />
–, die Biegefestigkeit sowie die Abrasionswerte,<br />
die letztendlich über die Langzeitperspektive der Restauration<br />
entscheiden 17 , sind damit noch nicht gesichert.<br />
Foto: AdobeStock/Oleg Zhukov<br />
Zum besseren Verständnis der Problematik bei der Lichthärtung<br />
müssen drei Begriffe unterschieden werden:<br />
• Die Lichtleistung einer Lichtquelle: Sie ist die Energiemenge,<br />
die pro Zeitspanne von einer Lichtquelle erzeugt wird, angegeben<br />
in W (Watt).<br />
• Die Lichtintensität: Sie ist die Energiemenge pro Fläche am<br />
Lichtaustrittsfenster, die pro Zeiteinheit ausgestrahlt wird,<br />
angegeben in mW/cm².<br />
• Die Bestrahlungsstärke: Sie gibt an, wie viel Lichtenergie am<br />
Wirkort, also bei den Photoinitiatoren ankommt, bezogen<br />
auf die Fläche, und wird daher ebenfalls in mW/cm² angegeben.<br />
Die empfohlene Intensität in mW/cm² am Lichtaustrittsfenster<br />
eines Lichtgerätes sollte zwischen 800 und 1.500 liegen 13 .<br />
Dieser Wert allein sagt aber noch nichts aus, denn er berechnet<br />
sich ja aus der Lichtleistung der Lichtquelle bezogen auf die<br />
Fläche des Lichtaustrittsfensters: Kleinere Durchmesser haben<br />
somit bei gleicher Lichtleistung der Lichtquelle eine höhere Intensität,<br />
allerdings auch nur eine eingeschränkte Beleuchtungsfläche<br />
(Abb. 1).<br />
LICHTHÄRTENDE FÜLLUNGSMATERIALIEN<br />
Um die physikalischen Eigenschaften lichthärtender Komposit-Füllungsmaterialien<br />
voll nutzen zu können, müssen<br />
sie zu Polymeren vernetzen, indem Radikale die Doppelbindungen<br />
an den Monomeren aktivieren. Die Radikale werden<br />
durch Einwirkung spezifischer Wellenlängen auf die Photoinitiatoren<br />
aktiviert. Diese Wellenlängen werden Absorptionsspektren<br />
genannt und müssen zu den Emissionsspektren<br />
der Lichtgeräte passen. Sie sind also entscheidend<br />
für die sichere Aushärtung des Kompositmaterials, bereiten<br />
aber für das menschliche Auge enorme Probleme 23 , denn gerade<br />
der blaue Wellenlängenbereich ist für die Netzhaut besonders<br />
gefährlich. Darauf weisen bereits Augenärzte hin bezüglich<br />
der verstärkten Nutzung von weißen LEDs in unserer<br />
alltäglichen Umgebung, die ebenfalls hohe Anteile an<br />
Wellenlängen des blauen Lichtes enthalten. Das Licht der<br />
Polymerisationsgeräte kann somit langfristig zur Beeinträchtigung<br />
der Sehfähigkeit führen. Daher sind Orange-<br />
Filter unbedingt erforderlich, um die korrekte Positionierung<br />
des Lichtaustrittsfensters visuell überprüfen zu können<br />
15 .<br />
BELICHTUNGSDOSIS ODER „TOTAL ENERGY CONCEPT“<br />
Zur sicheren Aushärtung eines lichthärtenden Kompositmaterials<br />
wird neben dem entsprechenden Absorptionsspektrum<br />
auch die genügende Menge an Radikalen in der gesamten<br />
Schichtstärke des Komposits nötig, also eine be-
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
37_FORTBILDUNG<br />
stimmte Belichtungsdosis. Dies wird als sogenanntes Total<br />
Energy Concept beschrieben.<br />
Die Belichtungsdosis ist dabei das Produkt aus Bestrahlungsstärke<br />
(also der Lichtenergie, die auf das auszuhärtende<br />
Komposit trifft) multipliziert mit der Belichtungszeit. 6<br />
Dabei gilt diese lineare Beziehung annäherungsweise allerdings<br />
nur im Bereich von Bestrahlungsstärken zwischen 500<br />
und 1.500 mW/cm².<br />
Für eine sichere Polymerisation der aktuellen Komposite ist<br />
für die adäquate Polymerisation eines 2 mm dicken Inkrementes<br />
eine erforderliche Energiedosis von 12.000 bis 24.000<br />
mWs/cm² = 12 bis 24 J/cm² berechnet worden 2,3,6,16,24 . Dadurch<br />
können sich, in Abhängigkeit von der Bestrahlungsstärke<br />
des verwendeten Polymerisationsgerätes, unterschiedlich<br />
lange Belichtungszeiten ergeben. Hochvisköse Bulkfill-<br />
Kompositmaterialien liegen wegen der dickeren Schichtstärke<br />
eher im oberen Bereich, also über 20 J/cm 2,9 .<br />
Lichtgeräte mit hoher Intensität, um ein schnelles Aushärten<br />
in besonders kurzer Zeit zu ermöglichen, werden kritisch<br />
gesehen, da ein Initiatorsystem nur eine bestimmte<br />
Menge an Energie pro Zeiteinheit aufnehmen kann und ab<br />
einer bestimmten Bestrahlungsstärke keine weitere Erhöhung<br />
der Radikalbildung mehr erfolgt 4,8 . Außerdem ist damit<br />
auch eine hohe Wärmeentwicklung verbunden, was die<br />
Gefahr der Pulpaüberhitzung oder Verletzungen des Weichgewebes<br />
erhöht.<br />
POLYMERISATIONS-LICHTGERÄTE<br />
Seit ca. zehn Jahren sind die LEDs (lichtemittierende Dioden)<br />
der Standard in der Lichtpolymerisation geworden 18 ,<br />
die mit einem relativ schmalen Wellenlängenbereich keine<br />
hohen Temperaturen an der Lichtquelle wie bei den Halogen-Lichtgeräten<br />
erzeugen. Daher können sie ohne Kühlung<br />
auskommen und als handliche Akku-Geräte angeboten<br />
werden. 5<br />
Die meisten LED-Polymerisationsgeräte weisen das typische<br />
enge Emissionsspektrum im blauen Wellenlängenbereich<br />
von 430 bis 490 nm auf und daher ist ihr universeller<br />
Einsatz nicht automatisch gegeben. Einige Hersteller (z. B.<br />
Ultradent, Vivadent, GC) bieten sogenannte Multi-Peak-<br />
LED-Lichtgeräte an, die verschiedene LEDs also für blaues<br />
und violettes Licht im Bereich von 385 bis 515 nm einsetzen<br />
und somit für alle lichthärtenden Materialien verwendet<br />
werden können 11,7 .<br />
LICHTSTREUUNG<br />
Ein weiteres Problem bei der Lichthärtung ist die Lichtstreuung,<br />
weil dadurch die Bestrahlungsstärke exponentiell mit<br />
der Entfernung abnimmt. Untersuchungen von Richard<br />
Price haben zeigen können, dass bei einer Entfernung von<br />
sechs mm die Bestrahlungsstärke bis um ca. 50 Prozent, bei<br />
einer Entfernung von 10 mm bis um ca. 80 Prozent abnehmen<br />
kann 10 , Entfernungen, die bei tiefen Kavitäten oder bei<br />
schwer zugänglichen Approximalflächen häufig vorliegen.<br />
Dann müssen die Belichtungszeiten entsprechend verlängert<br />
werden.<br />
Um die Streueffekte zu minimieren, sind bei Lichtgeräten,<br />
deren LEDs direkt vorn am Lichtaustrittsfenster liegen, Linsen<br />
angebracht worden oder das Licht wird durch Faserstäbe<br />
geleitet. Dabei sind parallelwandige sinnvoller als sich zum<br />
Lichtaustrittsfenster verjüngende Lichtleiter. Diese sogenannten<br />
Turbolichtleiter streuen nämlich besonders stark<br />
und zeichnen sich bei zunehmendem Abstand zum Lichtaustrittsfenster<br />
durch einen höheren Abfall der Bestrahlungsstärke<br />
aus 10 (Abb. 2) .<br />
Um die Hygienestandards einzuhalten, sollte der Lichtleiter<br />
idealerweise aus dem Handstück entfern- und autoklavierbar<br />
sein 1 . Ansonsten sind Einmal-Schutzfolien einzusetzen, wobei<br />
darauf zu achten ist, dass die Schutzfolie straff über das<br />
Lichtaustrittsfenster gespannt wird. Sonst kann auch dies bereits<br />
zu einer Verminderung der Bestrahlungsstärke führen.<br />
(Abb. 3)<br />
TEMPERATURENTWICKLUNG<br />
Beim Auftreffen der Lichtwellen auf das Kompositmaterial,<br />
auf die Zahnhartsubstanz und gegebenenfalls auf das benachbarte<br />
Weichgewebe kommt es zu einer Hitzeentwicklung,<br />
die vor allem in tiefen Kavitäten eine Reizung der Pulpa<br />
darstellen kann 7 . Dem kann auch mit Hilfe eines Luftstroms<br />
durch die Mehrfunktionsspritze oder den Suktor zur<br />
1<br />
Vergleich. Unterschiedliche Durchmesser von zwei Lichtaustrittsfenstern.<br />
2<br />
Lichtstreuung. Unterschiedliche Streuung parallelwandiger Lichtleiter<br />
und des Turbo-Tips.<br />
3<br />
Einfluss auf Strahlungsstärke. Ungünstig angelegte Schutzfolien, die<br />
die Bestrahlungsstärke negativ beeinträchtigen.<br />
Abb.: Dr. Uwe BLucnk
38_FORTBILDUNG<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
4<br />
Kühlung entgegengewirkt werden 13 . Bei der Lichthärtung in<br />
Gingivanähe ist zu bedenken, dass das rote Gewebe die Wellenlängen<br />
des blauen Lichts besonders gut absorbieren und<br />
es daher sogar zu Verbrennungen der Gingiva kommen<br />
kann.<br />
ENERGIESTRAHLPROFIL (BEAM PROFILE)<br />
Ebenso wichtig wie das Emissionsspektrum ist auch das sogenannte<br />
Energiestrahlprofil (engl. Beam Profile), die Verteilung<br />
der Bestrahlungsstärke und – bei Geräten mit unterschiedlichen<br />
LEDs – der Wellenlängen auf der Fläche des<br />
Lichtaustrittsfensters. In den Abb. 4 und 5 sind verschiedene<br />
Beam Profiles dargestellt, die deutlich zeigen, wie sehr der<br />
Durchmesser des Lichtaustrittsfensters und die gleichmäßige<br />
Verteilung der Bestrahlungsstärke Einfluss nehmen können<br />
auf die Lichthärtung in Standard-Kavitäten.<br />
Foto Dr. R. Price, Universität Halifax, Kanada<br />
Foto Dr. R. Price, Universität Halifax, Kanada<br />
Farbverteilung. Beam Profiles verschiedener Lichtgeräte, je mehr<br />
unterschiedliche Farben dargestellt werden, desto weniger<br />
gleichmäßig ist die Verteilung der Intensität.<br />
5<br />
Strahlungsleistung. Verteilung der Bestrahlungsstärke in der Kavität<br />
in Abhängigkeit vom Durchmesser und den Beam Profiles<br />
von zwei verschiedenen Lichtgeräten.<br />
WARTUNG<br />
Die benötigte Lichtmenge kann auch durch Verunreinigungen<br />
am Ausgangsfenster des Lichtleiters und durch defekte<br />
Fasern im Lichtleiter beeinflusst werden. Daher sollte auf Beschädigungen<br />
sowie Verschmutzungen des Lichtaustrittsfensters<br />
geachtet und die Intensität (Lichtleistung am Lichtaustrittsfenster)<br />
regelmäßig überprüft werden. 20 Die dazu<br />
angebotenen Lichtmessgeräte, so genannte Radiometer, ergeben<br />
keine verlässlichen Werte 20 , können aber den Verlauf<br />
der Lichtleistung eines Geräts über einen längeren Zeitlauf<br />
erfassen. Innerhalb der angebotenen Lichtmessgeräte zeichnet<br />
sich zurzeit das BluePhase Meter II (Ivoclar Vivadent)<br />
durch die genauesten Werte aus 20 und es kann durch Eingabe<br />
des Durchmessers des Lichtaustrittfensters die Intensität<br />
exakter bestimmen.<br />
AUSWAHL EINES LICHTGERÄTS<br />
Bei der Auswahl des Lichtgeräts sollte bedacht werden, dass<br />
nicht zertifizierte Billig-Angebote nur auf Kosten der Qualität<br />
der LEDs und der verwendeten Elektronik möglich sind.<br />
Es empfiehlt sich daher, Markenprodukte zu wählen, die<br />
durch deren hohe Qualitätskontrolle eine sichere Anwendung<br />
ermöglichen 13 .<br />
Bei der Auswahl sollte auf folgende Aspekte geachtet werden<br />
14 :<br />
• Die Leistung des Gerätes (mW) gibt mehr Auskunft über<br />
die Wertigkeit als die Intensität!<br />
• Entscheidend ist der Durchmesser des Lichtaustrittsfensters.<br />
Empfohlen werden Durchmesser ab ca. 10 mm.<br />
• Die Intensität sollte zwischen 800 und 1.500 mW/cm² liegen.<br />
• Wichtig ist eine geringe Streuung des Lichts mit zunehmender<br />
Distanz!<br />
• Das Emissionsspektrum und die benötigten Wellenlängen<br />
zur Aushärtung des angewendeten Kompositmaterials<br />
sollten übereinstimmen!<br />
• Die Verteilung der Lichtenergie auf der Fläche des Lichtaustrittsfensters,<br />
Beam Profile, sollte gleichmäßig sein!<br />
Ein weiteres Kriterium ist die Form des Lichtleiters. In der<br />
Kinderbehandlung und bei Patienten mit geringer Mundöffnung<br />
sowie beim Einsatz im posterioren Zahnreihenbereich<br />
empfehlen sich an der Spitze verkürzte Lichtleiter<br />
oder die Geräte mit LEDs direkt am Lichtaustrittsfenster.<br />
(Abb. 6)<br />
PROBLEME DER ANWENDUNG<br />
Studien von Richard Price konnten an Phantomköpfen mit<br />
eingebauten Photosensoren eindrucksvoll nachweisen, dass
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
39_FORTBILDUNG<br />
6 7<br />
Abb.: Dr. Uwe BLucnk<br />
Optimale Bestrahlung. Darstellung der unterschiedlichen<br />
Winkelung von Lichtleitern, die verschieden starke Mundöffnungen<br />
benötigen zur Lichthärtung im posterioren Seitenzahnbereich.<br />
Messung. Aufzeichnung der Bestrahlungsstärke am Boden einer 4 mm tiefen Kavität<br />
bei Anwendung eines Lichtgerätes durch verschiedene Studienteilnehmer<br />
(rot vor und grün nach Instruktion zur korrekten Abstützung).<br />
es nicht einfach ist, eine optimale Belichtung am Boden einer<br />
Klasse-I-Kavität sicherzustellen, und dass die Ergebnisse<br />
zwischen den verschiedenen Anwendern große Streuung<br />
aufzeigen 12 . (Abb. 7) Dabei konnte auch gemessen werden,<br />
dass bereits ein Winkel von 30 Grad zu einer Abnahme der<br />
Bestrahlungsstärke um 26 Prozent führt 12 . Außerdem<br />
kommt es bei schrägen Lichteinfallswinkeln zu Schattenbildungen<br />
in der Kavität, wodurch eventuell Teile des Komposits<br />
gar nicht vom Licht erreicht werden.<br />
Zur Sicherstellung einer effektiven Lichthärtung des Komposits<br />
kann es daher nötig sein, in mehreren überlappenden<br />
Zyklen die Lichthärtung durchzuführen. Die effektive Lichthärtung<br />
kann auch unterstützt werden, wenn nach Abnahme<br />
des Metall-Matrizenbandes nochmals der approximale<br />
Kasten von bukkal und oral belichtet wird 21, 22 .<br />
LEITLINIEN<br />
Zur sicheren Lichthärtung sollten folgende Hinweise beachtet<br />
werden 13 :<br />
• regelmäßig die Intensität des Lichtgerätes prüfen,<br />
• das Lichtaustrittsfenster auf Verunreinigungen kontrollieren,<br />
• die korrekte Belichtungszeit für das spezifische Kompositmaterial<br />
wählen,<br />
• das Komposit in der korrekten Schichtstärke applizieren,<br />
• die Entfernung zwischen Lichtaustrittsfenster und Komposit<br />
berücksichtigen und entsprechend die Belichtungszeit<br />
verlängern,<br />
• darauf achten, dass das applizierte Kompositmaterial<br />
vollständig vom Licht erfasst wird,<br />
• mögliche Hitzeschäden bedenken, gegebenenfalls vermindern<br />
mit Mehrfunktionsspritze oder Suktor und<br />
• die Augen schützen.<br />
FAZIT<br />
Damit ein Kompositmaterial seine vollen Eigenschaften entwickeln<br />
kann, muss die Polymerisation zu einer optimalen<br />
Vernetzung der Monomere führen. Bei lichthärtenden Produkten<br />
muss dazu eine ausreichende Belichtungsdosis das<br />
Kompositmaterial erreichen, die sich berechnet aus dem Produkt<br />
der Bestrahlungsstärke (mW/cm 2 ) und der Belichtungszeit.<br />
Die wirksame Bestrahlungsstärke wiederum ist abhängig<br />
von<br />
• der Intensität des Geräts,<br />
• der Entfernung vom Lichtaustrittsfenster,<br />
• dem Winkel der Einstrahlung,<br />
• der Schichtstärke des applizierten Kompositmaterials.<br />
Das kann nur mit visueller Kontrolle des Belichtungsvorgangs<br />
mit Augenschutz erfolgen.<br />
Die Lichtpolymerisation ist also ein komplexer Vorgang,<br />
dem genügend Aufmerksamkeit gewidmet werden muss! Es<br />
kommt somit nicht auf eine möglichst schnelle, sondern auf<br />
eine vollständige Aushärtung an, um dauerhafte Restaurationen<br />
erfolgreich legen zu können.<br />
OA Dr. Uwe Blunck,<br />
Charité-Universitätsmedizin Berlin<br />
Das Literaturverzeichnis kann beim IZZ bestellt werden unter<br />
Tel: 0711/222966-14 oder E-Mail: infozahnaerzteblatt.de.<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
0711 222966-14<br />
info@zahnaerzteblatt.de<br />
OA Dr. Uwe Blunck,<br />
Abteilung für Zahnerhaltung,<br />
Präventiv- und<br />
Kinderzahnmedizin<br />
Charité–Universitätsmedizin<br />
Berlin
40_FORTBILDUNG<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Sportzahnmedizin<br />
ZAHNMEDIZIN: CITIUS,<br />
ALTIUS, FORTIUS?<br />
Sport spielt in der Zahnarztpraxis meist erst eine Rolle, wenn Hilfe nach einem<br />
Sportunfall, der passende Mundschutz für „Kontakt-Sportarten“ gefragt ist oder wenn in<br />
Trainings- bzw. Wettkampfphasen akute Beschwerden entstehen. Das Querschnittsfach<br />
der Sportzahnmedizin erforscht jedoch noch viel mehr: Können Zahnschienen die sportliche<br />
Leistung positiv beeinflussen? Wirkt sich die Mundgesundheit auf die sportliche Leistung<br />
aus oder umgekehrt? Antworten auf diese Fragen sowie eine Einordnung gab eine Online-<br />
Fortbildung der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe im Februar 2023.<br />
Stärker. Pressen oder Beißen mit den Zähnen kann die Maximalkraft steigern, egal ob mit oder<br />
ohne Schiene.<br />
Der Titel der Veranstaltung „Sportzahnmedizin<br />
– Arbeit an der Schnittstelle zwischen<br />
Physiologie, Medizin und Zahnmedizin“<br />
spannte einen weiten Bogen, der<br />
mit Fakten und aktuellen Forschungsergebnissen<br />
gefüllt wurde. Zunächst gab<br />
PD Dr. Daniel Hellmann, Direktor der<br />
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung<br />
Karlsruhe, einen Überblick über die Aufgabenbereiche<br />
der Sportzahnmedizin.<br />
Danach stellte er aktuelle Forschungsergebnisse<br />
zur Leistungssteigerung im<br />
Sport durch Performanceschienen vor.<br />
BESSER DURCH SCHIENEN?<br />
Aufbiss-Schiene, Performance-Schiene,<br />
CMD-Schiene – das Phänomen ist mittlerweile<br />
auch auf dem deutschen Sportmarkt<br />
angekommen. Die Werbung ist<br />
verheißungsvoll: „Verbesserte Koordination,<br />
Beweglichkeit, Maximalkraft, Ausdauer<br />
und Regeneration“ verspricht beispielsweise<br />
der Fachverlag „fitness MA-<br />
NAGEMENT“ auf seiner Internetseite.<br />
Dr. Hellmann riet nach einem Blick auf<br />
die aktuelle Forschungslage zu Zurückhaltung.<br />
So ist belegt, dass das Pressen<br />
bzw. Beißen mit den Zähnen zu einer generellen<br />
Steigerung der Erregbarkeit des<br />
motorischen Systems führt – also die<br />
Reizleitung im Nervensystem und damit<br />
auch die Reflexaktivität beeinflusst. Allerdings<br />
spielt es dabei keine Rolle, ob der<br />
Sportler eine Schiene trägt oder nicht.<br />
Foto: Adobe Stock/Wollwerth Imagery<br />
BEISSEN KANN HELFEN<br />
Profi-Sportschützen profitieren davon,<br />
dass durch Beißen die Körperschwankung<br />
verringert werden kann. Sie können<br />
in manchen Positionen ruhiger stehen<br />
und so besser zielen. Jedoch geht<br />
der Effekt nicht auf eine „Versteifung“<br />
zurück, sondern auf die verbesserte motorische<br />
Kontrolle. Studien in Kraftsportarten<br />
berichten von einer Steigerung<br />
der Maximalkraft, vor allem in den<br />
unteren Extremitäten. Diese lässt sich<br />
auf die erhöhte Beißaktivität zurückführen<br />
und kann z. B. im Gewichtheben<br />
Einfluss auf die Leistung nehmen. Auch<br />
in Hochgeschwindigkeitssportarten<br />
(Ski alpin, Motorrad etc.) neigen viele<br />
Sportler zum Beißen, mit dem Ziel einer<br />
verbesserten Stabilität. Dr. Hellmann<br />
betonte, dass auch Placeboeffekte beim<br />
Einsatz von Schienen messbar seien.<br />
Und: Eine Erhöhung der Ausdauerleistungsfähigkeit<br />
konnte bis heute nicht<br />
eindeutig nachgewiesen werden.<br />
BRUXISMUS IST NORMAL<br />
Viele Sportler knirschen während der<br />
sportlichen Aktivität mit den Zähnen,<br />
zum Beispiel Radfahrer und Ruderer im<br />
Endspurt. Anekdotisch berichtete Dr.<br />
Hellmann von einer Unterwasser-Rugby-Spielerin,<br />
die erzählte, sie könne 20<br />
Sekunden länger unter Wasser bleiben,<br />
wenn sie mit großer Kraft auf ihr<br />
Schnorchel-Mundstück beiße. Sie spüre<br />
dadurch eine Reduzierung ihres „Lufthungers“.<br />
Das Beißen auf das Mundstück<br />
führte allerdings zu Schmerzen<br />
im Bereich der Kiefergelenke. Zur Entlastung<br />
beim Sport wurde eine spezielle<br />
Aufbiss-Schiene mit isolierten Aufbissen<br />
im Seitenzahnbereich gefertigt.<br />
CMD DURCH BEISSEN?<br />
Dr. Hellmann wies darauf hin, dass gerade<br />
bei Sportlern, die das Beißen gewollt<br />
oder intuitiv zur Leistungssteigerung<br />
einsetzten, auch mit negativen<br />
Folgen zu rechnen sei. Die umgebende<br />
Muskulatur kann durch die häufige Belastung<br />
geschädigt werden. Wie in der<br />
„normalen Bevölkerung“ treten diese<br />
schmerzhaften Veränderungen in Kiefermuskeln<br />
und -gelenken als Zahn-
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
41_FORTBILDUNG<br />
Individuell. Die Orthopantomogramm-Aufnahme junger männlicher<br />
Leistungssportler zeigen, wie unterschiedlich die orale Entzündungslast<br />
sein kann. Generell ist die Mundgesundheit von Leistungssportlern vergleichbar<br />
mit dem Bevölkerungsdurchschnitt.<br />
Abbildungen: Quintessenz Publishing/<br />
Erstpublikation: Quintessenz 2021;72(9):1052–1062.<br />
schmerzen auf. Die Sportler stellen sich<br />
dann in der Zahnarztpraxis vor. Abschließend<br />
wies Dr. Hellmann darauf<br />
hin, dass es bei einer Cranio-Mandibulären<br />
Dysfunktion (CMD) auch zu einer<br />
Schmerzwahrnehmung in weiteren<br />
Körperregionen außerhalb des Kauorgans<br />
kommen könne. Ursache hierfür<br />
seien subakute Läsionen (Verspannungen<br />
in der Muskulatur, die man bisher<br />
noch nicht als schmerzhaft wahrgenommen<br />
hat), die durch Sensibilisierungsphänomene<br />
des Schmerzleitungssystems<br />
spürbar werden, jedoch nicht in<br />
direktem Zusammenhang mit den<br />
Schmerzen im Kauorgan stehen.<br />
LEISTUNGSSPORT UND ZAHNMEDIZIN<br />
Der zweite Teil der Veranstaltung wurde<br />
von Prof. Dr. Dirk Ziebolz, Poliklinik für<br />
Zahnerhaltung und Parodontologie der<br />
Universität Leipzig, gestaltet. Unter dem<br />
Titel „Mundgesundheitszustand und belastungsabhängige<br />
Veränderungen bei<br />
Leistungssportlern“ stellte er aktuelle<br />
Forschungsergebnisse vor, verwies allerdings<br />
auch auf die dünne Studienlage.<br />
Problematisch sind zudem Studien, die<br />
im Umfeld von Spitzensportereignissen<br />
wie Olympischen Spielen entstehen.<br />
Denn meist werden dort Patienten einbezogen,<br />
die den zahnmedizinischen Dienst<br />
mit akuten Problemen aufsuchen.<br />
IM FOKUS: ENTZÜNDUNGEN<br />
Prof. Ziebolz zufolge haben deutsche<br />
Sportler generell eine mit der Bevölkerung<br />
vergleichbare Mundgesundheit, etwas<br />
häufiger entzündlich-bedingte Probleme<br />
mit (teil-) retinierten Weisheitszähnen.<br />
Zusätzlich weisen viele Athleten<br />
belastungsabhängige Veränderungen<br />
im Mund auf. Dabei ist Karies weniger<br />
problematisch. Hingegen sind Entzündungen<br />
der Gingiva in verschiedenen<br />
Schweregraden sowie initiale Parodontitis<br />
im Spitzensport weit verbreitet. Allerdings<br />
kann im Spitzensport kein direkter<br />
negativer Einfluss auf die sportliche<br />
Leistungsfähigkeit festgestellt werden.<br />
Ein Großteil der Sportler leidet unter<br />
Beschwerden bzw. Symptomen des<br />
CMD-Spektrums, also Auffälligkeiten<br />
des Kiefergelenks, der Kaumuskulatur<br />
etc. Hier können indikationsbezogene<br />
Aufbissbehelfe (Schienen) einen echten<br />
therapeutischen Nutzen bringen.<br />
EINFLUSS AUF ENTZÜNDUNGEN<br />
Die Mundgesundheit wird nach Prof.<br />
Ziebolz durch drei zentrale Faktoren beeinflusst:<br />
Ernährung, Verhalten und Belastung.<br />
Viele Entzündungen können auf<br />
das Mundpflege-Verhalten der Sporttreibenden<br />
und eine mangelhafte Inanspruchnahme<br />
professioneller präventivzahnmedizinischer<br />
Angebote wie der<br />
Professionellen Zahnreinigung zurückgeführt<br />
werden. Allerdings verwenden<br />
rund 45 Prozent der Athleten regelmäßig<br />
fluoridhaltige Mundspüllösungen, um<br />
ihre Zahngesundheit positiv zu beeinflussen.<br />
Rund 80 Prozent sind mit ihrer<br />
Mundgesundheit zufrieden, was wiederum<br />
das gering ausgeprägte (zahnmedizinische)<br />
Präventionsverhalten gut erklärt.<br />
Denn die meisten Sportler sind der Meinung,<br />
dass ihre sportliche Leistung nicht<br />
von der Mundgesundheit abhängt.<br />
Obwohl sich chronische Entzündungen<br />
im Körper negativ auf Verletzungsanfälligkeit<br />
und Regeneration auswirken, reiche<br />
das Vorliegen einer Gingivitis hierfür<br />
nicht aus, betonte Prof. Ziebolz. Beeinträchtigt<br />
wird die sportliche Leistungsfähigkeit<br />
jedoch durch akute orale Entzündungen<br />
wie eine Perikoronitis oder<br />
auch eine etablierte Parodontitis, hier<br />
vor allem bei älteren oder vorerkrankten<br />
Sportlern, z.B. im Rehasport. Damit ist<br />
die Parodontitis jedoch kein typisches<br />
Problem im Spitzensport.<br />
SCHADET LEISTUNGSSPORT?<br />
Am Beispiel Marathonlauf erläuterte<br />
Prof. Ziebolz die Auswirkungen extremer<br />
Ausdauerbelastungen auf das Immunsystem.<br />
Unmittelbar nach einem Marathon<br />
und bis zu 24 Stunden danach sind unterschiedliche<br />
und zunehmende Entzündungsprozesse<br />
im Körper nachweisbar.<br />
Das Immunsystem ist dadurch einerseits<br />
stark aktiviert, gleichzeitig ist die Immunabwehr<br />
geschwächt, so dass Angriffen<br />
von außen nicht wirksam begegnet<br />
werden kann. Dieser so genannte „Open-<br />
Windows-Effekt“ führt regelmäßig auch<br />
zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. Das<br />
Stressphänomen zeigt sich im Blut und<br />
auch im Speichel (durch Nachweis von<br />
Cortisol, Testosterol und proinflammatorischen<br />
Markern). Der Nachweis in der<br />
Mundhöhle legt nahe, dass dort möglicherweise<br />
auch Entzündungen verstärkt<br />
werden. Dies könnte unter Umständen<br />
eine Erklärung für das vermehrte Auftreten<br />
gingivaler Entzündungen vornehmlich<br />
bei Ausdauersportlern sein.<br />
WECHSEL DER PERSPEKTIVE<br />
Abschließend verwies Prof. Ziebolz auf<br />
die vordringlichste Aufgabe der Zahnärzteschaft:<br />
Die Gesundheit der Menschen<br />
zu erhalten – auch wenn deren<br />
sportliche Leistung dadurch nicht gefördert<br />
werden kann. Ziel der (Sport-)<br />
Zahnmedizin kann die Vermeidung und<br />
Reduktion von Entzündungen durch<br />
professionelle zahnmedizinische Angebote<br />
sein. Hierzu zählen auch präventionsorientierte<br />
Betreuungskonzepte mit<br />
dem Ziel, Kenntnis- und Verhaltensänderungen<br />
bei Sportlern zu bewirken –<br />
und natürlich eine zeitgemäße zahnärztliche<br />
präventionsorientierte Betreuung.<br />
Kerstin Sigle<br />
INFO<br />
AUFGABENBEREICHE DER<br />
SPORTZAHNMEDIZIN<br />
• Trauma und Traumaprävention<br />
• Antierosive, rekonstruktive Konzepte<br />
• Antiinflammatorische Konzepte<br />
• Craniomandibuläre Funktion –<br />
Auswirkungen der CMD im Sport<br />
• Atmungsverbessernde Konzepte
2023<br />
ZFZ Sommer-Akademie<br />
+ DGDH-Jahrestagung<br />
Jetzt noch Platz sichern unter<br />
sommerfest-zfz-dgdh.online<br />
DAS SOMMERFEST 2023:<br />
die Sommer-Akademie des ZFZ Stuttgart<br />
gemeinsam mit der DGDH-Jahrestagung<br />
Melden Sie sich jetzt an und erleben Sie ein vielfältiges Programm für das gesamte Praxisteam.<br />
Ihre Gastgeberin PD Dr. Yvonne Wagner (Direktorin des ZFZ Stuttgart) freut sich auf Sie.<br />
+ SOMMER-AKADEMIE: „Schmerzpatienten<br />
in der Zahnarztpraxis –<br />
Die häufigsten Diagnosen und ihre<br />
Behandlungen“<br />
+ Auswahl aus vielen Workshops<br />
oder Vorprogramm für Mitarbeiter<br />
der Praxisverwaltung<br />
+ alle Vorträge inkl. Diskussionen<br />
On-Demand bis 31.08.2023 abrufbar<br />
+ spannendes Rahmenprogramm<br />
+ ausgelassenes BBQ<br />
SOMMERAKADEMIE 7.-8. JULI 2023<br />
7. Juli 2023: Präsenz 7. Juli 2023: Präsenz oder Livestream<br />
Vorprogramm Teil 1: Abrechnung /<br />
PAR Abrechnung in der GOZ<br />
Dr. Dr. A. Raff<br />
Vorprogramm Teil 2:<br />
How not to get shot: Professioneller<br />
Umgang mit Patient:innen in<br />
anspruchsvollen Situationen<br />
Dr. Martin Simmel<br />
Der etwas andere Schmerzpatient<br />
oder auf was muss ich in der<br />
Kommunikation achten<br />
Dr. Christian Bittner
Präsenzveranstaltung im Forum<br />
Ludwigsburg oder als Live-Stream<br />
und On-Demand<br />
7. Juli 2023: Präsenz oder Livestream<br />
Präsenzveranstaltung<br />
im Forum Ludwigsburg<br />
oder als Live-Stream<br />
und On-Demand<br />
Endodontische Schmerzen:<br />
Diagnostik und Therapie?<br />
Prof. Dr. David Sonntag<br />
8. Juli 2023: Livestream<br />
Schmerzpatienten aus Sicht der<br />
Chirurgie / Chirurgische Notfälle<br />
im Notdienst<br />
Prof. Dr. Marco Kesting<br />
Notfälle in der Zahnarztpraxis –<br />
von A wie Aspiration bis Z<br />
wie Zyanose<br />
Dr. med. Jens Reichel<br />
6. Juli 2023<br />
DGDH-Jahrestagung<br />
Vorträge 9 – 18 Uhr<br />
7. Juli 2023<br />
Workshops / Vorprogramm<br />
9 – 12 Uhr<br />
Vorträge 13.30 – 18 Uhr<br />
Abendprogramm mit<br />
Barbecue 18.30 – 23 Uhr<br />
8. Juli 2023<br />
Vorträge 9 – 15.45 Uhr<br />
im Livestream<br />
bis 31. August 2023<br />
On-Demand verfügbar<br />
PAKET AUSWÄHLEN,<br />
ANMELDEN, ERLEBEN<br />
DGDH<br />
ONLY<br />
(Paket 1)<br />
SOMMER-AKADEMIE<br />
CLASSIC (Paket 2)<br />
Unsere Empfehlung<br />
Schmerzpatienten aus Sicht<br />
der Parodontologie<br />
Prof. Dr. Hendrik Dommisch<br />
Notfall und Schmerzpatienten<br />
aus Sicht der Kieferorthopädie<br />
Dr. Christroph-Ludwig Henning<br />
Der kindliche Schmerzpatient<br />
oder Schmerzfälle in der<br />
Kinderzahnheilkunde<br />
Prof. Dr. Katrin Bekes<br />
SOMMERFEST<br />
XXL<br />
(Paket 3)<br />
SOMMER-AKADEMIE<br />
ONLINE<br />
(Paket 4)<br />
Platinsponsoren<br />
Schmerzpatienten<br />
aus Sicht der Prothetik<br />
Prof. Dr. Nicole Passia<br />
Goldsponsor<br />
Zahnmedizinisches<br />
FortbildungsZentrum<br />
Stuttgart<br />
Eine Einrichtung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg<br />
Körperschaft des öffentlichen Rechts
44_PROPHYLAXE<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Sechste Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS•6)<br />
DEUTSCHLAND IN DEN MUND<br />
GESCHAUT<br />
Die Mundgesundheit der Bevölkerung in Deutschland wurde zuletzt vor acht Jahren<br />
im Rahmen der fünften Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS V) untersucht. Nun<br />
steht die sechste Auflage der oralepidemiologischen Studie an. Insgesamt wird<br />
dabei etwa 4000 Personen aus allen Altersgruppen und Bevölkerungsschichten auf<br />
den Zahn gefühlt, um genaue Aussagen über die Gesundheit der Zähne und des<br />
Mundes von Menschen in Deutschland treffen zu können. Hier ein Einblick in die<br />
Felduntersuchungen in Ditzingen bei Stuttgart.<br />
Proband. Ein 12-jähriger Studienteilnehmer lässt sich bereitwillig von Zahnarzt Lucas Szabo in<br />
den Mund schauen.<br />
„Bitte zählen Sie mir auf, was Sie alles regelmäßig<br />
beim Zähneputzen und zur<br />
Zahnpflege benutzen“, mit diesem Satz<br />
beginnt für alle Probandinnen und Probanden<br />
der Untersuchungstermin im<br />
Rahmen der DMS-6-Studie. Sie trägt<br />
den Titel „Deutschland auf den Zahn gefühlt“.<br />
An 90 verschiedenen Orten in<br />
Deutschland wird bis zum Sommer<br />
2023 insgesamt etwa 4000 Menschen genauestens<br />
in den Mund geschaut, davon<br />
in neun Untersuchungszentren in Baden-Württemberg.<br />
Eines ist das Hotel<br />
Dobler Green in Gerlingen bei Stuttgart,<br />
das als Anlaufstation für die Teilneh-<br />
menden aus Ditzingen dient. Hier untersuchte<br />
das DMS-Studienteam, bestehend<br />
aus Zahnarzt Lucas Szabo und Interviewer<br />
Rony Jolak, im April 2023<br />
sechs Tage in Folge etwa 50 ausgewählte<br />
Personen. Und hier durfte das ZBW einen<br />
ganzen Nachmittag lang zuschauen.<br />
STUDIE<br />
Die DMS ist die größte Untersuchung<br />
zur Mundgesundheit, zum Mundgesundheitsverhalten<br />
und zur zahnmedizinischen<br />
Versorgungssituation in<br />
Deutschland. Langfristig gibt die DMS<br />
im Vergleich mit früheren Auflagen einen<br />
Überblick über Zunahme oder<br />
Rückgang von oralen Erkrankungen.<br />
Zudem werden Anhaltspunkte für mögliche<br />
Verbesserungen der zahnmedizinischen<br />
Vorsorge und Behandlung oder<br />
schwierige Versorgungsstrukturen ermittelt,<br />
um entsprechend gegensteuern<br />
zu können. Die Ergebnisse bieten am<br />
Ende eine Basis für die gesundheitspolitische<br />
Diskussion sowie für die Entwicklung<br />
zukünftiger Versorgungskonzepte.<br />
Folgende Altersgruppen stehen bei der<br />
DMS • 6 im Fokus: 12-Jährige, 20-Jährige,<br />
35- bis 44-Jährige, 43- bis 52-Jährige, 65-<br />
bis 74-Jährige sowie 73- bis 82-Jährige.<br />
Die Kohorten sind so angelegt, dass eine<br />
Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen<br />
aus der vorherigen DMS und zukünftigen<br />
Studien gewährleistet ist. Das Institut<br />
der Deutschen Zahnärzte (IDS) leitet<br />
die Studie. Finanziert wird sie von der<br />
Bundeszahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen<br />
Bundesvereinigung.<br />
Die Firma Cerner Enviza (zuvor Kantar)<br />
ist für die Studienorganisation in Zusammenarbeit<br />
mit Infratrend zuständig.<br />
AUFWAND<br />
Wer auf der Basis von statistischen Faktoren<br />
aus dem Melderegister des Einwohnermeldeamtes<br />
ausgewählt wurde,<br />
wird zuerst schriftlich kontaktiert und<br />
soll einen schriftlichen Fragebogen beantworten.<br />
Anschließend folgt die Einladung<br />
zu einem Termin. Am Untersuchungstag<br />
stellen sich die Probandinnen<br />
und Probanden zuerst einem Interview,<br />
müssen anschließend ihre Zähne<br />
putzen – wenn sie es erlauben, sogar mit<br />
Videoaufzeichnung – anschließend<br />
folgt die ausführliche Untersuchung<br />
durch den Studienzahnarzt. Insgesamt<br />
dauert das Prozedere zwischen 30 (bei<br />
12-Jährigen) und 45 Minuten (bei Er-
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
45_PROPHYLAXE<br />
PAR-Untersuchung. Damit die umfangreiche Erhebung des parodontalen Befundes der 20-jährigen<br />
Probandin zügig und fehlerfrei erfolgt, assistiert Rony Jolak (l.) Zahnarzt Lucas Szabo (r.) bei der Eingabe<br />
der Untersuchungswerte.<br />
Hygiene. Diese Zahnputzeinheit zeichnet<br />
auf, wie sich die Probandinnen<br />
und Probanden die Zähne putzen.<br />
Fotos: Claudia Richter<br />
wachsenen). Die Teilnahme ist freiwillig,<br />
pro Untersuchungsort werden um<br />
die 50 Personen untersucht. Um diese<br />
Anzahl zu erreichen, müssen im Vorfeld<br />
bis zu 150 Personen angeschrieben werden.<br />
Wer nicht zum Untersuchungszentrum<br />
kommen kann, wird zuhause oder<br />
in der Betreuungseinrichtung befundet.<br />
Berufstätige bekommen zudem die<br />
Möglichkeit, sich abends oder an einem<br />
Samstag untersuchen zu lassen. Als<br />
Aufwandsentschädigung erhalten die<br />
Teilnehmenden mindestens 20 Euro.<br />
ABLAUF<br />
Zurück zum Hotel Dobler Green in<br />
Gerlingen: Dem Team Lucas Szabo und<br />
Rony Jolak steht für die Studie ein Tagungsraum<br />
zur Verfügung, den sie sich<br />
nach den erforderlichen Abläufen und<br />
Hygienerichtlinien selbst eingerichtet<br />
haben. Es gibt einen kleinen Empfangsbereich,<br />
eine Zahnputzstation sowie<br />
eine Untersuchungseinheit. Inzwischen<br />
hat sich die erste Probandin, eine<br />
12-Jährige, mit ihrer Mutter eingefunden.<br />
Befragung und Untersuchung von<br />
Minderjährigen erfolgen stets in Absprache<br />
mit den Erziehungsberechtigten.<br />
Nachdem beide die Fragen beantwortet<br />
haben, geht es ans Zähneputzen,<br />
und zwar so, wie es zuhause gemacht<br />
wird, mit den persönlichen Zahnputzutensilien.<br />
Anschließend darf das Mädchen<br />
auf der Untersuchungsliege Platz<br />
nehmen und eine Schutzbrille aufsetzen,<br />
damit die Lichtquelle nicht blendet.<br />
Um den Zustand der Zähne adäquat<br />
beurteilen zu können, benötigt<br />
der Zahnarzt Lucas Szabo eine perfekte<br />
Ausleuchtung. Er erläutert während der<br />
Untersuchung alle Arbeitsschritte und<br />
geht beruhigend auf die junge Probandin<br />
ein. Zuerst erfolgt der Zahnbefund,<br />
anschließend wird der Kariesstatus erhoben.<br />
Bis zum Alter von 20 Jahren<br />
wird außerdem nach einer Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation<br />
geschaut.<br />
Die Plaque-Untersuchung kommt zum<br />
Schluss. Dazu werden die Zähne eingefärbt.<br />
Nun zeigt sich, wie gut das vorherige<br />
Zähneputzen durchgeführt wurde.<br />
Lucas Szabo trägt alle Daten gewissenhaft<br />
in seinen Laptop ein. Die Dokumentation<br />
der Untersuchung erfolgt<br />
anonymisiert, d. h. die Probandin erscheint<br />
im System lediglich als Identifikationsnummer,<br />
die keinerlei Rückschlüsse<br />
auf die Person ermöglicht. Die<br />
Untersuchung ist eine reine Aufnahme<br />
des Ist-Zustands. Es wird nicht behandelt,<br />
nur geschaut. Auf Nachfrage gibt<br />
Lucas Szabo Auskunft, ob alles mit den<br />
Zähnen in Ordnung ist. Wäre etwas<br />
nicht okay, würde er einen Besuch beim<br />
Hauszahnarzt empfehlen.<br />
UNTERSUCHUNGSPARAMETER<br />
Bei Erwachsenen dauert die Untersuchung<br />
etwas länger, weil neben Zahnbefund,<br />
Karies und Plaque noch weitere<br />
Kriterien wichtig sind. Ab dem Alter von<br />
20 Jahren wird zusätzlich ein parodontaler<br />
Befund erhoben sowie die Abnutzung<br />
von Zahnhartsubstanzen ermittelt. Ab<br />
35 Jahren wird außerdem nach Wurzelkaries<br />
geschaut und der Zahnersatz dokumentiert.<br />
Ab 65 Jahren kommt die<br />
Untersuchung der Mundschleimhaut<br />
hinzu sowie die Messung der Belastbarkeit<br />
des älteren Menschen bei der zahnärztlichen<br />
Behandlung, seiner Mundhygienefähigkeit<br />
und Eigenverantwortlichkeit.<br />
Am umfangreichsten ist die Parodontaluntersuchung<br />
mit Bestimmung<br />
von Gingivahöhe, Sondierungstiefen<br />
und Attachmentlevel. Bei den Altersgruppen<br />
20, 35 bis 44 und 65 bis 74 Jahre<br />
findet dazu ein Full-Mouth-Recording<br />
an allen Zähnen statt.<br />
TEAMARBEIT<br />
Zahnarzt Lucas Szabo und Interviewer<br />
Rony Jolak sind als Team gut aufeinander<br />
abgestimmt. Sie reisen mit einem<br />
großen Transporter von einem Untersuchungszentrum<br />
zum nächsten und sind<br />
meist drei Wochen am Stück unterwegs.<br />
Dann folgt eine Woche Pause. Lucas Szabo<br />
hat sich für die Mitarbeit an der<br />
DMS • 6 beworben, weil er nach seiner<br />
Assistenzzeit die Chance nutzen wollte,<br />
um etwas ganz Neues zu machen, bevor<br />
er sich als Zahnarzt niederlässt – vermutlich<br />
in Baden-Württemberg. „Außerdem<br />
finde ich es sinnvoll und spannend, sich<br />
im öffentlichen Gesundheitswesen einzubringen<br />
und an einer großen Studie<br />
mitzuarbeiten“, erläuterte er seine weiteren<br />
Beweggründe, an der Studie mitzuarbeiten.<br />
AKZEPTANZ<br />
Unter den Teilnehmenden in Gerlingen<br />
gab es einige „Wiederholungstäter“, d. h.<br />
sie nahmen nicht zum ersten Mal an der<br />
DMS-Felduntersuchung teil. Die 20-jährige<br />
Probandin war als 12-Jährige schon<br />
dabei. Der 74-Jährige kam bereits zum<br />
dritten Mal und bedauerte es sehr, dass<br />
er bei der nächsten Studie vermutlich zu<br />
alt sein wird, um mitmachen zu dürfen.<br />
Dies zeigt, dass die Teilnahme an der<br />
Studie nicht als Belastung wahrgenommen<br />
wird, sondern als wichtiger persönlicher<br />
Beitrag zu einer großen gesellschaftsrelevanten<br />
Studie. Die Veröffentlichung<br />
der Ergebnisse der DMS • 6 wird<br />
in zwei Publikationswellen in den Jahren<br />
2025 und 2026 erfolgen. Das ZBW wird<br />
darüber berichten.<br />
Claudia Richter
46_PROPHYLAXE<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Einblicke in die Arbeitsfelder der Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit<br />
VON HÜRDEN UND<br />
HERAUSFORDERUNGEN<br />
Das Interview mit Carolin Möller-Scheib, Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft<br />
für Zahngesundheit (LAGZ) e. V. gewährt einen Einblick in die Herausforderungen, denen<br />
sich die regionalen Arbeitsgemeinschaften nach der Pandemie stellen müssen. Zudem<br />
wird die Bedeutung der Patenzahnärzt*innen beleuchtet, die mit ihrer engagierten Arbeit<br />
in den Kitas im Land einen wertvollen Beitrag zur Zahn- und Mundgesundheit der Kinder<br />
leisten. Im Fokus stehen außerdem aktuelle Projekte und neue Ideen.<br />
Foto: G. Billischek<br />
Ausgezeichnet. Carolin Möller-Scheib (r.) präsentierte das mit dem Wrigley-Prophylaxe-Preis ausgezeichnete<br />
Projekt „Mäusezähnchen“, das speziell für die Gruppe der unter Dreijährigen konzipiert wurde.<br />
In Baden-Württemberg haben wir<br />
derzeit 37 regionale Arbeitsgemeinschaften<br />
mit über 170 Prophylaxe-<br />
Fachkräften. Aktuell verzeichnen<br />
wir allerdings vermehrt Altersabgänge<br />
und haben Probleme, diese<br />
Stellen mit qualifiziertem Fachpersonal<br />
neu zu besetzen. Gegenwärtig<br />
drückt uns deshalb auch der Schuh<br />
hinsichtlich der Risikogruppen und<br />
bei der Versorgung der unter Dreijährigen.<br />
In diesem Zusammenhang<br />
setzen wir deshalb auch viel Hoffnung<br />
auf ein mit dem Wrigley-Prophylaxe-Preis<br />
ausgezeichneten Projekt,<br />
das von der AG Rhein-Neckar-<br />
Kreis konzipiert wurde. Es ist speziell<br />
für die Gruppe der unter Dreijährigen<br />
erdacht worden und heißt<br />
„Mäusezähnchen“. Als Erfolg empfinde<br />
ich auch die seit Corona gewachsene<br />
Zusammenarbeit zwischen<br />
der Geschäftsstelle und den<br />
regionalen Arbeitsgemeinschaften.<br />
Zurzeit treibt das Land vor allem der<br />
Engpass im Bereich der Patenzahnärzt*innen<br />
um. Welche Auswirkungen<br />
hat diese Versorgungslücke?<br />
ZBW: Corona hat die Arbeit der regionalen<br />
Arbeitsgemeinschaften der LAGZ<br />
massiv beeinträchtigt. Frau Möller-<br />
Scheib, wie ist die Resonanz aus den<br />
Arbeitsgemeinschaften? Können diese<br />
die Pandemie mittlerweile der Vergangenheit<br />
zuschreiben oder sind noch<br />
Ausläufer davon in der täglichen Arbeit<br />
zu spüren?<br />
Es gibt keine Einschränkungen mehr<br />
und wir befinden uns im regulären<br />
Betrieb. In den Schulen finden die<br />
Vorsorgeuntersuchungen durch die<br />
Jugendzahnärzt*innen des Öffentlichen<br />
Gesundheitsdienstes wieder wie<br />
gewohnt statt. Und im Bereich der<br />
zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe<br />
sind unsere Fachfrauen in<br />
den Kindertageseinrichtungen und<br />
Schulen stark nachgefragt. Wir spüren,<br />
dass hier ein hoher Nachholbedarf<br />
besteht, jedoch haben wir<br />
Schwierigkeiten, diesem aus personellen<br />
Gründen, vollständig gerecht<br />
zu werden.<br />
Wenn wir in die einzelnen AGs schauen,<br />
wie sind diese aktuell aufgestellt?<br />
Welche Schuhe drücken und welche<br />
Erfolge werden gefeiert?<br />
Zunächst können natürlich mit weniger<br />
Patenzahnärzt*innen weniger<br />
Kitas mit Vorsorgeuntersuchungen<br />
betreut werden. Das ist vor allem für<br />
die Kinder ein Problem, die zu den<br />
Risikogruppen gehören. Daraus<br />
folgt dann natürlich auch ein Mangel<br />
an Präventionsangeboten in den<br />
Praxen, wie man im aktuellen KKH-<br />
Report lesen kann. Und schließlich<br />
werden bedauerlicherweise diejenigen,<br />
die ohnehin schon sozial benachteiligt<br />
sind, noch weiter vernachlässigt.<br />
Woran liegt es Ihrer Ansicht nach,<br />
dass immer weniger Patenzahn-
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ärzt*innen im Einsatz sind? Eigentlich<br />
ist dieses Ehrenamt doch eine sehr<br />
schöne Aufgabe.<br />
Meiner Ansicht nach liegt die geringere<br />
Anzahl von Patenzahnärzt*innen<br />
hauptsächlich daran, dass der<br />
Workload für die verbleibenden<br />
Zahnarztpraxen aufgrund der Praxisschließungen<br />
aus Altersgründen<br />
im Laufe der Jahre deutlich gestiegen<br />
ist. Dies führt dazu, dass weniger<br />
Zahnärzt*innen die zusätzliche Zeit<br />
und Ressourcen haben, um sich ehrenamtlich<br />
einzubringen.<br />
Obwohl das Ehrenamt als Patenzahnarzt*ärztin<br />
eine sehr schöne<br />
Aufgabe sein kann, erfordert es eine<br />
gewisse Zeitinvestition. Die verbleibenden<br />
Zahnarztpraxen sind bereits<br />
mit einem erhöhten Arbeitspensum<br />
konfrontiert, da sie die Patientenversorgung<br />
für eine größere Bevölkerung<br />
übernehmen müssen. Dies lässt<br />
weniger Raum und Zeit für zusätzliche<br />
ehrenamtliche Tätigkeiten.<br />
Gibt es ein Maßnahmenpaket, um<br />
diesen Zustand zu ändern?<br />
Ende letzten Jahres einigte sich der<br />
LAGZ-Vorstand darauf, die Ehrenamtspauschale<br />
für diese Einsätze zu<br />
erhöhen. Zudem hat die Landeszahnärztekammer<br />
einen, wie ich finde,<br />
sehr schönen Flyer für die Gewinnung<br />
von Patenzahnärzt*innen konzipiert.<br />
Darüber hinaus versuchen<br />
die Bezirkszahnärztekammern ebenfalls<br />
im persönlichem Austausch, beispielsweise<br />
bei Neugründungen oder<br />
bei Infoveranstaltungen, für das Thema<br />
zu sensibilisieren. Auch die regionalen<br />
Arbeitsgemeinschaften sind<br />
hier aktiv und gehen persönlich auf<br />
die Kreisvorsitzenden zu.<br />
Mit welchen weiteren Herausforderungen<br />
sieht sich die LAGZ aktuell<br />
konfrontiert?<br />
Neben dem Mangel an Patenzahnärzt*innen<br />
ist es, wie bereits erwähnt,<br />
vor allem das Rekrutieren von neuem<br />
Personal und die Versorgung der unter<br />
Dreijährigen. Aber auch die steigende<br />
Zahl von Migrant*innen und<br />
Kriegsgeflüchteten stellt eine Herausforderung<br />
für uns dar. Sie erfordern<br />
nicht nur eine verbesserte interkulturelle<br />
Kompetenz und Sensibilität,<br />
sondern auch die Überwindung<br />
sprachlicher Barrieren und unterschiedlicher<br />
kultureller Ansichten<br />
zur Zahnmedizin.<br />
Wie sehen Sie die nahe Zukunft in Bezug<br />
auf die Prophylaxe? Gibt es Projekte<br />
oder Initiativen, auf die wir uns<br />
freuen dürfen?<br />
Die Pandemie hat uns gezeigt, dass<br />
die Gesundheit einen hohen Wert<br />
darstellt. Nicht nur die Zuwanderung<br />
wird uns in den nächsten Jahren<br />
vor große Herausforderungen<br />
stellen, sondern auch die stark reduzierte<br />
Gruppenprophylaxe der letzten<br />
Jahre.<br />
Durch Corona haben sich auch unsere<br />
Arbeitsgemeinschaften schneller<br />
den neuen Medien geöffnet, als dies<br />
vermutlich sonst der Fall gewesen<br />
wäre. Dabei sind einige zukunftsweisende<br />
Strategien entstanden, so beispielsweise<br />
auch unsere Online-Seminare.<br />
Besonders freuen dürfen wir uns<br />
auch auf unsere neuen Filme, die im<br />
Rahmen der nächsten Fortbildungsveranstaltung<br />
im Kloster Schöntal<br />
vorgestellt werden.<br />
Gemeinsam freuen dürfen wir uns<br />
außerdem auf den Tag der Zahngesundheit,<br />
der 2023 in Rottenburg<br />
stattfindet. Gemeinsam mit Ihrem<br />
IZZ-Team plant die regionale Arbeitsgemeinschaft<br />
Tübingen derzeit ja die<br />
Details dafür.<br />
Welche Rolle spielen digitale Technologien<br />
in der Arbeit der LAGZ und wie<br />
werden sie genutzt, um die Zahngesundheit<br />
zu verbessern?<br />
Hier stehen wir aktuell noch am Anfang.<br />
Wir haben in den vergangenen<br />
zwei Jahren Hörspiele entwickelt,<br />
jetzt arbeiten wir an drei Filmen für<br />
Erzieher*innen, Eltern und Kinder.<br />
Auf diese Weise versuchen wir, alle<br />
mit ins Boot zu nehmen und vor al-<br />
47_PROPHYLAXE<br />
» Meiner Ansicht nach liegt die geringere<br />
Anzahl von Patenzahnärzten*innen<br />
hauptsächlich daran, dass der<br />
Workload für die verbleibenden<br />
Zahnarztpraxen aufgrund der<br />
Praxisschließungen aus Altersgründen im<br />
Laufe der Jahre deutlich gestiegen ist.«<br />
Carolin Möller-Scheib<br />
lem Kinder mit allen Sinnen anzusprechen<br />
und für die Zahngesundheit<br />
zu begeistern. Auch zukünftig<br />
werden hier mit Sicherheit weitere<br />
Projekte entstehen, denn die regionalen<br />
Arbeitsgemeinschaften sind äußerst<br />
kreativ und engagiert.<br />
Das Gespräch führte Cornelia Schwarz<br />
INFO<br />
Die Landesarbeitsgemeinschaft<br />
für Zahngesundheit Baden-<br />
Württemberg e. V. besteht seit<br />
1954 und ist seit 1986 als Verein<br />
eingetragen. Sie ist eine gemeinsame<br />
Einrichtung von elf Organisationen,<br />
die sich die Erhaltung und<br />
Förderung der Zahngesundheit<br />
und damit die Verhütung von<br />
Zahn- und Munderkrankungen bei<br />
Kindern und Jugendlichen zum<br />
Ziel gesetzt haben.<br />
Sie wird vom Präsidenten der LZK<br />
BW, Dr. Torsten Tomppert, als<br />
Vorsitzendem geleitet.<br />
Mitglieder sind das Ministerium für<br />
Soziales, Gesundheit und Integration<br />
Baden-Württemberg, der<br />
Landkreistag Baden-Württemberg<br />
und der Städtetag Baden-Württemberg,<br />
die Kassenzahnärztliche<br />
Vereinigung Baden-Württemberg<br />
und die Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg, die AOK Baden-Württemberg,<br />
die IKK classic,<br />
der BKK Landesverband Süd, die<br />
Landwirtschaftliche Krankenkasse,<br />
die Knappschaft Regionaldirektion<br />
München sowie die vdek-Landesvertretung<br />
Baden-Württemberg.
48_KULTUR<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Spontaner Städtetrip<br />
MEDIENSTADT<br />
KARLSRUHE<br />
Foto: ARTIS-Uli_Deck,Maxin10sity<br />
Karlsruhe ist eine Stadt, die durch ihre einzigartige<br />
Verbindung von Tradition und Innovation beeindruckt.<br />
Mit einer lebendigen Kunst- und Kulturszene, einer<br />
reichen Geschichte und einer dynamischen Wirtschaft<br />
ist Karlsruhe ein Ort, der eine Vielzahl von Interessen<br />
und Vorlieben anspricht. Begleiten Sie uns auf einem<br />
kulturellen Streifzug durch die Stadt und ent decken Sie<br />
gemeinsam mit uns ihre verschiedenen Gesichter.<br />
Foto: Alamy Stock Photo/Timo Christ<br />
Sehenswürdigkeiten der Fächerstadt. Das Wahrzeichen und Zentrum der<br />
Fächerstadt Karlsruhe ist das barocke Schloss, das den badischen Großherzögen<br />
seit dem 18. Jahrhundert als Residenz diente. Heute beherbergt es das Badische<br />
Landesmuseum, in dem man viel über das hiesige Leben von der Frühgeschichte bis<br />
zur Neuzeit erfährt. Vom Schlossturm aus genießt man außerdem einen tollen<br />
Ausblick über die Stadt. Direkt hinter dem Schloss liegt der Schlossgarten, eine<br />
große Gartenanlage, die 1967 anlässlich der Bundesgartenschau im Stil eines<br />
englischen Landschaftsparks angelegt wurde. Hier findet vom 25. bis 27. August<br />
2023 auch die 21. Karlsruher Bierbörse statt – das größte Bierfest Baden-Württembergs.<br />
An rund 60 Ständen können Bierfans mehr als 500 traditionelle und<br />
exotische Biersorten verkosten. Nur wenige Gehminuten vom Schloss liegt der<br />
Botanische Garten (Foto oben), ein wunderschöner Ort, der zum Verweilen einlädt.<br />
Besucher können historische Bauten wie die Orangerie, Gewächshäuser, den<br />
Wintergarten und die Kunsthalle besichtigen. Ein entspannter Spaziergang lohnt<br />
sich hier auf jeden Fall. Der Marktplatz mit der Pyramide (Foto rechts) ist der wohl<br />
bekannteste Platz in Karlsruhe. Die Pyramide ist das Grabmal des Stadtgründers<br />
Karl Wilhelm von Baden-Durlach (1679–1738) und ein Wahrzeichen der Stadt.
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
49_KULTUR<br />
Kulinarische Genüsse. Beginnen Sie den Tag mit einem köstlichen Frühstück im<br />
Café Palaver am Lidellplatz oder im Café Juli am Gutenbergplatz. Für die<br />
Mittagspause empfiehlt sich das Restaurant Eigenart, das mit seiner bodenständig<br />
leckeren Bistroküche überzeugt. Wenn Sie frische Burger aus hochwertigen<br />
regionalen Zutaten und köstliche Pommes genießen möchten, ist DeliBurgers die<br />
richtige Wahl. Pinsa Si ist ein kleines, unscheinbares Restaurant mit unglaublich<br />
guter Pinsa. In Karlsruhe gibt es auch eine wachsende Auswahl an veganen<br />
Restaurants. Das Verde in der Kaiserstraße beeindruckt nicht nur mit seinem<br />
schönen Ambiente, sondern auch mit außergewöhnlichen Speisen. Die Süße<br />
Marie in der Karlsruher Südstadt bietet gutbürgerliche Küche und leckere Kuchen.<br />
Wenn Sie kreative Burger, Wraps, Salate, Currys und Eintöpfe suchen, ist das My<br />
Heart Beats Vegan in der Kriegsstraße eine gute Option. Für kulinarische<br />
Höhepunkte sollten Sie das Restaurant Sein mit der kreativen Küche von Thorsten<br />
Bender in der Scheffelstraße besuchen. Das Restaurant Erasmus in der Nürnberger<br />
Straße legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, ist Bio-zertifiziert und bietet eine<br />
italienisch-mediterrane Küche. Auf dem Gelände des Alten Schlachthofs in der<br />
Karlsruher Oststadt finden Sie einige Trendrestaurants. Carls Wirtshaus bietet<br />
Craft-Beer und Pub-Gerichte, im Aurum erwarten Sie feine Burger und Steaks, in<br />
der „Fettschmelze“ werden köstliche Pizzen serviert und in der Alten Hackerei<br />
können Sie bei regelmäßigen Live-Musikveranstaltungen entspannen.<br />
Foto: Alamy Stock Photo/Michael Liebrecht<br />
Foto: KTG Karlsruhe Tourismus GmbH/Mende<br />
Stadt der Medienkunst. Karlsruhe ist die erste deutsche Unesco-Stadt<br />
der Medienkunst. Eine herausragende Einrichtung in diesem Bereich<br />
ist das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM, Foto links). In einem<br />
denkmalgeschützten Industriebau, der einst eine Munitionsfabrik war,<br />
befinden sich das Museum für Neue Kunst, das Museum für Medienkunst,<br />
die Staatliche Hochschule für Gestaltung und mehrere<br />
Forschungsinstitute. Besonders interessant ist der Fokus auf zeitgenössische<br />
Kunst in Verbindung mit Medientechnologie und digitalem<br />
Wandel. Ein absolutes Highlight ist die interaktive Computerspiele-<br />
Ausstellung, die man sich keinesfalls entgehen lassen sollte. Bei den<br />
Karlsruher Schlosslichtspielen (großes Foto), die vom 16. August bis<br />
17. September 2023 stattfinden, wird die barocke Fassade des<br />
Karlsruher Schlosses in ein digitales Kunstwerk verwandelt. Darüber<br />
hinaus wird die ganze Innenstadt zur dezentralen Bühne und Ausstellungsfläche<br />
für Medienkunst, Illuminationen und leuchtende Aktionen.<br />
Foto: KTG Karlsruhe Tourismus GmbH/Fabian von Poser<br />
Reise ins Mittelalter. Bis 1938 war Durlach noch eine eigenständige<br />
Stadt und zuvor die erste Residenz des Markgrafen. Heute<br />
ist es der größte Stadtteil von Karlsruhe. Mittelalterliches Flair<br />
prägt die Durlacher Altstadt mit ihrem malerischen Marktplatz<br />
(Foto rechts), den Überresten der historischen Stadtmauer, dem<br />
Schlossplatz und den engen Gassen. Sehenswert sind die<br />
Stadtkirche, die Karlsburg und das Rathaus. Der Turmberg mit<br />
einer Höhe von 256 Metern ist ein beliebtes Ausflugsziel und<br />
kann über verschiedene Wege erreicht werden. Die Turmbergbahn,<br />
die seit 1888 den Berg hinauffährt, ist die älteste noch in<br />
Betrieb befindliche Standseilbahn Deutschlands. Eine Alternative<br />
sind die sogenannten „Hexenstäffele“, ein Treppenweg mit 528<br />
Stufen, der direkt von Durlach auf den Turmberg führt. Oben<br />
angekommen, bietet sich ein wunderschöner Blick auf die<br />
Rheinebene und das Stadtgebiet von Durlach und Karlsruhe.<br />
Gabriele Billischek<br />
Foto: Adobe Stock/marcelheinzmann
50_NAMEN UND NACHRICHTEN<br />
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
Pandemie<br />
UNGLEICHHEITEN VERSTÄRKT<br />
Die Europäische Kommission hat eine<br />
Metastudie veröffentlicht, die sich mit<br />
den Auswirkungen der Coronapandemie<br />
auf Geschlechtergleichheit in<br />
Forschung und Entwicklung beschäftigt<br />
hat, berichtet die Zeit. Die Studie<br />
komme zu dem Schluss, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen<br />
am meisten<br />
von den Folgen der Coronappandemie<br />
betroffen und benachteiligt<br />
waren. Dies gilt insbesondere für junge<br />
Wissenschaftlerinnen mit Kindern.<br />
Die Pandemie habe außerdem weitere<br />
Ungleichheiten wie etwa durch Behinderungen,<br />
ethnische Herkunft, sozio-ökonomische<br />
Hintergründe oder<br />
sexuelle Orientierung verstärkt. Im<br />
Vergleich zu ihren älteren Kollegen<br />
haben jedoch auch männliche Nachwuchswissenschaftler<br />
Nachteile erlebt.<br />
Die schon vor Beginn der Pandemie<br />
prekäre Lage junger Forschender<br />
habe sich allgemein verschlechtert,<br />
aufgrund der mangelnden internationalen<br />
Mobilität und des eingeschränkten<br />
Zugangs zu Arbeitsstätten<br />
hätten sie teilweise nicht die Erfahrungen<br />
machen und Kontakte knüpfen<br />
können, die ihre Karrieren befördert<br />
hätten.<br />
IZZ<br />
ZWEI DRITTEL FÜR WARNHINWEISE AUF ALKOHOLFLASCHEN<br />
Die Mehrheit der Bundesbürger fände einer Umfrage zufolge Warnhinweise auf<br />
alkoholischen Getränken gut. 67 Prozent der Befragten gaben in einer Yougov-Umfrage<br />
an, Hinweise über Gesundheitsrisiken durch Alkoholkonsum zu befürworten. Unter<br />
Frauen ist die Befürwortung für solche Warnungen mit 72 Prozent demnach höher als<br />
unter Männern mit 63 Prozent. Den Ergebnissen zufolge würden 22 Prozent der<br />
Befragten Warnhinweise auf Etiketten ablehnen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation<br />
WHO<br />
sterben jedes Jahr<br />
weltweit rund drei<br />
Millionen Menschen an<br />
den Folgen des Alkoholkonsums.<br />
Alkohol sei<br />
darüber hinaus ein<br />
Auslöser für über 200<br />
Krankheiten – darunter<br />
verschiedene Krebsformen,<br />
Depressionen oder<br />
Gehirnschädigungen. dpa<br />
500 ml<br />
Trinkwasser geht durch eine einfache Konversation mit<br />
ChatGPT von etwa 20 bis 50 Fragen und<br />
Antworten verloren, um die Server zu kühlen.<br />
Täglich nutzen Millionen von Nutzern ChatGPT – die Rechner laufen heiß.<br />
Quelle: dpa-Infografik<br />
Foto: auf Pixabay/Alexander Lesnitsky
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
51_NAMEN UND NACHRICHTEN<br />
Foto: Adobe Stock/fotoliaxrender<br />
Zungenschrittmacher<br />
ERFOLGREICHE IMPLANTATION<br />
In der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde,<br />
Kopf- und Halschirurgie Magdeburg, wurde unter<br />
der kommissarischen Leitung von Prof. Dr. med. Martin<br />
Durisin die zehnte Implantation eines sogenannten<br />
Zungenschrittmachers zur Therapie des nächtlichen<br />
obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms (OSAS) durchgeführt.<br />
Bei dieser Erkrankung erschlaffen die Zungenmuskulatur<br />
und das umliegende Gewebe während des<br />
Schlafes. Die Zunge rutscht nach hinten und behindert<br />
den Atemstrom zur Luftröhre. Der Atem stockt – teilweise<br />
sehr oft in der Nacht. Der Zungenschrittmacher<br />
stimuliert sanft den Zungenmuskelnerv, sodass ein<br />
nächtliches Zurückfallen der Zunge verhindert wird und<br />
die Luftwege wieder frei sind. Für ausgewählte Patient*innen<br />
ist dies eine wirkungsvolle Alternative zu klassischen<br />
Therapien. Die Kosten der gesamten Therapie werden<br />
von den gesetzlichen Krankenkassen getragen.<br />
Der operative Eingriff erfolgt über zwei kleine Schnitte,<br />
einmal im Bereich des Schlüsselbeins sowie im Bereich<br />
des Mundbodens. Der stationäre Aufenthalt nach dem<br />
Eingriff beträgt ein bis zwei Tage.<br />
Ein weiterer positiver Effekt<br />
des Zungenschrittmachers<br />
ist, dass es in vielen Fällen<br />
das Schnarchen signifikant<br />
reduziert.<br />
Das Neurostimulationssystem<br />
des Zungenschrittmachers<br />
misst<br />
kontinuierlich den<br />
Atemrhythmus im Schlaf<br />
und passt sich der<br />
natürlichen Atemfrequenz<br />
an. Die Betroffenen können<br />
das System selbstständig bedienen<br />
und schalten es per Fernbedienung vor dem Schlafengehen<br />
ein und morgens nach dem Erwachen wieder aus.<br />
Auch nächtliche Pausen für den Toilettengang oder zum<br />
Trinken sind problemlos möglich.<br />
Universität Magdeburg/IZZ<br />
Abbildung: Inspire Medical Systems Europe<br />
Künstliche Intelligenz<br />
„FAKE SCIENCE“<br />
Die Integrität des<br />
akademischen Publikationswesens<br />
wird<br />
zunehmend<br />
durch gefälschte<br />
wissenschaftliche<br />
Publikationen<br />
untergraben,<br />
die von kommerziellen<br />
„Redaktionsdiensten“<br />
(sogenannten „Paper Mills“) massenhaft produziert werden. Diese<br />
nutzen KI-gestützte, automatisierte Produktionstechniken in<br />
großem Maßstab und verkaufen gefälschte Publikationen an<br />
Studenten, Wissenschaftler und Ärzte, die unter dem Druck stehen,<br />
ihre Karriere voranzutreiben. Eine Studie des Direktors des Instituts<br />
für Medizinische Psychologie an der Otto-von-Guericke-Universität<br />
Magdeburg, Prof. Dr. Bernhard Sabel, zusammen mit seinen<br />
Mitarbeiterinnen Emely Knaack und Mirela Bilc, in Kooperation mit<br />
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung<br />
in Berlin, belegt einen deutlichen Anstieg gefälschter<br />
Publikationen in der Biomedizin. 28 Prozent der Publikationen<br />
stehen unter Verdacht der Fälschung, was mehr als 300.000<br />
Publikationen pro Jahr entspricht. Der Magdeburger Neuropsychologe<br />
hat ein Programm zur Erkennung von Fake-Science entwickelt,<br />
das ähnlich wie Anti-Spam-Mailprogramme arbeitet. In einer<br />
Teststichprobe erkannte das Tool 90 Prozent der gefälschten oder<br />
zurückgezogenen Arbeiten als Fake Science. Allerdings wurden 37<br />
Prozent der echten Arbeiten im Test fälschlicherweise als gefälscht<br />
eingestuft. Die Untersuchung von Sabel wurde auf dem Preprint-<br />
Server medRxiv veröffentlicht.<br />
Länder mit hohem Fälschungsanteil sind der Studie zufolge<br />
Russland, Türkei, Ägypten, China und Indien mit Werten zwischen<br />
39 bis 48 Prozent aller veröffentlichten Arbeiten, wobei absolut<br />
betrachtet China mit 55 Prozent das Ranking anführt. IZZ<br />
Foto: Adobe Stock/BillionPhotos.com
Landesverbandes<br />
Baden-Württemberg<br />
www.fvdz-bw.de<br />
LANDESVERSAMMLUNG<br />
DES LANDESVERBANDES<br />
BADEN-WÜRTTEMBERG<br />
TERMIN:<br />
ORT:<br />
SAMSTAG, DEN 15. JULI 2023, 9:30 UHR<br />
DENTAURUM GMBH & CO. KG, TURNSTR. 31, 75228 ISPRINGEN<br />
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,<br />
gemäß § 14 Abs. 2, 4 und 8 der Satzung laden wir hiermit alle Mitglieder des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte<br />
e.V. in Baden-Württemberg ganz herzlich ein zur Landesversammlung des Landesverbandes Baden-Württemberg.<br />
TAGESORDNUNG:<br />
1. Begrüßung<br />
2. Gastvortrag von Prof. Dr. Thomas Ratajczak:<br />
EU-MDR/vom Segen zum Fluch?<br />
3. Eröffnung der Sitzung gem. § 1 der<br />
Geschäftsordnung<br />
4. Regularien<br />
5. Fragestunde<br />
(Die Fragen dürfen sich nicht auf Punkte der<br />
Tagesordnung beziehen und müssen gemäß § 5<br />
der Geschäftsordnung mindestens 5 Tage vor der<br />
Sitzung der Landesversammlung in der Landesgeschäftsstelle<br />
schriftlich eingegangen sein.)<br />
6. Bericht des Landesvorsitzenden<br />
7. Diskussion<br />
8. Geschäftsbericht<br />
9. Bericht der Kassenprüfer<br />
10. Jahresrechnung 2022<br />
11. Entlastung des Landesvorstandes<br />
12. Wahlen<br />
12.1 Wahl der/des Landesvorsitzenden<br />
12.2 Wahl der beiden stellvertretenden<br />
Landesvorsitzenden<br />
12.3 Wahl der Versammlungsleiterin/<br />
des Versammlungsleiters<br />
12.4 Wahl von zwei stellvertretenden<br />
VersammlungsleiterInnen<br />
12.5 Wahl von einem/einer weiteren<br />
Delegierten zur Hauptversammlung<br />
und dessen/deren StellvertreterIn<br />
12.6 Wahl der zwei KassenprüferInnen und<br />
deren StellvertreterInnen<br />
13. Haushaltsplan 2023<br />
14. Anträge<br />
Anträge, die die Tagesordnung verändern, sind<br />
zwei Wochen vor der Landesversammlung schriftlich<br />
beim Landesvorstand über die Landesgeschäftsstelle<br />
einzureichen.<br />
15. Verschiedenes<br />
Die Landesversammlung ist für Mitglieder des<br />
Freien Verbandes öffentlich. Rede- und stimmberechtigt<br />
sind nur die Delegierten.<br />
! Anmeldung über die Landesgeschäftsstelle<br />
(info@fvdz-bw.de) unbedingt erforderlich.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V.<br />
Landesverband Baden-Württemberg<br />
Dr. Joachim Härer<br />
Landesvorsitzender<br />
Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V., Landesverband Baden-Württemberg<br />
Albstadtweg 9 • 70567 Stuttgart • Tel.: (0711) 7 80 30 90 • Fax: (0711) 7 80 30 92 • E-Mail: info@fvdz-bw.de
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
53_PRAXIS<br />
Foto: AdobeStock/Sondem<br />
Keine Angst vor HIV, HBV und HCV<br />
SENSIBEL VORGEHEN<br />
In der zahnmedizinischen Versorgung<br />
von Menschen mit HBV, HCV, HIV oder<br />
Aids kommt es immer wieder zu Fragen,<br />
Unsicherheiten und Ängsten. Bei Einhaltung<br />
der üblichen Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen<br />
besteht keine<br />
Infektionsgefahr, weder für Sie noch für<br />
Ihr Praxisteam oder für Patientinnen<br />
und Patienten. Und selbst bei Arbeitsunfällen,<br />
zum Beispiel Stich- oder<br />
Schnittverletzungen mit kontaminierten<br />
Instrumenten, oder bei Benetzung<br />
offener Wunden und Schleimhäute mit<br />
virushaltigen Flüssigkeiten kann das<br />
Ansteckungsrisiko durch Sofortmaßnahmen<br />
und gegebenenfalls eine Post-<br />
Expositions-Prophylaxe minimiert werden.<br />
ÜBERTRAGUNG<br />
Ein Infektionsrisiko besteht nur, wenn<br />
Viren in ausreichender Menge (z. B.<br />
durch Verletzungen mit kontaminierten<br />
Kanülen, Skalpellen oder Scalern)<br />
in den Körper gelangen oder durch<br />
Blutspritzer mit offenen Wunden oder<br />
Schleimhäuten in Berührung kommen.<br />
Sehr gering ist das Risiko einer HIV-<br />
Übertragung bei der zahnärztlichen Behandlung,<br />
wenn die Viruslast durch<br />
eine antiretrovirale Therapie dauerhaft<br />
unter der Nachweisgrenze liegt. Die Patientinnen<br />
und Patienten sind in den<br />
meisten Fällen gut über ihre Viruslast<br />
informiert, da dieser Wert regelmäßig<br />
kontrolliert wird. Keinerlei HIV-Ansteckungsgefahr<br />
besteht bei Alltagskontakten<br />
wie Händeschütteln, Berühren<br />
von Oberflächen, gemeinsame Benutzung<br />
von Toiletten oder Zusammenarbeit<br />
mit HIV-positiven Menschen.<br />
MASSNAHMEN?<br />
HIV, HBV und HCV erfordern keine besonderen<br />
Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen.<br />
Die Standard-Hygieneund<br />
Arbeitsschutzmaßnahmen einer<br />
Zahnarztpraxis stellen ein wirksames<br />
Bündel an Schutzmaßnahmen dar: Abfallentsorgung,<br />
persönliche Schutzausrüstung<br />
(auf konsequentes Tragen ist zu<br />
achten!), Flächenwischdesinfektion<br />
(nach jeder Patientenbehandlung), Hygienemanagement<br />
an den Behandlungseinheiten<br />
(Absauganlage, Wasser führende<br />
Systeme) und KRINKO-/BfArM-konforme<br />
Medizinprodukte-Aufbereitung.<br />
PATIENTEN<br />
Viele Menschen wissen nicht von ihren<br />
Infektionserkrankungen oder teilen sie<br />
aufgrund negativer Erfahrungen den behandelnden<br />
Zahnärztinnen und -ärzten<br />
bzw. dem Praxisteam nicht mit. Eine Mitteilungspflicht<br />
gibt es nicht. Alle Patientinnen<br />
und Patienten sind daher so zu behandeln,<br />
als ob sie infektiös wären. Nicht<br />
nötig sind Maßnahmen wie die folgenden,<br />
die zudem als diskriminierend empfunden<br />
werden könnten: Behandlung<br />
nur am Ende des Behandlungstags, gesonderte<br />
Aufbereitung der in der Behandlung<br />
eingesetzten Medizinprodukte.<br />
SENSIBEL<br />
Nicht nur für Menschen mit Infektionserkrankungen<br />
ist es wichtig, die Kontrolle<br />
darüber zu behalten, wer von ihrer Diagnose<br />
erfährt. Die Möglichkeit, den<br />
Anam nesebogen ohne neugierige Blicke<br />
auszufüllen, schützt die Privatsphäre und<br />
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass alle<br />
Erkrankungen angegeben werden. Nur<br />
wer sich sicher vor Ablehnung und Ausgrenzung<br />
fühlt, wird die Fragen zur<br />
Anam nese ehrlich beantworten. Der weitere<br />
sensible Umgang mit diesen Informationen<br />
liegt in Ihrer Verantwortung.<br />
Ein „Warnhinweis“ auf den Behandlungsunterlagen<br />
ist unnötig, weil für alle Patientinnen<br />
und Patienten die gleichen Hygiene-<br />
und (Arbeits-)Schutzmaßnahmen<br />
gelten. Bitte achten Sie auch stets auf die<br />
Wahrung des Datenschutzes.<br />
INFORMATIONEN<br />
Auf der Webseite der LZK BW (https://<br />
lzk-bw.de/downloads) haben Sie unter<br />
der Rubrik „Rund um die Praxisführung“<br />
im Bereich „Keine Angst vor HIV,<br />
HBV und HCV!“ einfach und schnell<br />
Zugang zu weiterführenden Informationen<br />
(z. B. Erklärvideo).<br />
Ihre LZK-Geschäftsstelle
Leiter Fortbildungsforum (m/w/d) in<br />
Voll- oder Teilzeit<br />
SERVICE • LEISTUNG • PARTNERSCHAFT
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
55_PRAXIS<br />
Der GOZ-Ausschuss der LZK BW informiert<br />
NEUE PAR-RICHTLINIE<br />
VERALTETE GOZ –<br />
EIN WIDERSPRUCH?<br />
Ein Punktwert, der seit nunmehr 35 Jahren bei 11 Pfennigen – heute umgerechnet<br />
5,62421 Cent – liegt und eine Honorierung, die der von 1965 entspricht: Besser<br />
hätte der Begriff „veraltete Gebührenordnung“ nicht definiert werden können. Aber<br />
die Teilhabe am medizinischen Fortschritt und eine Behandlung nach dem aktuellen<br />
Stand der Wissenschaft ist bei einer Vergütung ohne jeglichen wirtschaftlichen Bezug<br />
nicht möglich. Trotz ihrer Obsoleszenz bietet die GOZ einen Vorteil in Form<br />
der Freiheiten, abweichende Vereinbarungen nach § 2 abzuschließen und Analogabrechnungen<br />
entsprechend § 6 durchzuführen.<br />
S3-LEITLINIE<br />
Eine Behandlung von Parodontitis<br />
nach der neuen PAR-Richtlinie, die<br />
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen<br />
folgt und damit neue Qualitätsstandards<br />
setzt, muss selbstverständlich<br />
auch Privatversicherten zur<br />
Verfügung stehen. Die derzeitige GOZ<br />
bildet allerdings nicht alle Leistungen<br />
ab, die nach heutigem wissenschaftlichen<br />
Stand in der Parodontitistherapie<br />
erforderlich sind. Für derartige<br />
Leistungen hat der Gesetzgeber eine<br />
analoge Berechnung nach § 6 GOZ<br />
vorgesehen.<br />
PAR-ANALOGABRECHNUNG<br />
Im Zuge der Veröffentlichung zahlreicher<br />
Positionspapiere, welche eine<br />
Analogabrechnung unterstützen, unter<br />
anderem der BZÄK, der DG Paro<br />
und der LZK BW, haben PKV-Verband<br />
und Beihilfe Ende 2022 im Beratungsforum<br />
für Gebührenordnungsfragen<br />
endlich einer analogen Abrechnung<br />
einiger Leistungen der PAR-Behandlungsstrecke<br />
nach S3-Leitlinie zugestimmt.<br />
Dazu zählen die parodontale<br />
Diagnostik einschließlich Staging<br />
und Grading (8000a anstatt 4000),<br />
das Parodontologische Aufklärungsund<br />
Therapiegespräch (ATG) (2110a),<br />
die Antiinfektiöse Therapie (AIT)<br />
(einwurzelig 3010a, mehrwurzelig<br />
4138a), die BEV (Befundevaluation)<br />
(5070a, bis zu dreimal innerhalb eines<br />
Jahres) und die lokalisierte subgingivale<br />
Instrumentierung in der Unterstützende<br />
Parodontitistherapie (UPT)<br />
(einwurzelig 0090a, mehrwurzelig<br />
2197a). Bei den vorgeschlagenen Gebührenpositionen<br />
handelt es sich wie<br />
immer nur um Empfehlungen. Anzumerken<br />
ist dabei, dass selbstverständlich<br />
auch Analogleistungen im Faktor<br />
gesteigert werden können beziehungsweise,<br />
je nach Schwierigkeit und Zeitaufwand<br />
der einzelnen Leistung sowie<br />
der Umstände bei der Ausführung, gesteigert<br />
werden müssen.<br />
SICHERE KOSTENERSTATTUNG<br />
PKV und Beihilfe haben eine sichere<br />
Erstattung bei Liquidation entsprechend<br />
der Beschlüsse zugesagt. Dies<br />
war Voraussetzung für eine Einigung<br />
in der Sitzung des Beratungsforums.<br />
Falls die aktuellen Beschlüsse allerdings<br />
doch noch nicht zu allen Versicherern<br />
durchgedrungen sein sollten<br />
und es dadurch zu Erstattungskürzungen<br />
kommt, wird darum gebeten,<br />
sich an die zuständige GOZ-Stelle der<br />
jeweiligen BZK zu wenden. Restriktionen<br />
durch Mitgliedsunternehmen<br />
des PKV-Verbands, entgegen der Beschlüsse<br />
des eigenen Verbands, sind<br />
unter keinen Umständen zu akzeptieren.<br />
MUNDHYGIENEUNTERWEISUNGEN<br />
Der sprechenden Zahnmedizin wird<br />
in der neuen Richtlinie zur Parodontitisbehandlung<br />
eine entscheidende<br />
Bedeutung für den Therapieerfolg zugeschrieben.<br />
Teil davon ist die Mundhygieneunterweisung,<br />
welche die Instruktion<br />
und Motivation zur Verbesserung<br />
der Mundhygiene sowie die<br />
Kontrolle gingivaler Entzündungen<br />
im Verlauf aller Therapiestufen inklusive<br />
der UPT beinhaltet. Dabei wird<br />
der Fokus auch auf den Ausschluss<br />
beziehungsweise die Abmilderung<br />
von Risikofaktoren gelegt. Ziel ist es,<br />
durch eine gesamtgesundheitliche Intervention<br />
die Lebensgewohnheiten<br />
des Patienten hin zur parodontalen<br />
Gesundheit zu beeinflussen. Diese<br />
neu definierte Mundhygieneunterweisung<br />
im Rahmen der PAR-Therapie<br />
geht somit weit über die mit den<br />
originären Gebührennummern 1000<br />
und 1010 beschriebenen Leistungen<br />
Mundhygienestatus und -kontrolle<br />
hinaus. Diese beiden Leistungen bilden<br />
weder den aktuellen wissenschaftlichen<br />
Kenntnisstand ab, noch<br />
sind sie ansatzweise angemessen honoriert.<br />
Der Zusatz in der Leistungsbeschreibung<br />
„Dauer mind. 25 bzw.<br />
10 Min.“ macht es unumgänglich,<br />
hier eine abweichende Vereinbarung<br />
nach § 2 GOZ zu treffen, um eine betriebswirtschaftliche<br />
Kostendeckung<br />
zu erreichen.<br />
Eine Behandlung nach dem aktuellen<br />
Stand der Wissenschaft entsprechend<br />
der neuen PAR-Richtlinie kann nur<br />
bei Anwendung der §§ 2 und 6 der bestehenden<br />
GOZ zeitgemäß honoriert<br />
werden. Diese Paragrafen sollten von<br />
den Kolleginnen und Kollegen also<br />
definitiv genutzt werden.<br />
Autorenteam des GOZ-Ausschusses<br />
der LZK BW
Akademie<br />
Fortbildungsangebot<br />
Juli 2023 - September 2023<br />
Zahnärzte/-innen<br />
Kurs Nr. 9376 | 18 Punkte<br />
Einzelkurs | Frontzahnästhetik in der Praxis: Komposit statt<br />
Keramik?<br />
Referent: Prof. Dr. Gabriel Krastl<br />
Datum: 14.-15.07.2023 | 10:00 - 17:00 Uhr<br />
Kursgebühr: 800 €<br />
Kurs Nr. 9399 | 8 Punkte<br />
Hybrid | Einzelkurs | Trauma und Zahnverlust im wachsenden<br />
Kiefer – was tun?<br />
Referent: Prof. Dr. Andreas Filippi<br />
Datum: 14.07.2023<br />
Kursgebühr: 500 €<br />
Kurs Nr. 9400 | 6 Punkte<br />
Hybrid | Einzelkurs | Postendodontische Versorgung<br />
Referent: Prof. Dr. Thomas Wrbas<br />
Datum: 15.07.2023<br />
Kursgebühr: 350 €<br />
Kurs Nr. 9473 | 10 Punkte<br />
Einzelkurs | Bewegungsanalyse in der restaurativen Therapie<br />
Referent: PD Dr. Daniel Hellmann<br />
Datum: 09.09.2023<br />
Kursgebühr: 580 €<br />
Team | ZFA<br />
9 Punkte<br />
Online-Seminare | Hygienemodule der Landeszahnärztekammer<br />
BW<br />
08.07.2023 9489 Modul H2<br />
22.07.2023 9490 Modul H3<br />
07.10.2023 9494 Modul H1<br />
21.10.2023 9495 Modul H2<br />
18.11.2023 9496 Modul H3<br />
Referenten: Dr. Carsten Ullrich | Dieter Gaukel, M.A.<br />
Kursgebühr: jeweils 190 €<br />
Bei gleichzeitiger Buchung aller drei Module erhalten Sie einen<br />
Rabatt von 20 € pro Modul.<br />
Kurs Nr. 9469<br />
Einzelkurs | Röntgenkurs für Zahnmedizinische Fachangestellte<br />
Referent: Dr. Burkhard Maager<br />
Datum: 06.-08.07.2023<br />
Kursgebühr: 620 €<br />
Kurs Nr. 5784<br />
Aufstiegsfortbildung | Kombinationskurs Standard<br />
Referentinnen: Birgit Hackel, ZMF, u. a.<br />
Datum: 26.06.-21.07.2023<br />
Kursgebühr: 2100 € (inkl. 300 € Prüfungsgebühr)<br />
Kurs Nr. 5813<br />
Aufstiegsfortbildung | Herstellung von Provisorien und<br />
Situationsabformungen<br />
Referentinnen: Badegül Top, ZMF u. a.<br />
Datum: 06.-09.09.2023<br />
Kursgebühr: 620 € (inkl. 100 € Prüfungsgebühr)<br />
Kurs Nr. 9462<br />
Einzelkurs | Die professionelle Implantatreinigung – Implantatpatienten/-innen<br />
in der Prophylaxe<br />
Referentinnen: Dr. Sonja Rahmi-Wöstefeld, M.Sc.,<br />
Nadja Pfister, ZMF<br />
Datum: 16.09.2023<br />
Kursgebühr: 200 €<br />
Kurs Nr. 5813<br />
Aufstiegsfortbildung | Zahnmedizinische/-r Prophylaxeassistent/-in<br />
(ZMP) 2023/2024<br />
Referentinnen: Prof. Dr. Bernadette Pretzl, u. a.<br />
Datum: 06.09.2023-20.01.2024<br />
Kursgebühr: 4850 € (inkl. 550 € Prüfungsgebühr)<br />
Unser komplettes Programm mit vielen<br />
weiteren Kursangeboten finden Sie auch auf:<br />
www.za-karlsruhe.de<br />
Wir freuen uns auf Sie!<br />
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe | Lorenzstraße 7 | 76135 Karlsruhe | Fon +49 721 9181-200 | Fax + 49 721 9181-222 | fortbildung@za-karlsruhe.de<br />
Eine Fortbildungseinrichtung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg | Körperschaft des öffentlichen Rechts
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
57_PERSONALIA<br />
Trauer um Dr. Ulrich Seeger<br />
EIN MENSCHENFREUND<br />
IST VON UNS GEGANGEN<br />
Dr. Ulrich Seeger lebt nicht mehr. Er starb am 2. Mai 2023 in seinem 86. Lebensjahr.<br />
Wir alle haben Uli – wie wir ihn nannten – sehr viel zu verdanken, auch<br />
die jungen Kolleginnen und Kollegen, die ihn nicht mehr persönlich oder nur vom<br />
Hörensagen kennen.<br />
Kollege Ulrich Seeger prägte in der<br />
Kammer eine ganze Ära. Von 1985 bis<br />
2000 war er während vier Legislaturperioden<br />
Vorsitzender der BZK Stuttgart.<br />
Viele werden sich an die unzähligen<br />
Kreisversammlungen erinnern, die er in<br />
dieser langen Zeit absolvierte. Schon<br />
lange davor kam er zur Standespolitik<br />
und übte seit Anfang der siebziger Jahre<br />
zahlreiche Ehrenämter aus. Er war unter<br />
anderem stellvertretender Vorsitzender<br />
der Vertreterversammlung der früheren<br />
KZV Stuttgart, Mitglied der Vertreterversammlungen<br />
von LZK Baden-<br />
Württemberg und BZK Stuttgart, Delegierter<br />
zur BZÄK-Vertreterversammlung<br />
und Vorstandsmitglied der BZÄK,<br />
Mitglied des ZBW-Redaktionsausschusses,<br />
Verwaltungsratsvorsitzender<br />
des ZFZ. Außerdem war er Mitglied im<br />
Fachausschuss zur Überprüfung<br />
der Gleichwertigkeit<br />
zahnärztlicher<br />
Approbationen, dessen<br />
Votum eine Richtschnur<br />
für das Regierungspräsidium<br />
Stuttgart<br />
bei der Erteilung<br />
der deutschen Approbation<br />
war. Ein besonderes<br />
Anliegen war Dr.<br />
Seeger auch die allgemeine<br />
und individuelle<br />
Patientenberatung, die<br />
ganz wesentlich von<br />
ihm getragen und gefördert<br />
wurden. Ebenso<br />
war ihm die Qualifikation<br />
der Gutachter – die<br />
ja auch oftmals in der<br />
Gutachterkommission<br />
für Fragen zahnärztlicher<br />
Haftung schwierige<br />
Entscheidungen zu<br />
treffen hatten – ein Herzensanliegen.<br />
Zu Beginn<br />
dieses Jahrtausends<br />
erhielt er die Ehrennadel<br />
der Deutschen Zahnärzteschaft,<br />
die Verdienstmedaille der LZK<br />
Baden-Württemberg, und wurde zum<br />
Ehrenvorsitzenden der BZK Stuttgart<br />
ernannt.<br />
Aber nicht nur die Zahnärzteschaft würdigte<br />
das herausragende Engagement<br />
von Dr. Ulrich Seeger. Auch die „große“<br />
Politik war auf ihn aufmerksam geworden.<br />
Er erhielt aus den Händen des damaligen<br />
Oberbürgermeisters der Stadt<br />
Esslingen am Neckar, Dr. Jürgen Zieger,<br />
das Bundesverdienstkreuz am Bande –<br />
eine Würdigung, die ihm sehr naheging.<br />
Ich saß bei der Feierstunde im Esslinger<br />
Rathaus an seiner Seite und kann mir<br />
dieses Urteil also erlauben.<br />
So weit seine Ehrenämter und Auszeichnungen.<br />
Das ist aber nur der „offizielle“<br />
Teil seiner Person und seiner<br />
Foto: Dr. Martin Seeger<br />
Persönlichkeit. Uli zeichnete viel mehr<br />
aus: Es war ihm wichtig, die Menschen<br />
„mitzunehmen“, ihnen nicht unrecht<br />
zu tun und kein vorschnelles Urteil<br />
über sie zu fällen, sondern sie in ihrem<br />
Anliegen ernst zu nehmen. So ließ er<br />
uns in „seinem“ Vorstand so lange diskutieren,<br />
bis wir einen Konsens erzielt<br />
hatten, mit dem wir alle leben und den<br />
wir in der Kollegenschaft guten Gewissens<br />
vertreten konnten. Mehr als einmal<br />
fiel mir dabei die Rolle des „heißblütigen<br />
Jungspunds“ zu, der ich in der<br />
Tat ja war. Aber Uli ließ auch mich reden<br />
– so oft und zu welchem Thema<br />
ich wollte. Und ich hatte sehr häufig<br />
das Gefühl, dass ihm nicht unrecht<br />
war, was ich sagte.<br />
Etwas ganz „Seeger-Spezifisches“ habe<br />
ich als langjähriges BZK-Vorstandsmitglied<br />
und als unmittelbarer Nachfolger<br />
von ihm gelernt: Immer, wenn es in der<br />
Kollegenschaft oder in den Gremien gewisse<br />
„Probleme“ gab (die letztendlich<br />
eigentlich eher zwischenmenschlicher<br />
Natur waren), lud Ulrich Seeger zu einem<br />
Essen ein. Und nach zwei oder drei<br />
Stunden des gemeinsamen Essens mit<br />
„Smalltalk“ abseits des eigentlichen<br />
Problems war genau dieses eigentlich<br />
keines mehr. Es war schlichtweg von<br />
den Streitparteien vergessen worden<br />
und alle verabschiedeten sich angesichts<br />
des harmonischen Abends mit<br />
einem ehrlichen Händedruck. Ulrich<br />
Seeger hatte also ganze Arbeit geleistet –<br />
durch sein Wirken, das auf den ersten<br />
Blick und für einen Außenstehenden<br />
nicht nach Arbeit ausgesehen hatte.<br />
Aber wir alle wussten und spürten: Es<br />
war harte und wertvolle und sehr wichtige<br />
Arbeit, die Uli leistete!<br />
Uli hat uns nun für immer verlassen.<br />
Wirklich verlassen?<br />
Er ist uns nur vorausgegangen ...<br />
Dr. Rainer-Udo Steck
S-1.indd 1 02.05.2023 15:10:30<br />
62_LESERFORUM<br />
ZBW_7/2022<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW<br />
ZAHNÄRZTEBLATT BADEN-WÜRTTEMBERG<br />
5-6/2023<br />
Titelthema<br />
GOZ-Jahr 2023:<br />
Kampagne gestartet<br />
Fortbildung<br />
Obliterierte Wurzelkanäle:<br />
Guided Endodontics<br />
BLICK AUF DIE GOZ<br />
Diese Ausgabe enthält das neue<br />
ZBW-AUSGABE 5–6/2023,<br />
S. 12, GOZ-JAHR 2023:<br />
KAMPAGNE GESTARTET<br />
Ja hallo, endlich tut sich mal das, was ich<br />
seit mehr als 20 Jahren fordere. Die Tour<br />
de Ländle startet und das ungläubige<br />
Staunen des Auditoriums ist nicht erstaunlich.<br />
Schon Anfang der 90er an<br />
meinen Kreisstammtischen herrschte<br />
Verwunderung und zum Teil Unverständnis.<br />
Endlich wird auch von der Kollegenschaft<br />
die betriebswirtschaftliche<br />
Bewertung gefordert und im Mittel 6,00<br />
Euro/Min. angesetzt. Hui, noch vor zwei<br />
Jahren erhielt ich auf meine Berechnung<br />
(nur schlappe 5,00 Euro/Min.), einen<br />
Anschrieb des GOZ-Referenten Mannheim<br />
und mir wurde vorgehalten, dass<br />
ich wohl die Grundrechenarten nicht beherrsche.<br />
Wie sich der Wind doch drehen<br />
kann. Die Argumente, den § 2 GOZ<br />
nicht zu nutzen, sind allerdings seit Jahren<br />
die gleichen (siehe Sprechblase ZBW<br />
5-6/2023, S. 15). „Viele Patienten können<br />
sich das nicht leisten und ich möchte sie<br />
nicht verlieren...“. Ich habe meinem<br />
Tankwart gleich erklärt, dass ich mir die<br />
hohen Spritpreise nicht mehr leisten<br />
kann und er mir den Sprit billiger geben<br />
könnte, weil er mich ja nicht verlieren<br />
will! Oder „über 3,5 habe ich eine Bremse“,<br />
beim Leistung zu Dumpingpreisen<br />
Erbringen und der Politik zu bestätigen,<br />
ich habe es ja eigentlich nicht nötig, habe<br />
ich aber keine Bremse. Oder „ich fand es<br />
gut, dass nochmals rekapituliert wurde,<br />
wie viel? wir? einnehmen müssen, um<br />
kostendeckend…“ Selbst bin ich nämlich<br />
noch nicht auf die Idee gekommen das<br />
für mich und meine Praxis auszurechnen,<br />
schade. Die höchste Form cerebraler<br />
Diarrhoe bringt aber der Direktor des<br />
Verbandes der PKV, Dr. Reuther. Er erkennt<br />
sogar, dass z. B. chirurgische Leistungen<br />
unterbewertet sind, aber es darf<br />
nicht verkannt werden, dass anschließend,<br />
eventuell folgende, höher bewertete<br />
Leistung aus der Implantologie, erbracht<br />
werden. Ich habe heute meiner<br />
Werkstatt gleich erklärt, dass ich die Inspektion<br />
jetzt geringer bezahle, da ja in<br />
der Regel teurere Reparaturleistungen<br />
folgen. Auch für die Tramfahrkarte habe<br />
ich nur die Hälfte gezahlt, da ich ja normalerweise<br />
auch wieder zurückfahre.<br />
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die<br />
Conclusio lässt mich mit Sicherheit erahnen,<br />
dass wir in 10 Jahren die tupfengleiche<br />
Diskussion führen. Na dann<br />
gute Nacht und weiterhin viel Vergnügen.<br />
ZA Michael May, Freiburg<br />
AMTLICHE MITTEILUNGEN<br />
WEITERBILDUNGSSTÄTTE<br />
Nach §35 des Heilberufe-Kammergesetzes<br />
i. V. m. §§ 9 und 11 der Weiterbildungsordnung<br />
wurden folgende Kammermitglieder<br />
zur Weiterbildung ermächtigt:<br />
Oralchirurgie<br />
Dr. Philipp Endler, Gartenstraße 21,<br />
74564 Crailsheim<br />
Die anerkennungsfähige Weiterbildungszeit<br />
beträgt gem. § 24 Abs. 1<br />
und Abs. 4 der Weiterbildungsordnung<br />
2 Jahre.<br />
Anzeige<br />
Hausaufgaben machen. Ein Wunsch,<br />
den wir Millionen Kindern erfüllen.<br />
Aruna, ein Junge aus Sierra Leone, musste früher arbeiten. Heute geht er in die Schule.<br />
Wie er seinen Traum ver wirk lichen konnte, erfahren Sie unter: brot-fuer-die-welt.de/hausaufgaben
ZBW_7/2023<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
63_ZU GUTER LETZT<br />
Karikatur: picture alliance/dieKLEINERT | Karin Mihm<br />
IMPRESSUM<br />
IMPRESSUM<br />
_Herausgeber:<br />
Dr. Torsten Tomppert, Präsident der<br />
Landeszahnärztekammer Baden-<br />
Württemberg (LZK BW),<br />
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart,<br />
und Vorsitzender des Vorstands der<br />
Kassenzahnärztlichen Vereinigung<br />
Baden-Württemberg (KZV BW),<br />
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart,<br />
für das Informationszentrum<br />
Zahn- und Mundgesundheit Baden-<br />
Württemberg<br />
Eine Einrichtung der KZV BW und<br />
LZK BW<br />
_Redaktion:<br />
Cornelia Schwarz (cos) (ChR, verantw.)<br />
E-Mail: cornelia.schwarz@izzbw.de<br />
Telefon: 0711/222 966-10<br />
Gabriele Billischek (bi),<br />
E-Mail: gabriele.billischek@izzbw.de<br />
Telefon: 0711/222 966-14<br />
Andrea Mader (am),<br />
Landeszahnärztekammer Baden-<br />
Württemberg<br />
Telefon: 0711/228 45-29<br />
E-Mail: mader@lzk-bw.de<br />
Dr. Holger Simon-Denoix (hsd),<br />
Kassenzahnärztliche Vereinigung<br />
Baden-Württemberg<br />
Telefon: 0711/78 77-229<br />
E-Mail: holger.simon-denoix@kzvbw.de<br />
_Anschrift der Redaktion:<br />
Informationszentrum Zahn- und<br />
Mundgesundheit Baden-Württemberg<br />
Heßbrühlstr. 7, 70565 Stuttgart<br />
Telefon: 0711/222 966-14<br />
Telefax: 0711/222 966-21<br />
E-Mail: info@zahnaerzteblatt.de<br />
_Redaktionsassistenz:<br />
Gabriele Billischek<br />
_Layout:<br />
Armin Fischer, Gabriele Billischek<br />
_Autoren*innen dieser Ausgabe:<br />
Gabriele Billischek, Dr. Uwe Blunck,<br />
Prof. Dr. Roland Frankenberger,<br />
Alexander Messmer, Guido Reiter,<br />
Claudia Richter, Cornelia Schwarz,<br />
Kerstin Sigle, Dr. Holger Simon-Denoix,<br />
Dr. Rainer-Udo Steck, Dr. Manuel<br />
Wäschle.<br />
_Titelseite:<br />
Foto: istock/Devrimb<br />
_Rubrik Titelthema:<br />
Abbildungen: Adobe Stock: MINIWIDE;<br />
Armin Fischer<br />
_Verantwortlich für Amtliche<br />
Mitteilungen der Kassenzahnärztlichen<br />
Vereinigung Baden-<br />
Württemberg (KZV BW):<br />
Dr. Torsten Tomppert, Vorsitzender des<br />
Vorstands der Kassenzahnärztlichen<br />
Vereinigung Baden-Württemberg<br />
(KZV BW), KdöR<br />
_Verantwortlich für Amtliche<br />
Mitteilungen der Landeszahnärztekammer<br />
Baden-Württemberg<br />
(LZK BW):<br />
Dr. Torsten Tomppert, Präsident<br />
der Landeszahnärztekammer Baden-<br />
Württemberg (LZK BW), KdöR<br />
_Hinweise:<br />
Die Redaktion behält sich vor,<br />
Leserbriefe gekürzt zu veröffentlichen.<br />
Ein Anspruch auf Veröffentlichung<br />
besteht nicht. Bei Einsendungen an<br />
die Redaktion wird der vollen oder<br />
auszugsweisen Veröffentlichung<br />
zugestimmt.Unaufgefordert<br />
eingegangene Fortbildungsmanuskripte<br />
können nicht veröffentlicht<br />
werden, da die Redaktion nur mit<br />
wissenschaftlichen Autoren vereinbarte<br />
Fort bildungsbeiträge veröffentlicht.<br />
Alle Rechte an dem Druckerzeugnis,<br />
insbesondere Titel-, Namens- und<br />
Nutzungsrechte etc., stehen<br />
ausschließlich den Herausgebern zu.<br />
Mit Annahme des Manuskripts zur<br />
Publikation erwerben die Herausgeber<br />
das aus schließliche Nutzungsrecht,<br />
das die Erstellung von Fort- und<br />
Sonderdrucken, auch für Auftraggeber<br />
aus der Industrie, das Einstellen des<br />
ZBW ins Internet, die Übersetzung in<br />
andere Sprachen, die Erteilung von<br />
Abdruckgenehmigungen für Teile,<br />
Abbildungen oder die gesamte Arbeit<br />
an andere Verlage sowie Nachdrucke<br />
in Medien der Herausgeber, die<br />
fotomechanische sowie elektronische<br />
Vervielfältigung und die Wiederverwendung<br />
von Abbildungen umfasst.<br />
Dabei ist die Quelle anzugeben.<br />
Änderungen und Hinzufügungen<br />
zu Originalpublikationen bedürfen<br />
der Zustimmung des Autors und der<br />
Herausgeber.<br />
Bei Änderungen der Lieferanschrift<br />
(Umzug, Privatadresse) wenden Sie sich<br />
bitte an die Mitgliederverwaltung Ihrer<br />
zuständigen Bezirkszahnärztekammer<br />
_Bezugspreis:<br />
Jahresabonnement inkl. MwSt. € 60,-<br />
Einzelverkaufspreis inkl. MwSt. € 7,50<br />
Bestellungen werden von der W.<br />
Kohlhammer Druckerei GmbH +<br />
Co. KG entgegengenommen. Die<br />
Kündigungsfrist für Abonnements<br />
beträgt 6 Wochen zum Ende des<br />
Bezugszeitraumes. Für die Mitglieder<br />
der Landeszahnärztekammer Baden-<br />
Württemberg ist der Bezugspreis mit<br />
dem Mitgliedsbeitrag abgegolten.<br />
_Druck:<br />
W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG<br />
Augsburger Straße 722, 70329 Stuttgart<br />
Stefan Leicht, Tel. 0711 3272-232<br />
E-Mail: stefan.leicht@kohlhammerdruck.de<br />
www.kohlhammerdruck.de<br />
ISSN: 0340-3017